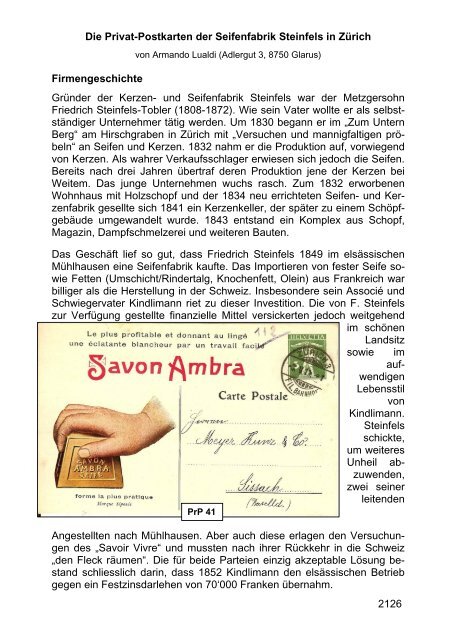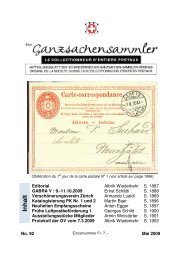101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein
101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein
101 - Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Privat-Postkarten der Seifenfabrik Steinfels in Zürich<br />
Firmengeschichte<br />
von Armando Lualdi (Adlergut 3, 8750 Glarus)<br />
Gründer der Kerzen- und Seifenfabrik Steinfels war der Metzgersohn<br />
Friedrich Steinfels-Tobler (1808-1872). Wie sein Vater wollte er als selbstständiger<br />
Unternehmer tätig werden. Um 1830 begann er im „Zum Untern<br />
Berg“ am Hirschgraben in Zürich mit „Versuchen und mannigfaltigen pröbeln“<br />
an Seifen und Kerzen. 1832 nahm er die Produktion auf, vorwiegend<br />
von Kerzen. Als wahrer Verkaufsschlager erwiesen sich jedoch die Seifen.<br />
Bereits nach drei Jahren übertraf deren Produktion jene der Kerzen bei<br />
Weitem. Das junge Unternehmen wuchs rasch. Zum 1832 erworbenen<br />
Wohnhaus mit Holzschopf und der 1834 neu errichteten Seifen- und Kerzenfabrik<br />
gesellte sich 1841 ein Kerzenkeller, der später zu einem Schöpfgebäude<br />
umgewandelt wurde. 1843 entstand ein Komplex aus Schopf,<br />
Magazin, Dampfschmelzerei und weiteren Bauten.<br />
Das Geschäft lief so gut, dass Friedrich Steinfels 1849 im elsässischen<br />
Mühlhausen eine Seifenfabrik kaufte. Das Importieren von fester Seife sowie<br />
Fetten (Umschicht/Rindertalg, Knochenfett, Olein) aus Frankreich war<br />
billiger als die Herstellung in der Schweiz. Insbesondere sein Associé und<br />
Schwiegervater Kindlimann riet zu dieser Investition. Die von F. Steinfels<br />
zur Verfügung gestellte finanzielle Mittel versickerten jedoch weitgehend<br />
im schönen<br />
Landsitz<br />
sowie im<br />
aufwendigen<br />
Lebensstil<br />
von<br />
Kindlimann.<br />
Steinfels<br />
schickte,<br />
um weiteres<br />
Unheil abzuwenden,<br />
zwei seiner<br />
leitenden<br />
PrP 41<br />
Angestellten nach Mühlhausen. Aber auch diese erlagen den Versuchungen<br />
des „Savoir Vivre“ und mussten nach ihrer Rückkehr in die Schweiz<br />
„den Fleck räumen“. Die für beide Parteien einzig akzeptable Lösung bestand<br />
schliesslich darin, dass 1852 Kindlimann den elsässischen Betrieb<br />
gegen ein Festzinsdarlehen von 70‘000 Franken übernahm.<br />
2126