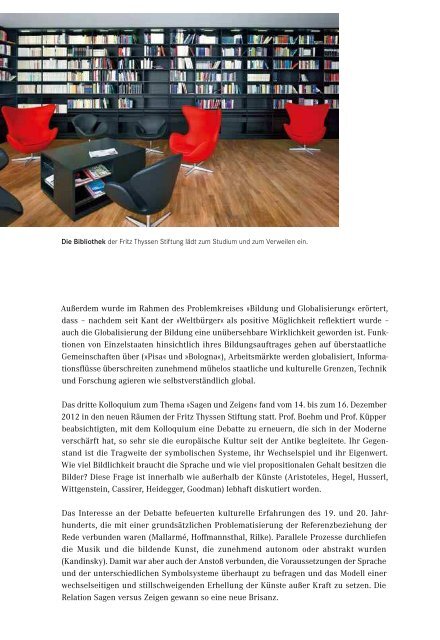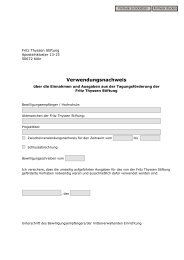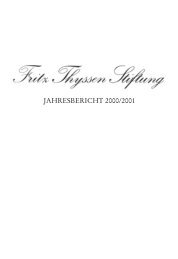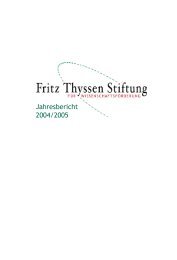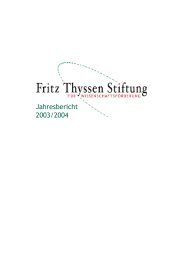Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Bibliothek der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> lädt zum Studium und zum Verweilen ein.<br />
Außerdem wurde im Rahmen des Problemkreises »Bildung und Globalisierung« erörtert,<br />
dass – nachdem seit Kant der »Weltbürger« als positive Möglichkeit reflektiert wurde –<br />
auch die Globalisierung der Bildung eine unübersehbare Wirklichkeit geworden ist. Funktionen<br />
von Einzelstaaten hinsichtlich ihres Bildungsauftrages gehen auf überstaatliche<br />
Gemeinschaften über (»Pisa« und »Bologna«), Arbeitsmärkte werden globalisiert, Informationsflüsse<br />
überschreiten zunehmend mühelos staatliche und kulturelle Grenzen, Technik<br />
und Forschung agieren wie selbstverständlich global.<br />
Das dritte Kolloquium zum Thema »Sagen und Zeigen« fand vom 14. bis zum 16. Dezember<br />
<strong>2012</strong> in den neuen Räumen der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> statt. Prof. Boehm und Prof. Küpper<br />
beabsichtigten, mit dem Kolloquium eine Debatte zu erneuern, die sich in der Moderne<br />
verschärft hat, so sehr sie die europäische Kultur seit der Antike begleitete. Ihr Gegenstand<br />
ist die Tragweite der symbolischen Systeme, ihr Wechselspiel und ihr Eigenwert.<br />
Wie viel Bildlichkeit braucht die Sprache und wie viel propositionalen Gehalt besitzen die<br />
Bilder? Diese Frage ist innerhalb wie außerhalb der Künste (Aristoteles, Hegel, Husserl,<br />
Wittgenstein, Cassirer, Heidegger, Goodman) lebhaft diskutiert worden.<br />
Das Interesse an der Debatte befeuerten kulturelle Erfahrungen des 19. und 20. Jahrhunderts,<br />
die mit einer grundsätzlichen Problematisierung der Referenzbeziehung der<br />
Rede verbunden waren (Mallarmé, Hoffmannsthal, Rilke). Parallele Prozesse durchliefen<br />
die Musik und die bildende Kunst, die zunehmend autonom oder abstrakt wurden<br />
(Kandinsky). Damit war aber auch der Anstoß verbunden, die Voraussetzungen der Sprache<br />
und der unterschiedlichen Symbolsysteme überhaupt zu befragen und das Modell einer<br />
wechselseitigen und stillschweigenden Erhellung der Künste außer Kraft zu setzen. Die<br />
Relation Sagen versus Zeigen gewann so eine neue Brisanz.<br />
Einige Diskussionsstränge, die sich seitdem entwickelt haben, wurden anlässlich des Symposions<br />
aufgegriffen. Es wurde u. a. der Frage nachgegangen, ob Sprache ein sich selbst<br />
erhaltendes System ist, das durch einen evolutionären oder transzendentalen Sprung<br />
in die Welt tritt, oder ob vielmehr die Argumente ihrer Hintergehbarkeit überwiegen<br />
(Saussure, Jakobson). Besonders in den Blick genommen wurde aus interdisziplinärer<br />
Perspektive die Beziehung zwischen Sagen und Zeigen.<br />
Menschenrechte im 20. Jahrhundert | prof. norbert frei, Historisches Institut,<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena, leitet einen interdisziplinären Arbeitskreis zum Thema<br />
»Humanitarismus und transnationale Rechtsprozesse im 20. Jahrhundert«. Die Treffen der<br />
Gruppe sowie die begleitende Forschungsarbeit werden von dr. daniel stahl koordiniert.<br />
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Menschenrechte zu einem Signalbegriff<br />
der politischen Kommunikation geworden. Diese Entwicklung war Teil der wachsenden<br />
Verrechtlichung nationaler und internationaler Politik nach dem Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs und Folge der sich aus ihm ergebenden neuen Konfliktlagen. Seitdem bedient<br />
sich eine Vielzahl von Akteuren aus unterschiedlichen Motiven der Sprache der Menschenrechte<br />
und nutzt sie zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen. Nach den beiden<br />
Supermächten und deren Verbündeten erkannten die antikolonialen Befreiungsbewegungen<br />
das Potenzial des Menschenrechtsdiskurses. Durch die wachsende Bedeutung<br />
zivilgesellschaftlichen Engagements kamen seit den 1960er- und 1970er-Jahren neue<br />
Akteure und neue Formen des Menschenrechtsaktivismus hinzu. Mittlerweile widmen<br />
sich zahlreiche staatliche, halbstaatliche und nichtstaatliche Organisationen der Stärkung<br />
der Menschenrechte.<br />
Der Arbeitskreis der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> bietet Vertretern unterschiedlicher Disziplinen<br />
ein Forum, die Entwicklung der Menschenrechte im 20. Jahrhundert historisierend zu<br />
reflektieren. Im Zentrum steht dabei der Blick auf nationale und internationale Akteure,<br />
Konzeptionen und Praktiken: Auf welche Weise und mit welchen Motiven trieben und<br />
treiben verschiedene Gruppen und Individuen die menschenrechtliche Normsetzung<br />
voran? Welche Praktiken entstehen daraus? Welche Rolle spielen Arenen wie die UNO, der<br />
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte oder der Internationale Strafgerichtshof? Mit<br />
welchen Begründungen operieren Anhänger und Gegner der Menschenrechte?<br />
Die voraussichtlich halbjährlich stattfindenden Treffen der interdisziplinär zusammengesetzten<br />
Arbeitsgruppe sollen dazu dienen, Forschungen anzustoßen und deren Ergebnisse<br />
17<br />
Die <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> – Ort der Wissenschaft