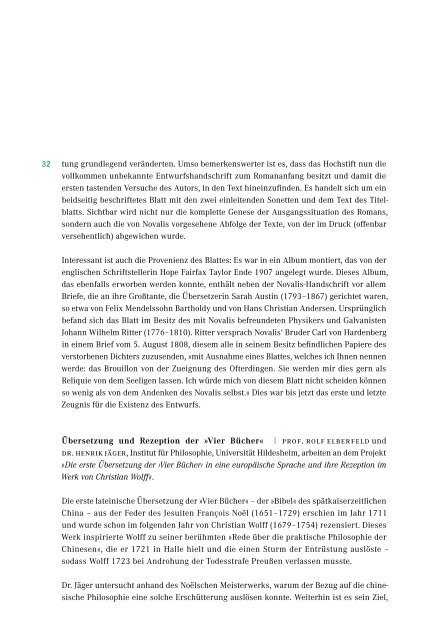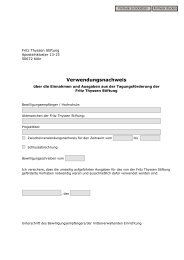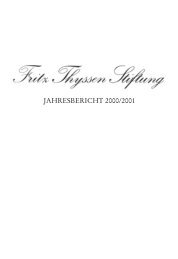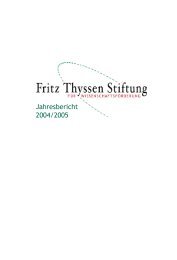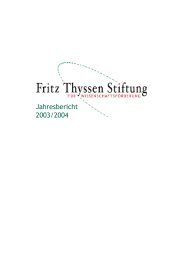Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
32<br />
tung grundlegend veränderten. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Hochstift nun die<br />
vollkommen unbekannte Entwurfshandschrift zum Romananfang besitzt und damit die<br />
ersten tastenden Versuche des Autors, in den Text hineinzufinden. Es handelt sich um ein<br />
beidseitig beschriftetes Blatt mit den zwei einleitenden Sonetten und dem Text des Titelblatts.<br />
Sichtbar wird nicht nur die komplette Genese der Ausgangssituation des Romans,<br />
sondern auch die von Novalis vorgesehene Abfolge der Texte, von der im Druck (offenbar<br />
versehentlich) abgewichen wurde.<br />
Interessant ist auch die Provenienz des Blattes: Es war in ein Album montiert, das von der<br />
englischen Schriftstellerin Hope Fairfax Taylor Ende 1907 angelegt wurde. Dieses Album,<br />
das ebenfalls erworben werden konnte, enthält neben der Novalis-Handschrift vor allem<br />
Briefe, die an ihre Großtante, die Übersetzerin Sarah Austin (1793–1867) gerichtet waren,<br />
so etwa von Felix Mendelssohn Bartholdy und von Hans Christian Andersen. Ursprünglich<br />
befand sich das Blatt im Besitz des mit Novalis befreundeten Physikers und Galvanisten<br />
Johann Wilhelm Ritter (1776–1810). Ritter versprach Novalis‘ Bruder Carl von Hardenberg<br />
in einem Brief vom 5. August 1808, diesem alle in seinem Besitz befindlichen Papiere des<br />
verstorbenen Dichters zuzusenden, »mit Ausnahme eines Blattes, welches ich Ihnen nennen<br />
werde: das Brouillon von der Zueignung des Ofterdingen. Sie werden mir dies gern als<br />
Reliquie von dem Seeligen lassen. Ich würde mich von diesem Blatt nicht scheiden können<br />
so wenig als von dem Andenken des Novalis selbst.« Dies war bis jetzt das erste und letzte<br />
Zeugnis für die Existenz des Entwurfs.<br />
Übersetzung und Rezeption der »Vier Bücher« | prof. rolf elberfeld und<br />
dr. henrik jäger, Institut für Philosophie, Universität Hildesheim, arbeiten an dem Projekt<br />
»Die erste Übersetzung der ›Vier Bücher‹ in eine europäische Sprache und ihre Rezeption im<br />
Werk von Christian Wolff«.<br />
Die erste lateinische Übersetzung der »Vier Bücher« – der »Bibel« des spätkaiserzeitlichen<br />
China – aus der Feder des Jesuiten François Noël (1651–1729) erschien im Jahr 1711<br />
und wurde schon im folgenden Jahr von Christian Wolff (1679–1754) rezensiert. Dieses<br />
Werk inspirierte Wolff zu seiner berühmten »Rede über die praktische Philosophie der<br />
Chinesen«, die er 1721 in Halle hielt und die einen Sturm der Entrüstung auslöste –<br />
sodass Wolff 1723 bei Androhung der Todesstrafe Preußen verlassen musste.<br />
Dr. Jäger untersucht anhand des Noëlschen Meisterwerks, warum der Bezug auf die chinesische<br />
Philosophie eine solche Erschütterung auslösen konnte. Weiterhin ist es sein Ziel,<br />
Projekt »Die erste Übersetzung der ›Vier Bücher‹ in eine europäische Sprache und ihre Rezeption im<br />
Werk von Christian Wolff«: Originalausgabe der Übersetzung von François Noël von 1711.<br />
auf der Grundlage der »Rede« und weiterer Schriften Wolffs Kriterien zu erarbeiten, die<br />
eine Bewertung und Einordnung seiner Konfuzianismusrezeption und ihrer Wirkung auf<br />
sein Werk ermöglichen.<br />
Die bisherige Projektarbeit hat ergeben, dass die »Rede« selbst den Schlüssel zur Konfuzianismusrezeption<br />
von Wolff liefert: Vergleicht man das Konfuziusbild, das Wolff in<br />
ihr zeichnet, mit den chinesischen Texten, so ergibt sich, dass Konfuzius nicht ein auswechselbares<br />
Modethema war, sondern eine Quelle der Inspiration für zukunftsweisende<br />
Neuerungen in Wolffs Werk. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist seine »Psychologia<br />
Empirica«, die – über die spätere Rezeption durch Wilhelm Wundt – die moderne Psychologie<br />
beeinflusst hat. Aber auch Wolffs Wirken auf die Politik und das Bildungswesen im<br />
Zeitalter der Aufklärung stellt Parallelen zum konfuzianischen Ethos des Gebildeten dar,<br />
der einen Beitrag zu einer menschlicheren und gerechteren Welt leisten wollte.<br />
Nach dem Projektplan steht die Vorbereitung einer Übersetzung (zentraler Passagen) und<br />
umfassenden Analyse des Werkes von Noël im Vordergrund. In seinem Vorwort schreibt<br />
Noël, dass er seine Arbeit vor allem als Beitrag zur Allgemeinbildung der Europäer verstanden<br />
hat: Er betont, wie wichtig es sei, in einer Zeit, in der so viel über China geredet<br />
wird, die geistigen Grundlagen der chinesischen Kultur zu erfassen. Durch dieses Bewusstsein<br />
als Kulturvermittler konnte Noël – jenseits aller theologischen Streitigkeiten – eine<br />
Übersetzung schaffen, von der sich Christian Wolff tiefgreifend beeinflussen ließ. Es bleibt<br />
noch zu erforschen, auf welche Weise Noëls Text auch auf Gelehrte wie Hume, Quesnay<br />
und Voltaire gewirkt hat. Die geplante Chinesisch-Lateinisch-Deutsche Ausgabe der wichtigsten<br />
Passagen der »Vier Bücher« wird diese bislang nicht beachtete Quelle der Aufklärung<br />
einem breiten Leserkreis zugänglich machen.<br />
Projekte im Fokus