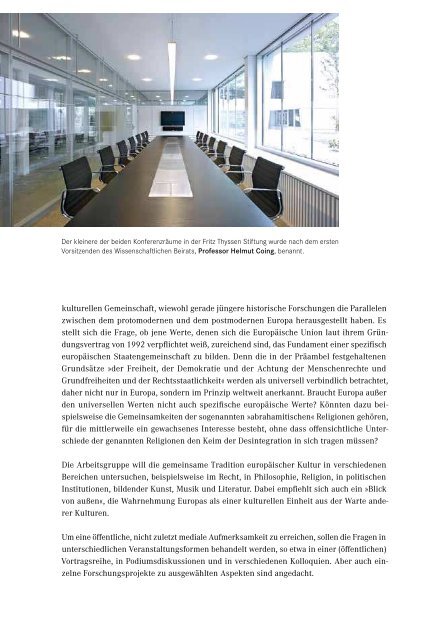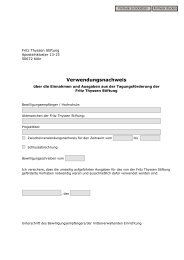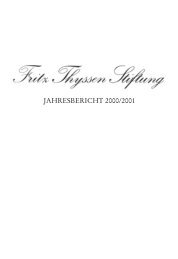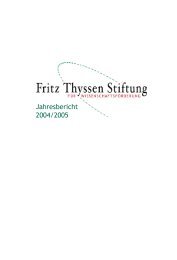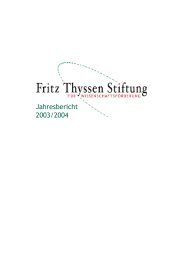Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Jahresbericht 2012 - Fritz Thyssen Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Städte des Rheinlandes<br />
schauen auf ein reiches<br />
Erbe an monumentalen<br />
Resten aus der Zeit zurück,<br />
in der sie Teil des römischen<br />
Reiches waren.<br />
Archäologisches Erbe im Rheinland | Die Veranstaltungsreihe »Das archäologische<br />
Erbe der Städte im Rheinland« wurde konzipiert und wird geleitet von prof. henner<br />
von hesberg, Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), Abteilung Rom.<br />
21<br />
Der kleinere der beiden Konferenzräume in der <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> wurde nach dem ersten<br />
Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats, Professor Helmut Coing, benannt.<br />
kulturellen Gemeinschaft, wiewohl gerade jüngere historische Forschungen die Parallelen<br />
zwischen dem protomodernen und dem postmodernen Europa herausgestellt haben. Es<br />
stellt sich die Frage, ob jene Werte, denen sich die Europäische Union laut ihrem Gründungsvertrag<br />
von 1992 verpflichtet weiß, zureichend sind, das Fundament einer spezifisch<br />
europäischen Staatengemeinschaft zu bilden. Denn die in der Präambel festgehaltenen<br />
Grundsätze »der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und<br />
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit« werden als universell verbindlich betrachtet,<br />
daher nicht nur in Europa, sondern im Prinzip weltweit anerkannt. Braucht Europa außer<br />
den universellen Werten nicht auch spezifische europäische Werte? Könnten dazu beispielsweise<br />
die Gemeinsamkeiten der sogenannten »abrahamitischen« Religionen gehören,<br />
für die mittlerweile ein gewachsenes Interesse besteht, ohne dass offensichtliche Unterschiede<br />
der genannten Religionen den Keim der Desintegration in sich tragen müssen?<br />
Die Arbeitsgruppe will die gemeinsame Tradition europäischer Kultur in verschiedenen<br />
Bereichen untersuchen, beispielsweise im Recht, in Philosophie, Religion, in politischen<br />
Institutionen, bildender Kunst, Musik und Literatur. Dabei empfiehlt sich auch ein »Blick<br />
von außen«, die Wahrnehmung Europas als einer kulturellen Einheit aus der Warte anderer<br />
Kulturen.<br />
Um eine öffentliche, nicht zuletzt mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, sollen die Fragen in<br />
unterschiedlichen Veranstaltungsformen behandelt werden, so etwa in einer (öffentlichen)<br />
Vortragsreihe, in Podiumsdiskussionen und in verschiedenen Kolloquien. Aber auch einzelne<br />
Forschungsprojekte zu ausgewählten Aspekten sind angedacht.<br />
Die Städte des Rheinlandes schauen auf ein reiches Erbe an monumentalen Resten aus der<br />
Zeit zurück, in der sie Teil des römischen Reiches waren. In Köln steht mit dem sogenannten<br />
Ubiermonument das Fundament des »ersten Monumentalbaus nördlich der Alpen«<br />
und in Trier bestimmen noch heute Porta Nigra und die Basilika des Kaiserpalastes das<br />
Stadtbild. In der Folge setzte hier die Monumentalisierung der christlichen Kirchen im<br />
frühen Mittelalter besonders rasch ein, sodass diese Städte mitsamt ihrem Umland über<br />
einen großen Bestand an Bau- und Kunstdenkmälern aus diesen Epochen verfügen.<br />
Diese Monumente bilden einen Schatz, denn sie eröffnen scheinbar ganz unmittelbar den<br />
Weg in die Vergangenheit und üben damit auch unmittelbar große Faszination aus. Sie<br />
sind aber zugleich eine Last, denn vielfach stehen sie Ausbauvorhaben im Wege, sind auch<br />
aus sich heraus nicht immer verständlich und bedürfen umfassender Erklärung.<br />
Solange es solche Monumente gibt, hat man sich mit ihnen auseinandergesetzt. Im Mittelalter<br />
wurden sie zum großen Teil als Steinbrüche verwendet, aber teilweise auch mit anderer<br />
Nutzung als Kirchenraum, als Kloster oder mit einer neuen Deutung ihres Sinnzusammenhanges<br />
erhalten. In der Neuzeit überwiegt der Wunsch, die Monumente zu erhalten<br />
und als Zeugnisse der Vergangenheit zu präsentieren. Allerdings scheiden sich daran die<br />
Geister. Einen prachtvollen Bau wie die sogenannte Palastaula in Trier hätte man nach den<br />
heute gültigen Normen der Denkmalpflege nicht in der Weise restauriert, wie sie heute in<br />
Trier als großer Kirchen- und Saalbau zugänglich ist und eine große Faszination ausübt.<br />
Erinnert sei auch an die Diskussionen in den 1980er-Jahren um die Rekonstruktionen der<br />
römischen Bauten in Xanten, die gerne als »Disneyland« diskreditiert wurden.<br />
Die für die Jahre 2013/14 geplante Serie von Veranstaltungen strebt nicht danach, am Ende<br />
so etwas wie eine neue Norm aufzustellen, etwa im Sinne einer Charta. Vielmehr geht es<br />
darum, sich der vielen Komponenten bewusst zu werden, die für die Entscheidungen den<br />
Ausschlag geben und die neben den Aspekten der Finanzierung, der Baustatik und der<br />
Didaktik vor allem die Integration in das urbane Umfeld und damit in das Bewusstsein der<br />
Bürgerinnen und Bürger umfassen. Die Monumente sollten in den Städten so gegenwärtig<br />
gehalten werden, dass sie auch heute noch Wirkung entfalten. Diese Wirkung aber ist<br />
immer wieder neu zu definieren.<br />
Die <strong>Fritz</strong> <strong>Thyssen</strong> <strong>Stiftung</strong> – Ort der Wissenschaft