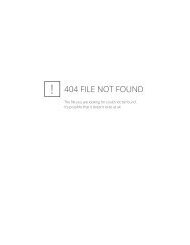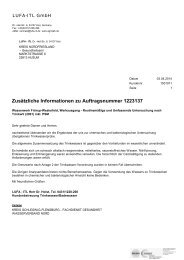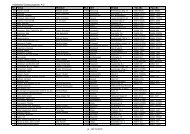April 2010 - Wasserverband Nord
April 2010 - Wasserverband Nord
April 2010 - Wasserverband Nord
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AUSGABE OEVERSEE<br />
INFORMATIONEN FÜR DIE KUNDEN DES WASSERVERBANDES NORD<br />
4. JAHRGANG NR. 1<br />
APRIL <strong>2010</strong><br />
BLAUES BAND<br />
Dr. Juliane<br />
Rumpf<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
in Schleswig-Holstein kommt<br />
dem Grundwasserschutz eine besondere<br />
Bedeutung zu, da unser<br />
Trinkwasser vollständig aus Grundwasser<br />
gewonnen wird. Rund 200<br />
Millionen Kubikmeter Wasser werden<br />
allein durch die 140 größten<br />
Wasserversorger, zu denen auch<br />
die Wasserverbände <strong>Nord</strong>erdithmarschen<br />
und <strong>Nord</strong> gehören, pro<br />
Jahr entnommen. Grundwasser<br />
ist Teil des Wasserkreislaufs. Es<br />
bildet sich aus Niederschlägen,<br />
die im Umfeld der Wasserwerke<br />
im Untergrund versickern. Dabei<br />
reichert es sich mit Mineralien an,<br />
die wichtig für unsere Gesundheit<br />
sind, aber es kann auch Schadstoffe<br />
aufnehmen, wenn diese im<br />
Boden enthalten sind.<br />
Gefährdungen für das Grundwasser<br />
ergeben sich beispielsweise<br />
aus Altlasten oder schadhafter<br />
Kanalisation. Große Probleme<br />
bereiten auch Austräge von Düngemitteln,<br />
die aus der landwirtschaftlichen<br />
Nutzung stammen.<br />
Damit die Trinkwasserversorgung<br />
in Schleswig-Holstein langfristig<br />
gesichert ist, wurden bereits 37<br />
Wasserschutzgebiete festgesetzt.<br />
Zur Verringerung von Schad- und<br />
Nährstoffeinträgen gelten – neben<br />
Maßgaben für gewerbliche<br />
und private Anlieger – insbesondere<br />
auch Vorschriften für eine<br />
grundwasserschonende Landbewirtschaftung.<br />
Eine spezielle<br />
landwirtschaftliche Beratung soll<br />
helfen, diese Regelungen in die<br />
Praxis umzusetzen. Grundwasserschutz<br />
muss uns allen ein ganz besonderes<br />
Anliegen sein, denn nur<br />
mit gemeinsamen Bemühungen<br />
werden wir es schaffen, auch für<br />
die nachfolgenden Generationen<br />
unser Wasser als gesunde Lebensgrundlage<br />
zu erhalten.<br />
Ihre Dr. Juliane Rumpf,<br />
Ministerin für<br />
Landwirtschaft, Umwelt<br />
und ländliche Räume<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> baut neuen Brunnen in Oeversee<br />
Wie das Schürfen nach Gold<br />
Eine entscheidende Rolle<br />
im Prozess der Wassergewinnung<br />
spielen die insgesamt<br />
elf Tiefbrunnen des<br />
WVN. Sie sind quasi die<br />
Zapfstellen des Verbandes.<br />
Da das Handeln des kommunalen<br />
Versorgers stets<br />
von Nachhaltigkeit geprägt<br />
ist, starteten Ende März die<br />
Bohrarbeiten für Brunnen<br />
Nummer 12.<br />
M<br />
it dieser Maßnahme wollen<br />
die Wasserexperten<br />
langfristig die Versorgung<br />
auch quantitativ sicherstellen – beispielsweise<br />
zu Abnahmespitzen im<br />
Sommer. Der verantwortliche Fachmann<br />
beim „Schürfen nach dem flüssigen<br />
Gold“ ist Dr. Christian Liebau<br />
von der GeoSystem GmbH aus Kiel.<br />
Er leitet dieses im Jahr <strong>2010</strong> mit rund<br />
einer halben Million Euro teuerste<br />
Einzelprojekt des <strong>Wasserverband</strong>es.<br />
Im Abstand von etwa 10 m zur bereits<br />
abgeteuften Aufschlussbohrung<br />
errichten die Kieler Experten derzeit<br />
den neuen Brunnen im sogenannten<br />
Lufthebebohrverfahren. „Die Proben<br />
können bei diesem speziellen Verfahren<br />
innerhalb des Bohrgestänges<br />
an die Oberfläche gebracht werden –<br />
haben deshalb eine bessere Qualität“,<br />
erläuterte der Geologe die Arbeiten<br />
gegenüber der Wasserzeitung und<br />
LANDPARTIE<br />
Der Spielmannszug des Bredstedter<br />
Handwerkervereins wurde bereits<br />
1924 gegründet. Zurzeit machen<br />
mehr als 50 Kinder und Jugendliche<br />
und etwa zehn Erwachsene in diesem<br />
Spielmannszug Musik der besonderen<br />
Art. Zwar werden auch Kinder- und<br />
Schützenfestumzüge begleitet, doch<br />
die große Stärke liegt in der Konzertmusik.<br />
„Vor zehn Jahren gewannen wir<br />
beispielsweise den Deutschen Orchesterwettbewerb<br />
bei den Spielmannszügen“,<br />
berichtet Vereinsvorsitzender<br />
Michael Klotzke. Stolz ist er<br />
vor allem über die Vizemeisterschaft<br />
beim ersten Bundesmusikfest aller<br />
Musikverbände in Würzburg in der<br />
Konzertklasse. „Dieses Event findet<br />
Bei den regelmäßigen Besprechungen stimmen sich Dr. Christian<br />
Liebau (GeoSystem), Jörg Carstensen (WVN) und Bohrmeister<br />
Stefan Janze (v. l. n. r.) von der Firma NBB aus Hamburg ab.<br />
Klänge auf der Kläranlage<br />
Die Stärke des vielstimmigen Chors liegt in der Konzertmusik.<br />
in diesem Jahr zum zweiten Mal<br />
statt. Im niedersächsischen Rastede<br />
werden die jungen Musiker ihr Bestes<br />
geben, um unter die ersten zehn von<br />
rund 50 Startern zu kommen.“<br />
Neben der Musik stehen auch viele<br />
Foto: Peter Mai<br />
meinte weiter: „Für die Bohrspülung<br />
selbst verwenden wir ausschließlich<br />
Trinkwasser. Aus gutem Grund, denn<br />
hygienisch muss bei diesem Bau<br />
alles unbedenklich sein. Hier geht<br />
es schließlich um das Lebensmittel<br />
Nr. 1.“ Insgesamt soll der Brunnen<br />
eine Endteufe von exakt 324 m unter<br />
der Geländeoberkante haben. Liebau:<br />
„Er gehört damit zu den tiefsten Exemplaren<br />
in <strong>Nord</strong>deutschland.“<br />
Förderung ab Mitte Juni<br />
Im Anschluss an die Brunnenbohrung<br />
stehen zirka 40 Siebanalysen an. Erst<br />
danach steht fest, in welcher Tiefe die<br />
rund 45 m lange Filterkiesstrecke eingebracht<br />
werden kann. Dies ist wichtig,<br />
weil in diesem Bereich ungelöste<br />
Feststoffe wie Sandkörner zurückgehalten<br />
und damit die Brunnenfilter<br />
geschützt werden sollen. Nach der<br />
Fertigstellung des Brunnens erfolgen<br />
ein geophysikalisches Mess programm,<br />
eine Kamerabefahrung sowie eine<br />
Flowmetermessung zur Abnahme und<br />
Dokumentation des Bauwerks. Die<br />
geplante Inbetriebnahme des neuen<br />
Kiesfilterbrunnens, der künftig bis<br />
zu 200 m 3 Trinkwasser in der Stunde<br />
(insgesamt mehr als 1 Mio. m 3 jährlich)<br />
fördern kann, ist für Mitte Juni vorgesehen.<br />
„Das sollten wir schaffen“, so<br />
Liebau zuversichtlich. Den Kunden des<br />
WVN kann man dann nur noch „Wohl<br />
bekomm’s“ wünschen.<br />
Freizeitveranstaltungen auf dem Programm<br />
der Musiker. Hier ist das Vereinshaus<br />
des Spielmannszuges ein<br />
sehr wichtiger Anlaufpunkt. „Nach<br />
einem Tipp nahmen wir im Jahr 2000<br />
Kontakt zur Stadt und zum <strong>Wasserverband</strong><br />
<strong>Nord</strong> auf. Wir begannen in<br />
Eigenarbeit die alte Kläranlage in<br />
Bredstedt zum Vereinsheim umzubauen.“<br />
Seit dieser Zeit organisiert<br />
der Verein viele Veranstaltungen für<br />
Bredstedt und die Bürger des Luftkurorts,<br />
z. B. das Maifest, auf diesem<br />
Gelände. Klotzke: „Diese Vereinsarbeit<br />
ist aber nur möglich, da der<br />
<strong>Wasserverband</strong> das Vereinsheim<br />
und das Gelände den jungen Leuten<br />
kostenfrei zu Verfügung stellt. Dafür<br />
nochmals vielen Dank.“ Umgekehrt<br />
bedankt sich auch der WVN, denn<br />
die Nachwuchsmusiker pflegen die<br />
Anlage sehr fürsorglich.<br />
Weitere Infos unter<br />
www.szbredstedt.de
SEITE 2<br />
GESCHICHTE DES TRINKWASSERS<br />
WASSERZEITUNG<br />
APRIL <strong>2010</strong> SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />
SEITE 3<br />
1<br />
Facetten<br />
des Wassers<br />
A<br />
ls Mitte des vergangenen<br />
Jahrhunderts in der <strong>Nord</strong>eifel<br />
die Spuren einer römischen<br />
Wasserleitung entdeckt<br />
wurden, ahnte man nicht, dass es sich<br />
hier um das größte Bauwerk der Antike<br />
nördlich der Alpen handelt. Dieser<br />
80 n. Chr. gebaute „Römerkanal“<br />
transportierte über eine Länge von<br />
95,5 km täglich 20.000 m³ Trinkwasser<br />
von Quellen im Flusstal der Urft<br />
bei Nettersheim ins römische Köln.<br />
Die zumeist unterirdisch verlaufende<br />
Trasse mit einem Querschnitt von<br />
70 cm Breite und 100 cm Höhe weist<br />
über die gesamte Strecke ein Gefälle<br />
von einem Promille auf, also auf<br />
1.000m Entfernung eine Höhendifferenz<br />
von einem<br />
Meter. Für den Bau<br />
dieses und all<br />
der anderen<br />
A q u ä -<br />
Eine Trinkwasserversorgung<br />
auf höchstem nischen Niveau entwickelte<br />
tech-<br />
das römische Imperium, das<br />
nächste Ziel unserer Zeitreise<br />
durch die Geschichte des<br />
Trinkwassers.<br />
dukte (so der Name für die gesamte<br />
Leitung und nicht nur für die Brücken)<br />
gab es vor allem einen Grund: In den<br />
römischen Städten schnellte explosionsartig<br />
der Wasserbedarf nach<br />
oben. Archäologen gehen davon aus,<br />
dass dem Verbrauch von 30 Litern<br />
Wasser pro Tag in den Städten des<br />
antiken Griechenlands bis zu 500 Liter<br />
bei den Römern (Deutschland heute:<br />
128 l/Tag) gegenüberstanden. Dafür<br />
sorgten neben den Fontänen und<br />
öffentlichen Brunnen vor allem die<br />
Vorgänger der heutigen „Wellnessindustrie“,<br />
die Thermen. Hier fanden die<br />
Römer in den oft pompös ausgestat-<br />
teten Bädern Entspannung bei Massagen,<br />
Maniküren und einem guten<br />
Schluck Wein; es wurden Geschäfte<br />
abgeschlossen oder politische Intrigen<br />
gesponnen. Um 400 n. Chr. gab<br />
es in Rom 856 Privatbäder und 11 öffentliche<br />
Thermen, deren bekannteste<br />
von 212 bis 216 durch Kaiser Caracalla<br />
errichtet wurde.<br />
Für diesen Luxus scheute das antike<br />
Rom weder Kosten noch Mühe. Über<br />
14 Wasserleitungen in einer Länge<br />
Die 730 m lange Brücke im spanischen Segovia gehörte zu einem 18 km langen Aquädukt, das Wasser in die Stadt brachte. Dieses<br />
Meisterwerk römischer Baukunst aus dem 2. Jh. n. Chr. ruht auf 118 Bögen aus Granitsteinen.<br />
Erft<br />
Zülpich<br />
Mechernich<br />
Urft<br />
Kall<br />
Urft<br />
Euskirchen<br />
Nettersheim<br />
Köln<br />
Hürth<br />
Kreuzweingarten<br />
Eine Betrachtung von<br />
Dr. Peter Viertel<br />
Bonn<br />
Rhein<br />
Meckenheim<br />
So verlief der 95,5 km lange Römerkanal nach Köln.<br />
2<br />
Antike –<br />
Das römische<br />
3 4<br />
Mittelalter bis zur<br />
5 Gegenwart –<br />
Zweistromland Imperium<br />
Industrialisierung<br />
Perspektiven<br />
Wahre Meister der Wasserkunst<br />
Ein antiker „Wasserturm“<br />
aus Pompeji.<br />
Römisches Aquädukt bei Caesarea in Palästina (ca. 1. Jh. n. Chr.).<br />
Die Leitungen bestanden meist aus Stein, wobei auch Holz, Leder<br />
und Blei zum Einsatz kamen.<br />
von 400 km, davon 64 km als Bogena-<br />
quädukt, wurden gebaut, um aus<br />
einem Umkreis von 100 km täglich<br />
zwischen 500.000 und 635.000 m³<br />
Trinkwasser in die „Ewige Stadt“<br />
zu liefern. Auch in den Provinzen<br />
wollten die Römer auf ihr gewohntes<br />
Pläsier nicht verzichten. Ob<br />
nun in Köln, Trier, Xanten,<br />
in Nimes oder Segovia,<br />
überall sorgten<br />
Aquädukte mit<br />
oft spektaku-<br />
lären Brückenbögen für eine üppige<br />
Versorgung. Jüngst spürte der deutsche<br />
Wissenschaftler Mathias Döring<br />
in <strong>Nord</strong>jordanien ein Aquädukt<br />
aus dem 2. Jh. n. Chr. auf. Die ca.<br />
170 km lange Wasserleitung belieferte<br />
die auf einem trockenen Hochplateau<br />
gelegene Stadt Gadara mit<br />
Trinkwasser. Sensationell ist dabei<br />
die Tatsache, dass 106 km dieses<br />
Aquädukts im Stollenvortrieb gebaut<br />
wurden. Damit präsentierte die<br />
römische Wasserversorgung einen<br />
weiteren Superlativ: den längs ten<br />
Tunnel der Antike.<br />
Querschnitt eines<br />
römischen Aquädukts.<br />
Der zwischen 40 und 60 n. Chr. errichtete 50 m hohe Pont du Gard<br />
bei Nimes ist wohl das bekannteste Brücken aquädukt der Römer.<br />
40.000 m³ Wasser wurden hier täglich nach Nimes transportiert.<br />
100 cm<br />
70 cm<br />
GUTES WASSER FÜR GUTE PRODUKTE (5)<br />
Möhren, Kartoffeln, Blumenkohl<br />
& Co. frisch auf den Tisch<br />
Gemüse, insbesondere aus<br />
biologischem Anbau, ist gesund.<br />
Roh oder schonend<br />
gegart, enthält es schließlich<br />
all die Vitamine, Spurenelemente<br />
und Mineralien, die<br />
wir zum Leben brauchen.<br />
Außerdem ist der Gehalt an<br />
Kohlenhydraten sehr gering<br />
und der Wasseranteil von<br />
rund 90 Prozent außerordentlich<br />
hoch.<br />
D<br />
ieser hohe Wassergehalt<br />
kommt sicher nicht aus unserer<br />
Trinkwasserleitung.<br />
Eine künstliche Bewässerung wird bei<br />
uns nur im Notfall durchgeführt“, erklärt<br />
Rainer Carstens, Geschäftsführer<br />
der Westhof Bio-Gemüse GmbH<br />
& Co. KG, Friedrichsgabekoog. Frischwasser<br />
aus der Leitung braucht sein<br />
Betrieb trotzdem: Ehe beispielsweise<br />
die Mohrrüben sortiert und portionsweise<br />
verpackt werden, müssen sie<br />
gründlich gewaschen werden. „Wir<br />
sorgen allerdings durch eine spezielle<br />
Technik dafür, dass mit dem Wasser<br />
sehr sparsam umgegangen wird“, so<br />
der umweltbewusste Unternehmer.<br />
„Mein Vater hat sich seinen Traum<br />
erfüllt, als er 1972 den Hof kaufte.<br />
Ich war damals 14 Jahre alt und<br />
verliebte mich sofort in das rund 60<br />
Hektar große Anwesen“, erinnert<br />
sich Cars tens. Nur sechs Jahre später<br />
gründete er hier seinen Betrieb<br />
und baute auf konventionelle Weise<br />
Getreide und Zuckerrüben an. 1989<br />
wagte er den Schritt, sich ganz auf<br />
biologischen Gemüse-Anbau zu<br />
konzentrieren, und schloss sich dem<br />
„Bioland“-Verband an.<br />
Westhof hat<br />
170 Mitarbeiter<br />
„Wie es sich gezeigt hat, war das<br />
genau die richtige Richtung für unser<br />
Unternehmen. Was mit einem<br />
Einmannbetrieb begonnen hat,<br />
bietet jetzt Arbeitsplätze für 80<br />
fest angestellte Mitarbeiter und<br />
90 Aushilfskräfte“, macht Carstens<br />
deutlich. Er verhehlt jedoch nicht,<br />
dass es dabei die eine oder andere<br />
Enttäuschung gegeben habe. „Man<br />
benötigt eben auch die Fähigkeit<br />
durchzuhalten.“ Wie beispielsweise<br />
beim Aufbau der Firma Bio-Frost<br />
Westhof GmbH in Wöhrden: „Die<br />
Lösung technischer Probleme hat<br />
mich drei Jahre meines Lebens gekostet.<br />
Aber Aufgeben kam für mich<br />
Rainer Carstens ist überzeugt: Qualität setzt sich durch.<br />
nicht infrage. Heute sind die Anlaufschwierigkeiten<br />
längst vergessen.“<br />
Drei gut funktionierende<br />
Betriebszweige<br />
Mittlerweile hat sich das Unternehmen<br />
„Westhof“ in drei Zweige aufgegliedert:<br />
Produziert wird das Gemüse<br />
bei „Dörscher & Carstens Bio GbR“<br />
auf einer Fläche von 670 Hektar, die<br />
Rainer Carstens gemeinsam mit seinem<br />
Nachbarn Paul-Heinrich Dörscher<br />
bewirtschaftet. „Da wir ganz auf chemische<br />
Düngemittel verzichten, unsere<br />
Pflanzen jedoch gut ernähren und<br />
gesund erhalten wollen, halten wir<br />
eine siebenjährige Fruchtfolge ein“,<br />
erläutert Rainer Carstens. Über zwei<br />
Jahre werde durch Klee Stickstoff aus<br />
der Luft gesammelt. Danach werden<br />
REZEPT<br />
Zutaten:<br />
500 g Möhren geraspelt<br />
250 g helle oder blaue Trauben,<br />
halbiert, entkernt<br />
1 ausgepresste Zitrone<br />
2 EL saure Sahne<br />
1 TL Honig<br />
1 TL Sonnenblumenöl<br />
50 g gehackte Nüsse<br />
Petersilie, Pfeffer<br />
Der Anbau von Bio-Gemüse<br />
bedarfsweise Kohl bzw. Blumenkohl<br />
oder Brokkoli, Erdbeeren, Porree und<br />
Sellerie, später Möhren, Kartoffeln<br />
und zum Schluss Erbsen angebaut,<br />
ehe der Kreislauf wieder mit Kleegras<br />
beginnt. Die Vermarktung und<br />
Verarbeitung des eigenen Gemüses<br />
wie auch von Produkten umliegender<br />
Bio-Landwirte erfolgt in der Westhof<br />
Bio-Gemüse GmbH & Co. KG. Hier<br />
werden jährlich rund 20.000 Tonnen<br />
frische Möhren und 7.000 Tonnen<br />
anderes Gemüse sortiert, geputzt,<br />
verpackt und jeweils sofort auf Lastkraftwagen<br />
verladen, um Händler in<br />
der Region und Großkunden im gesamten<br />
Bundesgebiet zu beliefern.<br />
Zu einem wichtigen Betriebszweig<br />
hat sich inzwischen auch die Bio-<br />
Frost Westhof GmbH in Wöhrden<br />
Möhrenrohkost<br />
Zubereitung:<br />
Zitronensaft, saure Sahne, Honig<br />
und Öl verrühren, Soße mit Möhren<br />
und Trauben mischen und auf Teller<br />
verteilen, mit Pfeffer, Nüssen und<br />
zerkleinerter Petersilie bestreuen.<br />
(gesehen im „Holtseer Salatebuch“,<br />
herausgegeben von der Grundschule<br />
Holtsee)<br />
entwickelt. Es werden hauptsächlich<br />
Industriekunden beliefert, die Babynahrung<br />
und Fertiggerichte herstellen.<br />
Der Entwicklung immer<br />
einen Schritt voraus<br />
„Meine Firmenphilosophie ist es, der<br />
allgemeinen Entwicklung möglichst<br />
ein Stück voraus zu sein. So ist zum<br />
Beispiel unsere Anlage deutschlandund<br />
möglicherweise sogar europaweit<br />
einmalig, die die Möhren vollautomatisch<br />
verpackt. Die Maschine erledigt<br />
alle schweren Arbeiten, und trotzdem<br />
bleibt jeder Arbeitsplatz erhalten“,<br />
erläutert der agile Firmenchef. Auch<br />
in puncto Mitarbeiterbezahlung war er<br />
schon immer seiner Zeit voraus: „Ein<br />
angemessener Mindestlohn ist das<br />
Beste. Alle müssen von ihrer Arbeit<br />
WESTHOF<br />
Heilen mit Gemüse<br />
Vielen Gemüsesorten<br />
wird eine heilende<br />
Wirkung zugesprochen.<br />
Hier eine kleine Auswahl:<br />
• Mohrrüben wehren „freie Radikale“<br />
und andere Schädlinge<br />
ab, stärken die Immunkräfte,<br />
verbessern das Sehvermögen<br />
und stärken Herz und Kreislauf.<br />
• Kartoffeln bauen Knochen-<br />
subs tanz auf, kräftigen die<br />
Muskeln sowie das Bindegewebe<br />
und aktivieren den<br />
gesamten Stoffwechsel.<br />
• Blumenkohl hilft bei Nierenund<br />
Blasenproblemen, wirkt<br />
blutdrucksenkend und beugt<br />
Dickdarmkrankheiten vor.<br />
• Brokkoli beugt Infektionen<br />
vor, hilft gegen nervöse Unruhe,<br />
Reizbarkeit und<br />
Schlafstörun gen und<br />
wirkt blutbildend.<br />
• Rot- und Weißkohl<br />
wirkt blutdrucksenkend und<br />
entwässernd, entgiftet<br />
den Darminhalt, stärkt die<br />
Konzentrationsfähigkeit.<br />
• Erbsen<br />
kräftigen die Nerven,<br />
Haare und das Bindegewebe,<br />
verbessern die Sehfähigkeit<br />
und senken den Cholesterin-<br />
und Blutfettspiegel.<br />
Quelle: Obst und Gemüse als Medizin,<br />
Verlag Südwest. ISBN 3-517-06038-0<br />
leben können.“ Subventionen steht<br />
er äußerst kritisch gegenüber: „Das<br />
verzerrt den Wettbewerb. Politik<br />
sollte sich um hoheitliche Aufgaben<br />
kümmern und sich nicht in die Wirtschaft<br />
einmischen.“<br />
Um künftig seinen biologischen Gemüseanbau<br />
klimaneutral betreiben<br />
zu können, hat der 52-Jährige ehrgeizige<br />
Pläne: „Meine Vision ist es, alle<br />
möglichen regenerativen Rohstoffe<br />
zu nutzen: Neben Solarenergie und<br />
Windkraft möchte ich eine Biogasanlage<br />
bauen, in die natürlich keine<br />
Nahrungsmittel, sondern alle ungenutzten<br />
Pflanzenanteile wandern.<br />
So könnten wir die Wärmeenergie,<br />
die wir erzeugen, selbst zu hundert<br />
Prozent nutzen und die zurückbleibenden<br />
Nährstoffe wieder dem Feld<br />
zuführen.“
WASSERZEITUNG • 1/<strong>2010</strong> PANORAMA<br />
SEITE 4/5<br />
O<br />
VORGESTELLT<br />
hne die stets fachkundigen<br />
Mitarbeiter in den einzelnen<br />
Bereichen und Abteilungen<br />
des <strong>Wasserverband</strong>es <strong>Nord</strong> wäre<br />
die gute Bilanz über weit mehr als<br />
ein halbes Jahrhundert nicht möglich<br />
gewesen. Heute sieht sich der WVN<br />
mehr denn je als Dienstleister rund<br />
ums kostbare Nass. Die Wasserzeitung<br />
stellt die Teams des kommunalen Verund<br />
Entsorgers in einer mehrteiligen<br />
Serie vor. Lesen Sie heute Teil 5 – die<br />
Abteilung Wasserwerk.<br />
Ständige Bereitschaft<br />
Es ist ein wahres „Kronjuwel“. Gemeint<br />
ist das verbandseigene Wasserwerk<br />
in Oeversee. Es bildet die Basis<br />
dafür, dass der WVN jährlich mehr als<br />
sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser<br />
zu seinen Verbrauchern liefert. Das<br />
bedeutet, dass hier täglich fast 20.000<br />
Kubikmeter des Lebensmittels die<br />
Reise in das 1.135 km 2 große Versorgungsgebiet<br />
antritt – das ist die Fläche<br />
von anderthalbmal Hamburg!<br />
Doch auch die modernste Technologie<br />
kommt heutzutage nicht ohne prüfenden<br />
Blick der Fachleute aus. Um<br />
den hohen Ansprüchen der Kundinnen<br />
und Kunden permanent gerecht zu werden,<br />
stecken die WVN-Mitarbeiter viel<br />
Arbeit sowie hohes fachliches Können<br />
in ihr exquisites „Produkt“. So sorgen<br />
insgesamt fünf Mitarbeiter unter der<br />
Leitung von Jörg Carstensen dafür,<br />
dass das Lebenselixier zu jeder Tagesund<br />
Nachtzeit mit dem richtigen Druck<br />
aus den Leitungen sprudelt. Abwechselnd<br />
sind neben Carstensen auch die<br />
Mitarbeiter Axel Müller (Wasser- und<br />
Elektromeister) und Markus Panna<br />
(Fachkraft für Wasserversorgung) für<br />
den Notfall in ständiger Bereitschaft.<br />
Seit seiner Gründung hat der WVN viel<br />
Geld in sein Wasserwerk, die insgesamt<br />
sieben Druckerhöhungsanlagen<br />
sowie die elf Tiefbrunnen investiert<br />
– Brunnen 12 wird gerade gebohrt<br />
(siehe Beitrag Seite 1). „Dem von uns<br />
geförderten Mischrohwasser“, erklärt<br />
Abteilung Wasserwerk<br />
Die Hüter des Kronjuwels<br />
Das Wasserwerk<br />
in Zahlen<br />
• Bewilligte Rohwasserförderung:<br />
7,5 Mio. m 3 pro Jahr<br />
• Wasserförderung aus 132 bis<br />
332 m Tiefe durch 12 Brunnen<br />
• 5 Verdüsungskammern<br />
• 4 Reaktionsbecken<br />
• 12 offene Filter<br />
• 12 Reinwasserpumpen<br />
• Rohrleitungen im Werk: 3.180 m<br />
• Speichervolumen der Reinwasserbehälter:<br />
12.000 m 3<br />
Erklimmen mit ihrer Arbeit die Spitze: Jörg Carstensen, Hermann<br />
Huber, der gemeinsam mit dem teilzeitbeschäftigten<br />
Werner Schmidt für die Pflege der Außen- und Wasserwerksanlagen<br />
verantwortlich ist, Markus Panna und Axel Müller (v. r. n. l.).<br />
Carstensen, „ist in tausenden Jahren<br />
aller gelöster Sauerstoff entzogen<br />
worden, dafür entstanden Kohlendioxid<br />
und Schwefelwasserstoff, die<br />
wiederum gelöst vorliegen. Eisen und<br />
Mangan, die normalerweise in unlöslichen<br />
Verbindungen im Grundwasser<br />
vorhanden sind, wurden vom Schwefelwasserstoff<br />
reduziert und damit<br />
wasserlöslich. Alles in allem haben<br />
wir es hier bereits mit einwandfreiem<br />
Grundwasser zu tun.“ Deshalb erfolgt<br />
die Aufbereitung des reduzierten Tiefengrundwassers<br />
lediglich durch Belüftung<br />
mit Luftsauerstoff. Carstensen:<br />
„Dazu wird das Mischrohwasser der<br />
unterschiedlichen Brunnen über Düsen<br />
in fünf Verdüsungskammern mit einer<br />
Gesamtfläche von 420 m 2 versprüht<br />
und dann ‚gestrippt’, d. h. Schwefelwasserstoff<br />
und Kohlendioxid werden<br />
ausgeblasen, da gefilterte Außenluft in<br />
die Kammern geführt wird.“ Das für so<br />
lange Zeit von der Luft getrennte Wasser<br />
beginnt in der Verdüsungskammer<br />
sofort, sich wieder mit der Atmosphäre<br />
auszutauschen. Eisen und Mangan oxidieren,<br />
gelöste Teile der Huminstoffe<br />
werden unlöslich. In zwölf offenen<br />
Schnellfiltern wird das Wasser dann<br />
filtriert. Eine weitere Behandlung<br />
des Wassers ist nicht notwendig. Anschließend<br />
wird das Trinkwasser in<br />
Reinwasserbehältern gespeichert und<br />
von dort ins Netz eingespeist.<br />
Beste Kontrolle<br />
Alles passiert zum Wohle der Verbraucher.<br />
Sie können das am meisten kontrollierte<br />
Lebensmittel „pur“ aus der<br />
Leitung genießen. Das leckere Nass<br />
wird regelmäßig auf Inhaltsstoffe wie<br />
Bakterien, Mineralien und Schwebestoffe<br />
vom Verband, von unabhängigen<br />
Labors und vom Gesundheitsamt des<br />
Landkreises Schleswig-Flensburg (hierbei<br />
von Jochen Mohr-Kriegshammer)<br />
auf Herz und Nieren geprüft. Darüber<br />
hinaus führt das Gesundheitsamt punktuell<br />
in öffentlichen Einrichtungen wie<br />
Schulen, Kitas, Seniorenheimen und<br />
Krankenhäusern Kontrollen durch.<br />
Übrigens bringen Jörg Carstensen und<br />
Axel Müller Schulklassen, Landfrauen<br />
und anderen Interessierten den Weg<br />
des Wassers in lebendigen Vorträgen<br />
nahe.<br />
Sie haben Interesse an einer<br />
Wasserwerksführung?<br />
Tel. 04638 8955-0<br />
Die ewigen Jungbrunnen<br />
Oeverseer Grundwasser viele hundert Jahre alt und noch immer „unberührt“<br />
Sage und schreibe 7,2 Mio. m 3 Trinkwasser<br />
liefert der WVN jährlich zu seinen Verbrauchern.<br />
Zum Vergleich: Mit diesem Wasservorrat<br />
ließen sich rund 90 Millionen Badewannen<br />
füllen! Das „Produkt“ Trinkwasser<br />
könnte dabei nicht besser sein. Es ist<br />
erfrischend, rund um die Uhr in schier<br />
unerschöpflicher Menge verfügbar,<br />
klar und anmutig im<br />
Erscheinungsbild und<br />
obendrein frei von<br />
menschlichen<br />
Einflüssen.<br />
D<br />
as kommt daher“, sagte<br />
WVN-Geschäftsführer Ernst<br />
Kern dieser Zeitung, „da das<br />
von uns geförderte Grundwasser<br />
nach neuesten Berechnungen von Dr.<br />
Jürgen Sültenfuß schon viele hundert<br />
Jahre alt ist“ – siehe rechts. Ein nahezu<br />
jungfräuliches Lebenselixier aus<br />
der Eiszeit-Rinne also. Die Geologie<br />
und die Grundwasserverhältnisse im<br />
rund 52 km 2 großen Wassereinzugsgebiet<br />
um das Wasserwerk Oeversee<br />
herum bieten bereits erstklassige<br />
Voraussetzungen, damit die etwa<br />
88.000 Menschen zwischen Großsolt<br />
und Süderoog, zwischen Weesby und<br />
Bondelum das Trinkwasser direkt aus<br />
dem Hahn genießen können. Gerade<br />
im Wassereinzugsbereich wird gewissermaßen<br />
die Zukunft bewahrt,<br />
8.000.000<br />
7.000.000<br />
6.000.000<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
0<br />
Wasserabgabe des Wasserwerkes Oeversee in Kubikmetern<br />
bewilligte Menge ab 1999: 7,5 Mio. m 3<br />
Wassereinzugs gebiet Oeversee<br />
denn das Grundwasser muss unbedingt<br />
vor Schaden bewahrt werden – nicht<br />
nur im Interesse heutiger, sondern auch<br />
nachfolgender Generationen.<br />
Grundwasser ist<br />
gut geschütztes Gut<br />
1963–2009<br />
Wasserwerk Oeversee<br />
Im Wasserwerk Oeversee wird das<br />
Grundwasser aus sehr tiefen Schichten<br />
entnommen. Die insgesamt 11 Trinkwasserbrunnen<br />
sind bis in eine Tiefe<br />
von 332 m verfiltert – lesen Sie hierzu<br />
auch den Beitrag auf der Titelseite. Die<br />
genutzten Braunkohlesande stellen einen<br />
sehr ergiebigen Grundwasserleiter<br />
dar, der im Gebiet zwischen Schleswig<br />
und Flensburg weiträumig verbreitet ist.<br />
„Diese Sande sind großflächig durch<br />
sehr gering wasserleitende Schichten<br />
überdeckt und somit sehr gut gegen<br />
Verunreinigungen geschützt“, beschreibt<br />
Jörg Carstensen, Abteilungsleiter<br />
Wasserwerk, die geologischen Vorzüge.<br />
Das Grundwasser im Nutzhorizont<br />
des Wasserwerkes wird im Bereich des<br />
Einzugsgebietes durch versickerndes<br />
Niederschlagswasser ergänzt. Carstensen:<br />
„Von den im Mittel 850 mm Regen<br />
pro Jahr stehen etwa 120 mm, also<br />
etwa ein Siebtel, der Grundwasserneubildung<br />
zur Verfügung, der andere Teil<br />
verdunstet oder fließt oberirdisch ab.“<br />
Unbegrenztes Dargebot<br />
des Grundwassers<br />
Das hört sich erst einmal wenig an,<br />
doch der Wasser experte beruhigt:<br />
„Aufgrund der naturräumlichen Dimension<br />
des genutzten Grundwasserleiters<br />
steht auch in Zukunft eine<br />
ausreichende Menge an Grundwasser<br />
zur Verfügung, um die Versorgung der<br />
Bevölkerung mit hervorragendem Trinkwasser<br />
zu sichern.“<br />
Infografiken: SPREE-PR<br />
Leuchtturm<br />
Pellworm<br />
41,5 m<br />
▲ Geländeoberkante<br />
Wasserstand<br />
12 m<br />
Unterwasserpumpe<br />
22 m<br />
Sand/Kies<br />
Tonsperre<br />
Sand/Kies<br />
Tonsperre<br />
PVC-Filterrohr<br />
ø 25 cm<br />
Tiefe: 332 m<br />
Wie alt ist das Grundwasser<br />
aus Oeversee?<br />
Dr. Jürgen Sültenfuß<br />
von der Universität Bremen:<br />
„Durch Untersuchungen mit modernster<br />
physikalischer Analysentechnik,<br />
bei der der radioaktive Zerfall<br />
von Elementen gemessen werden<br />
kann, lässt sich feststellen, dass das<br />
Grundwasser im Nutzhorizont mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit „sehr alt“,<br />
d. h. mehrere hundert Jahre alt ist.<br />
Von Interesse ist die Frage, ob durch<br />
die intensive Nutzung des Grundwasserstromes<br />
mit der Zeit auch Anteile<br />
jüngeren Wassers zufließen. Unter<br />
jüngerem Wasser ist solches zu verstehen,<br />
das sich aus Niederschlägen nach<br />
1955 gebildet hat. Denn ab diesem<br />
Zeitpunkt sind durch die Atombombentests<br />
der Großmächte nachweisbare<br />
Mengen des künstlichen radioaktiven<br />
Wasserstoffs in die Atmosphäre entlassen<br />
worden. Das Niederschlagswasser<br />
wurde sozusagen ab diesem<br />
Zeitpunkt „markiert“. Wir haben festgestellt,<br />
dass der Anteil von jüngerem<br />
Wasser im Grundwasser maximal<br />
1– 3 % beträgt. Im Vergleich zu Trinkwässern,<br />
welche aus Talsperren, Seen<br />
oder Flüssen entnommen werden und<br />
die nur wenige Tage bis einige Jahre<br />
alt sind, ist das Grundwasser aus Oeversee<br />
also wirklich erst zu Zeiten unserer<br />
Vor-Vorfahren gebildet worden.“<br />
Die Methode: Die Helium-3/Tritium-<br />
Methode eignet sich ausgezeichnet<br />
für die Datierung von Grundwasser.<br />
Sie basiert auf der Messung von<br />
radioaktivem Wasserstoff und seinem<br />
Zerfallsprodukt Helium-3.<br />
Die „alte“ C14-Methode<br />
Ein wichtiges Hilfsmittel bei archäologischen<br />
Untersuchungen ist das Datieren<br />
über radioaktiven Kohlenstoff. Es<br />
handelt sich um eine Methode, mit der<br />
das Alter von bestimmten Holz- oder<br />
Pflanzenresten, von tierischen oder<br />
menschlichen Knochen oder von Gerätschaften<br />
bestimmt werden kann, die<br />
in denselben Erdschichten gefunden<br />
wurden. Diese Methode wurde vom<br />
amerikanischen Chemiker Willard Libby<br />
(1908 – 1980) in den frühen 1950ern<br />
entwickelt. 1960 wurde er dafür mit<br />
dem Nobelpreis ausgezeichnet. Das radioaktive<br />
Datieren basiert darauf, dass<br />
einige Holz- oder Pflanzenüberbleibsel<br />
Rückstände von Kohlenstoff 14, einem<br />
radioaktiven Isotop des Kohlenstoffs,<br />
aufweisen. Dieses Isotop wird von der<br />
Pflanze während ihres Lebens gespeichert<br />
und beginnt mit ihrem Absterben<br />
zu zerfallen. Da die Halbwertszeit von<br />
Kohlenstoff 14 sehr groß ist (ungefähr<br />
5.568 Jahre), verbleiben messbare<br />
Mengen des Kohlenstoffs 14 auch<br />
noch nach vielen tausend Jahren.<br />
Neue Internetdarstellung freigeschaltet<br />
Das Fenster zur Welt<br />
Auf, zur Wassertour, möchte die WZ Ihnen raten – in übertragenem<br />
Sinne. Denn Sie sollen sich nicht aufs oder ins nasse Element<br />
begeben, sondern zum Fenster des WVN hineinschauen. Auf der<br />
von der GLC Glücksburg Consulting AG überarbeiteten Internetpräsentation<br />
warten aktuelle Informationen auf Sie. Formulare<br />
stehen ebenso zum Herunterladen bereit wie sämtliche Satzungen.<br />
Der Klick zum 24-h-Service lohnt sich auch deshalb, weil der<br />
problemlose E-Mail-Kontakt zu den Mitarbeitern so manchen<br />
umständlichen Schriftverkehr erspart: www.wv-nord.de<br />
WVN-Urgestein Wilhelm Behnemann erinnert sich:<br />
Kein Ritt auf der<br />
Kanonenkugel<br />
Nach dem Studium an der Schiffsingenieurschule<br />
in Flensburg und<br />
mehreren Jahren Fahrenszeit nahm<br />
ich im Juli 1963 die Stellung als Wassermeister<br />
beim WVN an. Zum Ende<br />
des Jahres wurde mir die Leitung<br />
der Rohrnetzabteilung übertragen. Es<br />
folgten turbulente Zeiten. Für das Jahr<br />
1964 standen umfangreiche Baumaßnahmen<br />
an. Zirka 100 km Haupt- und<br />
Nebenleitungen einschließlich des<br />
Überhangs aus dem Vorjahr waren zu<br />
bewältigen. Es galt Genehmigungen<br />
für einzelne Baumaßnahmen einzuholen,<br />
Zeichnungen der Baupläne<br />
anzufertigen, Leistungsverzeichnisse<br />
und Ausschreibungen für die Materiallieferungen<br />
und Verlegearbeiten zu<br />
koordinieren. Dabei passierte mitunter<br />
Witziges: Bspw. fand im Spätsommer<br />
1969 die durch uns beauftragte Baufirma<br />
Paul I. Peters bei der Verlegung<br />
der Trinkwasserleitung in Harrislee-<br />
Niehuus am Schlossberg in Höhe der<br />
Schule eine Eisenkugel. Ich stolperte<br />
bei der Baustellenbegehung über<br />
sie und nahm sie an mich, hegte und<br />
pflegte die Kugel all die Jahre. Im Gegensatz<br />
zu Baron Münchhausen beabsichtigte<br />
ich allerdings keinen Ritt auf<br />
der Kanonenkugel. Da meine Kinder<br />
und Enkel künftig sicher nichts mit<br />
„Willi“ Behnemann mit dem<br />
1969 gefundenen 15-Pfünder.<br />
diesem seltsamen Fundstück anfangen<br />
können, gebe ich sie nun in die vertrauensvollen<br />
Hände des WVN. Noch zwei<br />
weitere Ereignisse haben sich mir fest<br />
eingeprägt. Das wäre zuallererst die<br />
Aufrechterhaltung der Wasserversorgung<br />
auf der Hallig <strong>Nord</strong>erstrandischmoor<br />
im „Jahrhundertwinter“ 1978/79,<br />
wo im Bereich des Wattenmeeres die<br />
Leitungen eingefroren waren und wir<br />
immer wieder versuchten, die Rohre<br />
freizubekommen. Und zweitens übernahm<br />
ich 1986 die Bauleitung der<br />
zweiten Einspeiseleitung für die Insel<br />
Pellworm. 2000 sagte ich dem schönen<br />
Berufsleben schließlich Valet.
seIte 6<br />
WZ: Wie stehen Sie zu erneuerbaren<br />
Energien?<br />
Ingbert Liebing: Der Koalitionsvertrag<br />
der neuen christlich-liberalen<br />
Koalition bekennt sich ausdrücklich<br />
zum Ausbau der erneuerbaren Energien.<br />
Wir wollen den Weg in das<br />
regenerative Zeitalter gehen. Dabei<br />
legen wir im Sinne der Verbraucherinnen<br />
und Verbraucher großen Wert<br />
darauf, die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der neuen Energietechnologien stetig<br />
zu verbessern. In unserer Region<br />
wissen wir auch um den wirtschaftlichen<br />
Wert dieser Branche. Um unsere<br />
anspruchsvollen Ausbauziele zu<br />
erreichen, brauchen wir den Ausbau<br />
der Stromnetze und bessere Speichertechnologien.<br />
Wird das CCS-Gesetz kommen?<br />
Der Bundesumwelt- und der Wirtschaftsminister<br />
haben gemeinsam<br />
den Auftrag erhalten, einen CCS-<br />
Gesetzentwurf zu erarbeiten. Bislang<br />
liegt kein Entwurf vor – ich bin mir<br />
aber sicher, dies ist nur noch eine<br />
Aktuelles<br />
CCs-technologie bleibt umstritten<br />
Die Wasserzeitung sprach mit Ingbert Liebing, Bundestagsab geordneter der CDU für<br />
<strong>Nord</strong> friesland-Dithmarschen <strong>Nord</strong><br />
Bundesumweltminister Norbert<br />
Röttgen (CDU) will unterirdische<br />
CO 2<br />
-Speicher nicht gegen den Willen<br />
der örtlichen Bevölkerung durchsetzen.<br />
Das erklärte der Minister am<br />
24. März offiziell in Berlin. Realisiert<br />
werden soll das im Herbst kommende<br />
CCS-Gesetz nur dort, „wo es<br />
auch regionale Akzeptanz findet“.<br />
Frage der Zeit. Derzeit gehe ich davon<br />
aus, dass es im Herbst <strong>2010</strong> zu<br />
intensiven Gesetzesberatungen im<br />
Deutschen Bundestag kommen wird<br />
und das Verfahren bis zum Ende des<br />
Jahres abgeschlossen ist.<br />
Ist der Wasserversorgung Vorrang<br />
einzuräumen?<br />
Ja, auf jeden Fall. Ohne Wasser gibt<br />
es kein Leben. Der Trinkwasserschutz<br />
ist in Deutschland deshalb sehr hoch.<br />
Das neue Wasserhaushaltsgesetz,<br />
welches am 1. März <strong>2010</strong> in Kraft<br />
trat, trägt dem Rechnung. Es sind<br />
ausreichend Instrumente vorhanden,<br />
um Wasserschutzgebiete weiterhin<br />
Nicht gegen den Willen der Bevölkerung!<br />
So könnte der Windpark von Butendiek, etwa<br />
34 Kilometer westlich von der Insel Sylt in der<br />
<strong>Nord</strong>see, im Jahre 2012 aussehen. Dann sollen<br />
hier, außer Sichtweite vom Land aus und ohne<br />
Behinderungen für Fischerei und Seefahrt,<br />
insgesamt 80 Windräder über 280 MW Strom<br />
erzeugen. Im Gegensatz zur CCS-Technologie<br />
findet die Entwicklung erneuerbarer Energieformen<br />
in der Region großen Rückhalt. In<br />
Schleswig-Holstein werden zurzeit bereits<br />
16,5 % des Strombedarfs mit Windenergieanlagen<br />
gedeckt. Auf See (offshore) bieten sich<br />
große Flächen und der Wind weht stetig.<br />
Der Kieler Wirtschaftsminister Jost<br />
de Jager (CDU) begrüßte die Aussagen<br />
Röttgens. Das Land Schleswig-Holstein<br />
werde dafür kämpfen,<br />
„dass die Entscheidungsbefugnisse<br />
in dieser Frage allein auf die Länder<br />
übertragen werden.“<br />
Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> und<br />
der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen<br />
meinen: Durch CCS<br />
darf die Qualität des Grundwassers<br />
weder direkt noch indirekt gefährdet<br />
werden. Diese Meinung vertreten<br />
auch andere norddeutsche Wasserversorger<br />
aus Schleswig-Holstein,<br />
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen,<br />
die am 7. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> in<br />
Wittenburg über CCS beraten haben.<br />
Rückenwind für<br />
Bürgerwindpark<br />
Foto: Bundesverband WindEnergie e. V.<br />
Das Herausragende an dem Projekt Butendiek<br />
ist, dass sich die Bürger daran beteiligen können.<br />
Ab einer Mindesteinlage von 250 Euro (ein<br />
Anteil) steht der Einstieg in das Vorhaben allen<br />
Interessenten aus der Region offen. Hier bündeln<br />
sich viele Vorteile: Die Bürger sind Mitinhaber<br />
und haben Mitspracherecht; das eingesetzte<br />
Geld kann mit Rendite zurückverdient werden;<br />
die Region wird industriell entwickelt; Wertschöpfung<br />
und Geldzirkulation bleiben vor Ort.<br />
Baubeginn soll 2011 sein.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.butendiek.de<br />
besonders zu schützen. Abspeicherung<br />
von CO 2<br />
darf – egal wo – das<br />
Trinkwasser nicht gefährden.<br />
Wie kann man sichern, dass das<br />
Land Schleswig-Holstein das<br />
letzte Wort sprechen darf?<br />
Grundsätzlich bin ich der Ansicht,<br />
dass die Bundesländer über eine<br />
Raumordnungsklausel die Kompetenz<br />
erhalten sollten, ggf. auch CO 2<br />
-<br />
Speicher in ihrem Land auszuschließen.<br />
Ob dies durchzusetzen ist, ist<br />
offen. Das geplante Gesetz soll nach<br />
Aussagen unseres Bundesumweltministers<br />
der Akzeptanz eine hohe Bedeutung<br />
beimessen und sich auf ein<br />
Werner Asmus (64), Bürgermeister<br />
von Wallsbüll und<br />
Sprecher der Bürgerinitiative<br />
gegen ein CO 2<br />
Endlager<br />
unter der Geest, wurde von<br />
den Lesern der SHZ mit<br />
2.020 Stimmen zum „Menschen<br />
des Jahres 2009“ gewählt.<br />
Anlass für die Wasserzeitung<br />
das Gespräch mit<br />
dem Volkstribun gegen CCS<br />
zu suchen.<br />
WZ: Warum haben Sie sich an die<br />
Spitze des Widerstandes gegen<br />
ein CO 2<br />
-Endlager unter der Geest<br />
gestellt?<br />
Werner Asmus: Weil ich die menschenverachtende<br />
Vorgehensweise<br />
von RWE nicht hinnehmen wollte.<br />
Ich liebe meine Enkelkinder und ich<br />
möchte nicht, dass sie auf einer<br />
unterirdischen Deponie mit allen<br />
daraus resultierenden Gefahren aufwachsen.<br />
Wie konnten Sie so schnell so<br />
viele Menschen für die Bürgerinitiative<br />
mobilisieren und 80.000<br />
Protestunterschriften sammeln?<br />
Indem wir den Bürgerinnen und<br />
Bürgern hier die Tragweite des Vorhabens,<br />
CO 2<br />
unter der Geest zu verpressen,<br />
deutlich gemacht haben.<br />
Und es gelang uns, die Medien einzuschalten.<br />
Sie müssen auch wissen,<br />
dass die Menschen hier oben sehr<br />
wachsam sind. So fand ich für die<br />
Bürgerinitiative schnell Mitstreiter.<br />
Wir begannen bei null, warfen erstmal<br />
jeder 500 Euro in die Kasse und<br />
WAsseRZeItuNG<br />
begrenztes Demonstrationsprojekt in<br />
Brandenburg beschränken, das dort<br />
im Landtag von Regierung und Opposition<br />
gewollt ist. Dafür sind aber<br />
noch rechtliche Fragen zu klären.<br />
Was können Bürger gegen das<br />
CCS-Gesetz unternehmen?<br />
Der Protest hier in der Region hat im<br />
vergangenen Jahr viel bewirkt. Es gilt<br />
auch weiterhin, wachsam zu bleiben.<br />
Es bleibt wichtig, kontinuierlich auf<br />
bundespolitischer Ebene sachliche<br />
Überzeugungsarbeit zu leisten, dass<br />
uns ein CO 2<br />
-Endlager erspart bleibt.<br />
Dafür setze ich mich wie bisher in Berlin<br />
im Interesse unserer Region ein.<br />
Werner Asmus wurde<br />
zum Volkstribun und<br />
„Mensch 2009“<br />
Foto: Dewanger<br />
dann nahm das Unternehmen seinen<br />
Lauf.<br />
Ist die Kuh jetzt vom Eis oder<br />
muss man ein kontrollierendes<br />
Auge behalten?<br />
Mich irritiert die neue Grundwasserverordnung,<br />
an der in Berlin gestrickt<br />
wird. Da werden nämlich in den<br />
§§ 52–54 unter dem Mantel des „Allgemeinwohls“<br />
Ausnahmetat bestände<br />
geschaffen. Wenn man Klima zum höheren<br />
Allgemeinwohl erklärt, könnte<br />
man den Grundwasserschutz aushebeln.<br />
Da heißt es also: Obacht! In<br />
Schleswig-Holstein wird es aber mit<br />
der jetzigen Landesregierung kein<br />
CO 2<br />
-Endlager geben! Da bin ich mir<br />
sicher, da hängt das Schicksal des<br />
Ministerpräsidenten dran.<br />
Jetzt haben Sie ja wieder mehr<br />
Freizeit – was treiben Sie denn da?<br />
Als ehrenamtlicher Bürgermeister habe<br />
ich gut zu tun und dann gehe ich<br />
auch gern auf die Jagd. Da hat man<br />
Zeit zum Nachdenken.<br />
<strong>April</strong> <strong>2010</strong> DOKUMENTATiON<br />
SEiTE 7<br />
W<br />
tiere am wasser<br />
en hat nicht schon nachts<br />
das an griffs lus ti ge Surren<br />
ei ner Mü cke um den<br />
Schlaf ge bracht? Wer hat nicht erlebt,<br />
wie die Gar ten par ty an lau en<br />
Som mer aben den sich in ein wüs tes<br />
Hau en und Ste chen ver wan delt, um<br />
der Pla ge geis ter Herr zu wer den?<br />
Denn sie zäh len nicht ge ra de zu den<br />
Freun den der Men schen und der<br />
an de ren Warm blüt er, doch als Nah<br />
insekten<br />
Mach die Mü cke, Mü cke!?<br />
„Vam pir weib chen“ im Blut rausch<br />
rungs beu te für grö ße re In sek ten,<br />
Fi sche, Lur che und klei ne re Vö gel<br />
kann es ei gent lich nicht ge nug Mücken<br />
ge ben.<br />
Die In sek ten wer den 5 bis 6 mm<br />
lang, sind braungrau und le gen die<br />
Ei er als schwim men de Schiff chen<br />
auf dem Was ser bzw. an feuch ten<br />
Stel len ab. Für die Ent wick lung der<br />
Lar ven und Pup pen ist Was ser die<br />
Grund vo raus set zung. In Schleswig<br />
Vor und nach dem Mückenstich<br />
Für ih ren Nach wuchs – die Entwick<br />
lung der Ei er und die Ei ab la ge<br />
– brau chen die Mü cken weib chen<br />
ei ne Men ge Ener gie und Kraft: Deshalb<br />
sind sie stän dig auf Su che nach<br />
nähr stoff rei chem Blut und ste chen<br />
mehr fach, was das Zeug hält. Für die<br />
Or tung der Op fer die nen den klei nen<br />
Vam pi ren Körperwärme, aus ge at meter<br />
Wasserdampf und Koh len dio xid<br />
sowie Schweißgeruch. Die Männchen<br />
da ge gen be gnü gen sich mit<br />
Blü ten und Pflan zen säf ten.<br />
Die weibliche Stechmücke sticht<br />
vor allem während der Dämmerung.<br />
Nach der Landung auf der Haut<br />
wartet sie einige Sekunden, um sicherzugehen,<br />
dass sie nicht bemerkt<br />
wurde. Dann werden die Enden der<br />
Unterlippe aufgesetzt und ihre<br />
Mundwerkzeuge tief eingebohrt. Sie<br />
saugt Blut auf, wobei ihr Hinterleib<br />
anschwillt. Durch den in die Wunde<br />
abgegebenen Speichel wird das Blut<br />
Neben dem Essen von Knoblauch,<br />
um Mücken fern zu halten, bietet<br />
auch die Industrie viele Mittel<br />
gegen die Blutsauger an.<br />
Holstein gibt es um die 40 Ar ten, die<br />
drei Haupt grup pen zu ge ord net werden<br />
kön nen. Bei den Haus mü cken<br />
über win tert die letzte Generation als<br />
aus ge wach se ne Tie re an ge schütz ten<br />
Or ten und nach dem ers ten stär kenden<br />
Blut me nü le gen die Weib chen<br />
200 bis 400 Ei er. Da bei dient selbst<br />
die kleins te Was ser la che als Kin derstu<br />
be. Die Lar ven ent wick lung dau ert<br />
zwei bis drei Wo chen. Und nach ei ner<br />
des Opfers verflüssigt und ein Gerinnen<br />
verhindert, damit ihr Rüssel<br />
während der Nahrungsaufnahme<br />
nicht verstopft.<br />
Um Mücken fern zu halten, eignen<br />
sich laut Stiftung Warentest<br />
(Packungsgröße, unverbindliche<br />
Preisempfehlung): Autan Family<br />
Creme (50 ml; 4,80 Euro), Autan<br />
Active Stift (50 ml; 7,75 Euro),<br />
Autan Active Lotion (100 ml; 7,75<br />
Euro), Autan Family Milch (100 ml;<br />
7,75 Euro)<br />
Gegen Juckreiz und Entzündungen<br />
nach Stichen empfiehlt Stiftung<br />
Warentest (Packungsgröße;<br />
unverbindliche Preisempfehlung):<br />
Hydro Heumann Hautcreme 0,25 %<br />
(20 g; 5,11 Euro), Hydrocortison<br />
Hexal, 0,25 % Creme (20g; 5,11<br />
Euro), Hydrocutan Salbe mild (20 g;<br />
5,82 Euro)<br />
Pup pen ru he von zwei bis vier Ta gen<br />
schlüp fen ge schlechts rei fe Tie re,<br />
die dann nach höchs tens 20 Ta gen<br />
ihr Le ben be en den. Bei den Waldund<br />
Wie sen mü cken über win tern<br />
die Ei er. Die Wald mü cke zählt zu<br />
den Früh jahrs brü tern und sie nut zen<br />
Wald tüm pel aus Schmelz und Regen<br />
was ser, um sich in Ma ssen zu<br />
ver meh ren. Be son ders En de Ap ril bis<br />
An fang Mai tre ten sie in Schwär men<br />
auf. Die Luft feuch te der Mor genund<br />
Abend stun den führt zu er höh ter<br />
Ste ch lust. Frost im Win ter de zi miert<br />
diese Art nicht, son dern hilft die<br />
Schlupf hem mung der Ei er zu ver mindern.<br />
An son ni gen Tüm peln, Gru ben<br />
und Fluss nie de run gen sind die Wiesen<br />
mü cken zu Hau se. Ih re Be sonder<br />
heit: Auch bei Son nen schein ist<br />
kein „Warm blü ter“ vor Ste chat ta cken<br />
si cher. Da bei güns ti gen Tem pe ra turen<br />
in ner halb von zehn Ta gen die<br />
neue Ge ne ra ti on he ranwächst, tre ten<br />
dann „Mü cken wol ken“ auf.<br />
Im pres sum<br />
He raus ge ber:<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>,<br />
Oeversee; <strong>Wasserverband</strong><br />
<strong>Nord</strong>erdithmarschen, Heide;<br />
Wasserversorger Angeln<br />
Re dak ti on und Ver lag:<br />
Spree-pr, Niederlassung <strong>Nord</strong>,<br />
OT Degtow, Dorfstr. 4,<br />
23936 Grevesmühlen<br />
Telefon: 03881 755544<br />
e-Mail: alex.schmeichel@spree-pr.de<br />
www.spree-pr.com<br />
Blaugrüne Mosaikjungfer<br />
(Aeshna cyanea)<br />
Le bens raum:<br />
je des Ge wäs ser<br />
Nah rung:<br />
Mü cken, Brem sen<br />
Vorkommen:<br />
In SchleswigHolstein häufig<br />
in allen stehenden Gewässern*<br />
Wasserläufer<br />
(Gerris lacustris)<br />
Le bens raum:<br />
Tüm pel und Tei che<br />
Nah rung:<br />
to te In sek ten, die auf der<br />
Was ser ober flä che trei ben<br />
Vorkommen:<br />
in SchleswigHolstein häufig*<br />
Wasserskorpion<br />
(Nepa<br />
cinerea)<br />
Le bens raum:<br />
am schlam mi gen<br />
Grund von sehr<br />
fla chen Ge wäs sern<br />
Nah rung:<br />
Kaul quap pen, In sek ten lar ven<br />
Vorkommen:<br />
in SchleswigHolstein in<br />
eutrophen StillwasserTypen*<br />
Gelbrandkäfer<br />
(Dytiscus<br />
marginalis)<br />
Le bens raum:<br />
ste hen de Ge wäs ser<br />
al ler Art<br />
Nah rung:<br />
Lar ven ver schie de ner Was serin<br />
sek ten, kleine Fische<br />
Vorkommen:<br />
häufig in allen stehenden<br />
Gewässertypen im Lande*<br />
* Angaben zum Vorkommen<br />
vom Ministerium für Landwirtschaft,<br />
Umwelt und ländliche<br />
Räume Schleswig-Holstein<br />
V. i. S. d. P.: Thomas Marquard<br />
Re dak tion: Alexander Schmeichel<br />
Mitarbeit: Gaby Schütze, Jörg<br />
Schütze, Dr. peter Viertel<br />
Fo tos: G. Schütze, J. Schütze,<br />
H. petsch, A. Schmeichel, Archiv<br />
Layout: Spree-pr,<br />
Johannes Wollschläger<br />
Druck: <strong>Nord</strong>ost-Druck GmbH & Co.<br />
KG Neubrandenburg
WasserZeitung • 1/<strong>2010</strong> umschau<br />
seite 8<br />
auf einem Bein kann man nicht stehen<br />
Gemeinde Pellworm trat am 1. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> auch abwasserseitig in den <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> ein<br />
B<br />
ereits seit 47 Jahren ist die<br />
Gemeinde Pellworm Mitglied<br />
im <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>. Und<br />
seit genau 46 Jahren beziehen die<br />
Inselbewohner ihr Trinkwasser aus<br />
dem zentralen Wasserwerk Oeversee.<br />
Nun, nach beinahe einem halben<br />
Jahrhundert, übertrug die Gemeinde<br />
dem Verband auch die Aufgaben der<br />
Abwasserentsorgung. Ausgerechnet<br />
zum 1. <strong>April</strong>. Aber ein Scherz ist das<br />
keineswegs.<br />
liefert. Endgültig entschieden hatten<br />
sich die Gemeindevertreter am 4.<br />
März <strong>2010</strong>. Nach umfassender Beratung<br />
sprach sich das 11-köpfige<br />
Gremium einstimmig dafür aus, die<br />
Aufgabe der Abwasserbeseitigung<br />
dem WVN zu übertragen.<br />
Was verspricht sich die Gemeinde von<br />
dieser Weichenstellung? „Langfristig“,<br />
so Bürgermeister Klaus Jensen, „sollen<br />
alle Bürgerinnen und Bürger auch<br />
vom abwassertechnischen Know-how<br />
des Verbandes profitieren, der obendrein<br />
in Kooperation mit der Wassersparte<br />
vor Ort Synergien erschließen<br />
kann.“ Jederzeit wird gewährleistet,<br />
dass die hygienischen Belange der<br />
Trinkwasserversorgung zu 100 Prozent<br />
gesichert sind. Mit der Übertragung<br />
ist der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> nun<br />
Komplettdienstleister rund ums Wasser<br />
und Abwasser, da beispielsweise<br />
auch die Abfuhr des Fäkalschlamms<br />
aus Hauskläranlagen in das Aufgabengebiet<br />
fällt.<br />
Das Mengenentgelt für die Schmutzwasserbeseitigung<br />
bleibt unverändert<br />
bei 2,57 Euro pro Kubikmeter. Das ist<br />
die positive Nachricht. Nicht ganz so<br />
gut sieht‘s beim monatlichen Grundpreis<br />
aus. Der musste auf 23,30 Euro<br />
angehoben werden. Jensen: „Diese<br />
Anpassung war erforderlich, um<br />
beim Abwasser die Kosten decken<br />
zu können. Die Erhöhung wäre im Übrigen<br />
auch gekommen, wenn unsere<br />
Gemeinde die Abwasserentsorgung<br />
weiter in eigener Regie fortgeführt<br />
hätte.“ Eine Sache bleibt bei der Entsorgung<br />
dann doch beim Alten. Karl-<br />
Heinz Clausen, allgemein nur „Bube“<br />
gerufen, wird weiterhin der Fachmann<br />
fürs Abwasser sein. Er ist seit dem<br />
1. <strong>April</strong> <strong>2010</strong> Mitarbeiter des WVN.<br />
Verträge in<br />
trockenen Tüchern<br />
In den zurückliegenden Monaten hatte<br />
sich die Pellwormer Gemeindevertretung<br />
intensiv mit der Organisation<br />
der Abwasserbeseitigung befasst.<br />
Ziel war es, diese hoheitliche kommunale<br />
Aufgabe in zuverlässige<br />
Hände zu legen. Und was (oder wer)<br />
läge da näher als der <strong>Wasserverband</strong><br />
<strong>Nord</strong>? Der bestätigt seine Leistungsfähigkeit<br />
seit 1964 schließlich Tag<br />
für Tag, indem er zuverlässig und<br />
qualitativ hochwertig das Lebensmittel<br />
Nummer 1 über die beinahe 80 km<br />
langen Hauptleitungen von Oeversee<br />
zu den Verbrauchern nach Pellworm<br />
D<br />
ie Trinkwasserkonzeption<br />
des WVN dokumentiert:<br />
Aus Sicht des Rohwasserangebots,<br />
der Wasseraufbereitungskapazitäten<br />
und der -verteileranlagen<br />
bestehen für das gesamte Verbandsgebiet<br />
keine Bedenken hinsichtlich<br />
der stabilen Versorgung mit Trinkwasser.<br />
„Das kostbare Nass“, erklärt<br />
Peter Klerck, Technischer Leiter<br />
beim Verband, „wird über ein rund<br />
1.600 km langes Trinkwassernetz zu<br />
den Abnehmern befördert – selbst bis<br />
auf die von Oeversee 95 km entfernte<br />
(Leitungslänge) Hallig Süderoog.“<br />
Dass den Pellwormer und Süderooger<br />
Verbraucherinnen und Verbrauchern<br />
das Wasser auch ständig mit dem<br />
nötigen Druck zur Verfügung steht,<br />
dafür sorgt die Druckerhöhungsanlage<br />
(DEA) auf Pellworm. Klerck:<br />
„Unser <strong>Wasserverband</strong> hat die aus<br />
den 60er Jahren stammende Anlage<br />
2008/2009 modernisiert.“ Damals<br />
erneuerten die Fachleute die Anlagen-<br />
und Elektrotechnik. Klerck: „Die<br />
komplette Verrohrung, die Pumpen,<br />
Schaltschränke und Steuerung wurden<br />
ausgewechselt.“ Weiterhin erhielt<br />
die Station einen sogenannten<br />
Bypassbetrieb. Das bedeutet nichts<br />
anderes, als dass bei Stromausfall<br />
oder größeren Havarien die DEA umfahren<br />
und die <strong>Nord</strong>seeinsel direkt<br />
vom Festland aus über die Druckerhöhungsanlage<br />
Bredstedt versorgt<br />
werden kann – sozusagen eine zusätzliche<br />
„Lebensversicherung“ für<br />
die Inselbewohner.<br />
Druckerhöhungsanlage Pellworm<br />
Für den „Pep“ in den rohren<br />
Pellwormer Druckerhöhungsanlage (DEA) garantiert steten Wasserfluss /<br />
DEA Bredstedt als zusätzliche „Lebensversicherung“ für die <strong>Nord</strong>seeinsel<br />
Zentrale Kläranlage Pellworm<br />
Eindrucksvolle Luftaufnahme der <strong>Nord</strong>seeinsel Pellworm – fotografiert von Werner Köster.<br />
Die Druckerhöhungsanlage auf Pellworm sorgt für den nötigen Wasserdruck in den Leitungen.<br />
Historie<br />
Im Juni 1966 feierte man Richtfest<br />
am Moordamm. Die Firma Paul I.<br />
Peters baute dort für den WV <strong>Nord</strong><br />
die vollautomatische Druckstation.<br />
Kostenpunkt: 800.000 DM. Sie dient<br />
dazu, dass auf Pellworm ein Wasserdruck<br />
von drei bis vier bar vorhanden<br />
ist. Die Anlage umfasste damals<br />
zwei Reinwasserbehälter mit<br />
je 400 m 3 Fassungsvermögen. Damit<br />
konnte Pellworm, wenn einmal die<br />
Wasserzufuhr unterbrochen war,<br />
etwa fünf bis sechs Tage versorgt<br />
werden – wenn alle Haushalte sparsam<br />
mit Wasser umgingen.<br />
Zentrale Kläranlage Pellworm.<br />
DEA Pellworm.<br />
preisrätsel<br />
• Den wievielten Brunnen<br />
lässt der WVN bohren?<br />
• Wann ging Wilhelm Behnemann<br />
in den Ruhestand?<br />
• An welchem Tag übertrug<br />
Pellworm dem WVN die<br />
Abwasserentsorgung?<br />
Zu gewinnen gibt es:<br />
125, 75 und 50 Euro.<br />
Lösungen per Post oder E-Mail an<br />
den WVN – siehe „Kurzer Draht“<br />
unten. Stichwort: Preisrätsel<br />
Einsendeschluss: 15. 05. <strong>2010</strong><br />
Gewinner 2/2009:<br />
1. Wolfgang Tiersch, Großsolt<br />
2. Thomas Kraft, Meyn<br />
3. Jan Clasen, Haselund<br />
kurzer draht<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong><br />
Wanderuper Weg 23<br />
24988 Oeversee<br />
Tel.: 04638 8955-0<br />
Fax: 04638 8955-55<br />
E-Mail: info@wv-nord.de<br />
www.wv-nord.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag bis Donnerstag:<br />
08.30 –12.30 Uhr und<br />
13.30 –16.00 Uhr<br />
Freitag: 08.30 –12.00 Uhr