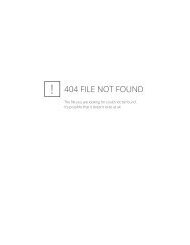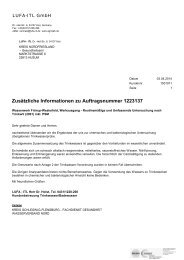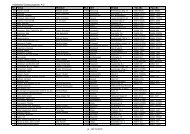1,35 € 450 - Wasserverband Nord
1,35 € 450 - Wasserverband Nord
1,35 € 450 - Wasserverband Nord
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
InformatIonen für dIe Kunden des WasserVerbandes nord<br />
Blaues Band<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
in alten Zeiten wurde Wasser als<br />
eines der vier Elemente angesehen,<br />
aus denen die Welt geschaffen ist.<br />
Und so ganz falsch lagen unsere Urahnen<br />
damit auch nicht. Wasser ist<br />
für uns mit Abstand das wichtigste<br />
Lebensmittel. Dementsprechend<br />
kommt dem Wasser und der nachhaltigen<br />
Wasserbewirtschaftung<br />
eine sehr große Bedeutung zu. Das<br />
schließt den Schutz des Lebensmittels<br />
Wasser und die Entwicklung<br />
des Lebensraums Gewässer ein und<br />
bedeutet auch den Schutz des Menschen<br />
vor den Gefahren des Wassers.<br />
Weltweit beobachten wir eine<br />
Zunahme extremer Wetterereignisse.<br />
Klimawandel ist also keine skeptische<br />
Prognose mehr, sondern Realität. Die<br />
sintflutartigen Regenfälle in vielen<br />
Teilen Deutschlands sprechen – leider<br />
– für sich. Die Wasserversorgung<br />
ist eine Kernaufgabe der kommunalen<br />
Daseinsvorsorge. Bei den Wasserverbänden<br />
in Schleswig-Holstein ist unser<br />
Wasser gut aufgehoben.<br />
Der <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> versorgt<br />
Sie zuverlässig mit erstklassigem<br />
Trinkwasser, das es im Oeverseer<br />
Grundwasser noch reichlich und in<br />
bester Qualität gibt. Das naturbelassene<br />
Lebensmittel erreicht Sie<br />
rund um die Uhr, im Sommer wie<br />
im Winter. In vielen Gemeinden ist<br />
der WV <strong>Nord</strong> auch für die Abwasserbeseitigung<br />
zuständig. Damit<br />
schließt sich der Kreislauf, denn in<br />
dieser Doppelfunktion ist die gründliche<br />
Reinigung des Abwassers vor<br />
der Abgabe an die Natur sein ureigenstes<br />
Interesse. Der Verband wird<br />
auch künftig im Kreis Schleswig-<br />
Flensburg mit meinem Nachfolger,<br />
Herrn Dr. Wolfgang Buschmann,<br />
einen verlässlichen Partner haben.<br />
Dr. Buschmann wird ihn bei der Erfüllung<br />
seiner wichtigen Aufgaben<br />
für unser Gemeinwesen angemessen<br />
unterstützen.<br />
Ich wünsche Ihnen und uns, dass uns<br />
niemand unser Wasser trübt.<br />
Ihr Bogislav-Tessen v. Gerlach,<br />
Landrat des Kreises<br />
Schleswig-Flensburg<br />
ausgabe oeVersee<br />
6. Jahrgang nr. 1<br />
aprIl 2012<br />
alles bio in der schlammtrocknung<br />
Landwirt<br />
Hans-Willi<br />
Brümmer wollte die<br />
Wärme, die bei der Stromerzeugung<br />
per Biogas entsteht,<br />
eigentlich nach Bredstedt<br />
schicken. Auf halbem Weg<br />
liegt aber die Kläranlage<br />
und mit den Fachleuten<br />
war er sich schnell handelseinig.<br />
Es gibt nur Vorteile<br />
für Mensch und Natur.<br />
Festmist von Mutterkühen und aus der<br />
Buntmast, gemixt mit Gras- und Maissilage<br />
– das sind die guten Zutaten, mit<br />
denen Landwirt Hans-Willi Brümmer<br />
in Sophien-Magdalenen Koog Biogas<br />
produziert.<br />
Die Die bei der<br />
Umwandlung<br />
zu Strom entstehende<br />
Wärme wollte er geschickt nutzen<br />
und fand auf der nahen Kläranlage<br />
beste Partner.<br />
Abwassermeister Martin Morzik<br />
suchte ohnehin eine mittelfristige<br />
Lösung für die Schlammbehandlung.<br />
2013 läuft ein Projekt mit Landwirten<br />
aus, die bisher die Hälfte des nassen<br />
Schlamms abnahmen. Der <strong>Wasserverband</strong><br />
<strong>Nord</strong> hätte über Investitionen<br />
in die Kapazitätsverdopplung der<br />
Schlammtrocknung entscheiden müssen.<br />
Bisher sorgen nach der maschinellen<br />
Entwässerung nur Sonne und<br />
Wind sowie ein computergesteuertes<br />
Fahrzeug energiesparend dafür, dass<br />
landpartie museumsort Kupfermühle in harrislee ist lohnendes Ziel für kleine Zeitreisen<br />
Die reizvolle Architektur und Landschaft<br />
können das ganze Jahr auf<br />
eigene Faust erkundet werden. Wer<br />
jedoch das Innenleben des Museumsortes<br />
Kupfermühle sehen möchte, der<br />
kann das ab dem 16. Mai wieder tun,<br />
oder sich mit einer Gruppe in der Ne-<br />
bensaison an- melden.<br />
Das Wasserrad im Museumsort Kupfermühle dreht sich wieder<br />
und setzt das Hammerwerk in Bewegung. Besucher erleben in<br />
Führungen, wie hier früher das Material bearbeitet wurde.<br />
Die Bredstedter Kläranlage in einer Übersicht. Das Blockheizkraftwerk<br />
links speist den Strom ins Netz und die Wärme in die Betriebsgebäude<br />
sowie die Schlammtrocknung (oben rechts).<br />
Landwirt Hans-Willi Brümmer (li.) und Abwassermeister Martin Morzik<br />
stehen in engem Kontakt und kontrollieren das gemeinsame Projekt.<br />
sich das Volumen des Schlamms aus<br />
der Abwasserreinigung verringert.<br />
Wenn nun ab Mai die Wärme aus<br />
dem Blockheizkraftwerk zugeführt<br />
wird, verkürzt sich der Trocknungszeitraum<br />
erheblich – von 1 ½ Monaten<br />
auf voraussichtlich 1 ½ Wochen!<br />
„Und das nur mit ein paar Leitungen,<br />
einigen Gebläsen und günstiger Wärme“,<br />
freut sich Martin Morzik. Schon<br />
jetzt wird das Betriebsgebäude geheizt.<br />
Der Vorteil für Landwirt Brümmer:<br />
Er erhält den Kraft-Wärme-Kopplungs-<br />
Bonus. „Ein tolles Beispiel für klugen<br />
Umweltschutz vor Ort“, findet Martin<br />
Morzik. Er weiß, dass Biogasanlagen<br />
mit Blick auf den Grundwasserschutz<br />
umstritten sind. Daher sei es wichtig,<br />
sie rücksichtsvoll zu betreiben. Landwirt<br />
Brümmer stellt sich dieser Aufgabe.<br />
Abwassermeister Martin Morzik ist<br />
An dem geschichtsträchtigen Standort<br />
in Harrislee befinden sich in Sichtweite<br />
und fußläufiger Umgebung das Kobbermølle<br />
Museum und das Industriemuseum.<br />
Ein Verein kümmert sich um<br />
das Areal, dessen Nutzung bis ins 17.<br />
Jahrhundert zurückreicht. Die Exponate<br />
der „Gisela und Bodo Daetz Stiftung“<br />
geben einen Einblick in die Geschichte<br />
der Fabrik und die Lebensumstände<br />
der Arbeiter aus vier Jahrhunderten.<br />
Besondere Anziehungspunkte<br />
in den beiden Fabrikhallen sind die<br />
funktionsfähige Dampfmaschine sowie<br />
das Hammerwerk, das nach seiner<br />
Rekonstruktion 2008 heute wieder eindrucksvoll<br />
die Kraft des Wassers unter<br />
Beweis stellt. Besondere Aktionen gibt<br />
sehr an der effektiven Schlammtrocknung<br />
gelegen. Schließlich gehe es<br />
nicht um den Selbstzweck. Indem der<br />
feuchte Schlamm zu trockenem Granulat<br />
wird, verringert sich der Aufwand,<br />
den bei Landwirten beliebten phosphathaltigen<br />
Dünger auf die Äcker<br />
auszufahren. Die Bauern brauchen<br />
weniger Fuhren und können statt Güllewagen<br />
nun Düngerstreuer einsetzen.<br />
„Das spart Zeit, Benzin, schont Straßen<br />
und verbessert die CO 2 -Bilanz<br />
erheblich“, zählt Morzik die Vorteile<br />
auf. Nicht zuletzt profitieren natürlich<br />
die Kunden des WV <strong>Nord</strong>. Der<br />
Verband stärkt seine Partner in der<br />
Region, schont die Umwelt und letztlich<br />
die Portemonnaies, weil eine gut<br />
funktionierende Verfahrenstechnik<br />
ein wichtiger Pfeiler für stabile Abwasserpreise<br />
ist.<br />
es zusätzlich zu den Öffnungszeiten am<br />
20. Mai (11–17 Uhr) anlässlich des Internationalen<br />
Museumstages und am<br />
28. Mai (10–17 Uhr) zum Deutschen<br />
Mühlentag.<br />
Öffnungszeiten:<br />
16. Mai – 18. Oktober:<br />
Mi./Do.: 14.30 –17 Uhr<br />
Führungen um 15 Uhr<br />
Eintritt:<br />
Erwachsene 4 <strong>€</strong>, Schüler 2 <strong>€</strong><br />
Kontakt:<br />
Museumsort Kupfermühle gGmbH<br />
Zur Kupfermühle 17 in Harrislee<br />
Telefon: 0461 4077125<br />
www.industriemuseum-<br />
kupfermuehle.de
seIte 2 Aktuelles<br />
WAsseRZeItuNG<br />
CCS – es ist noch nichts entschieden<br />
Verschiedene Varianten immer noch denkbar<br />
Der Ball ist noch im Spiel. Entschieden<br />
ist noch nichts. Die<br />
Hoffnungen sind noch groß.<br />
Sowohl von den Befürwortern<br />
der Kohlendioxidverpressung<br />
als auch von den CCS-<br />
Gegnern.<br />
Ende März sagte EU Energiekommissar<br />
Oettinger im Interview mit Dow Jones<br />
News: „Wir untersuchen gerade, ob<br />
wir einen Vorschlag entwickeln, zu<br />
welchem Zeitpunkt CCS für neue, aber<br />
auch für alte Kraftwerke verbindlich<br />
werden sollte.“<br />
In der Zwischenzeit hängt der Deutsche<br />
Entwurf des CCS-Gesetzes im Vermittlungsausschuss<br />
des Bundesrates fest.<br />
Nach vier ergebnislosen Beratungen<br />
kristallisieren sich drei Varianten<br />
heraus:<br />
1. Entwurf der Bundesregierung mit<br />
Länderklausel, d. h. ein weitgehender<br />
Rechtsrahmen für CCS allerdings mit<br />
einer Ausstiegsoption für einzelne<br />
Bundesländer (findet Zuspruch in<br />
Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen,Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Sachsen-Anhalt).<br />
2. Entwurf der Bundesregierung ohne<br />
Länderklausel, d. h. alle Länder wären<br />
verpflichtet CCS zuzulassen (Favorit<br />
in Brandenburg, Hamburg, Sachsen).<br />
3. Österreichische Lösung, d. h.<br />
CCS-Verbot für großtechnische Anwendungen,<br />
zugleich aber Erlaubnis<br />
für Forschungsanlagen bis 100.000<br />
Tonnen pro Speicher. B90/DIE GRÜ-<br />
NEN möchten diese Lösung noch<br />
weiter Einschränken auf so genannte<br />
prozessbedingte CO 2 -Emissionen.<br />
(Baden-Württemberg, Bremen, <strong>Nord</strong>rhein-Westfalen).<br />
Die Bürgerinitiativen drängen dagegen<br />
weiterhin auf ein konsequentes<br />
CCS-Verbotsgesetz ohne die Option<br />
eines „schmalen Forschungsgesetzes“.<br />
Sie haben diese Position am 21. März<br />
1,<strong>35</strong> <strong>€</strong> <strong>450</strong>,- <strong>€</strong><br />
Stoff zum<br />
Nachdenken<br />
Teil 1<br />
auf einer Anhörung des Bundesvorstandes<br />
der GRÜNEN in Berlin deutlich<br />
vor getra gen.<br />
Die Wasserwirtschaft sieht, dass es<br />
vor allem erhebliche wirtschaftliche<br />
Anreize sind, die für die Technik der<br />
Koh len dioxid ver pressung eine Lanze<br />
brechen:<br />
• Der Emissionshandel für Treib hausgase<br />
unterscheidet „schlechtes“ CO 2<br />
(in die Atmosphäre) und „gutes“ CO 2<br />
(unter die Erde).<br />
• Die Auswaschung von bisher unrentab<br />
len Erdölsanden mit flüssigem<br />
CO 2 .<br />
Da alle An reize auf eine massenhafte<br />
CCS An wen dung hinauslaufen, wäre<br />
auch bei einem Forschungsgesetz<br />
größte Vor sicht ge boten, es könnte<br />
schnell der Damm brechen. Ernst Kern,<br />
Ge schäfts führer des <strong>Wasserverband</strong>es<br />
<strong>Nord</strong> sagt: „Die am weitesten gehende<br />
Variante, nämlich ein klares Verbotsgesetz,<br />
wäre wohl die beste Lösung.“<br />
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Nach dem großen Erfolg des Kreuzworträtsels in der Dezemberausgabe folg<br />
hier wieder ein extra für die Schleswig-Holsteiner Knobelfreunde entworfenes.<br />
Gesucht sind regionale Begriffe, einige Hinweise stecken in der Zeitung. Das<br />
Lösungswort bezeichnet einen Feiertag, der in diesem Jahr im Mai begangen wird.<br />
1 2 3 4<br />
E<br />
5<br />
B<br />
12<br />
9<br />
F<br />
Lösungswort:<br />
6 7<br />
H<br />
8<br />
10 11<br />
D<br />
A B C D E F G H I<br />
13<br />
Senden Sie das Lösungswort bitte unter dem<br />
Kennwort „Wasserrätsel“ bis zum 11. Mai<br />
2012 per E-Mail oder Post an Ihren Wasserversorger.<br />
Bitte geben Sie unbedingt auch<br />
Ihre Adresse an (ausdrücklich nur für dieses<br />
Gewinnspiel), damit wir Sie im Gewinnfall<br />
auch auf dem Postweg erreichen können.<br />
A<br />
I<br />
Während das Gesetz in Deutschland immer noch nicht entschieden<br />
ist, gehen die Planungen für den Ausbau des europäischen<br />
Netzes weiter.<br />
G<br />
C<br />
CO 2 Quelle<br />
Erdgasfeld<br />
Aquifer<br />
(tiefer Wasserleiter<br />
als potenzieller<br />
Speicher)<br />
CO -Pipeline<br />
2<br />
Schiffsrouten<br />
1. 75,- Euro<br />
2. 50,- Euro<br />
3. 25,- Euro<br />
Waagerecht<br />
2. Zeltbefestigung, heißt wie ein<br />
beliebter Kappelner Fisch<br />
5. eine der Gezeiten<br />
6. drittgrößte nordfriesische Insel<br />
9. Wellnesstempel der Römer,<br />
„Thermen des …“<br />
10. Sturmflut, Blanker …<br />
12. Lebensmittel Nr. 1<br />
13. großer schwarz-weißer Vogel<br />
Senkrecht<br />
1. Restprodukt der<br />
Abwasserreinigung<br />
3. ETS-Region, das E steht für …<br />
4. Cartoonzeichner aus Schleswig-Holstein<br />
(Nachname)<br />
7. Ergänzen Sie: „Wo de<br />
Ostsee/<strong>Nord</strong>see… trecken<br />
an den Strand“<br />
8. Stadt an der Schlei<br />
11. Autor von „Der Schimmelreiter“<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>, Wanderuper Weg 23, 24988 Oeversee oder<br />
per E-Mail: info@wv-nord.de<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen, <strong>Nord</strong>strander Straße 26,<br />
25746 Heide oder per E-Mail: info@wv-norderdithmarschen.de<br />
In der Region Angeln schicken Sie bitte Ihre Antwort an den:<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>angeln, Am Wasserwerk 1a, 24972 Steinbergkirche<br />
oder E-Mail: wwsteinbergkirche@wv-nordangeln.de<br />
Grafik: SPREE-PR, Quelle: Europäische Kommission JRC, Institute for Energy
April 2012 SEiTE 3<br />
Sein privates Güllerup hat Kim Schmidt<br />
in Dollerup, östlich von Flensburg, gefunden.<br />
Er sieht auf Felder, Ostsee<br />
und Touristen sind nah, ebenso eine<br />
Biogasanlage. Hier auf dem Land gibt<br />
es alles, was der kreative Zeichner<br />
für seine Cartoons namens Local<br />
Heroes (Schweine, Kühe, Hühner<br />
etc.) braucht. Den letzten Schliff<br />
holte sich Kim Schmidt während<br />
eines Praktikums beim Bauern vor<br />
Ort. „Die Augen immer offen halten,<br />
aufmerksam sein, nichts ablehnen“,<br />
beschreibt der gebürtige Flensburger<br />
seine Arbeitsweise. Und so findet<br />
der 46jährige genügend Stoff<br />
für die wöchentliche Zeichnung in<br />
der sh:z oder auch für die lokalpolitischen<br />
Karikaturen im Flensburger<br />
wir sind schleswig-holstein – unikate aus dem land<br />
Frecher Stil im land bekannt<br />
Kim Schmidt haucht Schweinen, Kühen und Fröschen Leben ein<br />
Hedwig-Holzbein, Martha Pfahl, Local Heroes – der Cartoonlandschaft<br />
in Schleswig-Holstein würde ohne ihn ein be<br />
achtlicher Teil fehlen. Kim Schmidt ist der Kopf (und auch<br />
die Hand) hinter diesen und vielen Figuren mehr. Er<br />
versteht sich nicht als Künstler, sondern sieht sich<br />
als Handwerker.<br />
Leseempfehlung<br />
Local Heroes<br />
schnacken Platt<br />
Flying Kiwi Media GmbH<br />
Tageblatt. Dort nimmt er er<br />
mit frechem Pinselstrich die<br />
Geschehnisse im Rathaus<br />
aufs Korn. „Das gefällt sicher<br />
nicht jedem, aber ich bin ja nicht<br />
richtig böse.“ Tacheles redet allerdings<br />
seine Martha Pfahl in den<br />
ÖdeCartoons in der Moin Moin. „Sie<br />
ist ein lustiger, flexibler Charakter,<br />
ist resolut und darf alles aussprechen“,<br />
erzählt der sympathische Kim<br />
Schmidt in seinem Atelier. Ihm ist sein<br />
dienstältester Charakter (von 1986!)<br />
ans Herz gewachsen. Die Handschrift<br />
Kim Schmidts tragen zahlreiche Publikationen.<br />
Der viel seitige Zeichner illustriert<br />
u. a. die Jugendausgabe von<br />
„Die drei ???“ und die Geschichten<br />
rund um den 11jährigen Jungen Rick.<br />
Comicfiguren<br />
zeichnen<br />
Carlsen<br />
Verlag<br />
GmbH<br />
Und im Netz: www.kim-cartoon.com oder www.flying-kiwi.de<br />
Die Frösche aus den Local Heroes<br />
durften ein Eigenleben entwi<br />
ckeln, sodass es mit mittler<br />
weile<br />
gut 400 FrogsBil Frogs der gibt. Wie<br />
schafft er dieses Pensum?<br />
„Jeder, der selbstständig<br />
ist, weiß, dass man sich disziplinieren<br />
muss. Ich habe<br />
klare Pläne, arbeite recht<br />
viel, habe mit den verschiedenen<br />
Produkten mehrere<br />
Stand beine und gleichzeitig bleibt es<br />
so auch ab wechslungs reich.“ Gegen<br />
6 Uhr steht er mit der Familie auf und<br />
um halb 8 beginnt die Arbeit, beschreibt<br />
der Vater zweier Teenager<br />
Kim Schmidt gezeichnet und fotografiert.<br />
Das linke Bild zeigt anschaulich den Werdegang seiner Bilder.<br />
Zunächst zeichnet er grob vor, dann mit genauem Strich nach.<br />
Anschließend geht es an die farbliche Gestaltung. Die Unordnung<br />
entspricht übrigens nicht der Realität. Da hat sich der Zeichner<br />
die viel zitierte künstlerische Freiheit herausgenommen.<br />
Söhne den Start in den Tag. Gemeinsam<br />
mit seiner Frau Elke führt er den<br />
Verlag Flying Kiwi media, mit dem er<br />
Comic und Cartoonbücher aus eigener<br />
Feder und von weiteren Zeichnern und<br />
Autoren mit den Schwerpunkten auf<br />
<strong>Nord</strong>deutschland und Humor vertreibt.<br />
Der Verlag wurde geboren, als Kim<br />
Schmidt in den 90ern sein erstes<br />
Buch veröffentlichen wollte. „Als<br />
Newcomer hat man es bei Verlagen<br />
ja schwer, da hab ich das eben im<br />
Eigenverlag gemacht.“ Schon als<br />
Kind und Jugend licher kritzelte Kim<br />
Schmidt seine Hefte mit Zeichnungen<br />
voll, malte für die Schülerzeitung und<br />
fertigte Bilder für Vereine. Aber dann<br />
griff er mit der Ausbildung zum Krankenpfleger<br />
den Rat der Eltern, „erst<br />
etwas Ordentliches zu machen“, auf.<br />
Die Arbeit mit Menschen lag ihm,<br />
sodass er ein Lehrerstudium begann.<br />
Kurz vor dessen Abschluss setzte er<br />
dann aber doch ganz aufs Zeichnen.<br />
Lehrer ist der schlanke 1,75 Meter<br />
große Mann dennoch ein bisschen.<br />
Seine Comiczeichenkurse persönlich,<br />
im Forum oder per Lehrbuch (mittlerweile<br />
3) sind sehr beliebt. „Ich habe<br />
es gut getroffen. Seit 1997 kann ich<br />
vom Zeichnen leben, nicht feudal –<br />
aber mir reicht es.“
vun de föör bit to de hallichen<br />
WasserZeitung • 1/2012 seite 4/5<br />
Hier bauen wir 2012 für sie<br />
Erneuerung des TrinkwassErnETzEs<br />
Gemeinde Straße Länge (m)<br />
Achtrup Schulstraße, Bahnhofstraße, Schrupplund,<br />
Kirchweg, Sprakebüller Straße, Tettwanger<br />
Straße, Gutsallee, Brebek, Eulenberg,<br />
Hauptstraße, Hogelund, Gartenstraße,<br />
<strong>Nord</strong>erstraße, Karlumer Straße<br />
6.990<br />
Bohmstedt Bohmstedtfeld 2.100<br />
Bredstedt Am Mühlenberg, Treibweg, Osterrade,<br />
<strong>Nord</strong>seestraße, Westerstraße<br />
Eggebek Hauptstraße/Osterreihe,<br />
<strong>Nord</strong>erfeld<br />
900<br />
430<br />
790<br />
Handewitt/Jarplund Hornholzer Weg 120<br />
Harrislee Westerstraße 300<br />
Haselund Lorenz-Jensen Straße,<br />
Schulstraße<br />
680<br />
420<br />
Ladelund Poststraße 100<br />
Langenhorn/Efkebüll K 73/Altendeich 2.300<br />
Lindewitt An der Heide 1.400<br />
Löwenstedt Ostenau-Westerfeld 480<br />
Medelby Lückepott 250<br />
<strong>Nord</strong>hackstedt Neuhöruper Straße 3.300<br />
Oeversee Augaarder Weg 1.580<br />
Osterby Hauptstraße 200<br />
Schafflund Buchauweg 320<br />
Schafflund Umgehungsleitung für Meierei 1.516<br />
Sieverstedt OT Stenderup 760<br />
Sillerup Lück/Dorfstraße 950<br />
Sollerup Alter Kirchenweg,<br />
Achtert Holt<br />
1.100<br />
1.100<br />
Sollwitt/Pobüll Pobüller Straße 1.280<br />
Stadum Spierling 1.300<br />
Vollstedt Bulack/Schlagboom 360<br />
Wanderup Poststraße 250<br />
Erneuerung der ABwAssErkAnälE<br />
Gemeinde Straße Länge (m)<br />
Stadt<br />
Bredstedt<br />
Hermannstraße 2. BA ca. 380 m RW Kanal DN 300–500 (oB)<br />
ca. 70 m SW Kanal DN 200 (oB)<br />
ca. 190 m SW Kanal DN 200 (Ins)<br />
Breklum Brückenstraße/Am Mühlenberg<br />
ca. <strong>450</strong> m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />
Struckum Schreegstieg/Osterweg 1.BA ca. 300 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />
Jerrishoe Schulkoppel ca. 60 m RW- Sickerkanal DN (oB)<br />
Handewitt<br />
OT. Weding<br />
Siedlerstaße ca. 600 m SW- Kanal DN 200 (Ins)<br />
<strong>Nord</strong>hackstedt Flurstraße Sanierung v. RW Straßenquerungen<br />
Schafflund Bahnhofstraße<br />
Meyner Straße<br />
Hauptstraße B199<br />
Erläuterungen:<br />
DN = Nenndurchmesser in mm<br />
RW = Regenwasser<br />
ca. 220 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />
ca. 200 m RW-Kanal DN 300 (oB)<br />
Sanierungen v. Straßenquerungen<br />
SW = Schmutzwasser<br />
oB = offene Bauweise<br />
Ins = Inlinersanierung<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> dreht systematisch an den Stellschrauben<br />
Energieverbrauch immer im Visier<br />
Obwohl die Aufgaben des wV nord im wasser und Abwasser<br />
liegen, befasst er sich intensiv mit Energie. Und das aus<br />
gutem Grund – die stabile wasserversorgung und gründliche<br />
Abwasserreinigung benötigt große Mengen davon.<br />
Die Kläranlagen vor Ort sind meist<br />
die größten Stromabnehmer in der<br />
Kommune. Rechen, Förderschnecken,<br />
Gebläse, Rührwerke – all das funktioniert<br />
nur mit Strom. In Oeversee wird<br />
der Stromverbrauch der Kläranlage<br />
nur durch einen Abnehmer getoppt –<br />
das Wasserwerk.<br />
Hier benötigen die Förder- und Filteranlagen<br />
sowie etliche Pumpen gut<br />
20 Mal so viel Strom wie die Kläranlage.<br />
„Wir tragen das Wasser nicht<br />
mit Eimern zum Kunden. Wir pumpen<br />
es“, verdeutlicht Geschäftsführer<br />
Ernst Kern. Und deshalb sahen die<br />
Fachleute hier einen<br />
Punkt, die Abläufe<br />
günstiger zu gestalten.<br />
„Wir haben in<br />
die besten Pumpen<br />
investiert“, so der<br />
Geschäftsführer.<br />
„High efficiency“<br />
steht auf den<br />
Plaketten an den großen modernen<br />
Anlagen. Gute Planung, gute Motoren,<br />
gute Pumpen und beste Abstimmung<br />
sind die Stellschrauben,<br />
an denen der Verband systematisch<br />
dreht.<br />
Auf der Kläranlage in Bredstedt<br />
hatten die Fachleute ebenfalls<br />
Sparpotentiale ausgemacht. Hier<br />
" Wir tragen<br />
das Wasser<br />
nicht mit Eimern<br />
zum Kunden.<br />
Wir pumpen es."<br />
standen die Sauerstoffgebläse in<br />
der biologischen Reinigungsstufe<br />
im Fokus. Sie benötigen monatlich<br />
etwa 36.000 kWh. Das ist etwa das<br />
Zehnfache des durchschnittlichen<br />
Jahresverbrauches einer 2-köpfigen<br />
Familie! Arbeiteten die Gebläse bisher<br />
nach festen Zeitvorgaben, soll<br />
nun installierte Messtechnik den Einsatz<br />
entsprechend der Inhaltsstoffe<br />
Ammonium und Nitrat festlegen. So<br />
können bis zu 9.000 Euro jährlich eingespart<br />
werden.<br />
Neben dem finanziellen Aspekt, der<br />
ganz im Kundensinn sein dürfte, geht<br />
es dem WV <strong>Nord</strong> na-<br />
türlich auch um den<br />
ökologischen Aspekt.<br />
2.733 Tonnen Kohlendioxid<br />
produziert<br />
der <strong>Wasserverband</strong><br />
im Trink- und Abwasserbereich<br />
sowie durch den<br />
Verbrauch von Heizöl und Diesel.<br />
Damit konnte der Vorjahreswert um<br />
200 Tonnen unterschritten werden.<br />
Ernst Kern verdeutlicht: „Wir haben<br />
uns klar gegen die Kohlendioxidverpressung<br />
bei uns im Untergrund<br />
ausgesprochen. Der beste Umgang<br />
mit CO 2 ist immer noch seine Vermeidung!“<br />
Wassermeister Jörg Carstensen an einer der Hochleistungspumpen im Wasserwerk Oeversee.<br />
Übersicht der Stromkosten im Wasserwerk<br />
in Euro<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Strombedarf im Wasserwerk je Kubikmeter Reinwasser<br />
kWh/m 3<br />
0,56<br />
0,54<br />
0,52<br />
0,50<br />
0,48<br />
0,46<br />
0,44<br />
0,42<br />
0,40<br />
0,38<br />
Basisverbrauch: 3.500.000 kWh<br />
500.000<br />
in Euro<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
1992<br />
2001<br />
1993<br />
2002<br />
1994<br />
2003<br />
1995<br />
2004<br />
1996<br />
2005<br />
1997<br />
2006<br />
1998<br />
2007<br />
1999<br />
2008<br />
2000<br />
2009<br />
2001<br />
2010<br />
2002<br />
2011<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
0<br />
EEG-Abgabe<br />
Arbeitspreis inkl.<br />
Durchleitung<br />
Sonstige Abgaben<br />
<strong>35</strong>2.<strong>450</strong>,00<br />
45.818,50<br />
264.337,50<br />
42.294,00<br />
518.000,00<br />
124.320,00<br />
341.880,00<br />
51.800,00<br />
2009 2011<br />
Grafik oben rechts: Der Beitrag für die erneuerbaren Energien wird<br />
deutlich. Der Arbeitspreis steigt vergleichsweise wenig, sonstige<br />
Abgaben und die EEG-Abgabe haben sich etwa verdoppelt.<br />
Grafiken links: Wegen der steigenden Strompreise steigen die Stromkosten<br />
im Wasserwerk (s. oben). Sparmaßnahmen wirken dagegen<br />
und der fallende Verlauf beweist, dass sie greifen. Zwar beträgt die<br />
Spanne „nur“ 0,15 kWh/m3 , aber bei ca. 7 Mio. m³ ist das erheblich.<br />
Zusätzliche Pumpstation für<br />
Handewitter Abwasser<br />
Sowohl die Gemeinde Handewitt<br />
als auch das gemeinsame Gewerbegebiet<br />
mit Flensburg wachsen.<br />
In diesem Jahr soll auch die Fischfabrik,<br />
die zurzeit gebaut wird, ihre<br />
Geschäfte aufnehmen. Deshalb ist<br />
abzusehen, dass die kommunale<br />
Kläranlage in Handewitt an den<br />
Rand ihrer Kapazität stößt. Die<br />
Abwasserfachleute aus Flensburg<br />
und Oeversee haben deshalb<br />
schon reagiert und eine zusätzliche<br />
Pumpstation in Betrieb genommen.<br />
Diese pumpt einen Teil<br />
des Handewitter Abwassers zur<br />
Reinigung in die Kläranlage der Stadt Flensburg. Im Ortsteil Gottrupel trafen sich (v. li.) Dirk Behnemann<br />
(WV <strong>Nord</strong>), Jochen Schmidt (Stadt FL), Burkhard Andersen, Peter Julius Petersen (beide TBZ) und Peter<br />
Klerck (WV <strong>Nord</strong>), um die gemeinsame Anlage in Augenschein zu nehmen.<br />
Zertifizierung kein Geschenk<br />
Verband arbeitet weiter an nachhaltiger Struktur<br />
Im Jahr 2000 wurde der <strong>Wasserverband</strong><br />
<strong>Nord</strong> für sein Qualitätssicherungssystem<br />
nach ISO 9001 zertifiziert.<br />
Dafür wurden der gesamte<br />
Verband durchleuchtet, Prozesse,<br />
Leistungen, Arbeitsabläufe geprüft.<br />
Dabei ging es darum, die Effektivität<br />
und Effizienz in dem kommunalen<br />
Unternehmen noch weiter zu<br />
erhöhen. Sowohl die technischen<br />
Bereiche als auch die Verwaltung<br />
sind im Visier.<br />
Auf dem Zertifikat möchte und kann<br />
sich Geschäftsführer Ernst Kern jedoch<br />
nicht ausruhen. Alle drei Jahre<br />
kommen die externen Prüfer, um<br />
sich von der andauernden Leistung<br />
zu überzeugen. In diesem Jahr ist<br />
Gewinner<br />
Liebe Rätselfreunde! Herzlichen Dank<br />
für die zahlreiche Beteiligung am Preisrätsel<br />
in der Dezember-Ausgabe unserer<br />
Wasser Zeitung! Das Raten rund um Begriffe<br />
aus Schleswig-Holstein, der Weihnachtszeit<br />
und der Wasserwirtschaft hat<br />
Ihnen offenbar viel Freude gemacht. Fast<br />
alle der knapp 460 Einsender haben mit<br />
dem Lösungswort „Kerzenschein“ richtig<br />
gelegen. Wir gratulieren den Gewinnern:<br />
Frau Carla Randzio<br />
aus Osterby<br />
Herrn Kristof Reckweg<br />
aus Langenhorn<br />
Doris Doris und Gerd Siefert Siefert<br />
aus <strong>Nord</strong>strandischmoor<br />
Viel Spaß auch dieses Mal beim<br />
Knobeln auf der Seite 2!<br />
Im WV <strong>Nord</strong> begleitet Nina Hoffmann (mi.) die Zertifizierung. Sie<br />
stimmt sich mit Geschäftsführer Ernst Kern und Britta Schweim ab.<br />
es wieder so weit. In internen Gesprächen<br />
wird deshalb der Status<br />
quo erfasst und können auf Basis<br />
wasserverband nord<br />
Wanderuper Weg 23<br />
24988 Oeversee<br />
Tel.: 04638 8955-0<br />
Fax: 04638 895555<br />
E-Mail: info@wv-nord.de<br />
der kurze draht<br />
www.wv-nord.de<br />
dieser Ergebnisse schon im Vorfeld<br />
der Anhörung einige Reibungspunkte<br />
geglättet werden.<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag bis Donnerstag:<br />
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und<br />
13.30 Uhr bis 16 Uhr<br />
Freitag:<br />
8.30 Uhr bis 12 Uhr
Seite6 LebenseLixier Wasser<br />
WaSSerzeitung<br />
Sturmfluten haben schon immer an<br />
der Küste <strong>Nord</strong>frieslands Deiche<br />
durchbrochen, Inseln zerrissen und<br />
ganze Ortschaften untergehen lassen.<br />
Zwei der bedeutendsten Maler<br />
<strong>Nord</strong>frieslands, Carl Ludwig Jessen<br />
und Hans Peter Feddersen, haben<br />
sich auf ganz unterschiedliche<br />
Weise mit der zerstörerischen Kraft<br />
des Wassers auseinandergesetzt.<br />
Wasser und Kunst (2) Malerei<br />
Der „blanke Hans“ als bildhafte Darstellung<br />
Carl Ludwig Jessen, Nach der Sturmflut, Aquarell, um 1880, Museumsberg Flensburg.<br />
von Ulrich Schulte-Wülwer* Wasser ist der Quell des Lebens.<br />
Bäche, Flüsse, Seen und das<br />
Meer üben seit ewigen Zeiten eine magische Anziehungskraft auf den<br />
Menschen aus und haben Musiker, Dichter und Maler zu großen Leistungen<br />
inspiriert. Auf der anderen Seite belegt die schwere Sturmflut<br />
vor genau 50 Jahren, dass die elementare Gewalt des Wassers den<br />
Menschen bis heute in Angst und Schrecken versetzt.<br />
Beide greifen in ihren Bildern Themen<br />
auf, die auch literarisch behandelt<br />
wurden.<br />
Literatur in Bildern<br />
Carl Ludwig Jessen bezieht sich auf<br />
ein historisches Ereignis, das der<br />
Pas tor auf Hallig <strong>Nord</strong>strandischmoor,<br />
Johann Christoph Biernatzky,<br />
als Augenzeuge in einer Novelle ver-<br />
arbeitet hat. Es ging um die verheerende<br />
Sturmflut im Februar 1825. Die<br />
Wassermassen hatten vier der sieben<br />
Häuser und die Kirche weggerissen.<br />
Viermal zuvor schon war die Kirche<br />
auf <strong>Nord</strong>strandischmoor durch Sturmfluten<br />
zerstört. Wie durch ein Wunder<br />
konnte der kostbare mittelalterliche<br />
Kelch aus den Trümmern der Kirche<br />
geborgen werden.<br />
Kelch der Hoffnung<br />
Jessen schildert auf seinem Bild den<br />
Morgen nach der Flut. Die Bewohner<br />
haben sich auf der Kirchwarft versammelt<br />
und suchen Trost und Zuspruch.<br />
Ihr Kummer, ihre Sorgen und ihre Verzweiflung<br />
sind auf den Gesichtern und<br />
Hans Peter Feddersen, Blanker Hans, 1902. Öl auf Leinwand, <strong>Nord</strong>see Museum Husum.<br />
an ihren Körperhaltungen abzu lesen.<br />
Der Pastor macht den Gemeindemitgliedern<br />
Mut und zeigt ihnen den<br />
geborgenen Kelch als ein Zeichen<br />
der Hoffnung und eines Neubeginns.<br />
In der Anordnung der Figurengruppen<br />
wirkt das Bild wie die Schlussszene<br />
eines Theaterstücks.<br />
Stürzen und Ziehen<br />
Die Menschen fanden anschließend<br />
die Kraft, die zerstörten Häuser wieder<br />
aufzubauen, und nutzten dazu die<br />
Trümmer der Kirche, die nicht noch<br />
einmal errichtet wurde. Als König<br />
Friedrich VI. von Dänemark die Hallig<br />
besuchte, um sich ein Bild von dem<br />
Ausmaß der Zerstörung zu machen,<br />
überreichten ihm die Halligbewohner<br />
den Kelch, der sich heute im Nationalmuseum<br />
in Kopenhagen befindet.<br />
Hans Peter Feddersen geht das Thema<br />
völlig anders an. Sein Gemälde<br />
„Blanker Hans“ basiert auf dem<br />
berühmten Gedicht von Detlev von<br />
Liliencron, der als Hardesvogt auf<br />
Pellworm in seinem Gedicht „Trutz,<br />
Blanke Hans“ den<br />
* Ulrich<br />
Schulte-Wülwer (Jg. 1944)<br />
war bis 2009 als Direktor des<br />
Museumsberges in Flensburg<br />
und als Professor für Kunstgeschichte<br />
an der Universität<br />
Kiel tätig. Als Autor hat er sich<br />
unter anderem mit der Malerei<br />
in <strong>Nord</strong>deutschland befasst. Er<br />
ist Aufsichtsratsvorsitzender<br />
des Museums „Kunst der Westküste“<br />
auf Föhr und seit 2011<br />
Träger des Verdienstordens<br />
des Landes Schleswig-Holstein.<br />
Mythos von der im 14. Jahrhundert<br />
untergegangenen Ortschaft Rungholt<br />
beschwor. Liliencrons Versmaß ist<br />
der Rhythmus der rollenden Wogen:<br />
„Heut bin ich über Rungholt gefahren,<br />
/ die Stadt ging unter vor fünfhundert<br />
Jahren.“ Auch Feddersen weiß, dass<br />
jede Welle ihre eigene Struktur und<br />
ihr eigenes Bewegungsgesetz hat.<br />
Man erkennt den Sog der zurückdrängenden<br />
Flut, sieht das Brechen,<br />
Stürzen und Ziehen jeder einzelnen<br />
Woge, die die letzten Reste des Menschenwerks<br />
zermalmen. Die Möwen,<br />
die vor schwarzblauem Himmel auffliegen,<br />
kümmert dies nicht.<br />
Entfesselte Urgewalt<br />
Lange Zeit galt es als unmöglich, das<br />
Meer als entfesselte Urgewalt zu malen.<br />
Carl Ludwig Jessen zog es vor,<br />
sich wie ein Psychologe auf die Auswirkungen<br />
der Katastrophe auf den<br />
Menschen zu beschränken, Feddersen<br />
jedoch malte das Naturphänomen an<br />
sich und entfaltete die Meis terschaft<br />
eines großen Künstlers, die ihn zum<br />
bedeutendsten schleswig-holstei-<br />
nischen Landschaftsmaler vor Emil<br />
Nolde werden ließ.<br />
Die Bilder dieser Seite<br />
finden Sie neben vielen<br />
weiteren in diesem Buch.<br />
280 Seiten,<br />
gebundene Ausgabe,<br />
April 2012, Boyens Buchverlag
AprIl 2012<br />
Badekulturen der Welt SEITE 7<br />
Die römer, diese alten Genießer!<br />
Die Thermen des Caracalla waren ein wahrer Wellnesstempel,<br />
eintrittsfrei und hielten 300 Jahre – bis die Germanen kamen<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
wer schätzt sie nicht,<br />
die Wonnen der Wanne. In<br />
einer neuen Serie wollen<br />
wir Ihnen BadekuLturen<br />
der WeLt näherbringen.<br />
Lesen Sie heute als erstes,<br />
wie man sich im alten rom<br />
des Badens erfreute.<br />
Nur sehr wenige römische Häuser waren<br />
mit eigenen Bädern ausgestattet<br />
und so gab es in fast allen Städten,<br />
Siedlungen und sogar in den Legionslagern<br />
öffentliche Badehäuser. Sie<br />
dienten nicht nur der Hygiene, sondern<br />
waren zugleich Stätten, an denen man<br />
Geschäfte und Politik machte, Sport<br />
trieb und las oder sich mit Freunden<br />
traf. Die Eintritts preise waren sehr<br />
niedrig, oft war der Besuch auch kostenfrei.<br />
Das waren noch Zeiten, als<br />
die öffentlichen Bäder vom Staat aus<br />
Steuergeldern finanziert wurden!<br />
Die meisten Römer arbeiteten bis zum<br />
frühen Nachmittag, danach ging man<br />
ins Bad und blieb dort manchmal bis<br />
zum Sonnenuntergang.<br />
Zunächst suchte der Gast das Kaltbad<br />
Frigidarium auf, um sich zu waschen.<br />
Danach ging es zur ausführlicheren<br />
Reinigung mit dem Schabeisen ins<br />
lauwarme Tepidarium. Da die Seife<br />
noch nicht erfunden war, benutzte<br />
man Öl als Reinigungs- und auch<br />
Massagemittel. Die Reinigungsprozedur<br />
wurde oft von Sklaven ausgeführt.<br />
Von Kopf bis Fuß gesäubert und<br />
durchmassiert, suchte der Römer nun<br />
das Caldarium oder Lakonium auf,<br />
um im heißen Wasser oder Dampf<br />
zu entspannen, zu schwitzen und zu<br />
genießen. Zum Schluss stieg man<br />
noch mal ins kalte Wasser oder ins<br />
Schwimmbecken. Natürlich blieben<br />
jedem Besucher Reihenfolge und<br />
So sollen die Thermen des<br />
Caracalla ausgesehen haben<br />
(Darstellung im Schnitt).<br />
Selbst die Ruinen der Caracalla-Thermen vor den Toren Roms sind<br />
heute noch eindrucksvoll. Die Westgoten zerstörten die Badeanlage,<br />
um das belagerte Rom von der Trinkwasserversorgung abzuschneiden.<br />
Ein Fehlschlag, denn die Aqua Marcia zu den Thermen<br />
war nur eine von elf Wasserleitungen nach Rom.<br />
Nutzung der Bäder selbst überlassen.<br />
Im 4. Jahrhundert gab es allein in Rom<br />
neben rund 900 öffentlichen Bädern elf<br />
große Thermen. Zu den schönsten und<br />
größten gehörten die Thermen des Caracalla,<br />
deren Ruinen noch heute vor den<br />
Toren der italienischen Hauptstadt zu<br />
besichtigen sind. Unter Kaiser Caracalla<br />
von 212 bis 219 n. Chr. erbaut, boten sie<br />
bei freiem Eintritt 1.600 Badenden Platz.<br />
Hier gab es alles, was das Herz des Erholungsuchenden<br />
begehrt: Biblio theken,<br />
Verhandlungs-, Fecht-, Massage- und<br />
Gymnastikräume, groß zügige Grünanlagen,<br />
Gar küchen, Schönheitssalons,<br />
Brettspiele, Friseurgeschäfte und sogar<br />
ein Stadion. Die Räume des Riesenhallenbads<br />
im Hauptgebäude beeindruckten<br />
mit kunstvollen farbigen Mosaiken,<br />
Statuen und Gemälden. Einige erhaltene<br />
Mosaik-Frag mente vermitteln noch<br />
heute einen ungefähren Eindruck der<br />
Pracht dieses Wellnesstempels. Die<br />
Wasserversorgung und die Entsorgung<br />
waren perfekt gelöst. Frisches Wasser<br />
kam durch die nach ihrem Erbauer benannte<br />
Leitung Aqua Marcia aus einer<br />
Quelle im 91 km entfernten Anienetal.<br />
Auch das Heizsys tem der Anlage (lat.<br />
Hypocaustum) war ausgeklügelt: Unter<br />
der Anlage arbeiteten mehr als hundert<br />
Sklaven an riesigen mit Holz befeuerten<br />
Öfen. Von hier strömte Heißluft über<br />
Tonrohre, die außerdem als Fußbodenheizung<br />
dienten, in sämtliche Räume.Die<br />
Thermen des Caracalla hielten über 300<br />
Jahre, bis sie von den Goten im Jahre<br />
536 verwüstet und zerstört wurden. Die<br />
Rom belagernden Germanen glaubten<br />
dadurch die Trinkwasserzufuhr der Stadt<br />
abschneiden zu können. Heute finden in<br />
den Thermen des Caracalla wieder Konzerte<br />
und Theateraufführungen statt.<br />
Vor dem Baden wurde oft Sport<br />
getrieben. Die Männer rangen<br />
oder fochten, das weibliche Geschlecht<br />
bevorzugte Bälle (Mosaikfragment)<br />
oder den Trochus,<br />
einen mit einem Stock vorangetriebenen<br />
Ring.<br />
Frauen und Männer badeten zu<br />
getrennten Besuchszeiten bzw.<br />
in unterschiedlichen Bereichen.<br />
frigidarium<br />
Das Frigidarium (frigidus = kalt)<br />
diente als Waschbecken und Abkühlraum<br />
nach dem Bade oder dem<br />
Verlassen von Wärmeräumen.<br />
Ähnlich der heutigen Sauna diente<br />
der Sprung ins kalte Wasser der<br />
Revitalisierung und der Ankurbelung<br />
der Durchblutung.<br />
tepidarium<br />
Das Tepidarium (tepidus = lauwarm)<br />
ist ein beheizter Raum mit Bänken<br />
und Liegen, in dem die Luft trocken<br />
ist. Die Temperatur lag üblicherweise<br />
bei 38 – 40 °C. Hier erfolgte<br />
der Besuch meist leicht bekleidet<br />
in Tuniken oder umgehängten Tüchern.<br />
Durch die nur wenig über der<br />
Körpertemperatur liegende Raumtemperatur<br />
wurde die Durchblutung<br />
des Körpergewebes verbessert; dies<br />
erleichtert die Entspannung.<br />
caldarium<br />
Das Caldarium (von caldus oder<br />
calidus = warm, heiß) besteht aus<br />
einem Raum, bei dem der mit<br />
Warmluft von unten geheizte Boden<br />
und oft auch die Wände und<br />
Bänke eine gleichmäßige Wärme<br />
von 40 bis 50 °C abstrahlen. Die<br />
Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und<br />
beträgt nahezu 100 Prozent. Diese<br />
Art Bad gilt als kreislaufschonend,<br />
die Muskulatur entspannt sich.<br />
Zusätzliche Duft essenzen sollten<br />
anregen.<br />
lakonium<br />
Das Dampfschwitzbad der Römer<br />
(laco = Spartaner) wurde so<br />
genannt, weil es angeblich die<br />
einzige von den griechischen<br />
Spartanern akzeptierte Form des<br />
Badens war. Es handelte sich um<br />
einen halbrunden Alkoven. Meist<br />
gab es zusätzlich zur Fußbodenheizung<br />
ein Kohlebecken. In der Mitte<br />
befand sich ein flaches Becken mit<br />
Wasser, aus dem sich der Badende<br />
besprengte. Oft wurden heiße<br />
Steine (durch Sklaven) mit Wasser<br />
benässt.<br />
natatio (Schwimmbecken) frigidarium grosse halle tepidarium<br />
caldarium<br />
Im pres sum<br />
Herausgeber: <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>, Oeversee; <strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong>erdithmarschen, Heide; Wasserversorger Angeln Redakti dakti dak on und Verlag: SPREE-PR, Niederlassung <strong>Nord</strong>, Dorfstr. 4, 23936 Grevesmühlen OT Degtow,<br />
Telefon: 03881 75 55 44, E-Mail: susann.galda@spree-pr.com, Internet: www.spree-pr.com V.i.S.d.P.: Thomas Marquard Redaktion: daktion: dak Susann Galda Fotos: S. Galda, M. Schoop, F. Fucke, P. Klerck, Museumsort Kupfermühle,<br />
S. Wollesen, Archiv Layout: SPREE-PR, Marion Nitsche (verantw.), Franziska Fucke Druck: Berliner Zeitungsdruck Nachdruck von Beiträgen (auch auszugsweise) und Fotos nur mit Genehmigung von SPREE-PR!
Seite8 UMSCHAU<br />
WaSSerzeitung<br />
Anteil des Fremdwassers in neuer Mitgliedsgemeinde gesenkt<br />
Gutes Ergebnis nach genauer Suche<br />
Kanäle und Kläranlagen sind<br />
für das häusliche und gewerbliche<br />
Abwasser vorgesehen<br />
und dimensioniert. Fremdwasser<br />
belastet das System unnötig<br />
und verursacht Kosten.<br />
Am Tastruper Beispiel wird<br />
deutlich, welche Aufgaben der<br />
WV <strong>Nord</strong> in diesem Bereich<br />
erledigt.<br />
„Die Tastruper wollten ihren<br />
Fremdwasseranteil von bis zu 89<br />
Prozent drastisch reduzieren und<br />
traten an uns heran“, berichtet der<br />
Technische Leiter des WV <strong>Nord</strong>,<br />
Peter Klerck. Die Abwasserfachleute<br />
sollten die Ursachen aufspüren<br />
und Gegenmaßnahmen empfehlen.<br />
Denn die kleine Gemeinde<br />
Tastrup betreibt keine eigene Kläranlage,<br />
sondern leitet das Abwasser<br />
zur Reinigung nach Flensburg.<br />
Und für jeden Kubikmeter, der die<br />
30-Prozent-Marke des Fremdwasseranteils<br />
überschreitet, mussten<br />
sie tief in die Tasche greifen.<br />
„Fremdwasser kann Grundwasser<br />
und über Schächte einströmendes<br />
Regenwasser sein oder<br />
aus falsch angeschlossenen<br />
Dach- bzw. Grundstücksentwässerungen<br />
stammen“, erklärt Peter<br />
Klerck. Deshalb setzte der<br />
WV <strong>Nord</strong> auch an verschiedenen<br />
Punkten an. „Wir haben Kanäle<br />
gespült, um sie mit einer Kamera<br />
untersuchen zu können, Schächte<br />
inspiziert und uns auf die Suche<br />
Ein Schwerpunkt der Wasserrahmenrichtlinie<br />
im Land ist<br />
der Umbau der Kulturstaue in<br />
Sohlgleiten. Kleinstlebewesen<br />
können die künstlichen<br />
Staustufen aus den 60/70er<br />
Jahren nicht überwinden.<br />
Abhilfe schaffen Projekte wie<br />
die in Jerrisbek und Treia.<br />
nach Fremdeinleitern gemacht“,<br />
zählt Klerck auf.<br />
Im Ergebnis wurden noch<br />
im vergangenen Jahr vier<br />
und Anfang 2012 drei<br />
Schadstellen an Kanälen<br />
ausgebessert und zehn<br />
Schächte saniert. Ein<br />
Fremdeinleiter hat seine<br />
Anschlüsse auf Vordermann<br />
gebracht, so dass<br />
dem insgesamt recht<br />
großen Aufwand auch<br />
gute Ergebnisse folgten.<br />
„Der Anteil an Fremdwasser<br />
ging trotz der extremen<br />
Regenereignisse im<br />
vergangenen Jahr schon<br />
zurück. Wenn man bedenkt,<br />
dass ein Teil der<br />
Maßnahmen erst im laufenden<br />
Jahr 2011 und danach<br />
umgesetzt wurden,<br />
ist das schon ein Erfolg“,<br />
fasst Klerck zusammen.<br />
Die Gemeinde jedenfalls<br />
war überzeugt und übertrug<br />
die komplette Abwasserbeseitigung<br />
dem<br />
kompetenten Partner zum<br />
Jahresanfang 2012.<br />
Auch in anderen Gemeinden<br />
arbeitet der<br />
WV <strong>Nord</strong> an der Reduzierung<br />
des Fremdwasseranteils.<br />
So wurden in Barderup,<br />
Schafflund, Eggebek<br />
und Ellund Schächte saniert.<br />
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – Teil 2<br />
Kleinstlebewesen wandern dank Sohlgleiten<br />
Neben Fischen (mehr als 30 Arten in<br />
der Treene!) leben viele Wirbellose<br />
wie Larven von Libellen, Fliegen<br />
oder Mücken in Flüssen, zum großen<br />
Teil im Sohlsubstrat. Staustufen<br />
und Abstürze sollten vor 50 Jahren<br />
Erosionen der Sohle verhindern und<br />
Mindestwasserstände gewährleisten.<br />
Damit waren sie aber für Fisch&Co.<br />
Die neue Sohlgleite und der Kanupass (li.) am Pastorat in Treia.<br />
Tastrups Bürgermeister Peter Asmussen (re.) legte die Geschicke der Abwasserbeseitigung zum<br />
Jahresanfang in die Hände des <strong>Wasserverband</strong>es <strong>Nord</strong>, hier Andreas Jünck (li.) und Peter Klerck.<br />
nicht mehr stromaufwärts passierbar.<br />
Heute werden die künstlichen Betonbauwerke<br />
durch ebenfalls künstliche<br />
– aber den natürlichen Ansprüchen<br />
besser gerecht werdende – lang<br />
gestreckte Steinschüttungen ersetzt.<br />
Diese gewährleisten durch ein Gefälle<br />
von etwa 1:70 (1m Höhe = 70m<br />
Länge) die Fließgeschwindigkeiten,<br />
so dass sie auch kleinste Wassertiere<br />
bewältigen, und reguliert gleichzeitig<br />
die Wasserstände.<br />
Fünf Sohlgleiten in der Jerrisbek bei<br />
Wanderup wurden in diesem Frühjahr<br />
fertig. Auf den Gleiten wurden zusätzlich<br />
Bereiche angelegt, die Fischen als<br />
Laichplatz dienen können. Denn die<br />
sind in den sandgeprägten Gewässern<br />
auf der Geest Mangelware geworden.<br />
Eine der größten Sohlgleiten in der<br />
Region ist die in der Treene am Pa-<br />
Wenn das Grundwasser<br />
über undichte Schächte<br />
in die Kanäle fließt,<br />
werden Leitungen<br />
und Kläranlagen<br />
unnötig und kostenintensiv<br />
belastet.<br />
storat in Treia. Zwischen Juni und<br />
August 2010 rollten hier die Baufahrzeuge<br />
an. Im September, wenn<br />
die Meerforellen wieder steigen,<br />
sollte alles wieder fertig sein. In der<br />
Übergangszeit war die Treene per<br />
Spundwand abgesperrt und floss über<br />
einen 4 Meter breiten und 100 Meter<br />
langen Kanal. Für die über 20 Meter<br />
breite und 60 Meter lange Sohlgleite<br />
mussten 3.000 Tonnen Steine eingebracht<br />
werden! Schließlich muss sie<br />
stabil genug sein, um bei Hochwasser<br />
40 Kubikmetern Wasser je Sekunde<br />
standhalten zu können. Die Maßnahmen<br />
in Treia wurden finanziert<br />
aus Mitteln der EU, des Bundes und<br />
des Landes. Träger dieser Arbeiten<br />
an den Gewässern sind die Wasser-<br />
und Bodenverbände. Vielleicht helfen<br />
die Sohlgleiten dabei, dass der<br />
Niederschlag 2011<br />
1.400<br />
1.000<br />
800<br />
400<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Jacob Bundtzen vertritt den<br />
<strong>Wasserverband</strong> <strong>Nord</strong> im WRRL-<br />
Bearbeitungsgebiet Treene.<br />
fast ausgestorbene <strong>Nord</strong>seeschäpel<br />
wieder häufiger oberhalb von Treia<br />
gesichtet wird.<br />
Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit<br />
und errichtete im Projekt „Förderung<br />
des Kanutourismus“ einen Kanupass.<br />
Außerdem baute sie eine neue Fußgängerbrücke<br />
mit schönem Überblick<br />
über die Treene.