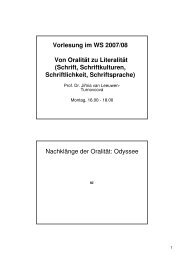Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
84<br />
85<br />
— Gibt es einen Wertewandel bei den unterschiedlichen Gruppen, <strong>der</strong> die<br />
bisherigen Abgrenzungen <strong>der</strong> ethnischen und religiösen Gruppen<br />
erodiert? Verlieren dabei die Gruppen an ihrer identitätsbildenden Kraft?<br />
Erscheinen dann gesellschaftliche Krisen als individuelle Krisen und wer<br />
den dann auch individuell verarbeitet?<br />
5. Methoden<br />
Die folgenden Ausführungen versuchen mögliche Methoden zu<br />
beschreiben, mit denen man sich den vorausgegangenen Fragestellungen<br />
nähern kann. Sie stützen sich auf die zu Beginn genannten<br />
Feldforschungen und streben selbstverständlich keine Vollständigkeit an.<br />
Narrative Gespräche und biographische Forschung<br />
Der biographische Ansatz (Fuchs 1984) ist ein optimaler Zugang für die<br />
Dokumentation <strong>der</strong> Identität sowie <strong>der</strong> hierdurch determinierten Formen<br />
interethnischer Koexistenz. Das Erzählen <strong>der</strong> Lebensgeschichte ist eine<br />
<strong>der</strong> wichtigsten Formen, die eigene Identität darzustellen und sich ihrer zu<br />
versichern (vgl. v. Engelhardt 1990, 197; Schimank 1988, 55). Begreift<br />
man mit Dausien & Alheit (1985, 8) Biographie als wechselseitige<br />
Beziehung von äußerem Lebenslauf unter historisch-gesellschaftlichen<br />
Bedingungen und <strong>der</strong> inneren, psychischen Entwicklung des Subjekts<br />
(Alheit 1992, 24f.), dann können sie als Ausdruck unverwechselbarer<br />
Individualität bei <strong>der</strong> Interpretation helfen, wie historische Prozesse erlebt<br />
und verarbeitet werden. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang Studien<br />
zur Oral History sowie <strong>der</strong> Untersuchung lebensgeschichtlicher Erfahrun<br />
gen (Niethammer 1994). Durch das biographische Interview können indi<br />
viduelle Erinnerung und kulturelles Gedächtnis (Assmann 1992), persön<br />
liche lebensgeschichtliche Erzählung sowie nationale historische Mythen<br />
und Erzählungen dargestellt und miteinan<strong>der</strong> in Bezug gesetzt werden.<br />
Narrative Gespräche können mit einem Teil strukturierter Fragen verse<br />
hen werden nnd mit „offenem Ende“ (Bargatzky 1997, 180-187) statt<br />
finden. Eine „rezeptivpassive Rolle“ (Esser 1975, 5. 79) des Forschers ist<br />
zu empfehlen. Dabei muss durch Pretests herausgefunden werden, ob <strong>der</strong><br />
geeignetste Gesprächstyp eher Schützes (1977) Begriff des „narrativen<br />
Interviews“ o<strong>der</strong> dem „ero-epischen Gespräch“ (fragend-erzählenden<br />
Gespräch) Patschei<strong>der</strong>s (1997) und Girtlers (2001, 147ff.) entspricht. In<br />
jedem Fall sollten beide Gesprächspartner in <strong>der</strong> Rolle des Lernenden<br />
sein, es soll also kein reines „Interview“ stattfinden, das den<br />
Gesprächspartner zu einer reinen Auskunftsperson machen würde. Am<br />
ergibigsten ist eine natürliche Gesprächssituation mit großem Spielraum<br />
für Spontaneität und Assoziation, die nicht durch einen überladenen<br />
Leitfaden leidet (wie dies Hopf 1979, 107 beschreibt). Meinungs<br />
äußerungen <strong>der</strong> Forschenden beeinflussen nicht nnbedingt die Aussagen<br />
des Interviewten, wie es Merton & Kendall (1979, 182) befürchten. Der<br />
Beginn eines biographischen Interviews kann sein, sich den Lebenslauf<br />
* des Gesprächspartners frei erzählen zu lassen, nachdem man ihn davon in<br />
Kenntnis gesetzt hat, was den Forscher beson<strong>der</strong>s interessiert. Die<br />
Lebensgeschichten sollten in <strong>der</strong> Reihenfolge, in <strong>der</strong> sie erlebt wurden,<br />
erzählt werden (biographische Methode nach Fischer-Rosenthal 1995).<br />
Um die Anfälligkeit <strong>der</strong> „Messung“ von Stereotypen, Vorurteilen, Mythen<br />
möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, in den Gesprächen nichtreaktiv<br />
vorzugehen und direkte Fragen zu vermeiden. Auch <strong>der</strong> verbale<br />
Ausdruck nnserer Gesprächspartner ist für diesen Zweck zu untersuchen.<br />
Im Gespräch sollte v.a. auf einfache sprachliche Formen geachtet werden<br />
wie Adjektive, Namen, Wortverbindungen, vergleichende Sätze und<br />
Ausrufe, Redewendungen (soweit sie nicht ihr affektives Potential verlo<br />
ren haben, Roth 1999, 26). So es möglich ist, sollten auch komplexe ver<br />
bale Formen wie Märchen und Sagen, Legenden, Schwänke systematisch<br />
untersucht werden: An Lie<strong>der</strong>n, Anekdoten und illustrativen Geschichten<br />
lassen sich Stereotype mit ethnischem Bezug herauslesen. Auch Varianten<br />
des Stroop-Tests (Wolcott 2Ö0 1) können angewendet werden.<br />
Gruppengespräche<br />
In freien Gruppengesprächen können kontroverse Auffassungen zum<br />
postulierten und tatsächlichen Wir-Gruppen-Verständnis sowie die<br />
Existenz „kollektiver Gruppenidentitäten“ (Schlee 2000b) erfasst werden.<br />
Gruppengespräche können darüber hinaus dazu dienen, einzelne<br />
Gesprächspartner gezielt auszuwählen, die für ausfLihrlichere Einzelgespräche<br />
von Interesse zu sein scheinen. In einem fortgeschrittenen<br />
L