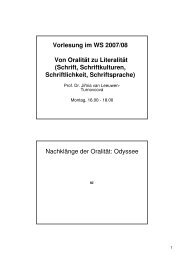Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Volltext - Institut für Slawistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
72 73<br />
3. Theorie<br />
Spätestens seit Goffman (1967) und Mead (1968) wird Identität6 sowohl<br />
in ihrer persönlich-individuellen Dimension als auch in ihrer sozialen,<br />
durch Gruppenzugehörigkeit und Fremdzuweisung bestimmten<br />
Dimension begriffen und die Identitätsbildung entsprechend als abhängig<br />
von Selbst- und Fremdwahrnehmung gesehen. Daher sollte versucht wer<br />
den, sich dem Problem sowohl aus <strong>der</strong> Innenperspektive als auch aus <strong>der</strong><br />
Perspektive <strong>der</strong> Kontaktgemeinschaften zu nähern. Im Sinn~ des symbol<br />
ischen Interaktjonismus (Goffman) sind Individuen in determinante<br />
soziale Netzwerke und communities of practice eingebettet. An <strong>der</strong><br />
Existenz eines kollektiven Bewusstseins, eines Wir-Gruppenbe<br />
wusstseins, kann kein Zweifel bestehen, genauso wenig daran, dass<br />
Selbst- und Fremdzuschreibungen und die daraus sich ergebenden „eth<br />
nischen Grenzziehungen“ (Barth 1969) immerzu in Verän<strong>der</strong>ung begriff<br />
en sind. Viele Vertreter ethnischer Gruppen werden in <strong>der</strong> EU<br />
Erweiterung auch die Chance. einer Stärkung <strong>der</strong> eigenen Identität und<br />
Kultur sehen. Ein Zuwachs an kultureller Diversität ist vielerorts schon zu<br />
spüren (Brezovszky et al. 1999, 73), es bildet sich zunehmend eine „Welt<br />
in Stücken“ (Geertz 1996), eine sehr fragmentierte Welt mit steigendem<br />
Individualisierungsprozess. Fragen zu Ethnizität, Identität und intereth<br />
nischen Beziehungen7 sind seit den 1980er Jahren auch ein Interessens<br />
gebiet <strong>der</strong> Kulturgeographie, in <strong>der</strong> sie nicht essentialistisch, son<strong>der</strong>n rela<br />
tional und dynamisch (Knox & Marston 2001, 254) begriffen werden.<br />
Die Erstellung und Interpretation von Biographien bilden einen<br />
Schwerpunkt <strong>der</strong> Identitätsforschung (s. Gedächtnistheorie von Luck<br />
6 Identität ist ein Selbstverständnis <strong>der</strong> Menschen, ein Bewusstsein von bestimmten<br />
Merkmalen, die durch Anerkennung, Nichtanerkennung und Vericennung an<strong>der</strong>er geprägt<br />
werden (Taylor 1993, 13).<br />
Den Terminus interethnische Beziehungen möchte ich nicht im weitgefassten Sinn als<br />
sämtliche Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen o<strong>der</strong> Individuen verstehen, son<strong>der</strong>n<br />
im engeren Sinne verstanden wissen als dynamische Prozesse zwischen ethnischen<br />
Gruppen o<strong>der</strong> Individuen, bei denen Ethnizität von Bedeutung ist (vgl. Zink 1996, 42f.)<br />
sowie als „organisierte Sozialgebilde mit einem aufeinan<strong>der</strong>bezogenen Handeln und be<br />
stimmten, historisch wechselnden Normvorstellungen“ (Weber-Kellermann 1978, 18).<br />
mann 1992 und Biographietheorie von Dausien & Alheit 1985).<br />
Dabei sei in Übereinstimmung mit Haarmarin (1996) <strong>der</strong> prozessuale<br />
Charakter <strong>der</strong> Konstituierung von Identität unterstrichen, <strong>der</strong> sich aus den<br />
Biographien als Lebensabläufe ergibt. In den Prozessen soziolcultureller<br />
und ethuischer Identifikation nimmt Religion einen vorrangigen Platz ein.<br />
Ethnische Identifikation als Reflex von Alteritätserfahrung ist ein<br />
wesentliches Element <strong>der</strong> Konstituierung von individueller Identität und<br />
<strong>der</strong> Partizipation an kollektiver Identität, <strong>der</strong> eigenen Zuordnung zu einer<br />
religiös bestimmten Gemeinschaft ebenso wie <strong>der</strong> Abgrenzung gegenüber<br />
(einer) an<strong>der</strong>en.<br />
Tritt die religiöse Identifikation in einer einheitlichen religiösen<br />
Umgebung in den Hintergrund, so erweist sie sich in Situationen und<br />
Räumen, in denen <strong>der</strong> Umgang mit an<strong>der</strong>en Religionen zum Alltag<br />
gehört, als wesentlich komplexer. Positive wie negative Erfahrungen mit<br />
Herrschaft (sei es als Privilegierung o<strong>der</strong> Diskriminierung <strong>der</strong> eigenen<br />
Religion, als Verweigerung des Rechts, die eigene Religion in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit überhaupt, nur bei bestimmten Gelegenheiten o<strong>der</strong> unter<br />
Einhaltung unbequemer sozialer Normzwänge auszuüben), Haltungen<br />
an<strong>der</strong>er gegenüber eigenen religiösen Praktiken, aber auch Erfahrungen<br />
des Zugangs zur an<strong>der</strong>en Gemeinschaft — alles dies lässt eine stets neu<br />
konstituierte Textur erkennen, aus <strong>der</strong> sowohl Krisenmomen~‘ beim<br />
Einzelnen als auch Spannungen zwischen religiös determinierten<br />
Gemeinschaften und Erscheinungen von gruppeninterner und gruppenex<br />
terner Solidarität entstehen. Die Gewohnheit, mit Angehörigen einer<br />
an<strong>der</strong>en Religion dieselbe Sprache zu reden, lässt im täglichen Umgang<br />
mit dem an<strong>der</strong>en einerseits das Fremdheitsgefühl geringer sein (insbeson<br />
<strong>der</strong>e bei mehrsprachigen Interakteuren); an<strong>der</strong>erseits kommt es dabei häu<br />
fig zu Abgrenzungen und Ablehnungen des an<strong>der</strong>en, vor allem, wenn dies<br />
an negative persönlich-unmittelbare o<strong>der</strong> vermittelte Erfahrungen<br />
geknüpft ist.<br />
Für die Bestimmung des Min<strong>der</strong>heitenbegriffs müssen sowohl objektive<br />
(Sprache, Herkunft, Gesellschaftsstruktur, gemeinsame Geschichte) als<br />
auch subjektive (Wir-Bewusstsein, staatsbürgerliches Verhalten)<br />
Min<strong>der</strong>heitskategorien bemüht werden (Modelle nach Haarmann 1983,<br />
21-42). Min<strong>der</strong>heiten werden im Multikulturalismus in <strong>der</strong> Regel nicht