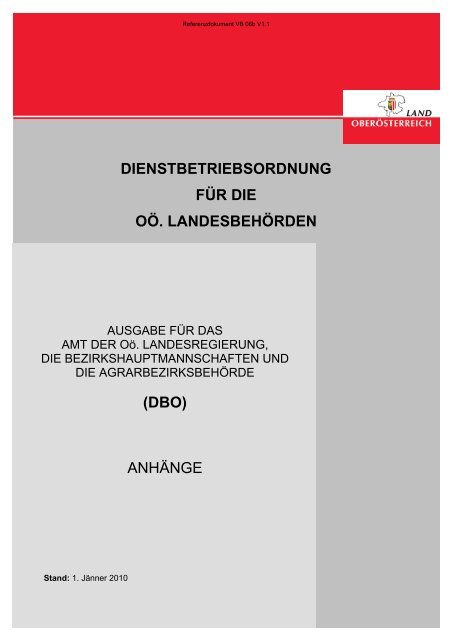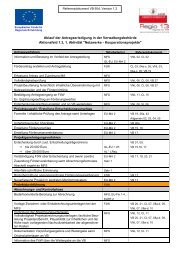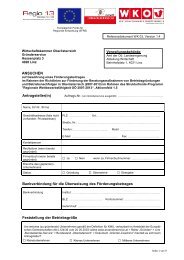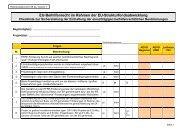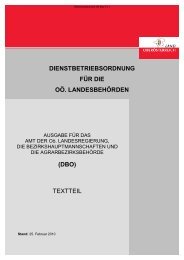VB 06b Dienstbetriebsordnung DBO-A Anhaenge V1.1 - Regio13
VB 06b Dienstbetriebsordnung DBO-A Anhaenge V1.1 - Regio13
VB 06b Dienstbetriebsordnung DBO-A Anhaenge V1.1 - Regio13
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
DIENSTBETRIEBSORDNUNG<br />
FÜR DIE<br />
OÖ. LANDESBEHÖRDEN<br />
AUSGABE FÜR DAS<br />
AMT DER Oö. LANDESREGIERUNG,<br />
DIE BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFTEN UND<br />
DIE AGRARBEZIRKSBEHÖRDE<br />
(<strong>DBO</strong>)<br />
ANHÄNGE<br />
Stand: 1. Jänner 2010<br />
1
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Verzeichnis der Anhänge zur <strong>DBO</strong> *<br />
Anhang zu § ... <strong>DBO</strong><br />
Gegenstand<br />
§ 3 Abs. 3 Sonstige innerdienstliche Vorschriften und Sonderregelungen, die für<br />
den inneren Dienst wesentliche Bedeutung haben<br />
§ 4 Abs. 3 Notanordnungen von Sachverständigen des Amtes der Oö. Landesregierung<br />
in Katastrophenfällen<br />
§ 11 Abs. 4 Organigrammstandards für die Abteilungen des Amtes der Landesregierung<br />
§ 11 Abs. 5 Organisation und Aufgabenstellung der Büros der Mitglieder der Landesregierung<br />
§ 17 Abs. 3 Sachverständige – Weisungen<br />
§ 19 Abs. 7 Anordnung von Überstunden<br />
§ 19 Abs. 9 Hauptaufgaben der Direktorinnen bzw. Direktoren und der Abteilungsleiterinnen<br />
bzw. Abteilungsleiter<br />
1 zu § 28 Abs. 1 und 2 Flexible Arbeitszeit mit elektronischer Zeiterfassung<br />
2 zu § 28 Abs. 1 und 2 Flexible Arbeitszeit mit händischer Zeiterfassung<br />
§ 28 Abs. 5 bzw. Dienstzeitregelung: 24. und 31. Dezember und Karfreitag<br />
§ 29 Abs. 5<br />
§ 32 Abs. 1 Dienstverhinderungen; Definition der Abwesenheitsgründe "Arztbesuch"<br />
und "(wichtiger) Behördengang"<br />
§ 34 Richtlinien für die Gewährung von Sonderurlaub<br />
1 zu § 35 Abs. 2 Pflegefreistellung<br />
2 zu § 35 Abs. 2 Sonderurlaub und Genehmigung von Kuraufenthalten (für Beamte);<br />
Übertragung der Entscheidungsbefugnis an die Dienststellenleiter<br />
§ 37 Abs. 7 bzw. Rufbereitschaft beim Amt der Oö. Landesregierung<br />
§ 38 Abs. 5<br />
1 zu § 41 Abs. 1 Expertenkonferenzen der Bundesländer – Richtlinien<br />
2 zu § 41 Abs. 1 Richtlinien für gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter<br />
§ 41 Abs. 2 Externe Fortbildung; Tagungen etc.; Genehmigung<br />
§ 42 Abs. 4 Auswärtige Dienstverrichtung; Außendiensttagebuch<br />
§ 43 Richtlinien für den Ausgleich von Reisezeiten außerhalb der Amtsstunden<br />
durch Freizeit<br />
1 zu § 51 Elektronische Datenverarbeitung in der Landesverwaltung; organisatorische<br />
Regelungen<br />
2 zu § 51 Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)<br />
3 zu § 51 Dienstvergütung für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren, IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren und IT-<br />
Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender; Neuregelung ab 1. Jänner<br />
2006<br />
4 zu § 51 Richtlinien für den Einsatz von Einrichtungen der Informations- und<br />
Kommunikationstechnologie<br />
5 zu § 51 Vorkehrungen für Datenschutz und Datensicherheit<br />
6 zu § 51 Einsicht in von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendete Daten und<br />
Programme durch den Dienstgeber<br />
§ 52 Abs. 1 Einsatz von Telefax-Geräten<br />
§ 53 Einsatz von Kraftfahrzeugen im Dienstbetrieb<br />
§ 54 Abs. 1 Bibliotheksordnung für die Amtsbibliothek des Amtes der Oö. Landesregierung<br />
§ 55 Abs. 4 Bürgernahe Verwaltung – Verständigung der betroffenen Personen<br />
3
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § ... <strong>DBO</strong><br />
Gegenstand<br />
§ 55 Abs. 6 Schriftverkehr; Anrede und Grußformel<br />
§ 58 Abs. 2 Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnungen und Unterschriftsklauseln<br />
im Bereich der Hoheitsverwaltung bzw. der Privatwirtschaftsverwaltung<br />
§ 60 Abs. 2 Vermerke auf dem Erledigungsentwurf<br />
§ 64 Amtssiegel; Landessigel<br />
§ 70 Abs. 1 Verschlusssachen; vertrauliche Geschäftsstücke<br />
§ 70 Abs. 2 Vertraulichkeit von Schriftstücken – Schutz von berechtigten Interessen<br />
von Personen<br />
§ 71 Äußere Form der Regierungssitzungsstücke; Arbeitsablauf vor und<br />
nach Behandlung in der Sitzung der Oö. Landesregierung<br />
§ 76 Verbesserungsvorschläge<br />
§ 77 Abs. 1 und 2 Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht und Amtshilfeersuchen<br />
§ 77 Abs. 4 Einsicht in Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit Diplomarbeiten,<br />
Forschungsaufträgen udgl.<br />
1 zu § 77 Abs. 5 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz<br />
2 zu § 77 Abs. 5 Umweltinformationsgesetz; Oö. Umweltschutzgesetz 1996; Durchführung<br />
§ 78 Objektive und unparteiische Entscheidungen von Landesbediensteten<br />
§ 80 Abs. 1 Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten; Genehmigungspflicht<br />
§ 81 Vertretung in Körperschaften des öffentlichen und des privaten Rechts,<br />
in Beräten udgl. durch Bedienstete<br />
* Es wird darauf hingewiesen, dass die in der <strong>DBO</strong> enthaltenen Anhänge mitunter nicht dem Letztstand<br />
der zugrundeliegenden Erlässe entsprechen.<br />
4
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 3 Abs. 3 <strong>DBO</strong><br />
Sonstige innerdienstliche Vorschriften und Sonderregelungen,<br />
denen im Bereich des inneren Dienstes wesentliche Bedeutung zukommt 1<br />
Neben der <strong>Dienstbetriebsordnung</strong>, der Kanzleiordnung, dem Organisationsplan des Amtes der<br />
Landesregierung und dem Komptenezen-Katalog sind im Besonderen folgende Regelungen zu<br />
beachten:<br />
1. Richtlinien für das Projektmanagement (PM) im Landesdienst<br />
Erlass vom 19. Oktober 1992, PräsI-100083/55-Kr/S<br />
2. Controlling-Leitbild<br />
Erlass vom 18. Dezember 2000, PräsI-100091/142-2000-Kg/Bra<br />
3. Kostenstellenplan und Verzeichnis der Produktzentren des Landes Oberösterreich<br />
4. Telefonie beim Land Oberösterreich – Telekommunikationsordnung (TKO)<br />
Erlass vom 6. Mai 2008, Präs-2007-8061/16-Ls/RM<br />
5. Einführung von A1Network – Mobile Nebenstellenanlagen beim Land OÖ<br />
Erlass vom 11. Juni 2002, PräsI-014106/13-2002-B/Ba<br />
6. Sprechfunkordnung für die Oö. Landesbehörden – Katastrophenfunknetz<br />
Erlass vom 24. Februar 2006, Präs-2005-8459/3<br />
7. Informations- und Wissensmanagement – Verteiler für Rundschreiben – Neugestaltung<br />
Erlass vom 29. November 2007, Präs-2007-6800/3-LD/BRA<br />
8. Volksanwaltschaft; Vorgangsweise<br />
Erlass vom 27. August 1993, PräsI-6800/3-LS/BRA<br />
9. Ermittlung von "Leistungsmengen- und Kennzahlen (LMKZ)"; Änderung der bisherigen<br />
Vorgehensweise<br />
Erlass vom 13. Mai 2008, Präs-2008-15765/1-RL/MS<br />
10. Organisationsguide für E-Government-Aktivitäten<br />
Erlass vom 13. Februar 2001, PräsI-063034/28-2000-Heu/Schm<br />
11. Telearbeit beim Land Oberösterreich<br />
Erlass vom 31. August 2004, PersR-450158/540-2004-Hm<br />
12. Melden von Dienstverhinderungen<br />
Erlass vom 19. März 1996, PersR-230013/136-1996-Hem<br />
13. Dienstfreistellung für Gemeindemandatare<br />
Erlass vom 22. Juni 1998, PersR-230011/121-1998/G<br />
14. Jobbörse – Neuerungen<br />
Erlass vom 28. Mai 1998, PersI/R-230029/870-1998/WA<br />
1<br />
Die angeführten innerdienstlichen Erlässe ("PräsI", "PersI", "FinI") bleiben (neben dem Test und den<br />
anderen Anhängen der <strong>DBO</strong>) weiterhin in Geltung.<br />
5
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
15. Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich<br />
Fin-010000/138-I-1998 idgF, Ausführungsbestimmungen FinD-010000/310-I-2008-Ni/pa idgF<br />
16. Dienstanweisung für die Landesbuchhaltung und die Personalverrechnung<br />
Erlass von 10. Jänner 2008, FinD-010000/310-I-2008-Ni/Pa<br />
17. Buchhaltungsorganisationsvorschriften gemäß § 11 der Dienstanweisung für die Landesbuchhaltung<br />
und die Personalverrechnung<br />
Erlass vom 11. Februar 2009, FinD-010515/3-I-2009-Ri/Ma<br />
18. Gebarung mit streng verrechenbaren Drucksorten<br />
Erlass vom 15. Mai 2007, FinI-050218/112-I-2007-Kra/Ma<br />
19. Richtlinien für die Verwaltung der beweglichen Sachen bei den Organisationseinheiten<br />
des Landes Oberösterreich (RIM-L)<br />
Erlass vom 8. Mai 1989, FinI-6061/54-I-Stö (in Kraft getreten am 1. Juli 1989) idgF; Ausführungsbestimmungen<br />
20. Brandschutzorganisation für die Gebäude des Amtes der Oö. Landesregierung<br />
Erlass vom 30. Mai 2007, GBM-010156/21-2007-Pei/FB idgF<br />
21. Abfalltrennung in Amtsgebäuden; Erlass über die Abfalltrennungsordnung (ATO)<br />
Erlass vom 20. Mai 2007, GBM-725000/9-Pei/Hie<br />
22. Bürgernahe Sprache im Schriftverkehr der Oö. Landesbehörden<br />
Erlass vom 31. März 1982, PräsI-6709/1-12/Me/LE<br />
23. Genehmigung von ICT-Ausstattung<br />
Erlass vom 10. März 2004, PräsI-060001/204-2004-Heu<br />
24. Beschwerdemanagement bei der Bürgerservicestelle<br />
Erlass vom 6. Oktober 2004, PräsI-135356/169-2004-Ws/Bra<br />
25. Impressumspflicht und Offenlegungspflicht für Websites und Newsletter<br />
Erlass vom 13. Oktober 2005, Pr-050.029/6-Has/La<br />
26. Leitfaden Verhalten von Vorgesetzen bei Dienstpflichtverletzungen<br />
Erlass vom 27. April 2005, PersR-450344/1-2005-Pr/Gem<br />
27. Richtlinien für die Herausgabe von Druckwerken des Landes Oberösterreich<br />
Erlass vom 14. November 2005, Pr-250.000/558-2005-Gri<br />
28. Aktenordnung für das Amt der Oö. Landesregierung und die Oö. Bezirkshauptmannschaften<br />
Erlass vom 15. März 1971, PräsI-8631/2-KzlDion<br />
29. Umstellung der Aktenevidenz<br />
Erlass vom 15. Oktober 2001, PräsI-190033/57-2001-Ilk/Ei<br />
30. Skartierungsordnung für die Bezirkshauptmannschaften<br />
Erlass vom 23. Dezember 1996, PräsI-120001/115-KE, ergänzt durch den Erlass vom 10. Juni<br />
1997, PräsI-120001/120-KE<br />
31. Gebarungsabwicklung und Haushaltsführung bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
Erlass vom 5. Dezember 2001, FinI-010000/251-I-2007-Ni/Fr<br />
6
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
32. Rufbereitschaft der Amtstierärzte Oberösterreichs<br />
Erlass vom 3. August 1979, Vet-2000/33-1979-Za/Wi<br />
33. Pilotprojekt "Verfahrenskonzentration im Anlagenrecht": Ergebnis<br />
Erlass vom 4. September 1995, PräsI-090011/51-Li<br />
7
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 4 Abs. 3 <strong>DBO</strong><br />
Notanordnungen von Sachverständigen des<br />
Amtes der Landesregierung in Katastrophenfällen 1<br />
Sachverständige Bedienstete des Amtes der Landesregierung oder der Bezirkshauptmannschaften,<br />
die im Rahmen einer Rufbereitschaft oder einer sonstigen dienstlichen Anordnung zu einer<br />
Katastrophe bzw. einem Unfall gerufen werden, sind ermächtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen<br />
Vorschriften (Katastrophenhilfsdienst-Gesetz LGBl. Nr. 88/1955, Gewerbeordnung 1994 usw.)<br />
Notanordnungen – auch mit Bescheidcharakter – zu treffen, wenn von der zuständigen Behörde<br />
keine Bedienstete bzw. kein Bediensteter, die bzw. der zum Erlassen von Bescheiden befugt ist,<br />
rechtzeitig erreicht werden kann.<br />
Die bzw. der sachverständige Bedienstete gilt in diesem Fall als der zuständigen Behörde (Landeshauptmann,<br />
Landesregierung, Bezirkshauptmannschaft) zugeteilt.<br />
Die bzw. der Sachverständige hat die Notanordnung unverzüglich einer bzw. einem Bediensteten<br />
der zuständigen Behörde, die bzw. der zum Erlassen von Bescheiden befugt ist, mitzuteilen.<br />
Diese Regelung gilt nicht für das übliche Einschreiten bei Ölunfällen, bei denen der Bürgermeister<br />
gemäß § 31 Abs. 3 WRG 1959 Anordnungen trifft.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 8. November 1982, PräsI-6796/18-R/Re.<br />
9
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 11 Abs. 4 <strong>DBO</strong><br />
Organigramm-Standards für Abteilungen<br />
Inhaltsübersicht<br />
Vorwort<br />
Allgemeines<br />
Abgabe/Abgabestelle<br />
Ansprechpersonen<br />
Gesamtorganigramm & Direktionsorganigramm<br />
Abteilungsorganigramme<br />
Organigramm Vorlage<br />
Warum wurde Microsoft Excel gewählt?<br />
Angaben zur Organigramm-Vorlage<br />
Ablaufplan<br />
Download, Öffnen und Speichern der Vorlage<br />
Übersicht der Organigramm-Vorlage<br />
Werkzeugleiste<br />
Vorgaben<br />
Abteilungskästchen<br />
Direktionskästchen<br />
Sekretariatskästchen<br />
Stabsstellenkästchen<br />
nachgeordnete Organisationseinheiten-Kästchen<br />
Gruppenkästchen<br />
Fachbereichskästchen*<br />
Referatskästchen<br />
Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen<br />
Legende<br />
Linien<br />
Landeslogo<br />
Abteilungslogo<br />
Anordnung der Kästchen<br />
Erstellung des Übersichtsorganigramms<br />
Vorgehensweise beim Erstellen des Übersichtsorganigramms<br />
Linien und Verbinder<br />
Ausrichtung der Kästchen<br />
Erstellen des Aufgabenorganigramms<br />
Vorgehensweise beim Erstellen des Aufgabenorganigramms<br />
Erstellen des Namensorganigramms<br />
Vorgehensweise beim Erstellen des Namensorganigramms<br />
Papierformat<br />
Einstellen des Papierformats<br />
Erstellen eines PDFs<br />
Zusammenarbeit mit anderen Programmen<br />
Verwendung der Organigramme im Word<br />
Verwendung der Organigramme im PowerPoint<br />
Spezialfälle<br />
Sehr viele nachgeordnete Organisationseinheiten<br />
Organigramme mit mehreren Seiten<br />
Fachbereichskästchen*<br />
Häufig gestellte Fragen<br />
Eigene Notizen<br />
* Vorläufige Regelung<br />
11
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorwort<br />
Von den Abteilungen wurden bisher in sehr unterschiedlichem Ausmaß und Aussehen die Organigramme<br />
gestaltet. Seit längerer Zeit gibt es Überlegungen nach einheitlichen Organigrammstandards.<br />
Diese sollen nun im Rahmen der NAO Umsetzung realisiert werden.<br />
Aufgrund der Vorlagen ist eine einheitliche Organigrammgestaltung im Aussehen und in den<br />
Inhalten gewährleistet. Diese Vorlagen sind für Sie zum Erstellen der Organigramme vorgesehen.<br />
Die nachstehenden Seiten des Skriptums dienen hauptsächlich als Anleitung zur Erstellung der<br />
Organigramme.<br />
Ziel ist, dass die Landesbediensteten im Intranet anhand des von ihnen gestalteten Übersichtsorganigramms<br />
(Seite 1) die Abteilungsstruktur leicht erkennen können.<br />
Zudem verweisen wir auch auf den Erlass der Abteilung Präsidium vom 17. März 2008. (Präs-<br />
2006-7879/19-SF/BRA)<br />
12
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Allgemeines<br />
Die Organigramme sind bis zum 31. März des Jahres der Abteilung Präsidium zu übermitteln. Es<br />
ist vorgesehen die Organigramme mittels E-Mail an folgendes Postfach zu übermitteln:<br />
praes.post@ooe.gv.at<br />
Abgabe/<br />
Abgabestelle<br />
Organisatorische Fragen:<br />
Günther Schleifer, DW 114 45<br />
DI Daniela König, DW 111 91<br />
Mag. Sigrid Wiesinger, DW 111 77<br />
Ansprechpersonen<br />
Fragen zur technischen Umsetzung:<br />
Bei einer Supportanforderung zur technischen Umsetzung der Organigramme kontaktieren Sie<br />
bitte Ihre/n IT-KoordinatorIn. Kann diese/r das Problem nicht lösen, wird das LIS@-Zentrum über<br />
das Ticketsystem informiert. Es wird sich dann ein/e Mitarbeiter/in des LIS@-Zentrums bei Ihnen<br />
melden.<br />
Das Gesamtorganigramm und die Direktionsorganigramme sind bereits von der Abteilung Präsidium<br />
angefertigt und im Internet/Intranet publiziert worden. Die Abteilung Präsidium übernimmt<br />
auch die Wartung dieser Organigramme.<br />
Gesamtorganigramm &<br />
Direktionsorganigramm<br />
Intranet:<br />
Organisation > Amt der Oö. Landesregierung<br />
Internet:<br />
Verwaltung > Amt der Oö. Landesregierung > Die Organisation und ihre Dienstleistungen auf<br />
einen Blick<br />
Es ist vorgesehen, dass jede Abteilung ein Übersichts-, Aufgaben- und Namensorganigramm<br />
erstellt.<br />
Abteilungsorganigramme<br />
Das Übersichtsorganigramm enthält die grundlegende Struktur der Abteilung (Gruppen, Referate,<br />
Sekretariate, ev. Stabsstellen, nachgeordnete Organisationseinheiten).<br />
Im Aufgabenorganigramm wird die gleiche Struktur wie im Übersichtsorganigramm dargestellt<br />
und mit den Hauptaufgaben ergänzt.<br />
Im Namensorganigramm werden die Namen der Mitarbeiter/innen mit den jeweiligen Legendenabkürzungen<br />
ergänzt.<br />
13
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Organigramm-Vorlage<br />
Für die Organigramm-Vorlage wurde Microsoft Excel aus folgenden Gründen gewählt:<br />
• Microsoft Excel ist standardmäßig auf jedem Computer beim Land Oberösterreich installiert.<br />
• Einfache Skalierung von A3 auf A4 bzw. umgekehrt ist möglich.<br />
• Bestimmte Bereiche können als Druckbereich definiert werden.<br />
• Es kann festgelegt werden, ob ein Element gedruckt werden soll oder nicht.<br />
• Eine angepasste Werkzeugleiste wurde zur Unterstützung an die Vorlage angehängt.<br />
• Einfache Ausrichtung der Grafiken an einem sichtbaren, vordefinierten Raster, der nicht<br />
gedruckt wird.<br />
Warum wurde Microsoft<br />
Excel gewählt?<br />
Die Organigramm-Vorlage finden Sie im Intranet unter Service A-Z > Grafik Service > Angebote<br />
zur Umsetzung > Excel sowie das Skriptum unter Service A-Z > Grafik Service > Hilfe ><br />
Corporate Design - Handbuch für Word und Excel.<br />
• Die Vorlage ist standardmäßig auf A3 eingerichtet. Sie kann aber einfach auf A4 skaliert<br />
werden.<br />
• Die Vorlage wurde für einen 17 Zoll-Bildschirm optimiert. Steht kein 17-Zoll-Bildschirm zur<br />
Verfügung, sollte der Zoom von Ihnen angepasst werden, um eine optimale Anzeige zu<br />
ermöglichen.<br />
• Die Vorlage wurde ohne <strong>VB</strong>A-Programmierung erstellt, damit es zu keinen Problemen mit<br />
diversen Sicherheitseinstellungen und Versionswechseln kommt.<br />
• In der Vorlage stehen Ihnen vier vordefinierte Seiten zur Verfügung.<br />
• Die Farbwerte wurden vom Präsidium vorgegeben und dürfen nicht verändert werden.<br />
Angaben zur Organigramm-Vorlage<br />
Info:<br />
<strong>VB</strong>A ist die Standard-<br />
Programmiersprache der<br />
Office-Programme.<br />
14
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Ablaufplan<br />
Download, Speichern und Öffnen der Organigramm-Vorlage<br />
Erstellen des Übersichtsorganigramms<br />
Erstellen des Aufgabenorganigramms<br />
Erstellen des Namensorganigramms<br />
Erstellen von PDF-Dateien<br />
Übermitteln der PDF-Dateien an die Abteilung Präsidium<br />
Publizieren des Übersichtsorganigramms im Intranet<br />
15
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die Vorlage befindet sich im Intranet unter Service A-Z > Grafik Service > Angebote zur Umsetzung<br />
> Excel<br />
Download, Öffnen und<br />
Speichern der Vorlage<br />
1. Klicken Sie mit der<br />
rechten Maustaste auf<br />
den Link Vorlage zur<br />
Erstellung des Abteilungsorganigramms<br />
und wählen Sie Ziel<br />
speichern unter.<br />
2. Geben Sie den Dateinamen<br />
ein.<br />
3. Beenden Sie den<br />
Download mit Schließen.<br />
Info:<br />
Der vorgegebene Dateiname<br />
lautet:<br />
Dir.kurzbezeichnung_Abt.<br />
kurzbezeichnung_Jahr_<br />
V1.xls oder<br />
Dir.kurzbezeichnung_Jahr_<br />
V1.xls<br />
Überschreiben Sie diesen<br />
laut Ihren Angaben.<br />
(Beispiel:<br />
PräsD_Präs_2008_V1.xls<br />
oder<br />
IKD_2008_V1.xls)<br />
Der Buchstabe V steht für<br />
Version.<br />
4. Öffnen Sie nun den<br />
Arbeitsplatz und wählen<br />
Sie das Verzeichnis<br />
aus, indem Sie die Vorlage<br />
abgespeichert haben.<br />
5. Sie sehen nun die<br />
Oberfläche der Organigramm-Vorlage.<br />
Diese<br />
wird Ihnen im<br />
nächsten Kapitel näher<br />
erklärt.<br />
16
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Übersicht der Organigramm-Vorlage<br />
3<br />
5 15<br />
6<br />
7 9 7 8<br />
9<br />
4<br />
16<br />
10 10<br />
10a<br />
11<br />
1<br />
14<br />
14<br />
11<br />
12<br />
2<br />
13<br />
17<br />
19<br />
18<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Arbeitsbereich<br />
Im Arbeitsbereich wird das Organigramm erstellt. Es befinden sich bereits Beispielelemente darin,<br />
die Sie für Ihr Organigramm verwenden können.<br />
Raster<br />
Dient zur einfachen Ausrichtung der Kästchen bzw. zur Orientierung. Der Raster wird nicht gedruckt.<br />
Werkzeugleiste<br />
In der Werkzeugleiste befinden sich Befehle, die Ihnen die Erstellung der Organigramme erleichtern.<br />
Auswahlbereich mit diversen Kästchen und Infoangaben<br />
Im Auswahlbereich stehen Ihnen zusätzliche Kästchen und Infoangaben zur Verfügung. Diese<br />
können einfach in den Arbeitsbereich verschoben werden. Wenn Sie ein Organigramm drucken,<br />
wird der Auswahlbereich nicht mitgedruckt.<br />
17
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
10a<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Abteilungskästchen<br />
Je nach Struktur der Direktion wird entweder ein Abteilungskästchen oder ein Direktionskästchen<br />
verwendet.<br />
Direktionskästchen<br />
Ein Direktionskästchen wird nur bei Direktionen verwendet, denen keine Abteilungen zugeordnet<br />
sind.<br />
Sekretariatskästchen<br />
Stabsstellenkästchen<br />
Auf der Abteilungsebene können auch Stabsstellen eingerichtet werden (Stabsstellen haben<br />
keine operativen Verantwortungen, ist Unterstützungsfunktion für Abteilungsleitung z.B. Sekretariate,<br />
Kostenrechnung, Budget, Controlling, ...).<br />
Für Unterstützungsfunktionen muss aber keine Stabsstelle eingerichtet werden, nämlich dann<br />
nicht, wenn diejenige Mitarbeiterin/derjenige Mitarbeiter die/der die entsprechenden Aufgaben<br />
wahrnimmt auch in der Linie Aufgaben hat und dadurch sein Mitarbeiter/innengespräch mit einer/einem<br />
Gruppen- oder Referatsleiter/In führt. Diese Stabsfunktionen sind dann z.B. mittels<br />
Fußnote (z.B. Stabsfunktion Controlling, Stabsfunktion Personalverwaltung, ...) beim Namensorganigramm<br />
zu vermerken.<br />
Nachgeordnete Organisationseinheiten-Kästchen<br />
Nachgeordnete Organisationseinheiten sind jene Organisationseinheiten, die im Organisationsplan<br />
als solche eingerichtet sind (entspricht hellblaue Kästchen im Gesamtorganigramm).<br />
Gruppenkästchen<br />
Fachbereichskästchen* (siehe Hinweis unter Spezialfälle)<br />
Referatskästchen<br />
Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen<br />
Im Aufgabenorganigramm wird dieses Kästchen für die Hauptaufgaben verwendet. Im Namensorganigramm<br />
werden die Namen und die entsprechenden Legendenabkürzungen in diesem<br />
Kästchen angegeben.<br />
Legende<br />
Die Legende wird nur im Namensorganigramm eingefügt.<br />
Infoangaben<br />
Die rot umrahmten Kästchen dienen nur zur Information.<br />
Landeslogo<br />
Hilfslinien<br />
Die Hilfslinien grenzen den Druckbereich horizontal und vertikal ein. Diese Linien umfassen immer<br />
genau eine Seite. Gedruckt werden diese Linien nicht.<br />
Tabellenblattname<br />
Das vorhandene Tabellenblatt wird vervielfältigt und nach dem jeweiligen Organigramm benannt.<br />
*Vorläufige Regelung<br />
Übersicht der Organigramm-Vorlage<br />
18
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Übersicht der Organigramm-Vorlage<br />
18<br />
1<br />
Kopf- und Fußzeile<br />
Die Fußzeile ist nur in der Seitenansicht bzw. am Ausdruck ersichtlich. Der Vorteil einer Fußzeile<br />
ist, dass dieser Text auf jeder Seite wiederholt und nicht jedes Mal eingegeben werden muss.<br />
Seitennummerierung<br />
Auf dem Übersichtsorganigramm ist die Seitennummer bereits definiert. Alle Seiten werden mit<br />
der Nummer 1 und den Zusätzen a, b, c bezeichnet. D.h. 1. Seite = Seite 1, 2. Seite = Seite 1a,<br />
3. Seite = Seite 1b, usw. Dies soll von Ihnen in den Folgeorganigrammen beachtet bzw. korrigiert<br />
werden.<br />
19
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Werkzeugleiste<br />
In der Werkzeugleiste finden Sie alle Befehle zur Erstellung der Organigramme.<br />
1 2 3 4<br />
5 6 7 8<br />
9 10 11 12 13<br />
14 15 16 17<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Seite einrichten<br />
Mit dieser Funktion können Sie das Papierformat von A3 auf A4 stellen. Weiters können Sie auch<br />
die Kopf- und Fußzeile mit diesem Befehl verändern.<br />
Drucken<br />
Mit dem Befehl Drucken gelangen Sie in das Druckermenü. Hier wählen Sie den gewünschten<br />
Drucker und den Druckbereich aus.<br />
Seitenansicht<br />
In der Seitenansicht sehen Sie eine vollständige Übersicht Ihres gezeichneten Organigramms,<br />
ohne dem Raster und den ausgeblendeten Objekten. So wie das Organigramm in dieser Ansicht<br />
aussieht, wird es auch gedruckt.<br />
Am Raster ausrichten<br />
Diese Funktion sollte immer aktiv sein, da Sie so die Kästchen am Raster ausrichten können.<br />
Objekte markieren<br />
Dieser Befehl erlaubt es Ihnen mit gedrückter Maustaste mehrere Objekte auf der<br />
Arbeitsoberfläche zu markieren.<br />
Gruppierung<br />
Mit der Befehlsgruppe Gruppierung können Sie mehrere Objekte miteinander gruppieren bzw. die<br />
Gruppierung wieder aufheben.<br />
Ausrichtung<br />
Mit den Befehlen in der Befehlsgruppe Ausrichtung können Sie mehrere Objekte miteinander<br />
ausrichten.<br />
Reihenfolge<br />
Mit den Befehlen in der Befehlsgruppe Reihenfolge können Sie die Reihenfolge der auf der<br />
Arbeitsoberfläche angezeigten Objekte ändern.<br />
Gerade Verbindung<br />
Mit dem geraden Verbinder können Sie eine gerade Verbindung zwischen zwei Objekten<br />
herstellen. Dieser Verbinder klebt automatisch am Objekt.<br />
Gewinkelte Verbindung<br />
Mit dem gewinkelten Verbinder können Sie eine gewinkelte Verbindung zwischen zwei Objekten<br />
herstellen. Dieser Verbinder klebt automatisch am Objekt.<br />
20
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Werkzeugleiste<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Linie<br />
Mit dem Linien-Werkzeug können Sie beliebig aussehende Verbindungen zwischen den Objekten<br />
zeichnen. Diese Linien kleben nicht automatisch am Objekt.<br />
Linienart<br />
Hier können Sie die Stärke der Linie ändern.<br />
Strichart<br />
Hier können Sie die Art der Linie ändern.<br />
Schriftart vergrößern/verkleinern<br />
Mit diesen beiden Befehlen können Sie die Schriftart in den Kästchen vergrößern bzw. verkleinern.<br />
Textfeld<br />
Mit dem Textfeld-Symbol können Sie weitere Textfelder auf Ihrer Arbeitsoberfläche hinzufügen.<br />
AutoFormen<br />
In dieser Befehlsgruppe finden Sie die Befehle zum Zeichnen von einem Rechteck, Linien und<br />
Pfeilen.<br />
Füllfarbe<br />
Mit dem Symbol Füllfarbe können Sie gezeichnete AutoFormen einfärben.<br />
21
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Wie die Kästchen aussehen ist vorgegeben. Grundsätzlich sollten Sie an den vorgegebenen<br />
Kästchen nichts, außer dem Inhalt und Anzahl, ändern.<br />
Bei allen Kästchen ist die Schriftart auf Arial eingestellt. Diese Schriftart soll nicht verändert werden.<br />
Abteilungskästchen<br />
Farbe: gelb (RGB: 255/239/67) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 14 pt<br />
1. Zeile: Wort Abteilung<br />
2. Zeile Abteilungsname mit Kurzbezeichnung in Klammer – fett<br />
3. Zeile: Wort Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter oder z.B. Landeskulturdirektorin/Landeskulturdirektor<br />
– fett<br />
4. Zeile: Familienname, Vorname und Titel der Abteilungsleiterin oder des Abteilungsleiters<br />
– fett<br />
Position: Die Position des Kästchens soll nicht verändert werden.<br />
Das Kästchen ist maximal 4 Zeilen hoch und soll idealerweise in der Größe nicht verändert werden.<br />
Wenn der Platz für den Text nicht ausreicht, können Sie die Schriftgröße verändern.<br />
Beispiel:<br />
Direktionskästchen<br />
Farbe: blau (RGB: 0/118/189) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 14 pt<br />
1. Zeile: Wort Direktion<br />
2. Zeile: Direktionsname mit Kurzbezeichnung in Klammer – fett<br />
3. Zeile: Wort Direktorin/Direktor oder z.B. Landeskulturdirektorin/Landeskulturdirektor –<br />
fett<br />
4. Zeile: Familienname, Vorname und Titel der Direktorin oder des Direktors – fett<br />
Position: Wenn Sie das Direktionskästchen verwenden, legen Sie es direkt über das Abteilungskästchen.<br />
Info:<br />
Je nach Struktur der Direktion<br />
wird entweder das Abteilungskästchen<br />
oder das<br />
Direktionskästchen (wenn<br />
keine Abteilung zugeordnet<br />
ist) verwendet.<br />
Pro Seite darf nur ein solches<br />
Kästchen vorkommen.<br />
Das Kästchen ist maximal 4 Zeilen hoch und soll idealerweise in der Größe nicht verändert werden.<br />
Wenn der Platz für den Text nicht ausreicht, können Sie die Schriftgröße verändern.<br />
Beispiel:<br />
22
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Sekretariatskästchen<br />
Farbe: grau (RGB: 192/192/192) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt<br />
1. Zeile: Wort Sekretariat<br />
Position: links unterhalb des Abteilungs- bzw. Direktionskästchens<br />
Dieses Kästchen enthält grundsätzlich nur das fett formatierte Wort Sekretariat. Es soll in der<br />
Größe nicht verändert werden.<br />
Stabsstellenkästchen<br />
Farbe: grau (RGB: 192/192/192) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt<br />
1. Zeile: Bezeichnung der Stabsstelle – fett<br />
Position: neben oder unter dem Sekretariatskästchen<br />
Reicht der Platz nicht aus für die Bezeichnung, kann die Schriftgröße verändert werden. Das<br />
Kästchen selber soll in der Größe nicht verändert werden.<br />
Beispiel:<br />
Farbe: hellblau (RGB: 204/255/255) ohne Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt<br />
1. Zeile: Name der nachgeordneten Organisationseinheit – fett mit Kurzbezeichnung in<br />
Klammer<br />
Position: rechts neben dem Sekretariatskästchen in gleicher Höhe; Es können auch<br />
mehrere solche Kästchen nebeneinander oder untereinander positioniert<br />
werden, je nachdem wie viel Platz noch ist.<br />
nachgeordnete Organi-<br />
sationseinheiten-<br />
Kästchen<br />
Es kann entweder den Namen der nachgeordneten Organisationseinheit beinhalten oder einen<br />
Verweis zu einer Beilage. Die Beilage enthält alle nachgeordneten Organisationseinheiten. (Dies<br />
ist der Fall, wenn es sehr viele nachgeordnete Organisationseinheiten gibt.)<br />
Reicht der Platz für die Bezeichnung nicht aus, kann die Schriftgröße verändert werden. Es ist<br />
aber auch möglich das Kästchen in der Größe zu verändern.<br />
Beispiel:<br />
23
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Gruppenkästchen<br />
Farbe: grün (RGB: 153/255/153) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt, die letzte Zeile 8 pt<br />
1. Zeile: Wort Gruppe<br />
2. Zeile: Gruppenbezeichnung – fett mit Kurzbezeichnung in Klammer<br />
3. Zeile: Familienname, Vorname und Titel der Gruppenleiterin oder des Gruppenleiters<br />
Position: unterhalb des Sekretariats und der nachgeordneten Organisationseinheiten<br />
Die Gruppenbezeichnung kann bis zu zwei Zeilen lang sein. Die Kurzbezeichnung kann gleich im<br />
Anschluss an die Gruppenbezeichnung stehen.<br />
Das Gruppenkästchen kann in der Größe verändert werden. Wenn Sie ein Kästchen ändern,<br />
sollen alle anderen Gruppenkästchen auch angepasst werden.<br />
Beispiel:<br />
Fachbereichskästchen*<br />
Farbe: hellgrün (RGB: 204/255/204) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt, die letzte Zeile 8 pt<br />
1. Zeile: Wort Fachbereich<br />
2. Zeile: Fachbezeichnung – fett mit Kurzbezeichnung in Klammer<br />
3. Zeile: Familienname, Vorname und Titel der Fachbereichsleiterin oder des Fachbereichsleiters<br />
*<br />
Position: auf Gruppenebene; in Ausnahmefällen unterhalb von Gruppen<br />
Die Fachbezeichnung* kann bis zu zwei Zeilen lang sein. Die Kurzbezeichnung kann gleich im<br />
Anschluss an die Fachbezeichnung stehen.<br />
Das Fachbereichskästchen* kann in der Größe verändert werden. Wenn Sie ein Kästchen ändern,<br />
sollen alle anderen Fachbereichskästchen* auch angepasst werden.<br />
*Vorläufige Regelung<br />
24
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Referatskästchen<br />
Farbe: hellgelb (RGB: 255/255/204) mit schwarzem Rahmen<br />
Schriftgröße: 10 pt, die letzte Zeile 8 pt<br />
1. Zeile: Wort Referat<br />
2. Zeile: Referatsbezeichnung – fett mit Kurzbezeichnung in Klammer<br />
3. Zeile: Familienname, Vorname und Titel der Referatsleiterin oder des Referatsleiters<br />
Position: unterhalb der Gruppenkästchen<br />
Die Referatsbezeichnung kann bis zu zwei Zeilen lang sein. Die Kurzbezeichnung kann gleich im<br />
Anschluss an die Referatsbezeichnung stehen.<br />
Das Referatskästchen kann in der Größe verändert werden. Wenn Sie ein Kästchen ändern, sind<br />
alle anderen auch anzupassen.<br />
Das Referatskästchen soll immer die gleiche Größe, wie das Gruppenkästchen haben.<br />
Beispiel:<br />
Info:<br />
Nicht jede Gruppe bzw.<br />
jedes Referat hat eine<br />
Kurzbezeichnung. Ist<br />
keine Kurzbezeichnung<br />
vorhanden wird der Begriff<br />
(Kurzbezeichnung) gelöscht.<br />
Aufgaben- oder Mitarbeiter/innenkästchen<br />
Farbe:<br />
Schriftgröße:<br />
Inhalt:<br />
Position:<br />
weiß mit schwarzem Rahmen<br />
8 pt<br />
umfasst die Hauptaufgaben (z.B. laut Kompetenzenkatalog) einer Gruppe bzw.<br />
eines Referates<br />
unterhalb der Gruppenkästchen oder unterhalb der Referatskästchen<br />
Dieses Kästchen kann in der Höhe beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Die Breite soll<br />
aber den Gruppen- und Referatskästchen entsprechen.<br />
Beispiel:<br />
25
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Aufgaben- oder Mitarbeiter/innenkästchen<br />
Farbe:<br />
Schriftgröße:<br />
Inhalt:<br />
Position:<br />
weiß mit schwarzem Rahmen<br />
8 pt<br />
Funktionsgruppe, Familienname, Vorname und Titel der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter einer Gruppe bzw. eines Referates, Legendenangaben<br />
unterhalb der Gruppenkästchen oder unterhalb der Referatskästchen<br />
Dieses Kästchen kann in der Höhe beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Die Breite soll<br />
aber den Gruppen- und Referatskästchen entsprechen.<br />
Beispiel:<br />
Legende (wird nur beim<br />
Namensorganigramm<br />
verwendet)<br />
Farbe: weiß ohne Rahmen<br />
Schriftgröße: 8 pt<br />
1. Zeile: Wort Legendenangaben – fett<br />
Inhalt: Abkürzungen und Bezeichnungen<br />
Position: Standardmäßig steht die Legende rechts unten am Seitenrand, außer es ist aus<br />
Platzgründen nicht möglich. Dann kann diese an eine andere Position verschoben<br />
werden.<br />
Die vorgegebenen Angaben sollen nicht gelöscht werden. Jedoch können sie beliebig ergänzt<br />
werden.<br />
Die Legende wird nur beim Namensorganigramm verwendet.<br />
Beispiel:<br />
26
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Vorgaben<br />
Die verschiedenen Kästchen sollen, je nach Struktur der Abteilung, miteinander verbunden werden.<br />
Sie können dies mit automatischen Verbindern oder mit selbstgezeichneten Linien machen.<br />
Es soll aber gewährleistet sein, dass alle Linien die gleiche Stärke aufweisen. Grundsätzlich soll<br />
die Stärke der Linien 0,75 Punkt betragen.<br />
Linien<br />
Das Landeslogo ist fix im oberen, rechten Rand positioniert. Diese Position soll so beibehalten<br />
werden, bzw. ist es nicht notwendig das Logo in der Größe zu ändern. Logo-Kombinationen (wie<br />
z.B. Gesundheits-Land Oberösterreich, ...) sind für externe Auftritte vorgesehen und bei internen<br />
Organigrammen nicht notwendig.<br />
Landeslogo<br />
Das Verwenden von Abteilungslogos ist nicht notwendig. Sollte es allerdings gewünscht sein,<br />
positionieren Sie es im rechten unteren Bereich.<br />
Abteilungslogo<br />
27
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anordnung der<br />
Kästchen<br />
Wie Sie die Kästchen auf der Arbeitsoberfläche anordnen, ist Ihnen überlassen. Nur das Abteilungs-<br />
bzw. das Direktionskästchen soll an der vorgegebenen Position bleiben.<br />
Es kommt auf die Struktur Ihrer Abteilung an, wie Sie die Gruppen und Referate darstellen. Haben<br />
Sie sehr viele Gruppen, können Sie diese auch in zwei Reihen anordnen. Genauso können<br />
Sie die Referate nebeneinander anordnen.<br />
Info:<br />
Versuchen Sie das Übersichtsorganigramm<br />
so zu<br />
gestalten, dass möglichst<br />
nur eine Seite benötigt<br />
wird.<br />
28
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Übersichtsorganigramms<br />
Wenn Sie die Vorlage starten, ist nur ein Tabellenblatt vorhanden, dieses nennt sich<br />
Übersichtsorganigramm. Im Arbeitsbereich sind bereits einige Standardkästchen vorhanden, die<br />
Ihnen die Position der einzelnen Kästchen vorgeben.<br />
1. Standardmäßig befindet sich das gelbe Abteilungskästchen auf der Arbeitsoberfläche.<br />
Wenn nötig tauschen Sie dieses gegen das blaue Direktionskästchen aus. Dazu markieren<br />
Sie das Direktionskästchen im Auswahlbereich und bewegen es mit den Cursortasten (auf<br />
der Tastatur) direkt auf das Abteilungskästchen.<br />
Vorgehensweise beim<br />
Erstellen des Übersichtsorganigramms<br />
Info:<br />
Je nach Struktur der Direktion<br />
wird entweder das Abteilungskästchen<br />
oder das<br />
Direktionskästchen (wenn<br />
keine Abteilung zugeordnet<br />
ist) verwendet.<br />
Info:<br />
Zum besseren Ausrichten<br />
der Kästchen aktivieren Sie<br />
den Befehl Am Raster ausrichten<br />
in der Werkzeugleiste.<br />
Somit richten sich die<br />
Kästchen beim Verschieben<br />
an dem Raster aus.<br />
2. Klicken Sie in das Kästchen und markieren Sie jene Zeile, die Sie überschreiben möchten.<br />
Geben Sie dann den gewünschten Text ein.<br />
Info:<br />
Wenn Sie die jeweilige vorgegebene<br />
Zeile überschreiben,<br />
ist gewährleistet, dass<br />
die richtige Formatierung<br />
übernommen wird.<br />
Info:<br />
Achten Sie darauf, dass Sie<br />
den Text AbteilungsleiterIn<br />
bzw. LandeskulturdirektorIn<br />
dem Geschlecht anpassen.<br />
3. Das Sekretariatskästchen ist bereits auf der Arbeitsoberfläche vorhanden. Wenn Sie es<br />
nicht benötigen, können Sie es löschen.<br />
Info:<br />
Nähere Beschreibungen der<br />
verschiedenen Kästchen<br />
finden Sie im Kapitel Vorgaben.<br />
29
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Übersichtsorganigramms<br />
4. In der gleichen Höhe wie das Sekretariatskästchen können Sie ein Kästchen für vorhandene<br />
Stabsstellen einfügen. Dazu bewegen Sie das im rechten Auswahlbereich vorhandene<br />
Stabsstellenkästchen in den Arbeitsbereich. Diese Kästchen sollen jedoch nur im geringen<br />
Ausmaß verwendet werden.<br />
5. Ein Feld für die nachgeordneten Organisationseinheiten (hellblaue Kästchen im Gesamtorganigramm)<br />
ist bereits vorhanden. Hat Ihre Abteilung keine nachgeordneten Organisationseinheiten,<br />
löschen Sie dieses Feld.<br />
Ansonsten ändern Sie den Text im Kästchen.<br />
Sie können auch mehrere solche Felder im Arbeitsbereich positionieren. Ist nicht genügend<br />
Platz vorhanden, schreiben Sie in das Kästchen einen Verweis auf eine Beilage, auf der Sie<br />
die nachgeordneten Organisationseinheiten darstellen.<br />
Info:<br />
Nähere Informationen zu<br />
nachgeordneten Organisationseinheiten<br />
finden Sie im<br />
Kapitel Spezialfälle.<br />
6. Als nächstes platzieren Sie so viele Gruppenkästchen auf dem Arbeitsblatt, wie Sie benötigen.<br />
Einige sind schon vorhanden. Wenn Sie diese nicht benötigen, löschen Sie sie. Zusätzliche<br />
Kästchen finden Sie im Auswahlbereich. Danach ändern Sie den Text.<br />
Info:<br />
Da Sie darauf achten sollten,<br />
dass Sie nur eine Seite für<br />
das gesamte Organigramm<br />
benötigen, ist es sinnvoll sich<br />
im Übersichtsorganigramm<br />
oben zu orientieren. Versuchen<br />
Sie nach unten möglichst<br />
viel Platz frei zu haben.<br />
Hier werden im Aufgabenund<br />
Namensorganigramm<br />
weitere Kästchen eingefügt.<br />
Info:<br />
Es stehen Ihnen genügend<br />
Kästchen im Auswahlbereich<br />
zur Verfügung. Es ist nicht<br />
notwendig diese zu kopieren<br />
oder selbst diese Kästchen<br />
zu erstellen.<br />
30
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Übersichtsorganigramms<br />
7. Unter den Gruppenkästchen finden Sie bereits Referatskästchen. Auch diese können gelöscht<br />
bzw. ergänzt werden. Zusätzliche Kästchen finden Sie wieder im Auswahlbereich.<br />
Ordnen Sie diese der richtigen Gruppe zu. Ändern Sie danach wieder den Text.<br />
Natürlich kann eine Gruppe auch mehrere Referate haben.<br />
Info:<br />
Wie Sie die Gruppen und<br />
Referate anordnen können,<br />
finden Sie im Kapitel Anordnung<br />
der Kästchen.<br />
Wenn ein Referat direkt der Abteilung untergeordnet ist, soll dieses Referatskästchen nicht<br />
in gleicher Höhe wie das Gruppenkästchen angeordnet werden. Es wird in gleicher Höhe<br />
mit den anderen Referatskästchen positioniert.<br />
8. Als nächstes richten Sie Ihre Kästchen so aus, dass eine übersichtliche Struktur entsteht.<br />
9. Dann verbinden Sie die einzelnen Kästchen mit Linien bzw. mit Verbindern. Dazu wählen<br />
Sie in der Werkzeugleiste das entsprechende Werkzeug aus und zeichnen auf der Arbeitsoberfläche<br />
die entsprechende Linie.<br />
Info:<br />
Wie Sie Objekte ausrichten,<br />
erfahren Sie im Kapitel<br />
Ausrichtung der Kästchen.<br />
Info:<br />
Wie Sie Linien und Verbinder<br />
zeichnen, wird Ihnen im<br />
Kapitel Linien und Verbinder<br />
erklärt.<br />
31
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Übersichtsorganigramms<br />
10. Zum Abschluss öffnen Sie das Menü Seite einrichten in der Werkzeugleiste.<br />
Wechseln Sie auf die Registerkarte Kopf- und Fußzeile. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche<br />
Benutzerdefinierte Fußzeile und ändern Sie hier den Stand und die Abteilungskurzbezeichnung.<br />
Info:<br />
Der Stand in der Fußzeile<br />
soll immer auf den Monat<br />
geändert werden, indem das<br />
Organigramm erstellt bzw.<br />
geändert wurde.<br />
11. Das Übersichtsorganigramm ist somit fertig erstellt.<br />
Info:<br />
Hat Ihr Organigramm zu<br />
wenig Platz auf einer Seite<br />
beginnen Sie eine neue.<br />
Nähere Infos dazu finden Sie<br />
im Kapitel Spezialfälle.<br />
32
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Linien und Verbinder<br />
Sie haben verschiedene Möglichkeiten die Verbindungen zwischen den einzelnen Kästchen zu<br />
zeichnen.<br />
2 2<br />
1 3<br />
Info:<br />
Bei Kästchen die untereinander<br />
ausgerichtet sind<br />
verlaufen die Linien grundsätzlich<br />
auf der linken Seite.<br />
1<br />
Linie<br />
Durch Ziehen mit der linken Maustaste können Sie eine horizontale und vertikale Linie erstellen.<br />
Drücken Sie dazu die Umschalt-Taste, so gelingt es Ihnen leichter, dass diese gerade wird. Diese<br />
Linie sollten Sie vorrangig zur Verbindung von Abteilung mit Sekretariat bzw. Gruppen verwenden.<br />
Info:<br />
Standardmäßig sollte die<br />
Linienstärke 0,75 pt betragen.<br />
2<br />
Gewinkelte Verbindung<br />
Alle Kästchen sind mit mehreren Verbindungspunkten versehen. Diese erleichtern die automatische<br />
Anknüpfung der Verbindungslinien.<br />
Haben Sie Verbindungslinien ausgewählt und bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Kästchen,<br />
werden die Verbindungspunkte sichtbar. Indem Sie draufklicken, wählen Sie den Punkt aus an<br />
den Sie anknüpfen wollen. Ziehen Sie nun den Verbinder auf das Zielkästchen und klicken Sie<br />
auch dort auf einen Verbindungspunkt.<br />
3<br />
Linienart und Strichart<br />
Hier haben Sie die Möglichkeit die Stärke bzw. die Art der Linie zu verändern. Normalerweise ist<br />
dies allerdings nicht notwendig, da standardmäßig eine durchgehende Linie mit 0,75 pt eingestellt<br />
ist.<br />
Info:<br />
Ändern Sie die Position bzw.<br />
die Größe der Kästchen erst<br />
nach der Erstellung der<br />
Linien, müssen Sie die Linien<br />
gegebenenfalls auch<br />
verändern.<br />
33
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Ausrichtung der<br />
Kästchen<br />
Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie die Kästchen einfach zueinander ausrichten.<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
1<br />
Am Raster ausrichten<br />
Eine große Hilfe zur besseren Ausrichtung bietet die Schaltfläche Am Raster ausrichten. Diese<br />
Option sollten Sie immer aktiviert haben, weil Sie gewährleistet, dass die Objekte genau an den<br />
Rasterlinien (blaues Gitternetz) ausgerichtet werden.<br />
D.h. verschieben Sie die Kästchen mit den Cursortasten oder der Maus, springt das Objekt immer<br />
nur um ein Rasterfeld weiter.<br />
2<br />
Objekte markieren<br />
Mit dem Befehl Objekte markieren können Sie durch Ziehen eines Markierungsrahmens mit der<br />
Maus mehrere Kästchen auswählen.<br />
3<br />
Gruppierung<br />
Mit der Gruppierung können Sie mehrere Kästchen zu einem Objekt zusammenschließen. Dazu<br />
müssen Sie zuerst die gewünschten Kästchen markieren und den Befehl Gruppierung auswählen.<br />
Um eine Gruppierung wieder aufzuheben, wählen Sie den Befehl Gruppierung aufheben.<br />
34
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Ausrichtung der<br />
Kästchen<br />
4<br />
Ausrichtung<br />
Bevor Sie Kästchen ausrichten können, müssen Sie diese wieder markieren. Wählen Sie dann im<br />
Menü Ausrichtung die gewünschte Option aus.<br />
Wollen Sie z.B. alle Kästchen auf gleicher Höhe ausgerichtet haben, markieren Sie diese und<br />
wählen im Menü Ausrichtung den Befehl Oben ausrichten aus.<br />
Soll der Abstand zwischen den Kästchen gleich groß sein, wählen Sie entweder Horizontal oder<br />
Vertikal verteilen.<br />
5<br />
Reihenfolge<br />
Mit den Befehlen unter dem Menü Reihenfolge können Sie bestimmen welche Objekte im Vordergrund<br />
bzw. im Hintergrund liegen sollen.<br />
Z.B. können Sie bestimmen, dass die Kästchen vor den Linien angezeigt werden sollen. Somit ist<br />
es nicht notwendig die Linien genau am Rand des Kästchens auszurichten.<br />
35
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Aufgabenorganigramms<br />
Wenn Sie zum Aufgabenorganigramm übergehen, brauchen Sie nicht wieder die gesamte Abteilungsstruktur<br />
erstellen, sondern es wird das vorhandene Übersichtsorganigramm als Grundlage<br />
genommen.<br />
Vorgehensweise beim<br />
Erstellen des Aufgabenorganigramms<br />
1. Das Übersichtsorganigramm muss kopiert werden, um es als Vorlage für das Aufgabenorganigramm<br />
verwenden zu können. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste direkt auf<br />
das Tabellenblatt und wählen Sie Verschieben/kopieren... aus. Um das Übersichtsorganigramm<br />
nun zu kopieren wählen Sie im folgenden Fenster die Option (ans Ende stellen) aus,<br />
aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen Kopie erstellen und bestätigen mit OK.<br />
Ein neues Tabellenblatt wird eingefügt und mit Übersichtsorganigramm(2) benannt. Um den<br />
Namen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Tabellenblatt und wählen<br />
im Kontextmenü den Befehl Umbenennen aus.<br />
Nun überschreiben Sie den markierten Text. Benennen Sie dieses Tabellenblatt mit Aufgabenorganigramm.<br />
2. Am Inhalt der vorhandenen Kästchen brauchen Sie nichts verändern, dieser bleibt gleich.<br />
Info:<br />
Es können sowohl Gruppen<br />
als auch Referate Aufgaben<br />
zugeteilt haben.<br />
3. Fügen Sie unterhalb der Gruppen und der Referate nun das Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen<br />
ein. Dieses finden Sie rechts im Auswahlbereich und kann wieder mit den<br />
Cursortasten oder der Maus in den Arbeitsbereich verschoben werden.<br />
Es ist hilfreich vorher die vorhandenen Linien zwischen Gruppen und Referaten zu löschen<br />
und die Kästchen etwas auseinander zu rücken.<br />
Geben Sie danach die Hauptaufgaben der entsprechenden Gruppe und des entsprechenden<br />
Referates in das Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen ein.<br />
Info:<br />
Nähere Infos zum Aufgabenkästchen<br />
finden Sie im Kapitel<br />
Vorgaben.<br />
36
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Aufgabenorganigramms<br />
Info:<br />
Bei den nachgeordneten<br />
Organisationseinheiten ist<br />
es nicht notwendig Aufgaben<br />
anzuführen.<br />
Info:<br />
Das Aufgabenkästchen<br />
können Sie beliebig in der<br />
Höhe verändern.<br />
4. Haben Sie alle Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen eingefügt, befüllt und ausgerichtet<br />
verbinden Sie die Kästchen wieder mit Linien. Zu den Aufgabenfeldern führen keine Linien.<br />
5. Ändern Sie zum Schluss noch die Seitennummerierung links unten im Arbeitsbereich auf<br />
Seite 2 um. Sollte Ihr Organigramm über mehrere Seiten gehen, lautet die Seitennummer<br />
der 2. Seite, Seite 2a, usw.<br />
Info:<br />
Hat Ihr Organigramm zu<br />
wenig Platz auf einer Seite,<br />
beginnen Sie eine neue.<br />
Nähere Infos dazu finden Sie<br />
im Kapitel Spezialfälle.<br />
37
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Namensorganigramms<br />
Grundlage für das Namensorganigramm ist das Aufgabenorganigramm.<br />
1. Kopieren Sie, wie bereits im Kapitel Erstellen des Aufgabenorganigramms beschrieben, das<br />
Tabellenblatt Aufgabenorganigramm und fügen Sie es wieder am Ende ein.<br />
Benennen Sie dieses Namensorganigramm.<br />
Vorgehensweise beim<br />
Erstellen des Namensorganigramms<br />
2. Im Namensorganigramm ist die Legende einzufügen. Dieses Kästchen ziehen Sie aus dem<br />
rechten Auswahlbereich und positionieren es standardmäßig unten rechts. Wenn es aus<br />
Platzgründen nicht möglich ist die Legende dort zu platzieren, können Sie diese an eine beliebige<br />
Position verschieben.<br />
Info:<br />
Bei mehrseitigen Namensorganigrammen<br />
ist die Legende<br />
auf jeder Seite anzuführen.<br />
Info:<br />
Die Legende kann mit speziellen<br />
Fußnoten ergänzt<br />
werden.<br />
3. Ergänzen Sie die Legendenangaben eventuell mit eigens verwendeten Kürzeln (z.B. Fußnoten).<br />
4. Zunächst markieren Sie alle Objekte unterhalb des Sekretariatskästchens und verschieben<br />
Sie diese etwas nach unten, sodass das Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen unter<br />
dem Sekretariat Platz hat. Dieses Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen ziehen Sie sich<br />
wieder aus dem Auswahlbereich in den Arbeitsbereich.<br />
Info:<br />
Es ist Ihnen überlassen, ob<br />
Sie die Linien vor dem Verschieben<br />
löschen oder<br />
nachher neu anpassen.<br />
Info:<br />
Mitarbeiter/innen werden nur<br />
einmal im Organigramm<br />
angeführt. Mehrfachzuteilungen<br />
können über Fußnoten<br />
beschrieben werden. Die<br />
Hauptanordnung des Mitarbeiters/der<br />
Mitarbeiterin<br />
erfolgt zu jenem Vorgesetzten<br />
der das Mitarbeiter/innengespräch<br />
zu führen<br />
hat.<br />
38
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Namensorganigramms<br />
5. Fügen Sie, wenn nötig, auch noch andere Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen zum<br />
Organigramm hinzu. Sind bereits alle Kästchen vorhanden, brauchen Sie nur mehr den Text<br />
ändern.<br />
6. Im Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen werden die Funktionsgruppe, Familienname,<br />
Vorname, Titel und die Legendenabkürzung angegeben. Beachten Sie, dass Funktionsgruppen<br />
jetzt auch bei allen Leiterinnen und Leitern (Abteilung bzw. Direktion, Gruppe, Referate)<br />
hinzugefügt werden müssen.<br />
Info:<br />
Bei den nachgeordneten<br />
Organisationseinheiten ist es<br />
nicht notwendig Mitarbeiterinnen<br />
bzw. Mitarbeiter<br />
anzuführen.<br />
Info:<br />
Mitarbeiter/innen werden je<br />
nach Funktionsgruppe hierarchisch<br />
gereiht.<br />
Lehrlinge sind keinen Funktionsgruppen<br />
zugeordnet.<br />
Info:<br />
Mitarbeiter/innen die sich in<br />
Altersteilzeit befinden sind<br />
nicht anzuführen, können<br />
jedoch gerne ergänzt werden.<br />
Es wird dann eine<br />
weitere Legendenabkürzung<br />
hinzugefügt (AT = Altersteilzeit).<br />
7. Passen Sie die Höhe der Kästchen an den Inhalt an und richten Sie die Kästchen wieder so<br />
aus, dass eine geordnete Struktur gegeben ist.<br />
Info:<br />
FG 1 = LD 1 bis LD 5<br />
FG 2 = LD 6 bis LD 10<br />
FG 3 = LD 11 bis LD 15<br />
FG 4 = LD 16 bis LD 20<br />
FG 5 = LD 21 bis LD 25<br />
39
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellung des Namensorganigramms<br />
8. Wenn Sie zuvor alle Linien gelöscht haben, zeichnen Sie diese nun wieder neu oder Sie<br />
bearbeiten die bereits vorhandenen.<br />
9. Ändern Sie zum Schluss noch die Seitennummerierung links unten im Arbeitsbereich auf<br />
Seite 3 um. Sollte Ihr Organigramm über mehrere Seiten gehen lautet die Seitennummer<br />
der 2. Seite, Seite 3a, usw.<br />
Info:<br />
Hat Ihr Organigramm zu<br />
wenig Platz auf einer Seite,<br />
beginnen Sie eine neue.<br />
Nähere Infos dazu finden Sie<br />
im Kapitel Spezialfälle.<br />
40
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Papierformat<br />
Das Papierformat der Vorlage ist standardmäßig auf A3 eingestellt. Falls Sie ihr Organigramm<br />
auf A4 ausdrucken möchten, ist das kein Problem.<br />
Einstellen des Papierformats<br />
1. Um das Papierformat zu ändern, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Befehl Seite<br />
einrichten.<br />
2. Wählen Sie im geöffneten Fenster die Registerkarte Papierformat.<br />
3. Um das Papierformat auf A4 umzustellen wählen Sie bei Papierformat die Option A4<br />
(210 x 297 mm) und klicken Sie auf OK.<br />
4. Wenn Sie jetzt das Organigramm drucken, wird es auf A4 gedruckt.<br />
41
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellen eines PDFs<br />
Es ist vorgesehen, dass Sie einmal im Jahr eine PDF-Datei des Abteilungsorganigramms an das<br />
Präsidium übermitteln. Daher ist es notwendig von der Excel-Datei einen PDF zu schreiben.<br />
Sie können dabei wählen, ob Sie einen PDF von der gesamten Arbeitsmappe, von einem einzelnen<br />
Tabellenblatt oder von einem bestimmten Bereich machen.<br />
1. Klicken Sie auf den Befehl Drucken in der Werkzeugleiste.<br />
2. Wählen Sie im geöffneten Fenster unter Name die Option PDF-XChange 3.0 aus.<br />
3. Im Bereich Druckbereich müssen Sie festlegen wie viele Seiten Sie drucken möchten. Umfasst<br />
Ihr Organigramm nur eine Seite, so geben Sie hier Seite 1 bis 1 ein. Hat ihr Organigramm<br />
z.B. 3 Seiten, geben Sie hier Seite 1 bis 3 an.<br />
4. Im Bereich Drucken können Sie wählen, von welchem Bereich Ihrer Arbeitsmappe Sie einen<br />
PDF schreiben möchten.<br />
Um einen PDF vom aktuellen Tabellenblatt zu erstellen, wählen Sie die Option Ausgewählte<br />
Blätter.<br />
Wenn Sie die Option Gesamte Arbeitsmappe wählen, wird von allen Tabellenblättern ein<br />
PDF erstellt.<br />
Mit der Option Markierung wird nur von dem markierten Bereich ein PDF erstellt.<br />
Info:<br />
Den Druckbereich brauchen<br />
Sie nur festlegen, wenn Sie<br />
das aktuelle Tabellenblatt<br />
drucken möchten. Einstellungen<br />
haben keine Auswirkung<br />
auf das Drucken der<br />
gesamten Arbeitsmappe.<br />
5. Klicken Sie anschließend auf OK.<br />
42
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Erstellen eines PDFs<br />
6. Nach kurzer Zeit erscheint das Fenster Speichern unter. Geben Sie hier den gewünschten<br />
Speichernamen (z.B. PräsD_Präs_2008_V1_Aufgabenorganigramm.xls) und Speicherpfad<br />
an und klicken Sie anschließend auf Speichern.<br />
7. Nach dem der PDF geschrieben wurde, öffnet er sich automatisch mit dem Programm<br />
Adobe Acrobat Reader.<br />
8. Diese PDFs können Sie nun an die Abteilung Präsidium übermitteln.<br />
Der PDF vom Übersichtsorganigramm muss von Ihnen im Intranet publiziert werden.<br />
43
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Zusammenarbeit mit<br />
anderen Programmen<br />
Sie haben die Möglichkeit die erstellten Organigramme in anderen Microsoft Office Programmen<br />
zu verwenden. Beispielsweise können Sie ein Organigramm in eine PowerPoint-Präsentation<br />
oder in ein Word-Dokument einbinden.<br />
1. Wollen Sie ein Organigramm in ein Word-Dokument einfügen, markieren Sie zuerst das<br />
gesamte Organigramm. Verwenden Sie dazu am besten den Befehl Objekte markieren in<br />
der Werkzeugleiste.<br />
Verwendung der Organigramme<br />
im Word<br />
2. Kopieren Sie dann die ausgewählten Objekte mit Bearbeiten – Kopieren.<br />
3. Öffnen Sie dann das Word Dokument.<br />
4. Wählen Sie in Word den Befehl Bearbeiten – Inhalte einfügen.<br />
5. Im darauf folgenden Fenster wählen Sie die Option Grafik (Windows-Metadatei) aus.<br />
44
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Zusammenarbeit mit<br />
anderen Programmen<br />
6. Klicken Sie dann auf OK und das Organigramm wird in Word eingefügt. Sie können es hier<br />
noch beliebig in der Größe verändern.<br />
Genauso wie in Word können Sie ein Organigramm in PowerPoint einfügen.<br />
1. Kopieren Sie zuerst wieder das Organigramm in Excel.<br />
Verwendung der Organigramme<br />
im Power-<br />
Point<br />
2. Wechseln Sie zu PowerPoint und wählen Sie wieder den Befehl Bearbeiten – Inhalte einfügen.<br />
3. Wählen Sie im geöffneten Fenster die Option Bild (Windows-Metadatei) aus.<br />
4. Das Organigramm wird in Originalgröße eingefügt. Sie können aber die Größe der Grafik<br />
beliebig verändern.<br />
45
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Spezialfälle<br />
Wenn eine Abteilung sehr viele nachgeordnete Organisationseinheiten hat, ist es sinnvoll, diese<br />
auf einer eigenen Seite darzustellen.<br />
Vermerken Sie im Tabellenblatt Übersichtsorganigramm, im Kästchen nachgeordnete Organisationseinheiten,<br />
wo diese angeführt worden sind.<br />
Sehr viele nachgeordnete<br />
Organisationseinheiten<br />
Info:<br />
Es ist Ihnen überlassen, ob<br />
Sie die nachgeordneten<br />
Organisationseinheiten auf<br />
der nächsten Seite oder auf<br />
einem eigenen Tabellenblatt<br />
abbilden.<br />
Zur besseren Übersicht muss der Kopfbereich des Organigramms (das Abteilungs- bzw. Direktionskästchen<br />
und das Landeslogo) angegeben werden.<br />
Info:<br />
Wenn Sie die nachgeordneten<br />
Organisationseinheiten<br />
auf einem eigenen Tabellenblatt<br />
angeführt haben, vergessen<br />
Sie nicht auch von<br />
diesen einen PDF zu schreiben.<br />
46
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Spezialfälle<br />
Reicht der Platz für ein Organigramm auf einer Seite nicht aus, soll dieses auf der nächsten Seite<br />
fortgesetzt werden. Es stehen Ihnen in der Vorlage vier Seiten zur Verfügung.<br />
Benötigen Sie bei der Erstellung des Übersichtsorganigramms eine weitere Seite, haben Sie<br />
folgende Möglichkeiten:<br />
Weitere Gruppen<br />
Organigramme mit mehreren<br />
Seiten<br />
Info<br />
Bevor eine zweite Seite<br />
verwendet wird soll versucht<br />
werden die Abstände zu<br />
verändern damit die Organigramme<br />
auf einer Seite Platz<br />
haben.<br />
Info<br />
Zur besseren Übersicht<br />
muss der Kopfbereich des<br />
Übersichtsorganigramms<br />
angegeben werden.<br />
Die Linie über den Gruppen soll auf der 1. Seite bis ganz nach rechts gezogen werden bzw. auf<br />
der 2. Seite ganz links beginnen.<br />
47
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Spezialfälle<br />
Weitere Referate<br />
Info<br />
Zur besseren Übersicht<br />
sollen auch die übergeordneten<br />
Gruppen auf der weiteren<br />
Seite angegeben werden.<br />
Die Linie jener Gruppen deren Referaten auf der 2. Seite fortgesetzt werden, soll auf der<br />
1. Seite bis ganz nach unten gezogen werden.<br />
So gehen Sie auch beim Aufgaben- und Namensorganigramm vor.<br />
Vergessen Sie nicht, dass Sie bei der Erstellung des Aufgaben- und Namensorganigramms die<br />
Seitennummerierung ändern.<br />
Beim Namensorganigramm muss die Legende auf jeder Seite angegeben werden.<br />
48
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Spezialfälle<br />
Fachbereichskästchen* sind für jene Personen vorzusehen, deren Aufgabe es ist, für eine fachliche<br />
Koordination zu sorgen und damit eine fachliche Leitung innehaben. Es ist damit keine innerdienstliche<br />
Führungsverantwortung verbunden. Es werden auch keine Mitarbeitergespräche als<br />
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Fachbereiche* können auf gleicher Ebene wie Gruppen<br />
bzw. Referate angesiedelt werden. Die fachliche Koordination ist mit einer strichlierten Linie im<br />
Namensorganigramm darzustellen.<br />
Fachbereichskästchen*<br />
*Vorläufige Regelung<br />
49
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Häufig gestellte<br />
Fragen<br />
Warum wird die Werkzeugleiste in der Vorlage nicht angezeigt? Wie kann ich diese wieder<br />
einblenden?<br />
Die Symbolleiste ist ausgeblendet. Sie können diese wieder unter dem Menü Ansicht – Symbolleisten<br />
– Werkzeugleiste für Organigramme einblenden.<br />
Darf das Landeslogo in der Größe verändert werden?<br />
Es ist nicht notwendig die Größe bzw. die Position des Landeslogos zu verändern.<br />
Darf das Abteilungslogo verwendet werden?<br />
Grundsätzlich ist kein Platzhalter für ein Abteilungslogo vorgesehen. Wird ein Abteilungslogo<br />
verwendet, so kann dieses im rechten unteren Rand positioniert werden.<br />
Ist es möglich hochformatige Organigramme zu erstellen?<br />
Die Vorlage ist standardmäßig auf Querformat eingestellt (kann nicht geändert werden).<br />
Sind Gruppensekretariate möglich?<br />
Sind Gruppensekretariate vorgesehen, dann sind die Aufgaben und Personen in der Gruppe und<br />
nicht als Stabsstelle auszuführen.<br />
Können der Stand und die DVR-Nummer (Fußzeile) in der Position verändert werden?<br />
Der Stand und die DVR-Nummer werden standardmäßig in der Fußzeile rechts unten angezeigt<br />
und sollen nicht verändert werden.<br />
Wo ist die Legende zu positionieren?<br />
Standardmäßig wird die Legende unten rechts positioniert. Wenn es aus Platzgründen nicht möglich<br />
ist, die Legende dort zu platzieren, können Sie sie an eine beliebige Position verschieben.<br />
Kann ich die Farbe der Kästchen verändern?<br />
Die Farbe ist standardisiert und soll deshalb nicht verändert werden.<br />
Dürfen die Kästchen in der Größe verändert werden?<br />
Es sollten nur die Gruppen-, Referats- und Aufgaben- und Mitarbeiter/innenkästchen in der Größe<br />
verändert werden.<br />
Darf ich eigene Kästchen zeichnen?<br />
Es ist nicht notwendig eigene Kästchen zu zeichnen. Es sind genügend im Auswahlbereich verfügbar.<br />
Sind Stabsstellen auf Gruppenebene möglich?<br />
Auf Gruppen- und Referatsebene können keine Stabsstellen eingerichtet werden.<br />
50
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Häufig gestellte<br />
Fragen<br />
Wie viele Stabsstellen sind möglich?<br />
Die Anzahl und die Bezeichnung der Stabsstellen ist vom Abteilungsleiter festzulegen. Erfahrungen<br />
zeigen, dass mind. eine Stabsstelle „Sekretariat“ standardmäßig eingerichtet ist.<br />
Dürfen auch Amtstitel angeführt werden?<br />
Aus Platzgründen wurde bei der Standardvorlage auf die Amtstitel verzichtet. Eine Abteilung<br />
kann selbstverständlich auch die Amtstitel im Namensorganigramm vermerken. Wichtig ist, dass<br />
dann durchgängig alle Amtstitel angeführt und aktuell gehalten werden.<br />
Können nachgeordnete Organisationseinheiten auch Gruppen oder Referaten nachgeordnet<br />
werden?<br />
Formal sind die nachgeordneten Organisationseinheiten der Abteilung nachgeordnet. Um die<br />
Hierarchie besser darzustellen, ist es allerdings im Abteilungsorganigramm durchaus auch möglich<br />
diese Organisationseinheiten der jeweiligen Gruppe oder dem jeweiligen Referat nachzuordnen,<br />
falls diese auch tatsächlich eine Art „Vorgesetztenfunktion“ wahrnehmen.<br />
Dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Namensorganigramm mehrmals angeführt<br />
werden?<br />
Grundsätzlich soll das Namensorganigramm für die Mitarbeiter/innen Klarheit bringen, wer mit<br />
wem Mitarbeiter/innengespräche führt und somit organisatorisch Vorgesetzte/Vorgesetzter ist.<br />
Deswegen sind MA im Namensorganigramm dort anzuführen, wo das MA-Gespräch geführt wird.<br />
Arbeiten MA fachlich auch in anderen Gruppen mit, so ist dies in erster Linie in der Stellenbeschreibung<br />
festzuhalten. Es kann auch durch eine Fußnote im Namensorganigramm bei der<br />
jeweiligen Person vermerkt werden.<br />
Wie groß müssen Gruppen oder Referate sein?<br />
Die Größe von Gruppen und Referaten werden von der Abteilungsleiterin/vom Abteilungsleiter<br />
bestimmt. Es gibt dazu keine allgemein gültige Festlegung. Gruppen und Referate bedeuten aber<br />
immer eine Führungsfunktion, weshalb „Einpersonenreferate“ nicht möglich sind.<br />
In welcher Reihenfolge sind die Personen in den Gruppen und Referaten anzuführen?<br />
Es wird vorgeschlagen zuerst die Reihung nach FG; dann nach Alphabet (Nachname) vorzunehmen.<br />
Muss jede Gruppe oder jedes Referat eine eigene Leiterin/einen eigenen Leiter haben?<br />
Nein, es kann auch ein Referat z.B. vom Gruppenleiter/Gruppenleiterin mitgeleitet werden oder<br />
eine Gruppe vom Abteilungsleiter/in. Ist dies der Fall ist im Übersichts-, Aufgaben- und Namensorganigramm<br />
kein Name bei der hierarchisch unteren Einheit einzufügen (z.B. Leitet die/der Abteilungsleiter/in<br />
die Gruppe 1 ist bei der Gruppe 1 kein Name im färbigen Kästchen anzuführen).<br />
Was tun, wenn von den Standards abgewichen werden muss oder soll?<br />
Es kann vorkommen, dass die Standardvorgaben für Organisationseinheiten nicht passen. Für<br />
Ausnahmen in der Darstellung ist mit der Abteilung Präsidium Kontakt aufzunehmen.<br />
51
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Häufig gestellte<br />
Fragen<br />
Für wen gelten die Organigrammstandards?<br />
Die Standards gelten für alle Organisationseinheiten des Amtes der Oö. Landesregierung (Direktionen,<br />
Abteilungen), nicht jedoch für nachgeordnete Organisationseinheiten. Sonderbehörden,<br />
Bezirkshauptmannschaften und die Agrarbezirksbehörde sind von diesen Standards ebenfalls<br />
nicht betroffen.<br />
Wie stelle ich die Stabsfunktionen ohne einer eigenen Stabsstelle dar (z.B. Controller,<br />
Organisationsentwickler, ...)?<br />
Am besten im Form einer Fußnote bei derjenigen Person, die diese Funktion inne hat. Die Person<br />
ist bei der Gruppe oder bei dem Referat anzusiedeln, wo sie in der Linie die Aufgaben wahrnimmt.<br />
Was mache ich, wenn in einem Referat oder einer Gruppe sehr viele Personen zugeordnet<br />
sind und dadurch der Platz zu wenig wird?<br />
Aus Platzgründen kann dann auch eine Summe angeführt werden z.B. 51 Portiere. Es wird empfohlen<br />
dann auf der Seite zwei des Namensorganigramms die Namensliste der Personen anzuhängen.<br />
Wer macht MA-Gespräch mit den Fachbereichsleitern* und den zugeordneten Mitarbeitern?<br />
Üblicherweise der in der Linienfunktion verantwortliche Vorgesetzte. Die/Der Fachbereichsleiterin/Fachbereichsleiter*<br />
führt keine MA-Gespräche (die Linienfunktionen sind für die Führung der<br />
MA-Gespräche entscheidend). Die Fachbereichsleitung* ist subsidiär zur Gruppenleitung oder<br />
Referatsleitung.<br />
Können einem Fachbereich* Referate bzw. nachgeordnete OE zugeordnet werden?<br />
Nur im Rahmen der fachlichen Aufsicht, nicht in der Linienorganisation.<br />
Wo sind Fachbereiche* anzusiedeln?<br />
Auf Gruppenebene bzw. auf Referatsebene.<br />
Was ist der Unterschied zwischen einer Stabsstelle und einer Fachbereichsleitung*?<br />
Die Stabsstelle unterstützt die Linienvorgesetzten. Die Fachbereichsleitung* kann in fachlicher<br />
Hinsicht direkt Vorschriften im Rahmen ihrer Befugnis erteilen.<br />
Kann statt der Stabsstelle "Sekretariat" wenn diese extra ausgewiesen ist auch als "Direktionssekretariat"<br />
benannt werden?<br />
Ja, wenn es sich um eine Direktion handelt bzw. wenn die Abteilung von einer/einem Direktorin/Direktor<br />
geleitet wird.<br />
*Vorläufige Regelung<br />
52
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 11 Abs. 5 <strong>DBO</strong><br />
Organisation und Aufgabenstellung<br />
der Büros der Mitglieder der Oö. Landesregierung 1<br />
1. Die Büros der Mitglieder der Oö. Landesregierung (im folgenden kurz als Büros bezeichnet)<br />
sind Teil des Amtes der Landesregierung. Innerorganisatorisch sind sie der Abteilung Präsidium<br />
angegliedert (siehe Organisationsplan des Amtes der Oö. Landesregierung).<br />
Jedes Büro ist Geschäftsapparat des Mitgliedes der Oö. Landesregierung, dem es zugeordnet<br />
ist. Daraus ergibt sich, dass die Bediensteten, die einem Büro zur Dienstleistung zugeteilt<br />
sind, in sachlicher Hinsicht ausschließlich dem betreffenden Mitglied der Oö. Landesregierung<br />
nachgeordnet sind und unter deren bzw. dessen Weisung und Verantwortung tätig werden.<br />
2. Für die Büros als Geschäftsapparat des betreffenden Mitgliedes der Oö. Landesregierung ist<br />
von besonderer Bedeutung, dass die Mitglieder der Oö. Landesregierung – soweit im gegebenen<br />
Zusammenhang von Bedeutung – in zwei Bereichen tätig werden, und zwar<br />
1. in einem Bereich, der durch die verfassungsrechtlichen Grundlagen (§ 3 des Bundesverfassungsgesetzes<br />
vom 30. Juli 1925, BGBl. Nr. 289, betreffend Grundsätze für die Einrichtung<br />
und Geschäftsführung der Ämter der Landesregierungen außer Wien; Art. 43 L-VG.<br />
1971 2 in Verbindung mit der Geschäftsordnung der Oö. Landesregierung und der Geschäftsordnung<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung gesehen, bestimmt und abgegrenzt<br />
wird (in der Folge kurz Funktionsbereich genannt) und<br />
2. in einem Bereich, der alle übrigen Aktivitäten umfasst.<br />
3. Soweit ein Büro im Bereich gemäß Z. 2 lit. b tätig wird, stehen solche Tätigkeiten in keinem<br />
unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der sonstigen Organisationseinheiten<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung, ausgenommen allenfalls Büros anderer Mitglieder<br />
der Oö. Landesregierung.<br />
4. Tätigkeiten eines Büros im Funktionsbereich (Z. 2 lit. a) stehen in aller Regel im sachlichen<br />
Zusammenhang mit den Aufgaben der jeweils zuständigen Organisationseinheit des Amtes<br />
der Oö. Landesregierung. Die Bearbeitung von Geschäftsfällen im Rahmen des Funktionsbereiches<br />
ist jedoch – nach Maßgabe erteilter Weisungen bzw. unter der Verantwortung des zuständigen<br />
Mitgliedes der Oö. Landesregierung – ausschließlich Aufgabe der sachlich zuständigen<br />
Organisationseinheit des Amtes der Oö. Landesregierung. Soweit ein Büro in diesem<br />
Zusammenhang gegenüber der zur Bearbeitung sachlich zuständigen Organisationseinheit<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung tätig wird, kann diese Tätigkeit nur im Rahmen des Weisungsrechtes<br />
bzw. der Verantwortung des Mitgliedes der Oö. Landesregierung liegen und<br />
muss bei der Bearbeitung des Geschäftsfalles in der sachlich zuständigen Organisationseinheit<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung gegebenenfalls entsprechend beachtet werden.<br />
5. Daraus ergibt sich, dass jedes Geschäftsstück im Bereich der für die Bearbeitung zuständigen<br />
Organisationseinheit des Amtes der Oö. Landesregierung evident zu führen ist und die Geschäftsstücke<br />
bzw. Akten – nach Maßgabe der einschlägigen innerdienstlichen Vorschriften –<br />
dort zu verwahren sind; dies unbeschadet einer Aktenvorlage an ein Mitglied der Oö. Landesregierung<br />
im Rahmen des normalen Geschäftsganges und des Rechtes des sachlich zuständigen<br />
Mitgliedes der Oö. Landesregierung, einzelne Geschäftsstücke bzw. Akten vorübergehend<br />
an sich zu ziehen.<br />
1<br />
2<br />
Wurde von der Oö. Landesregierung in ihrer Sitzung am 13. Oktober 1980 einstimmig zur Kenntnis<br />
genommen.<br />
Nunmehr: Art. 53 L-VG 1991.<br />
53
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
6. Die für das Amt der Oö. Landesregierung maßgeblichen innerdienstlichen Vorschriften hinsichtlich<br />
der Evidenthaltung von Geschäftsstücken bzw. Akten.<br />
7. Einschließlich der Verwahrung und Skartierung gelten für die Büros sinngemäß, soweit nicht<br />
das Mitglied der Oö. Landesregierung eine andere Regelung trifft.<br />
54
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 17 Abs. 3 <strong>DBO</strong><br />
Sachverständige – Weisungen<br />
1. Allgemeines:<br />
Sachverständige sind (physische) Personen, die aufgrund ihres besonderen fachlichen Wissens<br />
über für die behördliche Entscheidung erheblichen Tatsachen (in Form eines Befundes bzw. Gutachtens)<br />
Auskunft erteilen können. Die bzw. der Sachverständige ist dabei ein Hilfsorgan des zur<br />
Entscheidung berufenen Organwalters; sie bzw. er darf sich grundsätzlich nicht die Lösung von<br />
Rechtsfragen anmaßen, die in der rechtsstaatlichen Verwaltung dem Organwalter obliegen.<br />
Das Gutachten der bzw. des Sachverständigen hat den Befund und das Urteil (= Gutachten im<br />
engeren Sinne) zu enthalten und muss begründet sein. Darüber hinaus hat es nach der Judikatur<br />
dem letzten Stand der Wissenschaft zu entsprechen.<br />
Gemäß § 52 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) sind zwei verschiedene Formen<br />
des Sachverständigen zu unterscheiden, nämlich einerseits Amtssachverständige und andererseits<br />
nichtamtliche Sachverständige.<br />
§ 52 Abs. 1 AVG geht davon aus, dass sich die Behörde primär einer bzw. eines (beigegebenen<br />
oder zur Verfügung stehenden) Amtssachverständigen zu bedienen hat. Nur wenn eine bzw. ein<br />
Amtssachverständiger nicht zur Verfügung steht oder es mit Rücksicht auf die Besonderheit des<br />
Falles geboten ist, kann die Behörde ausnahmsweise eine andere geeignete Person – dh. eine<br />
nichtamtliche Sachverständige bzw. einen nichtamtlichen Sachverständigen – heranziehen (§ 52<br />
Abs. 2 AVG).<br />
Liegen die eben geschilderten Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 AVG nicht vor, kann sich die<br />
Behörde trotzdem einer bzw. eines nichtamtlichen Sachverständigen bedienen, wenn davon eine<br />
wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Dabei ist zu beachten, dass diese<br />
Heranziehung nur dann zulässig ist, wenn sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Verfahren<br />
eingeleitet wurde, angeregt wird und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser<br />
Partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten.<br />
Gemäß § 52 Abs. 4 AVG hat der Bestellung zur bzw. zum nichtamtlichen Sachverständigen Folge<br />
zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wird die<br />
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die Voraussetzung der geforderten<br />
Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder<br />
ermächtigt ist. Nichtamtliche Sachverständige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die Erstattung<br />
von Gutachten der erforderlichen Art im allgemeinen beeidet sind. Die §§ 49 und 50 AVG<br />
gelten auch für nichtamtliche Sachverständige.<br />
Für die Qualifikation als Amtssachverständige bzw. Amtssachverständiger ist nach § 52 Abs. 1<br />
AVG nur entscheidend, ob die bzw. der Sachverständige der Behörde beigegeben ist oder ihr zur<br />
Verfügung steht. Auf die rechtliche Qualifikation der Organisation, der die bzw. der Sachverständige<br />
angehört und auf ihre bzw. seine dienstrechtliche Stellung kommt es nicht an. Der Einordnung<br />
unter die Amtssachverständigen ist es nicht hinderlich, wenn kein Dienstverhältnis als öffentlich<br />
Bedienstete bzw. öffentlicher Bediensteter vorliegt. Gleiches gilt für die rechtliche Art der Organisation,<br />
der die bzw. der Sachverständige angehört (so der Verwaltungsgerichtshof vom 23. Jänner<br />
2002, 2001/07/0139).<br />
2. Zur Frage der Weisungsgebundenheit:<br />
Grundsätzlich normiert Art. 20 Abs. 1 B-VG, dass die Organe der Verwaltung an die Weisungen<br />
der ihnen vorgesetzten Organe gebunden und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich<br />
55
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
sind. Dieser Bestimmung unterliegen auch Bedienstete, die einem Sachverständigendienst angehören<br />
oder als Sachverständige bzw. Sachverständiger einer Abteilung bzw. einer Landeseinrichtung<br />
zugeteilt sind.<br />
Hinsichtlich der Frage der Weisungsgebundenheit bei der Gutachtenserstellung ist zu unterscheiden,<br />
ob eine Amtssachverständige bzw. ein Amtssachverständiger persönlich mit der Gutachtenserstellung<br />
beauftragt wurde und ein ihr bzw. ihm persönlich zurechenbares Gutachten zu erarbeiten<br />
hat oder ob der Sachverständigendienst als solcher beauftragt wurde.<br />
Wird einer bzw. einem Amtssachverständigen durch das zuständige Organ der Auftrag erteilt, in<br />
einem Verfahren ein persönlich zurechenbares Gutachten zu erstellen, so besteht keine Gehorsamspflicht<br />
(im Übrigen ist im Sinne des Art. 20 Abs. 1 B-VG von einer umfassenden Gehorsamspflicht<br />
auszugehen). Das bedeutet, dass eine Amtssachverständige bzw. ein Amtssachverständiger,<br />
der einer Behörde beigegeben ist oder ihr im Sinne des § 52 Abs. 1 AVG zur Verfügung steht,<br />
bei ihrer bzw. seiner durch die förmliche Beiziehung zu einem Verfahren nach dem AVG begründeten<br />
Tätigkeit – Erstattung eines Gutachtens bzw. Befundes – von der Gehorsamspflicht gemäß<br />
Art. 20 Abs. 1 B-VG nicht (mehr) erfasst, sondern in ein besonderes Auftragsverhältnis zur verfahrensführenden<br />
Behörde eingebunden ist, das eine Weisungsbeziehung, wie sie ansonsten die<br />
Situation der Verwaltungsorgane mit Ausnahme der obersten Organe des Bundes, der Länder und<br />
Gemeinden kennzeichnet, nicht umfasst (vgl. dazu Verwaltungsgerichtshof vom 26. April 2006,<br />
2005/12/0019 ua.).<br />
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Bestimmung des § 289 StGB zu verweisen, wonach<br />
wer vor einer Verwaltungsbehörde als Zeugin bzw. Zeuge bei ihrer bzw. seiner förmlichen Vernehmung<br />
zur Sache falsch aussagt oder als Sachverständige bzw. Sachverständiger einen falschen<br />
Befund oder ein falsches Gutachten erstattet, mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu<br />
bestrafen ist. Allein schon im Hinblick auf diese Bestimmung hätte eine Amtssachverständige bzw.<br />
ein Amtssachverständiger die Befolgung einer Weisung abzulehnen, wenn sie ihrer bzw. seiner<br />
(subjektiven) Überzeugung nach zu einem falschen Gutachten führen würde (vgl. Art. 20 Abs. 1<br />
letzter Satz B-VG).<br />
56
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 19 Abs. 7 <strong>DBO</strong><br />
Anordnung von Überstunden<br />
1. Die Vorgesetzten haben darauf hinzuwirken, dass die Dienstgeschäfte nach Möglichkeit in der<br />
normalen Dienstzeit abgewickelt werden.<br />
2. Überstunden können nur auf Anordnung 1, 2 geleistet werden; die Befugnis zur Anordnung<br />
richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der <strong>Dienstbetriebsordnung</strong>.<br />
3. Den auf Anordnung geleisteten Überstunden sind Überstunden gleichzuhalten, wenn<br />
a. die bzw. der Bedienstete eine zur Anordnung der Überstunde Befugte bzw. einen zur Anordnung<br />
der Überstunde Befugten nicht erreichen konnte,<br />
b. die Leistung der Überstunde zur Abwehr eines Schadens unverzüglich notwendig war,<br />
c. die Notwendigkeit der Leistung der Überstunde nicht auf Umstände zurückgeht, die von<br />
der bzw. dem Bediensteten, die bzw. der die Überstunde geleistet hat, hätte vermieden<br />
werden können, und<br />
d. die bzw. der Bedienstete diese Überstunde spätestens innerhalb einer Woche nach der<br />
Leistung schriftlich meldet; ist die bzw. der Bedienstete durch ein unvorhergesehenes oder<br />
unabwendbares Ereignis ohne ihr bzw. sein Verschulden verhindert, diese Frist einzuhalten,<br />
so verlängert sie sich um die Dauer der Verhinderung.<br />
4. Sofern der Organisationseinheit kein Überstundenkontingent zur Verfügung steht, bedarf die<br />
Anordnung von Überstunden zur Bewältigung vorübergehender Arbeitsspitzen der Zustimmung<br />
der Abteilung Personal des Amtes der Landesregierung, wenn die Überstunden finanziell<br />
abgegolten werden sollen.<br />
5. Detaillierte Regelungen über die Vergütung von Überstunden und die Gewährung von Freizeitausgleich<br />
enthält der Erlass vom 15. Februar 1993, PersR-450003/56-1993/G. Die Abgeltung<br />
von Überstunden, die durch den Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen anfallen,<br />
ist im Anhang 1 zu § 28 Abs. 1 und 2 (Punkt 4.1.4., "Besuch von Veranstaltungen der<br />
Aus- und Fortbildung") geregelt.<br />
1<br />
2<br />
Die Gewährung einer Verwendungszulage mit Mehrleistungsanteil inkludiert die Anordnung zur Leistung<br />
von Überstunden sowie die allenfalls erforderliche Zustimmung der Abteilung Personal zu dieser<br />
Anordnung. Dies gilt sinngemäß für die Leistung von Überstunden im Rahmen der in einem sogenannten<br />
"Überstundenpauschale" (Pauschalvergütung für Überstunden) festgelegten Überstundenanzahl.<br />
Teilzeitbeschäftigte Bedienstete dürfen über die für sie maßgebliche Wochendienstzeit hinaus zur<br />
Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn diese Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens<br />
unverzüglich notwendig ist und eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter, deren bzw. dessen Wochendienstzeit<br />
nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Diese zusätzlichen Dienstleistungen sind<br />
jedoch nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften nur dann als Überstunden auszugleichen bzw. abzugelten,<br />
wenn sie die volle Wochendienstzeit von 40 Stunden überschreiten.<br />
57
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 19 Abs. 9 <strong>DBO</strong><br />
Hauptaufgaben der Direktorinnen bzw. Direktoren und<br />
der Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleiter<br />
A. Direktorin bzw. Direktor eines Querschnittsbereichs<br />
1. Planungen<br />
- Strategische Ausrichtung des Querschnittsbereichs<br />
Konzipieren und Planen der mittel- und langfristigen fachlichen Grundausrichtung für die gesamte<br />
Direktion in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referentinnen und Referenten.<br />
Ermitteln, Beurteilen und Integrieren von Vorschlägen der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter<br />
zur fachlichen Ausrichtung der Abteilung(en). 1<br />
- Fachliche Koordination<br />
Abstimmen und Koordinieren der unternehmensweiten strategischen Planung und Steuerung<br />
mit den anderen Direktorinnen und Direktoren. Koordinieren der fachlichen Planung und<br />
Steuerung der nachgeordneten Organisationseinheiten.<br />
- Zielvereinbarungen und Planungen<br />
Vorbereiten und Abschließen von Zielvereinbarungen für die Direktion mit den politischen Referentinnen<br />
und Referenten und der Landesamtsdirektorin bzw. dem Landesamtsdirektor (im<br />
inneren Dienst) unter Beteiligung der betroffenen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 1 .<br />
Durchführen von Zielvereinbarungen mit den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern 1 , den<br />
unmittelbar zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Verfolgen der Zielerreichung.<br />
2. Ressourcensteuerung<br />
- Infrastruktur<br />
Entwickeln von Vorschlägen für die Bedarfsplanung der Infrastruktur (Räume, IT, Büroeinrichtung<br />
und Dienstkraftwagen) unter Einbeziehung von Vorschlägen der Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 1 zur Entscheidungsvorlage bei der Direktion Präsidium. Entscheiden über<br />
den direktions-internen Ausgleich von Infrastrukturressourcen im Rahmen der vereinbarten<br />
und geltenden Standards.<br />
- Budget und Finanzen<br />
Führen von Koordinierungsgesprächen mit der Direktion Finanzen unter Einbeziehung der Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 1 zur Vorbereitung der Budgets. Vorgeben und Planen<br />
der Budgetdetails für die Direktion sowie Sicherstellen der Durchführung durch die Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter. Einbringen von Vorschlägen zu finanziellen Umschichtungen<br />
sowie zu Beratungen und Gesprächen über die allgemeine Budgetplanung.<br />
- Personal<br />
Entscheiden über Personalanforderungen nach Vorlage durch die betreffenden Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 1 sowie über Besetzungsvorschläge. Mitwirken bei Entscheidungen<br />
über Personalaufnahmen. Entscheiden über Personalausgleich innerhalb der Direktion<br />
über Abteilungsgrenzen hinaus (max. 90 Tage) sowie über den Einsatz von Kontingenten<br />
(z.B. Überstunden, Aus- und Fortbildung, Belohnungen, Reisegebühren, etc.) unter Einbeziehung<br />
der nachgeordneten Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 1 . Führen und Sorge für<br />
Motivation der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 2 und der zugeordneten Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter sowie Entscheiden über grundsätzliche Personalentwicklungskonzepte in<br />
der Direktion.<br />
1<br />
Nur wenn die Direktion eine Abteilungsgruppe ist.<br />
59
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3. Leitung der Organisationseinheit<br />
- Standards und Dienstleistungen<br />
Festlegen von Standards und Richtlinien für die verantworteten Ressourcen für das Gesamtunternehmen<br />
und Sicherstellen von deren Umsetzung. Ermitteln des Ressourcenbedarfs des<br />
gesamten Unternehmens sowie Planen und Sicherstellen der entsprechenden Dienstleistungen<br />
entsprechend den definierten Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.<br />
- Organisatorische Gestaltung<br />
Entwickeln der Organisation in der Direktion im Rahmen der Unternehmensstandards sowie<br />
von Prozessen und Systemen im Sinne der Querschnittsfunktion für das gesamte Unternehmen.<br />
Umsetzen von Unternehmensstandards sowie Konzipieren und Sicherstellen von Standards<br />
in der Direktion. Gestalten der Kommunikations- und Informationsprozesse in der Direktion<br />
im Rahmen von Unternehmensstandards.<br />
- Operative Steuerung und Controlling<br />
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und zeitgerechten Durchführung der operativen fachlichen<br />
Tätigkeiten in den unterstellten Abteilungen 2 entsprechend den definierten Aufgaben.<br />
Koordinieren und Vernetzen von abteilungsübergreifenden 2 Themen (fachlich, infrastrukturell,<br />
und innerdienstlich). Sicherstellen eines umfassenden und leistungsfähigen Controllings hinsichtlich<br />
Berichtswesen, Budgetierung, der kontinuierlichen Verbesserung der Informationssysteme<br />
sowie der laufenden betriebswirtschaftlichen Analyse der Ergebnisse der Direktion.<br />
Erstellen von Quartals- und Jahresreports für die Ressourcensteuerer und die politischen Referentinnen<br />
und Referenten.<br />
- Berichtswesen und -pflicht<br />
Informieren der politischen Referentinnen und Referenten über fachübergreifende Angelegenheiten<br />
entsprechend der Informations- und Berichtspflicht.<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
Wahrnehmen von Öffentlichkeitsarbeitsaufgaben hinsichtlich Themen der verantworteten Direktion<br />
(in fachlicher Abstimmung mit der zuständigen unterstellten Abteilungsleiterin bzw.<br />
dem zuständigen unterstellten Abteilungsleiter) 2 , wie z.B. Interviews mit Presse, Rundfunk,<br />
TV, sowie Erfüllung von Repräsentationsaufgaben gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien,<br />
Verbänden, etc. im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Mitglied der Landesregierung.<br />
Die zuständige Abteilungsleiterin bzw. der zuständige Abteilungsleiter ist zu informieren.<br />
B. Direktorin bzw. Direktor eines Lebensbereichs<br />
1. Planungen<br />
- Strategische Ausrichtung des Lebensbereichs<br />
Konzipieren und Planen der mittel- und langfristigen fachlichen Grundausrichtung für den gesamten<br />
Lebensbereich in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referentinnen und Referenten.<br />
Ermitteln, Beurteilen und Integrieren von Vorschlägen der Abteilungsleiterinnen und<br />
Abteilungsleiter 2 zur fachlichen Ausrichtung der einzelnen Abteilungen.<br />
- Fachliche Koordination<br />
Abstimmen und Koordinieren der fach- und fachübergreifenden strategischen Planung und<br />
Steuerung mit den Direktorinnen und Direktoren der anderen Lebensbereiche. Koordinieren<br />
der fachlichen Planung und Steuerung der nachgeordneten Organisationseinheiten.<br />
- Zielvereinbarungen und Planungen<br />
Vorbereiten und Abschließen von Zielvereinbarungen für die Direktion mit den politischen Referentinnen<br />
und Referenten und der Landesamtsdirektorin bzw. dem Landesamtsdirektor (im<br />
inneren Dienst) unter Beteiligung der betroffenen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 3 .<br />
Durchführen von Zielvereinbarungen mit den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, den<br />
unmittelbar zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Verfolgen der Zielerreichung.<br />
2<br />
Nur wenn die Direktion eine Abteilungsgruppe ist.<br />
60
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
2. Ressourcensteuerung<br />
- Infrastruktur<br />
Entwickeln von Vorschlägen für die Bedarfsplanung der Infrastruktur (Räume, IT, Büroeinrichtung<br />
und Dienstkraftwagen) unter Einbeziehung von Vorschlägen der Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 3 zur Entscheidungsvorlage bei der Direktion Präsidium. Entscheiden über<br />
den direktions-internen Ausgleich von Infrastrukturressourcen im Rahmen der vereinbarten<br />
und geltenden Standards.<br />
- Budget und Finanzen<br />
Führen von Koordinierungsgesprächen mit der Direktion Finanzen unter Einbeziehung der Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 3 zur Vorbereitung der Budgets. Vorgeben und Planen<br />
der Budgetdetails für die Direktion sowie Sicherstellen der Durchführung durch die Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 1 . Einbringen von Vorschlägen zu finanziellen Umschichtungen<br />
sowie zu Beratungen und Gesprächen über die allgemeine Budgetplanung.<br />
- Personal<br />
Entscheiden über Personalanforderungen nach Vorlage durch die betreffenden Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter 3 sowie über Besetzungsvorschläge. Mitwirken bei Entscheidungen<br />
über Personalaufnahmen. Entscheiden über Personalausgleich innerhalb der Direktion<br />
über Abteilungsgrenzen hinaus (max. 90 Tage) sowie über den Einsatz von Kontingenten<br />
(z.B. Überstunden, Aus- und Fortbildung, Belohnungen, Reisegebühren, etc.) unter Einbeziehung<br />
der nachgeordneten Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 3 . Führen und Sorge für<br />
Motivation der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 3 und der zugeordneten Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter sowie Entscheiden über grundsätzliche Personalentwicklungskonzepte in<br />
der Direktion.<br />
3. Leitung der Organisationseinheit<br />
- Organisatorische Gestaltung<br />
Entwickeln der Organisation im Lebensbereich im Rahmen der Unternehmensstandards. Mitwirken<br />
bei der Entwicklung von Unternehmensstandards (z.B. WOV 2015, Qualitätsmanagement,<br />
Controlling, Wissensmanagement). Umsetzen von Unternehmensstandards sowie Konzipieren<br />
und Sicherstellen von Standards in der Direktion. Gestalten der Kommunikations- und<br />
Informationsprozesse in der Direktion im Rahmen von Unternehmensstandards.<br />
- Operative Steuerung und Controlling<br />
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und zeitgerechten Durchführung der operativen fachlichen<br />
Tätigkeiten in den unterstellten Abteilungen 3 entsprechend den definierten Aufgaben.<br />
Koordinieren und Vernetzen von abteilungsübergreifenden Themen 3 (fachlich, infrastrukturell,<br />
und innerdienstlich). Sicherstellen eines umfassenden und leistungsfähigen Controllings hinsichtlich<br />
Berichtswesen, Budgetierung, der kontinuierlichen Verbesserung der Informationssysteme<br />
sowie der laufenden betriebswirtschaftlichen Analyse der Ergebnisse der Direktion.<br />
Erstellen von Quartals- und Jahresreports für die Ressourcensteuerer und die politischen Referenten.<br />
- Berichtswesen und -pflicht<br />
Informieren der politischen Referentinnen und Referenten über fachübergreifende Angelegenheiten<br />
entsprechend der Informations- und Berichtspflicht.<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
Wahrnehmen von Öffentlichkeitsarbeitsaufgaben hinsichtlich Themen der verantworteten Direktion<br />
(in fachlicher Abstimmung mit der zuständigen unterstellten Abteilungsleiterin bzw.<br />
dem zuständigen unterstellten Abteilungsleiter), wie z.B. Interviews mit Presse, Rundfunk, TV,<br />
sowie Erfüllung von Repräsentationsaufgaben gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien, Verbänden,<br />
etc. im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Mitglied der Landesregierung. Die<br />
zuständige Abteilungsleiterin bzw. der zuständige Abteilungsleiter ist zu informieren.<br />
3<br />
Nur wenn die Direktion eine Abteilungsgruppe ist.<br />
61
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
C. Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter (sofern nicht Direktorin bzw. Direktor)<br />
1. Planungen<br />
- Ausrichtung der Abteilung<br />
Konzipieren und Planen der fachlichen Grundausrichtung der Abteilung in Abstimmung mit<br />
der Direktorin bzw. dem Direktor. Einbringen von Vorschlägen über die fachliche Koordination<br />
mit den anderen Abteilungen in der Direktion sowie über die strategische Ausrichtung der Direktion.<br />
- Ziele und Grundsätze<br />
Festlegen von Zielen und Definieren der Grundsätze für den Verantwortungsbereich im Rahmen<br />
der vom Direktor und dem Gesetz definierten Vorgaben. Entscheiden über Konzepte zur<br />
Implementierung der strategischen Ausrichtung sowie Steuerung der landesweiten Umsetzung.<br />
2. Ressourcensteuerung<br />
- Infrastruktur<br />
Einbringen von Vorschlägen für die Bedarfsplanung von Infrastrukturressourcen (Räume, IT,<br />
Büroeinrichtung, Dienstkraftwagen). Entscheiden über die Zuteilung von Infrastrukturressourcen<br />
im Rahmen der Abteilung. Entscheiden über Maßnahmen im Zusammenhang mit laufenden<br />
Kosten (z.B. Telefon, Büromaterial, etc.).<br />
- Finanzen<br />
Sicherstellen der Planung abteilungsweiter Budgets sowie Informieren des Direktionscontrollers<br />
über sämtliche budgetbezogenen Vorgänge. Einbringen von Vorschlägen für die mittelfristige<br />
Budgetvorschau und die Koordinierungsgespräche zwischen Direktion Finanzen und<br />
Direktion sowie für die Durchführung des Berichtwesens.<br />
- Personal<br />
Erstellen von Anforderungsprofilen und von Besetzungsvorschlägen für Stellen in der Abteilung.<br />
Mitwirken bei der Aufnahme von neuem Personal, dem Personalausgleich in der Direktion<br />
sowie bei der Verteilung von Kontingenten. Konzipieren von Personalentwicklungsmaßnahmen<br />
in Abstimmung mit der Direktorin bzw. dem Direktor und der Direktion Personal. Führen<br />
und Sorge für Motivation der unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />
3. Leitung der Organisationseinheit<br />
- Operative Steuerung<br />
Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und zeitgerechten Durchführung der operativen fachlichen<br />
Tätigkeiten in der unterstellten Abteilung entsprechend den definierten Aufgaben. Sicherstellen<br />
eines funktionalen operativen Controllings hinsichtlich der von der Abteilung zu erfüllenden<br />
Aufgaben.<br />
- Information<br />
Sicherstellen der Abhaltung regelmäßiger Dienstbesprechungen und der Aufrechterhaltung<br />
des Informationsflusses in der Abteilung.<br />
- Optimierung<br />
Identifizieren von Optimierungspotentialen im Verantwortungsbereich sowie Erarbeiten von<br />
Vorschlägen zu deren Realisation. Ableiten und Sicherstellen der Umsetzung entsprechender<br />
Maßnahmen nach Genehmigung durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzen.<br />
62
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 1 zu § 28 Abs. 1 und 2<br />
Flexible Arbeitszeit mit elektronischer Zeiterfassung 1<br />
1. Geltungsbereich:<br />
1.1. Sachlicher Geltungsbereich:<br />
Dieser Anhang regelt die flexible Arbeitszeit und die Erfassung der Dienstzeit der Bediensteten<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften und des Unabhängigen Verwaltungssenates,<br />
sofern ein elektronisches Zeiterfassungssystem installiert ist. Sonstige dienstrechtliche<br />
und inner-dienstliche Regelungen (z.B. über die Anordnungen von Überstunden) bleiben<br />
unberührt.<br />
1.2. Persönlicher Geltungsbereich:<br />
Die Regelung der flexiblen Arbeitszeit mit elektronischer Zeiterfassung gilt für die Bediensteten<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften und des Unabhängigen<br />
Verwaltungssenates, sofern sie ihren Arbeitsplatz in einer Dienststelle haben, in der ein elektronisches<br />
Zeiterfassungssystem installiert ist; ausgenommen hievon sind jedoch nachstehende Bedienstetengruppen:<br />
* Reinigungsdienst<br />
* Gebäudeaufsicht<br />
* Portierdienst<br />
* sonstige Bedienstete mit Schicht- oder Wechseldienst<br />
* Bedienstete der Landesmusikschulen<br />
* Bedienstete der Agrarbezirksbehörde<br />
* Bedienstete des Werkhofes und des LKW-Betriebes<br />
* Bedienstete der Telefonzentrale<br />
* Bedienstete des Dienstkraftwagen-Betriebes<br />
* Bedienstete der Straßen-, und Brückenmeistereien sowie der Betriebswerkstätten<br />
* <strong>VB</strong> II und handwerkliches Personal (soweit sie nicht bereits unter die vorstehenden Bedienstetengruppen<br />
fallen)<br />
* Ferialkräfte<br />
Für diese Bedienstetengruppen bestehen eigene Arbeitszeitregelungen.<br />
2. Allgemeine Bestimmungen:<br />
2.1. Sprachliche Gleichbehandlung:<br />
Personenbezogene Bezeichnungen in dieser Regelung gelten jeweils auch in ihrer weiblichen<br />
Form.<br />
2.2. Technisch-organisatorische Grundlagen des Zeiterfassungssystems:<br />
Je Dienststelle wird grundsätzlich mindestens ein Zeiterfassungsgerät installiert (es sei denn, eine<br />
sinnvolle Zuordnung zu anderen Dienststellen ist möglich).<br />
Ein Zeiterfassungsgerät besteht aus<br />
a. mindestens einem Zeiterfassungs-Terminal und<br />
b. einem Personalcomputer (PC).<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 9. Jänner 2006, PersR-45003/796-2006-Kop/Hoe.<br />
63
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Aktivitäten, die durch die Zeitbeauftragten der Dienststelle erfolgen müssen, werden ausschließlich<br />
auf einem zum Zeiterfassungssystem zugehörigen PC vorgenommen.<br />
Wesentliche Informationen (Datum, Uhrzeit, Über- bzw. Unterzeiten, noch verfügbarer Urlaub)<br />
sowie angeführte Funktionen (Kommen, Gehen, Dienstgang/Dienstreise, Auskunft) werden den<br />
Bedienerinnen und Bedienern des Zeiterfassungs-Terminals bei Benutzung angezeigt.<br />
2.3. Zeitbeauftragte:<br />
Zeitbeauftragte sind die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter bzw. die bzw. der von ihr<br />
bzw. ihm dazu beauftragte Bedienstete.<br />
2.4. Amtsstunden und Regeldienstzeit:<br />
2.4.1. Amtsstunden:<br />
Innerhalb des durch die wöchentliche Gesamtarbeitszeit vorgegebenen Rahmens werden von<br />
der Landesamtsdirektorin bzw. vom Landesamtsdirektor (Bezirkshauptfrau bzw. Bezirkshauptmann,<br />
Amtsvorständin bzw. Amtsvorstand der Agrarbezirksbehörde für OÖ , Präsidentin bzw.<br />
Präsidenten des Oö. Verwaltungssenates) die Amtsstunden verfügt; in den Amtsstunden muss<br />
der Dienstbetrieb – vorbehaltlich dienstlich erforderlicher Sonderregelungen – gewährleistet<br />
sein. Derzeit gelten beim Amt der Landesregierung folgende Amtstunden:<br />
Montag<br />
Dienstag<br />
Mittwoch<br />
Donnerstag<br />
Freitag<br />
7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
7:30 - 13:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr<br />
7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
7:30 - 13:00 Uhr<br />
Bei den Bezirkshauptmannschaften und der Agrarbezirksbehörde sind die Amtsstunden unterschiedlich<br />
geregelt und werden daher in diesem Erlass nicht wiedergegeben.<br />
Sowohl beim Amt, beim Unabhängigen Verwaltungssenat und auch bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
findet am Mittwoch ein eingeschränkter Dienstbetrieb im Zeitraum von 13.30<br />
(bzw. bei den Bezirkshauptmannschaften ab dem Ende der jeweiligen Regeldienstzeit) bis<br />
17.00 Uhr statt.<br />
In diesem Zeitraum muss im Rahmen einer Mindestbesetzung die telefonische Erreichbarkeit<br />
der Dienststelle durch eine in der Dienststelle anwesende kompetente Ansprechperson sichergestellt<br />
sein und müssen allfällige Auskünfte erteilt werden können. Darüber hinaus wird Parteienverkehr<br />
nur nach vorheriger Terminvereinbarung angeboten. Den genauen Umfang sowie<br />
die Ausgewogenheit bei der Einteilung der Mindestbesetzung bestimmt die Dienststellenleiterin<br />
bzw. der Dienststellenleiter.<br />
2.4.2. Regeldienstzeit:<br />
Innerhalb des durch die wöchentliche Gesamtarbeitszeit vorgegebenen Rahmens ist die Regeldienstzeit<br />
festgelegt.<br />
Die Regeldienstzeit beträgt 40 Stunden gem. § 64 Abs. 2 OÖ.LBG bzw. § 23 Abs. 2 OÖ.L<strong>VB</strong>G.<br />
Montag 7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
Dienstag 7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
Mittwoch 7:30 - 13:30 Uhr<br />
Donnerstag 7:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr<br />
Freitag 7:30 - 13:00 Uhr<br />
64
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Bei den Bezirkshauptmannschaften ist jedenfalls eine mindestens halbstündige Mittagspause<br />
an jedem langen Arbeitstag vorzusehen.<br />
Gesonderte Dienstpläne bzw. gesonderte Dienststundeneinteilungen sind der Regeldienstzeit<br />
gleichzuhalten (Sonderregelung siehe 3.9.)<br />
Zusätzlich findet am Mittwoch ein eingeschränkter Dienstbetrieb im Zeitraum von 13:30 ( bzw.<br />
bei den Bezirkshauptmannschaften ab dem Ende der jeweiligen Regeldienstzeit) bis 17:00 Uhr<br />
statt.<br />
Die Dienstleistung am Mittwoch Nachmittag ist eine angeordnete Mehrleistung (und daher keine<br />
Regeldienstzeit), für die gemäß Punkt 3.6.6. der Arbeitszeitregelung des Amtes Zeitausgleich<br />
(ZA 1:1) anfällt, bei Bezieherinnen bzw. Beziehern von Verwendungszulagen oder Ü-<br />
berstundenpauschalien Gleitzeitplus. Dies gilt nicht, wenn im Rahmen einer gesonderten<br />
Dienststundeneinteilung Dienst am Mittwoch Nachmittag versehen wird.<br />
2.5. Schriftlichkeit:<br />
Anordnungen der Dienstvorgesetzten bzw. des Dienstvorgesetzten sind auf Verlangen schriftlich<br />
zu erteilen.<br />
3. Flexible Arbeitszeit:<br />
Die Bediensteten des Amtes der Oö. Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften und des<br />
Unabhängigen Verwaltungssenates (Ausnahme siehe jedoch 1.2.) können – soweit nicht wichtige<br />
dienstliche Gründe entgegenstehen – eine von der Regeldienstzeit abweichende Dienststundeneinteilung<br />
(= flexible Arbeitszeit) in Anspruch nehmen. Arbeitszeiteinheit ist die Minute, flexibler<br />
Arbeitszeitraum je nachdem der Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr.<br />
Dabei gilt folgendes:<br />
3.1. Dienstzeitrahmen:<br />
Grundsätzlich können die Bediensteten ihren Dienstverrichtungen innerhalb des folgenden Dienstzeitrahmens<br />
nachkommen:<br />
Montag bis Donnerstag 6:30 - 20:00 Uhr<br />
Freitag<br />
6:30 - 16:00 Uhr<br />
Innerhalb dieses Dienstzeitrahmens können die Bediensteten bei Einhalten der Kernzeit (3.2.) den<br />
Beginn und das Ende ihrer Arbeitszeit frei wählen. Der außerhalb der Kernzeit gelegene Zeitraum<br />
wird im folgenden als "flexibler Arbeitszeitrahmen" bezeichnet.<br />
Innerhalb des Dienstzeitrahmens fallen keine Überstunden an.<br />
Für Dienstleistungen aus "dienstlichen Notwendigkeiten" während des Dienstzeitrahmens aber<br />
außerhalb der Regeldienstzeit wird innerhalb eines einjährigen Durchrechnungszeitraumes grundsätzlich<br />
Zeitausgleich 1:1 gewährt. Die Eingabe hat mittels Korrekturbeleg zu erfolgen.<br />
Der Durchrechnungszeitraum umfasst ein Kalenderjahr<br />
3.2. Kernzeit:<br />
Für alle Bediensteten – ausgenommen Sonderregelungen nach 3.9. – besteht an allen Arbeitstagen<br />
Anwesenheitspflicht von 9:00 bis 11:45 Uhr. Die Kernzeit ist, soweit nicht Ausnahmeregelungen<br />
getroffen wurden, lückenlos einzuhalten.<br />
65
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3.3. Mittagspause:<br />
Die Inanspruchnahme einer Ruhepause (von Ruhepausen) ist in der Zeiterfassung jedenfalls als<br />
Abwesenheit (siehe 4.) zu registrieren.<br />
Auch wenn die Betriebsküche im Amtsgebäude untergebracht ist, ist die Einnahme des Mittagessens<br />
als private Abwesenheit in der Zeiterfassung zu buchen.<br />
Wird (werden) bei Beendigung der Tages-Ist-Arbeitszeit ab 15.00 und einer Gesamttages-Ist-<br />
Arbeitszeit von mehr als 6,5 Stunden keine Ruhepause(n) in der Zeiterfassung registriert, so wird<br />
die Ist-Zeit (3.5.) um eine halbe Stunde bzw. um jenes Ausmaß gekürzt, das bei einer allfälligen<br />
(kürzeren) Arbeitsunterbrechung auf eine halbe Stunde fehlt. Anstelle einer halbstündigen Ruhepause<br />
können zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder drei Ruhepausen von je zehn<br />
Minuten verbraucht werden.<br />
Zeitbonus:<br />
Für alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter gilt ein "Zeitbonus" in Höhe von 1/40stel der jeweiligen<br />
Monats-Soll-Arbeitszeit reduziert um die Abwesenheiten (insbesondere Urlaub, Sonderurlaub,<br />
Kur- und Erholungsaufenthalt, Genesungsaufenthalt, Rehabilitation, Krankenstand, Pflegefreistellung,<br />
Beschäftigungsverbot, Suspendierung). Bei Teilzeitkräften wird der "Zeitbonus" aliquot dem<br />
Beschäftigungsausmaß errechnet.<br />
Der Zeitbonus wird am Ende jeden Kalendermonates auf das Gleitzeitkonto (nach einer allfälligen<br />
Saldokappung ) gutgeschrieben.<br />
3.4. Soll-Zeit:<br />
Die Soll-Zeit ist die fiktive Dienstzeit pro Tag; sie richtet sich nach der Regeldienstzeit und beträgt<br />
daher Montag, Dienstag und Donnerstag 9,5 Stunden, Mittwoch 6 Stunden und Freitag 5,5 Stunden.<br />
Die Soll-Zeit pro Kalendermonat in Stunden ergibt sich aus der Summe der Soll-Zeiten der<br />
jeweiligen Arbeitstage des Kalendermonats.<br />
Bei Teilzeitbeschäftigten ergibt sich die Soll-Zeit aus der gesonderten Dienststundeneinteilung.<br />
Die Soll-Zeit ist Grundlage für die Berechnungen bei Abwesenheit vom Dienst wegen Urlaub,<br />
Krankheit etc.<br />
3.5. Ist-Zeit:<br />
Die Ist-Zeit ist die tatsächlich erbrachte Dienstzeit pro Tag bzw. pro Kalendermonat einschließlich<br />
der der Ist-Zeit zuzurechnenden Abwesenheiten.<br />
3.6. Über- und Unterzeit:<br />
Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Zeit sind Über- bzw. Unterzeiten.<br />
3.6.1. Überzeiten:<br />
Überzeiten können durch die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit (= Gleitzeitplus) durch<br />
Überstunden, durch die Leistung von angeordneten Mehrleistungen innerhalb des Dienstzeitrahmens<br />
oder durch den Anfall von Reisezeiten entstehen.<br />
3.6.2. Überstunden:<br />
Überstunden sind die als solche angeordneten bzw. angeordneten gleichzuhaltenden Dienstzeiten,<br />
die außerhalb des Dienstzeitrahmens geleistet werden.<br />
Überschreitet das Zeitausgleichskonto 1:1 – ausgenommen Reisezeiten – am Ende eines Kalendermonates<br />
den Wert von plus 20 Stunden, so sind die über 20 Stunden hinausgehenden<br />
Stunden mit dem Faktor 1:1,5 aufzuwerten oder finanziell als Überstunden abzugelten.<br />
66
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die Anordnung der Überstunden ist durch die Zeitbeauftragte bzw. den Zeitbeauftragten in die<br />
Zeiterfassung einzugeben. Bei Überstunden, die angeordneten gleichzuhalten sind, hat die<br />
Eingabe nachträglich zu erfolgen.<br />
Generelle Überstundenberechtigungen dürfen im Zeiterfassungssystem nicht vergeben werden.<br />
Geleistete Überstunden dürfen erst nach Genehmigung durch die zuständige Vorgesetzte bzw.<br />
den zuständigen Vorgesetzten (Vermerk am Zeitbeleg) in das Zeiterfassungssystem übernommen<br />
werden.<br />
Die Gewährung einer Verwendungszulage mit Mehrleistungsanteil schließt die Anordnung von<br />
Überstunden sowie die allenfalls erforderliche Zustimmung der Abteilung Personal zu dieser<br />
Anordnung mit ein. Dies gilt sinngemäß für die Leistung von Überstunden im Rahmen eines<br />
"Überstundenpauschales" (Pauschalvergütung von Überstunden). Überstunden, die durch eine<br />
Verwendungszulage oder ein "Überstundenpauschale" abgegolten sind, können daher nicht zu<br />
Zeitausgleich oder einer gesonderten Überstundenvergütung führen.<br />
Die Gewährung einer Verwendungszulage mit Mehrleistungsanteil bzw. eines Überstundenpauschales<br />
schließt die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit nicht aus.<br />
Allerdings wird von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern mit einer Verwendungszulage oder einem<br />
Überstundenpauschale erwartet, dass sie im mehrmonatigen Schnitt zeitliche Mehrleistungen<br />
erbringen.<br />
3.6.3. Überstunden-Zeitausgleich:<br />
Angeordnete oder solchen gleichzuhaltende Überstunden sind – ausgenommen 3.6.2. dritter<br />
Absatz – grundsätzlich durch Freizeit auszugleichen. Dieser Überstunden-Zeitausgleich ist von<br />
der Dienststellenleiterin bzw. vom Dienststellenleiter unter Berücksichtigung der dienstlichen<br />
Erfordernisse zu gewähren und kann sich auch auf die Kernzeit erstrecken. Der Überstunden-<br />
Zeitausgleich hat in der Regel Vorrang vor dem "Zeitausgleich 1:1" (3.6.6.) und dem Gleitzeitplus-Ausgleich,<br />
ausgenommen der vorrangige Gleitzeitplus-Ausgleich (3.6.8.).<br />
3.6.4. Mehrleistungen von Teilzeitbeschäftigungen (bis 40 Wochenstunden):<br />
Mehrleistungen von Teilzeitbeschäftigten sind die als solche angeordneten bzw. solchen<br />
gleichzuhaltenden Dienstzeiten ausgehend vom festgesetzten Beschäftigungsausmaß bis zum<br />
Erreichen der 40 Wochenstunden.<br />
Mehrleistungen von Teilzeitbeschäftigten, die durch eine Verwendungszulage abgegolten sind,<br />
können nicht zu Zeitausgleich oder einer gesonderten Vergütung führen.<br />
3.6.5. Reisezeiten:<br />
Reisezeiten sind Zeiten einer Reisebewegung, um die sich eine Dienstreise über die Regeldienstzeit<br />
hinaus erstreckt.<br />
Reisezeiten von Bezieherinnen bzw. Beziehern einer Verwendungszulage oder eines "Überstundenpauschales"<br />
können nicht zu Zeitausgleich führen.<br />
3.6.6. "Zeitausgleich 1:1":<br />
Dienstleistungen aus "dienstlichen Notwendigkeiten" innerhalb des Dienstzeitrahmens aber außerhalb<br />
der Regeldienstzeit, Mehrleistungen von Teilzeitbeschäftigten (bis 40 Wochenstunden)<br />
und Reisezeiten sind - ausgenommen 3.6.4. und 3.6.5. jeweils letzter Absatz - durch Zeitausgleich<br />
im Ausmaß 1:1 auszugleichen. Dieser "Zeitausgleich 1:1" hat in der Regel Vorrang vor<br />
dem Gleitzeitplus-Ausgleich, ausgenommen der vorrangige Gleitzeitplus-Ausgleich (3.6.8.).<br />
Festlegen der "dienstlichen Notwendigkeit":<br />
Zur Abgrenzung wird festgehalten, dass die Anordnung von Dienstleistungen außerhalb der<br />
Regeldienstzeit nur aus Gründen die bzw. der "dienstlichen Notwendigkeit" erfolgen darf. Ob<br />
67
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
die "dienstliche Notwendigkeit" gegeben ist, entscheidet die bzw. der zuständige Dienstvorgesetzte.<br />
Die Anordnung von Mehrleistungen aus "dienstlichen Notwendigkeiten" innerhalb des Dienstzeitrahmens<br />
aber außerhalb der Regeldienstzeit ist durch die Zeiterfassungsbeauftragte bzw.<br />
den Zeitbeauftragten in die Zeiterfassung einzugeben.<br />
Abbau von Zeitausgleichsguthaben 1:1:<br />
Der Abbau von Zeitausgleichsguthaben hat grundsätzlich im Einvernehmen zwischen der bzw.<br />
dem Bediensteten und der bzw. dem Vorgesetzten zu erfolgen.<br />
Weist das Zeitausgleichsguthaben 1:1 entsprechende Pluswerte auf, dann kann die bzw. der<br />
Bedienstete von diesem Zeitausgleichsguthaben pro Kalenderhalbjahr einen geschlossenen<br />
Block von mindestens einer Kalenderwoche konsumieren, wenn die Inanspruchnahme dieses<br />
Zeitausgleichsguthabens mit einer mindestens einwöchigen Vorankündigungsfrist angemeldet<br />
wird (Vereinbarungsprinzip wie beim Erholungsurlaub).<br />
Zeitausgleich bis zu einem Arbeitstag ist zu gewähren wenn nicht zwingende dienstliche Gründe<br />
(insbesondere die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes) dagegen sprechen.<br />
Aufwertung von Zeitausgleichsguthaben:<br />
Kann innerhalb eines einjährigen Durchrechnungszeitraumes aus dienstlichen oder gesundheitlichen<br />
Gründen der Abbau des Zeitausgleichsguthaben 1:1 nicht zur Gänze erfolgen, dann<br />
werden die am Ende dieses Durchrechnungszeitraumes verbliebenen Zeitausgleichsstunden<br />
1:1, ausgenommen Reisezeiten, mit dem Faktor 1:1,5 in Form einer Zeitgutschrift auf das Konto<br />
1:1 in den nächsten Durchrechnungszeitraum übertragen oder finanziell als Überstunden abgegolten.<br />
Die Aufwertung des Zeitausgleichsguthabens am Ende des Kalendermonats (3.6.2, 2. Absatz)<br />
sowie am Ende des Durchrechnungszeitraumes findet dann nicht statt, wenn der bzw. dem Bediensteten<br />
nachweislich die Gelegenheit zum Abbau des Zeitausgleichsguthabens eingeräumt<br />
wurde, und sie bzw. er davon aus privaten - ausgenommen gesundheitlichen - Gründen keinen<br />
Gebrauch gemacht hat.<br />
3.6.6.1. Eingeschränkter Übertrag:<br />
Nach Ablauf von zwei Jahren können ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem sie entstanden<br />
sind, nur noch die Hälfte der noch nicht verbrauchten Zeitausgleich 1:1-Guthaben sowie<br />
die Hälfte der noch nicht verbrauchten Reisezeit-Guthaben (Punkt 3.6.5) verbraucht werden,<br />
der Rest erlischt nach Ablauf von drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem sie<br />
entstanden sind.<br />
Abweichend von dieser Bestimmung können in speziellen Arbeitszeitmodellen andere Regelungen<br />
über den Abbau von Zeitausgleichsguthaben (insb. Anordnungsrechte des Dienstgebers)<br />
vorgesehen werden.<br />
3.6.7. Gleitzeitplus:<br />
Die durch die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit erworbene Überzeit (= Gleitzeitplus)<br />
soll am Ende eines Kalendermonats nicht mehr als 50 Stunden betragen. Es dürfen daher maximal<br />
50 Gleitzeitplus-Stunden von einem Kalendermonat in den nächsten übertragen werden<br />
(sogenannte Saldokappung). Eine Überschreitung dieser Grenze ist nur wegen außergewöhnlichen<br />
Gründen (z.B. außergewöhnlicher Arbeitsbelastung) mit Zustimmung der Dienststellenleiterin<br />
bzw. des Dienststellenleiters zulässig und sobald wie möglich auf die zulässige Differenz<br />
von 50 Stunden zu reduzieren. Wird die Saldokappung länger als 6 Kalendermonate aufgehoben,<br />
hat die Dienststellenleitung die Abteilung Personal (zentrale Zeiterfassung) zu informieren.<br />
68
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Beträgt für Bezieherinnen bzw. Bezieher einer Verwendungszulage bzw. eines Überstundenpauschales<br />
die gesamte Überzeit (3.6.1.) am Ende eines Kalendermonats mehr als 50 Stunden,<br />
so können nur 50 Stunden als Gleitzeitplus in den nächsten Kalendermonat übertragen<br />
werden (sog. Saldokappung). Zeitliche Mehrleistungen sind durch diese Zulagen pauschal abgegolten.<br />
Diese Bestimmung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.<br />
3.6.8. Gleitzeitplus-Ausgleich:<br />
Gleitzeitplus-Stunden sind in der Regel innerhalb der Regeldienstzeit auszugleichen.<br />
Ein Kernzeit-Gleitzeitplus-Ausgleich bzw. ein vorrangiger Gleitzeitplus-Ausgleich kann nur im<br />
Ausmaß der vorhandenen Gleitzeitplusstunden in Anspruch genommen werden und muss bei<br />
der oder dem Vorgesetzten beantragt und von dieser oder diesem genehmigt werden.<br />
Mit Zustimmung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters können - soweit dienstliche<br />
Erfordernisse nicht entgegenstehen - insgesamt maximal 15 Gleitzeitplus-Stunden im Kalendermonat,<br />
maximal aber 5 ganze Arbeitstage in einem Kalendermonat<br />
a) in der Kernzeit (Kernzeit-Gleitzeitplus-Ausgleich) oder<br />
b) vorrangig gegenüber Überstundenzeitausgleich ( 3.6.3) bzw. Zeitausgleich 1:1<br />
(3.6.6) bei Guthaben von Überstunden-Zeitausgleich bzw. Zeitausgleich 1:1<br />
(vorrangige Gleitzeitplus-Ausgleich) ausgeglichen werden.<br />
Diese Bestimmung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.<br />
Soweit einem Gleitzeitplus-Ausgleich dienstliche Gründe entgegenstehen bzw. eine Mindestbesetzung<br />
nicht mehr gewährleistet ist, darf Zeitausgleich nicht in Anspruch genommen werden.<br />
Die Regelung betreffend die Erreichbarkeit (§ 30 Abs. 1) wird dadurch nicht berührt. An einem<br />
Tag sind alle Zeitausgleichsarten grundsätzlich miteinander frei kombinierbar. Die Kombination<br />
von stundenweisem Urlaub und Gleitzeitplus-Ausgleich ist nur dann möglich, wenn vor oder<br />
nach der Abwesenheit Dienst geleistet wird.<br />
3.6.9. Unterzeiten (Gleitzeitminus):<br />
Die durch die Inanspruchnahme der Gleitdienstzeit entstandene Unterzeit (Gleitzeitminus) darf<br />
am Ende eines Kalendermonats nicht mehr als 30 Stunden betragen.<br />
Ein allfälliges Gleitzeitminus ist jedenfalls zunächst durch bereits geleistete Überstunden und in<br />
weiterer Folge durch bereits erworbenen "Zeitausgleich 1:1" auszugleichen. Dieser Ausgleich<br />
von Gleitzeitminus-Stunden erfolgt – mit allenfalls auf Grund dienstrechtlicher Vorschriften bestehenden<br />
Umrechnungsfaktoren – automatisch beim periodischen Buchungsabschluss.<br />
Jegliches sodann verbleibendes Gleitzeitminus, das über 30 Stunden hinausgeht, gilt als unerlaubte<br />
Abwesenheit vom Dienst, sofern es nicht zum Ende des Kalendermonats (nachträglich)<br />
durch Erholungsurlaub ausgeglichen wird.<br />
Diese Bestimmung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.<br />
Auf Ansuchen der oder des Bediensteten können Unterzeiten (Gleitzeitminus) auch innerhalb<br />
des zulässigen Rahmens von 30 Stunden am Ende des Kalendermonats mit Zustimmung der<br />
Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters durch entsprechende Urlaubsguthaben ausgeglichen<br />
werden. Diese Bestimmung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.<br />
69
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3.7. Mindestbesetzung:<br />
Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter bestimmt nach den bei der Dienststelle gegebenen<br />
Notwendigkeiten, welche Stellen während der Regeldienstzeit besetzt sein müssen, damit<br />
ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb gewährleistet ist.<br />
Wenn sowohl die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter als auch deren bzw. dessen<br />
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter die Gleitdienstzeit in Anspruch nimmt, ist darauf zu achten, dass<br />
während der Regeldienstzeit für eine ausreichende Vertretung gesorgt wird.<br />
3.8. Teilzeitbeschäftigte:<br />
Für Teilzeitbeschäftigte gelten die Bestimmungen über die Gleitdienstzeit - unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Mindestbesetzung der Dienststelle - sinngemäß. Die gesonderte Dienststundeneinteilung<br />
ist der Regeldienstzeit gleichzuhalten.<br />
3.9. Sonderregelungen:<br />
Werden Sonderregelungen gemäß § 28 Abs. 1 letzter Satz erlassen, die auch auf Bedienstete<br />
anzuwenden sind, für die die Regelung über die Gleitdienstzeit gilt, so wird in diesen Sonderregelungen<br />
bestimmt, welche Dienststunden der Regeldienstzeit gleichzuhalten sind und welcher Sonder-Dienstzeitrahmen<br />
und welche Sonder-Kernzeit gilt.<br />
Bei Lehrlingen bestehen ebenfalls Sonderregelungen.<br />
4. Abwesenheiten:<br />
Für dienstliche und private Abwesenheiten gelten grundsätzlich die §§ 28 bis 35.<br />
Alle Bediensteten sind verpflichtet, das Zeiterfassungs-Terminal zu bedienen. Jedes Betreten bzw.<br />
Verlassen des Dienstgebäudes (bzw. des Gebäudekomplexes) muss jedenfalls zu einer Eintragung<br />
im Zeiterfassungssystem führen; ausgenommen sind lediglich rein private Anwesenheiten im<br />
Dienstgebäude (z.B. außerhalb der Regeldienstzeit oder während des Urlaubs).<br />
4.1. Dienstliche Abwesenheiten:<br />
70<br />
4.1.1. Außendienst (Dienstreise):<br />
Ein Außendienst (Dienstreise) im Sinne der Gleitzeitregelung ist eine Dienstverrichtung außerhalb<br />
oder innerhalb des Dienstortes, die einen Anspruch auf Reisegebühren begründet.<br />
Bei Außendiensten ist die tatsächliche Ausbleibezeit – abzüglich der (tatsächlichen) Mittagspause<br />
(3.3.) – als Ist-Zeit zu erfassen. Die Berechnung der Ausbleibezeit richtet sich nach den<br />
hiefür geltenden dienstlichen Bestimmungen. Überzeiten (3.6., insbesondere Reisezeiten<br />
(3.6.5.)) auf Grund von Außendiensten sind nach Maßgabe der dienstrechtlichen Bestimmungen<br />
zu genehmigen bzw. anzurechnen.<br />
Falls in die tatsächliche Ausbleibezeit auch Zeiten für private Besorgungen fallen oder sich die<br />
Bediensteten am Ort der auswärtigen Dienstverrichtung länger aufhalten als dienstlich erforderlich<br />
ist (z.B. gesellschaftliche Anlässe im Anschluss an eine dienstliche Verpflichtung), sind die<br />
dadurch anfallenden Zeiten nicht in der Ist-Zeit zuzurechnen.<br />
Wenn eine Zeiterfassung am Arbeitsplatz nicht möglich war (z.B. Fahrt zum Außendienst direkt<br />
vom Wohnort aus), sind Beginn und Ende des Außendienstes sowie allfällige Über- und Unterzeiten<br />
am nächstfolgenden Innendiensttag bekanntzugeben. Die erforderlichen Eintragungen<br />
und Änderungen sind von der bzw. dem Zeitbeauftragten durchzuführen, sofern die Eingabe
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
durch die Bedienstete bzw. den Bediensteten im elektronischen Gleitzeitsystem (SAP-ESS-<br />
CATS) nicht vorgesehen ist.<br />
Wenn die bzw. der Bedienstete noch innerhalb der Kernzeit vom Außendienst zurückkehrt, ist<br />
zumindest bis zum Ende der Kernzeit (siehe Regelung: 4.1.2. "Innendienst mit Außendienst")<br />
noch Innendienst zu versehen.<br />
4.1.2. Innendienst mit Außendienst:<br />
Wenn an einem Tag neben dem Außendienst auch Innendienst verrichtet wird, ist die tatsächliche<br />
Ausbleibezeit der Anwesenheitszeit im Innendienst zuzurechnen. Die Regelung für die Berechnung<br />
von Außendienstzeiten gilt sinngemäß.<br />
4.1.3. Dienstgang:<br />
Ein Dienstgang im Sinne der Gleitzeitregelung ist eine Dienstverrichtung außerhalb der Dienststelle,<br />
aber am Dienstort, die keinen Anspruch auf Reisegebühren begründet. Auch das Verlassen<br />
eines Dienstgebäudes als Dienstgang (z.B. zur Teilnahme an Besprechungen etc. bei<br />
Dienststellen in einem anderen Dienstgebäude/-komplex am Dienstort) ist im Zeiterfassungssystem<br />
einzutragen.<br />
Fallen auf dem Weg zum oder vom Besprechungsort Zeiten für private Besorgungen an, sind<br />
diese Zeiten von der Dienstzeit abzuziehen.<br />
4.1.4. Besuch von Veranstaltungen der Aus- und Fortbildung:<br />
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen werden sowohl innerhalb der Regeldienstzeit als auch<br />
außerhalb der Regeldienstzeit angeboten. Für die Anrechnung auf die Dienstzeit gelten die Regelungen<br />
des Erlasses vom 1. September 2002, PersI-010005/1500-2002-Rs/Ker über die<br />
Dienstzeitregelung für interne und externe Aus- und Fortbildung.<br />
4.1.5. Einschränkung des Dienstbetriebes:<br />
Wird der Dienstbetrieb aus besonderen Anlässen eingeschränkt, gelten die entsprechenden<br />
Zeiten im Sinne der Zeiterfassung als dienstfrei (keine Soll-Zeit). Die von den Bediensteten, die<br />
in diesem Fall zum Dienstbetrieb herangezogen werden, erbrachte Dienstzeit ist "Zeitausgleich<br />
1:1", bei Bezieherinnen bzw. Beziehern einer Verwendungszulage bzw. eines Überstundenpauschales<br />
Gleitzeitplus. Für den Dienstbetrieb am Tag des Betriebsausfluges gilt die Sonderregelung<br />
4.1.6.<br />
4.1.6. Betriebsausflug:<br />
Der Tag des Betriebsausfluges wird für die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer mit der Soll-Zeit<br />
des jeweiligen Tages gerechnet. Der Erwerb von Über- und Unterzeiten ist an diesem Tag<br />
grundsätzlich nicht möglich; Bedienstete, die jedoch ausdrücklich zur Aufrechterhaltung des<br />
Dienstbetriebes (4.1.5.) eingeteilt werden, erwerben aber "Zeitausgleich 1:1", bei Bezieherinnen<br />
bzw. Beziehern einer Verwendungszulage bzw. eines Überstundenpauschales Gleitzeitplus im<br />
Ausmaß der erbrachten Dienstzeit.<br />
Nehmen Teilzeitbeschäftigte an Tagen, an denen sie aufgrund der gesonderten Dienststundeneinteilung<br />
keinen Dienst zu leisten hätten, am Betriebsausflug teil, dann ist Ihnen ein Fünftel<br />
des festgesetzten Beschäftigungsausmaßes als "Zeitausgleich 1:1", bei Bezieherinnen bzw.<br />
Beziehern einer Verwendungszulage bzw. eines Überstundenpauschales als Gleitzeitplus auf<br />
die Ist-Zeit anzurechnen.<br />
Wird der Betriebsausflug an einem Samstag durchgeführt, sind den Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern<br />
9,5 Stunden (Teilzeitbeschäftigten jedoch ein Fünftel des festgesetzten Beschäftigungsausmaßes)<br />
als "Zeitausgleich 1:1" bei Bezieherinnen bzw. Beziehern einer Verwendungszulage<br />
oder eines "Überstundenpauschales" als Gleitzeitplus, der Ist-Zeit zuzurechnen.<br />
71
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
4.1.7. Personalvertretung:<br />
Die Tätigkeit als Personalvertreterin bzw. Personalvertreter (§ 3 Abs. 7 und § 24 Abs. 7 O.ö. L-<br />
PVG) ist der dienstlichen Tätigkeit gleichzuhalten (§ 28 Abs. 1 O.ö. L-PVG). Bei Verlassen des<br />
Dienstge-bäudes für die Ausübung dieser Funktion gelten die Regelungen 4.1.1., 4.1.2. und<br />
4.1.3.; die Abwesenheitszeit während der Regeldienstzeit wird der Ist-Zeit zugerechnet.<br />
4.2. Private Abwesenheiten:<br />
72<br />
4.2.1. Urlaub und Dienstbefreiung:<br />
Erholungsurlaub, Sonderurlaub und sonstige Dienstbefreiungen (Pflegefreistellung, Kuraufenthalte<br />
etc.) werden mit der jeweiligen Soll-Zeit pro Arbeitstag der Ist-Zeit zugerechnet.<br />
Werden Erholungsurlaub, Sonderurlaub und sonstige stundenweise konsumierbare Dienstbefreiungen<br />
(z.B. Pflegefreistellung) während der Regeldienstzeit stundenweise in Anspruch genommen,<br />
sind die dafür aufgewendeten Stunden der Ist-Zeit zuzurechnen.<br />
4.2.2. Dienstverhinderung:<br />
Sind die Bediensteten während der Regeldienstzeit infolge Erkrankung oder aus anderen - ihre<br />
Person betreffenden – wichtigen Gründen ohne ihr Verschulden an der Ausübung ihres Dienstes<br />
verhindert (Dienstverhinderung: z.B. Krankheit, Unfall, Gebrechen; Arztbesuch oder wichtige<br />
Behördengänge, soweit nicht außerhalb der Dienstzeit möglich; Vorladungen als Zeugin<br />
bzw. Zeuge, Schöffin bzw. Schöffe, Geschworene bzw. Geschworener, fachkundige Laienrichterin<br />
bzw. fachkundiger Laienrichter), so ist diese Zeit nach Maßgabe des Erlasses PersI-<br />
450003/137-1994/G, vom 27. Juli 1995 der Ist-Zeit zuzurechnen (ausgenommen in Fällen von<br />
nicht gerechtfertigter Abwesenheit vom Dienst). Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter<br />
ist von diesen Abwesenheiten zu informieren.<br />
Der Jahreszeit entsprechende – witterungsbedingte – Umstände (z.B. Schneefall, Glatteis etc.)<br />
bzw. übliche, durch das Verkehrsaufkommen (z.B. Stau im Frühverkehr) bedingte Behinderungen<br />
am Arbeitsweg, die eine Verspätung nach sich ziehen, sind kein Elementarereignis und<br />
daher keine gerechtfertigte Dienstverhinderung.<br />
Außerhalb der Regeldienstzeit sind solche Abwesenheitszeiten nicht der Ist-Zeit zuzurechnen.<br />
Fallen neben diesen gerechtfertigten Abwesenheiten Zeiten für private Besorgungen an, sind<br />
diese Zeiten von der Ist-Zeit abzuziehen.<br />
4.2.3. Sonstige private Abwesenheiten:<br />
Unter Berücksichtigung der Mindestbesetzung sind sonstige im privaten Interesse gelegene<br />
Besorgungen im unumgänglichen Ausmaß während der Regeldienstzeit zulässig; sie sollen<br />
grundsätzlich außerhalb der Kernzeit vorgenommen werden.<br />
Während der Kernzeit ist für solche privaten Wege die Zustimmung der Dienststellenleiterin<br />
bzw. des Dienststellenleiters erforderlich, die für bestimmte Fälle, soferne die Abwesenheit 15<br />
Minuten nicht übersteigt, auch generell erteilt werden kann. Als sonstige private Abwesenheiten<br />
sind u.a. Bankbesuch und das Besorgen der Jause anzusehen.<br />
Beim Verlassen und Betreten des Amtsgebäudes ist jeweils zu buchen.<br />
Sonstige private Abwesenheit während der Kernzeit sind, sofern sie 15 Minuten übersteigen,<br />
von der bzw. dem Vorgesetzten im Einzelfall zu genehmigen, und zur Gänze mittels Abwesenheitsantrag<br />
mit Zeit- bzw. Urlaubsguthaben zu belegen.<br />
Die entsprechenden Abwesenheitszeiten zwischen dem Beginn und dem Ende der Regeldienstzeit<br />
– einschließlich der allfälligen Mittagszeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr verkürzt um<br />
die einzuhaltende Mittagspause (3.3.) – werden bis zum Ausmaß von maximal zwei Stunden<br />
pro Kalendermonat der Ist-Zeit zugerechnet.
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5. Sonstiges:<br />
a. Betriebsfeiern in Amtsgebäuden (PersR-450003/136 vom 5. Dezember 1994) dürfen nur nach<br />
Genehmigung durch die Dienststellenleiterin bzw. den Dienststellenleiter und nur im unbedingt<br />
notwendigen Ausmaß während der Dienstzeiten stattfinden und sollten grundsätzlich<br />
nicht vor 16:00 Uhr (an langen Arbeitstagen) beginnen.<br />
Dauern sie über das Ende der Regeldienstzeit (bzw. gesonderte Dienststundeneinteilung)<br />
hinaus, so ist mit dem Ende der Regeldienstzeit (bzw. gesonderten Dienststundeneinteilung)<br />
auszubuchen, wobei dies zweckmäßigerweise in Form einer Sammelbuchung über die Zeitbeauftragten<br />
erfolgt.<br />
Durch die Teilnahme an Betriebsfeiern können keine Überzeiten bzw. kein Gleitzeitplus entstehen.<br />
b. Zeitbelege, die insbesondere für das Dienstabwesenheitsblatt relevante Daten enthalten<br />
(Krankenstand samt allfälliger ärztlicher Bestätigung, Sonderurlaub, Pflegefreistellung), weiters<br />
Überstundenanordnungen und Seminarbesuche sind das gesamte Kalenderjahr aufzubewahren<br />
und werden erst mit Löschung der Dezemberbuchungen, d.h. mit Beginn April des<br />
Folgejahres, vernichtet.<br />
Alle übrigen Zeitbelege, insbesondere Korrekturbuchungen sind solange von den Zeitbeauftragten<br />
aufzubewahren, als die entsprechenden Buchungen im Zeiterfassungssystem gespeichert<br />
sind (3 Monate); anschließend sind sie zu vernichten.<br />
Soweit aufgrund des elektronischen Zeiterfassungsystems (SAP/CATS/ESS) nicht ohnedies<br />
vorgesehen ist, dass die bzw. der Bedienstete Korrekturbuchungen vornehmen darf und soweit<br />
Korrekturbuchungen durch die Zeitbeauftragten nicht ohnedies durch die Anomalienliste<br />
vorgegeben sind, dürfen Korrekturbuchungen nur aufgrund von vorhandenen Zeitbelegen<br />
durchgeführt werden (keine Buchung ohne Beleg).<br />
c. Die Zeitnachweise (Monatsjournale) sind regelmäßig (monatlich) auszudrucken und von der<br />
Dienststellenleiterin bzw. vom Dienststellenleiter zu kontrollieren.<br />
Übergangsbestimmungen:<br />
"In-Kraft-Treten: Die Neuregelung des Punktes 3.6.6.1 gilt erstmals für Zeitausgleichs-Guthaben<br />
1:1 und Reisezeiten, die ab dem 1.1.2006 angefallen sind."<br />
Die übrigen Änderungen treten mit 1.2.2006 in Kraft.<br />
73
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 2 zu § 28 Abs. 1 und 2 <strong>DBO</strong><br />
Flexible Arbeitszeit mit händischer Zeiterfassung 1<br />
1. Geltungsbereich:<br />
1.1. Sachlicher Geltungsbereich:<br />
Dieser Anhang regelt die flexible Arbeitszeit und die Erfassung der Dienstzeit der Bediensteten<br />
des Amtes der Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften und des unabhängigen Verwaltungssenates,<br />
soweit kein elektronisches Zeiterfassungssystem installiert ist. Sonstige dienstrechtliche<br />
und inner-dienstliche Regelungen (z.B. über die Anordnung von Überstunden) bleiben unberührt.<br />
1.2. Persönlicher Geltungsbereich:<br />
Die Regelung der flexiblen Arbeitszeit mit händischer Zeiterfassung gilt – sofern nicht wichtige<br />
dienstliche Gründe entgegenstehen – für die Bediensteten des Amtes der Landesregierung, der<br />
Bezirkshauptmannschaften, der Agrarbezirksbehörde und des unabhängigen Verwaltungssenates,<br />
sofern sie ihren Arbeitsplatz in einer Dienststelle haben, in der kein elektronisches Zeiterfassungssystem<br />
installiert ist.<br />
2. Allgemeine Bestimmungen:<br />
2.1. Sprachliche Gleichbehandlung:<br />
Personenbezogene Bezeichnungen in dieser Regelung gelten jeweils auch in ihrer weiblichen<br />
Form.<br />
2.2. Amtsstunden:<br />
Innerhalb des durch die wöchentliche Gesamtarbeitszeit vorgegebenen Rahmens wird vom Landesamtsdirektor<br />
(Bezirkshauptmann, Amtsvorstand, Präsidenten des Oö. Verwaltungssenates)<br />
eine allgemeine Dienststundeneinteilung (Amtsstunden) verfügt; in den Amtsstunden muss der<br />
Dienstbetrieb – vorbehaltlich dienstlich erforderlicher Sonderregelungen – gewährleistet sein. Derzeit<br />
gelten beim Amt der Landesregierung folgende Amtsstunden (40 Wochenstunden):<br />
Montag<br />
Dienstag<br />
Mittwoch<br />
Donnerstag<br />
Freitag<br />
7.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<br />
7.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<br />
7.30 - 13.30 Uhr<br />
7.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr<br />
7.30 - 13.00 Uhr<br />
Gesonderte Dienstpläne bzw. gesonderte Dienststundeneinteilungen sind den Amtsstunden<br />
gleichzuhalten (Sonderregelungen siehe 3.9.).<br />
2.3. Schriftlichkeit:<br />
Anordnungen der Dienstvorgesetzten bzw. des Dienstvorgesetzten sind auf Verlangen schriftlich<br />
zu erteilen.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 6. Juli 1998, PersR-450003/373-1998/G.<br />
75
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3. Flexible Arbeitszeit:<br />
Für die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit gilt Folgendes:<br />
3.1. Dienstzeitrahmen:<br />
Grundsätzlich können die Bediensteten ihre Dienstverrichtungen innerhalb des folgenden Zeitraumes<br />
(Dienstzeitrahmen) nachkommen:<br />
Montag, Dienstag, Donnerstag<br />
Mittwoch, Freitag<br />
6.30 - 20.00 Uhr<br />
6.30 - 16.00 Uhr<br />
Innerhalb dieses Dienstzeitrahmens können die Bediensteten bei Einhaltung der Kernzeit (3.2.)<br />
den Beginn und das Ende ihrer Arbeitszeit frei wählen. Der außerhalb der Kernzeit gelegene Zeitraum<br />
wird im folgenden als "flexibler Arbeitszeitrahmen" bezeichnet.<br />
Innerhalb des Dienstzeitrahmens fallen keine Überstunden an.<br />
Für Dienstleistungen aus "dienstlichen Notwendigkeiten" während des Dienstzeitrahmens aber<br />
außerhalb der Amtsstunden wird innerhalb eines einjährigen Durchrechnungszeitraumes grundsätzlich<br />
Zeitausgleich 1:1 gewährt.<br />
Die Anordnung ist auf dem Gleitzeitblatt zu vermerken.<br />
Der Durchrechnungszeitraum umfasst ein Kalenderjahr.<br />
3.2. Kernzeit:<br />
Für alle Bediensteten – ausgenommen Sonderregelungen nach 3.9. – besteht an allen Arbeitstagen<br />
Anwesenheitspflicht von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie zusätzlich am Montag und Dienstag von<br />
14.00 bis 16.00 Uhr. Die Kernzeit ist, soweit nicht Ausnahmeregelungen getroffen wurden, lückenlos<br />
einzuhalten.<br />
3.3. Flexible Arbeitszeiteinheit und Flexibler Arbeitszeitraum:<br />
Die Zeiteinheit ist die Viertelstunde.<br />
Jeder Zeitteil darf nur<br />
a. zum vollen Stundenviertel (z.B. 7.00 Uhr, 7.15 Uhr) beginnen und<br />
b. die Zeiteinheit oder ein Vielfaches derselben (z.B. eine Viertelstunde, eine halbe Stunde) umfassen.<br />
Der flexible Arbeitszeitraum beträgt vier aufeinanderfolgende Kalenderwochen.<br />
3.4. Über- und Unterzeiten:<br />
Die durch die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit erworbene Überzeit (= Gleitzeitplus) soll<br />
am Ende eines aus drei aufeinanderfolgenen Kalendermonaten bestehenden Beobachtungszeitraumes<br />
(jeweils ein Kalenderquartal gerechnet ab dem 1. 1. des jeweiligen Jahres) nicht mehr als<br />
30 Stunden betragen. Während des Beobachtungszeitraumes kann der Übertrag der durch die<br />
Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit erworbenen Überzeit auf + 50 Stunden erhöht werden.<br />
Es dürfen daher während des Beobachtungszeitraumes maximal 50 Gleitzeitplus-Stunden und am<br />
Ende des Beobachtungszeitraumes maximal 30 Gleitzeitplus-Stunden von einem Kalendermonat<br />
in den nächsten übertragen werden.<br />
Beträgt für Bezieherinnen bzw. Bezieher einer Verwendungszulage bzw. eines Überstundenpauschales<br />
die gesamte Überzeit (3.6.1.) am Ende eines Kalendermonats innerhalb des Beobachtungszeitraumes<br />
mehr als 50 Stunden oder am Ende des Beobachtungszeitraumes mehr als 30<br />
76
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Stunden, so können nur 50 bzw. 30 Stunden als Gleitzeitplus in den nächsten Kalendermonat ü-<br />
bertragen werden. Zeitliche Mehrleistungen sind durch diese Zulagen pauschal abgegolten.<br />
Das Gleitzeitminus (das weniger an geleisteter Dienstzeit gegenüber den Amtsstunden) darf am<br />
Ende eines Gleitzeitraumes nicht mehr als 30 Stunden betragen.<br />
Jegliches sodann verbleibendes Gleitzeitminus, das über 30 Stunden hinausgeht, gilt als unerlaubte<br />
Abwesenheit vom Dienst, sofern es nicht zum Ende des Gleitzeitraumes (nachträglich)<br />
durch Erholungsurlaub ausgeglichen wird.<br />
Diese Bestimmungen gelten gleichermaßen für Teilzeitbeschäftigte.<br />
Innerhalb eines flexiblen Arbeitszeitraumes kann an Tagen, an denen kein Dienst geleistet wird<br />
(z.B. Dienstverhinderung 2 infolge Erkrankung, ganztägiger Urlaub, Betriebsausflug udgl.) und an<br />
Tagen, an denen eine Dienstreise durchgeführt wird, für die nach den einschlägigen Vorschriften<br />
eine Reisezulage gebührt, weder ein Gleitzeitplus noch ein Gleitzeitminus anfallen. Solche Tage<br />
sind hinsichtlich der flexiblen Arbeitszeit neutral.<br />
3.5. Mittagspause:<br />
Die Inanspruchnahme einer Ruhepause (von Ruhepausen) ist im Gleitzeitblatt jedenfalls als Abwesenheit<br />
einzutragen.<br />
Auch wenn die Betriebsküche im Amtsgebäude untergebracht ist, ist die Einnahme des Mittagessens<br />
als private Abwesenheit zu vermerken.<br />
Bei Beendigung der Tages-Ist-Arbeitszeit ab 15.00 und einer Gesamttages-Ist-Arbeitszeit von<br />
mehr als 6,5 Stunden ist eine Ruhepause von einer halben Stunde einzuhalten.<br />
Anstelle einer halbstündigen Ruhepause können zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder<br />
drei Ruhepausen von je zehn Minuten eingehalten werden.<br />
Für alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter gilt ein "Zeitbonus" in der Höhe von 1/40stel der jeweiligen<br />
Monats-Soll-Arbeitszeit reduziert um die Abwesenheit (Urlaub, Sonderurlaub, Kur- und Erholungsaufenthalt,<br />
Genesungsaufenthalt, Rehabilitation, Krankenstand, Pflegefreistellung, Beschäftigungsverbot,<br />
Suspendierung). Die Abwesenheiten bleiben unberücksichtigt, wenn die Mitarbeiterin<br />
bzw. der Mitarbeiter innerhalb einer Kalenderwoche zumindest an drei Arbeitstagen zumindest<br />
teilweise Dienst verrichtet. Sollte die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter innerhalb einer Kalenderwoche<br />
drei oder mehr Arbeitstage abwesend sein, so entsteht für diese Woche kein Zeitbonus.<br />
Bei Teilzeitkräften wird der "Zeitbonus" aliquot dem Beschäftigungsausmaß errechnet. Bei Teilzeitkräften<br />
bleiben Abwesenheiten dann unberücksichtigt, wenn sie an mindestens der Hälfte der<br />
Arbeitstage, die für sie festgelegt sind, Dienst verrichten. Sollte die teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin<br />
bzw. der teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter innerhalb einer Kalenderwoche an mehr als der Hälfte<br />
der Arbeitstage, die für ihn festgelegt sind, abwesend sein, so entsteht für diese Woche kein Zeitbonus.<br />
Der Zeitbonus wird am Ende jeden Kalendermonates auf das Gleitzeitkonto des Gleitzeitblattes<br />
des darauffolgenden Monats (Gleitzeitsaldo) gutgeschrieben.<br />
2<br />
Bezüglich der Definition der Abwesenheitsgründe "Arztbesuch" und "(wichtiger) Behördengang" siehe<br />
den Anhang zu § 32 Abs. 1.<br />
77
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3.6. Aufzeichnung:<br />
a. Gleitzeitblatt:<br />
Wer die Gleitdienstzeit in Anspruch nehmen will, hat die beabsichtigten flexiblen Arbeitszeiten<br />
in dauerhafter Schrift in der Regel für mindestens eine Woche im voraus in das Gleitzeitblatt<br />
einzutragen.<br />
Sind die beantragten flexiblen Arbeitszeiten für eine Kalenderwoche gleich den beantragten flexiblen<br />
Arbeitszeiten einer oder mehrerer Vorwochen im selben Gleitzeitraum, so genügt ein<br />
entsprechender Hinweis auf dem Gleitzeitblatt.<br />
b. Dauer-Gleitzeitblatt:<br />
Die flexible Arbeitszeit kann auch für mehrere aufeinanderfolgende flexible Arbeitszeiträume<br />
angesprochen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die flexiblen Arbeitszeiten innerhalb<br />
der aufeinanderfolgenden flexiblen Arbeitszeiträume gleich sind und dass die beantragte flexible<br />
Arbeitszeit innerhalb eines flexiblen Arbeitszeitraumes kein Zeitplus oder Zeitminus ergibt.<br />
In diesem Fall ist das Gleitzeitblatt als "Dauer-Gleitzeitblatt" zu bezeichnen; die flexible Arbeitszeit<br />
gilt solange, bis entweder eine flexible Arbeitszeit nicht mehr angesprochen oder eine geänderte<br />
flexible Arbeitszeit beantragt wird.<br />
c. Genehmigung:<br />
Das Gleitzeitblatt ist vor Inanspruchnahme des ersten Gleitzeitteiles der Dienststellenleiterin<br />
bzw. dem Dienststellenleiter zur Genehmigung der beantragten flexiblen Arbeitszeit vorzulegen.<br />
Die Genehmigung darf nur aus gewichtigen dienstlichen Gründen versagt werden.<br />
d. Kontrolle:<br />
Nach erfolgter Genehmigung der flexiblen Arbeitszeit ist das Gleitzeitblatt für Kontrollzwecke<br />
leicht einsehbar auf dem Arbeitsplatz aufzulegen.<br />
Die Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der flexiblen Arbeitszeit obliegt der Dienststellenleiterin<br />
bzw. dem Dienststellenleiter. Sie erfolgt überdies durch die Amtsleitung im Rahmen der übergeordneten<br />
Dienstaufsicht.<br />
e. Änderung der beantragten flexiblen Arbeitszeit:<br />
Beabsichtigt eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter eine Änderung der bereits genehmigten<br />
flexiblen Arbeitszeit, so gelten a) und c) sinngemäß. Aus wichtigen dienstlichen Gründen kann<br />
auch die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter die Genehmigung der flexiblen Arbeitszeit<br />
zur Gänze oder zum Teil widerrufen; gegebenenfalls kann ein Tag auch Arbeitstzeitneutral<br />
werden (siehe 3.4. letzter Absatz).<br />
f. Gleitzeitplus-Ausgleich:<br />
Gleitzeitplus-Stunden sind in der Regel innerhalb der Amtsstunden auszugleichen.<br />
Ein Kernzeit-Gleitzeitplus-Ausgleich bzw. ein Vorrangiger Gleitzeitplus-Ausgleich muss mit einem<br />
Zeitbeleg beantragt werden.<br />
Mit Zustimmung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters können – soweit dienstliche<br />
Erfordernisse nicht entgegenstehen – insgesamt maximal 15 Gleitzeitplus-Stunden im Kalendermonat,<br />
maximal aber 3 ganze Arbeitstage in einem Kalendermonat<br />
• in der Kernzeit (Kernzeit-Gleitzeitplus-Ausgleich) oder<br />
• vorrangig gegenüber Überstundenzeitausgleich (3.6.3.) bzw. Zeitausgleich 1:1 (3.6.6.) bei<br />
Guthaben von Überstunden-Zeitausgleich bzw. Zeitausgleich 1:1 (vorrangiger Gleitzeitplus-<br />
Ausgleich)<br />
ausgeglichen werden.<br />
78
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Darüber hinaus kann innerhalb des Beobachtungszeitraumes (Pkt 3. 6. 7) einmal ein maximal 5<br />
ganze Arbeitstage umfassender zusammenhängender Zeitraum<br />
• in der Kernzeit (Kernzeit-Gleitzeitplus-Ausgleich) oder<br />
• vorrangig gegenüber Überstundenzeitausgleich bzw. Zeitausgleich 1:1 (3.6.6.) bei Guthaben<br />
von Überstunden-Zeitausgleich bzw. Zeitausgleich 1:1 (vorrangiger Gleitzeitplus-Ausgleich)<br />
ausgeglichen werden.<br />
Der Ausgleich nach den vorhergehenden Absätzen darf innerhalb des Beobachtungszeitraumes<br />
(Pkt. 3. 6. 7) nicht mehr als 9 ganze Arbeitstage umfassen.<br />
Diese Bestimmung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.<br />
Soweit einem Gleitzeitplus-Ausgleich dienstliche Gründe entgegenstehen bzw. eine Mindestbesetzung<br />
nicht mehr gewährleistet ist, darf Zeitausgleich nicht in Anspruch genommen werden.<br />
Die Regelung betreffend die Erreichbarkeit (§ 30 Abs. 1) wird dadurch nicht berührt. An einem<br />
Tag sind alle Zeitausgleichsarten grundsätzlich miteinander frei kombinierbar. Die Kombination<br />
von stundenweisem Urlaub und Gleitzeitplus-Ausgleich ist nur dann möglich, wenn vor oder<br />
nach der Abwesenheit Dienst geleistet wird.<br />
g. Ende des flexiblen Arbeitszeitraumes:<br />
Nach Ablauf des flexiblen Arbeitszeitraumes hat die Bedienstete bzw. der Bedienstete das<br />
Gleitzeitblatt abzuschließen und der Dienststellenleiterin bzw. dem Dienststellenleiter vorzulegen.<br />
Das Gleitzeitblatt kann auch vor Ablauf des flexiblen Arbeitszeitraumes vorgelegt werden,<br />
wenn die genehmigte flexible Arbeitszeit absolviert ist. In diesem Fall endet der flexible Arbeitszeitraum<br />
mit der Vorlage des Gleitzeitblattes. Ein Dauer-Gleitzeitblatt ist der Dienststellenleiterin<br />
bzw. dem Dienststellenleiter vorzulegen, wenn die Dauer-flexible Arbeitszeit endet.<br />
h. Fortschreibung eines Gleitzeitplus/-minus:<br />
Ergibt sich beim Abschluss des Gleitzeitblattes ein Gleitzeitplus oder eine Gleitzeitminus, so ist<br />
dieses Gleitzeitplus oder Gleitzeitminus<br />
• wenn die flexible Arbeitszeit innerhalb von vier Wochen neuerlich beantragt wird, mitzuberücksichtigen;<br />
• in allen anderen Fällen durch Gleitzeitplus-Ausgleich bzw. Einarbeitung auszugleichen.<br />
Im Fall der lit. b) ist beim Abschluss des Gleitzeitblattes der Zeitpunkt der Inanspruchnahme<br />
des Gleitzeitplus-Ausgleiches bzw. der Einarbeitung zu beantragen. Dieser Antrag ist von der<br />
Dienststellenleiterin bzw. vom Dienststellenleiter zu genehmigen, wenn nicht wichtige dienstliche<br />
Gründe entgegenstehen. Kann die Genehmigung nicht erteilt werden, so hat die Dienststellenleiterin<br />
bzw. der Dienststellenleiter, der Organisationseinheit, und zwar soweit als möglich im<br />
Einvernehmen mit der Bediensteten bzw. dem Bediensteten, den Zeitpunkt des Gleitzeitplus-<br />
Ausgleiches bzw. der Einarbeitung festzulegen.<br />
Dies gilt sinngemäß bei Inanspruchnahme einer "Dauer-flexiblen Arbeitszeit", wenn ein Gleitzeitplus<br />
oder ein Gleitzeitminus innerhalb eines flexiblen Arbeitszeitraumes durch neutrale Tage<br />
anfal-en, und zwar mit der Maßgabe, dass ein Gleitzeitplus oder ein Gleitzeitminus innerhalb<br />
von acht Wochen auszugleichen ist. Gleitzeitplus-Ausgleich bzw. Einarbeitung sind auf einem<br />
Beiblatt zum Dauer-Gleitzeitblatt anzuführen.<br />
3.7. Mindestbesetzung:<br />
Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter bestimmt nach den bei der Dienststelle gegebenen<br />
Notwendigkeiten, welche Stellen während der Amtsstunden besetzt sein müssen, damit ein<br />
ordnungsgemäßer Dienstbetrieb gewährleistet ist.<br />
79
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Wenn sowohl die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter als auch deren Stellvertreterin<br />
bzw. dessen Stellvertreter die flexible Arbeitszeit in Anspruch nehmen, ist darauf zu achten, dass<br />
während der Amtsstunden für eine ausreichende Vertretung gesorgt wird.<br />
3.8. Teilzeitbeschäftigte:<br />
Für Teilzeitbeschäftigte gelten die Bestimmungen über die flexible Arbeitszeit – unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Mindestbesetzung der Dienststelle – sinngemäß. Die gesonderte Dienststundeneinteilung<br />
ist den Amtsstunden gleichzuhalten.<br />
3.9. Sonderregelungen:<br />
Werden Sonderregelungen gemäß § 28 Abs. 1 letzter Satz erlassen, die auch auf Bedienstete<br />
anzuwenden sind, für die die Regelung über die flexible Arbeitszeit gilt, so wird in diesen Sonderregelungen<br />
bestimmt, welche Dienststunden den Amtsstunden gleichzuhalten sind und welcher<br />
Sonder-Dienstzeitrahmen und welche Sonder-Kernzeit gilt.<br />
80
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 28 Abs. 5 <strong>DBO</strong> bzw.<br />
Anhang zu § 29 Abs. 5 <strong>DBO</strong><br />
Dienstzeitregelung:<br />
24. und 31. Dezember und Karfreitag 1<br />
Am 24. Dezember (Heiliger Abend) ist ganztägig dienstfrei; es sind keine Amtsstunden. Am<br />
31. Dezember endet der Dienst um 12.00 Uhr, es sind Amtsstunden laut Kundmachung gemäß<br />
§ 13 AVG, längstens jedoch bis 12.00 Uhr.<br />
Am Karfreitag sind Amtsstunden laut Kundmachung gemäß § 13 AVG, längstens jedoch bis 12.00<br />
Uhr. Am Karfreitag ist der Dienstbetrieb soweit aufrecht zu erhalten (Journaldienst), dass die unaufschiebbaren<br />
Amtsgeschäfte erledigt werden können und Parteienverkehr im notwendigen Umfang<br />
möglich ist.<br />
Bedienstete, die dem Evangelischen Glaubensbekenntnis, der Altkatholischen Kirche oder der<br />
Methodistenkirche angehören, sind am Karfreitag nicht zu diesem Dienstbetrieb heranzuziehen.<br />
Den Bediensteten, die zur Dienstleistung an einem Karfreitag herangezogen werden, ist Zeitausgleich<br />
zu gewähren. Es ist dafür zu sorgen, dass diese Heranziehung – langfristig gesehen – nicht<br />
zu einer unterschiedlichen Belastung der einzelnen Bediensteten führt.<br />
Bedienstete, die dem Evangelischen Glaubensbekenntnis angehören, erhalten am 31. Oktober<br />
(Reformationstag) die für den Besuch des Gottesdienstes erforderliche freie Zeit.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf den Erlässen vom 25. Oktober 1971, PräsI-8464/2 (Beschluss der Oö. Landesregierung<br />
vom 18. Oktober 1971), vom 7. April 1987, PräsI-121039/11, und vom 19. Juli 2000,<br />
PräsI-121039/88.<br />
81
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 32 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Dienstverhinderungen; Definition der Abwesenheitsgründe<br />
"Arztbesuch" und "(wichtiger) Behördengang" 1<br />
Im Zusammenhang mit der händischen/elektronischen Zeiterfassung taucht immer wieder die Frage<br />
auf, was unter "Arztbesuch" und "(wichtigem) Behördengang" zu verstehen ist.<br />
Nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 52 Abs. 1 Oö. Landesbeamtengesetz und<br />
§ 13 Abs. 1 Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz) liegt eine Dienstverhinderung dann vor,<br />
wenn eine Beamtin bzw. ein Beamter infolge Erkrankung oder aus anderen wichtigen Gründen an<br />
der Ausübung ihres bzw. seines Dienstes verhindert ist.<br />
Arztbesuche und Behördengänge sind daher als Dienstverhinderungen "aus anderen wichtigen<br />
Gründen" unter folgenden Voraussetzungen anzusehen:<br />
Arztbesuch:<br />
Arztbesuche sind grundsätzlich in der dienstfreien Zeit durchzuführen. Eine entsprechende Terminvereinbarung<br />
außerhalb der Amtsstunden (bei Teilzeitbeschäftigten: der gesonderten Dienststundeneinteilung)<br />
ist, soweit die Ordinationszeiten des Arztes dies ermöglichen, allen Dienstnehmerinnen<br />
bzw. Dienstnehmern zumutbar. Ausgenommen davon sind lediglich Arztbesuche aus<br />
akuten Anlassfällen.<br />
Soweit ein Arztbesuch dann dennoch in die Amtsstunden (bei Teilzeitbeschäftigten: die gesonderte<br />
Dienststundeneinteilung) fällt, ist er als "gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst" anzuerkennen.<br />
Dies gilt auch für die unbedingt notwendige Begleitung von Kindern zum Arztbesuch.<br />
Der Grundsatz der freien Arztwahl wird durch diese Regelung nicht betroffen.<br />
Sucht die bzw. der Bedienstete während der Amtsstunden (bei Teilzeitbeschäftigten: der gesonderten<br />
Dienststundeneinteilung) einen Arzt seines Vertrauens auf, so ist<br />
- die tatsächliche Dauer des Arztbesuches als gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst anzuerkennen,<br />
- die Fahrtzeit allerdings nur insoweit, als für eine Fahrtstrecke nicht mehr als 30 Minuten benötigt<br />
werden. Beginnt der Arztbesuch vor Dienstbeginn (Amtsstunden/Regeldienstzeit), so können<br />
maximal 45 Minuten für die Anreise zur Dienststelle berücksichtigt werden. Darüber hinausgehende<br />
Fahrtzeiten gehen zu Lasten der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers.<br />
Fällt der Arztbesuch bzw. die Fahrtzeit nur zum Teil in die Amtsstunden (gesonderte Dienststundeneinteilung),<br />
so sind nur die darauf entfallenden Teile als Dienstzeit anzuerkennen.<br />
Über Verlangen der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters ist eine Bestätigung über<br />
den Arztbesuch vorzulegen.<br />
Wichtiger Behördengang:<br />
Als gerechtfertigte Abwesenheiten vom Dienst sind beispielsweise folgende wichtige Behördengänge<br />
anzuerkennen:<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 27. Juli 1995, PersI-450003/137-1994/G.<br />
83
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
1. Vorladung als Zeugin bzw. Zeuge:<br />
Der Vorladung vor ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde als Zeugin bzw. Zeuge ist Folge zu<br />
leisten. Die Nichtbefolgung der Ladung steht unter Strafsanktion (vgl. die entsprechenden Bestimmungen<br />
ZPO, StPO, AVG). Die Erfüllung der Zeugnispflicht stellt eine (unverschuldete)<br />
Dienstverhinderung dar. Der Dienstgeber kann Bediensteten, die als Zeugin bzw. Zeuge vor Gericht<br />
oder eine Verwaltungsbehörde geladen sind, das Erscheinen dort nicht verwehren. Diese<br />
Dienstverhinderung ist rechtzeitig zu melden.<br />
2. Ladung oder Tätigwerden als Partei:<br />
Die Ladung oder das Tätigwerden von Bediensteten vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde<br />
als Partei ist in der Regel keine gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst, da es zumeist im privaten<br />
Interesse liegt. Bedienstete haben die dafür erforderliche freie Zeit daher durch Urlaub, Zeitausgleich<br />
oder Gleitzeitausgleich hereinzubringen.<br />
Ausgenommen ist die Teilnahme als Partei an Verfahren, an deren Verwirklichung ein überwiegendes<br />
öffentliches Interesse besteht (z.B. Enteignungsverfahren nach dem Oö. Straßengesetz,<br />
Wasserrechtsverfahren für Kanal-Wasserleitungsvorhaben; darunter fallen jedoch nicht sogenannte<br />
"Anrainerverfahren" wie z.B. Nachbar im Bau-, Gewerbeverfahren). In diesen Fällen ist die Zeit,<br />
die zur Geltendmachung der Parteiinteressen der bzw. des Bediensteten unbedingt notwendig ist,<br />
als Behördengang anzuerkennen.<br />
3. Vorsprache beim Finanzamt (einschließlich Familienbeihilfenstelle):<br />
Da auch diese Erledigungen im privaten Interesse der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers<br />
liegen, ist die dafür erforderliche freie Zeit durch Erholungsurlaub, Zeitausgleich oder Gleitzeitausgleich<br />
hereinzubringen.<br />
Zu 2. und 3.:<br />
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Behördengänge – sofern deren Befolgung nicht eine<br />
gesetzliche Verpflichtung darstellt – grundsätzlich im privaten Interesse der Bediensteten liegen<br />
und daher die dafür erforderliche freie Zeit entsprechend hereinzubringen ist.<br />
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass in den meisten Fällen ein berechtigtes Interesse<br />
der bzw. des Bediensteten an der persönlichen Teilnahme an der betreffenden Amtshandlung<br />
bzw. dem Behördengang vorliegen wird und daher die Teilnahme nicht verwehrt werden<br />
kann, allerdings gegen Hereinbringung der dafür erforderlichen Zeit.<br />
84
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 34 <strong>DBO</strong><br />
Richtlinien für die Gewährung von Sonderurlaub 1<br />
A. Allgemeine Bestimmungen<br />
(1) Der bzw. dem Bediensteten kann auf ihr bzw. sein Ansuchen aus wichtigen persönlichen oder<br />
familiären Gründen oder aus einem sonstigen besonderen Anlass ein Sonderurlaub gewährt werden.<br />
(2) Der Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn keine zwingenden dienstlichen Erfordernisse<br />
entgegenstehen; er darf die dem Anlass angemessene Dauer nicht übersteigen.<br />
(3) Der Sonderurlaub darf nur für einen Zeitraum gewährt werden, der mit dem Anlass unmittelbar<br />
zusammenhängt. Ein mehrtägiger Sonderurlaub ist für einen zusammenhängenden Zeitraum zu<br />
gewähren, soweit nicht der Anlass oder dienstliche Interessen die Teilung notwendig machen.<br />
(4) Fällt ein Ereignis, für welches Sonderurlaub nach P. 1 oder 2 der "Besonderen Bestimmungen"<br />
gewährt werden kann, auf einen dienstfreien Tag, so gebührt Sonderurlaub nur dann, wenn der<br />
Anlass (Eheschließung, Geburt eines Kindes) die bzw. den Bediensteten direkt (selbst) betrifft.<br />
(5) Ein dienstfreier Tag liegt vor:<br />
a. bei Fünftagewoche an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen,<br />
b. bei Schicht- und Wechseldienst an einem Tag, an dem keine Dienstleistung anfällt,<br />
c. bei Herabsetzung der Wochendienstzeit an einem Tag, an dem im Rahmen der Dienststundeneinteilung<br />
kein Dienst verrichtet wird.<br />
(6) Bei Bediensteten, bei denen die Wochendienstzeit herabgesetzt ist, ist das Ausmaß des Sonderurlaubes,<br />
soweit dieser in Stunden festgesetzt ist, entsprechend zu aliquotieren.<br />
(7) Für die Gewährung des Sonderurlaubes ist zuständig, soweit dies in den "Besonderen Bestimmungen"<br />
vorgesehen ist:<br />
a. die Dienststelle (DSt): Dienststellen im Sinne dieser Verfügung sind die Abteilungen des Amtes<br />
der Oö. Landesregierung, die Bezirkshauptmannschaften und die Agrarbezirksbehörde, für<br />
die Bediensteten der Anstalten und Betriebe deren Direktionen bzw. Verwaltungen bzw. Leitungen,<br />
für die übrigen Landesbediensteten die Stellen, bei denen sie verwendet werden;<br />
b. die Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management (GBM) für die Bediensteten der Anstalten<br />
und Betriebe; sie kann, soweit dies zweckmäßig ist, die Zuständigkeit an die Direktionen<br />
bzw. Verwaltungen bzw. Leitungen delegieren und – im Rahmen dieser Richtlinien – die<br />
Gewährung von Sonderurlaub näher regeln;<br />
c. die Abteilung Personal (Pers) für die übrigen Fälle.<br />
(8) Über einen Antrag der bzw. des Bediensteten auf Gewährung von Sonderurlaub soll binnen<br />
drei Arbeitstagen entschieden werden.<br />
(9) Die Gründe für eine ablehnende Entscheidung bzw. die Gründe für die nur teilweise Anrechnung<br />
als Sonderurlaub (nach Z. 11 bzw. 12 der Richtlinien) sind der bzw. dem Bediensteten<br />
gleichzeitig schriftlich bekanntzugeben.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf den Erlässen vom 20.Mai 1996, PersR-230011/94-1996/G, vom 6. Mai<br />
1997, PersR-230011/108-1997/G, geändert mit Sammelerlass PersR-490000/561-2006-Kop/Gi vom<br />
30. Oktober 2006.<br />
85
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(10) Bei einer Bewilligung für Aus- und Fortbildungszwecke ist zuvor noch die Kostentragung für<br />
die Teilnahme an dieser Veranstaltung abzuklären.<br />
(11) In Zweifelsfällen ist vor der Genehmigung des Sonderurlaubes das Einvernehmen mit der<br />
Personlabteilung herzustellen.<br />
(12) Für Sonderurlaube nach Punkt 11 der Richtlinien ist das Formblatt für die Teilnahme an Schulungen<br />
und Tagungen zu verwenden.<br />
(13) Für den Fall, dass seitens der Amtsleitung (Abteilung Präsidium) festgestellt wird, dass ein<br />
Katastrophenfall in einem Teil des Bundeslandes bzw. im gesamten Bundesland Oberösterreich<br />
vorliegt, (Elementarereignisse wie z.B. Hochwasserkatastrophe 2002, Schneechaos 2006) gilt<br />
abweichend von lit. B. Z. 13 Folgendes:<br />
a. Rettungseinsatz<br />
Angehörigen von Organisationen gemäß § 176 Abs. 1 Z. 7 lit. a ASVG, die im Katastrophenbzw.<br />
Rettungseinsatz stehen (insbesondere Feuerwehr, Rotes Kreuz, udgl.) kann für die gesamte<br />
Dauer des Einsatzes Sonderurlaub gewährt werden. Über das Ausmaß des Sonderurlaubs<br />
entscheidet im Einzelfall die Dienststellenleitung, an die die entsprechenden Ansuchen<br />
zu richten sind.<br />
b. Unzumutbarkeit der Dienstausübung<br />
Die Dienststellenleitungen werden ermächtigt, im Falle der Unzumutbarkeit des Dienstantritts<br />
auf Grund des Katastrophenfalles, insbesondere wegen unpassierbaren Verkehrswegen (<br />
Straßen, Brücken, Bahntrassen) bzw. Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel, Sonderurlaub im<br />
zwingend erforderlichen Ausmaß zu gewähren.<br />
c. Schutz des Eigentums<br />
Die Dienstellenleitungen werden ermächtigt, im Katastrophenfall betroffenen Bediensteten zur<br />
Ermöglichung von Maßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr bzw. zur Wiederherstellung<br />
eigener Güter wie zB. Schneebeseitigung bei Lawinen, Auspumpen des eigenen Kellers bei<br />
Hochwasser udgl., bis zu drei Tage Sonderurlaub zu gewähren.<br />
Eine Befassung der Abteilung Personal ist in den Fällen der lit. a, b und c nicht erforderlich.<br />
B. Besondere Bestimmungen<br />
Anlass<br />
1. Eheschließung<br />
a) der Bediensteten<br />
b) eines Kindes, eines Elternteiles<br />
oder von Geschwistern des Kindes<br />
der Lebensgefährtin bzw.<br />
des Lebensgefährten<br />
Dauer des<br />
Sonderurlaubes<br />
3 Arbeitstage<br />
1 Arbeitstag<br />
2. Geburt eines Kindes 2 Arbeitstage DSt<br />
Zuständigkeit<br />
DSt<br />
Besondere Voraussetzungen;<br />
Anmerkungen<br />
Der Sonderurlaub kann entweder<br />
bei der kirchlichen oder bei<br />
der standesamtlichen Eheschließung<br />
gewährt werden.<br />
3. Betreuung naher<br />
Angehöriger<br />
bis zu 40 Stunden<br />
jährlich<br />
DSt<br />
Zur Erfüllung einer familiären<br />
Pflicht der bzw. des Bediensteten,<br />
soweit dafür nicht grundsätzlich<br />
Pflegefreistellung vorgesehen<br />
ist.<br />
Ist das Ausmaß der Pflegefreistellung<br />
bereits erschöpft, so<br />
gebührt kein Sonderurlaub nach<br />
diesem Tatbestand.<br />
4. Todesfall (oder Tod)<br />
a) der Ehegattin oder des Ehegatten<br />
oder von Kindern<br />
3 Arbeitstage<br />
DSt<br />
86
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anlass<br />
Dauer des<br />
Sonderurlaubes<br />
Zuständigkeit<br />
Besondere Voraussetzungen;<br />
Anmerkungen<br />
b) von anderen nahen Angehörigen<br />
(Eltern; Lebensgefährtin bzw.<br />
Lebensgefährte; Verwandte in<br />
der "Seitenlinie" wie Onkel, Tante,<br />
Nichte u. dgl.;<br />
Angehörige im Rahmen der<br />
"Schwägerschaft")<br />
bis zu 1 Arbeitstag<br />
bis zu 3 Arbeitstagen<br />
5. Übersiedlung 1 Arbeitstag;<br />
2 Arbeitstage,<br />
wenn die Übersiedlung<br />
aus<br />
dienstlichen<br />
Gründen erfolgt<br />
6. Teilnahme oder Mitwirkung von<br />
Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern<br />
an Trainingslehrgängen,<br />
Vorbereitungskursen sowie an<br />
sportlichen Bewerben (Wettkämpfen)<br />
von wenigstens landesweiter<br />
Bedeutung (z.B. Landesmeisterschaft)<br />
7. Teilnahme oder Mitwirkung an kulturellen<br />
Bewerben von mindestens<br />
landesweiter Bedeutung<br />
8. Teilnahme an Veranstaltungen der<br />
Betriebssportgemeinschaft (Club<br />
Aktiv) als Betreuerin oder Betreuer<br />
oder Mannschaftsmitglied<br />
9. Tätigkeit als Betreuerin oder Betreuer<br />
bei Veranstaltungen für Jugendliche<br />
(Jugendlager u.dgl.)<br />
bis zu 80 Stunden<br />
jährlich; bei<br />
Teilnahme an<br />
Trainingslehrgängen<br />
oder<br />
Vorbereitungskursen<br />
dann,<br />
wenn für denselben<br />
Zweck e-<br />
bensoviel Erholungsurlaub<br />
aufgewendet<br />
wird<br />
wie Sonderurlaub<br />
bis zu 40 Stunden<br />
jährlich,<br />
wenn die Bediensteten<br />
für<br />
denselben Zweck<br />
ebensoviel Erholungsurlaub<br />
aufwenden<br />
wie<br />
Sonderurlaub<br />
bis zu 40 Stunden<br />
jährlich; weitere<br />
20 Stunden<br />
jährlich, wenn die<br />
Bediensteten für<br />
denselben Zweck<br />
soviel Erholungsurlaub<br />
aufwenden<br />
wie Sonderurlaub<br />
bis zu 20 Stunden<br />
jährlich,<br />
wenn die Bediensteten<br />
für<br />
denselben Zweck<br />
doppelt soviel<br />
Erholungsurlaub<br />
aufwenden wie<br />
Sonderurlaub<br />
DSt<br />
Pers<br />
Pers<br />
Pers<br />
DSt<br />
1 Arbeitstag zur Erfüllung einer<br />
familiären Pflicht der bzw. des<br />
Bediensteten, insbesondere<br />
wenn sie bzw. er mit der bzw.<br />
dem Verstorbenen im gemeinsamen<br />
Haushalt lebte<br />
wenn der bzw. dem Bediensteten<br />
die Besorgung des Begräbnisses<br />
obliegt<br />
Darunter fallen nicht Veranstaltungen<br />
des Dienstgebers oder<br />
der Betriebssportgemeinschaft<br />
(Club Aktiv).<br />
Sonderurlaub wird nicht gewährt,<br />
wenn die Bediensteten<br />
für die Teilnahme eine Vergütung<br />
(ausgenommen Ersatz von<br />
Reise- und Aufenthaltskosten)<br />
erhalten.<br />
Der Kreis der Spitzensportlerinnen<br />
und Spitzensportler wird im<br />
Einvernehmen mit der Landessportdirektion<br />
festgelegt.<br />
Sonderurlaub wird nicht gewährt,<br />
wenn die Bediensteten<br />
für die Teilnahme eine Vergütung<br />
(außer für tatsächlichen<br />
Aufwand) erhalten.<br />
Veranstaltungen der Betriebssportgemeinschaft<br />
(Club Aktiv),<br />
auch wenn die Bedienstete<br />
bzw. der Bedienstete als<br />
Betreuerin bzw. Betreuer tätig<br />
ist, fallen nicht unter diesen<br />
Sonderurlaubstatbestand.<br />
87
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anlass<br />
10. a) Vorbereitung auf Ablegung der<br />
- schriftlichen Dienstprüfung<br />
(Modul 2)<br />
- mündlichen Fachprüfung (Modul<br />
3)<br />
b) Staatsprüfung für den Försterdienst<br />
(Modul 3)<br />
c) Physikatsprüfung (Modul 3)<br />
Dauer des<br />
Sonderurlaubes<br />
40 Std.<br />
20 Std.<br />
20 Std.<br />
20 Std.<br />
Zuständigkeit<br />
DSt<br />
Besondere Voraussetzungen;<br />
Anmerkungen<br />
Der Sonderurlaub wird für die<br />
jeweilige Prüfung nur einmal<br />
gewährt. Soweit er nicht beansprucht<br />
wurde, kann er für eine<br />
spätere Prüfung gewährt werden.<br />
Unterziehen sich die bzw.<br />
der Bedienstete der Prüfung<br />
nicht, so gilt der beanspruchte<br />
Sonderurlaub als Erholungsurlaub.<br />
11. Teilnahme an Veranstaltungen zur<br />
Aus- und Fortbildung, Tagungen,<br />
Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen,<br />
wenn dienstliche Interessen<br />
vorliegen<br />
12. Sonstige Aufgaben im öffentlichen<br />
Interesse, insbesondere Teilnahme<br />
an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen<br />
für Mitglieder von freiwilligen<br />
Feuerwehren, Rettungs- oder sonstigen<br />
Hilfsorganisationen<br />
bis zu 80 Stunden<br />
jährlich je<br />
nach dem Grad<br />
des dienstlichen<br />
Interesses<br />
bis zu 40 Stunden<br />
jährlich, je<br />
nach dem Grad<br />
des öffentlichen<br />
Interesses ist<br />
dafür anteilig<br />
Erholungsurlaub<br />
aufzuwenden,<br />
zumindest aber<br />
im Verhältnis 1:1<br />
bis 25<br />
jährlich:<br />
DSt<br />
darüber<br />
hinaus:<br />
Pers<br />
GBM/Anst<br />
DSt<br />
Pers ist auch für die Bediensteten<br />
der Anstalten und Betriebe<br />
zuständig, wenn mit dem Sonderurlaub<br />
Folgen für das<br />
Dienstverhältnis verbunden<br />
sind.<br />
Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren<br />
und Rettungsorganisationen<br />
kann der Sonderurlaub<br />
für die Teilnahme an einem<br />
Ausbildungslehrgang pro Kalenderjahr<br />
zur Gänze, darüber<br />
hinaus anteilig mit Erholungsurlaub<br />
gewährt werden. Kein<br />
Sonderurlaub gebührt für die<br />
Teilnahme an Leistungswettbewerben.<br />
13. Sonstige besondere Anlässe (z.B.<br />
Soforteinsätze von Mitgliedern der<br />
freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen)<br />
14. Absolvierung einer "ambulanten"<br />
Kurbehandlung<br />
bis zu 1 Arbeitstag<br />
über 1 Arbeitstag<br />
bis zu 60 Stunden<br />
jährlich,<br />
wenn die Bediensteten<br />
für<br />
denselben Zweck<br />
ebensoviel Erholungsurlaub<br />
aufwenden<br />
wie Sonderurlaub<br />
DSt<br />
Pers<br />
DSt<br />
Der Geburtstag der Bediensteten<br />
ist kein besonderer Anlass<br />
im Sinn dieser Bestimmung<br />
Voraussetzung für die Gewährung<br />
von Sonderurlaub ist, dass<br />
der Sozialversicherungsträger<br />
bzw. die KFL den Bediensteten<br />
eine vom Arzt verordnete<br />
"ambulante Kurbehandlung"<br />
bewilligt hat.<br />
88
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 1 zu § 35 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Pflegefreistellung<br />
1. Die Voraussetzungen für Pflegefreistellungen sind im § 50 Oö. L<strong>VB</strong>G und im § 84 Oö. LBG<br />
geregelt. Die Erlässe vom 30. April 1990, PersR-230011/4-1990/Bum, vom 2. Februar 1993,<br />
PersR-230011/37-1993/G und vom 25. Juni 1993, PersR-230011/46-1993/G gelten darüber<br />
hinaus weiter. 1<br />
2. Für die Genehmigung der Pflegefreistellung ist jene bzw. jener Vorgesetzte zuständig, der bzw.<br />
dem die Bewilligung des Erholungsurlaubs obliegt.<br />
3. Für die Antragstellung und die Genehmigung ist das von der Abteilung Personal aufgelegte<br />
Formular zu verwenden.<br />
4. Pflegefreistellungen sind in das Dienstabwesenheitsblatt einzutragen bzw. in der elektronischen<br />
Zeiterfassung zu vermerken.<br />
5. Bei der Genehmigung oder Versagung der Pflegefreistellung gibt es kein Ermessen. Sind die<br />
Voraussetzungen gegeben, so ist die Pflegefreistellung zu genehmigen, sonst zu versagen.<br />
6. Wenn der Anspruch auf Pflegefreistellung nach Punkt 1. erschöpft ist und ein noch nicht 12-<br />
jähriges Kind der bzw. des Bediensteten erkrankt, besteht nunmehr die Möglichkeit, dass die<br />
bzw. der Bedienstete einen noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub zur Pflege des Kindes antreten<br />
kann, ohne vorher den Urlaubsantritt mit dem Dienstgeber zu vereinbaren. Allerdings ist<br />
der Dienstgeber in geeigneter Weise vom Urlaubsantritt und der voraussichtlichen Dauer in<br />
Kenntnis zu setzen. Ein solcher Urlaub darf den Zeitraum der notwendigen Pflege nicht überschreiten.<br />
Nach Dienstantritt ist für den zu Pflegezwecken konsumierten Erholungsurlaub umgehend ein<br />
Urlaubsantrag vorzulegen. Über Verlangen des Dienstgebers ist die Notwendigkeit der Pflege<br />
des im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten noch nicht 12-jährigen Kindes nachzuweisen.<br />
7. Für Auskünfte steht die Abteilung Personal zur Verfügung.<br />
1<br />
Im Erlass vom 25. Juni 1993, PersR-230011/46-1993/G, wurde festgehalten, dass es nicht zulässig ist,<br />
für denselben Verhinderungsfall unmittelbar anschließend an die erste Woche eine zusammenhängende<br />
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von 2 Wochen in Anspruch zu nehmen. Der Anspruch auf<br />
die weitere Woche bedingt einen neuerlichen Verhinderungsfall.<br />
89
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 2 zu § 35 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Genehmigung von Kuraufenthalten und Sonderurlauben<br />
für ambulante Kurbehandlungen<br />
Diese Regelung beruht auf den Erlässen PersR-230011/41-1993/S vom 2. April 1993 und PersR-<br />
230011/108-1997-G (geändert mit Sammelerlass PersR-490000/561-2006-Kop/Gi vom 30. Oktober<br />
2006).<br />
Für die Genehmigung von Kuraufenthalten sowie von "ambulanten Kurbehandlungen" ist die<br />
Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter zuständig.<br />
1. Die Dienstbefreiung für die Dauer eines Kuraufenthaltes oder für die Dauer der Unterbringung<br />
in einem Genesungsheim (zur völligen Herstellung der Gesundheit) darf nur dann gewährt werden,<br />
wenn der Dienststellenleiterin bzw. dem Dienststellenleiter die Kurbewilligung bzw. schriftliche<br />
Einweisung in ein Kur- oder Genesungsheim durch einen Sozialversicherungsträger bzw.<br />
die KFL vorgelegt wird.<br />
Die Genehmigung darf nur für den im Bewilligungsschreiben angegebenen Zeitraum oder auf<br />
die entsprechende Anzahl von Kalendertagen erstreckt werden, wobei bei der zeitlichen Einteilung<br />
der Dienstbefreiung auf zwingende dienstliche Gründe Rücksicht zu nehmen ist.<br />
2. Zur Absolvierung einer "ambulanten Kurbehandlung" ist der bzw. dem Bediensteten Sonderurlaub<br />
zu gewähren, wenn der Sozialversicherungsträger bzw. die KFL der bzw. dem Bediensteten<br />
eine vom Arzt verordnete "ambulante Kurbehandlung" bewilligt hat.<br />
In diesem Fall kann der bzw. dem Bediensteten auf seinen Antrag hin bis zu 60 Stunden Sonderurlaub<br />
jährlich gewährt werden, wenn die bzw. der Bedienstete für denselben Zweck ebensoviel<br />
Erholungsurlaub aufwendet als er Sonderurlaub erhält.<br />
Die Dauer eines Kur- bzw. Genesungsaufenthalts ist im Dienstverhinderungsformular (Sammelmeldung<br />
für Krank- bzw. Gesundmeldungen) einzutragen und im Dienstabwesenheitsblatt<br />
vorzumerken.<br />
Für die Genehmigungen ist das Formblatt zu verwenden. Für Auskünfte steht die Abteilung Personal<br />
zur Verfügung.<br />
91
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 37 Abs. 7 <strong>DBO</strong> bzw.<br />
Anhang zu § 38 Abs. 5 <strong>DBO</strong><br />
Rufbereitschaft beim Amt der Oö. Landesregierung<br />
Beim Amt der Oö. Landesregierung sind in verschiedenen Bereichen Rufbereitschaftsdienste eingerichtet.<br />
Die für die Rufbereitschaft eingeteilte Bedienstete bzw. der für die Rufbereitschaft eingeteilte Bedienstete<br />
versieht für die Dauer einer Woche Rufbereitschaft. Die Rufbereitschaft erstreckt sich<br />
auf die gesamte Zeit außerhalb der Regeldienstzeit.<br />
Für Fälle, in denen während der Regeldienstzeit schon Umstände bekannt werden, die darauf<br />
schließen lassen, dass außerhalb der Regeldienstzeit die Notwendigkeit besteht, erforderlichenfalls<br />
unaufschiebbare Maßnahmen treffen zu müssen, oder wenn aus dienstlichen Gründen die<br />
Notwendigkeit besteht (z.B. Sachverständige), ist die Erreichbarkeit des Rufbereiten bzw. der Rufbereiten<br />
auch während der Amtsstunden sicher zu stellen.<br />
Zur Vermeidung einer übergroßen zeitlichen Belastung der rufbereiten Bediensteten hat die Inanspruchnahme<br />
außerhalb der Regeldienstzeit nur in solchen Fällen zu erfolgen, die keinen Aufschub<br />
bis zum nächsten Arbeitstag dulden.<br />
Diese Rufbereitschaft ist insbesondere für Unfälle, Katastrophen- oder Krisenfälle, außergewöhnliche<br />
Ereignisse etc. eingerichtet, nicht jedoch etwa, um den Ursachen weniger gravierender Belästigungen<br />
und dergleichen nachzugehen.<br />
Die jeweils rufbereite Bedienstete bzw. der jeweils rufbereite Bedienstete ist innerhalb und außerhalb<br />
der Regeldienstzeit über die<br />
Landeswarnzentrale OÖ<br />
Petzoldstraße 43, 4020 Linz<br />
Tel. 0732.770.122 – 101<br />
anzufordern.<br />
Eine Kontaktaufnahme auf direktem Weg (persönlich oder über andere Kommunikationsmittel)<br />
bleibt nach wie vor unbenommen.<br />
Die anfordernde Stelle hat für die Freihaltung der Rückrufnummer für die Rufbereite bzw. den<br />
Rufbereiten zu sorgen. Für die entsprechende Ausstattung für die Rufbereite bzw. den Rufbereiten<br />
ist vorgesorgt.<br />
Für abgehende Gespräche von Endgeräten, die nicht vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt<br />
werden, können nur in begründeten Ausnahmefällen Gebühren verrechnet werden.<br />
Von der Landeswarnzentrale OÖ wird jeden Freitag in der Zeit zwischen 12.00 – 13.00 Uhr ein<br />
Proberuf durchgeführt. Der Proberuf unterscheidet sich von anderen Rufen durch die optische<br />
Meldung "Proberuf" am Display.<br />
Sollte kein Proberuf ankommen, ist mit der Landeswarnzentrale OÖ Kontakt aufzunehmen.<br />
Die für die Rufbereitschaft eingeteilte Bedienstete bzw. der für die Rufbereitschaft eingeteilte Bedienstete<br />
hat sich bei Beginn der Rufbereitschaft von der Funktionalität des Pagers (Batteriezustand,<br />
Empfangssymbol) zu überzeugen.<br />
93
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die zur Rufbereitschaft eingeteilten Bediensteten sind mittels Formblatt (Anhang) im Vorhinein bis<br />
spätestens zum 25. des Vormonats für das kommende Kalendermonat per E-Mail der<br />
Landeswarnzentrale Oö. (e-Mail: lwz@ooelfv.at)<br />
bekannt zu geben.<br />
Diese Einteilung der Rufbereitschaft hat jeweils Montags ab Beginn der Regeldienstzeit für die<br />
Dauer einer Woche zu erfolgen.<br />
Fällt ein Feiertag auf einen Montag, kann die Einteilung der bzw. des Rufbereiten auch am darauffolgenden<br />
Werktag erfolgen.<br />
Bei etwaigen Änderungsmeldungen ist das gesamte Formular per E-Mail als Austauschblatt zu<br />
übermitteln.<br />
Die Anfahrt der rufbereiten Bediensteten bzw. des rufbereiten Bediensteten zum Einsatzort erfolgt<br />
innerhalb der Dienstzeit mit dem Dienstkraftfahrzeug und außerhalb der Regeldienstzeit grundsätzlich<br />
mit dem eigenen PKW gegen Verrechnung des jeweils geltenden Kilometer-Geldes. In<br />
Ausnahmefällen besteht auch die Möglichkeit, dass die rufbereite Bedienstete bzw. der rufbereite<br />
Bedienstete mit einem Dienstkraftwagen der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft, mit dem<br />
Einsatzwagen des Landes-Feuerwehrkommandos oder – wenn sich hiezu eine besondere Notwendigkeit<br />
ergibt – auch mit dem Taxi fährt.<br />
94
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
RUFBEREITSCHAFTSEINTEILUNG<br />
Meldung<br />
Landeswarnzentrale OÖ<br />
Formular per E-Mail übermitteln.<br />
Petzoldstraße 43<br />
4020 Linz PräsD-Präs/I-1<br />
E-Mail: lwz@ooelfv.at<br />
Abteilung/Bezirkshauptmannschaft<br />
Bezeichnung der Abteilung/Bezirkshauptmannschaft<br />
Fachbereich<br />
Anschrift<br />
Mobiltelefon Rufbereitschaft<br />
Meldezeitraum<br />
Rufbereitschaft für den Monat<br />
Die Rufbereitschaft beginnt jeweils am Montag ab Beginn der Regeldienstzeit für die Dauer einer Woche.<br />
Personen<br />
KW Datum (von - bis) Name Private Erreichbarkeit<br />
Anmerkungen<br />
Rufnummerncode (Ric-Code)<br />
Ric-Code (7-stellig)<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
95
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 1 zu § 41 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Expertenkonferenzen der Bundesländer – Richtlinien 1<br />
Dem gesteigerten Informationsaustausch unter den Ländern, der Vorbereitung gemeinsamer Länderstellungnahmen<br />
sowie dem sonstigen Koordinieren von Ländermaßnahmen dienen in erster<br />
Linie schriftliche Länderumfragen über die Verbindungsstelle der Bundesländer; in zweiter Linie<br />
Länderexpertenkonferenzen.<br />
Länderexpertenkonferenzen müssen nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit<br />
und Zweckmäßigkeit ausgerichtet sein. Länderexpertenkonferenzen zum gleichen Fachbereich<br />
sollen nur einmal jährlich und nur eintägig – allenfalls an zwei aneinanderfolgenden Halbtagen –<br />
stattfinden. Ein Abweichen von dieser Grundregel ist ausdrücklich zu begründen.<br />
Es muss erwartet werden, dass Abteilungen bei Stellungnahmen zu Länderexpertenkonferenzen,<br />
die von anderen Bundesländern ausgerichtet sind, auf diesen Umstand hinweisen. Die Länderexpertenkonferenzen<br />
sind über die Verbindungsstelle abzuwickeln.<br />
Wird die Verbindungsstelle ersucht, eine Länderkonferenz in die Wege zu leiten, so ist zumindest<br />
a. Beratungsort,<br />
b. Beratungszeitraum,<br />
c. Beratungsgegenstand (aufgegliedert in Tagesordnungspunkte, versehen mit Sachverhaltsdarstellungen)<br />
und<br />
d. ein Land zur Vorsitzführung vorzuschlagen.<br />
Die bzw. der Vorsitzende in Länderexpertenkonferenzen soll das Beratungsergebnis je Tagesordnungspunkt<br />
möglichst in Empfehlungen zusammenfassen. Für Länderexpertenkonferenzen gilt<br />
das Einstimmigkeitsprinzip; divergierende Stellungnahmen können als Empfehlungsvarianten<br />
festgehalten werden. Das Konzept für das Empfehlungsprotokoll soll ehestens, spätestens binnen<br />
vier Wochen der Verbindungsstelle zur Vervielfältigung und Verteilung an alle Länder zugeleitet<br />
werden.<br />
In letzter Zeit haben Expertenkonferenzen wieder ein Ausmaß angenommen, das mit dem Gebot<br />
der Sparsamkeit nur mehr schwer in Einklang zu bringen ist. Dieser in allen Bundesländern festgestellte<br />
Umstand hat Anlass gegeben, die Landesamtsdirektoren- und Landeshauptmännerkonferenz<br />
damit zu befassen.<br />
Dieser Erlass setzt die bisherigen Richtlinien für Expertenkonferenzen hiemit außer Kraft und wird<br />
mit dem Ersuchen um strikte Beachtung zur Kenntnis gebracht.<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Amtsleitung die Notwendigkeit der Abhaltung, der<br />
Dauer, der Entsendungen udgl. von Expertenkonferenzen künftig strenger prüfen wird.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 5. Jänner 1995, PräsI-052127/26-Sch/K.<br />
97
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 2 zu § 41 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Richtlinien für die gemeinsamen Ländervertreterinnen<br />
bzw. Ländervertreter 1<br />
1. Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter werden bestellt, um rasch, einfach und<br />
wirtschaftlich die gemeinsamen Länderinteressen zu vertreten.<br />
2. Gemeinsame Ländervertreterin bzw. gemeinsamer Ländervertreter ist, wer durch Auftrag aller<br />
neun Länder im Voraus bestellt wurde, z.B. als Sachverständige bzw. Sachverständiger Auskunft<br />
in parlamentarischen Unterausschüssen zu geben oder die gemeinsamen Länderinteressen<br />
in einem österreichinternen oder internationalen Gremium zu vertreten.<br />
Als gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter können auch externe Sachverständige<br />
fallweise bestellt werden. Vor jedem Tätigwerden haben diese das Einvernehmen mit<br />
den Ländern im Wege der Verbindungsstelle herzustellen. Ist die Bestellung einer gemeinsamen<br />
Ländervertreterin bzw. eines gemeinsamen Ländervertreters sehr rasch erforderlich, dann<br />
kann dies mit Zustimmung der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden der Landesamtsdirektorenkonferenz<br />
durch die Leiterin bzw. den Leiter der Verbindungsstelle geschehen.<br />
3. Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter haben klarzustellen, dass sie als solche<br />
für alle Länder auftreten; dies gilt insbesondere für externe Sachverständige.<br />
4. Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter haben zweckdienliche Informationen<br />
und Unterlagen zu dem von ihnen bearbeiteten Sachgebiet ergänzend zu den offiziell übermittelten<br />
Unterlagen zu beschaffen, für eine unverzügliche Weitergabe an die Länder zu sorgen<br />
und nachhaltig und rechtzeitig die Standpunkte aller neun Länder zu akkordieren. Diese Akkordierung<br />
ist im Wege der Verbindungsstelle herzustellen, wobei zur Verbesserung des Informationsflusses<br />
auch vom jeweiligen Amt der Landesregierung genannte Kontaktpersonen um Unterstützung<br />
ersucht werden können. Dabei ist grundsätzlich die Einheit des Amtes der Landesregierung<br />
und im Falle von Angelegenheiten der europäischen Integration Art. 23d B VG und<br />
die Kooperationsvereinbarung, BGBl. 775/1992, zu beachten.<br />
Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter haben den akkordierten Standpunkt<br />
mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nachdrücklich gegenüber dem Bund und internationalen<br />
Institutionen, insbesondere der EU, zu vertreten. Richtschnur für die Akkordierung<br />
der Länderinteressen ist Lösungen zu suchen, die die Länder in die Lage versetzen, möglichst<br />
im eigenen Verantwortungsbereich zu entscheiden, soweit sich dies weder auf die Interessen<br />
der Republik Österreich noch auf die einzelnen Länder nachteilig auswirkt.<br />
5. Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter sind zunächst für die einmalige Vertretung<br />
der Länder bestellt. Bei länger dauernden Vertretungen hat die gemeinsame Ländervertreterin<br />
bzw. der gemeinsame Ländervertreter an sie bzw. ihn gerichtete Sitzungseinladungen der<br />
Verbindungsstelle und allfällige Kontaktpersonen bekannt zu geben, um die laufende Kooperation<br />
der Länder zu ermöglichen.<br />
6. Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter haben über ihre Vertretungstätigkeit<br />
selbst verfasste Berichte (Tagungsbehelfe genügen nicht) den Ländern im Wege der Verbindungsstelle<br />
ehestens vorzulegen.<br />
Gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter, die an Sitzungen der EU teilnehmen,<br />
legen innerhalb einer Arbeitswoche einen schriftlichen Bericht im Wege der Verbindungsstelle<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Beschluss der Landesamtsdirektorenkonferenz vom 23. März 2001.<br />
99
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
vor. Derartige Berichte umfassen nur die wesentlichen Verhandlungsergebnisse und zeigen vor<br />
allem länderrelevante Vorgänge auf.<br />
Sollten von derartigen Sitzungen verschiedene Berichte erstellt werden, insbesondere durch die<br />
Delegationsleitung oder die Ständige Vertretung, ist darauf in den Berichten der gemeinsamen<br />
Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter hinzuweisen. Gemeinsame Berichte sind anzustreben,<br />
sofern darin die Länderinteressen Berücksichtigung finden.<br />
7.<br />
a. Den Personalaufwand und den Sachaufwand, insbesondere Reisegebühren im Inland, für<br />
die Vertretung durch gemeinsame Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter, die Landesbedienstete<br />
sind, trägt ausschließlich jenes Land, dessen Personalstand die gemeinsame<br />
Ländervertreterin bzw. der gemeinsame Ländervertreter angehört.<br />
b. Reisegebühren von gemeinsamen Ländervertreterinnen bzw. Ländervertretern, die Landesbedienstete<br />
sind, werden bei Vertretungen im Ausland von allen Ländern (zur Hälfte<br />
nach Volkszahl, zur Hälfte linear) getragen.<br />
Dauert die Dienstreise länger als 2 Tage, dann wird den Reisegebühren ein pauschaliertes<br />
Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 10 % des Gebührenansatzes der Dienstklasse V,<br />
Gehaltsstufe 2, hinzugerechnet.<br />
c. Anträge auf Reisegebührenersatz von externen Sachverständigen werden, wenn der Bericht<br />
im Sinne des Punktes 6. vorliegt, von Niederösterreich nach den niederösterreichischen<br />
Reisegebührenvorschriften überprüft. Sie werden von allen Ländern nach lit. b) getragen.<br />
Für die Versteuerung und Versicherung sorgt der externe Sachverständige selbst.<br />
d. Reisegebühren für Ausbildungsveranstaltungen und Seminare können nicht als Kosten<br />
gemeinsamer Ländervertreterinnen bzw. Ländervertreter angesehen werden.<br />
8. Dienstreisen von gemeinsamen Ländervertreterinnen bzw. Ländervertretern außerhalb von<br />
Europa bedürfen jeweils der ausdrücklichen Zustimmung aller Länder.<br />
9. Die nach diesen Grundsätzen von den einzelnen Ländern bei der Verbindungsstelle geltend<br />
gemachten Reisegebühren sind von dieser mit der Jahresrechnung der Kosten der Verbindungsstelle<br />
abzurechnen, wenn ein Bericht im Sinne des Punktes 6. vorliegt.<br />
100
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 41 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Externe fachliche Fortbildungen 1 ; Tagungen etc.;<br />
Genehmigung<br />
Die Leiterin bzw. der Leiter einer Abteilungsgruppe bzw. die Leiterin bzw. der Leiter einer Abteilung,<br />
die nicht einer Abteilungsgruppe zugeordnet ist, bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann<br />
bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand ist ermächtigt, die Teilnahme von<br />
Bediensteten an externen fachlichen Schulungen und an sonstigen Veranstaltungen, Tagungen,<br />
Konferenzen, Workshops, Exkursionen, Messebesuchen, Studienreisen und dgl. zu genehmigen,<br />
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:<br />
1. die Teilnahmegebühr (Tagungsbeitrag, Seminarbeitrag ohne Reisegebühren usw.) für alle teilnehmenden<br />
Bediensteten der Abteilungsgruppe bzw. der Abteilungen, die keiner Abteilungsgruppe<br />
zugeordnet sind, bzw. der Bezirkshauptmannschaft bzw. der Agrarbezirksbehörde darf<br />
nicht mehr als 500,-- Euro (inkl. USt.) betragen,<br />
2. es nehmen nicht mehr als 2 Bedienstete, die der Abteilungsgruppe bzw. den Abteilungen, die<br />
keiner Abteilungsgruppe zugeordnet sind, bzw. der Bezirkshauptmannschaft bzw. der Agrarbezirksbehörde<br />
angehören, teil,<br />
3. das Kontingent der Abteilungsgruppe bzw. der Abteilungen, die keiner Abteilungsgruppe zugeordnet<br />
sind, bzw. der Bezirkshauptmannschaft bzw. der Agrarbezirksbehörde darf nicht überschritten<br />
werden,<br />
4. die Schulung/Veranstaltung findet im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen U-<br />
nion statt,<br />
5. es sind keine Flugreisen erforderlich und<br />
6. die Inhalte der externen fachlichen Schulung/Veranstaltung werden nicht durch interne Schulungsmaßnahmen<br />
oder Veranstaltungen abgedeckt.<br />
Wenn eine Voraussetzung der Z. 1 bis 6 nicht erfüllt ist, sowie für die Teilnahme der Abteilungsgruppenleiterin<br />
bzw. des Abteilungsgruppenleiters bzw. der Leiterin bzw. des Leiter einer Abteilung,<br />
die nicht einer Abteilungsgruppe zugeordnet ist, bzw. der Bezirkshauptfrau bzw. des Bezirkshauptmannes<br />
bzw. der Amtsvorständin bzw. des Amtsvorstandes selbst, bleibt die Genehmigungszuständigkeit<br />
bei der Abteilung Personal.<br />
Im Fall der Genehmigung durch die Abteilungsgruppenleiterin bzw. den Abteilungsgruppenleiter<br />
bzw. die Leiterin bzw. der Leiter einer Abteilung, die nicht einer Abteilungsgruppe zugeordnet ist,<br />
bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. den Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. den Amtsvorstand,<br />
übermittelt diese bzw. dieser bei externen fachlichen Fortbildungen das ausgefüllte<br />
Formblatt samt Beilagen (Rechnungen, Zahlscheine, Originalbelege) an die Abteilung Personal.<br />
Teilnahmebeiträge bis 70,-- Euro sind zunächst von den Bediensteten selbst zu bezahlen und<br />
werden dann rückerstattet. Die Abteilungsgruppenleiterinnen bzw. Abteilungsgruppenleiter bzw.<br />
die Leiterin bzw. der Leiter einer Abteilung, die nicht einer Abteilungsgruppe zugeordnet ist, bzw.<br />
die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand<br />
haben Aufzeichnungen über die verbrauchten Mittel zu führen.<br />
1<br />
Dieser Anhang gilt sinngemäß auch für Dienstreisen.<br />
101
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 42 Abs. 4 <strong>DBO</strong><br />
Auswärtige Dienstverrichtungen; Außendiensttagebuch<br />
In einzelnen Bereichen der Landesverwaltung werden derzeit schon sogenannte "Außendiensttagebücher"<br />
bei auswärtigen Dienstverrichtungen (außerhalb des Dienstortes) geführt. Die (laufend<br />
zu führenden) Außendiensttagebücher haben sich auch als geeignete Grundlage für das Erstellen<br />
der Reiserechnungen erwiesen, das oft erst Wochen nach der Dienstreise erfolgt. Mit Wirkung<br />
vom 1. März 1988 wird daher Folgendes angeordnet:<br />
1. Alle Bediensteten, die regelmäßig Außendienst 1 leisten, haben jede auswärtige Dienstverrichtung,<br />
für die Reisegebühren beansprucht werden können, in einem Außendiensttagebuch festzuhalten.<br />
Ausgenommen hievon sind Dienstreisen im Zusammenhang mit Veranstaltungen der<br />
Dienstausbildung und Fortbildung und im Zusammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten (insbesondere<br />
Verhandlungen), über die eine Niederschrift im Sinne des AVG oder sonstiger gesetzlicher<br />
Vorschriften abzufassen ist.<br />
2. Das Außendiensttagebuch ist in gebundener Form (seitennummeriert) so zu führen, dass keine<br />
Leerräume (Leerzeilen) entstehen. Jede auswärtige Dienstverrichtung ist fortlaufend im Außendiensttagebuch<br />
zu nummerieren; die jeweilige Nummer ist auch in der Reiserechnung (unter<br />
"Post-Nr.") anzuführen.<br />
3. Die Angaben im Außendiensttagebuch haben jedenfalls zu umfassen:<br />
a. Name der bzw. des Bediensteten und Bezeichnung der Organisationseinheit bzw. der<br />
Dienststelle,<br />
b. Datum der Dienstverrichtung,<br />
c. Beginn und Ende der jeweiligen auswärtigen Dienstverrichtung (genaue Zeitangabe) 2 ,<br />
d. Ort der auswärtigen Dienstverrichtung sowie<br />
e. stichwortartig die dienstliche Tätigkeit im Außendienst.<br />
4. Die Form der Außendiensttagebücher wird im Übrigen nicht vorgegeben; Außendiensttagebücher<br />
können auch (im Dienstweg) bei der Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management<br />
angefordert werden.<br />
5. Das Außendiensttagebuch ist laufend zu führen und dient als Grundlage für das Erstellen der<br />
Reiserechnungen, wobei durch dieses Außendiensttagebuch die Eintragungen in der Reiserechnung<br />
nicht ersetzt werden. Das laufende Führen des Außendiensttagebuches bedingt,<br />
dass es zur auswärtigen Dienstverrichtung mitgenommen wird. Das Außendiensttagebuch dient<br />
auch Kontrollzwecken im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht, die in diesem Zusammenhang<br />
nur aus besonderen Gründen angeordnet werden wird.<br />
6. Ausgeschriebene Außendiensttagebücher sind mindestens sechs Monate lang (gerechnet ab<br />
der letzten Eintragung) aufzubewahren.<br />
7. Jene Gruppen von Bediensteten, die schon vor dem 1. März 1988 Außendiensttagebücher zu<br />
führen hatten, haben die Außendiensttagebücher in der bisherigen Form weiterzuführen.<br />
1<br />
2<br />
Ein regelmäßiger Außendienst liegt dann vor, wenn (voraussichtlich) an mehr als 40 Tagen pro Kalenderjahr<br />
Außendienst geleistet wird.<br />
Werden zB. im Zuge eines Außendienstes mehrere Baustellen aufgesucht, so ist die Tätigkeit auf jeder<br />
Baustelle zeitlich (und inhaltlich / siehe lit. e) zu erfassen.<br />
103
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
8. Jene Bediensteten, die als Bauarbeiterin bzw. Bauarbeiter in den Außendienststellen der Direktion<br />
Straßenbau und Verkehr beschäftigt sind, sind vom Führen dieses Außendiensttagebuches<br />
entbunden. Sollte dies auch für andere Bedienstetengruppen sachlich gerechtfertigt sein, so ist<br />
der Abteilung Präsidium im Dienstweg ein entsprechender Antrag zu übermitteln.<br />
104
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 43 <strong>DBO</strong><br />
Richtlinien für den Ausgleich von Reisezeiten<br />
außerhalb der Amtsstunden durch Freizeit 1<br />
1. Für Reisezeit, um die sich eine Dienstreise über die Amtsstunden hinaus erstreckt, ist Freizeit<br />
im Ausmaß von 100 v.H. der Reisezeit zu gewähren.<br />
1.1 Diese Regelung gilt für Beamte und Vertragsbedienstete.<br />
2. Diese Regelung gilt für alle Tage der Woche gleich.<br />
3. Zeitausgleich wird nicht gewährt, wenn<br />
a. Anspruch auf eine Verwendungszulage gemäß § 30a Abs. 1 Z. 3 oder Abs. 2 Oö. Landes-<br />
Gehaltsgesetz oder eine Überstundenpauschale gebührt;<br />
b. eine Tätigkeit das Überschreiten der Amtsstunden verursacht, welche keine Dienstverrichtung<br />
darstellt; in diesem Fall ist jener Zeitraum als Reisezeit zu berücksichtigen, um den<br />
sich die Dienstreise über die Amtsstunden hinaus erstreckt hätte, wenn eine solche Tätigkeit<br />
nicht stattgefunden hätte;<br />
c. die Tätigkeit, wie insbesondere die Teilnahme an Empfängen und gesellschaftlichen Veranstaltungen,<br />
keinen Anspruch auf Überstundenvergütung begründet; oder<br />
d. die Reisezeit durch die Teilnahme an Tagungen, sonstigen Veranstaltungen oder an Veranstaltungen<br />
der dienstlichen Aus- und Fortbildung verursacht wird.<br />
4. Die abgeltungsfähigen Reisezeiten sind in den bestehenden Aufzeichnungen über die Gewährung<br />
von Zeitausgleich festzuhalten; darin ist auf den Beleg über die Dienstreise im Sinne des §<br />
42 <strong>DBO</strong> (Außendiensttagebuch, Fahrtenbuch, Aktenvermerk udgl.) zu verweisen.<br />
5. Diese Regelung ist mit 1. Jänner 1993 in Kraft getreten.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 23. November 1992, PersR-450003/46-1992/G.<br />
105
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 1 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Elektronische Datenverarbeitung in der Landesverwaltung;<br />
organisatorische Regelungen<br />
A. Grundsätzliche Angelegenheiten der EDV<br />
Die grundsätzlichen Angelegenheiten des Einsatzes und der Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitungen<br />
werden in der Abteilung Präsidium unter der Oberleitung der Landesamtsdirektorin<br />
bzw. des Landesamtsdirektors besorgt.<br />
B. Organisationsgrundsätze für die Abteilung Informationstechnologie<br />
I. Zur Durchführung der elektronischen Datenverarbeitung in der Landesverwaltung ist die Abteilung<br />
Informationstechnologie eingerichtet.<br />
II. Aufgaben:<br />
1. Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung bei der Aufgabenerledigung in den von der<br />
Amtsleitung bestimmten Aufgabenbereichen nach folgenden Bestimmungen:<br />
a. Während der Organisations- bzw. Voruntersuchung sowie während der gesamten Abwicklung<br />
eines EDV-Projektes haben die Abteilung Informationstechnologie und die jeweils<br />
fachlich zuständige Organisationseinheit zusammenzuarbeiten;<br />
b. Die Verantwortung dafür, dass die gemäß lit. a gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse den<br />
Erfordernissen des Sachgebietes gerecht werden, fällt in den Aufgabenbereich der fachlich<br />
zuständigen Organisationseinheit;<br />
c. Die Verantwortung für die auftragsgemäße Erstellung und Durchführung von EDV-<br />
Anwendungen fällt in den Aufgabenbereich der Abteilung Informationstechnologie; die<br />
Verantwortung für die Richtigkeit der Eingabedaten und die Beurteilung der Auswertungsergebnisse<br />
1 fällt in den Aufgabenbereich der fachlich zuständigen Organisationseinheit;<br />
d. Die fachlich zuständige Organisationseinheit hat Änderungen von Grundlagen (insbesondere<br />
Rechtsvorschriften), die Abänderungen von EDV-Anwendungen nach sich ziehen<br />
können, rechtzeitig wahrzunehmen und zu interpretieren; die auftragsgemäße Abänderung<br />
von EDV-Anwendungen obliegt der Abteilung Informationstechnologie.<br />
2. Erstellen von Leitlinien und Konzepten für den Einsatz von Informationstechnik in der Oö.<br />
Landesverwaltung; die Genehmigung dieser Leitlinien und Konzepte obliegt der Landesamtsdirektorin<br />
bzw. dem Landesamtsdirektor bzw. der Abteilung Präsidium.<br />
3. Auslösen von Initiativen zur Umstellung der Verwaltungstätigkeit auf elektronische Datenverarbeitung.<br />
2<br />
4. Erstellen, Erwerb 3 , Lizenznahme 3 und Adaptieren von Programmen sowie Dokumentation<br />
erstellter Programme.<br />
5. Mitwirkung 4 in den Angelegenheiten des Formularwesens, soweit es Durchführungen mit e-<br />
lektronischer Datenverarbeitung betrifft.<br />
6. Mitwirkung 4 beim Verfassen automationsgerechter Rechtsvorschriften. Um diese Aufgabe<br />
erfüllen zu können, ist die Abteilung Informationstechnologie von der fachlich zuständigen Or-<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Durch den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung werden gegebene Verantwortlichkeitsbereiche<br />
nicht verschoben. Das Maß für die Verantwortung und die Beurteilung der Auswertungsergebnisse<br />
richtet sich im Einzelnen nach den einschlägigen materiellen und verfahrensrechtlichen Vorschriften.<br />
Dies schließt nicht aus, dass auch von anderer Seite Initiativen gesetzt werden sollen.<br />
Siehe Anhang 2 zu § 51 Abs. 1.<br />
Die Mitwirkung an den Maßnahmen der fachlich zuständigen Organisationseinheiten schließt die Mitbeteiligung<br />
im Sinne des § 57 <strong>DBO</strong> ein; die Zuständigkeit der Abteilung Präsidium zur Oberleitung des<br />
EDV-Einsatzes im Landesbereich bleibt davon unberührt.<br />
107
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
ganisationseinheit im frühest möglichen Stadium über Entwürfe von Vorschriften (Gesetze,<br />
Verordnungen, Förderungsrichtlinien u.a.), die zu einem Einsatz von EDV oder zur Abänderung<br />
bestehender EDV-Anwendungen führen können, zu informieren.<br />
7. Herausgabe von Publikationen über den Einsatz der Abteilung Informationstechnologie.<br />
8. Fortlaufende Aus- bzw. Weiterbildung der Bediensteten der Abteilung Informationstechnologie<br />
durch interne Schulung und Kursbesuche 5 .<br />
9. Ausbildung von Bediensteten anderer Dienststellen für den EDV-Einsatz. Die Abteilungsleiterinnen<br />
und Abteilungsleiter sind jedoch verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur solche<br />
Bedienstete EDV-Anwender-Schulungen besuchen, die über ausreichende Basiskenntnisse<br />
(Umgang mit Personalcomputer, Tastatur und Maus) verfügen. Die Basiskenntnisse können<br />
entweder durch die EDV-Koordinatoren oder – nach Rücksprache mit der Abteilung Informationstechnologie<br />
– über Lisa vermittelt werden.<br />
10. Vertretung der Landesinteressen bei anderen Körperschaften (z.B. auf Bundesebene), soweit<br />
dies EDV-Angelegenheiten betrifft und sofern die Amtsleitung keine andere Regelung trifft.<br />
11. Mitwirkung 4 bei allen Geschäftsstücken anderer Organisationseinheiten, die sich auf Informationstechnik<br />
beziehen.<br />
In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass auch Sitzungsprotokolle über Angelegenheiten<br />
der Informationstechnik vor ihrer Aussendung der Abteilung Informationstechnologie zur<br />
Mitzeichnung zu geben sind, sofern in diesen Protokollen Aussagen über Informationstechnik<br />
festgehalten werden.<br />
Die Abteilung Informationstechnologie ist auch dann mitzubeteiligen 4 , wenn Organisationseinheiten<br />
Aufträge für die Untersuchung bzw. Veränderung der Aufbau- und Ablauforganisation<br />
an Dritte vergeben, sofern dabei Fragen des Einsatzes von Informationstechnik berührt sein<br />
könnten.<br />
Vor einer Anschaffung (Erwerb des Eigentums oder Gebrauchsrechts) von Hard- und Software<br />
ist – unabhängig aus welchen Haushaltsansätzen dies vorgesehen ist – die Abteilung Informationstechnologie<br />
zu befassen.<br />
12. Mitwirkung 4 beim Installieren und Benützen von Hard- und Software.<br />
13. Abschluss von Verträgen über Lizenzvergaben für erstellte Programme 4, 5 .<br />
III. Beim Einsatz elektronischer Datenverarbeitung hat die in den Handbüchern für EDV-Projekte in<br />
der oö. Landesverwaltung und im Anhang 2 zu § 51 festgelegte Zusammenarbeit zwischen der<br />
Abteilung Präsidium, der Abteilung Informationstechnologie und den fachlich zuständigen Organisationseinheiten<br />
besondere Bedeutung. Die Notwendigkeit ständiger gegenseitiger Information<br />
und Mitbeteiligung wird besonders unterstrichen.<br />
Wenn sich die Abteilung Informationstechnologie zur Erfüllung ihrer Aufgaben an eine andere<br />
Organisationseinheit wendet, hat diese die benötigten Auskünfte, vor allem für die Erstellung<br />
von Kosten-Nutzen-Analysen, zu geben.<br />
IV. Zur Durchführung der Aufgaben der Abteilung Informationstechnologie können Sonderarbeitskreise<br />
unter deren Leitung eingerichtet werden; in diesen sind Organisationseinheiten des Amtes<br />
je nach ihrem Aufgabenbereich vertreten. Die Einrichtung solcher Sonderarbeitskreise bedarf<br />
der Zustimmung der Abteilung Präsidium; der Abteilung Präsidium ist in regelmäßigen Abständen<br />
zu berichten.<br />
V. Schriftliche Erledigungen der Abteilung Informationstechnologie führen im Geschäftszeichen<br />
(Aktenzeichen "IT"). Im Übrigen gelten die innerdienstlichen Vorschriften.<br />
5<br />
Hierdurch werden jedoch einschlägige innerdienstliche Bestimmungen wie zB. über die Zuständigkeit<br />
der Abteilung Personal nicht berührt.<br />
108
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 2 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)<br />
A. Verfahren<br />
Für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) gelten folgende Regeln:<br />
1. Initiative:<br />
Die Initiative für den Einsatz von IKT geht primär von der betroffenen Organisationseinheit aus.<br />
Die Organisationseinheiten sind verpflichtet, sich mit der Abteilung Präsidium in Verbindung zu<br />
setzen, sobald sich absehen lässt, dass (aus welchen Gründen immer) eine Änderung oder Neukonzeption<br />
von Datenanwendungen der Organisationseinheit erforderlich werden könnte.<br />
Insbesondere bei bevorstehenden Gesetzesänderungen hat die betroffene Organisationseinheit<br />
mit der Abteilung Präsidium den Kontakt herzustellen, sobald sich Auswirkungen auf die IKT-<br />
Unterstützung von Arbeitsabläufen erkennen lassen.<br />
Der EDV-Koordinator der Organisationseinheit ist in alle diesbezüglichen Schritte einzubeziehen.<br />
Die Initiative für den Einsatz von IKT kann subsidiär auch von der Abteilung Informationstechnologie<br />
oder der Abteilung Präsidium ausgehen.<br />
2. Entscheidung über die weitere Vorgangsweise:<br />
Nach einer ersten Analyse trifft die Abteilung Präsidium die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise:<br />
Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von weiteren Analysen über die Durchführung eines EDV-<br />
Projekts bis hin zum unmittelbaren Ankauf von Hard- und Software, der Vergabe von EDV-<br />
Leistungen oder der Zustimmung zu Programmierleistungen durch die Abteilung Informationstechnologie.<br />
Soweit Ressourcen der Abteilung Informationstechnologie bei einem Vorhaben gebunden werden,<br />
entscheidet die Abteilung Präsidium gemeinsam mit der Abteilung Informationstechnologie über<br />
die Priorität der Bearbeitung durch die Abteilung Informationstechnologie.<br />
Soweit EDV-Projekte durchgeführt werden, sind diese nach den Handbüchern für EDV-Projekte in<br />
der oö. Landesverwaltung abzuwickeln. Es wird in aller Regel ein Lenkungsausschuss eingerichtet,<br />
dem neben Vertreterinnen bzw. Vertretern der betroffenen Organisationseinheit(en) auch<br />
Vertreterinnen bzw. Vertreter der Abteilung Informationstechnologie und der Abteilung Präsidium<br />
angehören. Falls ein Lenkungsausschuss eingerichtet wird, trifft dieser die wesentlichen weiteren<br />
Projektentscheidungen.<br />
3. Gemeinsame Realisierung der zu ändernden oder neuen Datenanwendung:<br />
In dieser Phase ist die intensive Zusammenarbeit zwischen der betroffenen Organisationseinheit<br />
und der Abteilung Informationstechnologie der entscheidende Erfolgsfaktor. Die Organisationseinheit<br />
hat die Richtigkeit der fachlichen Inhalte zu verantworten (einschließlich der erforderlichen<br />
Überlegungen, wie die Arbeitsabläufe zeitlich und qualitativ optimiert werden können). Die Abteilung<br />
Informationstechnologie verantwortet die möglichst zweckmäßige technische Unterstützung.<br />
Darüber hinaus berät die Abteilung Informationstechnologie die Organisationseinheit bezüglich der<br />
Optimierung von Arbeitsabläufen.<br />
109
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
4. Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen:<br />
Spätestens zu Beginn des Vollbetriebes einer Datenanwendung müssen von der Organisationseinheit<br />
die erforderlichen Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen (siehe den Anhang 5 zu<br />
§ 51) getroffen werden.<br />
Bei personenbezogenen Datenanwendungen ist eine Meldung an das Datenverarbeitungsregister<br />
(DVR) zu erstatten; unterliegt eine Datenanwendung der Vorabkontrolle im Sinn des Datenschutzgesetzes<br />
2000, so darf der Vollbetrieb der Datenanwendung erst nach Zustimmung der Datenschutzkommission<br />
aufgenommen werden. Die DVR-Meldung erfolgt durch die zuständige Organisationseinheit<br />
unter Mitbeteiligung ("zur Mitzeichnung") der Abteilung Präsidium. Die Abteilung<br />
Präsidium unterstützt die Organisationseinheit bei der Administration der DVR-Meldungen.<br />
Die Verantwortung für die Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen liegt bei der Organisationseinheit.<br />
5. Laufender Betrieb:<br />
Ab Inbetriebnahme einer Datenanwendung liegt die Verantwortung für diese Datenanwendung<br />
(insbesondere für die fachliche Richtigkeit) bei der Organisationseinheit. Die EDV-Koordinatorin<br />
bzw. der EDV-Koordinator der Organisationseinheit und die Abteilung Informationstechnologie<br />
verantworten im jeweiligen Zuständigkeitsbereich den technischen Betrieb der Datenanwendung.<br />
Änderungen von bestehenden Programmen sind von der Abteilung Präsidium zu genehmigen.<br />
Ausgenommen von dieser Genehmigungspflicht sind<br />
- Programmänderungen, die auf Grund gesetzlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind, und<br />
- Programmänderungen, die einen Programmieraufwand von zwei Personenmonaten voraussichtlich<br />
nicht übersteigen.<br />
Detaillierte Regelungen über die Abwicklung von EDV-Vorhaben enthalten die Handbücher für<br />
EDV-Projekte in der oö. Landesverwaltung. Weitere Regelungen enthalten Handbücher für bestimmte<br />
Bereiche der Datenverarbeitung wie z.B. das Handbuch für Internetanwender, das Corporate<br />
Design für die Internet-Präsentation, das Handbuch für GIS-Projekte in der oö. Landesverwaltung<br />
(Regelhandbuch DORIS), die Digitialisiervorschrift udgl. Diese Handbücher können – sofern<br />
sie nicht im Intranet publiziert sind – bei Bedarf in der Abteilung Informationstechnologie bzw. in<br />
den Organisationseinheiten, die die genannten Spezialbereiche betreuen (DORIS, DTP-Center<br />
etc.), angefordert werden.<br />
B. Umgang mit Programmen und Daten<br />
1. Allgemeine Regelungen:<br />
Sofern Organisationseinheiten selbst Programme erstellen wollen, haben sie vorher das Einvernehmen<br />
mit der Abteilung Informationstechnologie herzustellen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung<br />
sind lediglich Programmierungen mit Hilfe von Standard-Büroautomationswerkzeugen<br />
(z.B. Access).<br />
Vor dem Erwerb von Programmen bzw. der Vergabe von Programmierleistungen ist jedenfalls mit<br />
der Abteilung Informationstechnologie das Einvernehmen herzustellen (auch wenn die Programme<br />
unentgeltlich angeboten oder aus Budgetmitteln der Organisationseinheit bezahlt werden).<br />
Die Weitergabe von Programmen an Dritte ist nur mit Zustimmung der Abteilung Präsidium zulässig.<br />
110
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Zur Einsicht in von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendete Daten und Programme durch<br />
den Dienstgeber siehe auch die Punkte B) 2. bis 4. sowie die Vereinbarung vom 22. März 2004,<br />
PräsI-068003/97-2004-Heu/Win.<br />
2. Nicht lizenzierte Software:<br />
Auf EDV-Geräten des Landes Oberösterreich dürfen nur Programme eingesetzt werden, an denen<br />
das Land Oberösterreich ein Nutzungsrecht hat.<br />
Der Einsatz von sogenannten "Raubkopien" von Computerprogrammen ist sowohl auf dienstlichen<br />
als auch auf allenfalls für dienstliche Zwecke verwendeten privaten Computern ausdrücklich untersagt.<br />
Urheberrechtsverletzungen können für die Unternehmensleitung, aber auch für einzelne<br />
Bedienstete zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.<br />
Über Auftrag der Abteilung Präsidium prüft die Abteilung Informationstechnologie stichprobenartig,<br />
ob in den Organisationseinheiten nicht lizenzierte Software eingesetzt wird.<br />
Die Einsichtnahme in Daten und Programme ist dabei nur zulässig, wenn<br />
- der Auftrag durch die Abteilung Präsidium schriftlich angeordnet wurde,<br />
- die Personalvertretung zu Beginn der stichprobenartigen Prüfung verständigt wird,<br />
- der bzw. die Bedienstete über die Einsichtnahme informiert wird. Diese Information hat – sofern<br />
sie nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist – bei anwesenden Bediensteten spätestens<br />
zu Beginn der Einsichtnahme, bei abwesenden Bediensteten spätestens unmittelbar<br />
nach deren Rückkehr durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten zu erfolgen.<br />
Die Einsichtnahme ist entsprechend zu protokollieren (Datum, Name oder User-ID des bzw. der<br />
Bediensteten).<br />
3. Einsichtnahme in Daten und Programme:<br />
Für die Datenorganisation auf dem EDV-Arbeitsplatz gilt die grundsätzliche Regelung der <strong>DBO</strong>,<br />
nach der – ausgenommen die Fälle einer strengeren Regelung – Geschäftsstücke (hier: Daten<br />
bzw. EDV-Dokumente) so zu verwahren sind, dass sie zwar anderen Bediensteten auch in Abwesenheit<br />
des Verwahrers zugänglich sind, Unbefugten jedoch ein Zugriff verwehrt ist (§ 51).<br />
Eine Einsichtnahme in Daten und Programme, die Bedienstete verwenden, ist ohne deren Zustimmung<br />
nur dann zulässig, wenn<br />
- die Einsichtnahme im Rahmen der Dienstaufsicht von der Dienststellenleiterin bzw. vom<br />
Dienststellenleiter (bzw. im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht) schriftlich angeordnet<br />
wird und<br />
- gleichzeitig die Personalvertretung von dieser Anordnung verständigt wird und<br />
- wenn die bzw. der Bedienstete über die Einsichtnahme informiert wird. Diese Information hat –<br />
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist – bei anwesenden Bediensteten<br />
spätestens zu Beginn der Einsichtnahme, bei abwesenden Bediensteten spätestens unmittelbar<br />
nach deren Rückkehr durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten zu erfolgen.<br />
Diese Einsichtnahme ist entsprechend zu protokollieren (Datum, Name oder User-ID der bzw. des<br />
Bediensteten, Begründung der Einsichtnahme). Der bzw. dem Bediensteten ist eine Ausfertigung<br />
des Protokolls zu übergeben.<br />
4. Internet-Nutzung, Kontrollmaßnahmen:<br />
Die Abteilung Präsidium beauftragt in monatlichen Abständen bei der Abteilung Informationstechnologie<br />
eine Auswertung, welche Internet-Server von der Gesamtheit der Landesbediensteten am<br />
111
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
häufigsten angewählt werden. Diese Auswertung ist anonym; sie gibt über das grundsätzliche Internet-Verhalten<br />
der oö. Landesbediensteten Aufschluss.<br />
Den Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern wird in regelmäßigen Abständen von der Abteilung<br />
Informationstechnologie eine Auswertung zur Verfügung gestellt, welche Internet-Server in<br />
der Gesamtheit der Bediensteten der Dienststelle am häufigsten angewählt wurden ("Hitliste").<br />
Diese Auswertung ist anonym.<br />
Die Abteilung Präsidium überprüft gemeinsam mit dem Landespersonalausschuss in unregelmäßigen<br />
Abständen, welche Internet-Server von einem EDV-Arbeitsplatz (= IP-Adresse) aus angewählt<br />
wurden. Diese Auswertung ist auf einen konkreten EDV-Arbeitsplatz bezogen.<br />
Eine solche Überprüfung findet sowohl über begründetes Ersuchen einer Dienststellenleiterin bzw.<br />
eines Dienststellenleiters als auch – auf begründetem Verdacht – von Amts wegen im Rahmen der<br />
übergeordneten Dienstaufsicht statt.<br />
Die Überprüfung ist nur dann zulässig, wenn je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Abteilung<br />
Präsidium und des Landespersonalausschusses gleichzeitig anwesend ist.<br />
Die Überprüfungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten; dieses Überprüfungsprotokoll ist von der<br />
Vertreterin bzw. vom Vertreter der Abteilung Präsidium und von der Vertreterin bzw. vom Vertreter<br />
des Landespersonalausschusses zu unterzeichnen.<br />
Auch im Rahmen der erlaubten Verwendung von dienstlichen Geräten für die private Internet-<br />
Nutzung außerhalb der Dienstzeit ist das Betrachten von verfänglichen Inhalten (Pornografie, politischer<br />
Extremismus, Gewalt etc.) jedenfalls verboten und unterliegt den gleichen Kontrollmechanismen<br />
wie die Internet-Nutzung während der Dienstzeit.<br />
112
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 3 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Dienstvergütung für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren,<br />
IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren und IT-Leitanwenderinnen<br />
bzw. IT-Leitanwender; Neuregelung aber 1. Jänner 2006 1<br />
Die Dienstvergütung für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren, IT-Leitkoordinatorinnen bzw.<br />
IT-Leitkoordinatoren und IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwendern wurde mit Erlass vom<br />
18. Februar 2000, PersR-111008/119-1999-Vo/Pe, sowie mit dem Durchführungserlass vom<br />
22. Mai 2000, PersR-111008/130-2000-Ka, geregelt. Beide Erlässe waren bis 31. Dezember 2005<br />
befristet.<br />
Das Land Oberösterreich anerkennt die Notwendigkeit, IT-Koordinatorinnen bzw. IT-<br />
Koordinatoren, IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren und IT-Leitanwenderinnen bzw.<br />
IT-Leitanwender auch nach dem 31. Dezember 2005 eine Dienstvergütung – auch unter Berücksichtigung<br />
der "Besoldung Neu" – für ihre besonders anspruchsvollen Dienste zu gewähren.<br />
Diese Regelung ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht mehr befristet. Die geänderten<br />
Rahmenbedingungen der letzten Jahre im Informationstechnologie-Bereich (IT) des Landes<br />
Oberösterreich und die Erfahrungen bei der Handhabung der bisherigen Regelungen in diesem<br />
Bereich sollen jedoch Berücksichtigung finden. Dazu erfolgt eine permanente Leistungsüberprüfung<br />
durch die Abteilung Informationstechnologie.<br />
Aus diesem Anlass werden alle IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren, IT-Leitanwenderinnen<br />
bzw. IT-Leitanwender und IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren neu durchgerechnet.<br />
Die in diesem Erlass genannten neuen informationstechnologischen Begriffe (IT-Koordination, IT-<br />
Leitanwendung, Ist-IT, Soll-ITA, Profil) werden im Anhang erläutert.<br />
Dieser Erlass gilt NICHT für den Bereich der Oö. Gesundheits- und Spitals-AG.<br />
1. Anträge:<br />
Diese sind im Dienstweg über die Abteilung Informationstechnologie an die Abteilung Personal zu<br />
richten.<br />
Die Abteilung Informationstechnologie prüft, ob die von den Dienststellen gemeldeten Mitarbeiterinnen<br />
bzw. Mitarbeiter tatsächlich IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren oder IT-<br />
Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender oder IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren<br />
sind, beurteilt mittels Profilen und Soll-ITAs deren Tätigkeit quantitativ und qualitativ und leitet den<br />
Antrag mit der Stellungnahme an die Abteilung Personal weiter.<br />
Die Abteilung Personal berechnet die Höhe der Dienstvergütung und weist sie an.<br />
Ansprechpartner sind in der Abteilung Informationstechnologie die zuständigen Kundenbetreuerinnen<br />
bzw. Kundenbetreuer, in der Abteilung Personal die zentrale Bearbeiterin bzw. der zentrale<br />
Bearbeiter.<br />
2. Grundlagen der Tätigkeits- und Leistungsbeurteilung<br />
bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren:<br />
• Anzahl ITAs (= Ist-ITAs = informationstechnologische Arbeitsplätze; siehe Anhang)<br />
• Höhe der Soll-ITAs (siehe Anhang)<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass PersR-111008/174-2005-Ka vom 18. November 2005.<br />
113
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Erfüllung der vorgegebenen Profile (siehe Anhang)<br />
• ev. Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Personen und in welchem Ausmaß<br />
• Zu- und Abschläge je nach Beurteilung (Pkt. 13)<br />
3. Grundlagen der Tätigkeits- und Leistungsbeurteilung bei<br />
IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwendern:<br />
a) Applikation MIT Projektstruktur:<br />
• Projektleiterin bzw. Projektleiter und die Abteilung Informationstechnologie klären gemeinsam<br />
die Notwendigkeit einer Leitanwendung und schlagen sodann ein Ausmaß als Höchstrahmen<br />
vor<br />
• Kenntnisnahme und Zustimmung durch den zuständigen Lenkungsausschuss und die Abteilung<br />
Präsidium<br />
• Zustimmung durch die Abteilung Personal, die die Höhe der Dienstvergütung festsetzt<br />
• prozentueller Anteil oder Stundenanteil des durchschnittlichen Arbeitsaufwandes für diese<br />
Tätigkeit pro Woche<br />
• ev. Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Personen und in welchem Ausmaß<br />
• Zu- und Abschläge je nach Beurteilung (Pkt. 13)<br />
b) Applikation OHNE Projektstruktur:<br />
• verantwortliche Abteilungsleiterin bzw. verantwortlicher Abteilungsleiter und die Abteilung Informationstechnologie<br />
klären im Einvernehmen mit der Abteilung Präsidium gemeinsam die<br />
Notwendigkeit einer Leitanwendung und schlagen sodann ein Ausmaß als Höchstrahmen<br />
vor<br />
• Zustimmung durch die Abteilung Personal, die die Höhe der Dienstvergütung festsetzt<br />
• prozentueller Anteil oder Stundenanteil des durchschnittlichen Arbeitsaufwandes für diese<br />
Tätigkeit pro Woche<br />
• ev. Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Personen und in welchem Ausmaß<br />
• Zu- und Abschläge je nach Beurteilung (Pkt. 13)<br />
4. Grundlagen der Tätigkeits- und Leistungsbeurteilung<br />
bei IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren:<br />
• prozentueller Anteil oder Stundenanteil des durchschnittlichen Arbeitsaufwandes für diese Tätigkeit<br />
pro Woche<br />
• ev. Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Personen und in welchem Ausmaß<br />
• Zu- und Abschläge je nach Beurteilung (Pkt. 13)<br />
5. Härteausgleich:<br />
(gilt nur bei gleichbleibenden Voraussetzungen):<br />
Da es durch die Neuregelung auch zu einer Verringerung der bisherigen Dienstvergütung kommen<br />
kann, ist es erforderlich, für Betroffene einen Härteausgleich vorzusehen.<br />
a) Für Personen, die nach der "Besoldung alt" entlohnt werden:<br />
Die Dienstvergütung wird auf der Basis des neuen Erlasses berechnet. Sollte sich dabei ein geringerer<br />
Betrag ergeben gilt Folgendes:<br />
• IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren/IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender/IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner 2006 länger als 5 Jahre<br />
diesen Dienst verrichten, erhalten jene Dienstvergütung, die zum Dezember 2005 gewährt<br />
wurde, mit dem gleichen Betrag (also ohne weitere Valorisierung) weiterhin, solange die Tätigkeit<br />
unverändert ausgeübt wird.<br />
114
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren/IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender /<br />
IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner 2006 weniger als 5<br />
Jahre, aber länger als 1 Jahr diesen Dienst verrichten, wird eine Deckelung der Verschlechterung<br />
vorgesehen.<br />
Diese beträgt (abhängig von der Grundeinstufung):<br />
Einstufung maximale Verschlechterung<br />
d/D oder <strong>VB</strong> II 1% von V/2<br />
c/C 2% von V/2<br />
b/B 3% von V/2<br />
a/A 4% von V/2<br />
Der sich aus der Deckelung ergebende Restbetrag wird für die Dauer der Verwendung als<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender /<br />
IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren in der jeweiligen Dienststelle ohne jährliche<br />
Valorisierung (also starr) weiterbezahlt.<br />
• bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender<br />
/ IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner 2006 weniger als<br />
1 Jahr diesen Dienst verrichten, wird die Dienstvergütung neu berechnet.<br />
b) Für Personen, die nach der "Besoldung neu" entlohnt werden:<br />
Die Dienstvergütung wird auf der Basis des neuen Erlasses berechnet. Sollte sich dabei ein geringerer<br />
Betrag ergeben, gilt Folgendes:<br />
• IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender /<br />
IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner 2006 länger als 5 Jahre<br />
diesen Dienst verrichten, erhalten jene Dienstvergütung, die zum Dezember 2005 gewährt<br />
wurde mit dem gleichen Betrag (also ohne weitere Valorisierung) weiterhin, solange<br />
die Tätigkeit unverändert ausgeübt wird.<br />
• bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren /I T-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender<br />
/ IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner 2006 weniger als 5<br />
Jahre, aber länger als 1 Jahr diesen Dienst verrichten, wird eine Deckelung der Verschlechterung<br />
vorgesehen.<br />
Diese beträgt (abhängig von der Grundeinstufung):<br />
Einstufung maximale Verschlechterung<br />
LD 25 bis 20 1% von V/2<br />
LD 19 bis 16 2% von V/2<br />
LD 15 bis 12 3% von V/2<br />
ab LD 11 4% von V/2<br />
Im neuen Besoldungssystem ist der mit V/2 identische Betrag nach § 32 Abs.3 Z.2 GG 2001<br />
als Basis zu verstehen.<br />
Der sich aus der Deckelung ergebende Restbetrag wird für die Dauer der Verwendung als<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender /<br />
IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren in der jeweiligen Dienststelle ohne jährliche<br />
Valorisierung (also starr) weiterbezahlt.<br />
• bei EDV-Koordinatorinnen bzw. EDV-Koordinatoren / EDV-Leitanwenderinnen bzw. EDV-<br />
Leitanwendern / EDV-Leitkoordinatorinnen bzw. EDV-Leitkoordinatoren, die am 1. Jänner<br />
2006 weniger als 1 Jahr diesen Dienst verrichten, wird die Dienstvergütung neu berechnet.<br />
Ab 1.1.2006 bestellte IT-Koordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender / IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren und Änderungen bei den Voraussetzungen ab diesem<br />
Zeitpunkt unterliegen nicht dem Härteausgleich und werden nach den Richtlinien des neuen<br />
Erlasses berechnet und entlohnt.<br />
115
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
6. Anfall/Neuberechnung der Dienstvergütung:<br />
Ab 2006 werden aus verwaltungsökonomischen Gründen alle Änderungen bei Anfall, Wegfall oder<br />
Änderung der Höhe der Dienstvergütung nur mehr mit Beginn eines Kalenderjahres, frühestens<br />
jedoch nach einem Beobachtungszeitraum eines halben Jahres, durchgeführt. Zum gleichen Zeitpunkt<br />
erfolgt ev. auch eine dynamische Anpassung der ITAs.<br />
Ausnahmen bilden Beginn oder Ende einer Koordinatoren- oder Leitanwendertätigkeit bzw. Organisationsänderungen<br />
(dabei ist der nächstfolgende Monatserste maßgebend).<br />
7. IT-Projektarbeiten:<br />
Arbeiten im Rahmen von IT-Projekten mit Personen, die keine anerkannten IT-Koordinatorinnen<br />
bzw. IT-Koordinatoren/IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender sind, werden in Hinkunft nicht<br />
mehr über Dienstvergütungen des IT-Bereichs entlohnt. In solchen Fällen können Belohnungen für<br />
Projektarbeiten beantragt werden.<br />
8. Stellvertreterin bzw. Stellvertreter:<br />
Für zeitlich begrenzt tätige Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter von IT-Koordinatorinnen bzw. IT-<br />
Koordinatoren / IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-<br />
Leitanwender (z.B. während eines Urlaubs oder Krankenstandes) ist eine Dienstvergütung grundsätzlich<br />
nicht vorgesehen.<br />
9. Sockelbetrag:<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren /<br />
IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender erhalten einen Sockelbetrag von 2,0 % der Dienstklasse<br />
V der Gehaltsstufe 2 eines Beamten der allgemeinen Verwaltung als Dienstvergütung bei<br />
Vorliegen folgender Voraussetzungen:<br />
• bei Erreichen von 8 Wochenstunden der ITAs für 1 IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren /<br />
IT-Leitkoodinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren,<br />
mindestens 8 Wochenstunden der Wochenarbeitszeit für 1 IT-Leitanwenderin bzw. IT-<br />
Leitanwender,<br />
• bei Erreichen von 20 Wochenstunden der ITAs für 2 EDV-Koordinatorinnen bzw. EDV-<br />
Koordinatoren / EDV-Leitkoordinatorinnen bzw. EDV-Leitkoordinatoren<br />
mindestens 20 Wochenstunden der Wochenarbeitszeit für 2 IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-<br />
Leitanwender,<br />
• bei Erreichen von 40 Wochenstunden der ITAs für 3 EDV-Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren<br />
/ EDV-Leitkoordinatorinnen bzw. Leitkoordinatoren<br />
40 Wochenstunden der Wochenarbeitszeit für 3 IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwendern.<br />
• Der Sockelbetrag unterliegt keinen Kürzungen!<br />
10. Zusammenfallen mehrerer Dienstvergütungen im IT-Bereich:<br />
Übt eine Person gleichzeitig zwei oder mehrere IT-Tätigkeiten aus, werden die anfallenden finanziellen<br />
Besserstellungen getrennt berechnet und dann addiert. Die Summe für alle Vergütungen<br />
zusammen darf jedoch die Gesamthöchstgrenze von 18,0 % (maximal 22,5 % mit Zuschlägen)<br />
nicht übersteigen.<br />
116
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
11. Richtlinien für Bedienstete, für die die Bestimmungen des Oö. Gehaltsgesetzes gelten:<br />
(Besoldung "ALT")<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren/IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-<br />
Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender in allen Landesdienststellen (ohne GESPAG-Bereich)<br />
erhalten zur Abgeltung ihrer besonders anspruchsvollen Dienste unter erschwerten Umständen<br />
eine Dienstvergütung gemäß § 20e Abs.1, Z.1 Oö. Landes-Gehaltsgesetz in der geltenden Fassung.<br />
Der Rahmen dieser Dienstvergütung ist zwischen 2,0 % und 18,0 % (höchstens bis 22,5 % bei<br />
größtmöglichem Zuschlag) von V/2 festgelegt. Die individuelle Höhe der Dienstvergütung richtet<br />
sich nach den unten angeführten Berechnungsformeln und den unter Pkt. 13 geregelten Zu- bzw.<br />
Abschlägen.<br />
a) Berechnungsformel für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren:<br />
Die Anzahl der Ist-ITAs dividiert durch die festgelegten Soll-ITAs mal 18 ergibt die Obergrenze<br />
der Summe der Dienstvergütungen für eine Organisationseinheit, die sodann auf eine oder<br />
mehrere Personen aufgeteilt wird.<br />
b) Berechnungsformel für IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren:<br />
Aus dem prozentuellen / stundenmäßigen Anteil dieser Tätigkeit an der gesamten Wochenarbeitszeit<br />
errechnet sich die Höhe der Dienstvergütung für die betroffene Person.<br />
c) Berechnungsformel für IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender:<br />
Grundlage ist die Vorgabe eines maximalen Rahmens (vorgeschlagen durch den Lenkungsausschuss<br />
für die betroffene Applikation oder durch die verantwortliche Abteilungsleiterin bzw.<br />
den verantwortlichen Abteilungsleiter im Einvernehmen mit der Abteilung Informationstechnologie,<br />
der Abteilung Präsidium und der Abteilung Personal), sodann ergibt der prozentuelle /<br />
stundenmäßige Anteil der Tätigkeit an der Gesamt-Wochenarbeitszeit einer vollbeschäftigten<br />
Person die Höhe der Dienstvergütung.<br />
d) Kürzungen:<br />
Eine Kürzung der Dienstvergütung erfolgt grundsätzlich, wenn eine Arbeitsaufteilung zwischen<br />
zwei oder mehreren Personen vorliegt, diese Person einen bewerteten Posten besetzt oder bereits<br />
eine Verwendungszulage, Gehaltszulage oder Dienstvergütung (z.B. Baudienstzulage)<br />
bezieht, wobei auch mehrere Kürzungspunkte zusammentreffen können und dann zusammengerechnet<br />
werden (Prozentpunkte jeweils von V/2):<br />
• bei mit A-VIII bewerteten Dienstposten: - 5,0 %<br />
• bei mit B-VII bewerteten Dienstposten: - 3,0 %<br />
• bei N1-Zulagen in A-Verwendung: - 5,0 %<br />
• bei N1-Zulagen in B-Verwendung: - 3,0 %<br />
• bei Verwendungszulagen, Gehaltszulagen oder Dienstvergütungen (ev. kumuliert)<br />
- ab 10 % von V/2: - 1,0 %<br />
- ab 16 % von V/2: - 2,0 %<br />
- ab 24 % von V/2: - 3,0 %<br />
- ab 32 % von V/2: - 4,0 %<br />
- ab 40 % von V/2: - 5,0 %<br />
e) Qualitätszu-/-abschläge sind immer erst nach vollständiger Durchrechnung der Dienstvergütung<br />
(lit. a - d) zu berücksichtigen.<br />
f) Die ev. Teilbeschäftigung einer IT-Koordinatorin bzw. eines IT-Koordinators / einer IT-<br />
Leitkoordinatorin bzw. eines IT-Leitkoordinators / einer IT-Leitanwenderin bzw. eines IT-<br />
Leitanwenders findet nur in einer Aliquotierung der Höchstbemessung der Dienstvergütung ihren<br />
Niederschlag.<br />
117
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
g) Dienstpostenbewertungen (C-V):<br />
Die bisher möglichen Dienstpostenbewertungen für in C eingestufte IT-Koordinatorinnen bzw.<br />
IT-Koordinatoren / IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-Leitanwenderinnen<br />
bzw. IT-Leitanwendern auf CN2V haben sich als wenig zielführend erwiesen und werden ab<br />
1.1.2006 nicht mehr durchgeführt. Für Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppen d, e und<br />
p1 - p5 ist jedoch die Zuerkennung einer Zulage auf die jeweiligen Bezugsansätze der Entlohnungsgruppe<br />
c für die Dauer der überwiegenden Tätigkeit im IT-Bereich möglich. Ansuchen<br />
sind gesondert im Wege der Abteilung Informationstechnologie an die Abteilung Personal zu<br />
richten.<br />
h) Zu- und Abschläge:<br />
Zur Berücksichtigung der Leistungsqualität der IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwendern<br />
ist bei ausgezeichneter oder unterdurchschnittlicher Arbeitsleistung ein Zu- bzw. Abschlag von<br />
der errechneten Dienstvergütung vorgesehen, und zwar für eine ausgezeichnete Leistung ein<br />
25%iger Zuschlag, für eine unterdurchschnittliche Leistung ein 50%iger Abschlag.<br />
Die ausgezeichnete bzw. unterdurchschnittliche Arbeitsleistung ist besonders zu begründen<br />
sowie von der Abteilung Informationstechnologie und von der Dienststellenleiterin bzw. vom<br />
Dienststellenleiter zu überprüfen und zu bestätigen. Bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-<br />
Koordinatoren werden die im Anhang detailliert umschriebenen Profile zur Beurteilung herangezogen.<br />
Die bewertete Arbeitsleistung muss nicht mit der Dienstbeurteilung der betroffenen Person i-<br />
dent sein und ist in regelmäßigen Abständen von der Abteilung Informationstechnologie zu ü-<br />
berprüfen.<br />
12. Richtlinien für Bedienstete, für die die Bestimmungen<br />
des Oö. Gehaltsgesetzes 2001 gelten:<br />
(Besoldung "NEU")<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren /<br />
IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender in allen Landesdienststellen (ohne gespag-Bereich)<br />
erhalten zur Abgeltung ihrer besonders anspruchsvollen Dienste unter erschwerten Umständen<br />
eine Dienstvergütung gemäß § 38 Abs.1 Z.1 Gehaltsgesetz 2001 in der für Landesbeamtinnen<br />
bzw. Landesbeamte geltenden Fassung.<br />
Der Rahmen dieser Dienstvergütung ist zwischen 2,0 % und 18,0 % (höchstens bis 22,5 % bei<br />
größtmöglichem Zuschlag) von V/2 festgelegt. Die individuelle Höhe der Dienstvergütung richtet<br />
sich nach den unten angeführten Berechnungsformeln und den später näher beschriebenen Zubzw.<br />
Abschlägen.<br />
a) Berechnungsformel für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren:<br />
Die Anzahl der Ist-ITAs dividiert durch den festgelegten Soll-ITA mal 18 ergibt die Obergrenze<br />
der Summe der Dienstvergütungen für eine Organisationseinheit, die sodann auf eine oder<br />
mehrere Personen aufgeteilt wird.<br />
b) Berechnungsformel für IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren:<br />
Aus dem prozentuellen / stundenmäßigen Anteil dieser Tätigkeit an der gesamten Wochenarbeitszeit<br />
errechnet sich die Höhe der Dienstvergütung für die betroffene Person.<br />
c) Berechnungsformel für IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender:<br />
Grundlage ist die Vorgabe eines maximalen Rahmens (vorgeschlagen durch den Lenkungsausschuss<br />
für die betroffenen Applikationen im Einvernehmen mit der Abteilung Informationstechnologie,<br />
der Abteilung Präsidium und der Abteilung Personal), sodann ergibt der prozentuelle<br />
/ stundenmäßige Anteil der Tätigkeit an der Gesamt-Wochenarbeitszeit einer vollbeschäftigten<br />
Person die Höhe der Dienstvergütung.<br />
118
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
d) Kürzungen:<br />
Eine Kürzung der Dienstvergütung erfolgt grundsätzlich, wenn eine Arbeitsaufteilung zwischen<br />
zwei oder mehreren Personen vorliegt oder bereits eine Gehaltszulage (prozentuelle Aufzahlung<br />
auf die nächste gehaltsmäßig höhere LD) oder eine andere Dienstvergütung (z.B. Erschwernisabgeltung)<br />
bezogen wird, wobei auch mehrere Kürzungspunkte zusammentreffen<br />
können und dann zusammengerechnet werden (Prozentpunkte jeweils von V/2).<br />
• Bei Gehaltszulagen, die eine Aufzahlung auf die nächste nummerisch niedrigere LD darstellen,<br />
ist wie folgt zu kürzen:<br />
bis einschließlich 50 % um 1,0 % von V/2 und<br />
zwischen 51 % und 100 % um 2,0 % von V/2.<br />
• Bei anderen Dienstvergütungen ist wie folgt zu kürzen (ev. kumuliert):<br />
- ab 10 % von V/2: - 1,0 %<br />
- ab 16 % von V/2: - 2,0 %<br />
- ab 24 % von V/2: - 3,0 %<br />
- ab 32 % von V/2: - 4,0 %<br />
- ab 40 % von V/2: - 5,0 %<br />
• Die zu gewährende Dienstvergütung für IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-<br />
Leitanwendern beträgt maximal 18,0 % von V/2 des alten Entlohnungsschemas bei einer<br />
Einreihung in LD 18 und gehaltsmäßig höher,<br />
in der LD 17 beträgt sie maximal 16,0 %,<br />
in der LD 16 beträgt sie maximal 14,0 %,<br />
in der LD 15 beträgt sie maximal 12,0 %,<br />
in der LD 14 beträgt sie maximal 10,0 %,<br />
in der LD 13 beträgt sie maximal 8,0 %,<br />
in der LD 12 beträgt sie maximal 6,0 %,<br />
in der LD 11 beträgt sie maximal 4,0 %,<br />
in der LD 10 beträgt sie maximal 2,0 % und<br />
ab der LD 9 und niedriger wird keine Dienstvergütung mehr ausbezahlt.<br />
e) Qualitätszu-/-abschläge sind immer erst nach vollständiger Durchrechnung der Dienstvergütung<br />
(lit. a - d) zu berücksichtigen.<br />
f) Die ev. Teilbeschäftigung von IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-<br />
Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren / IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwendern<br />
findet nur in einer Aliquotierung der Höchstbemessung der Dienstvergütung ihren Niederschlag.<br />
g) grundsätzliche Einreihung:<br />
IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren / IT-Leitkoordinatorinnen bzw. IT-Leitkoordinatoren /<br />
IT-Leitanwenderinnen bzw. IT-Leitanwender bleiben grundsätzlich in ihrer Stammverwendung<br />
eingereiht. Für die Dauer einer überwiegenden IT-Tätigkeit ist aber eine Mindesteinstufung in<br />
der LD 18 vorgesehen:<br />
Dafür ist aber ein gesondertes und begründetes Ansuchen im Wege der Abteilung Informationstechnologie<br />
an die Abteilung Personal erforderlich. Die höhere Einreihung gilt nur für die<br />
Dauer dieser besonderen Verwendung.<br />
h) Zuschläge/Abschläge:<br />
Zur Berücksichtigung der Leistungsqualität der IT-Koordinatorin bzw. des IT-Koordinators / der<br />
IT-Leitkoordinatorin bzw. des IT-Leitkoordinators / der IT-Leitanwenderin bzw. des IT-<br />
Leitanwenders ist bei ausgezeichneter oder unterdurchschnittlicher Arbeitsleistung ein Zu- bzw.<br />
Abschlag von der errechneten Dienstvergütung vorgesehen, und zwar für eine ausgezeichnete<br />
Leistung ein 25%iger Zuschlag, für eine unter-durchschnittliche Leistung ein 50%iger Abschlag.<br />
Die ausgezeichnete bzw. unterdurchschnittliche Arbeitsleistung ist besonders zu begründen<br />
sowie von der Abteilung Informationstechnologie und von der Dienststellenleiterin bzw. vom<br />
Dienststellenleiter zu überprüfen und zu bestätigen. Bei IT-Koordinatorinnen bzw. IT-<br />
119
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Koordinatoren werden die im Anhang detailliert umschriebenen Profile zur Beurteilung herangezogen.<br />
Die bewertete Arbeitsleistung muss nicht mit der Dienstbeurteilung der betroffenen Person i-<br />
dent sein und ist in regelmäßigen Abständen von der Abteilung Informationstechnologie zu ü-<br />
berprüfen.<br />
120
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 4 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Richtlinien für den Einsatz von Einrichtungen<br />
der Informations- und Kommunikationstechnologie<br />
Informationen und die sie unterstützenden Prozesse, Systeme und Netzwerke sind wichtige Unternehmenswerte.<br />
Ihre Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit tragen wesentlich zum Erfolg<br />
und zur Qualität unserer Leistungen für unsere Kundinnen und Kunden, zur Einhaltung der gesetzlichen<br />
Vorschriften und zum Ansehen des Landes Oberösterreich bei.<br />
Informationssysteme und -netzwerke sehen sich Sicherheitsbedrohungen unterschiedlichster Herkunft<br />
gegenüber. Das kann Computerbetrug, Spionage oder Sabotage sein, aber auch Feuer, Ü-<br />
berschwemmungen oder Stromausfall. Gefahrenquellen wie Computerviren oder Hackerattacken<br />
werden immer verbreiteter und raffinierter. Einen großen Anteil an der Bedrohung haben aber<br />
auch unabsichtliche oder absichtliche Fehlbehandlungen der Benutzerinnen und Benutzer.<br />
Sicherheit ist dabei ein kritisches und wesentliches Element der Unternehmensphilosophie des<br />
Landes Oberösterreich. Dies spiegelt sich in der Leitrichtlinie für die Informationssicherheit beim<br />
Land Oberösterreich wieder. Je komfortabler die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten können,<br />
umso mehr Rechte benötigen sie und umso mehr potentielle Gefahren für die Sicherheit sind damit<br />
verbunden. Sicherheit ist auch immer ein Kompromiss zwischen Komfort und Eigenverantwortung<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letztendlich muss daher jede Mitarbeiterin und jeder<br />
Mitarbeiter zur Sicherheit beitragen.<br />
Für die Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen wurden folgende Richtlinien und Merkblätter<br />
für die Informationssicherheit definiert:<br />
• Richtlinie "Festlegungen"<br />
• Richtlinie "Passwörter"<br />
• Merkblatt "Computerviren"<br />
• Merkblatt "Behandlung von Spam"<br />
• Richtlinie "Arbeitsplatz/Arbeitsmittel"<br />
• Richtlinie "Daten"<br />
• Richtlinie "Desktops"<br />
• Richtlinie "Notebooks"<br />
• Richtlinie "E-Mail (elektronische Post)"<br />
• Merkblatt "E-Mail Verschlüsselung"<br />
• Richtlinie "Internet"<br />
• Richtlinie "Outlook"<br />
• Richtlinie "Blackberry"<br />
Die Nichteinhaltung der Informationssicherheits-Richtlinien kann zu dienstrechtlichen aber auch zu<br />
zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen.<br />
Weiterführende Informationen enthält die Information "Tipps im Umgang mit E-Mail und Internet"<br />
(siehe im Intranet unter ).<br />
121
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Leitrichtlinie für Informationssicherheit beim Land Oberösterreich<br />
1. Grundsatz<br />
1.1. Was ist die Informationssicherheit<br />
Das Land Oberösterreich ist, wie jede Behörde und jedes Unternehmen, von Informationen abhängig.<br />
Informationen können in vielen Formen vorliegen. Sie können ausgedruckt, auf Papier<br />
geschrieben, elektronisch gespeichert, auf dem Postweg oder elektronisch übermittelt, in Filmen<br />
gezeigt oder in Gesprächen mündlich weitergegeben werden. Informationen müssen, unabhängig<br />
von der dargebotenen Form, der gemeinsamen Nutzung oder der Speicherung immer<br />
angemessen geschützt werden.<br />
Informationssicherheit wird hier verstanden als Sicherung der<br />
Vertraulichkeit: Sicherstellung des Zugangs zu Informationen nur für Berechtigte<br />
Integrität: Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen und Verarbeitungsmethoden<br />
Verfügbarkeit: Sicherstellung des bedarfsorientierten Zugangs zu Informationen und zugehörigen<br />
Werten für berechtigte Benutzer.<br />
1.2. Warum ist Informationssicherheit notwendig<br />
Informationen und die sie unterstützenden Prozesse, Systeme und Netzwerke sind wichtige<br />
Unternehmenswerte. Ihre Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit tragen wesentlich zum Erfolg<br />
und zur Qualität unserer Leistung für unsere Kunden, zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften<br />
und zum Ansehen des Landes Oberösterreich bei.<br />
Informationssysteme und -netzwerke sehen sich Sicherheitsbedrohungen unterschiedlichster<br />
Herkunft gegenüber. Das kann Computerbetrug, Spionage oder Sabotage sein, aber auch<br />
Feuer, Überschwemmung oder Stromausfall. Gefahrenquellen wie Computerviren oder Hackerattacken<br />
werden immer verbreiteter und raffinierter. Einen großen Anteil an der Bedrohung<br />
haben aber auch unabsichtliche oder absichtliche Fehlhandlungen der Benutzer.<br />
Die Benutzerinnen und Benutzer haben mehr Rechte, damit aber auch viel mehr Verantwortung.<br />
Dieser Verantwortung müssen sie sich bewusst sein.<br />
Gegen die allgemeinen Gefahren werden vielfältige technische Maßnahmen gesetzt. Die besten<br />
Maßnahmen bleiben aber wirkungslos, wenn sich nicht jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter<br />
der Notwendigkeit der Informationssicherheit bewusst ist und entsprechend handelt.<br />
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des Landes Oberösterreich muss sich daher an diese<br />
Leitrichtlinie und die daraus abgeleiteten Standards und Richtlinien halten und ein entsprechendes<br />
Sicherheitsbewusstsein entwickeln.<br />
1.3. Sicherheitsbewusstsein<br />
Sicherheitsbewusstsein ist durch folgendes Verhalten gekennzeichnet:<br />
• Verstehen, dass Sicherheit ein kritisches und wesentliches Element der Unternehmensphilosophie<br />
ist.<br />
• Persönliche Verantwortlichkeit für proaktive Maßnahmen in Bezug auf Risiken für Mitarbeiter,<br />
Informationen, ideelle und materielle Werte und die Fortführung der Geschäftstätigkeit im<br />
Notfall.<br />
• Handeln nach den Sicherheitskriterien und Regeln bei allen täglich anfallenden Tätigkeiten.<br />
2. Erfordernisse<br />
Die Informationen müssen so geschützt werden, dass<br />
• die Vertraulichkeit in angemessener Weise gewahrt ist,<br />
• die Integrität der Informationen sichergestellt ist,<br />
122
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• sie bei Bedarf verfügbar sind,<br />
• die Beteiligung an einer Transaktion nicht geleugnet werden kann,<br />
• gesetzliche Verpflichtungen erfüllt werden können.<br />
Es ist erforderlich, dass<br />
• für Informationen (Daten, unterstützende Systeme und Verfahren) namentlich Informationseigentümer<br />
ernannt werden und dass diese für die Festlegung des erforderlichen Kontrollumfangs<br />
verantwortlich sind,<br />
• der jeweils für die Informationen geltende Sicherheits- und Kontrollumfang am jeweiligen Risiko<br />
für das Land Oberösterreich ausgerichtet ist,<br />
• die einzelnen Benutzer für die Nutzung der Informationen verantwortlich sind,<br />
• falls nötig durch Erzeugung zusätzlicher Informationen und durch zusätzliche Verfahren die<br />
Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gewährleistet ist,<br />
• es eine unabhängige Überprüfung der Verwaltung und Nutzung von Informationen gibt.<br />
2.1. Informationsklassifizierung und -kontrolle<br />
Für alle Informationen (Dokumente, Dateien, Datenbanken) und für die Infrastruktur (Netzwerke,<br />
Server) muss es benannte Eigentümer geben.<br />
Der Informationseigentümer muss sicherstellen, dass<br />
• geeignete Sicherheitsgrundsätze, Standards und entsprechende Richtlinien für die Informationsteile,<br />
die er direkt oder durch Ernennung zum Treuhänder besitzt, eingehalten werden,<br />
• der für den Schutz spezifischer Informationen oder Verfahren insgesamt geltende Sicherheits-<br />
und Kontrollumfang der Sensitivität, dem Wert und der Bedeutung der Informationen<br />
(z. B. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität, Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit)<br />
der Maßgabe eines festgelegten Klassifizierungsverfahrens entspricht.<br />
2.2. Systemzugangskontrolle<br />
Es werden logische und physische Zugangskontrollen eingesetzt. Soweit möglich werden Abläufe<br />
in Informationssystemen und Verfahren in Log-Dateien mitgeschrieben.<br />
• Die Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für die Festlegung von Zugriffsrechten liegen<br />
bei den Informationseigentümern.<br />
• Der Zugriff auf Informationen darf Benutzern nur für den definierten Zuständigkeitsbereich<br />
gewährt werden.<br />
2.3. Sicherheit der Informationssysteme während des Lebenszyklus<br />
• Eine Sicherheitsrisikoanalyse muss ein fester Bestandteil bei der Entwicklung, bei Einführungs-<br />
und bei Wartungsverfahren von Informationssystemen sein, und zwar ab Beginn des<br />
Lebenszyklus.<br />
• Neue Hardware und/oder Software muss den geltenden Informationssicherheitsstandards<br />
entsprechen.<br />
3. Verantwortlichkeiten<br />
3.1. Informationseigentümer<br />
Bei Datenanwendungen in der oö. Landesverwaltung ist im Regelfall die jeweilige Abteilung<br />
bzw. Bezirkshauptmannschaft oder andere Sonderbehörden sowie sonstige Einrichtungen, vertreten<br />
durch die Dienststellenleiterin bzw. den Dienststellenleiter als Informationseigentümer<br />
anzusehen.<br />
Der Informationseigentümer ist verantwortlich für:<br />
• die Festlegung der Relevanz seiner Informationen für das Land Oberösterreich,<br />
• die Festsetzung und Genehmigung des Sicherheits- und Kontrollumfangs, um in angemessener<br />
Weise die Sensitivität, den Wert und die Bedeutsamkeit seiner Informationen zu<br />
schützen,<br />
123
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
124<br />
• die Sicherstellung, dass Verantwortlichkeiten explizit definiert und Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen<br />
zur Verwaltung und zum Schutz seiner Informationen implementiert werden,<br />
• die Sicherstellung, dass die Systeme, mit denen seine Informationen bearbeitet werden, regelmäßig<br />
hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinien zur Informationssicherheit und der damit<br />
verbundenen Standards geprüft werden.<br />
Bei den Informationseigentümern muss es sich nicht notwendigerweise um eine Einzelperson<br />
handeln.<br />
Vielmehr kann diese Funktion durchaus auch von einem Lenkungsausschuss, einer Prüfkommission<br />
oder einer anderen offiziellen Einrichtung übernommen werden. Dabei sollte ebenfalls<br />
berücksichtigt werden, dass die Verwendung und das Sammeln von Informationen im Zuge der<br />
Bearbeitung oder Übertragung derselben in verschiedene Bereiche zu einem neuen Informationseigentümer<br />
führen kann.<br />
3.2. Informationstreuhänder<br />
Der Informationstreuhänder ist im Land Oberösterreich die Abteilung Informationstechnologie.<br />
Es ist für die Wahrung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität, der elektronisch<br />
verarbeiteten und /oder gespeicherten Informationen in dem vom Informationseigentümer<br />
festgelegten Umfang und nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Leitrichtlinie verantwortlich.<br />
Der Informationstreuhänder ist verpflichtet, den Informationseigentümer über die Risiken<br />
zu informieren, die sich durch eine vom Informationseigentümer getroffenen Sicherheitsentscheidung<br />
ergeben können.<br />
3.3. Benutzer<br />
Benutzer (Mitarbeiter, Vertragspartner, Berater) sind bei der Erstellung, Nutzung und Verwaltung<br />
von Informationen verpflichtet, die Richtlinien zur Informationssicherheit und die damit verbundenen<br />
Informationssicherheitsstandards sowie die allgemeinen Richtlinien des Landes O-<br />
berösterreich einzuhalten. Die einzelnen Benutzer sind für sämtliche Maßnahmen verantwortlich,<br />
die sie bei der Nutzung von Informationen und der damit verbundenen Systeme ergreifen.<br />
Die Benutzer müssen verstehen, wann und warum Informationen durch angemessene Kontrollen<br />
geschützt werden sollten. Um diese Kontrollen durchführen zu können, sind sie verpflichtet,<br />
adäquate Unterstützung einzuholen.<br />
Benutzer, die eine Verletzung der Richtlinien für Informationssicherheit und der damit verbundenen<br />
Informationssicherheitsstandards vermuten oder Kenntnis davon erlangt haben bzw. annehmen,<br />
dass Informationen nicht in geeigneter Weise geschützt sind, haben unverzüglich geeignete<br />
Schritte zur Behebung des Sicherheitsrisikos zu setzen.<br />
3.4. Informations-Sicherheitsmanagement<br />
Das Informations-Sicherheitsmanagement des Landes Oberösterreich ist für eine sichere Bearbeitung<br />
sämtlicher Transaktionen nach Maßgabe der festgelegten Standards sowie für die Sicherstellung<br />
des Schutzes der elektronisch verarbeiteten und / oder gespeicherten Informationen<br />
des Landes Oberösterreich verantwortlich.<br />
Das Sicherheitsmanagement stellt die Entwicklung der Richtlinien zur Informationssicherheit<br />
und der damit verbundenen Standards, ihre ständige Fortschreibung und Veröffentlichung sicher.<br />
Es ist sowohl für die Einführung von Sicherheitsprogrammen sowie für die Bereitstellung<br />
globaler Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz der Informationen des Landes Oberösterreich<br />
verantwortlich.<br />
Dazu zählen auch das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter, die Sicherheitsanalyse und die<br />
technische Überwachung. Das Sicherheitsmanagement versichert sich ständig über die Einhaltung<br />
dieser Richtlinie.<br />
3.5. Unabhängige Prüfung<br />
Die Verwaltung, Nutzung und Kontrolle von Informationen sollen von unabhängiger Seite überprüft<br />
werden. Bei dieser Prüfung soll die Stichhaltigkeit der Sicherheitsklassifizierung der Informationen<br />
festgestellt werden in Bezug auf<br />
• Zugriffsmöglichkeit zu den Informationen,
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Kontrollen im Zusammenhang mit den Informationen,<br />
• Verwaltung der Informationen, einschließlich der Trennung von Rollen und unabhängige<br />
Genehmigung / Überprüfung von Transaktionen,<br />
• Maßnahmen zur Wiederherstellung von Information und Verfahren.<br />
4. Durchsetzung<br />
4.1. Verstöße<br />
Als Verstöße gelten beabsichtigte oder grob fahrlässige Handlungen, die<br />
• dem Ansehen des Landes Oberösterreich schaden,<br />
• die Sicherheit der Mitarbeiter, Vertragspartner oder Berater gefährden,<br />
• dem Land Oberösterreich durch die Kompromittierung der Sicherheit von Daten oder Geschäftsinformationen<br />
tatsächlichen oder potentiellen finanziellen Verlust einbringen,<br />
• den unberechtigten Zugriff auf Informationen, deren Preisgabe und/oder Änderung beinhalten,<br />
• die Nutzung von Behördeninformationen für illegale Zwecke beinhalten.<br />
4.2. Strafen<br />
Die Nichteinhaltung der Informationssicherheits-Richtlinien kann zu dienstrechtlichen aber auch<br />
zu zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen.<br />
125
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Festlegungen"<br />
1. Grundlagen zur Bewertung der Informationssicherheit<br />
Zur Betrachtung der Sicherheit eines Informationssystems sowie zur Einführung eines Informationssicherheits-Management-Systems<br />
(ISMS) haben sich verschiedene Standards herausgebildet:<br />
• ISO/IEC 17799:2005 (ident mit ÖNORM ISO/IEC 17799)<br />
Informationsverarbeitung – Leitfaden für das Management von Informationssicherheit<br />
• ISO/IEC 27001:2005, entwickelt aus BS 7799-2:2002 (ÖNORM A 7799) Informationssicherheits-Managementsysteme<br />
– Spezifikation und Hinweise zur Nutzung<br />
• IT-Grundschutzhandbuch<br />
Herausgegeben vom Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik<br />
• Österreichisches Informationsicherheitshandbuch<br />
Teil 1: Informations-Sicherheitsmanagement<br />
Teil 2: Informations-Sicherheitsmaßnahmen<br />
Herausgegeben vom Chief Information Office beim Österreichischen Bundeskanzleramt<br />
Während das IT-Grundschutzhandbuch konkrete Maßnahmen und Verfahren zum Erreichen einer<br />
Grundsicherheit der Informationstechnologie beschreibt, befasst sich ISO/IEC 17799 und BS 7799<br />
mit dem Aufbau eines IT-Sicherheitsmanagements und seiner Verankerung in der Organisation.<br />
Das Österreichische IT-Sicherheitshandbuch versucht, beides zu kombinieren, folgt aber im Wesentlichen<br />
dem IT-Grundschutzhandbuch.<br />
Das Land Oberösterreich beabsichtigt, die Leitlinien und Empfehlungen von ISO/IEC 17799 bzw.<br />
BS 7799 umzusetzen. Überall dort, wo sie praktikabel sind, wird auf die Maßnahmen des Österreichischen<br />
Informationssicherheitshandbuches zurückgegriffen.<br />
Alle Maßnahmen, die durch die Standards vorgeschlagen werden, die aber vom Land Oberösterreich<br />
nicht umgesetzt werden, sollen mit Anführung der Gründe dokumentiert werden.<br />
2. Grundsätzliches zur Informationssicherheit:<br />
Die Anforderungen an die Informationssicherheit lassen sich in nachfolgende Bereiche unterteilen:<br />
• Vertraulichkeit<br />
Information darf nur dem Personenkreis zugänglich gemacht werden, der befugt ist, darauf zuzugreifen.<br />
• Integrität<br />
beschreibt die Forderung, dass Daten, Applikationen oder Systeme nicht unberechtigt geändert<br />
werden können bzw. dass jede Änderung erkannt wird.<br />
• Verfügbarkeit<br />
Sagt aus, dass Daten und Applikationen vereinbarungsgemäß zur Verfügung stehen. Entsprechende<br />
Vereinbarungen sind von besonderer Wichtigkeit, weil eine hundertprozentige Verfügbarkeit<br />
praktisch nicht machbar ist.<br />
• Authentizität<br />
In manchen Quellen wird als vierter Bereich von IT-Sicherheit noch Authentizität, d.h. gesicherte<br />
Herkunft, genannt. Die Authentizität kann mit besonderen Verfahren sichergestellt werden<br />
(PKI, Signatur) und muss im Einzelfall behandelt werden.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind technische und organisatorische Maßnahmen<br />
vorzusehen.<br />
Da diese Maßnahmen in der Regel einen nicht unerheblichen Aufwand verursachen und gegebenenfalls<br />
sogar einander entgegenwirken, ist ein Klassifizierungsschema vorgesehen, das die Anwendung<br />
der Maßnahmen auf die Daten und Informationen beziehungsweise auf die verarbeitenden<br />
Systeme einschränkt.<br />
126
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3. Klassifizierungsschemata<br />
3.1. Vertraulichkeitsstufe<br />
Vertraulichkeitsstufen sind auch in der Kanzleiordnung bzw. in ELVIS geregelt. Während dort<br />
der Fokus auf Dokumenten und den Zugriffsrechten der Bearbeiter liegt, steht in diesen Richtlinien<br />
die Information, also der Inhalt z.B. von Dokumenten im Vordergrund. Wo es sinnvoll ist<br />
gilt die im Folgenden genannte Zuordnung.<br />
• offen:<br />
Information, die ausdrücklich zur Veröffentlichung bzw. Informationsweiterverwendung freigegeben<br />
wurde oder deren Bekanntgabe von jedermann verlangt werden kann (Auskunftspflicht).<br />
Dabei muss weder der Nachweis des berechtigten Interesses erbracht werden, noch<br />
ist die Behörde zur Prüfung verpflichtet. Dazu zählen etwa Gesetze, Verordnungen, Pressemitteilungen,<br />
aber auch „freie“ Daten beispielsweise nach dem Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz-<br />
und Informationsweiterverwendungsgesetz bzw. dem Umweltinformationsgesetz.<br />
• intern:<br />
Daten, die keinen besonderen Vertraulichkeitsstatus besitzen, die aber nicht ausdrücklich<br />
zur Veröffentlichung bzw. Informationsweiterverwendung beispielsweise nach dem Oö.<br />
Auskunfts-pflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz freigegeben<br />
sind.<br />
• vertraulich (entspricht vertraulich in ELVIS bzw. Kanzleiordnung):<br />
Information, die nur für die Erfüllung des Aufgabenbereiches bestimmt ist. Dabei kann es<br />
sich sowohl um fachlichen Aufgabenbezug laut Geschäftseinteilung als auch um die Erfüllung<br />
innerdienstlicher oder dienstrechtlicher Aufgaben handeln. Für die Weitergabe von vertraulichen<br />
Daten ist jedenfalls einerseits der Nachweis des berechtigten Interesses durch<br />
den Empfänger zu erbringen und andererseits die Zulässigkeit der Übermittlung in rechtlicher<br />
Hinsicht oder gemäß innerdienstlicher Vorschriften zu überprüfen. In diese Kategorie<br />
fallen alle personenbezogenen Daten, deren Veröffentlichung gesetzlich nicht zulässig ist,<br />
sicherheitsrelevante Daten etc.<br />
Im Unterschied zu internen Informationen ist der Personenkreis, der Zugang zu vertraulichen<br />
Daten hat, identifizierbar.<br />
• streng vertraulich (entspricht streng vertraulich und Verschluss im ELVIS bzw. der Kanzleiordnung):<br />
Information, deren Offenlegung nur auf Grund von besonderen Vereinbarungen oder unter<br />
besonderen Umständen erfolgen darf, Informationen, die laut Datenschutzgesetz als besonders<br />
schutzwürdig gelten und daher unter die „sensiblen“ Daten eingereiht sind (Daten natürlicher<br />
Personen über deren rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit,<br />
religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder Sexualleben)<br />
sowie Verschlusssachen.<br />
3.2. Integrität<br />
Grundsätzlich darf die Integrität von Daten und Informationen nicht unter ein bestimmtes Niveau<br />
fallen, da andernfalls die durchgängige Verarbeitung unmöglich wird. In der Regel wird<br />
dieses Niveau durch einen ordnungsgemäß durchgeführten IT-Betrieb gewährleistet. Höhere<br />
Anforderungen sind vorzusehen, wenn einerseits die Wiederherstellung des Informationswertes<br />
sehr aufwändig wird, oder andererseits, wenn geringfügige Änderungen von Daten und Informationen<br />
starke Auswirkungen im weiteren Verarbeitungsprozess verursachen.<br />
• Integritätsklasse 1:<br />
Standardklasse, die durch den Normalbetrieb abgedeckt wird. Betrifft in der Regel den Großteil<br />
der Daten und Informationen.<br />
• Integritätsklasse 2:<br />
Erhöhte Integritätsanforderungen, etwa für Daten, deren ursprünglicher Zustand nur schwer<br />
ermittelt werden kann (z.B. Angebotsdaten oder wirtschaftlich relevante Daten, die ausschließlich<br />
in elektronischer Form hinterlegt sind).<br />
127
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Integritätsklasse 3:<br />
Hohe Integritätsanforderung. Betrifft Daten, die Urkundencharakter besitzen, gegebenenfalls<br />
auf Grund gesetzlicher Anforderungen über längeren Zeitraum elektronisch archiviert werden<br />
und nicht wieder herstellbar sind (Gutachten von Ziviltechnikern, Notariatsakte und ähnliches).<br />
3.3. Verfügbarkeit<br />
• Verfügbarkeitsklasse 1:<br />
Die Applikation / der Dienst / die Daten müssen nach einer Störung innerhalb von 3 Tagen<br />
wieder verfügbar sein.<br />
• Verfügbarkeitsklasse 2:<br />
Die Applikation / der Dienst / die Daten müssen nach einer Störung innerhalb von 1 Tag<br />
wieder verfügbar sein.<br />
• Verfügbarkeitsklasse 3:<br />
Die Applikation / der Dienst / die Daten müssen nach einer Störung innerhalb von 1 Stunde<br />
wieder verfügbar sein.<br />
Die Wiederherstellungszeiten gelten nicht im Katastrophenfall.<br />
4. Maßnahmen<br />
Um die jeweils angestrebten Klassen zu erreichen, stehen organisatorische und technische Maßnahmen<br />
zur Verfügung.<br />
4.1. Vertraulichkeit:<br />
• Bewusstseinsbildung<br />
• Kennzeichnung der Schriftstücke<br />
• Regelungen über Umgang und Weiterleitung von Dokumenten in elektronischer Form<br />
• Verschlüsselung (Mail, Speicher)<br />
4.2. Integrität:<br />
• „Vier Augen“ – Prinzip<br />
• Signatur, Prüfsummenverfahren<br />
4.3. Verfügbarkeit von Daten:<br />
• Datensicherung nach einem geeigneten Konzept<br />
• Sichere Verwahrung der Sicherungsmedien<br />
• Datenarchivierung<br />
• Abklärung der notwendigen Aufbewahrdauer für Daten<br />
4.4. Verfügbarkeit von Applikationen / Diensten:<br />
• Verwendung hochwertiger Hardware<br />
• Redundanz von wichtigen Bauteilen (Power Supply, Lüfter)<br />
• Redundante Speicher<br />
• Redundante Anbindung an das Netzwerk<br />
• Redundante Auslegung wichtiger Netzwerkkomponenten<br />
• Betrieb mehrerer Rechner mit Lastausgleich<br />
• Verteilung der Rechner auf mehrere, baulich getrennte Räume<br />
• Cluster<br />
128
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die verschiedenen Bedürfnisse der Rechnerverfügbarkeit werden derzeit mit drei Klassen von<br />
Hardwareeinrichtungen abgebildet:<br />
Server ohne besondere Anforderungen an die Verfügbarkeit:<br />
No-Name-Server oder Server ohne redundante Teile wie Netzgerät, Lüfter, Netzwerkkarten o-<br />
der RAID-Systemen. Entspricht der Verfügbarkeitsklasse 1.<br />
Server mit hoher Verfügbarkeit:<br />
Markengeräte mit Management und Fehlerfrüherkennung, redundante Netzteile mit getrennter<br />
Stromversorgung, mindestens eine davon unterbrechungsfrei, redundante Lüfter, redundante<br />
Netzwerkzugänge, Festplatten mit RAID-Systemen.<br />
Oder<br />
Rechnerverbund aus mehreren Rechnern ohne besondere Anforderungen an die Verfügbarkeit.<br />
Entspricht Verfügbarkeitsklasse 2.<br />
Weitgehend ausfallsichere Server:<br />
Rechnerverbund aus mindestens zwei Rechnern mit hoher Verfügbarkeit in getrennten Räumlichkeiten<br />
mit automatischer Lastübernahme im Fehlerfall.<br />
Entspricht Verfügbarkeitsklasse 3.<br />
129
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie Passwörter<br />
1. Ziel:<br />
Passwörter nehmen, solange sicherere Methoden wie Chipkarten oder biometrische Verfahren<br />
(sofern rechtlich zulässig) nicht mit vertretbarem Aufwand zu implementieren sind, eine zentrale<br />
Stellung unter den Sicherheitsvorkehrungen ein, die für IT-Systeme eingerichtet werden können.<br />
Durch Passwörter wird nicht nur generell der Zutritt in ein System geregelt (in ein Netzwerk oder in<br />
einen Netzwerkabschnitt, zu einem Arbeitsplatzrechner bzw. einem Notebook, zu einem Server,<br />
zu besonderen Funktionen, zu bestimmten Daten). Die richtige und sorgfältige Verwendung von<br />
Passwörtern ist auch von großer Bedeutung für die IT-Sicherheit.<br />
Zum Schutz der Passwörter gehört ganz wesentlich eine Kultur, in der von allen Betroffenen sichergestellt<br />
wird, dass Passwörter nicht ausgespäht werden können. Das geschieht durch<br />
- Verwenden von guten Passwörtern, um die Erkennung durch Passwort-Crack-Programme zu<br />
erschweren.<br />
- aktives und offensichtliches Abwenden oder Wegtreten, wenn von jemand anderem eine Passworteingabe<br />
durchgeführt wird.<br />
- ausdrückliches und energisches Einfordern eines solchen Verhaltens, wenn es nicht von vorne<br />
herein angeboten wird.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Die Wirksamkeit dieser wichtigen Einrichtung für die Sicherheit der IT kann nur durch verantwortungsvollen<br />
Umgang und damit auch genauer Befolgung der nachfolgenden Regeln durch alle<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt werden.<br />
Eine besondere Bedeutung haben Passwörter für Benutzer mit höheren Rechten (Administratorenpasswörter)<br />
– das sind alle, die über die Rechte der allgemeinen Benutzer hinausgehen. Inhaber<br />
dieser Passwörter unterliegen einer besonderen Verantwortung.<br />
4. Begriffe:<br />
Log-In:<br />
Anmelden an ein IT-System oder eine IT-Anwendung. Die einfachste Methode ist die Eingabe von<br />
Benutzerkennung und Passwort. Besser, aber zur Zeit noch sehr aufwendig, sind Chipkarten oder<br />
biometrische Verfahren (Fingerprinterkennung, Retinaerkennung etc.), sofern letztere (datenschutz-)rechtlich<br />
zulässig sind.<br />
Passwort:<br />
Mittel zur Authentifizierung eines Benutzers in einem System durch eine eindeutig diesem Benutzer<br />
zugeordnete Information. Die Authentisierung ist nur so lange sichergestellt, als das Passwort<br />
nur diesem Benutzer bekannt ist.<br />
Administratoren:<br />
Verwalter von IT-Systemen, die zur Wahrnehmung dieser Tätigkeit höhere Rechte bzw. Zugriff auf<br />
weitere Daten haben müssen als normale Benutzer.<br />
130
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Benutzer:<br />
Sind Personen, die mit Hilfe eines Computers (bzw. anderen durch Passwort schützbaren Geräten<br />
der Informations- und Kommunikationstechnologie) und den darauf laufenden Programmen arbeiten.<br />
5. Regeln für allgemeine Benutzer-Passwörter:<br />
5.1. Das Passwort darf keinen „sinnvollen“ (= lexikalischen) Begriff beinhalten und muss aus<br />
einer Kombination von Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung), Ziffern und Sonderzeichen<br />
bestehen. Methoden, solche Passwörter zu erstellen, die dennoch merkbar sind,<br />
können im Intranet unter nachgelesen<br />
werden.<br />
5.2. Keinesfalls dürfen im Passwort Begriffe aus der eigenen Lebensumwelt verwendet werden:<br />
Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Autokennzeichen, Namen von Haustieren etc. All diese<br />
Daten sind durch „Social Engineering“ – d.h. Nachforschen im Umfeld des Betroffenen –<br />
leicht zu erheben.<br />
5.3. Ein schriftliches Festhalten des Passworts in unmittelbarer Nähe des Rechners, offen oder<br />
versteckt, (Schreibtischunterlage, Bildschirm, Notebookunterseite etc.) ist grob fahrlässig!<br />
5.4. Die Passwort-Speicherfunktion von EDV-Applikationen darf keinesfalls verwendet werden,<br />
da so gespeicherte Passwörter durch Schadensoftware jederzeit ausgelesen und an unbefugte<br />
Personen weitergeleitet werden könnten.<br />
5.5. Das Passwort darf nur der Inhaberin bzw. dem Inhaber der Benutzerkennung bzw. in Ausnahmefällen<br />
(„Gruppenpasswörter“) den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe bekannt<br />
sein.<br />
Das Passwort darf in keinem Fall anderen Personen (auch Vorgesetzten, IT-Koordinatoren<br />
etc.) mitgeteilt werden. Ausgenommen davon sind Passwörter, die durch berechtigte Personen<br />
neu vergeben oder zurückgesetzt wurden.<br />
5.6. Passwörter, die im dienstlichen Bereich verwendet werden, dürfen nicht für private Benutzerkennungen<br />
verwendet werden.<br />
5.7. Voreingestellte (Installations-) Passwörter oder solche, die durch berechtigte Personen<br />
zurückgesetzt wurden, sind beim ersten Log-In zu ändern.<br />
5.8. Passwörter dürfen auf keine programmierbare Funktionstaste gelegt werden.<br />
5.9. Sollte ein Benutzer den Verdacht haben, eines seiner Passwörter könnte einem anderen<br />
bekannt geworden sein, ist er verpflichtet, dieses Passwort sofort zu ändern.<br />
5.10. Falls die jeweilige Software es unterstützt, wird die Änderung des Passworts nach 3 Monaten<br />
erzwungen.<br />
6. Regeln für Passwörter für Benutzer-ID mit erweiterten Rechten (Administratorenpasswörter):<br />
6.1. Alle Bestimmungen aus Pkt 5. „Regeln für allgemeine Benutzerpasswörter“ gelten, soweit<br />
sie nicht durch spezielle Anweisungen überschrieben werden.<br />
6.2. Um größtmögliche Sicherheit zu erlangen müssen Administratoren-Passwörter die vorher<br />
beschriebenen Bedingungen in einem derart hohen Maß erfüllen, dass sie sich nur mehr<br />
sehr schwer merken lassen.<br />
Weil ein so gewähltes Passwort einen sehr hohen Schutz gegen Ausspähung von außen<br />
und – bei Einhaltung der geltenden Regeln – einen ebenso hohen Schutz gegen Ausspähung<br />
von innen besitzt, wird die Laufzeit eines solchen Passworts nicht begrenzt. Die Inhaberin<br />
bzw. der Inhaber von Administratorrechten ist jedoch verpflichtet, auf die Geheimhaltung<br />
des Passwortes besonders zu achten und das Passwort schon beim geringsten<br />
Verdacht, dass es anderen bekannt geworden sein könnte, zu ändern.<br />
Sofern es sich dabei um Gruppenpasswörter handelt, muss beim Verdacht, dass dieses<br />
Passwort außerhalb der Gruppe bekannt geworden ist, entsprechend verfahren werden.<br />
6.3. Ein Log-In als Administrator darf nur für die Dauer der Tätigkeit erfolgen, für die das normale<br />
Benutzer-Log-In nicht ausreicht.<br />
131
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
6.4. Für sehr hoch berechtigte Administratorenkennungen (z.B. in der obersten Hierarchiestufe)<br />
gibt es im allgemeinen nur eine oder zwei Personen, die im Besitz des zugehörigen Passworts<br />
sind. In dem Fall ist das entsprechende Passwort in einem verschlossenen Kuvert<br />
bei der Leitung der Abteilung Informationstechnologie zu hinterlegen, dass diese Kennungen<br />
auch in Ausnahme- bzw. Notfällen zur Verfügung stehen.<br />
7. Zurücksetzung von Passwörtern:<br />
Ein Zurücksetzen des Passwortes darf nur auf Anforderung des Passworteigentümers und nach<br />
eindeutiger Feststellung der Identität, im Ausnahmefall auch durch die Abteilung Informationstechnologie,<br />
erfolgen. In jedem Fall darf das neue Passwort ausschließlich dem Passworteigentümer<br />
mitgeteilt werden.<br />
8. Referenzen<br />
Intranet: <br />
132
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Merkblatt "Computerviren"<br />
1. Einleitung:<br />
Die Bezeichnung Computervirus ist zum Überbegriff für die ganze Palette von Schadensoftware<br />
geworden. Die Unterscheidung in „echte“ Computerviren, Trojanische Pferde, Würmer oder Spyware<br />
ist nur für den Fachmann und für strategische Überlegungen wichtig, für den normalen Benutzer<br />
ist sie nicht von Belang.<br />
All diesen verschiedenen Typen von Computerviren ist gemein, dass sie über verschiedene Wege<br />
(Internet-Surfen, Mail, Wechseldatenträger etc.) in ein IT-System eindringen und in irgendeiner<br />
Weise Schaden anrichten. Mögliche Schäden können dabei sein:<br />
• Verfälschung von Daten<br />
• Zerstörung von Daten<br />
• Unkontrollierte Weitergabe von Daten<br />
• Ausspionierung von wichtigen Informationen (z.B. Passwörter)<br />
• Störung des normalen Rechnerverhaltens<br />
• Rechnerabstürze<br />
• Blockieren der Netzverbindungen<br />
• Selbständiges Einwählen an kostenpflichtige Telefonnummern<br />
2. Maßnahmen:<br />
Computerviren stellen eine große Gefahr für den geregelten Ablauf der IT des Landes Oberösterreich<br />
dar. Mit verschiedenen Maßnahmen wird versucht, dieser Gefahr zu begegnen.<br />
2.1. Virenscanner auf Arbeitsplatzrechnern und Servern<br />
Jeder Arbeitsplatzrechner, jedes Notebook und jeder Server ist durch einen Virenscanner geschützt.<br />
Das Update dieser Virenscanner erfolgt automatisch und zentral gesteuert.<br />
Die Einstellungen des Virenscanners dürfen nicht eigenmächtig verändert werden. Ebenso darf<br />
der Virenscanner keinesfalls deaktiviert werden. Sollte der Verdacht bestehen, dass das Update<br />
oder der Virenscanner insgesamt nicht einwandfrei funktionieren, ist umgehend mit der IT-<br />
Koordinatorin bzw. dem IT-Koordinator Kontakt aufzunehmen.<br />
Trotz des automatischen Updates kann es vorkommen, dass neue Viren in das Intranet (Landesdatennetz)<br />
gelangen, bevor ein Update der Scanner durchgeführt werden konnte. Es ist daher,<br />
besonders beim Öffnen von E-Mail-Attachments, immer Vorsicht walten zu lassen, siehe<br />
Punkt 3.<br />
2.2. Filterung und Prüfung von E-Mails<br />
Am Übergang von Internet zum Intranet (Landesdatennetz) ist ein weiterer Virenscanner eingeschaltet,<br />
ein so genannter Virengateway. Dieser Scanner überprüft jede ein- und ausgehende<br />
E-Mail auf Viren, prüft die E-Mails auf unerwünschte Inhalte und sperrt Mails, die nicht erwünschte<br />
Anhänge haben (z.B. ausführbare Dateien).<br />
2.3. Filterung des Inhalts von Internet-Seiten<br />
In jüngster Zeit werden zunehmend mehr Schadenprogramme beim einfachen Surfen im Internet<br />
übertragen. Aus diesem Grund wird ein weiterer Scanner zentral zwischen Internet und Internetbrowsern<br />
installiert, der diese Daten prüft.<br />
3. Richtiges Verhalten beim Umgang mit E-Mails<br />
Die meisten Viren verbreiten sich heute per E-Mail. Virenfilter und Scanner können keinen vollständigen<br />
Schutz bieten und müssen durch problembewusstes und sorgfältiges Verhalten des<br />
Anwenders unterstützt werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten:<br />
133
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Öffnen Sie nicht unbedacht Attachments, die Sie per E-Mail erhalten haben, egal woher! Auch<br />
Hinweise in den Nachrichten, wie "Virus Checked" oder Ähnliches, bieten keinerlei Schutz vor<br />
Viren, Würmern und trojanischen Pferden. Der beste Schutz ist nach wie vor ein gesundes<br />
Misstrauen des Benutzers. Dies gilt insbesondere für Nachrichten mit Attachments, die unerwartet<br />
eintreffen und nicht einer plausiblen Kommunikationsbeziehung, z.B. im Rahmen eines<br />
Projektes, bei dem Dokumente ausgetauscht werden, zuzuordnen sind. Allerdings ist auch hier<br />
Sorgfalt geboten, einige Würmer produzieren Nachrichten, die den Anschein erwecken sollen,<br />
zu einer solchen Beziehung zu gehören. Das Fälschen von Absenderangaben bei E-Mails ist<br />
sehr einfach.<br />
• Erhalten Sie eine E-Mail mit einem Attachment oder einem anklickbaren Link, die angeblich von<br />
Bekannten stammt und Sie auch nur die geringste Merkwürdigkeit an dieser E-Mail finden,<br />
dann öffnen Sie das Attachment oder den Link auf keinen Fall. Antworten Sie auch nicht auf<br />
derartige Mails, sondern rufen Sie stattdessen den vorgeblichen Absender an und vergewissern<br />
Sie sich, dass er Ihnen tatsächlich diese E-Mail geschickt hat.<br />
Solche Merkwürdigkeiten können sein: Unübliche Anrede oder Grußformel, Fremdsprache, obwohl<br />
mit dem Betreffenden normal nur deutsch gesprochen wird, ungewöhnlicher Stil, z.B. sehr<br />
saloppe Redeweise einem Vorgesetzten gegenüber etc.<br />
• Kein ernstzunehmender Hersteller von System- oder Antivirussoftware verschickt Werkzeuge<br />
zur Entfernung irgendwelcher Malware, Updates oder Patches per E-Mail. Insbesondere verschickt<br />
auch die Firma Microsoft Sicherheitsupdates (Hotfixes) niemals per E-Mail. Sollten Sie<br />
also eine solche Nachricht erhalten, können Sie davon ausgehen, dass es sich um eine gefälschte<br />
Nachricht handelt.<br />
4. Verhalten bei vermutetem Virenbefall<br />
• RUHE bewahren – es handelt sich vorerst nur um einen Verdacht<br />
• Rechner vom Netzwerk trennen, Netzwerkkabel (nicht Stromkabel!) herausziehen<br />
• IT-Koordinatorin bzw. IT-Koordinator verständigen, die bzw. der – allenfalls gemeinsam mit der<br />
Abteilung Informationstechnologie – die entsprechenden Schritte einleitet<br />
5. Begriffe:<br />
Attachment:<br />
Beilage zu einer E-Mail, z.B. Dokumente, Bilder etc. Bei Viren verbergen sich dahinter oft ausführbare<br />
Daten (Programme) die beim Anklicken ablaufen und den Rechner verseuchen.<br />
134
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Merkblatt "Behandlung von Spam"<br />
1. Was ist Spam?<br />
Spam ist die unverlangte und unerwünschte Zusendung von E-Mails.<br />
Zum einen Teil handelt es sich um Werbung für verschiedene Produkte, die über verschiedene<br />
Wege millionenfach versandt werden, zum anderen Teil sind es Mails, die durch Schadensoftware<br />
automatisch an alle Adressaten versandt werden, die auf einem befallenen Computer gespeichert<br />
sind.<br />
2. Überblick<br />
• Spam kann nicht verhindert werden, aber der Umgang damit kann organisiert werden<br />
(Spamfilter, Outlookregeln).<br />
• Die letzte Entscheidung darüber, was mit einer Mail zu geschehen hat, liegt immer beim<br />
Empfänger der Mail (außer, es handelt sich um gefährlichen oder schädlichen Inhalt)!<br />
• Bei Fragen im Zusammenhang mit Spam wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Koordinatorin<br />
bzw. Ihren IT-Koordinator.<br />
• Versuchen Sie keinesfalls, vermeintliche Absender von Spam anzuschreiben oder auf<br />
Spam zu antworten.<br />
• Versuchen Sie niemals, gegen Spammer vorzugehen, auch dann nicht, wenn Sie diese<br />
im Landesdienst vermuten. Informieren Sie in so einem Fall Ihre IT-Koordinatorin bzw.<br />
ihren IT-Koordinator.<br />
3. Wie kommt der Spammer zu meiner Adresse?<br />
Die Adressen werden durch automatisch ablaufende Programme aus allen möglichen Quellen, z.<br />
B. aus Webseiten gesammelt und werden regelrecht gehandelt. CDs mit etlichen Millionen Mailadressen<br />
sind um wenig Geld erhältlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Mailadresse in solchen<br />
Sammlungen enthalten ist, ist umso höher, je mehr sie verwendet wird und je öffentlicher sie<br />
ist.<br />
4. Was kann gegen Spam getan werden?<br />
Spam kann grundsätzlich nicht verhindert werden.<br />
Derzeit ist die einzige Methode, sich gegen Spam zu wehren, so genannte Spamfilter (Programme,<br />
die Spam erkennen sollen) zu verwenden. Auch im Bereich des Landes Oberösterreich wird<br />
so ein Filter eingesetzt, der jede Mail nach verschiedenen Methoden und auf verschiedene Merkmale<br />
hin überprüft und bei Verdacht in den Betreff der Mail die Kennzeichnung „[spam]“ setzt. Die<br />
so gekennzeichnete Mail wird an den Adressaten weitergeleitet.<br />
5. Warum werden Spam-Mails nicht sofort gelöscht?<br />
Der Spamfilter ist ein Programm, das nach bestimmten Regeln vorgeht. Die Trefferrate ist bei derartigen<br />
Produkten, wie sie auch beim Land Oberösterreich eingesetzt werden zwar sehr hoch,<br />
doch eine hundertprozentige Erkennung kann es aber nicht geben. Ebenso wird es immer wieder<br />
vorkommen, dass eine Mail, die kein Spam ist, doch als solche gekennzeichnet wird, weil sie eben<br />
bestimmte Merkmale aufweist.<br />
Eine automatische Löschung würde also „richtige“, unter Umständen auch wichtige Mails treffen.<br />
Mails unterliegen – ebenso wie Telefonate oder Faxe – dem Telekommunikationsgeheimnis auf<br />
Grund des Telekommunikationsgesetzes, sodass ein Löschen auch diesbezüglich rechtlich äußerst<br />
problematisch ist. Mails dürfen daher generell dem Adressaten nicht vorenthalten werden, es<br />
sei denn, sie würden eine Gefahr darstellen (Viren etc.).<br />
135
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die letzte Entscheidung darüber, was mit einer Mail zu geschehen hat, liegt daher immer<br />
beim Adressaten!<br />
6. Was empfiehlt die Abteilung Informationstechnologie?<br />
Eine sehr bewährte Vorgangsweise ist das Setzen einer Regel im Outlook, die alle Mails, in deren<br />
Betreff die Kennzeichnung „[spam]“ vorkommt, in einen eigenen Ordner verschiebt. Die Mails in<br />
diesem Ordner können von Zeit zu Zeit sehr rasch überblickt werden, Nicht-Spam kann gegebenenfalls<br />
herausgesucht und der Rest in einem gelöscht werden.<br />
Durch die geringe Größe der Spam-Mails (im Allgemeinen 3 – 5 KB) sollte es dadurch zu keinen<br />
Problemen mit dem im Postfach zur Verfügung stehenden Speicherplatz kommen.<br />
Vielfach hat sich auch bewährt, die mit [spam] gekennzeichneten Mails sofort automatisch in den<br />
Ordner "gelöschte Objekte" zu verschieben. Dabei wird allerdings auf eine Einzelprüfung auf "false<br />
positives", also fälschlich als Spam gekennzeichnete Mails, verzichtet.<br />
136
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Arbeitsplatz/Arbeitsmittel"<br />
1. Ziel:<br />
Diese Richtlinie fasst die Grundregeln zur Informationssicherheit am Arbeitsplatz sowie bei der<br />
Nutzung von Arbeitsmitteln innerhalb und außerhalb der Diensträume zusammen.<br />
Beim Umgang mit Informationen und Informationssystemen bestehen Risiken hinsichtlich<br />
• Unerwünschtes Offenlegen interner Informationen<br />
• Zugriff von Unbefugten<br />
• Verlust oder Verfälschung von Informationen<br />
• Einschleppen von Schadensoftware<br />
Diese Risiken gilt es sowohl im Umgang mit IKT-Ausstattung als auch mit generellen Verhaltensweisen<br />
zu minimieren.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Für die Wahrung der Informationssicherheit ist die Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
sowie der Führungskräfte erforderlich.<br />
4. Begriffe:<br />
Arbeitsmittel:<br />
Arbeitsmittel im Sinn dieser Regeln sind in Büro- oder Arbeitsbereichen eingesetzte technische<br />
Hilfsmittel, mit deren Hilfe organisationsinterne Informationen aufbewahrt, bearbeitet, weitergeleitet<br />
oder vernichtet werden (z.B. Computer, CD/DVD-Laufwerke, Datenträger, Schreibtisch,<br />
Schränke).<br />
Datenträger:<br />
Neben analogen Medien zum Speichern von Daten wie z.B. Schriftstücken in Papierform (Dokumente,<br />
Akten, etc.) oder Karteikarten sind unter Datenträger insbesondere technische Einrichtungen<br />
wie z.B. Festplatten, Disketten, CD/DVD-ROM, Magnetbänder, USB-Sticks, Memorykarten<br />
etc. zu verstehen.<br />
Informationen:<br />
Inhalt aller Quellen und Medien, mit denen Wissen über Personen, Sachen oder Geschehnisse<br />
erzeugt und weitergegeben oder gespeichert wird.<br />
PIN:<br />
Personal Identification Number. Nummer, die das "Wissen" darstellt, durch das gemeinsam mit<br />
dem "Besitz" z.B. einer Chipkarte (bekanntes Beispiel: Bankomatkarte) die Authentizität einer Person<br />
nachgewiesen wird.<br />
PDA:<br />
Personal Digital Assistent.<br />
137
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5. Regeln:<br />
Verhalten am Arbeitsplatz innerhalb und außerhalb von Diensträumlichkeiten; Umgang mit<br />
Unterlagen/Datenträger<br />
5.1. Organisationsinterne Informationen dürfen nicht in die Hände Unbefugter gelangen, in Gesprächen<br />
an Unbefugte weitergegeben oder von Unbefugten mitgehört werden.<br />
5.2. Die nicht organisationsinternen Informationen müssen entsprechend ihrer Schutzwürdigkeit<br />
eingestuft und behandelt werden. Siehe dazu auch die Richtlinie „Festlegungen“.<br />
5.3. Vertrauliche und streng vertrauliche Unterlagen bzw. Datenträger mit solchen Inhalten dürfen<br />
nicht unbeaufsichtigt offen liegen und sind stets unter Verschluss zu halten, wenn sie<br />
nicht benötigt werden.<br />
5.4. Bei auch kurzfristigem Verlassen des Arbeitsplatzes, ist der Arbeitsplatzrechner zu sperren<br />
(Tastenkombination ++>Entf> und „Lock Workstation“). Diese Maßnahme ist<br />
zum Schutz der Integrität und der Vertraulichkeit der Informationen (Änderung bzw. Einsicht<br />
durch Unbefugte) unbedingt nötig.<br />
5.5. Nach Besprechungen müssen alle Unterlagen mit vertraulichem oder streng vertraulichem<br />
Inhalt (Flipcharts etc.) aus Besprechungszimmern entfernt bzw. dort unter Verschluss gebracht<br />
werden.<br />
5.6. Unterlagen / Datenträger müssen immer, vor allem auch beim Versand, so behandelt werden,<br />
dass sie gegen Verlust, Beschädigung und Zerstörung ausreichend gesichert sind.<br />
5.7. So weit dies möglich ist, müssen Datenträger so eindeutig gekennzeichnet sein, dass der<br />
Inhalt und die Art der Daten eindeutig erkenntlich ist.<br />
5.8. Der Versand oder die elektronische Übertragung von vertraulichen oder streng vertraulichen<br />
Informationen muss so erfolgen, dass unerwünschte Offenlegung, Verlust oder fehlerhafte<br />
Weiterleitung verhindert wird.<br />
5.9. Für den Transport vertraulicher / streng vertraulicher Unterlagen / Datenträgern müssen<br />
speziell gesicherte Behältnisse verwendet werden. Der Transport soll persönlich überwacht<br />
werden.<br />
5.10. Nicht mehr benötigte Unterlagen / Datenträger müssen in dafür bereitgestellten Entsorgungseinrichtungen<br />
vernichtet werden. Siehe auch Kanzleiordnung.<br />
5.11. Zur Wiederverwendung vorgesehene, ausgebaute Festplatten müssen so gelöscht werden,<br />
dass keine organisationsinternen Daten auf dem Datenträger verbleiben.<br />
5.12. Arbeitsmittel, Informationen oder Software dürfen nicht ohne Genehmigung aus dem jeweiligen<br />
Amtsgebäude entfernt werden. Im Bedarfsfall müssen Arbeitsmittel abgemeldet und<br />
bei der Rückbringung wieder angemeldet werden. Die unberechtigte Entfernung von Eigentum<br />
des Landes Oberösterreich wird mittels Stichproben überprüft.<br />
Sicherheitszonen<br />
5.13. Bestimmte Örtlichkeiten können zu Sicherheitszonen erklärt werden. Der Zugang zu solchen<br />
Bereichen wird mit Zutrittskontrolle eingeschränkt und protokolliert. Die Identifikation<br />
bzw. Authentisierung für den Zutritt zu geschützten Bereichen erfolgt im allgemeinen mittels<br />
Zeiterfassungskarte.<br />
5.14. Die Zugangsrechte zu Sicherheitszonen sind regelmäßig, mindestens jährlich, zu überprüfen.<br />
5.15. Fremde Personen, das sind solche, die nicht Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Landes<br />
Oberösterreich sind oder deren Tätigkeitsbereich nicht in den besonders geschützten Bereichen<br />
liegt, dürfen diese nur in Begleitung von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern mit Zutrittsberechtigung<br />
betreten bzw. sich darin bewegen.<br />
5.16. Besucher haben sich im Zweifelsfall zu legitimieren. In einem Besuchsbuch ist jeder Besucher<br />
mit der Zeit seines Kommens und Gehens sowie dem Zweck seines Besuches oder<br />
dem Namen des Besuchten einzutragen.<br />
5.17. Die Verwendung von Fotoapparaten (auch von Mobiltelefonen mit entsprechender Ausstattung<br />
als Kamera) sowie von Video-, Audio- oder anderen Aufzeichnungseinrichtungen in<br />
Sicherheitszonen ist an die ausdrückliche Genehmigung durch die Dienststellenleiterin<br />
bzw. den Dienststellenleiter gebunden.<br />
138
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Zugangsschutz bei Möbeln und Räumen<br />
5.18. Schreibtische und Schränke müssen bei Verlassen des Raumes verschlossen werden,<br />
falls sie vertrauliche / streng vertrauliche Unterlagen / Datenträger enthalten oder wenn lokale<br />
Regelungen dies erfordern.<br />
5.19. Für Unbefugte zugängliche Arbeitsräume, in denen sich niemand befindet, müssen auch<br />
bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes abgeschlossen und der Schlüssel abgezogen<br />
werden. Dies gilt auch für Neben-, Akten- und Betriebsräume.<br />
5.20. Schlüssel müssen sicher aufbewahrt werden.<br />
Informationssicherheit beim Telefonieren<br />
5.21. Bei dienstlichen Telefongesprächen, insbesondere außerhalb der Arbeitsräume oder in der<br />
Öffentlichkeit, muss darauf geachtet werden, dass keine Unbefugten vertrauliche oder<br />
streng vertrauliche Informationen mithören können.<br />
Schutz vertraulicher / streng vertraulicher Faxinhalte<br />
5.22. Wenn vertrauliche / streng vertrauliche Unterlagen durch Fax übermittelt werden, muss<br />
sichergestellt sein, dass keine Unbefugten Zugriff auf die Unterlagen erhalten. Durch ein<br />
Testfax kann sichergestellt werden, dass die Adressatin bzw. der Adressat auch tatsächlich<br />
erreicht wird.<br />
5.23. Aufgrund des Abhörrisikos sollen vertrauliche Informationen nur dann mittels Fax versendet<br />
werden, wenn sie verschlüsselt sind. Streng vertrauliche Informationen dürfen mit Fax<br />
nur verschlüsselt übertragen werden.<br />
5.24. Damit eingehende, vertrauliche Faxsendungen Unbefugten nicht zugänglich werden, müssen<br />
solche Faxgeräte zutrittsgeschützt aufgestellt werden. Darüber hinaus muss, soweit<br />
technisch möglich, ein mittels PIN steuerbarer Speicherschutz aktiviert sein.<br />
Informationssicherheit beim Drucken, Kopieren und Scannen<br />
5.25. Vertrauliche / streng vertrauliche Unterlagen dürfen auf frei zugänglichen Druckern nur<br />
ausgegeben werden, wenn sichergestellt ist, dass die Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich<br />
sind, z.B. durch persönliches Überwachen des Druckvorganges.<br />
5.26. Nach dem Kopieren / Scannen von vertraulichen / streng vertraulichen Unterlagen muss<br />
darauf geachtet werden, dass keine Vorlagen im Kopierer / Scanner zurückgelassen werden.<br />
5.27. Fehlkopien von vertraulichen / streng vertraulichen Unterlagen müssen vernichtet werden.<br />
5.28. Vergessene Vorlagen, Kopien oder Ausdrucke anderer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter<br />
müssen diesen zugestellt oder, falls diese nicht ermittelt werden können, vernichtet werden.<br />
Zugang / Zugriff bei IT-Systemen<br />
5.29. Soweit zum Zugang zu informationstechnischen Systemen, einzelnen Anwendungen oder<br />
auch schützenswerten Dateien Schutzmechanismen wie z.B. Kennungen mit Passwort,<br />
PIN oder Chipkarte bestehen, müssen diese entsprechend der dafür im einzelnen vorgegebenen<br />
Regelungen eingesetzt werden.<br />
5.30. Die Deaktivierung oder Umgehung von voreingestellten Sicherheitseinstellungen, Schutzmechanismen,<br />
Filtern oder ähnlichem ist untersagt.<br />
Nutzung von Internet / Intranet<br />
5.31. Siehe dazu die Richtlinie „Internet“<br />
Schutz vor Computerviren<br />
5.32. Die im Merkblatt „Computerviren“ gegebenen Hinweise sind zu beachten.<br />
Datensicherung<br />
5.33. Daten auf Servern oder Serversystemen werden regelmäßig gesichert. Daten, die sich auf<br />
Festplatten von Arbeitsplatzrechnern oder Notebooks befinden, werden grundsätzlich nicht<br />
139
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
zentral gesichert. Eine allfällige Sicherung dieser Inhalte (dazu zählen auch Favoritenlisten<br />
etc.) ist Sache der jeweiligen Anwenderin bzw. des jeweiligen Anwenders.<br />
Elektronische Kommunikation<br />
5.34. Regelungen zur Informationssicherheit bei der Nutzung von E-Mail befinden sich in der<br />
Richtlinie „E-Mail (elektronische Post)“.<br />
Nutzung von IT-Systemen außerhalb der organisationseigenen Räumlichkeiten<br />
5.35. Der Einsatz dienstlicher IT-Systeme außerhalb der organisationseigenen Räumlichkeiten<br />
muss vorab genehmigt werden.<br />
5.36. Regeln für den Einsatz mobiler IT-Systeme befinden sich in den Richtlinien „Notebooks“<br />
und dem Standard für den „Einsatz von Organizern und PDAs“ (im Intranet unter )<br />
5.37. Für Fernzugänge zum Intranet dürfen nur die im konkreten Fall genehmigten und eingerichteten<br />
Dienste verwendet werden. Siehe auch Richtlinie „Desktops“.<br />
6. Referenzen:<br />
Richtlinie „Festlegungen“<br />
Richtlinie „Internet“<br />
Merkblatt „Computerviren“<br />
Richtlinie „E-Mail (elektronische Post)“<br />
Richtlinie „Desktops“<br />
Richtlinie „Notebooks“<br />
Standard für den „Einsatz von Organizern und PDAs“<br />
Standard für den „Einsatz von Multifunktionsgeräten (MFGs)“<br />
140
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Daten"<br />
1. Ziel:<br />
Die Speicherung von Daten ist unter verschiedenen Aspekten zu sehen:<br />
• Datenschutzgesetz<br />
• E-Government-Gesetz<br />
• Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit<br />
• Dateneigentümerschaft<br />
• „private“ und "dienstliche" (persönliche bzw. Dienststellen-) Daten<br />
• Kosten der Speicherung<br />
Der Datenhaltung ist daher in dem Maß Aufmerksamkeit zu schenken, dass dem Land Oberösterreich<br />
kein Schaden in ideeller und / oder materieller Hinsicht entstehen kann.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte.<br />
4. Begriffe:<br />
Dienstliche Daten:<br />
Dienstliche Daten sind persönliche Daten und Dienststellendaten.<br />
• Dienststellendaten:<br />
Sämtliche Daten, die in Vollziehung der dienstlichen Aufgaben entstehen (z.B. aktenrelevantes<br />
Schriftgut) und daher weder persönlich noch privat sind.<br />
• Persönliche Daten:<br />
Dienstliche Daten, die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind und daher auch nicht stellvertretungsrelevant<br />
sein können (z.B. Daten, die noch im Entwurfstadium stehen).<br />
Private Daten:<br />
Daten, die der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter persönlich gehören und in die sonst grundsätzlich<br />
niemand Einsicht nehmen darf.<br />
5. Regeln:<br />
Eigentümer:<br />
5.1. Daten haben grundsätzlich einen Eigentümer. Generell ist der Eigentümer aller nicht privaten<br />
Daten (dienstliche Daten) das Land Oberösterreich. In der Praxis werden die Dienststellenleiterinnen<br />
und Dienststellenleiter oder von ihnen beauftragte Personen als Dateneigentümer<br />
tätig.<br />
5.2. Der Dateneigentümer (Dienststellenleiterin bzw. Dienststellenleiter oder von ihr bzw. ihm<br />
beauftragte Person) muss für jede Art der in seinem Bereich anfallenden oder verarbeiteten<br />
Daten nach den Anforderungen an Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit eine<br />
Klassifikation vornehmen. Die Klassifikation erfolgt im Rahmen der Risikoanalyse gemeinsam<br />
mit der der Abteilung Informationstechnologie und hat direkte Auswirkung auf die Verarbeitung,<br />
Speicherung und Sicherung der Daten.<br />
141
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5.3. Die Speicherung von privaten Daten auf Speichermedien, die dem Land Oberösterreich<br />
gehören, ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Speicherung von privaten Daten im geringen<br />
Umfang wird jedoch im Rahmen des Punktes 5.10. geduldet. Von der Duldung sind jedenfalls<br />
Daten, die geltendes Recht verletzen (Urheberrecht, Lizenzrecht etc.) ausgenommen.<br />
5.4. Eine Einsichtnahme in Daten und Programme, die Bedienstete verwenden, ist ohne deren<br />
Zustimmung nur dann zulässig, wenn<br />
• die Einsichtnahme im Rahmen der Dienstaufsicht von der Dienststellenleiterin bzw. dem<br />
Dienststellenleiter (bzw. im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht) schriftlich angeordnet<br />
wird,<br />
• gleichzeitig die Personalvertretung von dieser Anordnung verständigt wird,<br />
• die Personalvertretung bei der Dateneinsicht anwesend ist und<br />
• die bzw. der Bedienstete über die Einsichtnahme informiert wird.<br />
Diese Information hat – sofern sie nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist –<br />
bei anwesenden Bediensteten spätestens zu Beginn der Einsichtnahme, bei abwesenden<br />
Bediensteten spätestens unmittelbar nach deren Rückkehr durch die/den Vorgesetzte/n zu<br />
erfolgen. (Siehe dazu auch Anhang 6 zu § 51)<br />
5.5. Daten werden, zu Zwecken der Datensicherung und Archivierung, immer mehrfach gespeichert.<br />
Die Speichermedien verursachen hohe Kosten. Es ist daher dafür Sorge zu tragen,<br />
dass keine unnötigen Daten abgelegt werden. Unnötige Daten wären z.B. jederzeit aus<br />
anderen Quellen re-konstruierbare Daten oder primär mehrfach gespeicherte Daten.<br />
5.6. Aus technischen Gründen ist für Systemadministratorinnen und Systemadministratoren der<br />
volle Zugriff auf alle Daten möglich, allerdings nicht erlaubt, es sei denn, ein derartiger<br />
Zugriff ist für die Aufrechterhaltung des Betriebs unabdingbar. Dies ist nur dann der Fall,<br />
wenn Gefahr im Verzug vorliegt. Jeder in diesem Zusammenhang missbräuchliche Zugriff<br />
stellt eine Dienstpflichtverletzung dar. Sollen Daten abgespeichert werden, bei denen auch<br />
eine unabsichtliche Einsichtnahme verhindert werden muss, stehen dafür grundsätzlich<br />
Möglichkeiten mit Verschlüsselungstechniken zur Verfügung.<br />
„I: Laufwerk“:<br />
5.7. Das im Bereich der IT des Landes Oberösterreich so genannte „I: Laufwerk“ dient der<br />
Speicherung von „persönlichen“ Daten, nicht von „privaten“ Daten. Dateneigentümer ist die<br />
Dienststelle bzw. das Land Oberösterreich.<br />
5.8. Bei Wechsel einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters von einer Dienststelle in eine andere<br />
geht das Zugriffsrecht auf das jeweilige „I: Laufwerk“ zur alten Dienststelle über. Der<br />
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter wird in der neuen Dienststelle ein neues „I: Laufwerk“<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
5.9. Beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters aus dem Landesdienst geht<br />
das Zugriffsrecht auf ihr bzw. sein „I: Laufwerk“ auf die Dienststelle über.<br />
Private Daten:<br />
5.10. Private Daten dürfen nur – in geringem Umfang – auf lokalen Datenträgern („C:Laufwerk“)<br />
gespeichert werden bzw. sind allenfalls als E-Mail im Netzwerk vorhanden. Private E-Mails<br />
dürfen nicht auf einen anderen Datenträger, der im Eigentum des Landes Oberösterreich<br />
steht, ausgelagert und in der Mailbox nicht in größerem Umfang gespeichert werden.<br />
5.11. Dem Land Oberösterreich ist der Zugriff auf die Mailboxen seiner Bediensteten – unter<br />
Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses laut Telekommunikationsgesetz – eingeräumt.<br />
Dies kann z.B. im Fall einer längeren Abwesenheit vom Dienst zum Zweck der Sichtung<br />
von dienstlichen Daten (nicht private Mails) oder im Rahmen einer Einsicht nach Anhang<br />
6 zu § 51 erforderlich sein. Private E-Mails sind daher auf das Nötigste zu beschränken.<br />
Zur Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses laut Telekommunikationsgesetz<br />
wird daher empfohlen, private Mails eindeutig als privat zu kennzeichnen. Dies kann durch<br />
voranstellen von "Privat:" im Betreff erfolgen. Eine Einsichtnahme in solche Daten ist ohne<br />
Zustimmung der Bediensteten nur unter den in Punkt 5.4. genannten Bedingungen zulässig.<br />
Die dienstliche Notwendigkeit des Zugriffs auf die Mailboxen der Bediensteten bzw.<br />
des Bediensteten muss durch die Dienststellenleiterin bzw. den Dienststellenleiter, die Abteilung<br />
Präsidium und die Personalvertretung gemeinsam festgestellt werden. Vorher muss<br />
142
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
jedoch versucht werden die Zustimmung der bzw. des Bediensteten einzuholen. Eine Einsichtnahme<br />
in Daten nach Punkt 5.11. ist im Übrigen nur unter den im Punkt 5.4. genannten<br />
Voraussetzungen zulässig.<br />
6. Referenzen:<br />
• Einsicht in von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern verwendete Daten und Programme (26. Februar<br />
2004)<br />
143
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Desktops"<br />
1. Ziel:<br />
Desktop-PCs (standortfeste Arbeitsplatzrechner) haben einerseits unter Umständen sensible Daten,<br />
wenigstens vorübergehend, lokal gespeichert, stellen andererseits durch die ihre Einbindung<br />
in das interne Netzwerk für mögliche Angreifer den Zugang zur gesamten IT des Landes Oberösterreich<br />
dar.<br />
Die Desktop-PCs stellen weiters eine wichtige Basis für die Tätigkeit der Bediensteten der Landesverwaltung<br />
dar. Ein falscher Umgang kann zu Ausfall an Arbeitszeit führen und zudem die<br />
Ressourcen der für diese Geräte zuständigen Mitarbeiter einschränken.<br />
Die hier angeführten Richtlinien sind strikt einzuhalten, um die Datensicherheit und die Qualität<br />
sowie die Produktivität der Arbeit der Bediensteten des Landes Oberösterreich zu gewährleisten.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Benutzer eines Desktop-PC.<br />
4. Begriffe:<br />
Dienstliche Geräte: IT-Systeme und zugehörige Komponenten, die der Dienstnehmerin bzw. dem<br />
Dienstnehmer vom Land Oberösterreich zur Erledigung ihrer bzw. seiner Aufgaben zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
5. Regeln:<br />
5.1. Arbeitsplatzrechner dürfen nur in der von der Abteilung Informationstechnologie vorgegebenen<br />
Konfiguration ohne Aktivierung zusätzlicher oder Deaktivierung vorgesehener Komponenten<br />
verwendet werden. Die eigenmächtige Installation oder Deinstallation von Software,<br />
Treibern etc. ist – sofern sich aus anderen Richtlinien bzw. Standards nicht anderes<br />
ergibt - untersagt.<br />
5.2. Die Nutzung eines dienstlichen Arbeitsplatzrechners für private Zwecke während der<br />
Dienstzeit ist grundsätzlich untersagt.<br />
Eine private Verwendung im geringen Ausmaß, wobei die Speicherung der Daten lokal<br />
erfolgen muss, wird geduldet. Die Verwendung von Outlook zur Speicherung auch privater<br />
Termine, Kontakte oder Notizen sowie die Verwendung von E-Mail wird ebenfalls im geringen<br />
Umfang geduldet. Siehe auch die Richtlinie „E-Mail“.<br />
5.3. Die Verwendung eines dienstlichen Arbeitsplatzrechners durch Personen, die nicht Bedienstete<br />
des Landes Oberösterreich sind, ist untersagt, sofern diese Verwendung nicht in<br />
dienstlichem Zusammenhang erfolgt.<br />
5.4. Die Verwendung von nicht dienstlichen Geräten am Desktop-PC ist nicht gestattet. Ausgenommen<br />
davon sind USB-Geräte zum Datenaustausch im dienstlichen Interesse.<br />
Für kleine, mobile Datenendgeräte (PDAs, Handhelds, Smart Phones) etc. gilt der im Intranet<br />
unter dargestellte Standard für den „Einsatz von Organizern<br />
und PDAs“.<br />
5.5. Bildschirme sind vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen.<br />
5.6. Bei auch kurzfristigem Verlassen des Arbeitsplatzes, ist der Arbeitsplatzrechner zu sperren<br />
(Tastenkombination ++>Entf> und „Lock Workstation“). Diese Maßnahme ist<br />
144
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
zum Schutz der Integrität und der Vertraulichkeit der Informationen (Änderung bzw. Einsicht<br />
durch Unbefugte) unbedingt nötig.<br />
5.7. Wenn Daten vom Arbeitsplatzrechner auf Wechseldatenträger (Disketten, USB-Speicher)<br />
oder PDAs gespeichert werden, sind im Umgang bzw. der Verwendung dieser Datenträger<br />
die Anforderungen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes zu berücksichtigen (siehe<br />
die Richtlinie „Arbeitsplatz / Arbeitsmittel“).<br />
5.8. Diese Standards gelten ebenso für Arbeitsplatzrechner von Tele-Arbeitern, sofern diese<br />
Geräte vom Land Oberösterreich beigestellt wurden.<br />
6. Referenzen:<br />
Standard für den „Einsatz von Organizern und PDAs“<br />
Richtlinie „Arbeitsplatz / Arbeitsmittel“<br />
Richtlinie „E-Mail (elektronische Post)“<br />
145
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Notebooks"<br />
1. Ziel:<br />
Durch die Verwendung von Notebooks (mobilen Personalcomputern) kann die Produktivität der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitunter stark erhöht werden.<br />
Gleichzeitig entsteht dadurch aber ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.<br />
Bei mobilen Computern sind vor allem drei Sicherheitsbereiche zu berücksichtigen:<br />
- Schutz vor Diebstahl des Gerätes, das einen erheblichen Wert darstellt, dadurch, dass es tragbar<br />
ist, aber leicht entwendet werden kann.<br />
- Schutz vor ungesichertem Andocken an fremde Netze und damit der Gefahr der Verseuchung<br />
durch Schadensoftware.<br />
- Schutz der Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind, vor Verlust, Diebstahl oder unberechtigtem<br />
Zugriff.<br />
Durch die Einhaltung der folgenden Regeln werden die angeführten Risiken beim Betrieb von<br />
Notebooks minimiert.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Benutzer eines Notebooks, Leiterinnen und Leiter von Dienststellen, in denen Notebooks verwendet<br />
werden.<br />
4. Regeln:<br />
4.1. Alle Regeln für die Verwendung von Desktop Geräten sind sinngemäß einzuhalten, siehe<br />
die Richtlinie „Desktops“.<br />
4.2. Notebooks sind empfindlich gegen mechanische Einwirkung und sind daher nach Möglichkeit<br />
nur in einer dafür vorgesehenen Tasche zu transportieren und entsprechend aufzubewahren<br />
(z.B. Schutz vor Erschütterung, Staub, Hitze, Feuchtigkeit, …).<br />
4.3. Die Herstellerangaben zum richtigen und sicheren Gebrauch des Notebooks sind zu beachten.<br />
4.4. Unbeaufsichtigte Notebooks sind gesichert zu verwahren, z. B. durch Absperren des Zimmers,<br />
Einschließen des Notebooks in Schreibtisch oder Kasten oder Verwendung eines<br />
Kensington-Schlosses.<br />
Beim Transport in einem Kraftfahrzeug soll, und wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt ist,<br />
darf das Notebook von außen nicht sichtbar sein (Abdecken bzw. Einschließen in den Kofferraum.<br />
Hier ist jedoch zu beachten, dass das Einschließen des Notebooks in den Kofferraum<br />
beim endgültigen Abstellen des Fahrzeuges z.B. auf einem Parkplatz beobachtet<br />
werden kann und Diebe gerade dadurch zu einem Einbruch motiviert werden können).<br />
4.5. Im mobilen Betrieb des Notebooks ist die bzw. der jeweilige Bedienstete persönlich für die<br />
Aktivierung des Virenscanners und die regelmäßige Überprüfung der Aktualität der Signaturdateien<br />
bzw. für das entsprechende Update verantwortlich.<br />
4.6. Daten, die im Außendienst auf dem Notebook entstanden sind oder abgespeichert wurden<br />
sind so schnell als möglich auf ein geeignetes Netz-Laufwerk zu übertragen, oder, falls<br />
dies nicht möglich ist, anders zu sichern (z.B. USB-Stick). Daten, die für das konkrete Arbeiten<br />
außerhalb des festen Arbeitsplatzes nicht benötigt werden, sind zu löschen.<br />
4.7. Notebooks, auf denen sich sensible Daten befinden, deren Missbrauch durch Dritte zu<br />
großen Schäden führen könnte (personenbezogene Daten, Finanzdaten, Daten politischer<br />
146
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Büros etc.), sind mit einer Zusatz-Software auszustatten, die die gesamte Festplatte verschlüsselt.<br />
Die Fest-platte kann dann nur gelesen werden, wenn ein entsprechendes<br />
Passwort eingegeben wird.<br />
4.8. Bei Notebooks, die nicht mit einer Festplattenverschlüsselung betrieben werden, ist das<br />
Start-Up Passwort zu aktivieren. Als Passwort kann ein Gruppenpasswort verwendet werden,<br />
das von der IT-Koordinatorin bzw. dem IT-Koordinator für die Abteilung festgelegt<br />
wird.<br />
4.9. Allfällige im Notebook eingebaute Netzwerkkomponenten (W-LAN, Modem, Blue Tooth)<br />
dürfen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Abteilung Präsidium und nach<br />
der Installation allfälliger zusätzlicher Schutzprogramme aktiviert bzw. betrieben werden.<br />
4.10. Ohne besondere Genehmigung durch die Abteilung Präsidium darf das Notebook ausschließlich<br />
im Netzwerk des Landes Oberösterreich betrieben werden. Der Betrieb des Notebooks<br />
in einem fremden Netz ohne eine durch die Abteilung Informationstechnologie installierte<br />
und konfigurierte Personal Firewall ist in jedem Fall untersagt.<br />
4.11. Ein Verlust des Notebooks ist umgehend der Abteilung Informationstechnologie / Servicedesk<br />
zu melden.<br />
5. Referenzen<br />
Richtlinie „Desktops“<br />
147
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "E-Mail (elektronische Post)"<br />
1. Ziel:<br />
E-Mail (elektronische Post) ist zu einem wichtigen Kommunikationsmedium geworden. Wegen der<br />
Effektivität und der Geschwindigkeit soll dem E-Mail-Verkehr der Vorrang gegenüber Briefpost<br />
oder Fax (sofern dem nicht technische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe entgegenstehen)<br />
eingeräumt werden.<br />
Durch falschen oder fahrlässigen Gebrauch dieses Mediums kann aber großer Schaden für das<br />
Land Oberösterreich entstehen. Die Einhaltung der hier beschriebenen Regeln ist daher unbedingt<br />
erforderlich.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Führungskräfte.<br />
4. Begriffe:<br />
Attachments:<br />
Beilagen, die mit E-Mails versandt werden.<br />
Mailserver:<br />
IT-System, das für den Empfang und den Versand von E-Mails verantwortlich ist.<br />
Dienstliche E-Mail-Adressen:<br />
Dienstliche E-Mailadressen sind persönliche E-Mailadressen und Organisationspostfächer.<br />
• Organisationspostfach:<br />
E-Mail-Adresse einer Dienststelle (i.d.R. dienststelle.post@ooe.gv.at) bzw. sonst für den offiziellen<br />
Kundenverkehr bestimmte E-Mail-Adressen (z.B. buergerservice@ooe.gv.at), die keiner<br />
natürlichen Person zugeordnet sind.<br />
• Persönliche E-Mailadressen:<br />
E-Mailadressen der Domäne des Landes Oberösterreich, die Einzelpersonen (Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter) zugeordnet sind z.B. max.muster@ooe.gv.at<br />
Spam-Mails:<br />
Unverlangt versandte Mails, die in Massen auftreten. Meist Werbung<br />
5. Regeln:<br />
5.1. E-Mail dient der Kommunikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander sowie<br />
mit externen Stellen. Eine private Verwendung des dienstlichen Mail-Systems hat sich auf<br />
das Nötigste zu beschränken und darf den Dienstbetrieb nicht beeinträchtigen.<br />
5.2. Die Definition zusätzlicher, privater Mailserver in Mailclients auf dienstlichen Arbeitsplatzrechnern<br />
oder Notebooks ist nicht gestattet (z.B. POP3 Mail von privaten Providern).<br />
5.3. Auf der E-Mail-Adresse, die jeder Mitarbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter des Landes Oberösterreich<br />
zugeteilt wird, scheint neben dem Namen oder der Dienststelle auch das Land O-<br />
berösterreich selbst auf. Dienstliche E-Mail-Adressen dürfen daher niemals für Zwecke<br />
verwendet werden, die dem Ansehen des Landes Oberösterreich schaden könnten.<br />
148
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5.4. Das Auftreten von so genannten Spam-Mails kann nicht verhindert werden. Der Umgang<br />
mit Spam ist im Merkblatt „Behandlung von Spam“ ausgeführt. Die dort abgegebenen Empfehlungen<br />
sind nach Möglichkeit zu befolgen.<br />
5.5. Der elektronische Briefkasten ist vom Benutzer regelmäßig (wenn möglich wenigstens<br />
einmal täglich) auf den Eingang von E-Mails zu kontrollieren.<br />
Die Organisationspostfächer müssen, soweit möglich, mehrmals täglich überprüft werden.<br />
5.6. „Irrläufer“, also Mails, die von einem falschen oder unzuständigen Adressaten empfangen<br />
wurden, sind entsprechend weiterzuleiten. Lässt sich die richtige Adresse nicht feststellen,<br />
sind solche Mails an den Absender zurückzusenden.<br />
5.7. Streng vertrauliche Inhalte dürfen per Mail nur verschlüsselt versendet werden. Siehe dazu<br />
Merkblatt „E-Mail-Verschlüsselung“.<br />
5.8. Die Identität des Absenders ist nur dann gesichert, wenn die E-Mail mit einer elektronischen<br />
Signatur versehen ist und diese verifiziert wurde.<br />
5.9. Empfangsbestätigungen, wie sie im Mailclient konfiguriert werden können, sind nur intern<br />
wirksam und auch da nur, wenn der Empfänger dem Versand einer Empfangsbestätigung<br />
zustimmt.<br />
Da durch so eine Konfiguration aber das Datenaufkommen deutlich erhöht werden kann,<br />
ist davon abzusehen.<br />
5.10. Automatisch versendete Mitteilungen über Dienstabwesenheit („Out of Office Notifications")<br />
werden nur intern weitergegeben, um der Verbreitung von verifizierten Adressen für<br />
Spammer nicht Vorschub zu leisten oder möglichen Angreifern zeitweilig unbenützte User-<br />
Adressen zur Verfügung zu stellen. Der Versand solcher Mitteilungen ins Internet wird am<br />
Mailserver blockiert.<br />
Für längere Abwesenheiten ist eine entsprechende Vertretungsregel zu etablieren.<br />
5.11. Die Weitersendung von Kettenbriefen gleich welcher Art („echte“ Kettenbriefe, Falschmeldungen<br />
über Viren, „Tränendrüsen-Briefe“, Spendenaufrufe aller Art etc.) mit der dienstlichen<br />
E-Mail-Adresse ist grundsätzlich verboten. Im Zweifelsfall bietet die Webseite der TU<br />
Berlin weiterführende Information:<br />
http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax.shtml<br />
Eine Ausnahme von dieser Regel kann nur durch die Abteilung Präsidium genehmigt werden.<br />
5.12. Der Versand von E-Mails an alle Bediensteten darf nur über ausdrückliche Genehmigung<br />
der Abteilung Präsidium erfolgen. Diese kann im Einzelfall oder für bestimmte Benutzer erteilt<br />
werden.<br />
E-Mails, die an alle Bediensteten einer oder mehrerer Dienststellen gerichtet sind, dürfen<br />
nur von der Dienststellenleiterin bzw. dem Dienststellenleiter oder von ihr bzw. ihm autorisierten<br />
Personen (z.B. Sekretariat, IT-Koordinator, Personalvertretung, etc.) versandt werden.<br />
5.13. Mails im HTML-Format können versteckte Schadensfunktionen enthalten. Die Annahme<br />
solcher Mails wird daher von vielen Organisationen verweigert. Aus diesem Grund sind bei<br />
der Erstellung von dienstlichen E-Mails ausschließlich die Formate „Nur Text“ und „Rich<br />
Text“ erlaubt. Die Erstellung dienstlicher Mails im HTML-Format ist nicht gestattet.<br />
5.14. Dienstliche E-Mails müssen mit einer Absenderangabe versehen sein. Der Mailabsender,<br />
der vom Clientprogramm angezeigt wird, ist nicht ausschlaggebend, weil er leicht gefälscht<br />
werden kann. Die Absenderangabe (Signatur) hat jedenfalls Name, Dienststelle, Adresse<br />
der Dienststelle, E Mail-Adresse der Dienststelle (Post-Adresse), dienstliche Telefonnummer,<br />
dienstliche Fax-Nummer und die jeweilige DVR-Nummer zu enthalten. Weiters ist der<br />
Hinweis aufzunehmen, dass eine Übermittlung von rechtsgültigen Erklärungen nur über<br />
Organisationspostfächer möglich ist. Private Daten wie Wohnadresse, private Telefonnummern,<br />
Adressen privater Homepages etc. dürfen nicht enthalten sein. Die Absenderabgabe<br />
ist nach folgendem dem Corporate Design entsprechenden Muster durchzuführen.<br />
5.15. Bei externen Erledigung soll u.a. aus Gründen der Rechtsicherheit ein unveränderliches<br />
Dokumentenformat (z.B. PDF oder signierte Officedokumente) verwendet werden. Proprietäre<br />
Formate wie Office-Dokumente sollen nur dann verwendet werden, wenn der Empfänger<br />
die Dokumente weiter bearbeiten soll.<br />
149
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
5.16. Werden Schriftstücke (z.B. PDF-Dokumente) mit versandt, die zuvor elektronisch erzeugt<br />
wurden, ist der Zusatz „Dieses Schriftstück wurde elektronisch beurkundet“ anzubringen.<br />
5.17. Dienstlichen E-Mail-Adressen dürfen für News-Groups, Mailinglisten, Bestellungen, Versteigerungen<br />
etc. nur dann verwendet werden, wenn die Aktivitäten in diesen Bereichen<br />
ausschließlich im dienstlichen Interesse stehen und wenn damit dem Ansehen des Landes<br />
nicht geschadet wird.<br />
5.18. Bestimmte Dokumentenformate dürfen für Beilagen zu E-Mails (Attachments) nicht verwendet<br />
werden (z.B. ausführbare Programme etc.). Ebenso ist die zulässige Größe von<br />
ein- bzw. ausgehenden E-Mails und die maximale Anzahl von Attachments beschränkt.<br />
Genaueres ist der E-Mail-Policy der oö. Landesverwaltung und den Kommunikationsformaten<br />
der oö. Landesverwaltung (siehe www.land-oberoesterreich.gv.at → Kontakt → Kommunikationsformate)<br />
zu entnehmen.<br />
5.19. Wenn einer E-Mail Beilagen (Attachments) angefügt werden, so soll in der E-Mail auf diese<br />
Beilage ausdrücklich hingewiesen werden (Name, Dokumentenformat, Inhalt).<br />
5.20. Wenn einer empfangenen E-Mail Beilagen (Attachments) angefügt sind, auf die in der E-<br />
Mail nicht ausdrücklich und in plausibler Form eingegangen wurde, so ist beim Öffnen dieser<br />
Beilagen mit erhöhter Vorsicht vorzugehen.<br />
5.21. Bei dienstlichen Mails ist die Betreff-Angabe immer auszufüllen. Falls vorhanden ist die<br />
Aktenzahl der Erledigung anzuführen.<br />
5.22. Falls es im einzelnen Fall notwendig ist, soll der Adressat aufgefordert werden, eine Empfangsbestätigung<br />
per E-Mail (z.B. mit Hilfe der „Reply“-Funktion) zu senden.<br />
5.23. Die Größe einer Mailbox, d.h. der Platz, der für die Mails einer Mitarbeiterin bzw. eines<br />
Mitarbeiters am Mailserver benötigt wird, ist beschränkt. Alte E-Mails, gleich ob empfangene<br />
oder versendete, sind daher immer wieder zu löschen. Sollten sie noch benötigt werden,<br />
so können sie auf einem Datenträger gesichert oder in einen so genannten "persönlichen<br />
Ordner" übertragen werden.<br />
6. Referenzen:<br />
Merkblatt „Behandlung von Spam“<br />
Merkblatt „E-Mail-Verschlüsselung“<br />
Information über Kettenbriefe: http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax.shtml<br />
E-Mail-Policy und Kommunikationsformate der oö. Landesverwaltung<br />
150
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Merkblatt "E-Mail Verschlüsselung"<br />
1. Einleitung:<br />
E-Mails, die über das Internet versandt werden, können grundsätzlich an jedem Knotenpunkt gelesen<br />
bzw. auch verändert werden. Aus diesem Grund ist das Versenden von Mails mit vertraulichem<br />
oder streng vertraulichem Inhalt nicht zulässig.<br />
Solche Inhalte dürfen nur per Post, durch Boten oder per verschlüsseltem E-Mail übermittelt werden.<br />
2. Verschlüsselungsverfahren:<br />
Für das Verschlüsseln von E-Mails gibt es mehrere Methoden, verwendet wird allerdings fast ausschließlich<br />
das Private-Public-Key Verfahren. Zum Verschlüsseln und Entschlüsseln werden dabei<br />
verschiedene Schlüssel (Key's) verwendet. Der zum Verschlüsseln dienende öffentliche Schlüssel<br />
(Public Key) kann über beliebige unsichere Kanäle übermittelt werden (Datenträger, E-Mail, Internet<br />
etc.). Zum Entschlüsseln, also Lesen einer Nachricht wird der private Schlüssel (Private Key)<br />
verwendet. Dieser verbleibt beim Besitzer und wird niemals an andere übermittelt.<br />
3. Vorgang bei der Verschlüsselung:<br />
Um verschlüsselte E-Mails austauschen zu können, muss jeder Mail-Partner ein Schlüsselpaar<br />
bestehend aus einem geheimen und einem öffentlichen Schlüssel besitzen. Während der geheime<br />
Schlüssel sorgfältig geschützt nur dem Anwender selbst zur Verfügung stehen sollte, ist der öffentliche<br />
Schlüssel an alle Kommunikationspartner zu verteilen.<br />
Wenn „Anton“ eine verschlüsselte E-Mail an „Beatrice" senden will, nimmt er den öffentlichen<br />
Schlüssel von „Beatrice“. „Beatrice“ kann mit ihrem privaten Schlüssel, den nur sie besitzt, die<br />
Nachricht entschlüsseln.<br />
Ebenso im umgekehrten Fall. Wenn „Beatrice“ eine verschlüsselte Nachricht an „Anton“ senden<br />
will, nutzt sie den öffentlichen Schlüssel von „Anton“, um die Nachricht zu chiffrieren. Nur „Anton“<br />
kann diese E-Mail mit seinem geheimen Schlüssel dechiffrieren und lesen.<br />
4. Schlüsselgenerierung:<br />
Für das Private-Public-Key Verfahren gibt es verschiedene Implementierungen wie PGP (Pretty<br />
Good Privacy), GNU-PG (GNU Privacy Guard) oder X 509 Zertifikate. Während PGP und GNU-<br />
PGP, bei dem die Schlüssel vom Benutzer generiert werden, vor allem im privaten Bereich verwendet<br />
wird, kommen im Unternehmensbereich, so auch beim Land Oberösterreich, vor allem X<br />
509 Zertifikate zum Einsatz.<br />
Die Zertifikate müssen von einer so genannten CA (Certificate Authority) ausgestellt werden.<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Oberösterreich erhalten für Verschlüsselung geeignete<br />
X 509 Zertifikate durch die Abteilung Informationstechnologie.<br />
Die Partner, mit denen der verschlüsselte Mailverkehr durchgeführt werden soll, müssen sich ein<br />
geeignetes Zertifikat bei einem Trust-Center ausstellen lassen (z.B. a-trust, Verisign etc.). Die Zertifikate<br />
sind im Allgemeinen kostenpflichtig, es gibt jedoch einige Zertifizierungsdiensteanbieter,<br />
die diesen Dienst kostenlos anbieten.<br />
Auf der Bürgerkarte ist ebenfalls ein Verschlüsselungszertifikat enthalten. Hier muss allerdings<br />
darauf geachtet werden, dass im Zertifikat die Mailadresse vermerkt ist, zu der verschlüsselte<br />
Mails gesandt werden können. Bei einer privaten Bürgerkarte wird das im Normalfall die private<br />
Mailadresse sein. Solche Bürgerkarten wären daher nicht geeignet.<br />
151
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Internet"<br />
1. Ziel:<br />
Das Internet spielt eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikation sowie der Beschaffung von Information.<br />
Gleichzeitig birgt das Internet aber auch große Gefahren für die innere Sicherheit der IT, für das<br />
Ansehen des Landes Oberösterreich und für die Privatsphäre.<br />
Durch das Einhalten dieser Regeln werden die Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb des<br />
Internets geschaffen.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte.<br />
4. Begriffe:<br />
Abrufen:<br />
Aus dem Intranet des Landes Oberösterreich auf im Internet vorhandene Informationen zugreifen.<br />
Herunterladen:<br />
Englisch „Download“. Übertragung von Daten von der angewählten Internetseite auf den eigenen<br />
Rechner.<br />
Internet Browser (Webbrowser):<br />
Computerprogramm zum betrachten von Web-Seiten im Internet.<br />
5. Regeln:<br />
5.1. Die Nutzung der Internet-Dienste dient dem Zugriff auf weltweit verfügbare Informationen<br />
und Daten, die für die Bewältigung der dienstlichen Aufgaben nötig sind.<br />
5.2. Die private Nutzung von Internetdiensten während der Dienstzeit ist grundsätzlich untersagt.<br />
Eine geringfügige Nutzung in der Dienstzeit wird aber toleriert.<br />
In der Freizeit (Ausstempeln!) steht der Zugriff zu den Internetdiensten allen Mitarbeiterinnen<br />
bzw. Mitarbeitern zur Verfügung. Es gelten jedoch die unten beschriebenen Einschränkungen<br />
auch in der Freizeit.<br />
5.3. Internet ist nicht anonym! Bei jeder Verbindung zu einem Webserver im Internet wird diesem<br />
bekannt, dass der Zugriff aus dem Netz des Landes Oberösterreich kommt. Jede Nutzung<br />
des Internets, die geeignet erscheint, den Interessen oder dem Ansehen des Landes<br />
Oberösterreich zu schaden oder die gegen geltende Gesetze verstößt, ist daher nicht zulässig.<br />
5.4. Beim Zugriff auf das Internet werden von verschiedenen Servern (Proxy, Firewall, Router)<br />
Verbindungsinformationen mitprotokolliert. Eine personenbezogene Auswertung dieser Dateien<br />
findet nur über begründetes Ersuchen einer Dienststellenleiterin bzw. eines Dienststellenleiters<br />
als auch – auf begründeten Verdacht – von Amts wegen im Rahmen der ü-<br />
bergeordneten Dienstaufsicht statt (siehe dazu auch den Anhang 6 zu § 51).<br />
5.5. Die Internet-Browser schreiben während der Verbindung zum Internet vielfache Informationen<br />
auf die Festplatte. Eine Auswertung dieser Daten ist nur nach den Regeln für die Ein-<br />
152
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
sicht in von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendeten Daten und Programmen zulässig<br />
(siehe dazu auch den Anhang 6 zu § 51).<br />
5.6. Grundsätzlich untersagt (auch in der Freizeit) ist beispielsweise der Zugriff auf Seiten<br />
mit/über<br />
1. Kriminelle Aktivitäten<br />
2. Glücksspiel<br />
3. Chat (mit Ausnahme des Chats des Landes Oberösterreich)<br />
4. Verfassungsfeindliche Inhalte<br />
5. Pornographie<br />
6. Rassistische oder sexistische Äußerungen<br />
5.7. Das Herunterladen (Download) von ausführbaren Dateien (Programmen) und Multimedia-<br />
Dateien (Musik, Filme) ist, auch in der Freizeit, nicht gestattet.<br />
5.8. Um die missbräuchliche Verwendung des Internet einzuschränken, ist der Internetzugang<br />
des Landes Oberösterreich mit einem Filter abgesichert, der den Zugriff auf viele Server,<br />
die nicht erwünschte Inhalte anbieten, sperrt. Sollte es aus dienstlichen Gründen notwendig<br />
sein, trotzdem auf solche Seiten zuzugreifen, so ist dazu eine Freischaltung durch die<br />
Abteilung Informationstechnologie erforderlich.<br />
Wenn Seiten vom Filter nicht gesperrt werden, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass<br />
der Zugriff auf diese Seiten gestattet ist. Eine Umgehung des Filters ist nicht zulässig.<br />
5.9. Von der Abteilung Informationstechnologie voreingestellte Parameter des Internet-<br />
Explorers dürfen nicht verändert werden.<br />
6. Referenzen:<br />
Anhang 6 zu § 51<br />
153
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie Outlook – Kalender (Terminführung)<br />
1. Ziel:<br />
Die elektronische Terminvereinbarung und Kalenderführung ist wie E-Mail (beides wird in der oö.<br />
Landesverwaltung durch das Softwareprodukt Microsoft Outlook zur Verfügung gestellt) zu einem<br />
wichtigen Kommunikationsmedium geworden. Die elektronische Terminvereinbarung sollte von<br />
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dienstliche Termine verwendet werden. Damit verbunden<br />
ist freilich auch die elektronische Kalenderführung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei<br />
hier auch die Möglichkeit gegeben sein soll, unter Beachtung der Privatsphäre, private Termine<br />
ebenfalls zu führen.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte.<br />
4. Begriffe:<br />
Attachments:<br />
Beilagen, die mit Terminanfragen versandt bzw. die Termineinträgen beigefügt werden.<br />
Dienstliche Termineinträge:<br />
Das sind jene Termineinträge, die zu dienstlichen Zwecken via Terminanfrage in Outlook eingetragen<br />
werden bzw. die die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter selbst einträgt und jeweils nicht als<br />
„privat“ gekennzeichnet sind.<br />
Dienstliche Abwesenheit:<br />
Jede Abwesenheit während der Regeldienstzeit sowie alle Abwesenheiten, die in Erfüllung der<br />
Dienstpflicht auch außerhalb der Regeldienstzeit erfolgen.<br />
Exchange Central:<br />
Exchange Central ist ein Zusatzprodukt für Outlook-Kalender, das eine bessere Übersichtlichkeit<br />
bei der Führung von Gruppenkalendern ermöglicht. Für Exchange Central gelten die gleichen Bestimmungen<br />
wie für Outlook-Kalender.<br />
Kalendereinsicht:<br />
Outlook ermöglicht durch Vergabe von Zugriffsrechten, dass andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
die Termine im Kalender einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters einsehen (bzw. wenn gewünscht<br />
bei entsprechenden Rechten auch verändern) können. Damit ist ein dienstlicher Termin<br />
auch inhaltlich (Betreff, Ort, Anmerkungen, ...) sichtbar.<br />
Private Termineinträge:<br />
Das sind jene Termineinträge, die via Terminanfrage in Outlook eingetragen werden bzw. die die<br />
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter selbst einträgt und als „privat“ gekennzeichnet sind.<br />
Terminanfragen:<br />
Unter Terminanfragen sind Anfragen zur Besprechungsteilnahme zu verstehen, die mittels Outlook-Kalender<br />
an potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Termins (z.B.: einer Besprechung)<br />
via E-Mail versandt werden. Zum Zwecke der Terminanfrage werden die eingetragenen<br />
154
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Termine aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Balkenansicht als belegt ("abwesend", "gebucht",<br />
"mit Vorbehalt") oder nicht belegt "frei" angezeigt. Inhalte der Termine werden dabei nicht<br />
angezeigt.<br />
5. Regeln:<br />
5.1. Die elektronische Terminanfrage dient der dienstlichen Terminabstimmung der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter untereinander. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihr E-<br />
Mail-Postfach regelmäßig (wenn möglich wenigstens einmal täglich) auf den Eingang von<br />
Terminabfragen (wie E-Mails) zu kontrollieren.<br />
5.2. Wenn dies die jeweilige Dienststellenleitung zum Zweck der Erleichterung von Terminanfragen<br />
für zweckmäßig hält und die örtliche Personalvertretung zustimmt, sind sämtliche<br />
dienstliche Abwesenheiten von den Bediensteten im Outlook-Kalender einzutragen.<br />
5.3. Durch Zustimmung des jeweiligen Mitarbeiters bzw. der jeweiligen Mitarbeiterin kann den<br />
Vorgesetzten und/oder den jeweiligen Sekretariaten (Vorzimmer) bzw. den sonstigen mit<br />
der Terminkoordination befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Outlook-Kalender<br />
einsehbar gemacht werden. Diese Rechtevergabe durch die Bediensteten ist nicht verpflichtend.<br />
Bei der entsprechende Rechtevergabe sind die IT-Koordinatorinnen und Koordinatoren<br />
behilflich.<br />
5.4. Sofern eine Rechtevergabe gemäß Punkt 5.3. nicht erfolgt, sind die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter verpflichtet, ihre dienstlichen Abwesenheiten im jeweiligen Sekretariat (Vorzimmer)<br />
bzw. bei sonstigen mit der Terminkoordination befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
bekannt zu geben, um eine allfällige Erreichbarkeit sicher zu stellen.<br />
5.5. Eine nachträgliche Erfassung bzw. die Korrektur dienstlicher Kalender ist nicht erforderlich.<br />
5.6. Sofern eine Rechtevergabe gemäß Punkt 5.3. erfolgt ist, sind bei dienstlichen Terminen<br />
der Betreff und der Ort anzugeben.<br />
5.7. Outlook-Kalender dient der Terminkoordination der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander<br />
sowie mit externen Stellen. Die Verwendung von Outlook-Kalender zur Führung<br />
von privaten Terminen wird zum Zwecke der gemeinsamen und koordinierten Terminverwaltung<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestattet.<br />
5.8. Bei Terminen und Terminanfragen sind Attachments tunlichst zu vermeiden, da diese zusätzlichen<br />
Speicherplatz in der Mailbox belegen. Sind zu Terminen etc. Beilagen erforderlich,<br />
sollen diese getrennt per E-Mail versandt werden. Umfangreiche Beilagen bzw. solche<br />
mit großem Speicherplatzbedarf sind gesondert (z.B. Netzlaufwerke, Tauschserver, CD,<br />
etc.) unter Hinweis auf die Fundstelle zur Verfügung zu stellen.<br />
6. Referenzen:<br />
Richtlinie "E-Mail (elektronische Post)"<br />
155
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Richtlinie "Blackberry-Endgeräte"<br />
1. Ziel:<br />
Durch die Verwendung von Blackberry-Endgeräten (im Folgenden Blackberrys genannt) kann die<br />
Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitunter stark erhöht werden.<br />
Gleichzeitig entsteht dadurch aber ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.<br />
Bei mobilen Computern sind vor allem drei Sicherheitsbereiche zu berücksichtigen:<br />
- Schutz vor Diebstahl des Gerätes, das einen erheblichen Wert darstellt, dadurch, dass es tragbar<br />
und klein ist und dadurch leicht entwendet werden kann.<br />
- Schutz vor ungesichertem Andocken an fremde Netze und damit der Gefahr der Verseuchung<br />
durch Schadensoftware.<br />
- Schutz der Daten, die auf dem Gerät lokal gespeichert sind, vor Verlust, Diebstahl oder unberechtigtem<br />
Zugriff.<br />
Durch die Einhaltung der folgenden Regeln werden die angeführten Risiken beim Betrieb von<br />
Blackberrys minimiert.<br />
2. Geltungsbereich:<br />
Diese Richtlinie gilt für alle Bediensteten des Landes Oberösterreich, die unter den Geltungsbereich<br />
der <strong>DBO</strong> fallen, bzw. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen, denen die in<br />
diesem Zusammenhang maßgeblichen Bestimmungen (vertraglich) überbunden wurden.<br />
3. Verantwortlichkeit:<br />
Alle Benutzer von Blackberrys, Leiterinnen und Leiter von Dienststellen, in denen Blackberrys<br />
verwendet werden.<br />
4. Regeln:<br />
4.1 Alle Regeln für die Verwendung von Desktop Geräten sind sinngemäß einzuhalten, siehe<br />
die Richtlinie "Desktops“ und die Richtlinie "Notebooks".<br />
4.2 Blackberrys sind empfindlich gegen mechanische Einwirkung und sind daher nach Möglichkeit<br />
nur in einer dafür vorgesehenen Tasche zu transportieren und entsprechend aufzubewahren<br />
(z.B. Schutz vor Erschütterung, Staub, Hitze, Feuchtigkeit, …).<br />
4.3 Die Herstellerangaben zum richtigen und sicheren Gebrauch des Blackberrys sind zu beachten.<br />
4.4 Blackberrys sind zu beaufsichtigen. Soweit eine Beaufsichtigung aus zwingenden Gründen<br />
ausnahmsweise nicht möglich ist, sind alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen<br />
Diebstahl des Blackberrys zu vermeiden.<br />
4.5 Da sich auf Blackberrys so wie auf Mobiltelefonen unter anderem vertrauliche Daten (personen-bezogene<br />
Daten wie Telefonnummern, Mailadressen, Daten politischer Büros, etc.)<br />
befinden können, deren Missbrauch durch Dritte zu großem Schaden führen könnte, werden<br />
alle Daten die sich auf dem Gerät befinden automatisch verschlüsselt.<br />
4.6 Blackberryanwender/innen können selbst auswählen, ob sie ihr Gerät entweder versperrt<br />
und damit geschützt (und durch Eingabe eines Passworts wieder entsperrbar) oder permanent<br />
entsperrt benutzen. In der Standardeinstellung ist der Blackberry passwortgeschützt!<br />
Wird der Blackberry mit aktivierter Sicherheitsfunktion betrieben, dann wird er nach Ablauf<br />
von 30 Minuten automatisch gesperrt.<br />
Beim ungeschützten Betrieb können bei Verlust oder Diebstahl des Geräts die darauf<br />
gespeicher-ten Daten (E-Mails, Dateien, Adressen, Kalendereinträge) in die Hände von<br />
Unbefugten geraten können. Die Verantwortung trägt der/die Anwender/in.<br />
156
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
4.7 Allfällige im Blackberry eingebaute Netzwerkkomponenten (W-LAN, Modem, Blue Tooth)<br />
dürfen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Abteilung Informationstechnologie<br />
und nach der Installation allfälliger zusätzlicher Schutzprogramme aktiviert bzw. betrieben<br />
werden. Die Verwendung von Blue Tooth ist ausschließlich zum Betreiben der Telefon-Freisprecheinrichtung<br />
erlaubt und daher entsprechend konfiguriert.<br />
4.8 Ohne besondere Genehmigung durch die Abteilung Informationstechnologie darf der<br />
Blackberry ausschließlich mit der voreingestellten Systemkonfiguration betrieben werden.<br />
4.9 Ein Verlust des Blackberry ist umgehend der Abteilung Informationstechnologie / Servicedesk<br />
zu melden. In diesem Falle werden sämtliche Daten auf diesem Gerät per Fernwartung<br />
komplett gelöscht.<br />
4.10 Die eigenmächtige Installation von Software wird durch Systemeinstellungen unterbunden.<br />
Wird eine zusätzliche Software benötigt, ist diese im Dienstweg anzufordern.<br />
5. Referenzen:<br />
Richtlinie „Desktops“<br />
Richtlinie "Notebook"<br />
157
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 5 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Vorkehrungen für Datenschutz und Datensicherheit<br />
1. Grundsätze:<br />
• Daten-Verantwortung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters:<br />
Die Verantwortung für die Daten und Informationen, die von einer Dienststelle verarbeitet<br />
werden, liegt bei der Dienststellenleiterin bzw. beim Dienststellenleiter.<br />
Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter trägt somit insbesondere die Verantwortung,<br />
- dass in der Dienststelle Daten rechtmäßig im Sinne des Datenschutzgesetzes verarbeitet<br />
werden,<br />
- dass nur jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Daten zugreifen können, die sie auch<br />
wirklich zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen,<br />
- dass Daten nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen des Datenschutzgesetzes 2000<br />
verwendet und insbesondere an andere übermittelt werden dürfen,<br />
- dass Daten ausreichend gesichert werden, wenn in der Dienststelle eine dezentrale Datenverarbeitungsanlage<br />
(Rechenanlage, Fileserver etc.) installiert ist und die Daten nicht ohnehin<br />
als Dienstleistung von der Abteilung Informationstechnologie gesichert werden,<br />
- dass die Richtlinien zur Informationssicherheit eingehalten werden,<br />
- dass nur Programme verwendet werden, an denen das Land Oberösterreich das Nutzungsrecht<br />
hat,<br />
- dass alle in der Dienststelle bestehenden Verarbeitungen dokumentiert sind (bei regelmäßiger<br />
Verwendung personenbezogener Daten muss die Dokumentation in Form einer Datenverarbeitungsregister-Meldung<br />
erfolgen) und<br />
- dass die DVR-Meldungen zum Zweck der Registrierung im Datenverarbeitungsregister<br />
(DVR) an die Datenschutzkommission erstattet werden.<br />
Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter hat in Wahrnehmung dieser Verantwortung<br />
entsprechende Dienstanweisungen zu treffen.<br />
• Abgrenzung zu den Aufgaben der Abteilung Informationstechnologie und der Abteilung<br />
Präsidium:<br />
Aufgabe der Abteilung Informationstechnologie ist es, technische und organisatorische Hilfestellung<br />
zu leisten. Die Abteilung Informationstechnologie ist in diesem Zusammenhang ausschließlich<br />
als Dienstleister (im Auftrag der jeweiligen Dienststelle) tätig.<br />
Die Abteilung Präsidium<br />
- berät auf Anforderung der Dienststelle in datenschutzrechtlichen Fragen,<br />
- unterstützt die Organisationseinheiten bei der Administration der DVR-Meldungen (DVR-<br />
Meldung erfolgt durch die Organisationseinheit unter Mitbeteiligung der Abteilung Präsidium)<br />
und<br />
- fungiert als Kontrollinstanz bezüglich der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung, bei den Bezirkshauptmannschaften und der Agrarbezirksbehörde.<br />
Abgesehen von diesen Aufgaben der Abteilung Informationstechnologie und der Abteilung<br />
Präsidium liegt die Verantwortung für wirksame Vorkehrungen für Datenschutz und Datensicherheit<br />
letztlich bei der Dienststellenleiterin bzw. beim Dienststellenleiter.<br />
• Abgrenzung zu den Aufgaben der IT-Koordinatorin bzw. des IT-Koordinators:<br />
Falls sich die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter durch eine IT-Koordinatorin bzw.<br />
einen IT-Koordinator unterstützen lässt, kann diese bzw. dieser die operative Tätigkeit auch<br />
im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheits- bzw. Informationssicherheitsvorkeh-<br />
159
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
rungen übernehmen; die Verantwortung für die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit dieser Maßnahmen<br />
liegt aber weiterhin bei der Dienststellenleiterin bzw. beim Dienststellenleiter.<br />
• Daten-Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der oö. Landesverwaltung haben Daten aus Datenanwendungen,<br />
die ihnen ausschließlich aufgrund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut<br />
wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet der Amtsverschwiegenheit und sonstiger<br />
gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger<br />
Grund für eine Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen Daten besteht<br />
(Datengeheimnis).<br />
Das Datengeheimnis ist auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses zum Land Oberösterreich<br />
einzuhalten.<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Daten nur aufgrund einer generellen oder konkreten<br />
(im Einzelfall erteilten) Anforderung der Vorgesetzten bzw. des Vorgesetzten übermitteln.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Richtlinie zur Informationssicherheit einzuhalten.<br />
2. Datenschutz und Datensicherheit im Online-Betrieb:<br />
Unter Online-Betrieb versteht man die Arbeit von Anwenderinnen bzw. Anwendern an einem Bildschirm<br />
oder Personalcomputer. Im Online-Betrieb werden Informationen unmittelbar verarbeitet<br />
(Abfragen, Erstellung eines Bescheides, Erfassen von Daten usw.).<br />
a. Benutzerberechtigung (User-ID) und Passwort:<br />
Um sicherzustellen, dass nur solche Anwenderinnen und Anwender Zugang zu den Daten<br />
haben, zu deren Nutzung sie auch berechtigt sind, stellen Informationssysteme (Datenverarbeitungsanlagen,<br />
Netzwerke usw.) technische Hilfsmittel zur Verfügung, mit deren Hilfe ein<br />
solcher Zugang gestattet, aber auch verwehrt werden kann.<br />
Gegenüber solchen Systemen identifiziert sich eine Anwenderin bzw. ein Anwender mit ihrer<br />
bzw. seiner Benutzeridentifikation, die einen symbolischen Namen, den die Benutzerin bzw.<br />
der Benutzer im System trägt, darstellt. Solche Benutzeridentifikationen werden eingerichtet<br />
um einerseits eine eindeutige Identifikation gegenüber einem Informationssystem zu gewährleisten<br />
(mehrere natürliche Personen könnten den gleichen Familiennamen haben) und andererseits<br />
den Änderungsaufwand in Grenzen halten zu können (Namensänderung bei Verehelichung<br />
usw.).<br />
Da eine solche Benutzeridentifikation wie ein Name öffentlich bekannt ist, ist ein weiteres<br />
Merkmal nötig, das in der Lage ist, einem Informationssystem zu zeigen, dass es wirklich die<br />
berechtigte Anwenderin bzw. der berechtigte Anwender ist, der Zugang zu den Daten sucht.<br />
Zu diesem Zweck wird bei einer Anmeldung bei einem Informationssystem (das ist der Vorgang,<br />
bei dem sich die Anwenderin bzw. der Anwender gegenüber dem System identifiziert<br />
und bei dem seine Berechtigungen mit bestimmten Daten zu arbeiten, überprüft werden) zusätzlich<br />
zu der Benutzeridentifikation der Anwenderin bzw. des Anwenders ein Merkmal, das<br />
nur sie bzw. er selbst kennen kann, verlangt. Dieses zusätzliche Merkmal ist ein Passwort.<br />
Passwörter nehmen, solange sicherere Methoden wie Chipkarten oder biometrische Verfahren<br />
(sofern rechtlich zulässig) nicht mit vertretbarem Aufwand zu implementieren sind, eine<br />
zentrale Stellung unter den Sicherheitsvorkehrungen ein, die für IT-Systeme eingerichtet werden<br />
können. Durch Passwörter wird nicht nur generell der Zutritt in ein System geregelt (in ein<br />
Netzwerk oder in einen Netzwerkabschnitt, zu einem Arbeitsplatzrechner bzw. einem Notebook,<br />
zu einem Server, zu besonderen Funktionen, zu bestimmten Daten). Die richtige und<br />
sorgfältige Verwendung von Passwörtern ist auch von großer Bedeutung für die IT-Sicherheit.<br />
160
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Mit Angabe dieser zwei Identifikationsmerkmale (Benutzeridentifikation und Passwort) kann<br />
eine Anmeldung beim Informationssystem durchgeführt werden. Bei diesem Vorgang wird die<br />
Zusammengehörigkeit und Richtigkeit der beiden Merkmale überprüft und der Zugang zu Anwendungen<br />
und Daten gestattet oder, wenn Benutzeridentifikation oder Passwort falsch sind,<br />
verweigert.<br />
Eine Benutzeridentifikation wird über Auftrag der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters<br />
von der Abteilung Informationstechnologie oder nach einem von dieser Abteilung zur<br />
Verfügung gestellten Standardverfahren für die eigene Dienststelle von der IT-Koordinatorin<br />
bzw. vom IT-Koordinator eingerichtet. Dabei wird von der Abteilung Informationstechnologie<br />
gleichzeitig ein Passwort, das der Benutzeridentifikation entspricht, vergeben. Diese Kombination<br />
erlaubt es einer neuen Anwenderin bzw. einem neuen Anwender nach vorheriger expliziter<br />
Freischaltung, sich bei einem Informationssystem anzumelden. Sie bzw. er wird dann vom<br />
System aufgefordert, ihr bzw. sein Passwort zu ändern, sodass ab diesem Zeitpunkt sichergestellt<br />
ist, dass nur mehr sie bzw. er die richtige Kombination kennt.<br />
Auch der Abteilung Informationstechnologie ist es nicht möglich, ein Passwort einer Anwenderin<br />
bzw. eines Anwenders auszulesen, ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT<br />
und IT-Koordinatorinnen bzw. IT-Koordinatoren für ihre Dienststelle sind aber in der Lage, ein<br />
Passwort neu zu vergeben. Dies geschieht dann, wenn eine Anwenderin bzw. ein Anwender<br />
ihr bzw. sein Passwort vergessen hat.<br />
Verbunden mit einer Benutzeridentifikation ist das Recht, bestimmte Anwendungen auf einem<br />
bestimmten Rechner (Großrechner, Personalcomputer, Fileserver, …) zu benützen und bestimmte<br />
Daten zu verarbeiten. Dabei kann es Abstufungen geben. Es kann etwa einer Anwenderin<br />
bzw. einem Anwender nur das Lesen (ansehen) der Daten gestattet werden, während<br />
eine andere bzw. ein anderer diese Daten erfassen, ändern und löschen darf. Auch diese<br />
(unterschiedlichen) Rechte werden von der Abteilung Informationstechnologie auf Anforderung<br />
der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters eingerichtet. Da es dafür erforderlich<br />
ist, Kenntnis über die technischen Zusammenhänge hinsichtlich der Zugriffsmethode und<br />
der Art der Speicherung der Daten zu haben, wird die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter<br />
bei der Anforderung entweder von der zuständigen Kundenbetreuerin bzw. vom zuständigen<br />
Kundenbetreuer oder von der zuständigen Projektleiterin bzw. vom zuständigen<br />
Projektleiter der Abteilung Informationstechnologie oder von der IT-Koordinatorin bzw. vom IT-<br />
Koordinator der Dienststelle unterstützt.<br />
Für den Umgang mit Passwörtern ist die Informationssicherheits-Richtlinie "Passwörter" anzuwenden.<br />
b. Verantwortung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters bei EDV-<br />
Anwendungen im Online-Betrieb:<br />
- Die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter hat die Abteilung Informationstechnologie<br />
(oder die IT-Koordinatorin bzw. den IT-Koordinator) mit der Einrichtung der erforderlichen<br />
Benutzeridentifikation schriftlich zu beauftragen und die damit verbunden Zugriffsberechtigungen<br />
festzuhalten.<br />
- Es liegt in der Verantwortung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters für die<br />
Einhaltung der Informationssicherheits-Richtlinie "Passwörter" zu sorgen.<br />
3. Datenschutz und Datensicherheit im Stapel-Betrieb:<br />
Bestimmte EDV-Anwendungen, die Rechenanlangen stark belasten und allenfalls mehrere Stunden<br />
dauern, laufen nicht im Online-Betrieb oder in lokalen Netzwerken, sondern meist in betriebsarmen<br />
Zeiten (Nacht, Wochenende etc.) im so genannten Stapelbetrieb am Großrechner ("Batch-<br />
Betrieb").<br />
Im Unterschied zum Onlinebetrieb werden dabei Datenerfassung, Verarbeitung und Auswertung<br />
der Daten nicht durch die Dienststelle sondern durch die Abteilung Informationstechnologie vorgenommen.<br />
161
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
a. Auftrag für Arbeiten der Abteilung Informationstechnologie:<br />
Die Dienststelle gibt eine Verarbeitung im Stapelbetrieb mit dem "Anforderungs- und Begleitschein<br />
" in Auftrag. Mit diesem Anforderungs- und Begleitschein werden auch Auswertungen<br />
beauftragt.<br />
Falls auch Datenerfassungsarbeiten durch die Abteilung Informationstechnologie durchzuführen<br />
sind, beauftragt die Dienststelle diese Arbeiten, indem sie die Erfassungsbelege mit einem<br />
"Belegübernahmeschein" an die Abteilung Informationstechnologie übermittelt.<br />
Die beiden Formulare werden von der Abteilung Informationstechnologie nach Bedarf zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Jede Dienststellenleiterin bzw. jeder Dienststellenleiter hat schriftlich festzulegen, welche Bediensteten<br />
die genannten Formulare verwenden und damit Aufträge an die Abteilung Informationstechnologie<br />
erteilen dürfen.<br />
b. Auslieferung von Auswertungen, die von der Abteilung Informationstechnologie erteilt<br />
wurden:<br />
EDV-Auswertungen aus dem Stapelbetrieb werden von der Abteilung Informationstechnologie<br />
auf zwei verschiedene Arten zur Verfügung gestellt:<br />
- Bereitstellung von EDV-Auswertungen über das Schließfach:<br />
Die Dienststelle erhält einen Schlüssel zu einem Schließfach, über das die EDV-<br />
Auswertungen für die jeweilige Dienststelle zur Verfügung gestellt werden. Ab der Zurverfügungstellung<br />
im Schließfach trägt die Dienststelle die Verantwortung für die Auswertungen.<br />
Diese Form kommt für Dienststellen mit häufigen aber geringen Auswertungsmengen und<br />
mit kurzem Weg in die Abteilung Informationstechnologie in Betracht.<br />
- Versand von EDV-Auswertungen mit der Dienstpost:<br />
Die angeforderten EDV-Auswertungen werden auf Gefahr der Dienststelle mit der Dienstpost<br />
übermittelt.<br />
- Ausnahmen:<br />
Dienststellen, die über ein Schließfach verfügen, können ausnahmsweise Auswertungen<br />
auf eigene Gefahr auch mit der Dienstpost erhalten. In diesem Fall ist der Vermerk "MIT<br />
DIENST-POST" auf dem Anforderungs- und Begleitschein anzubringen oder die Arbeitsvorbereitung<br />
tele-fonisch (0732/7720-13111) zu verständigen.<br />
Dienststellen, die üblicherweise EDV-Auswertungen mit der Dienstpost erhalten, können<br />
diese ausnahmsweise unmittelbar in der Abteilung Informationstechnologie abholen. In<br />
diesem Fall ist der Vermerk "WIRD ABGEHOLT" auf dem Anforderungs- und Begleitschein<br />
anzubringen oder die Arbeitsvorbereitung telefonisch zu verständigen. Soll eine Auswertung<br />
durch eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten abgeholt werden, der nicht anforderungsberechtigt<br />
ist, so hat die bzw. der anforderungsberechtigte Bedienstete eine Vollmacht<br />
auszustellen. Die Vollmacht ist bei der Abholung vorzuweisen; sie verbleibt in der<br />
Abteilung Informationstechnologie.<br />
c. Verantwortung der Dienststellenleiterin bzw. des Dienststellenleiters bei EDV-<br />
Anwendungen im Stapelbetrieb:<br />
- Änderungen der Berechtigung gemäß Z 1 erfolgen ebenfalls durch eine von der Dienststellenleiterin<br />
bzw. vom Dienststellenleiter unterschriebene Änderungsmeldung.<br />
- Falls Auswertungen über das Schließfach abgeholt werden, hat die Dienststellenleiterin<br />
bzw. der Dienststellenleiter festzulegen, welche Bedienstete bzw. welcher Bedienstete sie<br />
bzw. er zur Verfügung über das Schließfach ermächtigt.<br />
- Falls der Schlüssel für ein Schließfach verloren geht, hat die Dienststelle die Abteilung Informationstechnologie<br />
unverzüglich darüber zu informieren.<br />
162
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 6 zu § 51 <strong>DBO</strong><br />
Einsicht in von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendete<br />
Daten und Programme durch den Dienstgeber<br />
Die Unterzeichner dieser Regelung weisen darauf hin, dass Daten über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
durch die beteiligten Organisationseinheiten nur nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige<br />
Weise verwendet werden (§ 6 Abs. 1 Z. 1 DSG 2000).<br />
Die folgenden Regelungen präzisieren diesen gesetzlich angeordneten Grundsatz des Vertrauensschutzes<br />
und der Rechtmäßigkeit. Verstöße gegen diese Regelung stellen eine Dienstpflichtverletzung<br />
dar.<br />
A) Allgemeine Regelungen<br />
1. Verwahrung von Geschäftsstücken<br />
Sofern nicht eine strengere Regelung gilt (z.B. über streng verrechenbare Drucksorten und Gegenstände,<br />
vertrauliche Geschäftsstücke, Verschlusssachen), sind Geschäftsstücke nach Möglichkeit<br />
so zu verwahren, dass sie zwar anderen Bediensteten auch in Abwesenheit der Verwahrerin<br />
bzw. des Verwahrers zugänglich sind, Unbefugten jedoch ein Zugriff verwehrt ist.<br />
2. Allgemeine Regeln für den Zugriff auf Daten und Programme<br />
a. Verwendung von Protokoll- und Dokumentationsdaten<br />
Protokoll- und Dokumentationsdaten dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die mit ihrem<br />
Ermittlungszweck – das ist die Kontrolle der Zulässigkeit der Verwendung des protokollierten<br />
oder dokumentierten Datenbestandes – unvereinbar sind. Unvereinbar ist insbesondere die<br />
Weiterverwendung zum Zweck der Kontrolle von Betroffenen, deren Daten im protokollierten<br />
Datenbestand enthalten sind oder zum Zweck der Kontrolle jener Personen, die auf den protokollierten<br />
Datenbestand zugegriffen haben, aus einem anderen Grund als jenem der Prüfung<br />
ihrer Zugriffsberechtigung, es sei denn, dass es sich um die Verwendung zum Zweck der<br />
Verhinderung oder Verfolgung eines Verbrechens nach § 278a StGB (Kriminelle Organisation)<br />
oder eines Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt,<br />
handelt.<br />
b) Einsichtnahme in Daten und Programme<br />
Für die Datenorganisation auf dem EDV-Arbeitsplatz gilt die grundsätzliche Regelung der<br />
<strong>DBO</strong>, nach der - ausgenommen die Fälle einer strengeren Regelung - Geschäftsstücke (hier:<br />
Daten bzw. EDV-Dokumente) so zu verwahren sind, dass sie zwar anderen Bediensteten<br />
auch in Abwesenheit des Verwahrers bzw. der Verwahrerin zugänglich sind, Unbefugten jedoch<br />
ein Zugriff verwehrt ist (§ 46).<br />
Eine Einsichtnahme in Daten und Programme, die Bedienstete verwenden, ist ohne deren<br />
Zustimmung nur dann zulässig, wenn<br />
- die Einsichtnahme im Rahmen der Dienstaufsicht von der Dienststellenleiterin bzw. vom<br />
Dienststellenleiter (bzw. im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht) schriftlich angeordnet<br />
wird und<br />
- gleichzeitig die Personalvertretung von dieser Anordnung verständigt wird und<br />
- wenn die Bedienstete bzw. der Bedienstete über die Einsichtnahme informiert wird. Diese<br />
Information hat – sofern sie nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist – bei<br />
anwesenden Bediensteten spätestens zu Beginn der Einsichtnahme, bei abwesenden Be-<br />
163
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
diensteten spätestens unmittelbar nach deren Rückkehr durch die Vorgesetzte bzw. den<br />
Vorgesetzten zu erfolgen.<br />
Diese Einsichtnahme ist entsprechend zu protokollieren (Datum, Name oder User-ID der Bediensteten<br />
bzw. des Bediensteten, Begründung der Einsichtnahme). Der Bediensteten bzw.<br />
dem Bediensteten ist eine Ausfertigung des Protokolls zu übergeben.<br />
c) Einsatz von Werkzeugen für die Anwenderinnenbetreuung bzw. Anwenderbetreuung<br />
Die Verwendung von Werkzeugen für die Anwenderinnenbetreuung bzw. Anwenderbetreuung,<br />
die die Spiegelung des Bildschirminhaltes von EDV-Arbeitsplätzen zur jeweiligen Betreuerin<br />
bzw. zum jeweiligen Betreuer, Leitanwenderin bzw. Leitanwender bzw. EDV-<br />
Koordinatorin bzw. EDV-Koordinator ermöglichen (wie z.B. Netop, Citrix Spiegel-Konsole<br />
etc.), ist unter der Bedingung zu-lässig, dass dieser Einsatz nur nach vorangegangener ausdrücklicher<br />
Zustimmung seitens der jeweiligen Anwenderin bzw. des jeweiligen Anwenders<br />
bzw. nach persönlicher Freigabe des PCs durch die Anwenderin bzw. den Anwender selbst<br />
erfolgt.<br />
d) Überprüfung auf Verwendung nicht lizenzierter Software<br />
Auf EDV-Geräten des Landes Oberösterreich dürfen nur Programme eingesetzt werden, an<br />
denen das Land Oberösterreich ein Nutzungsrecht hat.<br />
Der Einsatz von so genannten "Raubkopien" von Computerprogrammen ist sowohl auf dienstlichen<br />
als auch auf allenfalls für dienstliche Zwecke verwendeten privaten Computern ausdrücklich<br />
untersagt.<br />
Urheberrechtsverletzungen können für die Unternehmensleitung, aber auch für einzelne Bedienstete<br />
zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.<br />
Über Auftrag des Präsidiums prüft das Rechenzentrum stichprobenartig, ob in den Organisationseinheiten<br />
nicht lizenzierte Software eingesetzt wird. Die Vorgangsweise erfolgt dabei<br />
analog Punkt A) 2. b) dieser Vereinbarung.<br />
3. Verwertungsverbot für personenbezogene Mitarbeiterdaten<br />
Personenbezogene Mitarbeiterdaten, die entgegen den Bestimmungen dieser Vereinbarung bekannt<br />
werden, dürfen nicht gegen die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter verwendet werden.<br />
4. Vorgangsweise bei eventuellem Änderungsbedarf der Regelungen<br />
Wird erkennbar, dass auf Grund der technisch-organisatorischen Umsetzung der gegenständlichen<br />
Reglungen oder auf Grund der technisch-organisatorischen Weiterentwicklung Änderungen<br />
der gegenständlichen Regelungen erforderlich werden könnten, so hat das Präsidium auf Grund<br />
einer Information durch die zu-ständige Organisationseinheit den Landespersonalausschuss darüber<br />
umgehend zu informieren.<br />
Die weitere Vorgangsweise ist daraufhin mit dem Landespersonalausschuss zu vereinbaren.<br />
B) Spezielle Regelungen<br />
1. Zeiterfassung<br />
Für Korrektur und Abfragen von Zeitbelegen ohne Zustimmung der Dienstnehmerin bzw. des<br />
Dienstnehmers wird Folgendes festgelegt:<br />
164
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Dienstnehmerin bzw.<br />
Dienstnehmer<br />
wer korrigieren abfragen<br />
Zeiterfassungsbeauftragte<br />
bzw. Zeiterfassungsbeauftragter<br />
bzw. Dienststellenleiterin<br />
bzw. Dienststellenleiter<br />
Zentrale Zeiterfassungsbeauftragte<br />
bzw. Zeiterfassungsbeauftragter<br />
Zeiterfassungskontrolle<br />
• laufendes Kalendermonat<br />
• zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
• laufendes Kalendermonat<br />
• zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
(nur nach Information des<br />
Dienstnehmers)<br />
• laufendes und vorangegangenes<br />
Kalenderjahr (nur nach Information<br />
des Dienstnehmers und nach<br />
Information der örtlichen Personalvertretung)<br />
• wie Zeiterfassungsbeauftragte<br />
bzw. Zeiterfassungsbeauftragter<br />
im Rahmen ihrer/seiner Befugnis<br />
als Leitanwenderin bzw. Leitanwender<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
• laufendes Kalendermonat und<br />
• zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
ohne Einschränkung<br />
• laufendes und vorangegangenes<br />
Kalenderjahr (nur nach Information<br />
der örtlichen Personalvertretung<br />
und des Dienstnehmers)<br />
• unbeschränkt im Rahmen ihrer<br />
Befugnis als Leitanwenderin bzw.<br />
Leitanwender (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
--- • laufendes Kalendermonat<br />
• zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
ohne Einschränkung<br />
• laufendes und vorangegangenes<br />
Kalenderjahr (nur nach Information<br />
der Dienstnehmerin bzw. des<br />
Dienstnehmers und Einhaltung<br />
des in § 10 Oö. L-PVG vorgesehenen<br />
Verfahrens)<br />
Die Zeiterfassungsdaten werden zentral gespeichert. Korrekturen durch zentrale Zeitbeauftragte<br />
werden elektronisch protokolliert, die Protokolle werden dem LPA monatlich zur Einsicht übermittelt.<br />
Abfragen der zentralen Zeitbeauftragten, die länger als zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
betreffen und berechtigte Interessen der Betroffenen berühren können, müssen von den zentralen<br />
Zeitbeauftragten protokolliert und die Protokolle dem LPA monatlich zur Einsicht übermittelt<br />
werden.<br />
Technisch werden die informations- bzw. mitwirkungsbedürftigen Korrekturen bzw. Abfragen folgendermaßen<br />
eingerichtet: Der Dienststellenleiter bzw. die Dienststellenleiterin genehmigt (nach<br />
Information des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin bzw. der örtlichen Personalvertretung)<br />
den Auftrag der Dienststelle an die Abteilung Informationstechnologie betreffend Datenfreigabe.<br />
Die Abteilung Informationstechnologie schaltet auf Grund dieses Auftrages die Arbeitszeitdaten<br />
(ohne Einschränkung auf eine bestimmte Personalnummer) für den Zeitbeauftragten bzw. die<br />
Zeitbeauftragte für drei Arbeitstage frei. Zulässig ist die Kontrolle der zeitlichen Mehrleistungen<br />
von Bezieherinnen bzw. Beziehern von Verwendungszulagen (mit zeitlichen Mehrleistungsanteil)<br />
oder pauschalierten Überstundenvergütungen für das vorangegangene Kalenderjahr bzw. die letzten<br />
12 Monate. 1<br />
2.Personalressourcenerfassung (PRE/CATS)<br />
Die geltenden Vereinbarungen bezüglich der Zeiterfassung werden nicht berührt.<br />
Aus technischen Gründen (Wartbarkeit, Schnittstelle, Redundanzen, Datensicherheit) ist es erforderlich,<br />
so wie auch bei der Zeiterfassung die Daten zentral zu speichern.<br />
Die Daten der einzelnen Dienststellen sind so abgeschottet, dass nur berechtigte Personen aus<br />
der jeweiligen Dienststelle Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben. Der "Supervisor" (der<br />
1<br />
Diese Ergänzung beruht auf dem Erlass vom 23. Juli 2007, PersI-450003/1065-2007-Kop/Pum.<br />
165
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Berechtigte pro Produktzentrum) muss die Möglichkeit haben, händische Eingaben (Programmabschluss)<br />
zu machen.<br />
Innerhalb der Dienststellen muss den Führungskräften zur Wahrnehmung der Dienstaufsicht der<br />
Zugang zu den Ressourcenzuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den einzelnen<br />
Leistungen und Aufträgen über den "Supervisor" ermöglicht werden. Nur dadurch kann auch dem<br />
Auftrag zur Dienstaufsicht und zur gezielten Steuerung des Personaleinsatzes durch die Führungskräfte<br />
nachgekommen werden. Daher sind innerhalb der Dienststellen zum Zwecke der<br />
Dienstaufsicht und für die Steuerung des Personaleinsatzes Auswertungen zulässig. Zum Zwecke<br />
der Steuerung von Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Dienststellen sollen Auswertungen<br />
jedoch aus der Kostenrechnung (CO-Modul von SAP/R3) herangezogen werden.<br />
Der "Supervisor" wird über allgemeinen Auftrag des Dienststellenleiters bzw. der Dienststellenleiterin<br />
(Leiter/in des Produktzentrums) tätig. Es ist dies eine analoge Vorgangsweise wie bei der<br />
Zeiterfassung.<br />
Alle in PRE/CATS erfassten Daten werden monatlich vom "Supervisor" ausgewertet (standardisiert):<br />
- Verteilung pro MA auf Produkt und Aufträge<br />
- Produktauswertungen inkl. der einzelnen MA-Zeiten darauf<br />
- Auftragsauswertungen inkl. der einzelnen MA-Zeiten<br />
Die Daten in PRE/CATS werden vier Monate nach Jahresabschluss gelöscht.<br />
Der Administrator als übergeordneter Koordinator hat Zugriff auf alle Daten in PRE/CATS. Er ist in<br />
der Finanzabteilung angesiedelt und wird im Auftrag der Abteilungsleiterin bzw. des Abteilungsleiters<br />
tätig. Die Aufgaben sind auf administrative Tätigkeiten (Anlegen neuer Produktzentren für<br />
PRE/CATS; Vergabe von Berechtigungen für "Supervisor" etc.) beschränkt, die auf Grund technischer<br />
Notwendigkeit erforderlich sind (analog der bestehenden Praxis bei der Zeiterfassung). Der<br />
Administrator ist nicht berechtigt, die personen-bezogenen Daten durch Verknüpfungen produktzentrumsübergreifend<br />
für eine übergeordnete Dienstaufsicht zu verwerten.<br />
Dem jeweiligen Personalvertretungsorgan sind die PRE/CATS-Daten zugänglich zu machen bzw.<br />
bekannt zu geben, wenn auf Grund dieser Daten vom Dienstgeber bzw. von der Dienststellenleiterin<br />
bzw. vom Dienststellenleiter oder der Vorgesetzten bzw. dem Vorgesetzten Maßnahmen getroffen<br />
werden sollen.<br />
3. Leistungserfassung<br />
Für Korrektur und Abfragen von Leistungserfassungsbelegen werden folgende Fristen festgelegt:<br />
wer korrigieren abfragen<br />
Dienstnehmerin bzw. Dienstnehmer<br />
Kostenrechnungsbeauftragte<br />
bzw. Kostenrechnungsbeauftragter<br />
bzw. Dienststellenleiterin<br />
bzw. Dienststellenleiter<br />
Zentrale Kostenrechnungsbetreuung<br />
– Leitanwender<br />
• laufendes Kalendermonat<br />
• zwei vorangegangene Kalendermonate<br />
(ausschließlich für<br />
Ergänzungen)<br />
• laufendes Kalenderjahr<br />
• vorangegangenes Kalenderjahr<br />
---<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
• laufendes Kalenderjahr<br />
• vorangegangenes Kalenderjahr<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
Kontrolle --- ---<br />
Die Leistungserfassungsdaten werden zentral gespeichert.<br />
166
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die Daten der einzelnen Dienststellen sind so abgeschottet, dass nur berechtigte Personen aus<br />
der jeweiligen Dienststelle Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben. Der/Die vom Dienststellenleiter<br />
bzw. der Dienststellenleiterin für die Leistungserfassung beauftragte Bedienstete (in<br />
aller Regel die Kostenrechnungsbeauftragte bzw. der Kostenrechnungsbeauftragte) muss die<br />
Möglichkeit haben, manuelle Eingaben (zum Periodenabschluss) zu machen.<br />
Innerhalb der Dienststellen muss den Führungskräften zur Wahrnehmung der unmittelbaren Führungsverantwortung<br />
der Zugang zu den Ressourcenzuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
zu den einzelnen Produkten und Aufträgen über die "Kostenrechnungsbeauftragte" bzw.<br />
den "Kostenrechnungsbeauftragten" ermöglicht werden. Nur dadurch kann auch dem Auftrag zur<br />
Dienstaufsicht und zur gezielten Steuerung des Personaleinsatzes durch die Führungskräfte<br />
nachgekommen werden. Daher sind innerhalb der Dienststellen zu Zwecken der Dienstaufsicht<br />
und für die Steuerung des Personaleinsatzes durch die Führungskräfte Auswertungen zulässig.<br />
Personenbezogene Daten aus solchen Auswertungen dürfen nicht veröffentlicht oder an Dritte<br />
weitergegeben werden.<br />
Zum Zweck der Steuerung von Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Dienststellen sollen<br />
Auswertungen aus der Kostenrechnung (und nicht aus der Leistungserfassung) herangezogen<br />
werden.<br />
Die/Der "Kostenrechnungsbeauftragte" wird über allgemeinen Auftrag des Dienststellenleiters/der<br />
Dienststellenleiterin (Leiterin/Leiter des Produktzentrums) tätig.<br />
Alle Leistungserfassungsdaten werden in periodischen Abständen in Bezug auf die Verteilung der<br />
Kostenträgerelemente je Mitarbeiter ausgewertet und in die Kostenrechnung übergeleitet.<br />
Die Leistungserfassungsdaten stehen maximal 24 Monate für Auswertungen direkt aus der Leistungserfassung<br />
zur Verfügung.<br />
Die Leitanwenderinnen bzw. Leitanwender der Finanzabteilung als übergeordnete Koordinatorinnen<br />
bzw. Koordinatoren haben Zugriff auf alle Daten im Arbeitszeitblatt; sie werden im Auftrag der<br />
Abteilungsleiterin bzw. des Abteilungsleiters tätig. Die Aufgaben sind auf fachliche und technische<br />
Unterstützung der Kostenrechnungsbeauftragten beschränkt. Aus technischer Sicht ist der Zugriff<br />
auf die Arbeitszeitdaten anderer Produktzentren durch die Leitanwenderinnen bzw. Leitanwender<br />
möglich. Die Leitanwenderinnen bzw. Leit-anwender sind aber nicht berechtigt, die personenbezogenen<br />
Daten im Arbeitszeitblatt durch produktzentrumsübergreifende Verknüpfungen auszuwerten<br />
bzw. zu verwerten.<br />
4. Reisemanagement<br />
Für Korrekturen und Abfragen von Reisemanagement-Belegen (Reiserechnungen) werden folgende<br />
Fristen festgelegt:<br />
Dienstnehmerin bzw.<br />
Dienstnehmer<br />
Wer korrigieren abfragen<br />
Personalabteilung (Reisestelle)<br />
Zentrale Besoldungsstelle,<br />
Abteilung Bau-Services<br />
• bis 6 Monate nach Einreichung<br />
(einschließlich Nachreichung von<br />
Unterlagen)<br />
• laufendes Kalenderjahr und vorangegangenes<br />
Kalenderjahr<br />
Die Reisemanagement-Daten werden zentral gespeichert.<br />
---<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
• unbeschränkt (solange die Daten<br />
im direkten Zugriff der Datenbank<br />
liegen)<br />
5. Einsatz der elektronischen Verfahrensinformation (EVI)<br />
a. EVI-Einsatz für Betriebsanlagenverfahren<br />
167
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Der Landespersonalausschuss stimmt dem Einsatz der elektronischen Verfahrensinformation<br />
(EVI) als Instrument der Verfahrensverfolgung und -steuerung im Bereich der Betriebsanlagengenehmigungen<br />
bei den Bezirkshauptmannschaften zu (Basis ist das vom Rechenzentrum<br />
entwickelte Programm sowie das dazu erstellte Anwenderhandbuch).<br />
b) Steuerung der Verfahren auf den BHen<br />
Auf den Bezirkshauptmannschaften haben alle zuständigen Bearbeiterinnen bzw. Bearbeiter<br />
(Schreibkräfte) sowie deren Vorgesetzte Zugang zu den Daten des EVI, um die Verfahren<br />
selbst und den damit verbundenen Personaleinsatz zu steuern. Unter Steuerungsmaßnahmen<br />
sind auch BH-interne Auswertungen zu verstehen. Eine Abstimmung der einzelnen internen<br />
Auswertungen der BHen ist sicherzustellen.<br />
c) Gemeinsame Auswertung<br />
Die Daten des EVI sind physisch auf die für die einzelnen BHen getrennten Datenbanken in der<br />
Abteilung Informationstechnologie abgelegt. Diese Daten der EVI-Anwendung für die einzelnen<br />
Bezirkshauptmannschaften werden auch - mit Ausnahme der Datenfelder Bearbeiter und Notizfeld<br />
der Oberbehörde (Abteilung Wirtschaft) zu Auswerte- und Analysezwecken zur Verfügung<br />
gestellt. Die Abteilung Wirtschaft wird im Einvernehmen mit Vertreterinnen bzw. Vertretern der<br />
Bezirkshauptmannschaften standardisierte Auswertungen (Berichtswesen) erstellen und diese<br />
Auswertungen den Bezirkshauptmannschaften regelmäßig zur Verfügung stellen. Zudem sind<br />
weitere Analysen und Auswertungen aus dem EVI-Datenbestand zulässig, Schlussfolgerungen<br />
aus dem standardisierten Berichtswesen und den zusätzlichen Auswertungen werden partnerschaftlich<br />
zwischen Vertretern der Bezirkshauptmannschaften und der Oberbehörde im Sinn<br />
eines Lernens vom Besten (Bench-Learning) gezogen.<br />
d) Umgang mit wettbewerbsrelevanten Daten<br />
Die Landesamtsdirektorin bzw. der Landesamtsdirektor strebt zudem eine Vereinbarung mit<br />
den Bezirkshauptleuten über den Umgang mit wettbewerbsrelevanten Daten (aus dem EVI und<br />
generell) an. Dadurch soll sichergestellt werden, dass es keine negativen Nebeneffekte durch<br />
das Bekannt-werden von wettbewerbsrelevanten Daten gibt (Alleingänge einzelner BHen, Profilierung<br />
auf Kosten anderer BHen).<br />
e) Weiterer EVl-Einsatz<br />
Die elektronische Verfahrensinformation (EVI) wurde als Programm so erstellt, dass es auch für<br />
an-dere Verwaltungsbereiche zur Steuerung und Lenkung der Verwaltungsverfahren Einsatz<br />
finden kann. Der LPA stimmt einem weiteren Einsatz von EVI in anderen Verfahrensbereichen<br />
zu, wenn folgende Vorgangsweise eingehalten wird:<br />
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Verwaltungseinheiten und der LPA<br />
werden zeitgerecht über den geplanten Einsatz des EVI für ihre Verwaltungsverfahren informiert.<br />
- Vor Einsatz des EVI in weiteren Verwaltungsverfahren muss das Anwenderhandbuch entsprechend<br />
adaptiert sein und vorliegen.<br />
- Für den Einsatz von EVI in anderen Verwaltungsverfahren gelten dieselben Rahmenbedingungen<br />
wie für den Einsatz von EVI im Bereich der Betriebsanlagenbewilligungen, insbesondere<br />
was die Auswertung und Analyse von Daten der Bezirkshauptmannschaften durch<br />
Oberbehörden (Fachabteilungen des Amtes der Oö. Landesregierung) betrifft.<br />
- Verwaltungseinheiten können auf freiwilliger Basis einen EVI-Einsatz für ihren Verwaltungsbereich<br />
in Pilotprojekten testen; dieser Piloteinsatz wird aber auf maximal ein Jahr beschränkt.<br />
Darüber hinausgehende EVI-Anwendungen haben entsprechend den unter e) angeführten<br />
Punkten zu erfolgen.<br />
6. Dokumentenmanagement in betriebswirtschaftlichen Systemen (wie z.B. SAP)<br />
Generell sind alle Prozessschritte in mehreren Protokolltabellen technisch in der SAP-Datenbank<br />
abgelegt. Die Auswertung dieser technischen Protokolle ist nur mit speziellen Berechtigungen<br />
(Transaktionen SWI* - System Workflow Information) möglich.<br />
168
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Diese technische Berechtigung wird benötigt, um Programm-, Ablauf- und Bedienungsfehler evaluieren<br />
zu können. In diesen SWI-Transaktionen werden auch verschiedene Auswertetransaktionen angeboten<br />
z.B.: durchschnittliche Liegezeit, durchschnittliche Bearbeitungsdauer, etc. pro User ID.<br />
SWI*-Transaktions-Berechtigungen sind nur für die Anwendungsbetreuerinnen bzw. Anwendungsbetreuer<br />
der Abteilung Informationstechnologie vorgesehen.<br />
Den Benutzern stehen zur Workflowsteuerung zwei verschiedene SAP-Zugänge zur Verfügung:<br />
a) WEB-User (Employee Self Service)<br />
Beim Workflow-unterstützten Arbeiten über WEB (Abwesenheiten, Reiseanträge, Arbeitszeitblatt,...)<br />
wird in zwei Aufgabenkategorien unterschieden:<br />
- Eigen gestartete Aufgabe: Hier kann der durchgängige Workflowprozess aller am Workflow<br />
beteiligten Benutzer angezeigt werden.<br />
- Fremd gestartete Aufgabe: Hier kann nur der eigene durchgeführte Prozessschritt angezeigt<br />
werden (von Fremden zugewiesenes Work-Item)<br />
b) SAP R/3 User (SAPGui)<br />
Auch hier sind so wie beim WEB die Aufgaben in zwei Kategorien unterteilt, wobei es jedoch<br />
zusätzliche Möglichkeiten der Workflowanzeige gibt. Hier können zusätzlich zu den zwei Kategorien<br />
auch noch die Belegnummer, Objektdienste und spezielle Transaktionen einzelner<br />
Workflowschritte oder Aufgaben ausgewertet werden.<br />
Innerhalb der Dienststellen ist den Führungskräften zur Wahrnehmung der unmittelbaren Führungsverantwortung<br />
und zur gezielten Steuerung des Personal- und Ressourceneinsatzes sowie<br />
für Benchmarking-Zwecke eine personenanonymisierte Auswertung möglich.<br />
Eine personenbezogene Auswertung der technischen Protokolle (SWI*-Transaktionen) ist ohne<br />
Zustimmung der Bediensteten nur dann zulässig, wenn<br />
- die Einsichtnahme im Rahmen der Dienstaufsicht von der Dienststellenleiterin bzw. vom<br />
Dienststellenleiter (bzw. im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht vom Präsidium)<br />
angeordnet wird und<br />
- gleichzeitig die örtliche Personalvertretung von dieser Anordnung verständigt wird und<br />
- wenn die/der Bedienstete über die Einsichtnahme informiert wird. Diese Information hat -<br />
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist - bei anwesenden Bediensteten<br />
spätestens zu Beginn der Einsichtnahme, bei abwesenden Bediensteten spätestens<br />
unmittelbar nach deren Rückkehr durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten zu<br />
erfolgen.<br />
Diese Einsichtnahme ist entsprechend zu protokollieren (Datum, Name oder User-ID des/der<br />
Bediensteten, Begründung der Einsichtnahme). Der bzw. dem Bediensteten ist eine Ausfertigung<br />
des Protokolls zu übergeben.<br />
7. Internet-Nutzung<br />
Die Abteilung Präsidium beauftragt in monatlichen Abständen bei der Abteilung Informationstechnologie<br />
eine Auswertung, welche Internet-Server von der Gesamtheit der Landesbediensteten am<br />
häufigsten angewählt werden. Diese Auswertung ist anonym; sie gibt über das grundsätzliche Internet-Verhalten<br />
der oö. Landesbediensteten Aufschluss.<br />
Den Dienststellenleiterinnen bzw. Dienststellenleitern wird in regelmäßigen Abständen von der<br />
Abteilung Informationstechnologie eine Auswertung zur Verfügung gestellt, welche Internet-Server<br />
von der Gesamtheit der Bediensteten der Dienststelle am häufigsten angewählt wurden ("Hitliste").<br />
Diese Auswertung ist anonym.<br />
169
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die Abteilung Präsidium überprüft gemeinsam mit dem Landespersonalausschuss in unregelmäßigen<br />
Abständen, welche Internet-Server von einem EDV-Arbeitsplatz (= IP-Adresse) aus angewählt<br />
wurden. Diese Auswertung ist auf einen konkreten EDV-Arbeitsplatz bezogen.<br />
Eine solche Überprüfung findet sowohl über begründetes Ersuchen einer Dienststellenleiterin bzw.<br />
eines Dienststellenleiters als auch - auf begründeten Verdacht - von Amts wegen im Rahmen der<br />
übergeordneten Dienstaufsicht statt.<br />
Die Überprüfung ist nur dann zulässig, wenn je ein Vertreter des Präsidiums und des Landes-<br />
Personalausschusses gleichzeitig anwesend ist.<br />
Die Überprüfungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten; dieses Überprüfungsprotokoll ist vom<br />
Vertreter des Präsidiums und vom Vertreter des Landespersonalausschusses zu unterzeichnen.<br />
Auch im Rahmen der erlaubten Verwendung von dienstlichen Geräten für die private Internet-<br />
Nutzung außerhalb der Dienstzeit ist das Betrachten von verfänglichen Inhalten (Pornographie,<br />
politischer Extremismus, Gewalt etc.) jedenfalls verboten und unterliegt den gleichen Kontrollmechanismen<br />
wie die Internet-Nutzung während der Dienstzeit.<br />
8. Kontrolle von Telefondaten<br />
Die in der Telefondatenbank gespeicherten Telefondaten über dienstliche Gespräche (sowohl im<br />
Festnetz als auch im Mobilnetz) können vom Dienstgeber - sowohl nach Organisationseinheiten<br />
als auch nach einzelnen Nebenstellen (dies geschieht in Abstimmung mit der Personalvertretung)<br />
geordnet - im Rahmen der übergeordneten Dienstaufsicht (Amtsinspektion) kontrolliert werden.<br />
Dabei wird geprüft, ob<br />
- Dienstgespräche so ökonomisch wie möglich (§ 2 Abs. 2 Fernsprechordnung) geführt und<br />
- als dienstlich gekennzeichnete Gespräche tatsächlich in Erfüllung dienstlicher Aufgaben getätigt<br />
wurden.<br />
Die gemeinsame Kontrollmöglichkeit der Dienstgespräche durch Amtsleitung und Dienstnehmervertretung<br />
ist folgendermaßen ausgestaltet:<br />
Bei Bedarf kann in die in der Datenbank verzeichneten Dienstgespräche (bzw. der als Dienstgespräche<br />
deklarierten Privatgespräche) einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters Einsicht genommen<br />
werden. Dafür ist es notwendig, dass sowohl seitens der Abteilung Präsidium beim Amt der<br />
Oö. Landesregierung als auch seitens des Landespersonalausschusses der ihnen jeweils zustehende<br />
Code zur Öffnung der elektronischen Datenbank gemeinsam eingegeben wird. Über jede<br />
Einsichtnahme in eine Datenbank ist vom Präsi-dium ein Aktenvermerk anzulegen, wenn nicht<br />
ohnehin eine schriftliche Erledigung erfolgt. Über Ersuchen des Landespersonalausschusses ist<br />
diesem eine Ausfertigung der schriftlichen Erledigung bzw. des Aktenvermerks zur Verfügung zu<br />
stellen.<br />
Nach Einführung einer zentralen Telefongebührenabrechnung bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
gelten die oben angeführten Punkte sinngemäß. In diesem Fall kann die Abteilung Präsidium seine<br />
Kontrollfunktion an die jeweilige Bezirkshauptfrau bzw. den jeweiligen Bezirkshauptmann delegieren;<br />
der Landespersonalausschuss kann seine Kontrollfunktion an die jeweilige Obfrau bzw.<br />
den jeweiligen Obmann des örtlichen Dienststellenausschusses delegieren.<br />
9. eLearning<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Werkzeuge für computerunterstütztes Lernen (eLearning,<br />
web-based-tranining, etc.) zur Verfügung gestellt.<br />
Die in diesen Systemen automatisch mitprotokollierten Daten über die Absolvierung von Lektionen<br />
bzw. Tests dürfen vom Dienstgeber nicht ausgewertet werden.<br />
Soweit der Dienstgeber für die Zulassung zu Präsenzkursen oder Prüfungen die vorherige erfolgreiche<br />
Absolvierung von Online-Kursen festlegt, hat die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer<br />
170
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
die erforderlichen Auswertungen aus dem eLearning-System selbst vorzunehmen (Ausdrucken<br />
von Zertifikaten, etc.)<br />
10. Kontrolle der Abfragen aus Datenbanken außerhalb der oö. Landesverwaltung<br />
a) Online-Zugriff auf Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger<br />
Das Präsidium führt in unregelmäßigen Abständen Stichprobenüberprüfungen betreffend Abfragen<br />
auf Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger durch<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaften und einiger Abteilungen des<br />
Amtes der Oö. Landesregierung durch. Bei diesen Stichprobenüberprüfungen wird erhoben:<br />
User-ID des anfragenden Bediensteten, Abfragedatum und Zeit, Name des Versicherten und<br />
Anfragegrund. Diese Stichproben werden der jeweiligen Dienststellenleiterin bzw. dem jeweiligen<br />
Dienststellenleiter übermittelt, der anschließend anhand des konkreten Verwaltungsaktes<br />
zu überprüfen hat, ob ausreichende Rechtsgrundlagen für eine solche Abfrage vorlagen.<br />
b) Online-Abfragen aus dem Elektronischen krimmalpolizeilichen Informationssystem (EKIS)<br />
Das Bundesministerium für Inneres überprüft mit Hilfe eines Zufallsgenerators Anfragen an die<br />
zentralen Anwendungen des BMI (insbesondere EKIS-Abfragen). Das BMI übermittelt solche<br />
Protokolldatensätze an die jeweiligen Dienststellen. Von den Dienststellenleiterinnen bzw.<br />
Dienststellenleitern ist zu prüfen, ob ausreichende Rechtsgrundlagen für eine Abfrage vorlagen.<br />
171
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 52 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Einsatz von Telefax-Geräten<br />
1. Versand von Schriftstücken<br />
a. Gemäß § 18 (1) AVG hat die Behörde die Sache möglichst zweckmäßig, rasch, einfach und<br />
kostensparend zu erledigen.<br />
Gemäß § 37 Zustellgesetz sind Zustellungen ohne Zustellnachweis – Fax-Zustellungen – möglich.<br />
Von der Bearbeiterin bzw. vom Bearbeiter ist auf dem Erledigungsentwurf der Übermittlungsmodus<br />
mit dem Vermerk "FAX" festzulegen. Die Kanzlei hat die Ausfertigung der Erledigung –<br />
wenn sie diese nicht ohnehin selbst versendet – an die in Betracht kommenden Telefaxstellen<br />
zur Absendung zu übergeben.<br />
Es wird empfohlen, ein Telefax-Begleitblatt zu verwenden, das die notwendigen Angaben enthält,<br />
die erforderlich sind, um<br />
1. die Empfängerin bzw. den Empfänger, die Absenderin bzw. den Absender und deren bzw.<br />
dessen Telefaxnummer identifizieren,<br />
2. das Schriftstück unverzüglich und fehlerfrei im Rahmen einer Organisationseinheit weiterleiten<br />
und<br />
3. die Vollständigkeit der Übertragung, insbesondere die Seitenzahl, überprüfen zu können.<br />
Nach Absendung retourniert die Telefax-Stelle die Originalschriftstücke (samt Telefax-<br />
Begleitblatt) zusammen mit dem jeweiligen Übertragungsprotokoll an die in Betracht kommende<br />
Kanzlei.<br />
b. Diese Regelung ist sinngemäß für den Versand von sonstigen Schriftstücken, Zeichnungen<br />
udgl. anzuwenden.<br />
2. Empfang von Schriftstücken<br />
a. Über Telefax einlangende Schriftstücke sind – ausgenommen die unter lit. b und c angeführten<br />
Fälle – unverzüglich von der Telefaxstelle der in Betracht kommenden Kanzlei zu übergeben.<br />
Die Kanzlei hat in diesem Fall funktionell die Aufgaben der Poststelle wahrzunehmen; sie ist für<br />
die weitere kanzleimäßige Behandlung des Schriftstückes (z.B. Evidenthalten, Vergebühren<br />
udgl.) verantwortlich.<br />
Im Zusammenhang mit Amtsstunden, Fristenlauf und Identität der Einschreiterin bzw. des<br />
Einschreiters bzw. Authentizität des Anbringens wird auf § 13 AVG verwiesen.<br />
Gemäß § 13 Abs. 5 AVG gelten mit Telefax, binnen offener Frist, eingebrachte Anbringen, die<br />
außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, als rechtzeitig eingebracht. Behördliche<br />
Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen.<br />
Hat die Behörde Zweifel darüber, ob das per Telefax eingebrachte Anbringen von der darin genannten<br />
Person stammt, kann eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger<br />
und urschriftlicher Unterschrift aufgetragen werden (§ 13 Abs 4 AVG).<br />
b. Über Telefax einlangende Schriftstücke von der Verbindungsstelle der Bundesländer und der<br />
Volksanwaltschaft sind – soweit nicht eine andere Regelung getroffen ist – unmittelbar der Abteilung<br />
Präsidium vorzulegen.<br />
173
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
c. Sofern über Telefax einlangende Schriftstücke an eine namentlich bezeichnete Bedienstete<br />
bzw. einen namentlich bezeichneten Bediensteten adressiert sind, hat die Telefaxstelle dieses<br />
Schriftstück der bzw. dem Bediensteten (bzw. der Vertreterin bzw. dem Vertreter) zu übergeben.<br />
Die Empfängerin bzw. der Empfänger ist (analog zur persönlichen Übergabe von Schriftstücken)<br />
für die weitere kanzleimäßige Behandlung bzw. Bearbeitung im Sinn der <strong>Dienstbetriebsordnung</strong><br />
verantwortlich.<br />
3. Das Verwenden von Telefax-Geräten zu privaten Zwecken ist unzulässig.<br />
174
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 53 <strong>DBO</strong><br />
Einsatz von Kraftfahrzeugen im Dienstbetrieb<br />
§ 1<br />
Zuständigkeit; Allgemeins<br />
(1) Beim Amt der Landesregierung ist – soweit nicht besondere Zuständigkeiten festgelegt sind 1 –<br />
für den Einsatz von Kraftfahrzeugen im Bereich des Amtes der Landesregierung die Abteilung<br />
Präsidium zuständig.<br />
Für Lastkraftfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen udgl., die im Bereich der Abteilungsgruppe<br />
Direktion Straßenbau und Verkehr eingesetzt sind, gelten die nachfolgenden Bestimmungen<br />
nur soweit, als nicht im Rahmen dieser Abteilungsgruppe besondere Regelungen bestehen.<br />
(2) Bei den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde hat die Bezirkshauptfrau<br />
bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand den Einsatz der<br />
Dienstkraftfahrzeuge, die der Bezirkshauptmannschaft bzw. der Agrarbezirksbehörde zur Verfügung<br />
stehen, zu regeln.<br />
Sofern es notwendig ist, kann das Amt der Landesregierung (Abteilung Präsidium bzw. – insbesondere<br />
für Lastkraftwagen – die Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management) um vorübergehende<br />
Beistellung von Dienstkraftwagen ersucht werden.<br />
Änderungen des Dienstkraftfahrzeuges bzw. seiner Ausstattung sind nur mit Zustimmung des Amtes<br />
der Landesregierung (Abteilung Präsidium) zulässig).<br />
§ 2<br />
Dienstfahrt, Fahrtauftrag<br />
(1) Dienstkraftfahrzeuge dürfen nur zu Fahrten zur Besorgung von Dienstgeschäften und zu Fahrten,<br />
die sonst im überwiegenden dienstlichen Interesse gelegen sind, eingesetzt werden (Dienstfahrten).<br />
(2) Dienstfahrten dürfen – auf den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde mit<br />
Ausnahme der Fahrten der Bezirkshauptfrau bzw. des Bezirkshauptmannes bzw. der Amtsvorständin<br />
bzw. des Amtsvorstandes und der Fahrten für Zwecke der Amtsleitung – nur auf Grund<br />
eines schriftlichen Fahrtauftrages durchgeführt werden.<br />
(3) Beim Amt der Landesregierung ist der Antrag auf Beistellung eines Dienstkraftfahrzeuges (siehe<br />
das in der Textverarbeitung zur Verfügung gestellte Muster) nach Möglichkeit, soweit nicht besondere<br />
Anweisungen über eine Antragstellung zu periodischen Zeitpunkten bestehen, spätestens<br />
am dritten Arbeitstag vor der beabsichtigten Dienstfahrt beim Dienstkraftwagenbetrieb möglichst<br />
über E-Mail einzubringen.<br />
Die einlangenden Anträge werden unter Berücksichtigung der Dringlichkeit für die beantragte Zeit<br />
vorgemerkt. Ergeben diese Vormerkungen einen ungedeckten Bedarf, so hat die Abteilung Präsidium<br />
wegen einer Terminverlegung bei der antragstellenden Organisationseinheit rückzufragen.<br />
Auf Grund der Anträge wird der Fahrtauftrag nach Maßgabe der vorhandenen Dienstkraftfahrzeuge<br />
erteilt. Kann kein Dienstkraftfahrzeug zur Verfügung gestellt werden, so ist die antragstellende<br />
Organisationseinheit zu verständigen.<br />
Kann ausnahmsweise der Antrag auf Beistellung eines Dienstkraftfahrzeuges für eine unbedingt<br />
notwendige Dienstfahrt nicht mehr rechtzeitig schriftlich gestellt werden, so kann dieser Antrag -<br />
unmittelbar bei der Abteilung Präsidium - mündlich gestellt und der Fahrtauftrag auch mündlich<br />
erteilt werden. In diesen Fällen ist der Antrag unverzüglich schriftlich nachzureichen.<br />
1<br />
ZB. die Zuständigkeit der Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management für Lastkraftfahrzeuge<br />
im Bereich des Amtes der Landesregierung (ausgenommen den Bereich der Abteilungsgruppe Direktion<br />
Straßenbau und Verkehr) oder die Zuständigkeit der Abteilung Präsidium für den Bereich sonstiger<br />
Verwaltungsstellen des Landes.<br />
175
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(4) Bei den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde ist der Antrag auf Beistellung<br />
eines Dienstkraftfahrzeuges rechtzeitig schriftlich zu stellen. Ist dies ausnahmsweise nicht<br />
möglich, so kann dieser Antrag bei der Amtsleitung mündlich gestellt und der Fahrtauftrag auch<br />
mündlich erteilt werden. In diesen Fällen ist der Antrag unverzüglich schriftlich nachzureichen.<br />
Die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand<br />
kann einen Fahrtauftrag für regelmäßig wiederkehrende Dienstfahrten erteilen, wenn ein Dienstkraftfahrzeug<br />
vorwiegend für einen bestimmten Aufgabenbereich (zB. forsttechnischer Dienst) zur<br />
Verfügung gestellt wurde.<br />
§ 3<br />
Durchführung der Dienstfahrt, Allgemeines<br />
(1) Jede Dienstfahrt ist grundsätzlich nach dem erteilten Fahrtauftrag durchzuführen. Die jeweils<br />
kürzeste oder nach den besonderen Umständen zweckmäßigste Fahrtstrecke zu den einzelnen<br />
Fahrtzielen ist zu wählen.<br />
(2) Die Rückkehr hat zum frühest möglichen und zumutbaren Zeitpunkt zu erfolgen.<br />
(3) Die Fahrtteilnehmerinnen bzw. Fahrtteilnehmer können zu Beginn der Dienstfahrt von der<br />
Wohnung abgeholt und nach Erledigung der Dienstgeschäfte zur Wohnung zurückgebracht werden,<br />
wenn<br />
a. entweder die Wohnung im Dienstort oder an der Fahrtstrecke liegt, oder<br />
b. aus einem anderen Grund die Teilnahme an der Dienstfahrt andernfalls nicht zumutbar wäre; in<br />
diesem Fall muss der Fahrtauftrag ausdrücklich darauf abgestellt sein.<br />
§ 4<br />
Fahrerinnen bzw. Fahrer und Fahrtteilnehmerinnen bzw. Fahrtteilnehmer<br />
(1) Die bzw. der für die Dienstfahrt eingeteilte Kraftfahrerin bzw. Kraftfahrer ist für die Einhaltung<br />
der verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie für die erforderliche technische und sonstige Betreuung<br />
des Dienskraftwagens allein verantwortlich.<br />
(2) Wird für die Dienstfahrt keine Kraftfahrerin bzw. kein Kraftfahrer eingeteilt, so ist die bzw. der<br />
im Fahrtauftrag als Fahrerin bzw. Fahrer ("Selbstlenker") angeführte Bedienstete für die Einhaltung<br />
der verkehrsrechtlichen Vorschriften verantwortlich; zur Betreuung des Dienstkraftwagens ist<br />
sie bzw. er nur soweit verpflichtet, als es um die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie Betriebsbereitschaft<br />
des Fahrzeuges geht (diese Pflichten obliegen aufgrund der verkehrsrechtlichen Vorschriften<br />
jeder Lenkerin bzw. jedem Lenker eines Kraftfahrzeuges).<br />
(3) Abgesehen von Abs. 1 und 2 sind die Fahrtteilnehmerinnen bzw. Fahrtteilnehmer für die ordnungsgemäße<br />
Durchführung der Dienstfahrt verantwortlich. Die Kraftfahrerin bzw. der Kraftfahrer<br />
ist insoweit an die Weisungen der Fahrtteilnehmerinnen bzw. Fahrtteilnehmer gebunden. Diese<br />
haben auch dafür zu sorgen, dass der Kraftfahrerin bzw. dem Kraftfahrer die Möglichkeit zur Einnahme<br />
der üblichen Mahlzeiten geboten wird.<br />
(4) Amtsfremde Personen dürfen beim Amt der Landesregierung nur mit Zustimmung der Abteilung<br />
Präsidium, bei den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde nur mit Zustimmung<br />
der Bezirkshauptfrau bzw. des Bezirkshauptmannes bzw. der Amtsvorständin bzw. des<br />
Amtsvorstandes bei einer Dienstfahrt mitgenommen werden. Ohne eine solche Zustimmung ist die<br />
Mitnahme von amtsfremden Personen nur zulässig,<br />
a. wenn sich bei der Durchführung des Dienstgeschäftes ein besonderes dienstliches Interesse<br />
dafür ergibt oder<br />
b. zwischen Dienstort und Wohnort, wenn entsprechend den geltenden Regelungen der Dienstkraftwagen<br />
benützt wird und die Person dem Lenker bekannt ist.<br />
(5) Tiere dürfen in Dienstkraftfahrzeugen nur mitgenommen werden, wenn es aus dienstlichen<br />
Gründen geboten ist.<br />
176
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
§ 5<br />
Nachträgliche Änderungen<br />
(1) Tritt nach Erteilung des Fahrtauftrages aber noch vor Fahrtbeginn eine wesentliche Änderung<br />
ein (Verhinderung, andere Fahrtstrecken, andere Abfahrtszeit u.dgl.), so hat die antragstellende<br />
Organisationseinheit bzw. die eingeteilte Kraftfahrerin bzw. der eingeteilte Kraftfahrer beim Amt<br />
der Landesregierung unverzüglich die Abteilung Präsidium bzw. bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
bzw. der Agrarbezirksbehörde unverzüglich die Amtsleitung zu verständigen.<br />
(2) Tritt die wesentliche Änderung nach Fahrtbeginn ein, so ist die Entscheidung, die dieser Änderung<br />
zugrundeliegt, im Fahrtnachweis festzuhalten.<br />
§ 6<br />
Verhalten bei Verkehrsunfällen<br />
(1) Bei Verkehrsunfällen anlässlich einer Dienstfahrt hat die Kraftfahrerin bzw. der Kraftfahrer bzw.<br />
wenn diese bzw. dieser dazu nicht in der Lage ist, eine der Fahrtteilnehmerinnen bzw. einer der.<br />
Fahrtteilnehmer die nächste Sicherheitsdienststelle 2 wegen der Aufnahme des Unfalles zu verständigen<br />
sowie alles sonst nach den einschlägigen Vorschriften (insbesondere der Straßenverkehrsordnung)<br />
Erforderliche zu veranlassen.<br />
(2) Aussagen an Ort und Stelle zur Verschuldensfrage sind zu unterlassen.<br />
(3) Erforderlichenfalls ist das Dienstkraftfahrzeug zur Beförderung von verletzten Personen zur<br />
Verfügung zu stellen.<br />
(4) Vom Hergang des Unfalles und den im Zusammenhang damit getroffenen Veranlassungen ist<br />
beim Amt der Landesregierung die Abteilung Präsidium bzw. bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
bzw. der Agrarbezirksbehörde die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin<br />
bzw. der Amtsvorstand ehestmöglich zu verständigen. Von Unfällen, bei denen schwerer<br />
Personen- oder Sachschaden verursacht wurde, ist die Abteilung Präsidium überdies sofort<br />
(Telefon, Funk u.dgl.) zu verständigen.<br />
(5) Für die Schadensanzeige ist das in der Kfz-Haftpflichtversicherung übliche Formular zu verwenden.<br />
Diese Schadensanzeige ist unverzüglich an die Abteilung Präsidium zu übermitteln.<br />
§ 7<br />
Fahrtnachweisbuch<br />
(1) Für jedes Dienstkraftfahrzeug ist ein Fahrtnachweisbuch zu führen.<br />
(2) Die Kraftfahrerin bzw. der Kraftfahrer bzw. die Selbstlenkerin bzw. der Selbstlenker hat für jede<br />
Dienstfahrt einen Fahrtnachweis (mit Durchschlag) auszufüllen und zu unterschreiben; eine bzw.<br />
einer der Fahrtteilnehmerinnen bzw. Fahrtteilnehmer hat die Angaben zu bestätigen. Die Kraftfahrerin<br />
bzw. der Kraftfahrer bzw. die Selbstlenkerin bzw. der Selbstlenker hat den Durchschlag des<br />
Fahrtnachweises nach Beendigung der Dienstfahrt bzw. der Dienstfahrten dieses Tages ihrer bzw.<br />
seiner Organisationseinheit zu übermitteln. Die Fahrtnachweise sind in der jeweiligen Organisationseinheit<br />
7 Jahre aufzubewahren.<br />
2<br />
Falls eine Landesbedienstete bzw. ein Landesbediensteter ein privates Kraftfahrzeug bei einer Dienstfahrt<br />
verwende, ist der Schaden nur dann der nächsten Polizeidienststelle zu melden, wenn<br />
- ein Personenschaden,<br />
- ein größerer Sachschaden oder<br />
- ein Sachschaden eingetreten ist, bei dem der Unfallhergang nicht einwandfrei nachvollziehbar ist.<br />
177
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Benutzung von Dienstkraftwagen zum Selbstlenken 3<br />
1. Sonderbestimmungen für Dienststellen-Selbstlenkerfahrzeuge<br />
Für die Auslastung der zugeteilten Dienstkraftwagen ist die Abteilung bzw. Dienststelle verantwortlich.<br />
Dem Einsatz von Dienstkraftwagen zum Selbstlenken kommt gegenüber der Nutzung von<br />
Privat-PKWs gegen Verrechnung des km-Geldes jedenfalls Priorität zu.<br />
Für die reibungslose Abwicklung der zugeteilten Fahrzeuge gilt weiterhin die von der Dienststellenleitung<br />
der Abteilung Präsidium/Dienstkraftwagenbetrieb namhaft gemachte Person. Die Gesamtverantwortung<br />
für den wirtschaftlichen Einsatz liegt jedoch bei der Dienststellenleitung.<br />
Die den Dienststellen zugewiesenen Dienstkraftfahrzeuge zum Selbstlenken und die beim Dienstkraftwagenbetrieb<br />
der Abteilung Präsidium zur Verfügung stehenden Selbstlenkerfahrzeuge sind<br />
bei einer geplanten Fahrtstrecke von über 50 km vorrangig vor Privat-PKWs in Anspruch zu<br />
nehmen.<br />
Es sind also primär die einer Dienststelle zugewiesenen Dienstkraftwagen – bei entsprechender<br />
Verfügbarkeit auch bei Dienstreisen unter 50 km – zu benützen, wobei die Dienststellen auf<br />
einen möglichst wirtschaftlichen Einsatz der Dienstkraftwagen zum Selbstlenken vor allem durch<br />
Abdeckung von Reisebewegungen mit hoher Kilometerauslastung zu achten haben.<br />
2. Bestimmungen für alle Selbstlenkerfahrzeuge<br />
2.1: 50-Km-Grenze<br />
Beim Dienstkraftwagenbetrieb der Abteilung Präsidium (DKW-Betrieb) stehen Selbstlenkerfahrzeuge<br />
zur Verfügung, die bei einer Fahrtstrecke von über fünfzig (50) Kilometer vorrangig vor dem<br />
Privat-PKW in Anspruch zu nehmen sind.<br />
Können Dienstreisen mit einer geplanten Fahrtstrecke über 50 km nicht mit zugewiesenen Dienstkraftwagen<br />
abgedeckt werden oder stehen solche einer Dienststelle nicht zur Verfügung, ist ein<br />
Dienstkraftwagen beim Dienstkraftwagenbetrieb der Abteilung Präsidium anzufordern.<br />
Dies gilt sowohl für Dienststellen, denen keine Selbstlenkerfahrzeuge zugeteilt sind, als auch für<br />
Dienststellen mit Selbstlenkerfahrzeugen an Tagen, an denen diese zur Gänze im Einsatz sind<br />
(bzw. gewartet werden und dgl.).<br />
Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Dienststellen, deren Dienstort nicht Linz ist und denen<br />
ein Zugriff auf einen Dienstkraftwagen vom Dienstkraftwagenbetrieb nicht möglich ist.<br />
Werden bei einer Dienstreise mit einer geplanten Fahrtstrecke von über 50 km Dienstkraftwagen<br />
nicht angefordert oder zugeteilte Dienstkraftwagen nicht benützt, so werden nur die Kosten des<br />
billigsten öffentlichen Verkehrsmittels ersetzt (Pauschaliert 0,11 Euro/Kilometer oder der niedrigste<br />
Tarif des öffentlichen Verkehrsmittels).<br />
Keinesfalls zulässig ist es, statt der tatsächlichen Fahrtstrecken, die in Summe über 50 km betragen,<br />
dem Dienstgeber "nur" 50 km gegen das Kilometergeld für Privat-PKW (0,420 €/km) zu verrechnen.<br />
2.2 Abwicklung<br />
Auf § 2 Abs. 3 des Anhangs zu § 53 wird hingewiesen, wonach grundsätzlich spätestens am dritten<br />
Arbeitstag vor der beabsichtigten Dienstfahrt ein Antrag auf Bestellung eines Dienstkraftwagen<br />
einzubringen ist, um rechtzeitige Zusagen des DKW-Betriebs und entsprechende Planungen gewährleisten<br />
zu können.<br />
Bei späterem Einlangen von Fahrtanträgen, die nicht erfüllt werden können, kann für die Benützung<br />
eines Privat-PKW lediglich eine Entschädigung von 0,11 Euro pro Kilometer verrechnet wer-<br />
3<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass PersR-230000/1601-2008-Ra/Pal vom 1. August 2008.<br />
178
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
den, es sei dem, es wird vom Dienstnehmer bzw. von der Dienstnehmerin nachgewiesen, dass die<br />
Dienstreise kurzfristig und unvorhersehbar erforderlich war (zB Vertretung einer/eines erkrankten<br />
Kollegin/Kollegen oder behördliche Maßnahmen bei Gefahr in Verzug). Im letzteren Fall gebührt<br />
das amtliche Kilometergeld.<br />
Liegen die Voraussetzungen für die Benützung eines Selbstlenkers nicht vor bzw. steht ein Selbstlenkerfahrzeug<br />
nicht zur Verfügung, so gebührt für das Lenken des eigenen Personenkraftwagens<br />
das amtliche Kilometergeld.<br />
2.3 Mitnahme zur Wohnung<br />
Nach § 3 Abs. 3 des Anhangs zu § 53 können die Fahrtteilnehmer/innen zu Beginn der Dienstfahrt<br />
von der Wohnung abgeholt und nach Erledigung der Dienstgeschäfte zur Wohnung zurückgebracht<br />
werden, wenn<br />
a. entweder die Wohnung im Dienstort oder an der Fahrtstrecke liegt oder<br />
b. aus einem anderen Grund die Teilnahme an der Dienstfahrt andernfalls nicht zumutbar wäre; in<br />
diesem Fall muss der Fahrtauftrag ausdrücklich darauf abgestellt sein.<br />
Um den zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz der Selbstlenkerfahrzeuge zu garantieren,<br />
können diese Fahrzeuge, wenn die Dienstreise von der Wohnung aus angetreten wird (siehe unten<br />
Punkt 3) und der bzw. die Bedienstete an der Fahrtstrecke der Dienstreise wohnt, grundsätzlich<br />
am Vortag für die Nutzung zur Fahrt in den Wohnort verwendet werden.<br />
Ist der Wohnort in der Nähe des DKW-Standortes (siehe Punkt 3), so ist das Mitnachhausenehmen<br />
des DKW am Vortag auch zulässig, wenn der Ort der Dienstverrichtung (Dienstreiseziel) am<br />
nächsten Tag nicht auf der direkten Strecke zwischen Dienstort und Einsatzort liegt. In beiden<br />
Fällen ist eine Abstimmung mit dem Dienstkraftwagenbetrieb bzw. mit der von der Dienststelle für<br />
die Verwaltung der Selbstlenkerfahrzeuge namhaft gemachten Person vorzunehmen.<br />
Unter den selben Voraussetzungen ist die Rückgabe erst am Folgetag zulässig. Dies gilt auch,<br />
wenn aufgrund der Rückkehr zur Dienststelle in der Nachtzeit kein zumutbares öffentliches Verkehrsmittel<br />
zum Wohnort mehr zur Verfügung steht.<br />
Für den DKW-Betrieb der Abteilung Präsidium ist eine Rückgabe des DKW am darauffolgenden<br />
Tag bis 7:00 Uhr erforderlich, um eine reibungslose Dienstverrichtung der Nachnutzer zu ermöglichen.<br />
Ausnahmen sind nur zulässig, sofern in begründeten Ausnahmen eine Vereinbarung mit dem<br />
Dienstkraftwagenbetrieb getroffen wurde.<br />
Auf der Fahrtstrecke zwischen Dienststelle und Wohnung wird also nur die oben genannte Nutzung<br />
des Dienstkraftwagens erlaubt. Nicht erlaubt sind wie bisher weitergehende Privatnutzungen<br />
wie Ausflüge, Einkaufstouren und dgl. sowie Fahrten, die über die oben genannten Fahrtstrecken<br />
hinausgehen.<br />
Bei der Mitnahme von amtsfremden Personen ist nach § 4 Abs. 4 vorzugehen.<br />
2.4 Mehrtägige Dienstreisen<br />
Der Dienstnehmervertretung wurde eine großzügigere Prüfung der Genehmigung der Dienstreisen<br />
mit dem Privat-PKW zugesagt, sofern sich die Dienstreise auf mehr als zwei Kalendertage erstreckt<br />
und es sich um keine Maßnahme der Aus- und Fortbildung handelt (zB mehrtägige Prüfung<br />
von Außendienststellen durch die Landesbuchhaltung und dergleichen).<br />
3. Wohnung als Ausgangspunkt der Dienstreise<br />
Nach § 5 Abs. 1 Oö. LRGV darf die Dienstreise von der Wohnung aus angetreten bzw. beendet<br />
werden, wenn dadurch niedrigere Reisegebühren anfallen. Dies ist der Fall, wenn die Strecke zum<br />
Ort der Dienstverrichtung von der Wohnung aus kürzer ist als vom Dienstort.<br />
179
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Liegt diese Voraussetzung vor, war bisher geregelt, dass Dienstnehmer/innen verpflichtet sind, bis<br />
zu 25 km vom Wohnort zum DKW-Standort zurückzulegen und vom DKW-Standort aus die<br />
Dienstreise zum Ort der Dienstverrichtung anzutreten. Nunmehr wird diese Entfernung auf<br />
15 Kilometer verkürzt.<br />
Beispiel:<br />
Ein Bediensteter wohnt in Neuhofen, sein Dienstort ist Linz und der Ort der Dienstverrichtung (Lokalaugenschein<br />
mit z.B. mündlicher Verhandlung) ist Weyer. Da die Strecke Neuhofen – Weyer<br />
kürzer ist als die Strecke Linz – Weyer und die Entfernung Neuhofen zum DKW-Betrieb in Linz<br />
mehr als 15 km (konkret: 20 km) ausmacht, kann er mit dem Privat-PKW nach Weyer fahren und<br />
Kilometergeld für Privat-PKW (derzeit 0,376 Euro/km) verrechnen. Wäre die Entfernung vom<br />
Wohnort (z.B. Leonding) zum DKW-Standort kürzer als 15 km, so müsste der Dienstnehmer den<br />
DKW (in Linz) abholen und kann in der Folge die Selbstlenkerentschädigung (0,037 Euro/km) von<br />
Linz nach Weyer (und retour) verrechnen.<br />
4. Grundsätzliches<br />
Wir bieten auch weiterhin als Anreiz jenen Bediensteten, die die höchsten Kilometerleistungen mit<br />
einem Dienstkraftwagen zurückgelegt haben, eine Einladung zu einem eintägigen Fahrtechnikkurs<br />
auf Kosten des Dienstgebers an.<br />
Für den Fall eines Schadensfalls im Zusammenhang mit Dienstverrichtungen gilt weiterhin der<br />
Erlass "Schadensfälle" Fin-050058/31-Roi vom 21. Dezember 2001.<br />
In der Beilage ist ein Merkblatt für die Benutzung von Selbstlenkerfahrzeugen angeschlossen.<br />
Bei fix an Bedienstete zugeteilten Selbstlenkerfahrzeugen wird die Frage der lohnsteuerrechtlichen<br />
Sachbezugsbewertung jeweils im Einvernehmen mit dem DKW-Betrieb und der PVR geprüft.<br />
180
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Beilage zu PersR-230000/1601-2008-Ra<br />
Benützung von Selbstlenkerfahrzeugen<br />
(Dienstkraftfahrzeuge)<br />
Für die Benützung von Selbstlenkerfahrzeugen (Dienstkraftfahrzeugen) gelten die Bestimmungen<br />
des § 53 und Anhang zu § 53.<br />
Als Selbstlenkerfahrzeuge stehen generell Fahrzeuge der Typen VW Golf/Opel Astra/VW Passat/VW<br />
Bus zur Verfügung.<br />
In Ausnahmefällen (z.B. Auslandsfahrten) können auch andere Fahrzeuge zur Verfügung gestellt<br />
werden.<br />
Die Selbstlenkerfahrzeuge werden ab sofort mit folgender Mindestausstattung ausgestattet:<br />
- ABS<br />
- Klimaanlage<br />
- Außenspiegel von innen verstellbar<br />
- Nebelscheinwerfer<br />
- RDS-Radio<br />
- Airbag für Fahrer und Beifahrer<br />
- Servolenkung<br />
- Zentralverriegelung<br />
- Verbandspaket<br />
- Warndreieck<br />
- Feuerlöscher<br />
- Autobahnvignette<br />
- Sicherheitswarnweste<br />
- Bluetooth Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon (Bedienungsanleitung / Kurzbeschreibung in<br />
der blauen Ringmappe)<br />
In jedem Fahrzeug befindet sich eine blaue Ringmappe (A6), in der sich folgende Unterlagen befinden:<br />
- Zulassungsschein<br />
- Abschnitt Autobahnvignette<br />
- Karte für Versicherungspolizzennummer<br />
- Hinweise, wo sich Verbandszeug, Warndreieck und Feuerlöscher befinden<br />
- Hinweis für Verhalten bei Unfällen<br />
- Liste der Kontaktpersonen (Telefonnummern) bei Unklarheiten, Störungen und Unfällen etc.<br />
- Fahrtenbuch<br />
- Liste der Tankstellen in den Straßenmeistereien<br />
Gemäß § 7 des Anhanges zu § 53 ist für jede Dienstfahrt ein Fahrtnachweis auszufüllen (vollständig<br />
und leserlich – bei unleserlicher Unterschrift Namen in Druckschrift ergänzen) und zu unterschreiben.<br />
Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir, die Fahrtnachweisbücher für die bei den Dienststellen<br />
eingesetzten Dienstkraftfahrzeuge in der Dienststelle zu hinterlegen. Die Fahrtenbücher sind<br />
mindestens sieben Jahre so aufzubewahren, dass in sie jederzeit Einsicht genommen werden<br />
kann.<br />
Die Prüfung der ordnungsgemäßen Führung der Fahrtnachweise sowie eine erforderliche Überprüfung<br />
im Zusammenhang mit der Vorlage von Reiserechnungen ist von der Dienststellen wahrzunehmen.<br />
181
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Selbstlenkerfahrzeuge, die beim Dienstkraftwagenbetrieb der Abteilung Präsidium (DKW-Betrieb),<br />
Promenade, stationiert sind, können täglich (Montag bis Freitag) ab 06.30 Uhr übernommen werden.<br />
Die Rückgabemöglichkeit besteht Montag, Dienstag und Donnerstag bis 22.00 Uhr und Mittwoch<br />
und<br />
Freitag bis 21.00 Uhr. Fahrzeuge, die zu einem späteren Zeitpunkt zurückgebracht werden, können<br />
auf dem Parkplatz beim Dienstkraftwagenbetrieb gegenüber der Garage (Parkplätze Nr. 47<br />
bis 51) abgestellt werden. Der Schlüssel ist in einem dafür vorgesehenen Schlüsseleinwurf zu<br />
deponieren.<br />
Bei den in den Abteilungen/Dienststellen stationierten Selbstlenkerfahrzeugen ist Folgendes<br />
zu beachten:<br />
a. Wahrnehmung der Serviceintervalle im Einvernehmen mit dem Garagenmeister<br />
b. Betankung der Fahrzeuge bei der eigenen Betriebstankstelle bei der Garage Promenade<br />
(Schlüsseltankstelle – gelegentlich soll einen Motorölstandskontrolle durchgeführt werden, sie<br />
wird erforderlichenfalls vom Werkstättenpersonal vorgenommen). Die Betankungsmöglichkeit<br />
besteht Montag, Dienstag und Donnerstag bis 22.00 Uhr und Mittwoch und Freitag bis 21.00<br />
Uhr.<br />
Weitere Betankungsmöglichkeit in 8 Straßenmeistereien.<br />
Sollte im Ausnahmefall eine Betankung auswärts erforderlich sein, wird gegen Vorlage des<br />
Zahlungsbelegs der Betrag beim Dienstkraftwagenbetrieb ausbezahlt.<br />
c. Die Reinigung der Fahrzeuge kann bei der in der Garage vorhandenen Autowaschanlage vorgenommen<br />
werden. Die dazu erforderliche Karte ist beim Garagenmeister bzw. Stellvertreter<br />
erhältlich.<br />
Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass bei Unfällen grundsätzlich eine Aufnahme<br />
durch die Polizei (auch bei Bagatellschäden) erforderlich ist. Für Dienstkraftfahrzeuge der Gebietskörperschaften<br />
ist keine "Blaulichtsteuer" zu entrichten.<br />
Probleme/Mängel an Fahrzeugen sind umgehend dem Garagenmeister bzw. seinem Stellvertreter<br />
zu melden.<br />
Versicherung:<br />
Durch die KFZ-Haftpflichtversicherung sind alle Schäden, welche durch die Haltung und Verwendung<br />
der Fahrzeuge entstehen, abgesichert. Haftpflichtansprüche der Beifahrer sind somit (Abwehr<br />
und Befriedigung) über die KFZ-Haftpflichtversicherung gedeckt.<br />
Dies bedeutet auch, dass Schäden an den Insassen des Fahrzeuges – jedoch immer ausgenommen<br />
der Lenker und der Halter – durch die KFZ-Haftpflichtversicherung abgedeckt sind, sofern<br />
das Verschulden beim Lenker des Fahrzeuges liegt. In jenen Fällen, wo das Verschulden bei einem<br />
anderen Fahrzeug liegt, ist die Absicherung der Haftpflichtansprüche durch die gegnerische<br />
KFZ-Haftpflichtversicherung gegeben.<br />
Reifenpannen:<br />
Im Falle einer Reifenpanne wird wenn erforderlich während der Regeldienstzeit über den DKW-<br />
Betrieb (Telefonnummern Kontaktpersonen siehe blaue Ringmappe) Hilfe über die nächstgelegene<br />
Straßenmeisterei oder Betriebswerkstätte organisiert. Außerhalb der Dienstzeiten kann erforderlichenfalls<br />
Hilfe über einen Pannendienst gegen Rechnungslegung in Anspruch genommen<br />
werden.<br />
182
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 54 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Bibliotheksordnung für die Amtsbibliothek des<br />
Amtes der Oö. Landesregierung<br />
(einschließlich Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen)<br />
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen<br />
§ 1 Zweck und Geltungsbereich<br />
§ 2 Benützungsbedingungen<br />
2. Abschnitt: Bestand der Amtsbibliothek<br />
§ 3 Örtlicher Bestand<br />
§ 4 Materielle Zusammensetzung des Bibliotheksbestandes<br />
3. Abschnitt: Bestellwesen<br />
§ 5 Zuständigkeit<br />
§ 6 Anforderung von Druckwerken/digitalen Medien<br />
§ 7 Evidenthaltung angekaufter Produkte<br />
4. Abschnitt: Katalogisierung bzw. Recherche mittels Bibliothekssoftware ALEPH<br />
§ 8 Katalogisierung<br />
§ 9 Recherche<br />
5. Abschnitt: Benutzung, Entlehnung und Fristen<br />
§ 10 Benutzung<br />
§ 11 Einsichtnahme<br />
§ 12 Dauerentlehnung<br />
§ 13 Kurzfrist(Kurzzeit-)entlehnung<br />
§ 14 Entlehnfristen<br />
6. Abschnitt: Rückgabe nicht mehr benötigter Literatur, Überprüfung der Aktualität und<br />
Skartierung<br />
§ 15 Rückgabe nicht mehr benötigter Literatur<br />
§ 16 Überprüfung der Aktualität<br />
§ 17 Skartierung<br />
7. Abschnitt: Schlussbestimmungen<br />
§ 18 Behandlung entlehnter Druckwerke/digitaler Medien<br />
§ 19 Zuständigkeiten<br />
§ 20 Inkrafttreten<br />
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen<br />
§ 1 Zweck und Geltungsbereich<br />
(1) Der Zweck der Amtsbibliothek ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bediensteten des Amtes<br />
der Oö. Landesregierung (einschließlich der Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen) mit<br />
Fachliteratur und sonstigen Informationen. Damit verbunden ist es Aufgabe der Amtsbibliothek<br />
Fachliteratur und Wissensquellen zur Verfügung zu stellen sowie die Bediensteten zu beraten und<br />
beim Auffinden von Literatur zu unterstützen. Nähere Details und die Inanspruchnahme von Leistungen<br />
der Amtsbibliothek werden mit dieser Bibliotheksordnung geregelt.<br />
(2) Der Betrieb und die Führung der Amtsbibliothek obliegen der Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management.<br />
183
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(3) Die Aufgabenstellung der Oö. Landesbibliothek bleibt von den Bestimmungen der Bibliotheksordnung<br />
unberührt.<br />
§ 2 Benützungsbedingungen<br />
Die Benützung des Bibliotheksbestandes respektive der Serviceleistungen der Amtsbibliothek ist<br />
für die Bediensteten des Amtes der Oö. Landesregierung (einschließlich der Sonderbehörden und<br />
sonstigen Einrichtungen) unter Einhaltung der Bestimmungen der Bibliotheksordnung, insbesondere<br />
auch der Bestimmungen des § 18 unter gleichen Bedingungen möglich.<br />
2. Abschnitt: Bestand der Amtsbibliothek<br />
§ 3 Örtlicher Bestand<br />
Der Bestand der Amtsbibliothek setzt sich in örtlicher Hinsicht aus folgenden Standorten zusammen:<br />
1. Bestand in den Räumlichkeiten der Amtsbibliothek sowie<br />
2. dislozierter Bestand in den Organisationseinheiten des Amtes der Oö. Landesregierung (einschließlich<br />
der Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen).<br />
§ 4 Materielle Zusammensetzung des Bibliotheksbestandes<br />
(1)Den Bestand in den Räumlichkeiten der Amtsbibliothek bilden folgenden Medien:<br />
a. Bundesgesetzblätter, Landesgesetzblätter, amtliche Mitteilungsblätter aus den Bundesländern<br />
b. Gesetzeskommentare (zu aktuellen Gesetzeskommentaren vgl. § 4 Abs. 3)<br />
c. (Kommentierte) Loseblattsammlungen diverser Rechtsbereiche<br />
d. Normen sowie nationale und internationale Regelwerke<br />
e. Digitale Medien bzw. Online-Produkte<br />
f. Fachzeitschriften<br />
g. Sonstige Literatur (wissenschaftliche Publikationen, Fachbücher, Nachschlagewerke etc.)<br />
(2) Teilbestände der Amtsbibliothek befinden sich in den verschiedenen Organisationseinheiten<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung (einschließlich Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen).<br />
Diese Teilbestände setzen sich aus folgenden Medien zusammen:<br />
a. Fachbücher in Printform (in thematischer Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung der<br />
Organisationseinheit) und<br />
b. digitale Medien bzw. Online-Produkte<br />
(3) Zum Bestand der Amtsbibliothek (im Sinne einer Nutzungsvereinbarung) zählen ebenfalls literarische<br />
Online-Datenbanken wie das Normenmanagement (ON) und insbesondere auch die juristischen<br />
Online-Datenbanken Rechtsdatenbank (RDB), LexisNexis, Lexunited und Rechts-Index-<br />
Datenbank (RIDA). Diese enthalten neben zahlreichen juristischen Fachzeitschriften, deren Inhalt<br />
von jedem EDV-Arbeitsplatz im Volltext abrufbar ist, auch Entscheidungssammlungen und vor<br />
allem Online-Gesetzeskommentare, die einen repräsentativen Querschnitt der Aufgaben der Landesverwaltung<br />
reflektieren.<br />
(4) Unbeschadet der Verwahrung von Teilbeständen der Amtsbibliothek bei anderen Organisationseinheiten<br />
ist die Transparenz über den Bibliotheksbestand und den physischen Standort desselben<br />
durch das Bibliotheksprogramm ALEPH gewährleistet (vgl. insofern §§ 7 und 8).<br />
(5) Zum Bestand der Amtsbibliothek gehören nicht<br />
a. amtsinterne Arbeitsbehelfe wie etwa gedruckte Telefonverzeichnisse, Telefon-bücher, Ausgaben<br />
der <strong>Dienstbetriebsordnung</strong> und des Organisationsplanes etc.<br />
b. Tageszeitungen, Prospekte udgl.<br />
c. Online-Datenbanken ohne literarischen Bezug, wie etwa Grundstücksdatenbank und Firmenbuch<br />
184
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
3. Abschnitt: Bestellwesen<br />
§ 5 Zuständigkeit<br />
Für den Ankauf von Druckwerken und digitalen Medien, die in den Bestand der Amtsbibliothek<br />
aufzunehmen sind, ist ausschließlich die Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management<br />
zuständig.<br />
§ 6 Anforderung von Druckwerken/digitalen Medien<br />
(1) Um den allgemeinen verwaltungsökonomischen Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit<br />
und Zweckmäßigkeit gerecht zu werden ist vor Anforderung (Ankauf) eines Bibliotheksprodukts<br />
mittels des Bibliotheksprogramms ALEPH (vgl. §§ 7 Abs. 2 und 9 Abs. 3) abzuklären, ob ein<br />
bestimmter Bedarf nicht durch (amtsinterne) Ausleihe, Einsichtnahme, Anfertigen von Kopien etc.<br />
gedeckt werden kann.<br />
(2) Kann ein entsprechender Bedarf auf diese Weise (Abs. 1) nicht befriedigt werden, ist folgende<br />
Vorgangsweise einzuhalten:<br />
1. Anforderung mittels entsprechendem Bestellschein; dieser hat neben verschiedenen bibliothekarischen<br />
Angaben vor allem eine begründete Ankaufsnotwendigkeit zu enthalten.<br />
2. Die Anforderung ist von der Abteilungsleitung bzw. der Dienststellenleitung mit Budgetverantwortung<br />
zu unterfertigen.<br />
3. Ein Neuankauf von Literatur ist nur im Rahmen des der jeweiligen Organisati-onseinheit zugewiesenen<br />
Budgets möglich.<br />
4. Der Ankauf von Literatur erfolgt gem. § 5 ausschließlich durch die Amtsbibliothek (Abteilung<br />
Gebäude- und Beschaffungs-Management). Von Organisationseinheiten autonom beschaffte<br />
Literatur kann aus dem Budget der Amtsbibliothek nicht beglichen werden.<br />
§ 7 Evidenthaltung angekaufter Produkte<br />
(1) Neu angekaufte Produkte sind von den Bediensteten der Amtsbibliothek mittels Bibliothekssoftware<br />
ALEPH zu erfassen (Katalogisierung). Sie sind an die bestellende Organisationseinheit<br />
zu übermitteln, falls eine physische Präsenz des angekauften Produkts in der jeweiligen Organisationseinheit<br />
aus dienstlichen Gründen unabdingbar ist.<br />
(2) Besteller/innen von Bibliotheksprodukten, die neu angekaufte Produkte an ihrem jeweiligen<br />
örtlichen Standort aufbewahren (Abs. 1) trifft die Obliegenheit, auch anderen Bediensteten/Organisationseinheiten<br />
Einsicht in diese zu gewähren oder allenfalls kurzfristig zu leihen, falls<br />
dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist.<br />
(3) Bei einzelnen Produkten (insbesondere Gesetzes- und Verordnungsblätter, Ergänzungslieferungen<br />
zu Loseblattsammlungen, amtlichen Mitteilungsblättern, Normblättern, Fachzeitschriften)<br />
kann seitens der Amtsbibliothek auf eine Katalogisierung (und das Anbringen eines Stempelaufdrucks<br />
nach § 8 Abs. 3) verzichtet werden, wenn eine Evidenthaltung auf andere Art und Weise<br />
sichergestellt wird.<br />
4. Abschnitt: Katalogisierung bzw. Recherche mittels Bibliothekssoftware ALEPH<br />
§ 8 Katalogisierung<br />
(1) Die Katalogisierung von gedruckten und digitalen Medien erfolgt mittels Bibliothekssoftware A-<br />
LEPH durch die Bediensteten der Amtsbibliothek unter Beachtung des internationalen Bibliotheksregelwerks<br />
RAK (Regeln für angewandte Katalogisierung).<br />
(2) Das RAK-Regelwerk hat jedenfalls Angaben über Verfasser und Herausgeber, Titel, Medieninhaber,<br />
Verlag, Erscheinungsort und -jahr des Werks und als Annex den Standort (= Abteilung/Organisationseinheit<br />
oder Amtsbibliothek) zu enthalten.<br />
185
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(3) Auf den katalogisierten Druckwerken und digitalen Medien ist mittels Stempelaufdruck ein<br />
Vermerk anzubringen, der insbesondere Bibliotheksnummer, Datum der Katalogisierung und<br />
Standort des Werks zu enthalten hat.<br />
(4) Nach Abschluss der Katalogisierung sind die in den Bestand der Amtsbibliothek aufgenommenen<br />
Druckwerke/digitalen Medien in der Amtsbibliothek zur Benutzung bereitzuhalten bzw. an die<br />
anfordernde Organisationseinheit weiterzuleiten (vgl. insofern die korrespondierenden Bestimmungen<br />
in § 7 Abs. 1 und 3).<br />
§ 9 Recherche<br />
(1) Nutzer/innen des Intranets sind auch potenzielle Nutzer/innen des Bibliothekssystems ALEPH.<br />
Über dieses ist eine erschöpfende Abfrage über beim Amt der Oö. Landesregierung (einschließlich<br />
Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen) verfügbare Literatur und deren Standort möglich.<br />
(2) Nach erfolgreicher Recherche von Literatur in ALEPH bestehen – in Abhängigkeit vom Standort<br />
des Werkes – verschiedene Möglichkeiten, das Werk zu entlehnen bzw. Einsicht zu nehmen,<br />
vgl. dazu §§ 7 Abs. 2 und 13 Abs. 1 lit. a. und b.<br />
(3) Wird nach Recherche in ALEPH festgestellt, dass ein bestimmtes Werk im Organisationsbereich<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung (einschließlich Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen)<br />
nicht vorhanden ist oder dass trotz Vorhandenseins ein weiteres Exemplar dieses Werkes<br />
benötigt wird, besteht im Rahmen des der jeweiligen Organisationseinheit zugewiesenen Bibliotheksbudgets<br />
die Möglichkeit eines Ankaufs durch die Amtsbibliothek (§ 6 Abs. 2).<br />
5. Abschnitt: Benutzung, Entlehnung und Fristen<br />
§ 10 Benutzung<br />
Die Benutzung des Bestandes der Amtsbibliothek kann entweder durch zweckentsprechende Einsichtnahme<br />
in die Bibliotheksprodukte, durch Kurzfrist- (Kurzzeit-)entlehnung oder durch Dauerentlehnung<br />
erfolgen.<br />
§ 11 Einsichtnahme<br />
Druckwerke und digitale Medien, die in den Räumen der Amtsbibliothek verwahrt werden, können<br />
während der Öffnungszeiten der Amtsbibliothek eingesehen werden.<br />
§ 12 Dauerentlehnung<br />
(1) Wenn es dienstliche Gründe rechtfertigen, dass einzelne Druckwerke/digitale Medien ständig<br />
im unmittelbaren Arbeitsbereich einer Organisationseinheit des Amtes der Oö. Landesregierung<br />
(einschließlich Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen) zur Verfügung stehen, können diese<br />
auch dauernd entlehnt werden.<br />
(2) Für Dauerentlehnungen gilt § 6 Abs. 2 Z. 1 – Z. 4 sinngemäß. Demnach ist eine Dauerentlehnung<br />
von den Abteilungsleitungen bzw. Dienststellenleitungen mit Budgetverantwortung unter Vorlage<br />
des entsprechenden Bestellscheines zu beantragen. Zur Dauerentlehnung vorgesehene<br />
Druckwerke werden von der Amtsbibliothek gegen Übernahmebestätigung ausgefolgt.<br />
(3) Dauerentlehnte Druckwerke/digitale Medien verbleiben im Bestand der Amtsbibliothek. Ungeachtet<br />
der dauernden Verwahrung in der anfordernden Organisationseinheit ist bei Bedarf auch<br />
Bediensteten anderer Organisationseinheiten Einsicht/Kurzzeitentlehnung in dauerentlehnte Medien<br />
zu gewähren (vgl. insofern § 7 Abs. 2). Die Entlehnung ist nachvollziehbar zu dokumentieren<br />
(Entlehnschein).<br />
186
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(4) Nicht mehr benötigte dauerentlehnte Medien sind an die Amtsbibliothek zurückzustellen.<br />
§ 13 Kurzfrist(Kurzzeit-)entlehnung<br />
(1) Bei der Abwicklung von Kurzfristentlehnungen ist nach (Dauer)Standort des Werkes zu unterscheiden:<br />
a. Ist als Standort in ALEPH die Amtsbibliothek ausgewiesen: Anforderung der benötigten Literatur<br />
bei den Bediensteten der Amtsbibliothek und nachfolgend persönliche oder auf sonstige<br />
Weise zweckmäßige (z.B. Dienstpost) Übergabe des Werkes gegen Unterfertigung eines Entlehnscheines.<br />
b. Ist als Standort in ALEPH eine andere Organisationseinheit ausgewiesen: Anforderung der benötigten<br />
Literatur direkt beim/bei der (Dauer)entlehner/in oder im Wege der Amtsbibliothek.<br />
Vorab ist abzuklären, ob nicht eine kurzfristige Einsichtnahme in das Werk vor Ort (in den<br />
Amtsräumen der jeweiligen Dauerentlehner/innen) zweckmäßig und ausreichend ist. Bei allenfalls<br />
auftretenden Interessenskonflikten entscheidet die Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-<br />
Management. Die Entlehnung ist nachvollziehbar zu dokumentieren (Entlehnschein).<br />
(2) Die Möglichkeit zur kurzfristigen Entlehnung besteht grundsätzlich nur für Bedienstete des<br />
Landes Oberösterreich. Die Entlehnung von Druckwerken oder jede andere Nutzung des Bestandes<br />
der Amtsbibliothek durch Dritte bedarf der Zustimmung der Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management.<br />
(3) Ausnahmen von Abs. 2 ergeben sich lediglich durch besondere Bestimmungen der Rechtsordnung.<br />
So ist z.B. nach § 11 des Oö. Kundmachungsgesetzes, LGBl. Nr. 55/1998, einem bestimmten<br />
Personenkreis die Einsicht in Gesetzblätter oder sonstige Druckwerke ex lege zu ermöglichen.<br />
§ 14 Entlehnfristen<br />
(1) Kurzfristentlehnung:<br />
a. Die Entlehnfrist bei kurzfristiger Entlehnung beträgt drei Wochen.<br />
b. Entlehnte Druckwerke/Medien sind vor Ablauf der Entlehnfrist zurückzugeben. Eine Verlängerung<br />
der Entlehnfrist ist möglich.<br />
c. Aus besonderen Gründen ist auch eine Verkürzung der Entlehnfrist möglich.<br />
(2) Dauerentlehnung: Dauerentlehnte Druckwerke/Medien sind zurückzugeben, wenn diese nicht<br />
mehr benötigt werden oder nicht mehr weiter verwendbar sind (z.B. durch Verlust der Aktualität),<br />
insbesondere auch bei Verwendungsänderung/ Versetzung oder Ausscheiden eines/einer Bediensteten.<br />
6. Abschnitt: Rückgabe nicht mehr benötigter Literatur,<br />
Überprüfung der Aktualität und Skartierung<br />
§ 15 Rückgabe nicht mehr benötigter Literatur<br />
Dauerentlehnte Druckwerke/digitale Medien, die von der jeweiligen Organisationseinheit nicht<br />
mehr benötigt werden, sind an die Amtsbibliothek zurückzugeben. Vor Rückgabe größerer Mengen<br />
nicht mehr benötigter Literatur (etwa aus Anlass einer Übersiedlung) ist das Einvernehmen<br />
mit der Amtsbibliothek herzustellen.<br />
§ 16 Überprüfung der Aktualität<br />
Zurückgestellte Druckwerke/digitale Medien sind von der Amtsbibliothek auf ihre Aktualität zu prüfen.<br />
Medien, die für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes der Oö. Landesregierung (einschließlich<br />
Sonderbehörden und sonstigen Einrichtungen) nicht mehr von Belang sind, können aus dem<br />
Bestand der Amtsbibliothek ausgeschieden werden.<br />
187
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
§ 17 Skartierung<br />
Kommt eine sinnvolle Weiterverwendung von Druckwerken/digitalen Medien bei den Dienststellen<br />
des Landes Oberösterreich nicht mehr in Betracht und ist auch eine wirtschaftliche Weiterveräußerung<br />
(z.B. an Antiquariate) nicht möglich, sind diese unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen<br />
durch die Amtsbibliothek zu skartieren. Jedenfalls ist vor Skartierung von Werken, die von<br />
archivarischer Relevanz sein könnten, das Einvernehmen mit dem Oö. Landearchiv herzustellen.<br />
7. Abschnitt: Schlussbestimmungen<br />
§ 18 Behandlung entlehnter Druckwerke/digitaler Medien<br />
(1) Die entlehnten (Teil)bestände der Amtsbibliothek sind von den Nutzerinnen/Nutzern schonend<br />
zu behandeln. Beschädigungen von Medien sind der Amtsbibliothek anzuzeigen, in Verlust geratene<br />
Druckwerke/Medien sind ebenfalls der Amtsbibliothek zu melden.<br />
(2) Bei dauerentlehnten Druckwerken ist es zulässig, durch Unterstreichen von Textstellen oder<br />
Anbringung von Anmerkungen, eine bessere Benutzbarkeit sicherzustellen.<br />
(3) Dem Bestand der Amtsbibliothek zugeordnete Druckwerke dürfen Geschäftsstücken bzw. Akten<br />
nicht dauernd angeschlossen werden.<br />
§ 19 Zuständigkeiten<br />
(1) Für die zweckentsprechende Verwahrung, Behandlung, Bestellung, Evidenthaltung und Rückgabe<br />
von dislozierten Amtsbibliotheksbeständen sind die Abteilungsleiter/innen bzw. Leiter/innen<br />
der jeweiligen Organisationseinheiten verantwortlich (vgl. dazu insbesondere die §§ 6 Abs. 2, 7<br />
Abs. 2, 12 Abs. 2, 14 Abs. 2 und 18 Abs. 1).<br />
(2) Die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der Bibliotheksordnung fällt in die Zuständigkeit<br />
der Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management.<br />
Die Bibliotheksordnung tritt mit 1.1.2008 in Kraft.<br />
§ 20 Inkrafttreten<br />
188
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 55 Abs. 4 <strong>DBO</strong><br />
Bürgernahe Verwaltung – Verständigung der betroffenen Personen 1<br />
1. Eine Person, deren Eingabe innerhalb von drei Wochen nach dem Einlangen nicht erledigt<br />
(Enderledigung, Zwischenerledigung, telefonische Rücksprache) werden kann, ist, sofern sich<br />
aus Z. 2 nichts anderes ergibt,<br />
a. vom Einlangen ihrer Eingabe in Kenntnis zu setzen,<br />
b. auf das Bemühen hinzuweisen, dass ihre Angelegenheit so rasch wie möglich bearbeitet<br />
wird, und<br />
c. gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass das vor der Enderledigung durchzuführende Verfahren<br />
einige Zeit in Anspruch nehmen wird.<br />
Werden Eingaben mündlich eingebracht bzw. persönlich abgegeben, ist in der Regel eine Mitteilung<br />
im Sinn der lit. b. und lit. c. erforderlich.<br />
2. Eine solche Vorgangsweise scheidet dann aus, wenn eine Mitteilung über das Einlangen der<br />
Eingabe bzw. allenfalls über die zu erwartende Bearbeitungsdauer von der betroffenen Person<br />
missverstanden werden könnte (z.B. in Straf- und Vollstreckungsverfahren; bei von Amts wegen<br />
eingeleiteten Verfahren, die einen Entzug von Rechten betreffen udgl.). Mitteilungen dieser<br />
Art können daher nur Eingaben betreffen, in denen Wünsche geäußert oder Rechte geltend<br />
gemacht werden.<br />
Weiters ist von einer Mitteilung dieser Art dann abzusehen, wenn die Annahme gerechtfertigt<br />
ist, dass die betroffene Person Klarheit darüber besitzt, dass wegen der Besonderheiten des<br />
Verfahrens (z.B. Anhörungsrechte von Interessenvertretungen; Anbote) von vornherein die Bearbeitung<br />
der Eingabe längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Dies gilt jedenfalls für Eingaben<br />
von Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen udgl.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 8. Februar 1983, PräsS-30310/3-PesW/Di/S.<br />
189
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 55 Abs. 6 <strong>DBO</strong><br />
Schriftverkehr; Anrede und Grußformel<br />
Schriftverkehr ist eine Anrede ("Sehr geehrte Frau ...", "Sehr geehrter Herr ..." etc.) und eine Grußformel<br />
("mit den besten Grüßen", "mit freundlichen Grüßen" oder ähnliche Grußformeln) zu verwenden.<br />
Ausgenommen sind nur solche Erledigungen, in denen eine persönliche Anrede in stilistischer<br />
Hinsicht störend oder zu kompliziert wäre (z.B. mehrere Adressaten eines Bescheides) oder wenn<br />
eine Grußformel missverstanden werden könnte (z.B. Aufforderung zum Antritt einer Freiheitsstrafe).<br />
Dabei ist ein strenger Maßstab zugunsten der Anrede und Grußformel anzulegen: Erledigungen,<br />
in denen Zwangsmittel nicht unmittelbar angeordnet werden (z.B. Anonymverfügungen,<br />
Straferkenntnisse etc.), haben eine Anrede und Grußformel zu enthalten.<br />
Regelungen über Amtsbezeichnungen und Unterschriftsklauseln bleiben unberührt: Die Grußformel<br />
ist vor die Unterschriftsklausel zu setzen.<br />
191
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 58 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnungen und Unterschriftsklauseln im Bereich der Hoheitsverwaltung bzw. der<br />
Privatwirtschaftsverwaltung<br />
A) Amt der Oö. Landesregierung<br />
I. Hoheitsverwaltung<br />
Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
1. "Oberösterreichische Landesregierung" "Für die Oö. Landesregierung:<br />
....................<br />
kommt nur in Betracht bei Erledigungen, die in Ausführung<br />
eines Beschlusses der Landesregierung<br />
Landeshauptmann"<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw.<br />
Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
ergehen und die von einem Mitglied der Landesregierung<br />
oder von der Landesamtsdirektorin bzw.<br />
vom Landesamtsdirektor (bzw. Landesamtsdirektor-<br />
Landesrätin bzw. Landesrat" bzw. Stellvertreterin bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter)<br />
Landesamtsdirektorin bzw. Landesamtsdirektor"<br />
genehmigt werden.<br />
bzw.<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreterin bzw.<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreter"<br />
2. "Der Landeshauptmann von Oberösterreich" "Der Landeshauptmann:<br />
In Vertretung<br />
....................<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw.<br />
Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
3. "Der Landeshauptmann von Oberösterreich" a)<br />
b)<br />
"Der Landeshauptmann:<br />
...................."<br />
"Für den Landeshauptmann:<br />
....................<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw.<br />
Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
Vertretungsweise Unterfertigung einer Verordnung<br />
des Landeshauptmannes<br />
bei Erledigungen, die der Landeshauptmann selbst<br />
genehmigt,<br />
aa) in den Angelegenheiten als Vorstand des Amtes<br />
der Landesregierung (bzw. in Ausübung der Aufsicht<br />
über den inneren Dienst),<br />
bb) in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung<br />
und in den Angelegenheiten der<br />
Landesverwaltung, für die gemäß ausdrücklicher<br />
Verfassungsbestimmung der Landeshauptmann<br />
zuständig ist,<br />
bei obigen Erledigungen (aa bis bb), die in Vertretung<br />
des Landeshauptmannes von der Landeshauptmann-Stellvertreterin<br />
bzw. vom Landeshauptmann-Stellvertreter<br />
genehmigt werden.<br />
193
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
4. "Amt der Oö. Landesregierung" bzw.<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
bei allen Erledigungen, die nicht gemäß Z. 1, 2 oder 3<br />
ausgefertigt werden, soweit nicht die Bestimmungen<br />
unter Z.5 zutreffen,<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
d)<br />
e)<br />
* "Für den Landeshauptmann:<br />
....................<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw.<br />
Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
Landesrätin bzw. Landesrat"<br />
Landesamtsdirektorin bzw. Landesamtsdirektor"<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreterin bzw.<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreter"<br />
* "Für die Oö. Landesregierung:<br />
....................<br />
Landeshauptmann"<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw.<br />
Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
Landesrätin bzw. Landesrat"<br />
Landesamtsdirektorin bzw. Landesamtsdirektor"<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreterin bzw.<br />
Landesamtsdirektor-Stellvertreter"<br />
* "Für den Landeshauptmann:<br />
Im Auftrag<br />
...................."<br />
* "Für die Oö. Landesregierung:<br />
Im Auftrag<br />
...................."<br />
"Die Landesamtsdirektorin bzw. Der Landesamtsdirektor:<br />
...................."<br />
"Die Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Der Landesamtsdirektor-Stellvertreter<br />
...................."<br />
"Im Auftrag:<br />
...................."<br />
"Für den Landesamtsdirektor:<br />
...................."<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
oder<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten der mittelbaren<br />
Bundesverwaltung, die von einem Mitglied der Landesregierung<br />
oder von der Landesamtsdirektorin bzw. vom<br />
Landesamtsdirektor (bzw. Landesamtsdirektor-<br />
Stellvertreterin bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter)<br />
genehmigt werden.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten der Landesverwaltung,<br />
die von einem Mitglied der Landesregierung<br />
oder von der Landesamtsdirektorin bzw. vom Landesamtsdirektor<br />
(bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter)<br />
genehmigt werden,<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten der mittelbaren<br />
Bundesverwaltung, soweit die Genehmigung nicht<br />
gemäß Z. 4 lit. a erfolgt,<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten der Landesverwaltung,<br />
soweit die Genehmigung nicht gemäß Z. 4 lit.<br />
b erfolgt,<br />
bei Erledigungen<br />
aa) in Angelegenheiten gemäß Z. 3 in den Fällen lit.aa<br />
und<br />
bb) in den Angelegenheiten des inneren Dienstes,<br />
die von der Landesamtsdirektorin bzw. vom Landesamtsdirektor<br />
(bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter) bzw. von Bediensteten,<br />
die hiezu berufen sind, genehmigt werden.<br />
194
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
5. "....................<br />
bei Erledigungen der beim bzw. im Amt der Oö.<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung"<br />
Landesregierung eingerichteten Sonderbehörden<br />
z.B.<br />
(§ 4 Abs. 1 <strong>DBO</strong>-A)<br />
"Oö. Landesagrarsenat<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung"<br />
.<br />
"Landesgrundverkehrskommission<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung"<br />
"Landeswahlbehörde<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung"<br />
a)<br />
"Die Vorsitzende bzw. Der Vorsitzende:<br />
....................."<br />
" Die Stellvertreterin bzw. Der Stellvertreter<br />
der bzw. des Vorsitzenden<br />
...................."<br />
"Für die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden:<br />
...................."<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
die Unterschriftsklausel richtet sich nach der Bezeichnung<br />
des genehmigenden Organes; ist die<br />
bzw. der Genehmigende Mitglied der Landesregierung,<br />
so ist unter die Unterschrift die entsprechende<br />
Funktionsbezeichnung (Landeshauptmann, Landeshauptmann-Stellvertreterin<br />
bzw. Landeshauptmann-<br />
Stellvertreter, Landesrätin bzw. Landesrat) zu setzen;<br />
dies gilt sinngemäß auch für die Unterschrift<br />
der Landesamtsdirektorin bzw. des Landesamtsdirektors<br />
(bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreters),<br />
b)<br />
"Für die Landeswahlbehörde:<br />
....................<br />
Landeswahlleiterin bzw. Landeswahlleiter"<br />
Landeswahlleiter-Stellvertreter in bzw.<br />
Landeswahlleiter-Stellvertreter "<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in den Wirkungsbereich der Wahlleiterin<br />
bzw. des Wahlleiters fällt,<br />
c)<br />
"Für die Landeswahlbehörde:<br />
....................<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender"<br />
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter der<br />
bzw. des Vorsitzenden"<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in die Zuständigkeit der Wahlbehörde (als<br />
Kollegialorgan) fällt,<br />
d)<br />
"Für die Kreiswahlbehörde:<br />
...................."<br />
Kreiswahlleiterin bzw. Kreiswahlleiter"<br />
Kreiswahleiter-Stellvertreterin bzw.<br />
Kreiswahlleiter-Stellvertreter"<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in den Wirkungsbereich der Wahlleiterin<br />
bzw. des Wahlleiters fällt,<br />
195
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Behörden- bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
e) "Für die Kreiswahlbehörde:<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
....................<br />
in die Zuständigkeit der Wahlbehörde (als<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender" bzw. Kollegialorgan) fällt,<br />
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter der<br />
bzw. des Vorsitzenden"<br />
"Amt der Oö. Landesregierung"<br />
"Für das Amt der Oö. Landesregierung:<br />
...................."<br />
bei Erledigungen, die vom Amt der Oö. Landesregierung<br />
in Wahrnehmung der Aufgaben als Abgabenbehörde<br />
erster Instanz im Sinne des § 48 der<br />
Oö. Landesabgabenordnung 1996 ergehen,<br />
Anmerkungen:<br />
a. Die Unterschriftsklauseln der Hoheitsverwaltung gelten auch dann, wenn in Ausnahmefällen Angelegenheiten der Privatwirtschaftsverwaltung<br />
erledigt werden und eine Unterschriftsklausel laut II. (Privatwirtschaftsverwaltung) nicht in Betracht kommt.<br />
b. Für den Schriftverkehr im Rahmen des Funktionsbereiches der Mitglieder der Landesregierung bzw. der Büros der Mitglieder der Landesregierung<br />
(siehe Z. 2 lit. a des Anhanges zu § 10 Abs. 5 <strong>DBO</strong>-A) mit Organisationseinheiten des Amtes der Landesregierung wurde davon abgesehen,<br />
einschlägige Formvorschriften zu erlassen. In jenem Bereich, der alle übrigen Aktivitäten umfasst, ist keine Zuständigkeit im Rahmen des<br />
inneren Dienstes gegeben.<br />
c. Hinsichtlich der Behörden(Amts-)bezeichnung und Unterschriftsklausel bei Erledigungen der überörtlichen Kontrollorgane wie zB. der Aufsichtsorgane<br />
nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und bei Vorladungen gemäß § 56 KFG gelten gesonderte Verfügungen<br />
der Abteilung Präsidiums.<br />
196
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
II. Privatwirtschaftsverwaltung<br />
Organe bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
1. "Der Landeshauptmann<br />
von Oberösterreich"<br />
bzw.<br />
"Amt der Oö. Landesregierung“<br />
bzw.<br />
"Für die Republik Österreich: 1)<br />
....................<br />
Landeshauptmann"<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw. Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
bzw.<br />
Bei Erledigungen, die vom Landeshauptmann oder von<br />
der Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw. vom Landeshauptmann-Stellvertreter<br />
unterschrieben werden<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
2. "Der Landeshauptmann<br />
von Oberösterreich"<br />
"Amt der Oö. Landesregierung"<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
"Für die Republik Österreich: 1)<br />
....................<br />
Landesrätin bzw. Landesrat"<br />
bei Erledigungen, die von einem sonstigen Mitglied der<br />
Landesregierung unterschrieben werden<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
3. "Amt der Oö. Landesregierung"<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
bzw.<br />
"Für die Republik Österreich: 1)<br />
...................."<br />
bei allen übrigen Erledigungen;<br />
4 "Oberösterreichische<br />
Landesregierung"<br />
"Amt der Oö. Landesregierung"<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
"Für das Land Oberösterreich: 2)<br />
....................<br />
Landeshauptmann"<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw. Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
Landesrätin bzw. Landesrat"<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen, die von einem Mitglied der Landesregierung<br />
unterschrieben werden,<br />
5. "Amt der Oö. Landesregierung"<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
6. "Amt der Oö. Landesregierung<br />
Verwaltung des (der) ....."<br />
Dienststellenbezeichnung<br />
Verwaltung des (der) ...<br />
bzw. "Für das Land Oberösterreich: 2)<br />
...................."<br />
bzw.<br />
bei allen übrigen Erledigungen;<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten der Verwaltung<br />
jener juristischen Personen des öffentichen Rechts,<br />
deren Geschäfte auf Grund gesetzlicher Vorschriften<br />
durch das Amt der Oö. Landesregierung, die Oö. Landesregierung<br />
oder den Landeshauptmann besorgt<br />
werden,<br />
197
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Organe bzw. Dienststellenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
z.B.<br />
"Amt der Oö. Landesregierung<br />
bei Erledigungen, die von einem Mitglied der Landesregierung<br />
unterschrieben werden,<br />
Verwaltung des Oö. Landes-<br />
bzw.<br />
Wohnungs- und Siedlungsfonds" bzw.<br />
z.B.<br />
"Abteilung Wohnbauförderung<br />
Verwaltung des Oö. Landes-<br />
Wohnungs- und Siedlungsfonds"<br />
"Für den Fonds:<br />
....................<br />
Landeshauptmann"<br />
Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw. Landeshauptmann-Stellvertreter"<br />
Landesrätin bzw. Landesrat"<br />
Für den Fonds:<br />
...................."<br />
bzw.<br />
bei allen übrigen Erledigungen.<br />
Anmerkungen:<br />
1)<br />
In den Angelegenheiten, in denen der Bund Träger von Privatrechten ist.<br />
2)<br />
In den Angelegenheiten, in denen das Land Träger von Privatrechten ist.<br />
B) Bezirkshauptmannschaften und Agrarbezirksbehörde für Oberösterreich<br />
I. Hoheitsverwaltung<br />
Behördenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
1. "Bezirkshauptmannschaft ............................" a) "Die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann:<br />
bei Erledigungen, die von der Bezirkshauptfrau bzw.<br />
vom Bezirkshauptmann genehmigt werden,<br />
...................."<br />
2. Außenstellen der Bezirkshauptmannschaften<br />
führen je nach dem Inhalt ihrer Tätigkeit nachstehende<br />
Bezeichnungen (beispielsweise Aufzählung):<br />
a) Bezirkshauptmannschaft...............................<br />
Jugendwohlfahrt-Außenstelle........................<br />
198<br />
b) Bezirkshauptmannschaft...............................<br />
Forstaufsichtsstelle .......................................<br />
b)<br />
"Für die Bezirkshauptfrau bzw. den Bezirkshauptmann:<br />
...................."<br />
"Für die Bezirkshauptfrau bzw. den Bezirkshauptmann:<br />
...................."<br />
bei Erledigungen, die von anderen Bediensteten genehmigt<br />
werden.
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Behördenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
bei Erledigungen der bei einer Bezirkshauptmannschaft<br />
in gesetzlich bestimmten Einzelfällen eingerichteten<br />
Sonderbehörden<br />
3. " .........................................................................<br />
bei der Bezirkshauptmannschaft ....................."<br />
z.B.<br />
"Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis ..............<br />
bei der Bezirkshauptmannschaft ....................."<br />
a)<br />
"Für die Kreiswahlbehörde:<br />
....................<br />
Kreiswahlleiterin bzw. Kreiswahlleiter"<br />
Kreiswahlleiter-Stellvertreterin bzw.<br />
Kreiswahlleiter-Stellvertreter "<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in den Wirkungsbereich der Wahlleiterin<br />
bzw. des Wahlleiters fällt,<br />
"Bezirkswahlbehörde.........................................<br />
bei der Bezirkshauptmannschaft......................"<br />
b)<br />
a)<br />
"Für die Kreiswahlbehörde:<br />
....................<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender"<br />
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter der<br />
bzw. des Vorsitzenden"<br />
"Für die Bezirkswahlbehörde:<br />
....................<br />
Bezirkswahlleiterin bzw. Bezirkswahlleiter<br />
"<br />
Bezirkswahlleiter-Stellvertreterin bzw.<br />
Bezirkswahlleiter-Stellvertreter "<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in die Zuständigkeit der Wahlbehörde (als<br />
Kollegialorgan) fällt,<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in den Wirkungsbereich des Wahlleiters fällt<br />
4. "Agrarbezirksbehörde für Oberösterreich" a)<br />
b)<br />
b)<br />
"Für die Bezirkswahlbehörde:<br />
....................<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender"<br />
Stellvertreterin bzw. Stellvertreter des<br />
Vorsitzenden"<br />
"Für die Agrarbezirksbehörde:<br />
....................<br />
Amtsvorständin bzw. Amtsvorstand"<br />
die technische Leiterin bzw. der technische<br />
Leiter"<br />
"Für die Agrarbezirksbehörde:<br />
Im Auftrag<br />
...................."<br />
bzw.<br />
bzw.<br />
bei Erledigungen in Angelegenheiten, deren Wahrnehmung<br />
in die Zuständigkeit der Wahlbehörde (als<br />
Kollegialorgan) fällt.<br />
bei Erledigungen, die von der Amtsvorständin bzw.<br />
vom Amtsvorstand bzw. von der technischen Leiterin<br />
bzw. vom technischen Leiter der Agrarbezirksbehörde<br />
genehmigt werden,<br />
bei Erledigungen, die von anderen Bediensteten genehmigt<br />
werden.<br />
199
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
II. Privatwirtschaftsverwaltung<br />
Behördenbezeichnung Unterschriftsklauseln Anmerkungen über den Anwendungsbereich<br />
1. "Bezirkshauptmannschaft ....................................<br />
"Für das Land Oberösterreich 1<br />
....................<br />
Bezirkshauptfrau bzw. Bezirkshauptmann"<br />
"Für die Republik Österreich 2<br />
....................<br />
Bezirkshauptfrau bzw. Bezirkshauptmann"<br />
bei Erledigungen, die von der Bezirkshauptfrau bzw.<br />
vom Bezirkshauptmann gezeichnet werden. Zeichnet<br />
eine andere bevollmächtigte Bedienstete bzw. ein<br />
anderer bevollmächtigter Bediensteter, entfällt die<br />
Funktionsbezeichnung "Bezirkshauptfrau bzw. Bezirkshauptmann".<br />
2. "Agrarbezirksbehörde Oberösterreich"<br />
Die Ausführungen unter Z. 1 gelten sinngemäß<br />
Anmerkungen:<br />
1)<br />
In den Angelegenheiten, in denen der Bund Träger von Privatrechten ist.<br />
2)<br />
In den Angelegenheiten, in denen das Land Träger von Privatrechten ist.<br />
200
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 60 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Vermerke auf dem Erledigungsentwurf<br />
Folgende Vermerke für die kanzleimäßige Behandlung kommen insbesondere in Betracht:<br />
a) die Ordnungszahlen miterledigter Geschäftsstücke<br />
b) die Ordnungszahlen miterledigter Geschäftsstücke bzw. der Vermerk "offene Subzahlen" sind<br />
unmittelbar unter dem Geschäftszeichen nach dem Ausdruck "miterl." anzuführen;<br />
c) Vermerke über die vertrauliche Behandlung des Geschäftsstücks oder Aktes bzw. deren Bezeichnung<br />
als Verschlusssache (siehe den Anhang zu § 70 Abs. 1);<br />
d) Dringlichkeitsvermerke ("SOFORT", "AM ... ABSENDEN"): Der Dringlichkeitsvermerk "SO-<br />
FORT" soll die beschleunigte Ausfertigung, Weiterleitung oder Zusendung einer Erledigung<br />
bewirken. Ein mit "SOFORT" gekennzeichnetes Geschäftsstück hat Vorrang in der kanzleimäßigen<br />
Behandlung vor anderen Geschäftsstücken. Dieser Dringlichkeitsvermerk darf von der<br />
Bearbeiterin bzw. vom Bearbeiter nur in begründeten Fällen verwendet werden. Darüber hinaus<br />
kann die Bearbeiterin bzw. der Bearbeiter einen bestimmten Termin für das Absenden festsetzen,<br />
wenn sie bzw. er erwarten bzw. dafür sorgen kann, dass die kanzleimäßige Behandlung<br />
termingerecht erfolgen kann (z.B. "AM ... ABSENDEN");<br />
e) Zustellvermerke ("RSa", "RSb", "Einschreiben") und Übermittlungsvermerke ("FAX", "EDV"):<br />
Die Zustellung mittels Rückschein ist nur in begründeten Fällen durch einen Zustellvermerk<br />
("RSa", "RSb", "Einschreiben") festzulegen; sie ist innerhalb der Behörde unzulässig. Durch<br />
Vermerk ist ferner festzulegen, ob eine Erledigung mit Telefax ("FAX", siehe Anhang zu § 52<br />
Abs. 1) oder mit E-Mail weiterzuleiten ist. Bezüglich der Zustellung von Verschlusssachen siehe<br />
Anhang zu § 70 Abs. 1;<br />
f) Vermerke, die die Ausfertigung betreffen ("unter Abschrift von ..."; "auf Eingangsstück", "mit<br />
Formular ..." u.dgl.);<br />
g) soll eine Erledigung, die an mehrere Empfänger gerichtet ist, an die einzelnen Empfänger gesondert<br />
ergehen, so ist der Vermerk "je gesondert" zu setzen;<br />
h) Vermerke über anzuschließende Beilagen (siehe § 58 Abs. 6);<br />
i) Vermerke über die Mitbeteiligung ("zK", "zM");<br />
j) Vorlage der Reinschrift zur Unterschrift ("RzU");<br />
k) Hinweise für die kanzleimäßige Behandlung, dass der Bezug zu anderen Akten herzustellen ist<br />
oder solche Akten anzuschließen sind;<br />
l) Verwendung von Briefmarken oder Stempelmarken;<br />
m) Wiedervorlage ("Wv") bzw. Sammelvorlage ("Sv");<br />
n) Bei Verwendung der EDV-Textverarbeitung: "Löschen" für nicht mehr benötigte bzw. "Auslagern"<br />
für in absehbarer Zeit wieder benötigte Texte.<br />
201
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 64 <strong>DBO</strong><br />
Amtssiegel; Landessiegel<br />
(1) Das Amtssiegel ist rund und zeigt das Landeswappen (LGBl. Nr. 126/1997). Weiters zeigt es<br />
beim Amt der Oö. Landesregierung die Nummer des Amtssiegel-Stempels (im Folgenden kurz:<br />
Stempel) und die Bezeichnung "Amt der Oö. Landesregierung", bei den Bezirkshauptmannschaften<br />
bzw. bei der Agrarbezirksbehörde in Umschrift die Bezeichnung der Behörde sowie die Nummer<br />
des Stempels.<br />
(2) Das Amtssiegel kann entweder durch Aufdruck mit einem Rundstempel oder durch Eindruck<br />
mit einem Prägestempel (Hochdruckstempel) auf den in Betracht kommenden Schriftstücken angebracht<br />
werden. Soweit nicht Rechtsvorschriften eine dieser Arten vorschreiben, stehen beide<br />
zur Wahl. Die erforderlichen Stempel (Rundstempel und Prägestempel) sind bei der Abteilung<br />
Gebäude- und Beschaffungs-Management anzufordern.<br />
(3) Das Amtssiegel darf, soweit die Verwendung in den einschlägigen Rechtsvorschriften nicht<br />
ausdrücklich näher geregelt ist, nur auf Schriftstücken angebracht werden, die öffentliche oder<br />
privatrechtliche Urkunden sind und wegen ihrer Bedeutung einer besonderen Hervorhebung bedürfen<br />
(z.B. Zeugnisse, Legitimationen, Bestätigungen udgl.), oder wenn es aus anderen Gründen<br />
zweckmäßig oder geboten ist.<br />
(4) Nach Erfordernis sind die einzelnen Stempel jenen Bediensteten zu überantworten, die Schriftstücke<br />
gemäß Abs. 3 ausfertigen. Jede bzw. jeder dieser Bediensteten übernimmt mit der Ausfolgung<br />
eines Stempels die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Gebrauch und für die gesicherte<br />
Verwahrung des Stempels. Unter ihrer bzw. seiner Verantwortung kann sie bzw. er auch<br />
anderen Bediensteten den Stempel zur Ausfertigung von Schriftstücken gemäß Abs. 3 benützen<br />
lassen. Festzulegen ist ferner, wer die Verantwortung und die Verpflichtung gemäß Abs. 6 im Verhinderungsfall<br />
übernimmt.<br />
(5) Bei der Übergabe eines Stempels (Abs. 4) ist die bzw. der Bedienstete über ihre bzw. seine<br />
Verantwortung und die damit verbundenen Pflichten zu belehren. Dies gilt sinngemäß für die Ü-<br />
bergabe im Verhinderungsfall. Die Übernahme des Stempels und die erfolgte Belehrung hat die<br />
bzw. der Bedienstete schriftlich zu bestätigen; diese Bestätigung ist beim Vormerk (Abs. 7) zu hinterlegen.<br />
(6) Beim Amt der Oö. Landesregierung ist das Abhandenkommen eines Stempels sowie jede<br />
missbräuchliche Verwendung unverzüglich der Abteilung Präsidium zu melden. Von der Abteilung<br />
Präsidium wird dann im Wege der Abteilung Presse eine Ungültigkeitserklärung in der Amtlichen<br />
Linzer Zeitung veranlasst. Ist ein Stempel unbrauchbar geworden oder ist die Voraussetzung für<br />
seine Überantwortung an eine bestimmte Mitarbeiterin bzw. einen bestimmten Mitarbeiter nicht<br />
mehr gegeben, so ist der Stempel ohne Verzug rückzustellen bzw. einzuziehen.<br />
Bei den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde ist das Abhandenkommen eines<br />
Stempels sowie jede missbräuchliche Verwendung unverzüglich der Amtsleitung zu melden.<br />
Ist ein Stempel unbrauchbar geworden oder ist die Voraussetzung für seine Überantwortung an<br />
eine bestimmte Mitarbeiterin bzw. einen bestimmten Mitarbeiter nicht mehr gegeben, so ist der<br />
Stempel ohne Verzug rückzustellen bzw. einzuziehen. Bei Verlust eines Amtssiegels hat die Bezirkshauptmannschaft<br />
bzw. die Agrarbezirksbehörde eine Ungültigkeitserklärung in der Amtlichen<br />
Linzer Zeitung (im Wege der Abteilung Presse beim Amt der Landesregierung) veröffentlichen zu<br />
lassen.<br />
(7) Beim Amt der Landesregierung die Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management, bei<br />
den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde die Amtsleitung hat einen Vormerk<br />
darüber zu führen, welchen Bediensteten (Abs. 4) die einzelnen Stempel überantwortet wurden<br />
203
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
und welche Stempel bzw. wann sie wegen Unbrauchbarkeit vernichtet wurden (Amtssiegel-<br />
Stempelvormerk).<br />
(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten für das Landessiegel (Umschrift "Land Oberösterreich") sinngemäß mit<br />
der Maßgabe, dass der Vormerk im Sinne des Abs. 7 im Bereich der Direktion Finanzen zu führen<br />
ist.<br />
204
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 70 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Verschlusssachen; vertrauliche Geschäftsstücke<br />
§ 1<br />
Verschlusssachen<br />
(1) Verschlusssachen sind alle Geschäftsstücke, die<br />
a) als Verschlusssachen an das Amt der Landesregierung bzw. die Bezirkshauptmannschaft bzw.<br />
die Agrarbezirksbehörde gelangen oder<br />
b) im Verlauf der Bearbeitung beim Amt der Landesregierung bzw. der Bezirkshauptmannschaft<br />
bzw. der Agrarbezirksbehörde wegen ihres Inhaltes, insbesondere weil sie<br />
• Grundsätze über die Umfassende Landesverteidigung zum Inhalt haben,<br />
• die Funktionsfähigkeit staatlicher Organe und besonders wichtiger Einrichtungen staatlicher<br />
und nichtstaatlicher Art betreffen,<br />
• staatspolitisch bedeutsame Richtlinien der Regierungspolitik enthalten, soweit sie nicht in<br />
den gesetzgebenden Organen behandelt werden oder zur Information der Öffentlichkeit bestimmt<br />
sind,<br />
zur Verschlusssache erklärt werden müssen.<br />
(2) Die Erklärung eines Geschäftsstückes zur Verschlusssache im Verlauf der Bearbeitung beim<br />
Amt der Landesregierung bzw. bei der Bezirkshauptmannschaft bzw. bei der Agrarbezirksbehörde<br />
hat die zuständige Bearbeiterin bzw. der zuständige Bearbeiter bzw. ein dieser bzw. diesem Vorgesetzte<br />
bzw. ein dieser bzw. diesem Vorgesetzter durch Anbringen des entsprechenden Vermerks<br />
(§ 2) vorzunehmen. Der Widerruf dieser Erklärung ist beim Wegfall der Voraussetzungen<br />
von der Abteilungsleiterin bzw. vom Abteilungsleiter bzw. von der Bezirkshauptfrau bzw. vom Bezirkshauptmann<br />
bzw. von der Amtsvorständin bzw. vom Amtsvorstand bzw. einer sachlich übergeordneten<br />
Behörde (Dienststelle) vorzunehmen, sofern nicht durch eine zulässige Veröffentlichung<br />
bzw. Bekanntgabe der Zweck der Verschlusshaltung bereits weggefallen ist.<br />
§ 2<br />
Kennzeichnung<br />
Alle Verschlusssachen müssen durch den Vermerk "Verschluss" deutlich gekennzeichnet sein.<br />
Dieser Vermerk ist auf allen als Verschlusssache zu behandelnden Geschäftsstücken deutlich<br />
erkennbar und nach Möglichkeit rechts oben anzubringen, soweit dieser Vermerk nicht bereits<br />
durch externe Stellen angebracht wurde.<br />
§ 3<br />
Besondere Verpflichtung<br />
(1) Der Inhalt von Verschlusssachen darf – außer der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter<br />
bzw. der Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilungsgruppe bzw. der Bezirkshauptfrau bzw. dem Bezirkshauptmann<br />
bzw. der Amtsvorständin bzw. dem Amtsvorstand – nur jenen namentlich benannten<br />
Bediensteten zur Kenntnis gelangen, die unmittelbar damit befasst sind; dieser Personenkreis<br />
ist möglichst klein zu halten.<br />
(2) Der in Abs. 1 genannte Personenkreis hat dafür Sorge zu tragen, dass der Inhalt von Verschlusssachen<br />
unbefugten Personen nicht zur Kenntnis gelangt; insbesondere ist sicherzustellen,<br />
dass Verschlussakten bzw. Verschlusssachen so aufbewahrt werden, dass nur befugte Personen<br />
Zugang haben.<br />
205
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
(3) Die kanzleimäßige Behandlung von Verschlusssachen hinsichtlich des Anlegens und der Evidenz<br />
der Akten ist in der Kanzleiordnung 1 geregelt.<br />
(4) Auskünfte in Verschlussangelegenheiten dürfen nur nach den Anordnungen der Abteilungsleiterin<br />
bzw. des Abteilungsleiters bzw. der Bezirkshauptfrau bzw. des Bezirkshauptmannes bzw. der<br />
Amtsvorständin bzw. des Amtsvorstandes von den zuständigen Bearbeiterinnen bzw. Bearbeitern<br />
bzw. Vorgesetzten erteilt werden.<br />
§ 4<br />
Weitergabe<br />
(1) Sind Verschlusssachen (Verschlussakten) innerhalb des Amtes bzw. der Bezirkshauptmannschaft<br />
bzw. der Agrarbezirksbehörde weiterzugeben, so hat diese Weitergabe in der Regel unmittelbar<br />
(von Hand zu Hand) zwischen befugten Bediensteten zu erfolgen.<br />
(2) Erfolgt die Weitergabe unter Heranziehung von anderen Bediensteten (Botin bzw. Boten), so<br />
ist die Verschlusssache (der Verschlussakt) in einem verschlossenen Kuvert weiterzugeben.<br />
§ 5<br />
Beförderung durch die Post<br />
(1) Sollen Verschlusssachen durch die Post befördert werden, so sind sie<br />
a. nur an namentlich benannte Personen oder an deren Vertreterin bzw. Vertreter ("zu eigenen<br />
Handen"),<br />
b. gegen Zustellnachweis und<br />
c. mit zweifachem Umschlag zu versenden.<br />
(2) Hiebei ist folgende Vorgangsweise einzuhalten:<br />
Der innere Umschlag mit den zu befördernden Schriftstücken ist mit dem Vermerk "Verschlusssache"<br />
zu kennzeichnen. Wenn es die besondere Bedeutung der Verschlusssache erforderlich<br />
macht, ist in den inneren Umschlag ein vorbereiteter Empfangsnachweis einzulegen, um dessen<br />
Rücksendung nach eigenhändiger Bestätigung die Adressatin bzw. der Adressat zu ersuchen ist.<br />
Der verschlossene innere Umschlag ist der Poststelle bzw. der Auslaufstelle mit den erforderlichen<br />
Aufträgen zuzuleiten. Die weitere Vorgangsweise der Poststelle bzw. der Auslaufstelle ist in der<br />
Kanzleiordnung 1 geregelt.<br />
§ 6<br />
Vertrauliche Geschäftsstücke<br />
(1) Ist für Geschäftsstücke eine Erklärung als Verschlusssache auf Grund des Inhaltes nicht erforderlich,<br />
die vertrauliche Behandlung dieser Geschäftsstücke jedoch trotzdem geboten, sind diese<br />
Geschäftsstücke unter sinngemäßer Anwendung des § 2 durch den Vermerk "Vertraulich" zu<br />
kennzeichnen.<br />
(2) Für vertrauliche Geschäftsstücke gelten § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 3 und 4 sinngemäß.<br />
(3) Im Übrigen hat die Abteilungsleiterin bzw. der Abteilungsleiter bzw. die Bezirkshauptfrau bzw.<br />
der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand erforderlichenfalls durch<br />
Dienstanweisung sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit gewisser Geschäftsstücke gewahrt<br />
bleibt; in diesen Dienstanweisungen kann insbesondere eine sinngemäße Anwendung weiterer<br />
Bestimmungen dieses Anhanges angeordnet werden.<br />
1<br />
Bei den Bezirkshauptmannschaften und der Agrarbezirksbehörde ist bis zum Inkrafttreten einer Kanzleiordnung<br />
in diesem Bereich wie immer vorzugehen.<br />
206
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 70 Abs. 2 <strong>DBO</strong><br />
Vertraulichkeit von Schriftstücken – Schutz berechtigter<br />
Interessen von Personen 1<br />
Der überwiegende Anteil unserer Geschäftsstücke betrifft Vorgänge, die zwar unter die Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
fallen, darüber hinaus aber zu keinen besonderen Vorkehrungen Anlass<br />
geben. Ein eher kleiner Anteil ist gemäß <strong>DBO</strong> zu Verschlusssachen zu erklären oder als "Vertraulich"<br />
zu bezeichnen.<br />
Darüber hinaus ist jedoch denjenigen Geschäftsstücken, die Informationen über Personen enthalten,<br />
die zum Schutz berechtigter Interessen der Betroffenen nur einem auf die unmittelbar dienstliche<br />
Notwendigkeit abgestimmten Personenkreis zugänglich sein sollten, besondere Aufmerksamkeit<br />
zu schenken. Darunter fällt auch ein Teil des in der Personalverwaltung anfallenden Schriftverkehrs.<br />
Es wird daher ersucht, in Hinkunft gerade diesem Bereich hinsichtlich der Zugänglichkeit zu den<br />
darin enthaltenen Informationen gerade auf dem Übermittlungsweg auch innerhalb einer Organisationseinheit<br />
besonderes Augenmerk zu schenken und den Kreis der damit befassten Mitarbeiter<br />
zu überprüfen und so klein wie möglich zu halten. Geschäftsstücke mit entsprechendem Inhalt<br />
sollten grundsätzlich im Einzel- oder Sammelkuvert versandt und sowohl die Berechtigung zum<br />
Öffnen und Verteilen sowie die Zugriffsberechtigungen und der Zugang zu den Akten, soweit die<br />
Notwendigkeit solche anzulegen überhaupt gesehen wird, restriktiv gehandhabt werden.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 10. April 2000, PräsI-120010/15-2000-Ri/Bi.<br />
207
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 71 <strong>DBO</strong><br />
Äußere Form der Regierungssitzungsstücke; Arbeitsablauf vor und nach der<br />
Behandlung in der Sitzung der Oö. Landesregierung<br />
I.<br />
Äußere Form der Regierungssitzungsstücke<br />
(1) Das Regierungssitzungsstück ist im äußeren Aufbau wie folgt zu gliedern:<br />
1. Abteilung, Geschäftszeichen und Bezeichnung des Gegenstandes sowie rechts oben ein großes<br />
rotes "V" (Vortrag in der Regierungssitzung),<br />
2. Amtsvortrag (Abs. 2),<br />
3. Antrag (Abs. 3),<br />
4. Zeichnungsvermerk (Abs. 4),<br />
5. Allfällige Geschäftsgang- und Kanzleivermerke (Abs. 5).<br />
(2) Der Amtsvortrag ist als solcher zu bezeichnen und hat die Sachverhaltsdarstellung einschließlich<br />
der allfälligen rechtlichen Begründung des Antrages übersichtlich und kurz gefasst zu enthalten.<br />
Der Antrag muss aus dem Amtsvortrag schlüssig sein. Für die Erstellung des Amtsvortrages<br />
sind ausschließlich die allen Abteilungen des Amtes der Oö. Landesregierung zur Verfügung gestellten<br />
Vorlagen ("Smiley") zu verwenden. Der Amtsvortrag ist – außer in begründeten Ausnahmefällen<br />
– in schwarz-weiß auszudrucken und das "V" in rot nachzuziehen.<br />
(3) Für den Antrag gilt Folgendes:<br />
1. Er ist als solcher zu bezeichnen und durch die Wendung "Die Oö. Landesregierung möge beschließen:"<br />
einzuleiten.<br />
2. Er ist so zu formulieren, wie der Beschluss der Landesregierung erfolgen soll; zB. "Dem Verein<br />
N.N. wird für … eine Förderung von Euro … gewährt."<br />
3. Werden Geldbeträge angeführt, so sind diese in Ziffern und in Worten darzustellen.<br />
4. Wird eine Gemeinde genannt, so ist in Klammer der politische Bezirk, dem die Gemeinde zugehört,<br />
anzuführen.<br />
5. Kann der Antrag nicht in wenigen klaren Sätzen gefasst werden (zB. bei einer Gesetzesvorlage<br />
an den Landtag, bei einem Vertragsabschluss) oder ist es aus anderen Gründen zweckmäßig,<br />
so ist der wesentliche Inhalt des Antrages in einer (mehreren) Beilage(n) zu umschreiben.<br />
In diesem Fall ist der Inhalt der Beilage (Beilagen) in den Antrag etwa durch folgende<br />
Formulierung einzubeziehen: "Die Verordnung der Oö. Landesregierung … wird in der aus der<br />
Beilage ersichtlichen Fassung erlassen."<br />
6. Z. 5 gilt sinngemäß für den Fall, dass Berichte, Sachverhaltsdarstellungen udgl. im unmittelbaren<br />
Zusammenhang mit einem Antrag stehen, jedoch nicht im Wortlaut Beschlussinhalt sein<br />
sollen, sondern nur Voraussetzung für den beantragten Beschluss bilden. Der Antrag hat gegebenenfalls<br />
zu lauten: "Der aus der Beilage ersichtliche Bericht betreffend … wird zur Kenntnis<br />
genommen." Dies gilt sinngemäß auch, wenn im Antrag auf Ausführungen im Amtsvortrag<br />
hingewiesen wird (zB. "Der im Amtsvortrag dargelegte Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.").<br />
(4) Auf das Regierungssitzungsstück ist unterhalb des Textes des Antrages – allerdings noch in<br />
klarem Zusammenhang mit dem Text (jedenfalls nicht allein auf einer Seite) – mit Textverarbeitung<br />
folgender Zeichnungsvermerk anzubringen.<br />
209
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Dieser hat bei Abteilungen, die keiner Abteilungsgruppe zugeordnet sind, wie folgt auszuschauen:<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender in der Regierungssitzung:<br />
Mitglied der Oö. Landesregierung:<br />
Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter:<br />
Bearbeiterin bzw. Bearbeiter:<br />
<br />
Dieser Bereich ist für Geschäftsgangsvermerke<br />
(siehe I. Abs. 5) und für Vermerke der Schriftführerin<br />
bzw. des Schriftführers über die Beschlussfassung<br />
(siehe III. Abs. 3) freizuhalten.<br />
Bei Abteilungen, die einer Abteilungsgruppe zugeordnet sind, hat der Zeichnungsvermerk wie folgt<br />
auszuschauen:<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender in der Regierungssitzung:<br />
Mitglied der Oö. Landesregierung:<br />
Leiterin bzw. Leiter der Abteilungsgruppe:<br />
Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter:<br />
Bearbeiterin bzw. Bearbeiter:<br />
<br />
Dieser Bereich ist für Geschäftsgangsvermerke<br />
(siehe I. Abs. 5) und für Vermerke der Schriftführerin<br />
bzw. des Schriftführers über die Beschlussfassung<br />
(siehe III. Abs. 3) freizuhalten.<br />
210
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Bei Abteilungen, die einer Abteilungsgruppe zugeordnet sind und von der Abteilungsgruppenleiterin<br />
bzw. vom Abteilungsgruppenleiter selbst geleitet werden, hat der Zeichnungsvermerk wie folgt<br />
auszuschauen:<br />
Vorsitzende bzw. Vorsitzender in der Regierungssitzung:<br />
Mitglied der Oö. Landesregierung:<br />
Leiterin bzw. Leiter der Abteilungsgruppe und Abteilungsleiterin<br />
bzw. Abteilungsleiter:<br />
Bearbeiterin bzw. Bearbeiter:<br />
<br />
Dieser Bereich ist für Geschäftsgangsvermerke<br />
(siehe I. Abs. 5) und für Vermerke der Schriftführerin<br />
bzw. des Schriftführers über die Beschlussfassung<br />
(siehe III. Abs. 3) freizuhalten.<br />
Der Zeichnungsvermerk ist folgendermaßen auszufüllen, wobei die jeweils nicht benötigte Genderform<br />
entfallen kann.<br />
1. In die Zeile "Bearbeiterin bzw. Bearbeiter:" ist aufzunehmen:<br />
a. Name der Bearbeiterin bzw. des Bearbeiters und<br />
b. datierte Unterschrift der Bearbeiterin bzw. des Bearbeiters.<br />
2. In die Zeile "Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter:" ist aufzunehmen:<br />
a. Name der Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiters bzw. im Fall der Verhinderung Name<br />
der Vertreterin bzw. des Vertreters mit vorangestelltem "i.V.",<br />
b. datierte Unterschrift der Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiters 1 bzw. der Vertreterin bzw.<br />
des Vertreters,<br />
c. lit. a und lit. b gelten sinngemäß zum Beispiel für die Leiterin bzw. den Leiter von Abteilungsgruppen<br />
und für die Landesamtsdirektorin bzw. den Landesamtsdirektor (Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter), wenn eine bzw.<br />
einer dieser Bediensteten das Regierungssitzungsstück selbst abgefasst hat.<br />
d. Für den Sonderfall, dass ein Amtsvortrag von einem Büro eines Mitglieds der Oö. Landesregierung<br />
erstellt wird, tritt anstelle der Abteilungsleiterin bzw. des Abteilungsleiters die Leiterin<br />
bzw. der Leiter des Büros des Mitglieds der Oö. Landesregierung. In diesem Fall ist<br />
der Zeichnungsvermerk für Abteilungen, die keiner Abteilungsgruppe zugeordnet sind, zu<br />
verwenden und in der Zeile "Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter:" stattdessen die Leiterin<br />
bzw. der Leiter des Büros aufzunehmen; in diesem Fall ist die Zeile mit "Dienststellenleiterin<br />
bzw. Dienststellenleiter:" zu bezeichnen. Alle Bestimmungen dieses Anhangs gelten<br />
sinngemäß.<br />
3. In die Zeile "Leiterin bzw. Leiter der Abteilungsgruppe:" ist aufzunehmen:<br />
a. Name der Leiterin der Abteilungsgruppe bzw. des Leiters der Abteilungsgruppe bzw. im<br />
Fall der Verhinderung Name der Vertreterin bzw. des Vertreters mit vorangestelltem "i.V.";<br />
b. datierte Unterschrift der Leiterin bzw. des Leiters der Abteilungsgruppe 1 bzw. der Vertreterin<br />
bzw. des Vertreters;<br />
1<br />
Diese Aufgabe ist nicht delegierbar.<br />
211
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
c. in besonders begründeten Fällen kann die Leiterin bzw. der Leiter einer Abteilungsgruppe 1<br />
mit Zustimmung der Landesamtsdirektorin bzw. des Landesamtsdirektors verfügen, dass<br />
ihr bzw. ihm bestimmte Kategorien von Amtsvorträgen nicht zur Mitzeichnung vorzulegen<br />
sind. In diesen Fällen ist statt des Namens der Leiterin bzw. des Leiters der Abteilungsgruppe<br />
sowie ihrer bzw. seiner Unterschrift ein Verweis auf diese Ausnahmeregelung aufzunehmen;<br />
d. lit. a und lit. b gelten sinngemäß zum Beispiel für die Leiterin bzw. den Leiter von Abteilungsgruppen<br />
und für die Landesamtsdirektorin bzw. den Landesamtsdirektor (Landesamtsdirektor-Stellvertreterin<br />
bzw. Landesamtsdirektor-Stellvertreter), wenn eine bzw.<br />
einer dieser Bediensteten das Regierungssitzungsstück selbst abgefasst hat.<br />
4. In die Zeile "Mitglied der Oö. Landesregierung:" ist der Name des nach der Geschäftsverteilung<br />
der Landesregierung zuständigen Mitglieds der Oö. Landesregierung einzusetzen.<br />
5. In die Zeile "Vorsitzende bzw. Vorsitzender in der Regierungssitzung:" ist der Name des Landeshauptmannes<br />
einzusetzen.<br />
(5) Mitbeteiligungsvermerke und sonstige Geschäftsgangs- und Kanzleivermerke sind unterhalb<br />
des Antragstextes anzubringen.<br />
II.<br />
Arbeitsablauf vor der Behandlung in der Sitzung<br />
der Oö. Landesregierung; Sitzungsbogen<br />
(1) Das Regierungssitzungsstück ist mit den allfälligen Beilagen und dazugehörigen Akten dem<br />
zuständigen Mitglied der Oö. Landesregierung vorzulegen.<br />
(2) Sofern das Mitglied der Oö. Landesregierung das Regierungssitzungsstück in einer der nächsten<br />
Sitzungen der Landesregierung vortragen will, setzt sie bzw. er in den Zeichnungsvermerk ihre<br />
bzw. seine datierte Unterschrift und gibt das Regierungssitzungsstück samt allfälligen Beilagen an<br />
die zuständige Abteilung zurück.<br />
(3) Die zuständige Abteilung hat die vorbereiteten Anträge der Mitglieder der Oö. Landesregierung<br />
aus ihrem Aufgabenbereich – für jedes Mitglied der Landesregierung gesondert – auf einem Sitzungsbogen<br />
zusammenzufassen; dabei ist ausschließlich die allen Abteilungen des Amtes der Oö.<br />
Landesregierung zur Verfügung gestellte Vorlage zu verwenden. Es liegt in der alleinigen Verantwortlichkeit<br />
der zuständigen Abteilung, dass nur Regierungssitzungsstücke, die die notwendigen<br />
Voraussetzungen erfüllen (insbesondere alle Unterschriften aufweisen), in den Sitzungsbogen<br />
aufgenommen werden und dass der Antrag auf dem Regierungssitzungsstück und dem Sitzungsbogen<br />
vollkommen ident ist.<br />
(4) Die Sitzungsbogen sind nach folgendem Muster zu erstellen:<br />
Mitglied der Oö. Landesregierung:<br />
Regierungssitzung<br />
am ….<br />
Seite … von …<br />
Lfd.Nr.<br />
Aktenzahl:<br />
A n t r a g<br />
Anmerkungen:<br />
Gegenstand:<br />
Die Oö. Landesregierung möge beschließen:<br />
(5) In den Regierungssitzungsbogen sind einzutragen:<br />
a. Datum der Regierungssitzung;<br />
b. Name des Mitglieds der Oö. Landesregierung;<br />
212
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
c. Geschäftszeichen des Regierungssitzungsstückes und Gegenstandsbezeichnung;<br />
d. Antrag des Regierungssitzungsstückes, und zwar – außer im Falle offenkundiger Tippfehler –<br />
buchstabengetreu.<br />
Die Spalte "Anmerkungen" ist ausschließlich von der Schriftführerin bzw. vom Schriftführer zu befüllen.<br />
(6) Das Regierungssitzungsstück samt dazugehörigen Beilagen im Original ist in einem entsprechend<br />
gekennzeichneten Aktenumschlag von der zuständigen Abteilung der Poststelle zu übermitteln;<br />
die Verantwortung dafür, dass alle Beilagen dem jeweiligen Regierungssitzungsstück korrekt<br />
angeschlossen werden, trägt die zuständige Abteilung. Der Sitzungsbogen ist von der zuständigen<br />
Abteilung – für jedes Mitglied der Landesregierung gesondert – dem Lis@-Zentrum elektronisch<br />
zu übermitteln. Die Übermittlung an das Lis@-Zentrum darf ausschließlich vom offiziellen Abteilungspostfach<br />
an die bekannt gegebene Postadresse für Regierungssitzungen (vgl. II. Abs. 8) erfolgen.<br />
(7) Jedem Sitzungsbogen sind die dazugehörigen Beilagen anzuschließen (Abschnitt I Abs. 3 Z. 5<br />
und 6). Wird im Antrag auf den Amtsvortrag hingewiesen, ist eine Ausfertigung des Amtsvortrages<br />
als Beilage anzuschließen. Soweit Beilagen nicht in der erforderlichen Anzahl von den Abteilungen<br />
übermittelt werden, sind sie von der Poststelle anzufertigen. Im Sitzungsbogen ist die Kennzeichnung<br />
etwa durch Unterstreichen des Wortes "Beilage" zu gewährleisten oder durch sonstige Unterstreichungen<br />
deutlich kenntlich zu machen.<br />
(8) Da die Sitzungen der Oö. Landesregierung üblicherweise an Montagen nachmittags abgehalten<br />
werden, sind die Sitzungsbogen samt allfälligen Beilagen von der Poststelle am vorhergehenden<br />
Donnerstag während der Amtsstunden an alle Mitglieder der Oö. Landesregierung sowie an<br />
die sonstigen Empfänger (zB. Schriftführerin bzw. Schriftführer) nach einem von der Landesamtsdirektorin<br />
bzw. vom Landesamtsdirektor zu bestimmenden Verteiler zuzustellen. Daher haben alle<br />
Abteilungen die Regierungssitzungsstücke samt Beilagen bis spätestens am vorhergehenden<br />
Mittwoch bis 12.00 Uhr mittags der Poststelle zu übergeben. Die von den Abteilungen erstellten<br />
Regierungssitzungsbogen sind ebenfalls bis spätestens am vorhergehenden Mittwoch bis 12.00<br />
Uhr mittags per Mail an "regierungssitzung.post@ooe.gv.at" (im Adressbuch als "Post, Regierungssitzung"<br />
dargestellt) zu übermitteln. In beiden Fällen liegt das Risiko für die vollständige und<br />
rechtzeitige Übermittlung ausschließlich bei der zuständigen Abteilung; sie kann vom Lis@-<br />
Zentrum eine Lesebestätigung anfordern. Findet eine Sitzung der Oö. Landesregierung ausnahmsweise<br />
nicht an einem Montag statt, so ist nach § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Oö.<br />
Landesregierung vorzugehen.<br />
(9) Die für eine Regierungssitzung vorbereiteten Sitzungsbogen sind vom Lis@-Zentrum nach<br />
Geschäftsgruppen zusammenzufassen und wie folgt zu nummerieren:<br />
a. fortlaufende Nummerierung der Sitzungsbogen, und zwar jeweils für jede Geschäftsgruppe<br />
gesondert (unter Seite … von …);<br />
b. fortlaufende Nummerierung der einzelnen Anträge (auf einem oder mehreren Sitzungsbogen<br />
angeführt), die im Rahmen einer Geschäftsgruppe gestellt werden (unter "Lfd.Nr. …").<br />
(10) Regierungssitzungsstücke, deren Anträge nicht mehr in den Sitzungsbogen aufgenommen<br />
werden können, sind unverzüglich dem Mitglied der Oö. Landesregierung zurückzugeben. Dieses<br />
entscheidet, ob sie bzw. er den Antrag in der bevorstehenden Sitzung der Oö. Landesregierung<br />
unter dem Tagesordnungspunkt "Allfälliges" vorbringt. Soll der Antrag in den Sitzungsbogen für<br />
eine der darauffolgenden Sitzungen der Oö. Landesregierung aufgenommen werden, gilt Abs. 2<br />
sinngemäß.<br />
(11) Die Abteilung, in der das Regierungssitzungsstück erstellt wurde, hat dafür zu sorgen, dass<br />
dem Mitglied der Oö. Landesregierung bei Behandlung des Antrages in der Sitzung der Landesregierung<br />
das Regierungssitzungsstück samt allfälligen Beilagen (allenfalls auch die dazugehörigen<br />
Akten) vorliegt.<br />
213
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
III.<br />
Arbeitsablauf nach der Behandlung<br />
in der Sitzung der Oö. Landesregierung<br />
(1) Die von der Oö. Landesregierung gefassten Beschlüsse werden von der Vorsitzenden bzw.<br />
vom Vorsitzenden beurkundet. Die Beurkundung (durch Unterschrift) erfolgt entweder in der Zeile<br />
"Vorsitzende bzw. Vorsitzender in der Regierungssitzung:" des Zeichnungsvermerkes (jedenfalls<br />
bei den unter "Allfälliges" vorgetragenen Regierungssitzungsstücken) oder auf dem Sitzungsbogen<br />
eines Mitglieds der Oö. Landesregierung (bei mehreren Sitzungsbogen eines Mitglieds der<br />
Oö. Landesregierung auf dem letzten dieser Sitzungsbogen).<br />
(2) Abgesehen von der Beurkundung gemäß Abs. 1 und der Anfertigung einer Niederschrift über<br />
die Sitzung der Oö. Landesregierung durch die Schriftführerin bzw. den Schriftführer hat diese<br />
bzw. dieser auf jedem Regierungssitzungsstück, und zwar einschließlich der unter "Allfälliges"<br />
vorgetragenen Regierungssitzungsstücke, zu vermerken, ob die Oö. Landesregierung einen antragsgemäßen<br />
oder einen den Antrag abändernden Beschluss gefasst hat.<br />
Sie bzw. er kann überdies vermerken, ob<br />
• die Oö. Landesregierung einen den Antrag ablehnenden Beschluss gefasst hat, oder<br />
• die Entscheidung über den Antrag zurückgestellt oder den Antrag ohne Beschlussfassung beraten<br />
hat, oder<br />
• das antragstellende Mitglied der Oö. Landesregierung den Antrag zurückgezogen hat.<br />
(3) Erfolgt die Beurkundung durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden (Abs. 1) auf dem Sitzungsbogen<br />
(dies ist üblicherweise der Fall), so ist in den Vermerk folgender Satz aufzunehmen:<br />
"Die Beurkundung durch den Vorsitzenden erfolgte auf dem entsprechenden (bzw. letzten) Sitzungsbogen<br />
des Mitglieds der Oö. Landesregierung; die Sitzungsbogen sind Bestandteil der Amtlichen<br />
Niederschrift über die heutige Sitzung."<br />
(4) Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer stellt überdies die in den Zeichnungsvermerken eingetragenen<br />
Namen der Mitglieder der Oö. Landesregierung richtig, wenn der Vorsitz nicht vom Landeshauptmann<br />
geführt bzw. wenn ein Antrag nicht vom zuständigen Mitglied der Oö. Landesregierung<br />
gestellt wurde ("In Vertretung beantragt von …").<br />
(5) Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer veranlasst abschließend, dass die Anträge der unter<br />
"Allfälliges" vorgetragenen Regierungssitzungsstücke in nachträglich zu erstellende Sitzungsbogen<br />
aufgenommen werden (Abschnitt II Abs. 3 bis 8 gilt sinngemäß). Dazu ist vom Lis@-Zentrum<br />
ein Nachtragsbogen zu erstellen. Die Regierungssitzungsstücke sind dem Lis@-Zentrum nach der<br />
Regierungssitzung ehebaldigst zu übermitteln und vom Lis@-Zentum sofort, längstens aber bis<br />
zum darauffolgenden Dienstag 12.00 Uhr zu erstellen und gemeinsam mit den zugehörigen Regierungssitzungsstücken<br />
samt allfälligen Akten der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer zu übermitteln.<br />
(6) Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer veranlasst über Kanzlei bzw. Poststelle die Rückübermittlung<br />
der Regierungssitzungsstücke samt Akten an die Abteilungen.<br />
214
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 76 <strong>DBO</strong><br />
Verbesserungsvorschläge<br />
Richtlinien<br />
Unser Ziel ist die wirkungsorientierte Verwaltung, bei der das gewünschte Ergebnis unser Handeln<br />
bestimmt. Wir bemühen uns, unsere Produkte und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen<br />
und Bürger auszurichten. Ein Verbesserungsvorschlag sollte daher eine Verbesserung in<br />
einem der folgenden Bereiche bringen:<br />
• Arbeitseffizienz bzw. interne Abläufe<br />
• Arbeitsergebnisse bzw. Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen<br />
• Bürgerfreundlichkeit<br />
• Image der Landesverwaltung in der Öffentlichkeit<br />
• Kosteneinsparung<br />
• Mitarbeiterzufriedenheit<br />
Eine Prämierung ist dann möglich, wenn der Vorschlag<br />
• neu ist,<br />
• den Pflichten und Befugnisbereich einer bzw. eines einzelnen Bediensteten überschreitet und<br />
über ihre bzw. seine Dienstpflichten hinausgeht 1 ,<br />
• umgesetzt wird.<br />
Verfahren<br />
1. Dezentral:<br />
Einbringung des Verbesserungsvorschlags bei der Abteilungsleiterin bzw. beim Abteilungsleiter<br />
Diese oder dieser kann, wenn der Vorschlag nicht über den Bereich der eigenen Abteilung hinausgeht<br />
und eine Prämierung mit bis zu 250,-- Euro angemessen scheint, den Vorschlag sofort<br />
umsetzen und zur Prämierung vorschlagen. Andere Vorschläge sind unverzüglich an die<br />
Abteilung Präsidium zur Prüfung weiterzuleiten.<br />
Ist das Ergebnis der dezentralen Prüfung negativ, kann die bzw. der Bedienstete den Vorschlag<br />
bei der Abteilung Präsidium nochmals einbringen.<br />
Die dezentralen Prämierungsvorschläge sind der Abteilung Präsidium mit Vorschlag, Ergebnis<br />
der Prüfung und Prämienhöhe mitzuteilen. Bei schwerwiegenden Bedenken nimmt die Abteilung<br />
Präsidium nochmals Kontakt mit der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter auf, ansonsten<br />
wird der Vorschlag zur Anweisung der Prämie an die Abteilung Personal weitergeleitet.<br />
2. Zentral:<br />
Einbringung der Verbesserungsvorschläge bei der Abteilung Präsidium<br />
Die Einhaltung des Dienstweges ist nicht nötig. Der Verbesserungsvorschlag kann auf Wunsch<br />
auch vertraulich behandelt werden. Die Abteilung Präsidium prüft den Vorschlag bzw. leitet ihn<br />
zur Prüfung an eine Abteilung weiter.<br />
Eine Kommission bestehend aus<br />
• Landesamtsdirektorin bzw. Landesamtsdirektor<br />
• Landesfinanzdirektorin bzw. Landesfinanzdirektor<br />
1<br />
Verbesserungen im eigenen Arbeitsbereich sind Aufgabe jeder bzw. jedes Bediensteten.<br />
215
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Landespersonaldirektorin bzw. Landespersonaldirektor<br />
• Rechnungshofdirektorin bzw. Rechnungshofdirektor<br />
• Obfrau bzw. Obmann des Landespersonalausschusses<br />
beurteilt den Verbesserungsvorschlag.<br />
Prämierung durch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Landeshauptmann-Stellvertreter<br />
Franz Hiesl.<br />
Prämien der Kommission bis 2.200,-- Euro!<br />
216
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 77 Abs. 1 und 2 <strong>DBO</strong><br />
Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
und Amtshilfeersuchen<br />
A. GRUNDSÄTZE BETREFFEND DIE AMTSVERSCHWIEGENHEIT<br />
Gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG sind alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung<br />
betrauten Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts – soweit<br />
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist – zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus<br />
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung<br />
- im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,<br />
- im Interesse der umfassenden Landesverteidigung,<br />
- im Interesse der auswärtigen Beziehungen,<br />
- im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts,<br />
- zur Vorbereitung einer Entscheidung oder<br />
- im überwiegenden Interesse der Parteien<br />
geboten ist.<br />
Schutzobjekt der Amtsverschwiegenheit sind dabei "Tatsachen"; dieser Begriff wird weit interpretiert<br />
und umfasst etwa Akten, Aktenteile und noch nicht erlassene normative Akte. Allgemein<br />
kommen als Gegenstand der Amtsverschwiegenheit nicht nur Ereignisse in der Außenwelt, wie<br />
zB. mündliche Äußerungen, sondern auch interne Vorgänge, wie – etwa aus Gesprächen erschließbare<br />
– Absichten in Betracht; gleiches gilt für die Äußerung von Meinungen, die zweifelsfreie<br />
Rückschlüsse auf bestimmte Tatsachen zulassen.<br />
Zu beachten ist auch, dass einem Organ "aus seiner amtlichen Tätigkeit" nicht nur jene Tatsachen<br />
bekannt geworden sind, die ihm aufgrund seiner zugewiesenen Tätigkeit bekannt sind, sondern<br />
auch jene, die ihm nur deshalb bekannt sind, weil der Organwalter seine amtliche Tätigkeit ausübt.<br />
Daher gehört zur "amtlichen Tätigkeit" nicht nur die unmittelbare Amtsausübung, sondern jegliches<br />
Verhalten, das einen Konnex zur Dienstverrichtung aufweist, wie etwa informelle Gespräche mit<br />
anderen Organwaltern im Rahmen der Dienstausübung.<br />
Grundsätzlich keine Verschwiegenheitspflicht besteht aber, wenn ein Organwalter im privaten<br />
Kreis von irgendwelchen amtlichen Vorgängen erfährt. Da nur Tatsachen der Amtsverschwiegenheit<br />
unterliegen, die dem Organwalter ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt geworden<br />
sind, unterliegen Tatsachen, von denen der Organwalter verlässlich (keine bloßen Vermutungen)<br />
zuvor privat Kenntnis erlangt hat, prinzipiell nicht der Amtsverschwiegenheit.<br />
Weiters unterliegen nur geheime Tatsachen der Amtsverschwiegenheit. Das bedeutet, dass die<br />
Geheimhal-tung dieser Tatsachen aufgrund der in Art. 20 Abs. 3 B-VG angegebenen Interessen<br />
geboten sein muss.<br />
Keine Amtsverschwiegenheit besteht weiters, wenn Gesetze ausdrücklich die Verpflichtung zur<br />
Auskunftserteilung über bestimmte Tatsachen vorsehen.<br />
Im Zusammenhang mit Auskunftserteilung und Amtsverschwiegenheit ist weiters auf die Bestimmungen<br />
des Datenschutzgesetzes 2000 Bedacht zu nehmen.<br />
Hat eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter nach den Bestimmungen des § 82 einen Sachverhalt<br />
gemäß § 78 StPO angezeigt, so unterliegen Bedienstete im nachfolgenden Gerichtsverfahren<br />
grundsätzlich nicht der Amtsverschwiegenheit, soweit das Verfahren diesen Sachverhalt betrifft.<br />
217
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
In allen anderen Fällen ist über die Frage der Entbindung von der Amtsverschwiegenheit zu entscheiden.<br />
Dabei ist das Interesse an der Geheimhaltung gegen das Interesse an der Aussage<br />
abzuwägen, wobei der Zweck des Verfahrens, sowie der der bzw. dem Bediensteten allenfalls<br />
drohende Schaden zu berücksichtigen sind. Die Entbindung von der Amtsverschwiegenheit kann<br />
unter der Voraussetzung ausgesprochen werden, dass die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage,<br />
der den Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird.<br />
Grundsätzlich sollen Bedienstete aus Zeitgründen nur im unvermeidbaren Ausmaß zur Aussage<br />
als Zeugen oder Sachverständige herangezogen werden. Wenn die Beweisthemen, zu denen das<br />
Gericht oder die Verwaltungsbehörde eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten einvernehmen<br />
will, ohnehin aus dem Akt hervorgehen oder die Fragen schriftlich beantwortet werden können, so<br />
soll der Aktenübersendung bzw. einem Schreiben an das Gericht oder an die Verwaltungsbehörde<br />
der Vorrang gegeben werden. Nur in Ausnahmefällen (z.B. schriftliche Beantwortung der Fragen<br />
würde einen höheren Zeitaufwand erfordern als die Aussage) soll eine an sich mögliche schriftliche<br />
Erledigung unterbleiben. Die Amtsleitung ist im Hinblick auf diesen Grundsatz auch bereits an<br />
das Oberlandesgericht Linz herangetreten, wobei festzuhalten ist, dass im Zweifelsfall dem<br />
Grundsatz der Mündlichkeit im Gerichtsverfahren Rechnung zu tragen ist.<br />
B. ENTBINDUNG VON DER AMTSVERSCHWIEGENHEIT – ABLAUF<br />
Die folgende Vorgangsweise ist auf Einvernahmen durch Gerichte zugeschnitten. Sie ist jedoch<br />
auch auf Einvernahmen durch Verwaltungsbehörden sinngemäß anzuwenden:<br />
Wenn das Gericht eine Bedienstete bzw. einen Bediensteten als Zeugin bzw. Zeugen oder Sachverständige<br />
bzw. Sachverständigen einvernehmen will, kann es<br />
a) ein ausdrückliches Ersuchen übermitteln (und zwar bevor eine Ladung ausgefertigt wird),<br />
b) die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten der bzw. des Bediensteten gemäß StPO oder ZPO verständigen<br />
oder<br />
c) die Bedienstete bzw. den Bediensteten laden.<br />
Wenn eine solche beabsichtigte Einvernahme der bzw. dem Vorgesetzten oder der bzw. dem Bediensteten<br />
(diese bzw. dieser hat übrigens eine direkt an sie bzw. ihn gerichtete Ladung unverzüglich<br />
der bzw. dem Vorgesetzten vorzulegen) bekannt wird, ist zunächst zu prüfen, ob überhaupt –<br />
insbesondere im Hinblick auf die Fassung des Art. 20 Abs. 3 B-VG – eine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit<br />
vorliegt. Diese Prüfung ist von der Abteilungsleiterin bzw. vom Abteilungsleiter<br />
durchzuführen. Wird durch die Aussage der bzw. des Bediensteten die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit<br />
nicht berührt, ist außer der Eintragung der Abwesenheit im Dienstabwesenheitsverzeichnis<br />
nichts weiteres zu veranlassen.<br />
Berührt die gewünschte Aussage die Verschwiegenheitspflicht oder kann dies nicht mit Sicherheit<br />
ausgeschlossen werden, so ist grundsätzlich in folgender Weise weiter vorzugehen:<br />
1. Wenn das Gericht das Beweisthema nicht ausreichend konkretisiert hat, ist es aufzufordern,<br />
dieses genauer zu umschreiben (diese genauere Umschreibung kann auch notwendig sein, um<br />
überhaupt feststellen zu können, ob eine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit durch die<br />
Aussage berührt werden könnte).<br />
2. Nach Möglichkeit sollen von der jeweiligen Verwaltungsbehörde Akten übersendet bzw. Fragen<br />
schriftlich beantwortet werden, wenn dadurch das vorgegebene Beweisthema ausreichend behandelt<br />
werden kann. Das Gericht ist in einem solchen Fall auch zu ersuchen, eine eventuell<br />
schon ausgefertigte Ladung zu widerrufen und dies der Verwaltungsbehörde bekanntzugeben.<br />
3. Wenn nach Ansicht der Verwaltungsbehörde zum Beweisthema ein anderer bzw. eine andere<br />
als die bzw. der geladene Bedienstete zweckmäßiger aussagen kann, ist das Gericht davon zu<br />
informieren und gleichzeitig zu ersuchen, die getroffenen Verfügungen entsprechend zu ändern.<br />
Ähnlich liegt der Fall, wenn die bzw. der Bedienstete von einem nicht am Dienstort eingerichteten<br />
Gericht vernommen werden soll. In diesem Fall soll darauf hingewirkt werden, dass<br />
218
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
ein "ersuchter Richter" bei einem Gericht am Amtssitz der Behörde die Einvernahme durchführt.<br />
4. Wenn nach dieser Prüfung eine Einvernahme einer bzw. eines Bediensteten notwendig ist oder<br />
das Gericht auf eine Einvernahme besteht, so hat die Abteilungsleiterin bzw. der Abteilungsleiter<br />
bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der<br />
Amtsvorstand über die Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht zu entscheiden,<br />
soweit nicht Bedienstete generell von der Amtsverschwiegenheitspflicht entbunden sind (siehe<br />
Abschnitt "C"). Sofern die Abteilungsleiterin bzw. der Abteilungsleiter bzw. die Bezirkshauptfrau<br />
bzw. der Bezirkshauptmann bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand selbst betroffen<br />
ist, entscheidet die Abteilung Präsidium.<br />
5. Gelangt die Abteilungsleiterin bzw. der Abteilungsleiter bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann<br />
bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand zur Auffassung, dass die Entbindung<br />
nicht ausgesprochen wird, so hat sie bzw. er das Gericht um Widerruf der Ladung zu<br />
ersuchen. Wird diese nicht widerrufen, hat die bzw. der Geladene zwar eine Verpflichtung<br />
zum Erscheinen vor Gericht (wenn sie bzw. er nicht durch einen Auftrag zur Besorgung unaufschiebbarer<br />
Dienstgeschäfte auch davon entbunden wird), sie bzw. er hat aber auf die<br />
Nicht-Entbindung hinzuweisen. Aussagen darf sie bzw. er nur dann, wenn der Richter protokolliert,<br />
dass nach Ansicht des Gerichtes das Beweisthema nicht der Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
unterliegt.<br />
6. Lässt sich aus der Ladung nicht erkennen, dass der Gegenstand der Aussage der Amtsverschwiegenheit<br />
unterliegen könnte und stellt sich dies erst bei der Aussage heraus, so hat die<br />
bzw. der Bedienstete die Beantwortung weiterer Fragen zu verweigern. Die vernehmende Behörde<br />
hat – wenn sie die Aussage für erforderlich hält – die Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
zu beantragen.<br />
7. Gemäß Gebührenanspruchsgesetz 1975 besteht für Zeuginnen bzw. Zeugen und Sachverständige<br />
ein Anspruch auf Reiseauslagenersatz. Reisekosten für das Erscheinen vor Gericht<br />
sind gemäß § 19 bzw. § 38 Gebührenanspruchsgesetz 1975 binnen 14 Tagen nach der Beweisaufnahme<br />
beim zuständigen Gericht geltend zu machen. Es ist daher keine Reiserechnung<br />
an das Amt der Landesregierung zu übermitteln.<br />
8. Die in diesem Abschnitt beschriebene Vorgangsweise ist auch anzuwenden, wenn Gerichte um<br />
Namhaftmachung von informierten Vertreterinnen bzw. Vertretern als Zeuginnen bzw. Zeugen<br />
oder Sachverständige ersuchen oder informierte Vertreterinnen bzw. Vertreter laden bzw. Bedienstete<br />
in eigener Sache (etwa als Beschuldigte bzw. Beschuldigter) geladen werden. Diese<br />
Vorgangsweise ist auch dann sinngemäß anzuwenden, wenn Bedienstete von Sicherheitsbehörden<br />
als Auskunftspersonen über strafbare Handlungen vernommen werden.<br />
9. Schriftliche Erledigungen in diesen Angelegenheiten sind mit der Unterschriftsklausel "Für die<br />
Landesamtsdirektorin" bzw. "Für den Landesamtsdirektor" zu versehen.<br />
C. GENERELLE ENTBINDUNG VON DER AMTSVERSCHWIEGENHEIT<br />
Aus verwaltungsökonomischen Überlegungen werden verschiedene Gruppen von Bediensteten in<br />
unterschiedlichem Ausmaß von der Amtsverschwiegenheitspflicht für gleichartige Fälle generell<br />
entbunden. Allerdings muss auch in diesen Fällen das Beweisthema konkret bekanntgegeben und<br />
auch geprüft werden, ob nicht schriftliche Erledigungen im oben angeführten Sinn ausreichend<br />
sind (siehe "Grundsätze – Punkt 5"). Bestehen im Rahmen dieser Prüfung für den konkreten Einzelfall<br />
Bedenken wegen dieser generellen Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht, kann<br />
– in sinngemäßer Anwendung von Abschnitt "B. Ablauf" – beantragt werden, die Entbindung rückgängig<br />
zu machen.<br />
Folgende Gruppen sind im geschilderten Umfang von der Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
generell entbunden:<br />
a) Bedienstete der Bezirkshauptmannschaften, die in Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt<br />
mit der Durchführung von Rechtshilfeersuchen nach dem Jugendgerichtsgesetz 1988 betraut<br />
219
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
sind, soweit sie vor Gericht als Zeuginnen bzw. Zeugen über sachliche Wahrnehmungen in<br />
Durchführung der Jugend-gerichtshilfe befragt werden.<br />
b) Jene Bediensteten der Aufgabengruppen Jugendwohlfahrt und Sozialhilfe, die in Strafverfahren<br />
gemäß §§ 195 bis 200 StGB aussagen sollen, soweit sich ihre Aussagen auf sachliche<br />
Wahrnehmungen beschränken, die sie bei der Besorgung von Angelegenheiten dieser beiden<br />
Aufgabengruppen im Zusammenhang mit den betreffenden Tatbeständen des Strafgesetzbuches<br />
gemacht haben.<br />
Diese Regelung gilt auch für Bedienstete der Bezirkshauptmannschaften, die mit Angelegenheiten<br />
der Aufgabengruppe Sozialhilfeverband-Geschäftsstelle betraut sind, wenn aus der<br />
Sicht des Sozialhilfeträgers keine sachlichen Bedenken gegen eine Entbindung bestehen. Bestehen<br />
solche Bedenken, ist ein Antrag auf Entbindung von der Amtsverschwiegenheitspflicht<br />
an das Amt der Landesregierung (Abteilung Präsidium) zu übermitteln.<br />
c) Alle Bediensteten, die zu "Aufsichtsorganen" gemäß §§ 24 ff des Bundesgesetzes über Sicherheitsanforderungen<br />
und weitere Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände<br />
und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Lebensmittelsicherheits-<br />
und Verbraucherschutzgesetz - LMSVG) bestellt sind, wenn sie als Zeuginnen bzw.<br />
Zeugen in Gerichts- oder Verwaltungsstrafverfahren einvernommen werden sollen, soweit sich<br />
ihre Aussagen auf sachliche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Aufsichtsorgane<br />
beschränken.<br />
d) Alle Bediensteten, die in Verfahren vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes O-<br />
berösterreich als Zeuginnen bzw. Zeugen bzw. Beteiligte aussagen sollen, soweit sich ihre<br />
Aussage auf die von ihnen zu besorgenden Aufgaben im Zusammenhang mit dem Anlassfall<br />
beschränken.<br />
e) Bedienstete der Landesbuchhaltung, soweit sie in Gerichtsverfahren zur Eintreibung offener<br />
Forderungen des Landes Oberösterreich Auskünfte aus der Buchhaltung (wie z.B. über Darlehens-<br />
und Mietzinsberechnungen) erteilen.<br />
D. AMTSHILFEERSUCHEN<br />
1. Gemäß Art. 22 B-VG sind alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden im Rahmen<br />
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet.<br />
2. Diese Verpflichtung zur Amtshilfe ist auf Grund der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes<br />
unmittelbar anwendbar und bedarf keiner ausdrücklichen einfachgesetzlichen Konkretisierung.<br />
Damit ist eine Hilfeleistungspflicht gegenüber den Organen des Bundes und der Gemeinden<br />
dem Grunde nach jedenfalls auch ohne weitere einfachgesetzliche Regelung gegeben. Wie<br />
weit diese Hilfeleistungspflicht reicht, muss jedoch im Einzelfall jeweils konkret unter Heranziehung<br />
– allenfalls vorhandener – einfachgesetzlicher Ausführungen dieser verfassungsmäßigen<br />
Hilfeleistungspflicht beurteilt werden.<br />
3. Vielfach enthalten die einfachen Verwaltungsgesetze Konkretisierungen des Art. 22<br />
B-VG, die den Umfang der Amtshilfepflicht jedenfalls abstecken. Insbesondere ist in diesem<br />
Zusammenhang auf die Bestimmung der §§ 76 f der Strafprozessordnung hinzuweisen.<br />
4. Die Prüfung der Frage, wie weit der Umfang der Amtshilfeleistungspflicht reicht, ist im Einzelfall<br />
von der jeweiligen Bearbeiterin bzw. vom jeweiligen Bearbeiter bzw. in Zweifelsfragen von der<br />
Abteilungsleiterin bzw. vom Abteilungsleiter – für die Abteilungen des Fachdienstes von den für<br />
sie zuständigen Rechtsabteilungen –, allenfalls unter Mitbeteiligung der Direktion Verfassungsdienst,<br />
zu beurteilen.<br />
5. Innerhalb des Amtshilfeverkehrs ist die Amtsverschwiegenheit (siehe oben A.) sowie der Datenschutz<br />
zu beachten. Die Beurteilung der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes hat<br />
durch die jeweilige Bearbeiterin bzw. den jeweiligen Bearbeiter bzw. in Zweifelsfragen durch die<br />
Abteilungsleiterin bzw. durch den Abteilungsleiter bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. den Bezirkshauptmann<br />
bzw. die Amtsvorständin bzw. den Amtsvorstand zu erfolgen.<br />
220
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 77 Abs. 4 <strong>DBO</strong><br />
Einsicht in Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit<br />
Diplomarbeiten, Forschungsaufträgen udgl.<br />
Es ersuchen immer wieder insbesondere amtsfremde Personen um Einsicht in Verwaltungsvorgänge<br />
um Diplomarbeiten zu erstellen, Forschungsaufträge zu erfüllen udgl. Ebenso vergibt die<br />
oö. Landesverwaltung aktiv Diplomarbeits- und Dissertationsthemen udgl. Beim Bearbeiten solcher<br />
Aufgabenstellungen ergeben sich einerseits vielfältige Probleme für den Amtsbetrieb (Verpflichtung<br />
zur Amtsverschwiegenheit, Datenschutz, aber auch Belastung der Landesbediensteten<br />
durch die Unterstützung von solchen Arbeiten), andererseits können solche Arbeiten natürlich<br />
auch positive Anregungen enthalten und somit Auswirkungen auf die Verbesserung des Verwaltungsbetriebes<br />
haben.<br />
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird die Einsicht in Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang<br />
mit Diplomarbeiten udgl. folgendermaßen geregelt:<br />
A. Formelle Erfordernisse:<br />
1. Die Zustimmung zur Einsichtnahme in Verwaltungsvorgänge obliegt beim Amt der Landesregierung<br />
der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter jener Abteilung, die auf Grund der Geschäftseinteilung<br />
des Amtes der Oö. Landesregierung und des Kompetenzen-Katalogs mit der<br />
Wahrnehmung der Angelegenheit betraut ist, auf die sich das Einsichtsbegehren bezieht.<br />
Bei den Bezirkshauptmannschaften bzw. der Agrarbezirksbehörde obliegt die Zustimmung zur<br />
Einsichtnahme in Verwaltungsvorgänge der Bezirkshauptfrau bzw. dem Bezirkshauptmann<br />
bzw. der Amtsvorständin bzw. dem Amtsvorstand unter Einbeziehung der Abteilungsleiterin<br />
bzw. des Abteilungsleiters jener Abteilung, die auf Grund der Geschäftseinteilung des Amtes<br />
der Oö. Landesregierung und des Kompetenzen-Katalogs mit der Wahrnehmung der Angelegenheit<br />
betraut ist, auf die sich das Einsichtsbegehren bezieht.<br />
Sind mehrere Organisationseinheiten von einem solchen Begehren betroffen, wird die Entscheidung<br />
von der Leiterin bzw. vom Leiter derjenigen Organisationseinheit getroffen, die<br />
hauptsächlich von diesem Ersuchen betroffen bzw. an die das Begehren gerichtet ist. Diese<br />
Abteilungsleiterin bzw. dieser Abteilungsleiter bzw. die Bezirkshauptfrau bzw. der Bezirkshauptmann<br />
bzw. die Amtsvorständin bzw. der Amtsvorstand sorgt auch für die Koordination mit<br />
den anderen Abteilungen bzw. Organisationseinheiten.<br />
2. Soll eine Diplomarbeit bzw. Dissertation oä. erstellt werden, ist der Abteilungsleiterin bzw. dem<br />
Abteilungsleiter bzw. der Bezirkshauptfrau bzw. dem Bezirkshauptmann bzw. der Amtsvorständin<br />
bzw. dem Amtsvorstand eine Bestätigung der Universität bzw. Fachhochschule udgl. vorzulegen;<br />
aus dieser Bestätigung muss hervorgehen, dass das Diplomarbeits- bzw. Dissertationsthema<br />
anerkannt wird.<br />
3. Die Abteilung Präsidium ist sowohl über die Entscheidung als auch vom Abschluss der Diplomarbeit<br />
schriftlich zu verständigen.<br />
Bei der Zustimmung ist darauf zu achten, dass<br />
B. Materielle Erfordernisse:<br />
1. die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit und das Datenschutzgesetz sowie allfällige weitere<br />
gesetzliche Geheimhaltungspflichten nicht verletzt werden,<br />
221
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
2. für das Land Oberösterreich keine Kosten durch die Diplomarbeit udgl. entstehen dürfen (ausgenommen<br />
sind Entgelte für eine befristete Tätigkeit als Ferialpraktikantin bzw. Ferialpraktikant<br />
bzw. wenn auf Initiative der oö. Landesverwaltung eine Diplomarbeit bzw. Dissertation in Auftrag<br />
gegeben wird.) und die Diplomarbeit udgl. von den Bediensteten außerhalb der Dienstzeit<br />
erstellt wird,<br />
3. kein zusätzlicher Arbeitsaufwand für Bedienstete des Landes Oberösterreich entsteht, der sie<br />
an ihrer eigentlichen Arbeit hindert,<br />
4. dem Land Oberösterreich ein kostenloses Exemplar der Arbeit zur Verfügung gestellt wird.<br />
222
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 1 zu § 77 Abs. 5 <strong>DBO</strong><br />
Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und<br />
Informationsweiterverwendungsgesetz<br />
Das Landesgesetz über die Auskunftspflicht, den Datenschutz und die Weiterverwendung von<br />
Informationen öffentlicher Stellen (Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz),<br />
LGBl.Nr. 46/1988 idF. LGBl.Nr.86/2006, gliedert sich in vier Abschnitte: Abschnitt<br />
1 betrifft die Auskunftspflicht, Abschnitt 2 den Datenschutz und Abschnitt 3 die Informationsweiterverwendung;<br />
der vierte Abschnitt betrifft gemeinsame Bestimmungen.<br />
A. Auskunftspflicht<br />
1. Allgemeines<br />
Die Pflicht zur Erteilung von Auskünften trifft aufgrund des § 1 Abs. 1 des Oö. Auskunftspflicht-,<br />
Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes die Organe des Landes, der Gemeinden,<br />
der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwaltung. Aufgrund<br />
des Umstandes, dass es sich beim Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz<br />
um eine organisationsrechtliche Regelung im weiteren Sinn (also nicht um<br />
eine lediglich den inneren Dienst betreffende Regelung) handelt, ist dieses Gesetz für alle jene<br />
Organe verpflichtend, die in Abs. 1 angeführt werden, und zwar unabhängig davon, wem sie funktionell<br />
– dem Bund oder dem Land – zuzuordnen sind. Es unterliegen daher auch jene Landesorgane<br />
(organisatorisch) diesem Gesetz, die (auch) in der mittelbaren Bundesverwaltung tätig sind<br />
(Bezirksverwaltungsbehörde, Landeshauptmann etc.).<br />
Wie sich schon aus der Bestimmung des Art. 20 Abs. 4 erster Satz B-VG ("alle mit Aufgaben der<br />
Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe ...") ergibt, gilt das Oö. Auskunftspflicht-,<br />
Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz sowohl für die Hoheits- als<br />
auch für die Privatwirtschaftsverwaltung.<br />
Mit dem Begriff "Organ" wird lediglich eine rechtlich geregelte Einrichtung und nicht eine bestimmte<br />
Person bezeichnet, die deren Funktionen als Amts- oder Organwalter wahrnimmt. Dies<br />
bedeutet – geht man von dieser Begriffsbestimmung aus –, dass nicht eine bestimmte Person<br />
zur Auskunftserteilung verhalten ist, sondern nur das (abstrakte) Organ. Es hat daher ein Auskunftswerber<br />
keinen Rechtsanspruch darauf, dass die gewünschte Auskunft von einer bestimmten<br />
Person, d.h. also von einem bestimmten Organwalter (dem Landeshauptmann, der Bezirkshauptfrau<br />
bzw. dem Bezirkshauptmann, der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter usw.) erteilt<br />
wird. Ungeachtet dessen kann jedoch durch innerdienstliche Anordnungen festgelegt sein, dass<br />
nur bestimmte Personen bzw. nur eine bestimmte Organisationseinheit mit der Auskunftserteilung<br />
betraut wird. Zu verweisen ist in diesem Sinn auf § 3 des Auskunftspflicht-Grundsatzgesetzes,<br />
wonach besondere Einrichtungen mit der Erfüllung der Auskunftspflicht betraut werden können.<br />
Im § 1 Abs. 2 des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes<br />
ist der Begriff "Auskunft" definiert. Entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter<br />
Auskunft die Mitteilung gesicherten Wissens, nicht aber von Meinungen, Auffassungen und Mutmaßungen<br />
zu verstehen. So betrachtet sind insbesondere nur Ergebnisse eines abgeschlossenen<br />
Willensbildungsprozesses beim zuständigen Organ und damit Tatsachen Gegenstand einer<br />
Auskunft.<br />
Wie die Erfahrung zeigt, ergeben sich besondere Probleme im Zusammenhang mit Rechtsauskünften.<br />
Auch dabei wird zwischen der Mitteilung gesicherten Wissens und der Äußerung einer<br />
bloßen Rechtsmeinung zu unterscheiden sein: Wissensmitteilungen in Rechtsfragen (z.B. die Mitteilung<br />
des Inhalts einer bestimmten Vorschrift; der Hinweis, in welcher Rechtsvorschrift eine An-<br />
223
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
gelegenheit geregelt ist etc.) fallen unter die gesetzliche Auskunftspflicht. Die Äußerung einer<br />
Rechtsmeinung dagegen, etwa in dem ein fiktiver Sachverhalt zur Beurteilung vorgetragen wird,<br />
ist nicht Gegenstand der Auskunftspflicht.<br />
Zum Verhältnis zwischen der Auskunftspflicht und dem Recht auf Akteneinsicht ist zu bemerken,<br />
dass das Auskunftspflichtgesetz keinen Rechtsanspruch auf Akteneinsicht vermittelt. Vielmehr ist<br />
unter "Auskunft" nur die allfällige Mitteilung über den Inhalt von Akten zu verstehen, nicht aber<br />
auch die Verpflichtung, der bzw. dem Fragenden Gelegenheit zu geben, sich selbst ein Urteil über<br />
den Akteninhalt zu geben. Im Übrigen werden die verfahrensrechtlichen Regelungen über die Akteneinsicht<br />
durch das Auskunftspflichtgesetz in keiner Weise berührt.<br />
Ähnliches gilt auch für die in den Verfahrensgesetzen vorgesehene Manuduktionspflicht. Auch sie<br />
steht neben der Auskunftspflicht und wird von letzterer in keiner Weise berührt.<br />
2. Rechtliche Grenzen der Auskunftspflicht<br />
a. Die Organe des Landes sind gemäß § 1 Abs. 1 des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und<br />
Informationsweiterverwendungsgesetzes verhalten, über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches<br />
Auskünfte zu erteilen. Eine Auskunftspflicht besteht sohin nur im Rahmen der sachlichen<br />
Zuständigkeit des jeweils befragten Organs des Landes (zum Organbegriff vgl. oben).<br />
224<br />
Sind in einer Angelegenheit mehrere Landesorgane zuständig, so ist jedes Organ hinsichtlich<br />
des von ihm gesetzten oder zu setzenden Teilaktes auskunftspflichtig.<br />
Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung sollte ein Organ, das um eine Auskunft ersucht<br />
wurde, zu deren Erteilung es aber nicht zuständig ist, in der Regel so vorgehen, dass unter Erteilung<br />
einer Abgabenachricht das Auskunftsbegehren der zuständigen Stelle übermittelt wird<br />
(§ 2 Abs. 3 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes).<br />
Sollte die Auskunftswerberin bzw. der Auskunftswerber allerdings gegenüber dem unzuständigen<br />
Organ auf einer Auskunftserteilung bestehen, so müsste auf Verlangen auch ein die Auskunft<br />
mangels Zuständigkeit ablehnender Bescheid erlassen werden.<br />
b. Eine Auskunft ist nicht zu erteilen, wenn dem eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht entgegensteht<br />
(§ 3 Abs. 1 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz).<br />
Eine solche "gesetzliche Verschwiegenheitspflicht" ist vor allem die in Art. 20 Abs. 3<br />
B-VG geregelte Amtsverschwiegenheit; Verschwiegenheitspflichten können sich aber etwa<br />
auch aus dem Datenschutzgesetz 2000 ergeben.<br />
Eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht im Sinne des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutzund<br />
Informationsweiterverwendungsgesetzes besteht nicht nur dann, wenn die Amtsverschwiegenheit<br />
zum Tragen kommt, sondern auch dann, wenn besondere gesetzliche Vorschriften bestehen,<br />
die die Weitergabe bestimmter Tatsachen untersagen. In diesem Zusammenhang sei<br />
etwa auf § 13 Preisgesetz, § 9 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, §§ 54 und 89 Ärztegesetz<br />
etc. hingewiesen.<br />
c. Eine Grenze der Auskunftspflicht ist das mutwillige Auskunftsbegehren. § 3 Abs. 2 lit. a Oö.<br />
Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz bestimmt, dass<br />
Auskünfte verweigert werden können, wenn sie "offenbar mutwillig verlangt" werden.<br />
Auch in diesem Fall lässt sich keine allgemeine Umschreibung dafür geben, unter welchen<br />
Voraussetzungen ein Auskunftsbegehren als mutwillig anzusehen ist. In diesem Zusammenhang<br />
sei aber etwa auf VwSlg. 8448A/1973 hingewiesen. Dieses Erkenntnis erging zwar zu §<br />
35 AVG 1950; es kann aber auch im vorliegenden Zusammenhang als eine gewisse Richtlinie<br />
gelten. Mutwillig handelt danach, "wer sich in dem Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosig-
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
keit, der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Anbringens an die Behörde wendet, sowie wer aus<br />
Freude an der Behelligung der Behörde handelt". Ein Indiz kann im gegebenen Zusammenhang<br />
auch sein, dass etwa eine Person immer wieder Auskünfte in der erkundbaren Absicht<br />
verlangt herauszubekommen, wie lange die Behörde zur Erledigung braucht. Ein anderes Indiz<br />
kann darin bestehen, dass Auskünfte über Tatsachen verlangt werden, die auf anderem Wege<br />
relativ einfach zugänglich sind.<br />
Auch in diesem Zusammenhang wird nahegelegt, eine großzügige Haltung einzunehmen und<br />
ein Auskunftsbegehren nur dann als mutwillig zu betrachten, wenn dies auf der Hand liegt.<br />
d. Eine weitere Grenze der Auskunftserteilung ergibt sich aus § 3 Abs. 2 lit. b Oö. Auskunftspflicht-,<br />
Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz, wonach die Erteilung einer<br />
Auskunft verweigert werden kann, wenn die Erteilung der Auskunft umfangreiche Erhebungen<br />
und Ausarbeitungen erfordert, die die ordnungsgemäße Besorgung der übrigen gesetzlichen<br />
Aufgaben der Organe wesentlich beeinträchtigt. Der Grundgedanke dieser gesetzlichen Regelung<br />
besteht darin, dass die Auskunftserteilung zwar eine Serviceleistung der Verwaltung ist,<br />
dadurch aber die eigentlichen Aufgaben des Verwaltungsorgans nicht wesentlich beeinträchtigt<br />
werden dürfen.<br />
Ausgehend davon könnte daher dann, wenn die Erteilung einer verlangten Auskunft einen unverhältnismäßig<br />
hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringen würde, die Verweigerung der<br />
Auskunft gerechtfertigt sein. Unter welchen Voraussetzungen ganz allgemein die Besorgung<br />
der übrigen Aufgaben der Verwaltung durch die Erteilung von Auskünften "wesentlich beeinträchtigt"<br />
würde, lässt sich im allgemeinen nicht sagen. Eine Beurteilung dieser Frage ist etwa<br />
von der Größe der Behörde und des zur Verfügung stehenden Personals ebenso abhängig, wie<br />
von der Zahl der eingelangten Auskunftsbegehren. Es ist daher denkbar, dass unter dem hier<br />
behandelten Aspekt Auskünfte verweigert werden müssen, weil sie in einer so großen Zahl an<br />
das Organ herangetragen werden, dass die übrigen Verwaltungsaufgaben nicht mehr ordnungsgemäß<br />
erfüllt werden könnten, würde allen diesen Auskunftsbegehren entsprochen werden.<br />
Ebenso ist es auch denkbar, dass einem konkreten Auskunftsbegehren deshalb nicht entsprochen<br />
werden kann, weil es außerordentlich umfangreiche Vorarbeiten erfordern würde.<br />
Grundsätzlich sollte jedoch bei der Handhabung des Auskunftspflichtgesetzes von der Überlegung<br />
ausgegangen werden, dass im Interesse des angestrebten Verwaltungsservices nur in<br />
Ausnahmefällen die Erteilung einer Auskunft wegen einer wesentlichen Beeinträchtigung der<br />
Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung verweigert werden sollte.<br />
Überdies wäre auch zu prüfen, ob dem Auskunftsbegehren – mit vertretbarem Arbeitsaufwand<br />
– wenigstens teilweise entsprochen werden könnte.<br />
e. Weiters kann die Auskunft gemäß § 3 Abs. 2 lit. c Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz<br />
dann verweigert werden, wenn der Auskunftswerberin<br />
bzw. dem Auskunftswerber die gewünschten Informationen anders unmittelbar zugänglich sind.<br />
Diese, ebenfalls der Entlastung der Verwaltung dienende Bestimmung ermöglicht es, die Auskunft<br />
unter dem Hinweis zu verweigern, dass die gewünschte Information z.B. den Medien, einem<br />
Informationsblatt, einer Broschüre etc. entnommen werden kann.<br />
3. Vorgangsweise bei der Auskunftserteilung<br />
Hinsichtlich der Vorgangsweise bei der Auskunftserteilung ist zunächst darauf hinzuweisen, dass<br />
die Auskunft ihrer Rechtsnatur nach – wie bereits oben erwähnt – eine Wissenserklärung ist und<br />
somit keinen nomativen Inhalt hat. Die Auskunft gestaltet auch keine Rechtsverhältnisse und kann<br />
solche nicht in rechtsverbindlicher Weise feststellen. Demgemäß ist eine Auskunft kein Verwaltungsakt<br />
im Sinne der österreichischen Terminologie. Für die Auskunftserteilung sind daher verfahrensrechtliche<br />
Bestimmungen – insbesondere das AVG 1991 – nicht anwendbar. Es geht ihr<br />
225
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
daher auch kein Verfahren voraus. Die Auskunftserteilung ist vielmehr das tatsächliche Entsprechen<br />
einem bestehenden Rechtsanspruch gegenüber.<br />
§ 2 Abs. 1 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz regelt<br />
näher, wie Auskunftsbegehren zu stellen sind. Es wird dabei von dem Grundgedanken ausgegangen,<br />
dass derartige Begehren in jeder Form mündlich oder schriftlich angebracht werden können.<br />
Im § 2 Abs. 2 leg. cit. ist festgehalten, dass verlangt werden kann, ein mündlich oder telefonisch<br />
angebrachtes Auskunftsbegehren schriftlich auszuführen. Dies gilt dann, wenn das Auskunftsbegehren<br />
seinem Inhalt oder dem Umfang der gewünschten Auskunft nach nicht ausreichend klar<br />
ist. Wird ein solcher Auftrag zur schriftlichen Ausführung erteilt, so liegt ein Auskunftsbegehren im<br />
Sinne des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz erst vor,<br />
wenn der Auskunftswerber entsprechend diesem Auftrag die schriftliche Ausführung eingebracht<br />
hat. Geschieht dies nicht, so ist demgemäß nichts weiter zu veranlassen.<br />
Was die Art und Weise der Erteilung der Auskunft anlangt, so enthält das Oö. Auskunftspflicht-,<br />
Daten-schutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz die Regelung, dass die Auskunft soweit<br />
wie möglich mündlich oder telefonisch zu erteilen ist (§ 4 Abs. 1 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz-<br />
und Informationsweiterverwendungsgesetz). Diese Regelung entspricht auch der bisherigen<br />
Praxis; insbesondere telefonische oder mündliche Auskunftsbegehren können sofort beantwortet<br />
werden. In allen anderen Fällen wird die Auskunft in der Regel schriftlich zu erteilen sein.<br />
§ 4 Abs. 2 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz sieht<br />
allerdings vor, dass Auskünfte ohne unnötigen Aufschub zu erteilen sind, tunlichst aber innerhalb<br />
von 8 Wochen nach dem Einlangen des Auskunftsbegehrens; kann diese Frist aus besonderen<br />
Gründen nicht eingehalten werden, ist die Auskunftswerberin bzw. der Auskunftswerber unter Angabe<br />
der Gründe zu benachrichtigen. Die Zielsetzung des Gesetzes geht also dahin, dass Auskünfte<br />
möglichst schnell erteilt werden.<br />
Im Gegensatz zur Auskunftserteilung ist die Verweigerung einer Auskunft ein Verwaltungsakt:<br />
§ 5 Abs. 1 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz normiert<br />
nämlich, dass – wird eine Auskunft verweigert – die Behörde aufgrund eines schriftlichen<br />
Antrages der Auskunftswerberin bzw. des Auskunftswerbers, in dem das Auskunftsbegehren<br />
nochmals darzulegen ist, die Verweigerung mit schriftlichem Bescheid auszusprechen und die<br />
dafür maßgebenden Gründe anzuführen hat.<br />
Hinsichtlich des anzuwendenden Verfahrens sieht § 5 Abs. 2 vor, dass das AVG 1991 gilt.<br />
Sowohl zur Auskunftserteilung als auch zur Bescheiderstellung ist jeweils die Abteilung des Amtes<br />
der Landesregierung zuständig, die mit der Wahrnehmung jener Angelegenheit, in der die Auskunft<br />
erwünscht wurde, betraut ist (siehe insbesondere Kompetenzen-Katalog). Soweit ein Auskunftsbegehren<br />
bei einer Bezirkshauptmannschaft einlangt, ist die Auskunft von dieser zu erteilen,<br />
wenn die Angelegenheit, auf die sich die Auskunft bezieht, von der Bezirkshauptmannschaft<br />
wahrgenommen wird. Vor allem im Hoheitsbereich sind zuweilen mehrere Organisationseinheiten<br />
mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten betraut (z.B. Amt der Landesregierung - Bezirkshauptmannschaften<br />
im Gewerberecht, Wasserrecht, Naturschutz etc.). In diesem Fall trifft die<br />
Verpflichtung zur Auskunftserteilung diejenige Organisationseinheit, an die das Auskunftsbegehren<br />
gerichtet ist. Beinhaltet jedoch das Begehren einen bestimmten "Verfahrensstand",<br />
so wird die Auskunft von jener Organisationseinheit zu erteilen sein, die mit der Durchführung<br />
des Verfahrens be-traut ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass in den<br />
einzelnen Organisationseinheiten einzelne oder alle Bearbeiterinnen bzw. Bearbeiter mit der Erteilung<br />
der Auskunft betraut werden können.<br />
Gemäß § 6 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz ist zur<br />
Erlassung des Bescheides nach § 6 leg. cit. zuständig:<br />
- wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein Gemeindeorgan ist: Die Bürgermeisterin<br />
bzw. der Bürgermeister (Abs. 1 Z 1);<br />
- wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein Organ eines Gemeindeverbandes (Abs.<br />
1 Z 2) oder ein Organ eines sonstigen landesgesetzlich eingerichteten Selbstverwaltungskörpers<br />
(Abs. 1 Z 3) ist: Das zur Vertretung nach außen berufene Organ;<br />
226
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
- wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle die Bezirksverwaltungsbehörde oder die Agrarbezirksbehörde<br />
ist: Diese Behörde (Abs. 1 Z 4);<br />
- wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein sonstiges dem Land organisatorisch zugeordnetes<br />
Organ ist: Die Landesregierung, sofern in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist (Abs.<br />
1 Z 5);<br />
- wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Behörde der Unabhängige Verwaltungssenat ist, ist<br />
dieser zur Erlassung eines Bescheides gemäß § 5 leg. cit. in erster und letzter Instanz zuständig<br />
(Abs. 2).<br />
Gegen Bescheide, die gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 erlassen wurden, kann unmittelbar Vorstellung<br />
an die Aufsichtsbehörde im Sinn der jeweils maßgeblichen organisatorischen Bestimmungen erhoben<br />
werden (§ 6 Abs. 3 Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz).<br />
Über Berufungen gegen Bescheide, die gemäß § 6 Abs. 1 Z 3 bis 5 erlassen wurden,<br />
entscheidet der Unabhängige Verwaltungssenat (Abs. 4).<br />
B. Datenschutz<br />
Der zweite Abschnitt (§§ 8 und 9) des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes<br />
betrifft den Datenschutz; dabei wird grundsätzlich pauschal auf das Datenschutzgesetz<br />
2000 verwiesen.<br />
C. Informationsweiterverwendung<br />
Der dritte Abschnitt (§§ 10 ff) des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes<br />
(LGBl. Nr. 46/1988 in der Fassung LGBl. Nr. 86/2006), der in Umsetzung der<br />
so genannten PSI-Richtlinie (Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors –<br />
Directive on the reuse of public sector information) ergangen ist, hat die Erschließung des wirtschaftlichen<br />
Potentials, das in den Dokumenten öffentlicher Stellen liegt, zum Ziel. Insbesondere<br />
soll es Unternehmen erleichtert werden, neue Informationsprodukte und -dienste zu erstellen, indem<br />
ihnen die Möglichkeit geboten wird, durch die Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher<br />
Stellen deren wirtschaftliches Potential als Ausgangsmaterial für Produkte und Dienste, insbesondere<br />
mit digitalen Inhalten, zu nutzen und so zu Wirtschaftswachstum und zur Schaffung<br />
neuer Arbeitsplätze beizutragen (vgl. AB zu § 10, Beilage 904/2006 zum kurzschriftlichen Bericht<br />
des Oö. Landtags, XXVI. Gesetzgebungsperiode, unter Hinweis auf die Richtlinie).<br />
Unter einer "öffentlichen Stelle" im Sinne des gegenständlichen Gesetzes sind das Land (darunter<br />
fallen wohl auch die Bezirkshauptmannschaften), die Gemeinden, die landesgesetzlich eingerichteten<br />
Selbstverwaltungskörper und gewisse Einrichtungen auf landesgesetzlicher Grundlage zu<br />
verstehen (vgl. § 11).<br />
Eine Verpflichtung, Dokumente zur Weiterverwendung zur Verfügung zu stellen, wurde nicht normiert.<br />
Die Entscheidung, ob die Weiterverwendung genehmigt wird, ist Sache der jeweils betroffenen<br />
öffentlichen Stelle. Wird die Weitergabe von Dokumenten gestattet, hat dies nach Maßgabe<br />
der Bestimmungen des Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes<br />
zu erfolgen.<br />
Zu beachten ist auch, dass Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen<br />
regeln, datenschutzrechtliche Bestimmungen und gesetzliche Verschwiegenheitsbestimmungen<br />
durch das Informationsweiterverwendungsgesetz nicht berührt werden (vgl. § 10 Abs. 3).<br />
Der Begriff "Dokument" ist unabhängig von der Form des Datenträgers zu verstehen. Informationen<br />
können daher in Papier, in elektronischer Form oder als Ton,- Bild- oder audiovisuelles Material<br />
vorliegen.<br />
227
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Nach § 15 leg. cit. können öffentliche Stellen Bedingungen für die Weiterverwendung der in ihrem<br />
Besitz befindlichen Dokumente in einem Vertrag festlegen, in dem die wesentlichen Fragen der<br />
Weiterverwendung geregelt werden. Diese Bedingungen dürfen die Möglichkeit der Weiterverwendung<br />
der begehrten Dokumente nicht unnötig einschränken und keine Behinderung des Wettbewerbs<br />
bewirken.<br />
Entscheidend ist grundsätzlich, dass die Weitergabe von Dokumenten in nichtdiskriminierender<br />
Weise geschieht (vgl. § 17). Das bedeutet einerseits, dass Dokumente, die sich im Besitz von öffentlichen<br />
Stellen befinden und zur Weiterverwendung verfügbar sind, allen potenziellen Marktteilnehmerinnen<br />
und Marktteilnehmern offen stehen müssen, und andererseits, dass die Entgelte und<br />
sonstigen Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten, die sich im Besitz öffentlicher<br />
Stellen befinden, für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung nicht diskriminierend zu sein<br />
haben. Vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung liegen dann vor, wenn der Zweck der<br />
Weiterverwendung bzw. das mit der Weiterverwendung beabsichtigte Endprodukt gleich oder zumindest<br />
gleichartig ist. Für verschiedene Zwecke der Weiterverwendung können daher auch verschiedene<br />
Entgelte für ein und dasselbe Dokument verrechnet werden. Ausschließlichkeitsvereinbarungen,<br />
dh. Vereinbarungen zwischen öffentlichen Stellen und Dritten, die ausschließliche<br />
Rechte hinsichtlich der Weiterverwendung der in den Geltungsbereich des Oö. Auskunftspflicht-,<br />
Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetzes fallenden Dokumente festlegen, sind<br />
daher jedenfalls unzulässig (vgl. § 18 Abs. 1). Für die kommerzielle und die nicht-kommerzielle<br />
Weiterverwendung der Dokumente können öffentliche Stellen unterschiedliche Entgelte und unterschiedliche<br />
Nutzungsbedingungen vorsehen.<br />
Zur Frage der Einhebung von Entgelten ist auf § 14 zu verweisen. Nach dieser Bestimmung steht<br />
es den öffentlichen Stellen frei, ob Entgelte eingehoben werden oder nicht. Entscheiden sich die<br />
öffentlichen Stellen für die Einhebung von Entgelten, so haben sie diese selbst festzulegen; allerdings<br />
dürfen diese Entgelte nicht willkürlich festgesetzt werden und nicht überhöht sein (nähere<br />
Regelungen trifft § 14).<br />
§ 16 Abs. 1 sieht vor, dass die für die Weiterverwendung von Dokumenten geltenden Standardbedingungen<br />
und Standardentgelte von den öffentlichen Stellen im Voraus festzulegen und in geeigneter<br />
Weise – nach Möglichkeit im Internet – zu veröffentlichen sind.<br />
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die öffentlichen Stellen nicht verpflichtet sind, Dokumente,<br />
die sich in ihrem Besitz befinden, weiterzugeben und bei der Weitergabe von Daten auf<br />
gesetzliche Bestimmungen wie etwa Datenschutz und Amtsverschwiegenheit zu achten haben.<br />
Sofern Daten gegen Entgelt weitergegeben werden, werden entsprechende Regelungen getroffen<br />
und entsprechend veröffentlicht.<br />
228
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang 2 zu § 77 Abs. 5 <strong>DBO</strong><br />
Umweltinformationsgesetz; Oö. Umweltschutzgesetz 1996;<br />
Durchführung<br />
Für die innerorganisatorische Kompetenz zur Auskunftserteilung bzw. zur Bescheiderlassung nach<br />
dem Umweltinformationsgesetz (UIG) bzw. dem Oö. Umweltschutzgesetz 1996 gilt Folgendes:<br />
1. Auskunftserteilung und Bescheiderlassung beim Amt der Oö. Landesregierung:<br />
a) Grundsatz:<br />
Wird ein Begehren auf Mitteilung von Umweltdaten beim Amt der Landesregierung eingebracht,<br />
so ist zur Auskunftserteilung bzw. Bescheiderlassung grundsätzlich jene Abteilung<br />
zuständig, die auf Grund der Geschäftseinteilung des Amtes der Oö. Landesregierung und<br />
des Kompetenzen-Kataloges mit der Wahrnehmung der Angelegenheit betraut ist, auf die<br />
sich das Auskunftsbegehren bezieht.<br />
b) Sonderregelung für die Abteilungen des "Fachdienstes":<br />
Wird ein schriftliches Begehren auf Mitteilung von Umweltdaten nach dem UIG bei Abteilungen<br />
des "Fachdienstes" eingebracht, so hat zunächst die Abteilung des "Fachdienstes", die<br />
aufgrund der Geschäftseinteilung des Amtes der Oö. Landesregierung und des Kompetenzen-Kataloges<br />
mit der Wahrnehmung der angefragten Angelegenheit betraut ist, festzustellen,<br />
inwieweit die angefragten Umweltdaten zur Verfügung stehen. Anschließend hat diese<br />
Abteilung die Anfrage samt den zur Verfügung stehenden Umweltdaten bzw. samt einer Information<br />
über das Nicht-Vorhandensein von Umweltdaten an die für sie im konkreten Fall<br />
zuständige "Rechtsabteilung" zu übermitteln.<br />
Zur Auskunftserteilung (einschließlich des Verfahrens im Zusammenhang mit Geschäftsund<br />
Betriebsgeheimnissen gemäß § 7 UIG bzw. § 18 Oö. Umweltschutzgesetz 1996) bzw.<br />
zur Bescheiderlassung ist in diesen Fällen die (nach der Geschäftseinteilung des Amtes der<br />
Oö. Landesregierung und nach dem Kompetenzen-Katalog) jeweils für die angefragte Materie<br />
in Betracht kommende "Rechtsabteilung" zuständig.<br />
Beispiel anhand der Direktion Umwelt und Wasser: Bei der Abteilung Umweltschutz werden<br />
Umweltdaten angefragt. Die Abteilung Umweltschutz übermittelt die Anfrage samt vorhandenen<br />
Daten an die Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht. Die Abteilung Anlagen-,<br />
Umwelt- und Wasserrecht erteilt dann die Auskunft (bzw. erlässt bei angefragten Umweltdaten,<br />
die nicht vorhanden sind oder über die nicht Auskunft erteilt werden kann, den abweisenden<br />
Bescheid).<br />
Die Verpflichtung, das Informationsbegehren ohne unnötigen Aufschub unter Berücksichtigung<br />
etwaiger von der bzw. dem Informationssuchenden angegebenen Terminen, grundsätzlich<br />
aber spätestens innerhalb eines Monats (vgl. dazu § 5 Abs. 6 UIG; § 16 Abs. 6 Oö.<br />
Umweltschutzgesetz 1996) zu beantworten, trifft in diesen Fällen alle beteiligten Abteilungen;<br />
eine enge Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Abteilungen des "Fachdienstes"<br />
und den jeweils zuständigen "Rechtsabteilungen" empfiehlt sich daher.<br />
c) Vorgangsweise, wenn mehrere Organisationseinheiten von einer Anfrage betroffen<br />
sind:<br />
Wenn mehrere Organisationseinheiten mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten betraut<br />
sind, auf die sich ein Auskunftsbegehren bezieht, trifft die Verpflichtung zur Auskunftserteilung<br />
bzw. Bescheiderlassung diejenige Organisationseinheit, an die das Auskunftsbegehren<br />
229
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
gerichtet ist. Falls es sich dabei um eine Abteilung des "Fachdienstes" handelt, gilt die unter<br />
b) festgehaltene Regelung sinngemäß.<br />
d) Vorgangsweise, wenn eine Anfrage an mehrere Organisationseinheiten gerichtet ist:<br />
Soweit aus der Anfrage erkennbar ist, dass diese an mehrere Organisationseinheiten gerichtet<br />
wurde, hat die hauptsächlich von der Anfrage betroffene Organisationseinheit (siehe Geschäftseinteilung<br />
des Amtes der Landesregierung bzw. Kompetenzen-Katalog) neben der<br />
Auskunftserteilung bzw. Bescheiderlassung auch die entsprechenden Koordinierungsmaßnahmen<br />
zu treffen. Falls es sich dabei um eine Abteilung des "Fachdienstes" handelt, gilt die<br />
unter b) festgehaltene Regelung sinngemäß.<br />
2. Auskunftserteilung und Bescheiderlassung bei den Bezirkshauptmannschaften und der<br />
Agrarbezirksbehörde:<br />
Sofern die Angelegenheit, auf die sich das Auskunftsbegehren bezieht, von Bezirkshauptmannschaften<br />
bzw. der Agrarbezirksbehörde wahrgenommen wird, sind diese für die Auskunftserteilung<br />
bzw. die Bescheiderlassung zuständig.<br />
Anfragen nach dem UIG und nach dem Oö. Umweltschutzgesetz 1996 haben in einem besonderen<br />
Ausmaß fachübergreifenden Charakter; aus diesem Grund ist es notwendig, dass bei der Anfragebeantwortung<br />
zwischen den beteiligten Organisationseinheiten eine möglichst effiziente und<br />
unbürokratische Zusammenarbeit (vor allem in Form telefonischer Absprachen und kurzer Besprechungen<br />
der beteiligten Bearbeiterinnen bzw. Bearbeiter) stattfindet.<br />
230
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 78 <strong>DBO</strong><br />
Objektive und unparteiische Entscheidungen von Landesbediensteten<br />
Es ist in unser aller Interesse, nicht nur gesetzmäßig und objektiv zu entscheiden, sondern dies<br />
auch für Außenstehende klar erkenntlich zu machen. Daher ist auch im Bereich der Privatwirtschaft<br />
der § 7 Abs. 1 AVG 1991 jedenfalls als Leitlinie heranzuziehen.<br />
Von Befangenheit ist gemäß VwGH-Judikatur dann zu sprechen, wenn die Möglichkeit besteht,<br />
dass ein Organ durch seine persönliche Beziehung zu der den Gegenstand einer Beratung und<br />
Beschlussfassung bildenden Sache oder zu den an dieser Sache beteiligten Personen in der unparteiischen<br />
Amtsführung beeinflusst sein könnte.<br />
Zu § 7 Abs. 1 Z. 3 hat der VwGH weiters entschieden, dass zum Beispiel die Bezeichnung einer<br />
Partei als "lächerliche Fischereiberechtigte" die Unbefangenheit bereits in Zweifel ziehen lässt.<br />
Auch ist die "Ausübung verschiedener Funktionen durch dieselbe Person im gleichen Falle" bedenklich,<br />
wenn es nicht andere gesetzliche Anordnungen gibt. Allerdings ist das "Du-Wort" alleine<br />
noch kein Indiz für Befangenheit.<br />
Im Sinne einer bürgerorientierten Verwaltung ist somit neben der objektiven Entscheidung in der<br />
Sache immer auch die Optik für Außenstehende zu beachten. Im Zweifelsfall ist bei hoheitlichen<br />
ebenso wie bei privatwirtschaftlichen Verfahren die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter<br />
zu informieren und eine Vertretung zu veranlassen.<br />
231
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 80 Abs. 1 <strong>DBO</strong><br />
Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten;<br />
Genehmigungspflicht 1<br />
Nachfolgender Erlass betreffend die Genehmigungspflicht von Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten<br />
gilt mit Wirkung vom 8. März 1999.<br />
A. Allgemeine Bestimmungen<br />
1. Definition der Nebenbeschäftigung<br />
Nebenbeschäftigung ist jede erwerbsmäßige Beschäftigung, die Landesbedienstete außerhalb<br />
ihres Dienstverhältnisses ausüben.<br />
Erwerbsmäßig ist jede selbständige oder unselbständige Tätigkeit, die unabhängig von Dauer, Ort<br />
oder tatsächlichem Erfolg die Erzielung von Einnahmen bezweckt. (Entscheidend ist nicht der tatsächliche<br />
subjektive Wille der bzw. des Bediensteten, sondern der aus ihrer bzw. seiner Tätigkeit<br />
zutage tretende objektive Erklärungswert aus der Sicht eines vernünftigen und einsichtigen Menschen<br />
in der konkreten Situation des Handelnden unter Berücksichtigung der allgemeinen Lebenserfahrung;<br />
objektiviert-subjektiver Maßstab).<br />
Dazu zählen insbesondere der Betrieb eines Unternehmens, mag dieser im Einzelfall auch Verluste<br />
bringen, eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ<br />
einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten Rechtes oder Personengesellschaft.<br />
Dazu zählen insbesondere die Aktiengesellschaften, GmbH, OHG, KG, OEG, KEG, EEG, Genossenschaften,<br />
Stiftungen, Fonds, Vereinssparkassen.<br />
Nicht darunter fallen Vermietung, Verpachtung oder sonstige Nutzung bzw. Verwaltung des eigenen<br />
Vermögens. (Dies gilt nicht bei gewerbsmäßigen Vermietungen wie z.B. § 4 GewO 1994 bezüglich<br />
Vermietung von Stellplätzen.)<br />
Nicht erwerbsmäßig sind weiters ehrenamtliche Tätigkeiten wie z.B. freiwillige Rot-Kreuz-Helfer,<br />
freiwillige Feuerwehr, etc. Dies gilt grundsätzlich für alle Funktionen in Vereinen nach dem Vereinsgesetz,<br />
selbst wenn diese mit Aufwandsentschädigungen verbunden sind.<br />
2. Unzulässigkeit von Nebenbeschäftigungen<br />
Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung ist bei Vorliegen der folgenden Gründe auch dann unzulässig,<br />
wenn die Grenzen der Genehmigungspflicht (siehe Abschnitt A, Punkt 4.) nicht erreicht<br />
werden.<br />
Landesbedienstete dürfen keine Nebenbeschäftigung ausüben, die<br />
a. sie an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben behindern,<br />
b. die Vermutung der Befangenheit in Ausübung ihres Dienstes hervorrufen (dies liegt dann<br />
vor, wenn durch die Ausübung der Nebenbeschäftigung in der Bevölkerung der Eindruck erweckt<br />
werden könnte, dass Bedienstete bei der Versehung ihres Dienstes nicht völlig unbefangen<br />
und in ihrer Entscheidungsfreiheit gehemmt sind),<br />
c. für die Landesbedienstete bzw. den Landesbediensteten eine zusätzliche Belastung schafft,<br />
durch die eine Beeinträchtigung der vollen geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit im<br />
Dienst zu erwarten ist,<br />
d. dem Grund der gewährten Teilzeitbeschäftigung oder des gewährten Karenzurlaubs widerspricht<br />
oder<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf dem Erlass vom 3. Februar 1999, PersR-450016/143-1998/Kop, geändert<br />
mit Sammelerlass vom 30. Oktober 2006, PersR-490000/561-2006-Kop/Gi.<br />
233
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
e. sonstige wesentliche Interessen des Landes Oberösterreich als Dienstgeber oder als<br />
Träger von Privatrechten gefährdet.<br />
Die Einhaltung dieser Bestimmungen hat jede bzw. jeder Bedienstete sowohl vor Aufnahme einer<br />
Nebenbeschäftigung als auch während der Ausübung von genehmigten Nebenbeschäftigungen<br />
auch für sich selber ständig zu prüfen und zu beachten. Im Fall eines Verstoßes der Nebenbeschäftigung<br />
gegen diese Regelung hat sie bzw. er die Nebenbeschäftigung entsprechend einzuschränken<br />
bzw. gänzlich zu unterlassen.<br />
Weiters hat die bzw. der jeweilige Vorgesetzte die Einhaltung dieser Vorschriften nach bestem<br />
Wissen und Gewissen zu kontrollieren und bei Zuwiderhandeln für die Einhaltung der Vorschriften<br />
zu sorgen. Wird die Nebenbeschäftigung dennoch nicht eingeschränkt bzw. unterlassen, ist unverzüglich<br />
Meldung an die Abteilung Personal zu erstatten.<br />
3. Vorrang der dienstlichen Tätigkeit<br />
Die dienstliche Tätigkeit hat – insbesondere auch bei Diensteinteilungen, Notwendigkeiten von<br />
Mehrdienstleistungen, etc. – Vorrang gegenüber einer Nebenbeschäftigung.<br />
Dies gilt nicht in jenen Fällen, in denen das (zeitliche) Ausmaß der Beschäftigung im Landesdienst<br />
im Verhältnis zur Normalarbeitszeit so gering ist, dass bei realistischer Betrachtungsweise von der<br />
bzw. dem Be-diensteten der Vorrang des Dienstverhältnisses zum Land Oberösterreich im Hinblick<br />
auf seinen Hauptberuf in zumutbarer Weise nicht verlangt werden kann (z.B.: Konsiliarfachärztin<br />
bzw. Konsiliarfacharzt).<br />
4. Genehmigungspflicht<br />
Einer Genehmigung für die beabsichtigte Ausübung einer Nebenbeschäftigung bedürfen Landesbedienstete,<br />
wenn das (der) aus einer Nebenbeschäftigung erzielte Entgelt (Umsatz) bar oder in<br />
Güterform voraussichtlich den Betrag von 291 Euro in einem Kalendermonat überschreitet. (Die<br />
einmalige Überschreitung der Grenze von 291 Euro begründet auch dann die Genehmigungspflicht,<br />
wenn der Umsatz in einem anderen Monat diesen Wert nicht erreicht oder wenn keine Absicht<br />
besteht, die Tätigkeit zu wiederholen.)<br />
Dies gilt nicht für Konsiliarfachärztinnen und -ärzte.<br />
Für die Berechnung dieser Grenze (291 Euro) sind die "Brutto(Roh-)einnahmen", also das Entgelt<br />
(der Umsatz) vor dem Abzug der Steuern bzw. Sozialversicherungsbeiträge und ohne Berücksichtigung<br />
der Betriebsaufwendungen (Werbungskosten, Investitionsaufwand, Vorsteuerabzug, etc.)<br />
maßgebend.<br />
Bis zur Entscheidung der Abteilung Personal darf die Nebenbeschäftigung nicht ausgeübt werden,<br />
es ist daher rechtzeitig vor Aufnahme der geplanten Tätigkeit schriftlich, mittels des beiliegenden<br />
Formblattes um Genehmigung anzusuchen.<br />
Dem Ansuchen sind alle zur Beurteilung der Nebenbeschäftigung und der Auswirkungen der Nebenbeschäftigung<br />
erforderlichen Angaben, wie insbesondere Angaben über die Art und die Dauer<br />
der Nebenbeschäftigung sowie die voraussichtliche Höhe des dadurch erzielten Entgelts (Umsatzes),<br />
anzuschließen.<br />
Die bzw. der Landesbedienstete hat eine Gleichschrift (Kopie) seines Ansuchens unverzüglich<br />
auf direktem Weg – ohne Stellungnahme seiner bzw. seines Vorgesetzten – der Abteilung<br />
Personal zu übermitteln (Vorabinformation).<br />
Die bzw. der Vorgesetzte (Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter, Bezirkshauptfrau bzw. Bezirkshauptmann,<br />
ärztliche Leiterin bzw. ärztlicher Leiter, Verwaltungsleiterin bzw. Verwaltungsleiter,<br />
etc.) hat eine ausführliche Stellungnahme (Unterschrift und Datum allein genügen nicht) zu<br />
234
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
der in Aussicht genommenen Nebenbeschäftigung abzugeben und diese mit der bzw. dem Bediensteten<br />
zu besprechen.<br />
Das Ansuchen (ausgefülltes Formblatt samt Stellungnahme) ist von der bzw. von dem Vorgesetzten<br />
unverzüglich, spätestens jedoch binnen vierzehn Tagen ab Einlangen an die Abteilung<br />
Personal weiterzuleiten.<br />
Enthält das Ansuchen die geforderten Angaben nicht oder nicht vollständig, ist der bzw. dem Bediensteten<br />
formfrei die Nachbringung fehlender Unterlagen oder Angaben binnen angemessener<br />
Frist von der Abteilung Personal aufzutragen. Kommt die bzw. der Bedienstete dieser<br />
Aufforderung nicht fristgerecht nach, gilt ihr bzw. sein Genehmigungsansuchen als zurückgezogen.<br />
(Innerhalb der offenen Frist für die Verbesserung eines Ansuchens wird der Fristenlauf<br />
für die Nichtgenehmigung einer Nebenbeschäftigung (vgl. unten) unterbrochen.)<br />
Die Genehmigung ist aus den in Abschnitt A, Punkt 2 aufgezählten Gründen zu versagen.<br />
Eine Genehmigung gilt unbeschadet allenfalls erforderlicher sonstiger Voraussetzungen (zB.<br />
Gewerbeschein, etc.) als erteilt, wenn der Dienstgeber nicht binnen zwei Monaten nach Absendung<br />
der Gleichschrift des Genehmigungsansuchens durch die Landesbedienstete<br />
bzw. den Landesbediensteten direkt an die Abteilung Personal (Vorabinformation) die Ausübung<br />
der Nebenbeschäftigung untersagt.<br />
Unterbleibt eine Vorabinformation, beginnt diese Frist mit Einlangen des Ansuchens in der Abteilung<br />
Personal zu laufen.<br />
Neu in den oö. Landesdienst eintretende Bedienstete, die bereits zu diesem Zeitpunkt eine Nebenbeschäftigung<br />
ausüben, haben unverzüglich nach Dienstantritt um Genehmigung anzusuchen.<br />
Bisher gemeldete und vom Dienstgeber zur Kenntnis genommene Nebenbeschäftigungen bedürfen<br />
nur im Fall einer wesentlichen Änderung der Tätigkeit (siehe unten Pkt. 6) einer Genehmigung.<br />
5. Widerruf<br />
Der Dienstgeber hat die Genehmigung einer Nebenbeschäftigung zu widerrufen, wenn nachträglich<br />
ein in Abschnitt A, Punkt 2. dieses Erlasses genannter Grund eintritt oder hervorkommt und<br />
dieser auch durch die nachträgliche Vorschreibung einer Befristung oder von Bedingungen oder<br />
Auflagen nicht beseitigt werden kann.<br />
6. Veränderungen/Wegfall<br />
Sofern sich eine gemeldete Nebenbeschäftigung hinsichtlich des Ausmaßes der zeitlichen Inanspruchnahme<br />
der bzw. des Bediensteten oder sonst wesentlich ändert (sofern keine zeitliche Einschränkung<br />
der Nebenbeschäftigung vorliegt, bedarf allerdings die Änderung der Nebenbeschäftigung<br />
einer Genehmigung), oder wenn die Nebenbeschäftigung nicht mehr ausgeübt wird, ist dies<br />
unverzüglich im Dienstweg der Abteilung Personal zu melden.<br />
7. Sämtliche Nebenbeschäftigungen dürfen nur (noch) außerhalb der Dienstzeit ausgeübt<br />
werden<br />
Ist dennoch eine Ausübung der Nebenbeschäftigung während der Dienstzeit erforderlich und stehen<br />
dem keine dienstlichen Interessen entgegen, so kann die Nebenbeschäftigung auch zu dieser<br />
Zeit ausgeübt werden, sofern die dadurch versäumten Dienststunden durch Erholungsurlaub oder<br />
Zeitausgleich ausgeglichen werden.<br />
8. Konkurrenzierung<br />
Jede Konkurrenzierung des Landes Oberösterreich im selben Geschäftszweig bzw. Aufgabengebiet<br />
wie das dienstliche Aufgabengebiet der bzw. des Bediensteten ist unzulässig, wenn dadurch<br />
235
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Interessen des Landes Oberösterreich beeinträchtigt werden könnten. (Je nach konkreter Situation<br />
können sich Nebenbeschäftigungen, die der Art nach auch durch das Land Oberösterreich<br />
selbst erbracht werden, positiv oder negativ auf die Interessen des Landes Oberösterreich auswirken,<br />
z.B. Materialprüfungen.)<br />
Jede bewusste solche Konkurrenzierung ist eine Dienstpflichtverletzung.<br />
9. Werbung, Geschäftsanbahnung, etc.<br />
Grundsätzlich ist die Entfaltung jedweder Aktivität (zB. Werbung, Geschäftsanbahnung, Vermittlung,<br />
Terminkoordination, etc.) im Zusammenhang mit der Nebenbeschäftigung während des<br />
Dienstes und im Bereich der Dienststelle untersagt.<br />
10. Amtseinrichtungen<br />
Sofern im Rahmen von Nebenbeschäftigungen Amtseinrichtungen (auch Amtsräume!) verwendet<br />
werden sollen, ist mit der Landesgebäudeverwaltung hinsichtlich einer Abgeltungsregelung das<br />
Einvernehmen herzustellen.<br />
Die Benützung von Amtseinrichtungen ohne entsprechende Abgeltung ist grundsätzlich unzulässig.<br />
(Diese kann allenfalls auch darin bestehen, dass die unentgeltliche Zurverfügungstellung vereinbart<br />
ist.)<br />
B. Sonderbestimmungen<br />
1. Privatordination von Ärztinnen und Ärzten<br />
§ 7 Oö. Krankenanstaltenfonds-Gesetz, LGBl.Nr.42/1997, sieht das Ziel der "Eindämmung der<br />
Nebenbeschäftigung von in Krankenanstalten beschäftigten Ärztinnen/Ärzten in Form einer Niederlassung<br />
in freier Praxis" vor. Die Bestimmungen über Nebenbeschäftigungen in den Dienstrechtsgesetzen<br />
(§ 58 Oö. LBG, § 14 Oö. L<strong>VB</strong>G) sind daher insoweit restriktiv auszulegen.<br />
Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass mit dem Betrieb einer Privatordination<br />
eine Genehmigungspflicht (gemäß Abschnitt A, Punkt 4. dieses Erlasses) besteht.<br />
Für künftige Neueröffnungen von Privatordinationen von Ärztinnen bzw. Ärzten gilt daher:<br />
• Organisatorische Belange der Dienststelle dürfen nicht beeinträchtigt werden, insbesondere<br />
müssen die Ordinationszeiten in Übereinstimmung mit den dienstlichen Erfordernissen<br />
(Diensteinteilung, Einteilung zu Sonn-, Feiertags-, Nacht- und OP-Diensten, etc.) fixiert werden.<br />
• Es darf keine Kassenplanstelle für die in § 2 des Gesamtvertrages (abgeschlossen zwischen<br />
der Ärztekammer für Oberösterreich und dem Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungs-träger)<br />
angeführten Krankenversicherungsträger bestehen.<br />
• Die Nebenbeschäftigung darf den Intentionen des Landes Oberösterreich als Träger der Landeskrankenanstalten<br />
nicht widersprechen. Insbesondere sind Operationen und Behandlungen<br />
(konsiliariter) von Patientinnen und Patienten der Privatordination in Krankenanstalten, Tageskliniken<br />
oder Ambulatorien, die nicht in der Trägerschaft des Landes Oberösterreich stehen,<br />
grundsätzlich unzulässig (Ausnahme nur in Notfällen).<br />
• Die Privatordination darf das zeitliche Ausmaß von maximal 6 Stunden pro Woche nicht ü-<br />
berschreiten.<br />
• Die Adresse der Privatordination sowie die (genauen) Ordinationszeiten und der Zeitpunkt<br />
der Eröffnung der Privatordination sind der Abteilung Personal jedenfalls bekanntzugeben.<br />
2. Amtsärzte<br />
• Für Nebenbeschäftigungen, die – wenn es dienstlich möglich ist – während der Dienstzeit ausgeübt<br />
werden, ist Erholungsurlaub oder Zeitausgleich heranzuziehen. Für die Inanspruchnah-<br />
236
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
me von Zeitausgleich während der Kerndienstzeit gelten die Bestimmungen der Gleitzeitregelung.<br />
Es ist jeweils ein Zeitbeleg auszufüllen.<br />
• Betriebsärztliche Tätigkeiten nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz dürfen jeweils nur<br />
außerhalb des jeweiligen örtlichen Zuständigkeitsbereichs/Bezirks der dienstlichen Zuständigkeit<br />
durchgeführt werden. (Davon ausgenommen sind lediglich Untersuchungen gemäß § 49<br />
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz von einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinsichtlich<br />
gefährlicher Arbeitsstoffe sowie generell die arbeitsmedizinische Betreuung von Betrieben<br />
der Sozialhilfeverbände).<br />
• Führerscheinuntersuchungen als sachverständige Ärztin bzw. sachverständiger Arzt gemäß<br />
§ 34 Führerscheingesetz i.V.m. § 22 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung dürfen lediglich<br />
außerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs/Bezirks der dienstlichen Zuständigkeit<br />
durchgeführt werden. (Mit der bescheidmäßigen Bestellung zur sachverständigen<br />
Ärztin bzw. zum sachverständigen Arzt gemäß § 34 i.V.m. mit § 8 Führerscheingesetz durch<br />
den Landeshauptmann als Verkehrsbehörde ist keine dienstrechtliche Genehmigung dieser<br />
Nebenbeschäftigung verbunden.)<br />
• Sofern eine Mitwirkung von sonstigen Landesbediensteten bei Nebenbeschäftigungen erforderlich<br />
sein sollte, gelten dafür die allgemeinen Regelungen für Nebenbeschäftigungen (Abschnitt<br />
A dieses Erlasses). Eine Heranziehung von solchen Bediensteten kann nur auf freiwilliger<br />
Basis erfolgen.<br />
Zur Klarstellung dient weiters folgende Abgrenzung:<br />
Alle Impfungen (samt Impfberatungen) für Kinder und Jugendliche laut Impfplan sind (künftig) jedenfalls<br />
Dienst. Dies gilt auch für die FSME-Impfung.<br />
Die Durchführung von Impfberatungen und Impfungen für Fernreisende sind jedenfalls für die<br />
Landessanitätsdirektion dienstliche Tätigkeit. (Impfberatungen durch BH-Amtsärzte sowie Durchführung<br />
dieser Impfungen in Einzelfällen bedürfen ebenfalls keiner Meldung bzw. Genehmigung.)<br />
3. Sachverständigen- und Planungstätigkeit<br />
• Beabsichtigt eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter, ihre bzw. seine Eintragung in eine der bei<br />
den Gerichtshöfen zu führenden Sachverständigenlisten / Dolmetscherlisten zu beantragen<br />
oder will sie bzw. er – ohne in die Liste eingetragen zu sein – bzw. soll sie bzw. er als Sachverständiger/Dolmetscher<br />
im Einzelfall bei Gericht herangezogen werden, benötigt sie bzw. er<br />
unter den Voraussetzungen des Abschnitt A, Punkt 4. dieses Erlasses, die nach der allgemeinen<br />
Lebenserfahrung in der Regel vorliegen werden, eine Genehmigung des Dienstgebers.<br />
• In jedem konkreten Fall einer Heranziehung in einem Gerichtsverfahren ist weiters unverzüglich<br />
eine Meldung an die jeweilige Vorgesetzte bzw. den jeweiligen Vorgesetzten, bei der<br />
bzw. dem hierüber schriftliche Aufzeichnungen zu führen sind, im Dienstweg zu erstatten. (Die<br />
bloße Dokumentation in Form von Gleitzeitmonatsjournalen reicht nicht.)<br />
Sofern eine solche konkrete Nebenbeschäftigung von vornherein unzulässig ist (siehe Abschnitt<br />
A, Punkt 2. dieses Erlasses), hat die bzw. der Vorgesetzte unverzüglich der bzw. dem<br />
Bediensteten die Ausübung der Nebenbeschäftigung zu untersagen, damit die bzw. der Bedienstete<br />
ehestmöglich die zuständige Richterin bzw. den zuständigen Richter davon in Kenntnis<br />
setzen kann (um eine Aufhebung der Bestellung als Sachverständige bzw. Sachverständiger<br />
zu bewirken).<br />
• Sachverständigentätigkeiten dürfen nicht im selben sachlichen/fachlichen bzw. örtlichen<br />
Zuständigkeitsbereich (vgl. Abschnitt B, Punkt 2., 3. Absatz) wie die dienstliche Tätigkeit der<br />
bzw. des Be-diensteten ausgeübt werden, sofern die bzw. der Bedienstete durch die Ausübung<br />
der Nebenbeschäftigung bei ihrer bzw. seiner dienstlichen Tätigkeit befangen sein könnte.<br />
• Bei außergerichtlicher Sachverständigentätigkeit und für Planungstätigkeiten gelten die<br />
vorgenannten Punkte gleichermaßen. (Die Pflicht zur zusätzlichen Meldung im Einzelfall – Abschnitt<br />
B, Punkt 3., 2. Absatz – besteht nicht, wenn die Genehmigung des Dienstgebers diese<br />
Fälle abdeckt. Dies ist insbesondere bei einer Genehmigung der gewerbsmäßigen Ausübung in<br />
Form eines eigenen Unternehmens oder bei dauerhaften Arbeitsverhältnissen zu einem bestimmten<br />
Unternehmen wie zB einem Architektenbüro, Zivilingenieurbüro regelmäßig der Fall.)<br />
237
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Für Sachverständigentätigkeiten von Ärztinnen bzw. Ärzten in Landesanstalten und -betrieben<br />
sowie für Sachverständigentätigkeiten oder Planungstätigkeiten von Lehrerinnen bzw. Lehrern<br />
gilt die in den vorgehenden vier Absätzen vorgeschriebene Vorgangsweise – ohne, dass die<br />
Genehmigungspflicht selbst davon berührt wird – nicht.<br />
C. Evaluierung<br />
entfällt mit Sammelerlass PersR-490000/561-2006-Kop/Gi<br />
D. Politische Tätigkeit<br />
Politische Funktionen i.S. der Bezügegesetze des Bundes und der Länder, insbesondere des Oö.<br />
Landes-Bezügegesetzes 1998 bzw. des Oö. Gemeinde-Bezügegesetzes 1998, sind keine Nebenbeschäftigungen<br />
im Sinn dieses Erlasses und brauchen daher nicht gemeldet zu werden. Für diese<br />
Funktionen gelten die diesbezüglichen Bestimmungen des Oö. L<strong>VB</strong>G bzw. des Oö. LBG.<br />
E. Abschließende Bemerkungen<br />
Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Erlasses ist eine Dienstpflichtverletzung und kann<br />
neben anderen dienstrechtlichen Konsequenzen u.a. zum Widerruf der Genehmigung der Nebenbeschäftigung<br />
führen.<br />
Alle früheren Erlässe betreffend Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten sind mit Inkrafttreten<br />
dieses Erlasses ersatzlos aufgehoben.<br />
Wir ersuchen, diesen Erlass allen Bediensteten nachweislich zur Kenntnis zu bringen.<br />
Weiters werden die dezentralen Personalstellen hiermit angewiesen, einlangende Ansuchen mit<br />
dem Eingangsstempel (Datum!) zu versehen und (gemäß Abschnitt A, Punkt 4 dieses Erlasses)<br />
unverzüglich an die Abteilung Personal weiterzuleiten, sowie die Bediensteten auf Ihre Verpflichtung<br />
zur Vorabinformation (gemäß Abschnitt A, Punkt 4 dieses Erlasses) hinzuweisen.<br />
In Zweifelsfällen ist die Abteilung Personal zu befassen.<br />
Nebentätigkeiten<br />
1. Grundsätzliches<br />
Gemäß § 25 Oö. Landes-Gehaltsgesetz liegt eine Nebentätigkeit vor, wenn eine Beamtin bzw.<br />
ein Beamter (bzw. gem. § 25 Oö. Landes-Gehaltsgesetz iVm. § 28 Oö. L<strong>VB</strong>G eine Vertragsbedienstete<br />
bzw. ein Vertragsbediensteter) ohne unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem bzw. seinem<br />
ihr bzw. ihm nach dem Dienstposten obliegenden Dienstpflichten noch eine weitere Tätigkeit<br />
für das Land in einem anderen Wirkungskreis entfaltet, weswegen der bzw. dem Bediensteten<br />
auch gemäß § 90 Abs. 2 Oö. LBG eine gesonderte Entschädigung (Nebentätigkeits-<br />
Entschädigung) zusteht.<br />
(Im Unterschied dazu ist eine Nebenbeschäftigung gem. § 14 Oö. L<strong>VB</strong>G bzw. § 58 Oö. LBG jede<br />
erwerbsmäßige 2 Beschäftigung, die die Beamtin bzw. der Beamte bzw. die Vertragsbedienstete<br />
bzw. der Vertragsbedienstete außerhalb seines Dienstverhältnisses ausübt. 3 )<br />
Im Schreiben vom 12.3.1999, PersR-450016/162-1999/Kop wurde bereits angekündigt, dass Entschädigungen<br />
für Nebentätigkeiten von Landesbediensteten – mit Ausnahme von hoheitlichen<br />
2<br />
3<br />
Erwerbsmäßig ist jede selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit, die unabhängig von Dauer, Ort<br />
oder tatsächlichem Erfolg die Erzielung von Einnahmen bezweckt.<br />
Die Nebentätigkeit wird für das Land, die Nebenbeschäftigung für andere erbracht.<br />
238
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Funktionen (siehe im folgenden unter Pkt 2.1.) – nicht mehr wie bisher von den einzelnen Bewirtschaftern<br />
(insb. aus dem Sachaufwand) brutto für netto angewiesen werden dürfen, sondern<br />
zwecks sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Behandlung künftig im Wege der Zentralen<br />
Besoldungsstelle mit dem Monatsbezug abgerechnet werden.<br />
2. Unterscheidung der Nebentätigkeiten<br />
2.1. Hoheitliche Nebentätigkeiten<br />
Nebentätigkeiten in Form von hoheitlichen Funktionen, für die der betreffende Landesbedienstete<br />
hoheitlich (mit Bescheid bzw. Beschluss der Oö. Landesregierung) ernannt wird 4 .<br />
Dazu zählen insbesondere<br />
behördliche Tätigkeiten wie in<br />
• Bezirksgrundverkehrskommissionen<br />
• Bezirksschulräte<br />
• Dienstbeurteilungs(ober)kommission(en)<br />
• Disziplinar(ober)kommission(en)<br />
• Landesagrarsenat<br />
• Landesgrundverkehrskommission<br />
• Ethikkommission<br />
Aufsichtstätigkeiten wie zB für/bei<br />
• Sparkassen (Kommissär)<br />
• Kranken- und Unfallfürsorgeeinrichtungen<br />
Prüfungstätigkeiten wie zB<br />
• Baugewerbe-Prüfung<br />
• Bildvorführerprüfung<br />
• Sonstige gewerberechtliche Prüfungen<br />
• Dienstprüfung 5 ; (Land, Gemeinden, Statutarstädte)<br />
• Fahrprüfung (Führerscheinprüfung 6 )<br />
• Schiffsführerprüfung<br />
• Luftverkehrsprüfung<br />
• Jagdprüfung<br />
• Jagdhüterprüfung<br />
• Berufsjägerprüfung<br />
• Fischereischutzprüfung<br />
Tätigkeiten in gesetzlich vorgesehenen (beratenden) Organen 7 wie zB<br />
• Landessanitätsrat<br />
• Raumordnungsbeirat<br />
• Musikschulbeirat<br />
• Landeskulturbeirat<br />
• Beirat für Sozialplanung<br />
• Familienbeirat<br />
• Fachbeirat für Bodenschutz<br />
• Jagdbeirat<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Da der Verordnungsentwurf des Finanzministeriums zu § 25 EStG 1988 vom 20.5.1999, GZ. 07 01<br />
03/1-IV/7/99/1, in der Folge nicht als Verordnung erlassen wurde, tritt bei dieser Art der Nebentätigkeiten<br />
keine Änderung ein.<br />
Vortragstätigkeiten im Zuge von Dienstprüfungskursen werden ebenfalls als Funktionsgebühren anerkannt;<br />
vgl. Anhang III, Z. 9 der Einkommensteuerrichtlinien 1984; zur Sozialversicherungsbefreiung vgl.<br />
Dienstgeberinformation der Gebietskrankenkasse, Nr. 140/98, S. 3; in diesem Sinn im Erlass vom<br />
1.1.2000, PersR-450016/190-1999-Kop/Ehr geregelt.<br />
Dazu zählt auch die Tätigkeit als Aufsichtsperson iSd. § 3 FSG-PV.<br />
Die Aufzählung ist unabhängig davon, ob zur Zeit eine Entschädigung geleistet wird oder nicht.<br />
239
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
• Jagdschutzkommission<br />
• Naturschutzbeauftragte<br />
Bei allfälligen für diese Tätigkeiten zu leistenden Entschädigungen handelt es sich um Funktionsgebühren<br />
iSd. § 29 Z. 4 EStG 1988, die nach wie vor einkommenssteuer-, aber nicht lohnsteuerpflichtig<br />
sind, ebenso wenig sind vom Land Oö. Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.<br />
Bei den hoheitlichen Nebentätigkeiten tritt somit keine Änderung ein.<br />
2.2. "Nicht-hoheitliche" Nebentätigkeiten<br />
2.2.1 Vortragstätigkeiten<br />
Die weitaus überwiegende Anzahl der anfallenden Tätigkeiten sind Vorträge, Organisation und<br />
Durchführung von Seminaren, Referaten u. dgl.<br />
Die wichtigsten Bereiche von Vortragstätigkeiten wurden bereits mit folgenden Erlässen, welche<br />
vollinhaltlich aufrecht bleiben neu geregelt:<br />
• Erlass über die Vortragstätigkeiten an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und A-<br />
kademien, der Sozialakademie und Altenbetreuungsschule; Nebentätigkeiten; freie Dienstverträge,<br />
Werkverträge; steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Neuordnung vom<br />
16. September 1999, PersR-450016/181-1999-Kop/Ehr; ergänzt durch Erlass vom<br />
6.10.1999, PersR-450016/184-1999-Kop/Ehr bezüglich Prüfungstätigkeiten;<br />
• Erlass über die Vortragstätigkeiten, u. a. im Bereich der Abteilung Personal (Gruppe Bildung<br />
und Personalentwicklung) sowie der Landesanstaltendirektion (insbesondere Aus- und Fortbildung);<br />
Nebentätigkeiten; freie Dienstverträge; Werkverträge; steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche<br />
Neuordnung vom 1.1.2000, PersR-450016/190-1999-Kop/Ehr sowie<br />
• Erlass über die Vortragstätigkeiten u.a. im Bereich der Abt. Bildung, Jugend und Sport; Nebentätigkeiten;<br />
freie Dienstverträge, Werkverträge; steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche<br />
Neuordnung vom 28.3.2000, PersR-450016/213-2000-Kop/Gl.<br />
Unter diesen Erlass fallen nunmehr alle übrigen Vortragstätigkeiten, Referate, Organisation und<br />
Durchführung von Seminaren, u. dgl. von Landesbediensteten, soweit sie nicht bereits in den<br />
oben genannten Erlässen geregelt worden sind. (zB im Bereich der Abteilung Jugendwohlfahrt,<br />
der Abteilung Direktion Kultur oder der Akademie für Umwelt und Natur).<br />
2.2.2 Sonstige, von diesem Erlass erfasste Nebentätigkeiten<br />
Dieser Erlass betrifft alle übrigen Arten von Nebentätigkeiten, die nicht unter Pkt. 2.1. dieses Erlasses<br />
fallen.<br />
Es sind dies insbesondere<br />
• allgemeine Beratungs- oder Gutachtertätigkeiten<br />
• psychologische Beratungen, Diagnostik (zB Soz.päd. Jugendwohnheim Linz)<br />
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Betreuung von Info-Ständen<br />
• Organisation und Durchführung von Exkursionen<br />
• Unterricht, Lehrgänge, Seminare, Schulungen und dgl., soweit nicht bereits unter Pkt. 2.2.1<br />
berücksichtigt<br />
• Führungen, Aufsichtsdienste, Kassendienste (zB Museum)<br />
• Auf- und Abbau von Ausstellungen (zB Museum)<br />
• (insb. pädagog. oder psycholog.) Einzelbetreuung / Nachbetreuung von Kindern oder Jugendlichen<br />
• Nachhilfeunterricht (zB JW)<br />
• Sonstige Betreuung von Jugendlichen<br />
In Zweifelsfällen ist eine Entscheidung der Abteilung Personal einzuholen.<br />
Die Beauftragung von Landesbeamtinnen bzw. Landesbeamten bzw. -vertragsbediensteten mit<br />
Nebentätigkeiten bedarf künftig keiner zusätzlichen Vertragsverhältnisse (zB freie Dienstverträ-<br />
240
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
ge, Werkverträge), da diese Leistungen aufgrund der Dienstverhältnisse zum Land erbracht<br />
werden.<br />
Es ist ausreichend, dass die Beauftragung schriftlich festgehalten ist (vgl. dazu Pkt. 7 dieses<br />
Erlasses).<br />
3. Versteuerung; Sozialversicherungsbeiträge<br />
Die unter Pkt 2.2.1 und 2.2.2. fallenden Nebentätigkeitsentschädigungen unterliegen derzeit bereits<br />
der Sozialversicherungspflicht und nunmehr auch der Lohnsteuer. Diese Entschädigungen<br />
stellen künftig einen Personalaufwand dar, eine Budgetierung im Sachaufwand ist somit insoweit<br />
nicht mehr erforderlich.<br />
Diese Entschädigungen für Nebentätigkeiten, die bisher aus dem Sachaufwand (insb. aufgrund<br />
eines Werk- oder freien Dienstvertrags) bezahlt wurden, werden künftig – für Beamte und Vertragsbedienstete<br />
gleichermaßen – im Wege der Zentralen Besoldungsstelle zwecks Lohnsteuerabzug<br />
angewiesen (siehe unter Pkt. 5).<br />
Bei Vertragsbediensteten 8 unterliegt diese Nebentätigkeitsentschädigung zudem auch der Sozialversicherungspflicht<br />
gemäß § 4 Abs. 2 ASVG (<strong>VB</strong> I : Dienstnehmerbeitrag 16, 65 % und Dienstgeberbeitrag<br />
20,45 %; <strong>VB</strong> II: Dienstnehmerbeitrag 17,20 % und Dienstgeberbeitrag 20,9 % des Monatsentgelts<br />
gemäß § 49 ASVG bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG in der jeweils<br />
geltenden Fassung 9 ).<br />
4. Ausnahmen vom Geltungsbereich:<br />
Dieser Erlass gilt nicht für Tätigkeiten von<br />
• karenzierten oder pensionierten Landesbediensteten 10<br />
• Landeslehrerinnen bzw. Landeslehrern, die in den Zuständigkeitsbereich des Landesschulrates<br />
fallen, sowie<br />
• Landesbediensteten, die in einem ABGB-Dienstverhältnis stehen.<br />
Diese Personen sind insoweit externen Kräften (nicht im Landesdienst stehenden Personen)<br />
gleichzuhalten (Abschluss von freien Dienstverträgen, Werkverträgen, siehe unten unter Pkt.<br />
6).<br />
Dieser Erlass gilt weiters nicht für Landesbedienstete, hinsichtlich deren Nebentätigkeit ein eigener<br />
Dienstvertrag abgeschlossen wurde/wird (zB Landesbeamtin bzw. Landesbeamter, der zusätzlich<br />
als Vertragslehrerin bzw. Vertragslehrer nach dem Oö. L<strong>VB</strong>G an der Sozialakademie unterrichtet).<br />
5. Verbuchungstechnische Vorgangsweise<br />
Künftig ist die Verrechnung zu Lasten der Personalaufwands-Posten 5640 (bei Beamtinnen bzw.<br />
Beamten) bzw. 5641 (bei <strong>VB</strong> I) und 5642 (bei <strong>VB</strong> II), bei pragmatisierten Lehrerinnen bzw. Lehrern<br />
5645, bei Vertragslehrerinnen bzw. Vertragslehrern (IL) 5646 vorzunehmen. 11<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
Bei Beamtinnen bzw. Beamten wird die NT-Entschädigung weder beim Pensionsbeitrag gem. § 22 Oö.<br />
Landes-GehaltsG, noch beim Beitrag für die Krankenfürsorge gem. § 18 Abs. 3 Oö. Kranken- und Unfallfürsorgegesetz<br />
für Landesbeamte, noch beim Beitrag für die Unfallfürsorge gem. § 41 Oö. KFLG berücksichtigt.<br />
Änderung ab 1.1.2001 durch Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 (ARÄG), BGBl. I. Nr. 44/2000; Reduktion<br />
des Dienstgeberbeitrags zur Krankenversicherung von 3,7 % auf 3,4 %.<br />
Weil eine Nebentätigkeit schon begrifflich nicht ohne Haupttätigkeit denkbar ist. Die Beschäftigung während<br />
des Karenzurlaubs ist bedenklich, wenn eine Karenzvertretung eingestellt wurde, deren Dienstvertrag<br />
für die Dauer der Abwesenheit des/der Karenzierten iSd § 4 Abs. 1 iVm. § 4 Abs. 5 Z. 1 Oö. L<strong>VB</strong>G<br />
abgeschlossen wurde und bedarf der Befassung der Abteilung Personal, Gruppe Vertragsrecht und<br />
Besoldung.<br />
Vgl Erlass der Direktion Finanzen zur Ergänzung des Postenverzeichnisses gem Anlage 3a der VRV<br />
vom 18.1.2000, Fin -000009/858-I-Stg/Has<br />
241
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Die Auszahlung über die Lohnverrechnung hat im Wege der Zentralen Besoldungsstelle (ZB) zu<br />
erfolgen. Die Abrechnung erfolgt bis auf weiteres über ein Durchläuferkonto der Landesbuchhaltung:<br />
Die die Entschädigung leistende Dienststelle übermittelt der ZB (direkt, ohne Einschaltung der<br />
Abteilung Personal) einen Umbuchungsauftrag. Der AUSGABE-Teil enthält den anzuweisenden<br />
Bruttobetrag aus der entsprechenden Voranschlagstelle (der Dienststelle, zu deren Gunsten die<br />
Nebentätigkeit erfolgt) mit der entsprechenden Unterschrift des Anordnungsbefugten. Im EIN-<br />
NAHME-Teil ist für die Verbuchung das DurchL-Konto 3798/010 anzugeben. Gleichzeitig ist als<br />
Namensliste das in der Beilage enthaltene Formular in zweifacher Ausfertigung (für die Landesbuchhaltung<br />
sowie die Zentrale Besoldungsstelle) dem Umbuchungsauftrag beizulegen.<br />
Die PVR veranlasst sodann die Abrechnung der Beträge beim nächstfolgenden Lohnabrechnungstermin<br />
und die Weiterleitung des von ihr im EINNAHME-Teil unterfertigten Umbuchungsauftrages<br />
an die Landesbuchhaltung.<br />
Erläuterung dieser Vorgangsweise aus verrechnungstheoretischer Sicht:<br />
Bei der "normalen" Bezugsverrechnung fungiert die ZB als Zwischenglied zwischen dem jeweiligen<br />
Bewirtschafter (Zahlungsanweisung) und der Landesbuchhaltung (Zahlungsvollzug). Der Bewirtschafter<br />
erteilt anstelle der üblicherweise an die Landesbuchhaltung gerichteten Zahlungsaufträge<br />
der ZB für die Bezugsabrechnung eine Zahlungsanordnung. Die ZB übernimmt für den Bewirtschafter<br />
die Abrechnung und erteilt für ihn den Zahlungsauftrag an die Landesbuchhaltung -<br />
die Anordnungsbefugnis ist zu diesem Zweck an die ZB delegiert. Für die Landesbuchhaltung hat<br />
die ZB gleichzeitig die Anordnungskontrolle gegenüber dem Bewirtschafter auszuüben.<br />
Im obigen Sonderfall erteilt der Bewirtschafter den Zahlungsauftrag (über den AUSGABE-Teil des<br />
Umbuchungsauftrages) direkt an die Landesbuchhaltung, während die ZB die Einbindung in die<br />
Lohnverrechnung mittels des gemeinschaftlichen Durchläuferkontos vornimmt.<br />
Verbuchungstechnische Fragen sind an die Personalverrechnung zu richten.<br />
6. Externe Kräfte (Personen, die in keinem Dienstverhältnis zum Land Oberösterreich stehen).<br />
Hier ist – wie bisher – je nach Art der Tätigkeit ein Werkvertrag bzw. ein freier Dienstvertrag abzuschließen.<br />
Hinsichtlich der Vorgangsweise (und der Mitwirkung der Abteilung Personal) wird auf den einschlägigen<br />
Erlass der Abteilung Personal vom 22.8.2000, PersR-450118/173-2000/Pr/Gl verwiesen.<br />
7. Meldepflicht des beauftragten Landesbediensteten, Befassung der Abteilung Personal<br />
Wie bisher 12 sind Nebentätigkeiten unter Verwendung des beiliegenden Formblattes (Beilage 2 13 )<br />
im Dienstweg der Abteilung Personal zu melden. (Bereits gemeldete Nebentätigkeiten brauchen<br />
nicht erneut gemeldet zu werden).<br />
Keiner Meldung bedürfen künftig Vortragstätigkeiten (insb. im Rahmen der Aus- und Fortbildung<br />
für Landesbedienstete) sowie Unterrichts- und Vortragstätigkeiten an landeseigenen Einrichtungen<br />
(wie zB an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und medizinisch-technischen Akademien).<br />
12<br />
13<br />
vgl. Erlass vom 23.7.1996, PersR-450016/108-1996/Ks; vgl weiters § 74 <strong>DBO</strong>-A und § 68 <strong>DBO</strong>-B, veröffentlicht<br />
in http://intranet.ooe.gv.at/praes/normen/dbo_a/index.htm bzw dbo_b/index.htm, vgl. auch §<br />
57 <strong>DBO</strong>-Anst und § 62 <strong>DBO</strong>-K<br />
Das bisherige Formular (intranet.ooe.gv.at/praes/normen/dbo_a/ index.htm bzw. intranet.ooe.gv.at/lpa/personalvertretung/dienstrecht/index.htm)<br />
kann nötigenfalls weiterhin verwendet werden.<br />
242
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
7.1. Befassung der Abteilung Personal durch die beauftragte Dienststelle<br />
Vor der Betrauung der bzw. des Bediensteten mit einer Nebentätigkeit ist gem. Anhang zu § 80<br />
das Einvernehmen mit der Abteilung Personal herzustellen, soweit für die Übertragung nicht ohnehin<br />
die Zuständigkeit der Abteilung Personal gegeben ist.<br />
Dies gilt künftig nicht mehr<br />
• für Vortrags- und Unterrichtstätigkeiten,<br />
• für Veranstaltungsorganisation, Ausstellungsdienste (Auf- und Abbau), Führungen, Aufsichtsdienst,<br />
Kassendienst, Betreuung von Info-Ständen, u. dgl. bei Ausstellungen und Veranstaltungen,<br />
sowie<br />
• für sonstige Nebentätigkeiten im Sinn von Pkt. 2.2.2. dieses Erlasses, sofern die Betrauung mit<br />
der Nebentätigkeit nicht auf Dauer (unbefristet) erfolgt und die Nebentätigkeitsentschädigung<br />
voraussichtlich den Betrag von brutto 291,-- Euro in einem Kalendermonat nicht überschreitet. 14<br />
8. Hinweis für den Bearbeiter durch die beauftragende Dienststelle<br />
Zusammenfassend treffen die Bearbeiter vor der jeweiligen Betrauung von Landesbediensteten<br />
mit Nebentätigkeiten folgende Pflichten:<br />
• Befassung der Abteilung Personal (zB. im Mitzeichungsweg) nach Maßgabe von Pkt. 7.1 dieses<br />
Erlasses<br />
• Hinweis an die Landesbediensteten betreffend dessen Meldepflicht iSd. Pkt. 7 dieses Erlasses<br />
Nach der Beauftragung hat bezüglich der Abrechnung der Nebentätigkeitsentschädigung wie folgt<br />
vorzugehen:<br />
• Bei hoheitlichen Nebentätigkeiten iSd. Pkt. 2.1 dieses Erlasses wie bisher.<br />
• Bei nicht hoheitlichen Nebentätigkeiten iSd. Pkt. 2.2.2 dieses Erlasses im Wege der Zentralen<br />
Besoldungsstelle nach Pkt. 5 dieses Erlasses.<br />
9. In-Kraft-Treten<br />
Diese Regelung ist mit 1. 10. 2000 in Kraft getreten.<br />
Außerkrafttreten<br />
Mit diesem Erlass werden die Erlässe PersR - 224/2 - 1983/Hi vom 16. März 1983, PersR - 224/14<br />
- 1988/Hi vom 23. Dezember 1988 und PersR - 450016/22 - 1992/G vom 9. November 1992 außer<br />
Kraft gesetzt.<br />
Beilage (Formblatt)<br />
Mit freundlichen Grüßen!<br />
Für die Oö. Landesregierung:<br />
Im Auftrag<br />
14<br />
Es handelt sich um keine Durchschnittsberechnung. Die Abgrenzung erfolgt analog zu Pkt. A.4. (Seite<br />
4) des Erlasses betreffend Nebenbeschäftigungen von Landesbediensteten, PersR-450016/143-<br />
1998/Kop vom 3.2.1999, veröffentlicht im Intranet unter pers/normen/Erlaesse.<br />
243
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong>
Referenzdokument <strong>VB</strong> <strong>06b</strong> <strong>V1.1</strong><br />
Anhang zu § 81 <strong>DBO</strong><br />
Vertretung in Körperschaften des öffentlichen und des privaten<br />
Rechts, in Beräten udgl. durch Bedienstete 1<br />
Landesbedienstete haben im Rahmen des ihnen übertragenen oder damit im Zusammenhang<br />
stehenden Aufgabenbereiches auch Vertretungsbefugnisse in juristischen Personen des öffentlichen<br />
Rechts bzw. in deren Organen (z.B. Verwaltungskörper von Sozialversicherungsträgern,<br />
Organe von dienstrechtlichen Krankenfürsorgeeinrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,<br />
Anstalten und Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit), in juristischen Personen des privaten<br />
Rechts bzw. in deren Organen (z.B. Vereine, Genos-senschaften, Aktiengesellschaften), in Beiräten,<br />
Ausschüssen, Kommissionen im Rahmen von Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG und in<br />
sonstigen institutionalisierten Gremien (dazu gehören in aller Regel nicht sog. "Expertenkonferenzen")<br />
wahrzunehmen.<br />
Die Ausübung solcher Vertretungsbefugnisse berührt wesentliche innerdienstliche und personalrechtliche<br />
Belange und vielfach auch solche der Finanz- und Vermögensgebarung des Landes. Es<br />
ist daher erforderlich, bei der Übertragung solcher Vertretungsbefugnisse die Abteilung Präsidium<br />
und die Abteilung Personal sowie gegebenenfalls auch die Direktion Finanzen einzuschalten. Um<br />
dies sicherzustellen, wird folgende Vorgangsweise festgelegt:<br />
1. Die Übertragung der Vertretungsbefugnis ist eine Angelegenheit, die<br />
a) bei Beteiligung des Landes an allen Kapital- und Personengesellschaften sowie an jenen<br />
Genossenschaften, die ihre Geschäftstätigkeit im Bereich des Wohnungs- und Siedlungswesens<br />
haben, federführend von der Direktion Finanzen (siehe Kompetenzen-Katalog Fin),<br />
b) in allen übrigen Fällen federführend im Rahmen der sachlich zuständigen Organisationseinheit<br />
(Aufgabengruppe bzw. Abteilung)<br />
zu besorgen ist.<br />
2. Die Abteilung Präsidium und die Abteilung Personal sind hierbei in jedem Fall mitzubeteiligen,<br />
und zwar auch dann, wenn die Übertragung der Vertretungsbefugnis durch Beschluss der Oö.<br />
Landesregierung bzw. durch Entscheidung des zuständigen Mitglieds der Oö. Landesregierung<br />
erfolgen soll. Von der erfolgten Übertragung ist der Abteilung Personal abschriftlich Kenntnis zu<br />
geben.<br />
3. Wird in den Fällen der Z. 1 lit. b der Aufgabenbereich der Direktion Finanzen ("Oberleitung und<br />
Beaufsichtigung der gesamten Finanz- und Vermögensgebarung des Landes") berührt, so ist<br />
überdies die Direktion Finanzen mitzubeteiligen.<br />
4. Ist es zweifelhaft, ob die Ausübung der Vertretungsbefugnis Dienst im Sinne der dienstrechtlichen<br />
Vorschriften ist, so hat die Abteilung Personal im Zuge ihrer Mitbeteiligung diese Frage zu<br />
klären.<br />
--------------------<br />
Die vorstehende Regelung gilt nicht in jenen Fällen, in denen<br />
a. sich aus Gesetzen, Verordnungen, Staatsverträgen, Vereinbarungen im Sinne des Art. 15a B-<br />
VG oder Beschlüssen der Oö. Landesregierung ergibt, dass die Vertretungsbefugnis mit einer<br />
bestimmten Funktion einer bzw. eines Bediensteten bzw. mit der Wahrnehmung der Funktion<br />
auf Grund innerdienstlicher Vorschriften verbunden ist (z.B. die "Bezirkshauptfrau" bzw. der<br />
"Bezirkshauptmann" als Obfrau bzw. Obmann des Verbandsausschusses des Sozialhilfeverbandes)<br />
oder<br />
b. die Vertretungsbefugnis nur für einen konkreten Vertretungsakt (z.B. Entsendung in die Hauptversammlung<br />
einer Aktiengesellschaft in Vertretung des Landes als Aktionär) erteilt wird.<br />
1<br />
Diese Regelung beruht auf den Erlässen vom 22. Dezember 1981, PräsI-6678/2-Kr/Le/Lw und vom<br />
29. Jänner 1997, PräsI-070016/38-HEU.<br />
245