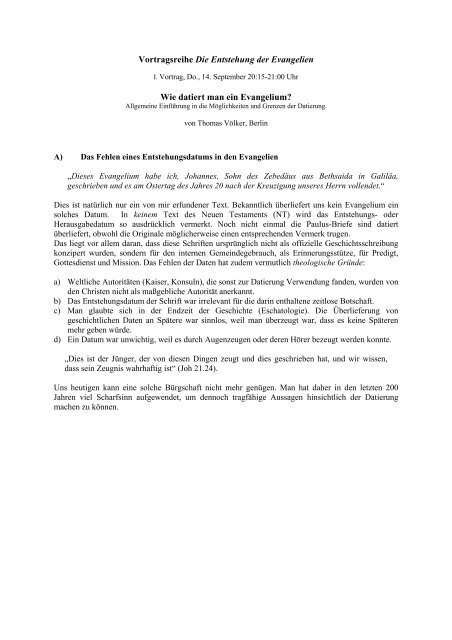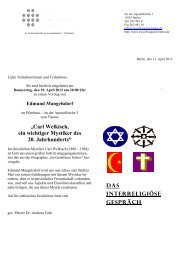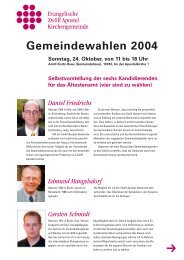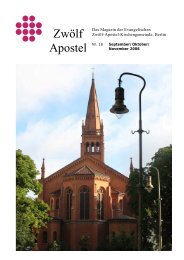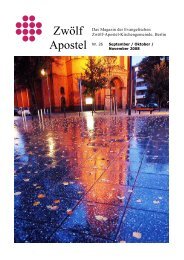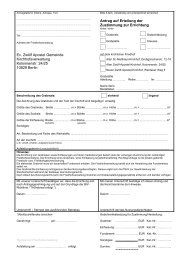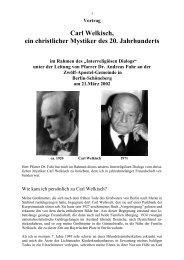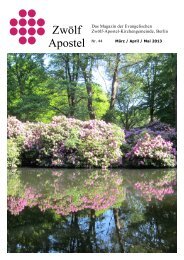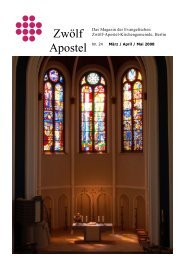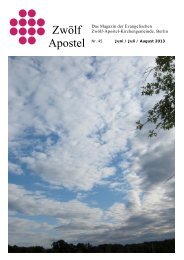Wie datiert man ein Evangelium
Wie datiert man ein Evangelium
Wie datiert man ein Evangelium
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vortragsreihe Die Entstehung der Evangelien<br />
I. Vortrag, Do., 14. September 20:15-21:00 Uhr<br />
<strong>Wie</strong> <strong>datiert</strong> <strong>man</strong> <strong>ein</strong> <strong>Evangelium</strong>?<br />
Allgem<strong>ein</strong>e Einführung in die Möglichkeiten und Grenzen der Datierung.<br />
von Thomas Völker, Berlin<br />
A) Das Fehlen <strong>ein</strong>es Entstehungsdatums in den Evangelien<br />
„Dieses <strong>Evangelium</strong> habe ich, Johannes, Sohn des Zebedäus aus Bethsaida in Galiläa,<br />
geschrieben und es am Ostertag des Jahres 20 nach der Kreuzigung unseres Herrn vollendet.“<br />
Dies ist natürlich nur <strong>ein</strong> von mir erfundener Text. Bekanntlich überliefert uns k<strong>ein</strong> <strong>Evangelium</strong> <strong>ein</strong><br />
solches Datum. In k<strong>ein</strong>em Text des Neuen Testaments (NT) wird das Entstehungs- oder<br />
Herausgabedatum so ausdrücklich vermerkt. Noch nicht <strong>ein</strong>mal die Paulus-Briefe sind <strong>datiert</strong><br />
überliefert, obwohl die Originale möglicherweise <strong>ein</strong>en entsprechenden Vermerk trugen.<br />
Das liegt vor allem daran, dass diese Schriften ursprünglich nicht als offizielle Geschichtsschreibung<br />
konzipert wurden, sondern für den internen Gem<strong>ein</strong>degebrauch, als Erinnerungsstütze, für Predigt,<br />
Gottesdienst und Mission. Das Fehlen der Daten hat zudem vermutlich theologische Gründe:<br />
a) Weltliche Autoritäten (Kaiser, Konsuln), die sonst zur Datierung Verwendung fanden, wurden von<br />
den Christen nicht als maßgebliche Autorität anerkannt.<br />
b) Das Entstehungsdatum der Schrift war irrelevant für die darin enthaltene zeitlose Botschaft.<br />
c) Man glaubte sich in der Endzeit der Geschichte (Eschatologie). Die Überlieferung von<br />
geschichtlichen Daten an Spätere war sinnlos, weil <strong>man</strong> überzeugt war, dass es k<strong>ein</strong>e Späteren<br />
mehr geben würde.<br />
d) Ein Datum war unwichtig, weil es durch Augenzeugen oder deren Hörer bezeugt werden konnte.<br />
„Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat, und wir wissen,<br />
dass s<strong>ein</strong> Zeugnis wahrhaftig ist“ (Joh 21.24).<br />
Uns heutigen kann <strong>ein</strong>e solche Bürgschaft nicht mehr genügen. Man hat daher in den letzten 200<br />
Jahren viel Scharfsinn aufgewendet, um dennoch tragfähige Aussagen hinsichtlich der Datierung<br />
machen zu können.
B) Lukas als Geschichtsschreiber 1<br />
Eine Ausnahme hinsichtlich der Datierungen macht nur Lukas, der sich immer wieder auch als<br />
Geschichtsschreiber versteht:<br />
●<br />
„1.5 Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa [37-4 v. Chr.], <strong>ein</strong> Priester mit<br />
Namen Zacharias...“<br />
Weltbekannt ist der Beginn der Weihnachtsgeschichte im 2. Kapitel:<br />
● „2.1 Es geschah aber in jenen Tagen, dass <strong>ein</strong>e Verordnung vom Kaiser Augustus [31 v. Chr. - 14<br />
n. Chr.] ausging, den ganzen Erdkreis <strong>ein</strong>zuschreiben. 2.2 Diese Einschreibung geschah als erste,<br />
als Cyrenius Statthalter von Syrien war [ca. 6 n. Chr.].“<br />
●<br />
„3.1 Aber im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius [ca. 29 n. Chr.], als Pontius<br />
Pilatus Statthalter von Judäa war [ca. 26-36 n. Chr.] und Herodes Vierfürst von Galiläa [6-37<br />
n. Chr.] und s<strong>ein</strong> Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis [6-31 n.<br />
Chr.], und Lysanias Vierfürst von Abilene, 3.2 unter dem Hohenpriestertum von Hannas und<br />
Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.<br />
1<br />
sh. z.B. MARTIN HENGEL: Zur urchristlichen Geschichtsschreibung. Stuttgart 2 1984.
C) Einleitungswissenschaft 2<br />
Die Datierung ist Teil der sogen. biblischen „Einleitungswissenschaft“.<br />
„In der Einleitungswissenschaft werden die biblischen Bücher betreffs ihrer Struktur,<br />
ihrem literarischem Aufbau und den in ihnen enthaltenen literarischen Gattungen<br />
analysiert, sowie auf mögliche Verfasserschaft, eventuell erkennbare Adressaten und<br />
Entstehungsort und -zeit hin befragt.“ 3<br />
D) Absolute und relative Datierung<br />
Abb. 1:<br />
Relative und Absolute Datierung (Schema):<br />
Dokument A<br />
relative Datierung Dokument B 50 n. Chr.<br />
(nach A, vor C)<br />
Dokument C<br />
absolute Datierung<br />
(1951 Jahre alt)<br />
2006 n. Chr. (Heute)<br />
Zur absoluten Datierung dienen <strong>ein</strong>e Anzahl von naturwissenschaftlichen Methoden. Abgesehen von<br />
der umstrittenen Kalibrierung verbietet die Zerstörung von originalem Material den Einsatz der C 14 -<br />
Methode in der Papyrologie.<br />
2<br />
3<br />
sh. z.B. ALFRED WIKENHAUSER: Einleitung in das Neue Testament. Freiburg, Basel, <strong>Wie</strong>n 5 1963, WILLY<br />
MARXSEN: Einleitung in das Neue Testament. Gütersloh 1 1963, WERNER GEORG KÜMMEL: Einleitung in<br />
das Neue Testament, Heidelberg 21 1983, UDO SCHNELLE: Einleitung in das Neue Testament. Göttingen<br />
4 2002.<br />
Quelle: Wikipedia, Lemma „Biblische Einleitungswissenschaft, Stand 14.9.06, 19:00 Uhr.
E) Die Eingrenzung der relativen Datierung<br />
Die zeitliche Abfolge bei Niederschrift und Verbreitung <strong>ein</strong>es beliebigen Dokuments folgt<br />
<strong>ein</strong>em gesetzmäßigen Ablauf.<br />
1. In der Regel verwendet jeder Autor <strong>ein</strong>e Anzahl (schriftlicher aber auch mündlicher)<br />
Quellen.<br />
2. Diese Quellen werden gesichtet, sortiert und verarbeitet.<br />
3. Die Niederschrift selbst nimmt auch <strong>ein</strong>en gewissen Zeitraum in Anspruch<br />
4. Möglicherweise erfolgt danach noch <strong>ein</strong>e Überarbeitung des Ur<strong>man</strong>uskripts durch den<br />
Autor oder durch Redaktoren.<br />
5. Erst nach der Herausgabe kommt es zur Verbreitung der Schrift und zur<br />
Weiterverarbeitung durch andere Schriftsteller.<br />
6. Die Erhaltung der Originalschriften und der sie benutzenden Werke ist neben der<br />
Auflagenhöhe, der Wertschätzung etc. immer auch vom Zufall abhängig.<br />
Abb. 2:<br />
Früheste und spätestmögliche Datierung (Schema):<br />
1. Quellen Quelle A<br />
Quelle B<br />
2. Sammlung und Auswahl der Quellen<br />
3. Niederschrift des Dokuments Dok. 1<br />
Quelle C<br />
terminus post quem<br />
….<br />
Z<br />
E<br />
I<br />
T<br />
4. Überarbeitung und Endredaktion Red.<br />
5. Herausgabe und Weiterverbreitung Ed.<br />
Zufall<br />
6.a (datierbarer) Archäologischer Fund Fund<br />
6.b Verwertung als Quelle durch Spätere terminus ante quem Dok 2<br />
terminus ante quem<br />
Auf diese Weise lässt sich <strong>man</strong>chmal <strong>ein</strong> Stammbaum („Stemma“) herstellen, der aufzeigt, welche<br />
Schriften von<strong>ein</strong>ander abhängig sind.<br />
Die genaue Datierung <strong>ein</strong>er Schrift lässt sich hieraus folgend auf zwei Wegen <strong>ein</strong>grenzen.
a) Die innere Datierung<br />
Die innere Datierung beruht auf den inneren Argumenten <strong>ein</strong>es Textes.<br />
a) Erwähnung historischer oder zeitgenössischer Personen oder Ereignisse im Text,<br />
b) Zitierung anderer datierbarer Schriften,<br />
c) Zeitgebundener Stil,<br />
d) Das Fehlen wichtiger Ereignisse oder Personen (argumentum ex nihilo oder ex silentio)<br />
Die innere Datierung kann meist nur den frühestmöglichen Zeitpunkt der Entstehung (terminus post<br />
quem) festlegen.<br />
Beispiele<br />
So sollen die Evangelien angeblich indirekt die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. erwähnen.<br />
Wenn das stimmt, können sie erst danach entstanden s<strong>ein</strong>.<br />
1 Da es nun schon viele unternommen haben, <strong>ein</strong>en Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich<br />
unter uns zugetragen haben,<br />
2 wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen<br />
sind,<br />
3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster<br />
Theophilus, der Reihe nach zu schreiben,<br />
4 damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. (Lukas 1.1-4)<br />
Darüberhinaus müssen für die Interpretation die Eigenart <strong>ein</strong>es Textes und die Fähigkeiten und<br />
Intentionen des Autors berücksichtigt werden.<br />
- Um was für <strong>ein</strong>e Art von Text handelt es sich? (Geschichtsschreibung? Privatbrief? Legende?<br />
Apologie?)<br />
- Ist der Autor in s<strong>ein</strong>en Angaben gewissenhaft und glaubwürdig? <strong>Wie</strong> gut beherrscht er Sprache und<br />
Thema? Was ist s<strong>ein</strong> eigentliches Anliegen?
) Die äußere Datierung<br />
Die äußere Datierung erfolgt im besten Fall durch <strong>ein</strong>en datierbaren archäologischen Fund oder durch<br />
die nachweisbare Erwähnung in <strong>ein</strong>em anderen, sicher datierbaren Text.<br />
a) Archäologische Schichtlage<br />
Problem: Die Zuweisung der Funde zu konkreten Daten erfolgt über geschriebene Geschichte<br />
b) Paläographische Einordnung<br />
Problem: Zumeist kann nur <strong>ein</strong> größerer Zeitraum von mindestens 50 J. angegeben werden.<br />
c) Zitierung in <strong>ein</strong>em späteren Text.<br />
Problem: Sofern das Werk oder Autor nicht ausdrücklich als Quelle genannt sind, lässt sich meist nur<br />
schwer entscheiden, wer bei wem abgeschrieben hat.<br />
Die äußere Datierung gibt den spätestmöglichen Zeitpunkt (terminus ante quem).<br />
Beispiele<br />
- Während z.B. CLEMENS VON ROM (Ende des 1. Jhs. i ) Paulusbriefe kennt und benutzt, findet sich bei<br />
ihm k<strong>ein</strong>e Spur des Johannesevangeliums. Erst verhältnismäßig spät (nämlich bei IRENÄUS um 180 n.<br />
Chr.) wird Johannes ausdrücklich und nachweisbar zitiert. Damit ist aber lediglich <strong>ein</strong>e Obergrenze<br />
markiert.<br />
- Der spätestens um 125 geschriebene Papyrus p53 beweist, dass das Johannesevangelium vor dieser<br />
Zeit entstanden s<strong>ein</strong> muss.
Papyrus p52 (THIEDE 4 1994, 33)<br />
5 MB<br />
Der Text des p52 gem THIEDE 4 1994, 20:<br />
„... 31 Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet<br />
ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns<br />
nicht erlaubt, je<strong>man</strong>den zu töten; 32 damit das Wort Jesu<br />
erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er<br />
sterben sollte. 33 Pilatus ging nun wieder hin<strong>ein</strong> in das Praetorium und rief<br />
Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Koenig der Juden?...“ (Joh 18.31ff)<br />
„... 37 Da sprach Pilatus zu ihm: Also, du bist <strong>ein</strong> König? Jesus<br />
antwortete: Du sagst es, dass ich <strong>ein</strong> König bin. Ich bin dazu<br />
geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit<br />
Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört m<strong>ein</strong>e<br />
Stimme. 38 Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und<br />
als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und<br />
spricht zu ihnen: Ich finde k<strong>ein</strong>erlei Schuld an ihm...“ (Joh 18.37f)
F) Die Altkirchliche Überlieferung. Das Zeugnis des Papias (um 130?)<br />
„ 1 [...] die Zuhörer des Petrus [...] wollten sich nicht damit begnügen, ihn <strong>ein</strong> <strong>ein</strong>ziges Mal nur gehört<br />
zu haben. Sie wollten von der Lehre s<strong>ein</strong>er göttlichen Predigt auch Aufzeichnungen besitzen. Daher<br />
wandten sie sich inständig mit verschiedenen Bitten an Markus, den Verfasser des <strong>Evangelium</strong>s, den<br />
Begleiter des Petrus, er möchte ihnen schriftliche Erinnerungen an die mündlich vorgetragene Lehre<br />
hinterlassen. Und sie standen nicht eher von ihren Bitten ab, als bis sie den Mann gewonnen hatten. So<br />
wurden sie die Veranlassung zum sogenannten Markusevangelium. 2 Nachdem Petrus durch <strong>ein</strong>e<br />
Offenbarung des Geistes von dem Vorfall Kenntnis erhalten hatte, soll er sich über den Eifer der Leute<br />
gefreut und die Schrift für die Lesung in den Kirchen bestätigt haben. Klemens hat diese Tatsache im<br />
sechsten Buch s<strong>ein</strong>er Hypotyposen berichtet, und mit ihm stimmt Bischof Papias von Hierapolis<br />
über<strong>ein</strong>.“ (EUSEBIUS (4. Jh.) Kirchengeschichte II.15.1f.)<br />
14 Noch andere Erzählungen des zuvor erwähnten Aristion über Herrrenworte und Überlieferungen des<br />
Presbyters Johannes überliefert er in derselben Schrift. Nachdem wir die wißbegierigen Leser darauf<br />
hingewiesen haben, müssen wir jetzt s<strong>ein</strong>en zuvor zitierten Äußerungen die Überlieferung hinzufügen,<br />
die er über Markus, der das <strong>Evangelium</strong> geschrieben hat, folgendermaßen aufgezeichnet hat:<br />
15 ,Auch dies sagte der Presbyter:<br />
Markus, der Dolmetscher des Petrus, hat alles, dessen er sich erinnerte, genau aufgeschrieben,<br />
freilich nicht der (richtigen) Reihe nach - das, was vom Herrn sei es gesagt, sei es getan worden<br />
war; er hatte nämlich weder den Herrn gehört noch war er ihm nachgefolgt. Später aber, wie<br />
gesagt, (folgte er) dem Petrus, der s<strong>ein</strong>e Lehrvorträge den Bedürfnissen entsprechend gestaltete,<br />
jedoch nicht, um <strong>ein</strong>e zusammenhängende Darstellung der Herrnworte zu geben, so daß Markus<br />
nicht falsch handelte, als er <strong>ein</strong>iges so aufschrieb, wie er sich erinnerte. Denn für <strong>ein</strong>es trug er<br />
Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder darunter etwas Unwahres zu<br />
berichten."<br />
Dies also wird von Papias über Markus berichtet.<br />
16 Über Matthäus aber hat er folgendes gesagt:<br />
"Matthäus hat die Logien also in hebräischer Sprache zusammengestellt; es übersetzte sie <strong>ein</strong> jeder<br />
aber, so gut er es vermochte." (EUSEBIUS (4. Jh.) Kirchengeschichte III 39.14-16)<br />
„Es beginnt die Darstellung gemäß Johannes. Das <strong>Evangelium</strong> des Johannes ist offenbart und gegeben<br />
worden den Kirchen von Johannes, als dieser noch am Leben war, wie Papias, genannt Hierapolitaner,<br />
<strong>ein</strong> lieber Schüler des Johannes, in den exoterischen, das heißt in den äußersten fünf Büchern,<br />
berichtet hat. [...] Er (Papias) hat sogar das <strong>Evangelium</strong> nach dem Diktat des Johannes korrekt<br />
aufgeschrieben. Aber der Ketzer Marcion [ca. 85-160, , Gründung der eigenen Kirche 144 n. Chr.!], da<br />
er von ihm verworfen worden war, weil er Gegensätzliches dachte, ist durch Johannes<br />
zunichtegemacht worden. Er hat nämlich Schriften oder Briefe zu ihm überbracht von Brüdern, die in<br />
Pontus lebten.“ (Alter (antimarcionitischer) Johannes-Prolog (9.Jh.) 4<br />
4 Cod. Vatic. Alex. (reg. lat.) 14 s. IX ed. J. M. TOMASIUS Card. Opp. I, 344, Romae 1747; PITRA, Analecta sacra II, 160.]
G) Die Synoptischen Evangelien<br />
a) Die Zweiquellentheorie<br />
Abb. 3:<br />
Zweiquellentheorie (Stemma):<br />
Leben Jesu (bis um 30/33)<br />
ca. 40 Jahre schriftlose (mündliche) Tradition<br />
Markus (um 68?) Spruchsammlung „Q“ (um 60/65?)<br />
Sondergut Mt<br />
Sondergut Lk<br />
Matthäus (um 80?)<br />
? Lukas (um 85?)<br />
Johannes (um 95?)<br />
?
Abb. 4: Wissenschaftliche Datierung der Evangelien (Auswahl) 5<br />
HARNACK CLEMEN KÜMMEL ZIEGLER MACK ROBINSON<br />
1897 1919<br />
2 1975 1993 2000 1976<br />
a b c d e f<br />
Markus 65-70 67/68 ~ 70 ~ 70 ~ 80 45-60<br />
Matthäus 70-75 72 80-100 ~ 80 ~ 90 40-60+<br />
Lukas 79-93 94/95 70-90 ~ 80-90 ~ 115 -57-60+<br />
Johannes 80-110 100-110 90-100 v.100 ~ 95 -40-65+<br />
H) <strong>Wie</strong> stringent ist die Beweisführung?<br />
5 HARNACK gem. ROBINSON 15, CLEMEN 4, KÜMMEL gem. ROBINSON 17. (Der „kl<strong>ein</strong>e Pauly“ folgt bei Mk und Mt KÜMMEL (Kl.P. III 1014<br />
u. 1085); zu Lukas und Johannes k<strong>ein</strong>e Angaben); ZIEGLER 40-43. Er beruft sich auf BOVON (1989), CONZELMANN ( 9 1988), GNILKA (1988),<br />
PESCH (1984) und E. SCHWEIZER (1982) (ZIEGLER 233 u. 234 Anm. 23); MACK 2000, 419.
Abb. 5:<br />
Wissenschaftliche Datierung des Johannesevangeliums (Auszug)<br />
F. C. BAUR um 1850 um 160/170<br />
P.W. SCHMIEDEL 1908 132-140<br />
R. BULTMANN 1971 nicht nach 120<br />
H. LATIMER JACKSON 1918 ca. 100[90?]-125<br />
CLEMEN 1919 100-110<br />
R.E. BROWN 1966-70<br />
40-60 Sammlung<br />
ca 50-75 Entfaltung<br />
75-85 1. Ausgabe<br />
späte 80er/frühe 90er Revision<br />
ca. 100 Endredaktion<br />
H. VON SODEN 1899-1903, ZIEGLER 1993 vor 100<br />
B.F. WESTCOTT 1883<br />
Ende 90er<br />
EDWARD J. TINSLEY 95<br />
BURTON L. MACK 2000 ca. 95<br />
CRAIG S. KEENER<br />
Mitte 90er<br />
F.J.A. HORT, J.B. LIGHTFOOT,<br />
ALFRED WIKENHAUSER 5 1963 90er Jahre<br />
WERNER GEORG KÜMMEL 2 1975<br />
90-100, vor 80-90 möglich<br />
C.H.DODD 1963, T. W. MANSON (um 1950-60) 90-100<br />
JAMES M. EFIRD, JOSEPH B. TYSON 90-95<br />
G. A. WELLS nach 90<br />
FRANKLIN W. YOUNG, DAVID A. FIENSY,<br />
JOSEPH A. FITZMYER, HOWARD<br />
CLARK KEE, BRUCE METZGER 90<br />
BEAUFORD H. BRYANT, MARK S. KRAUSE 85-95<br />
STEPHEN S. SMALLEY 85<br />
ADOLF V. HARNACK 1897 80-110<br />
C.K. BARETT ca. 90 (nicht vor 80)<br />
NORMAN PERRIN 1974 80-100<br />
WILLIAM HENDRIKSEN 80-98<br />
Believer's Study Bible, 80-95<br />
GEORGE R. BEASLEY-MURRAY 80<br />
THEODOR ZAHN wahrsch 80-90, frühestens 75<br />
RICHARD C.H. LENSKI zw. 75 u. 100, wahrsch. 80 od. 85<br />
W.F. ALBRIGHT späte 70er oder frühe 80er Jahre, nicht n. 90<br />
RAYMOND BROWN 75-85, in d. 2. Aufl. 85-95<br />
LEON MORRIS<br />
vor den 70ern<br />
CARSTEN PETER THIEDE 1996 früher als 70<br />
B.P.W. STATHER HUNT vor 70<br />
KLAUS BERGER 1994, 1997, 1999 <strong>ein</strong>e Zeit vor 70/ 67-70 / 68-69<br />
J.A.T. ROBINSON 1975 65<br />
RUDOLF MÖCKEL 1999 62<br />
Die wie <strong>ein</strong>e feststehende Wahrheit vorgetragenen wissenschaftlichen Datierungen weisen <strong>ein</strong>e<br />
erhebliche Schwankungsbreite auf (sh. Abb. 5, exemplarisch am Johannesevangelium dargestellt).<br />
Dies all<strong>ein</strong> schon sollte zur Zurückhaltung mahnen.
Weiterführende Literatur:<br />
KLAUS BERGER (Übers. u. Hg.): Das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Frankfurt<br />
a.M./Leipzig, 1 1999/2005<br />
BURTON L. MACK: Wer schrieb das Neue Testament? Die Erfindung des christlichen Mythos.<br />
München 2000.<br />
JOHN. A. T. ROBINSON: Wann entstand das Neue Testament? Paderborn/Wuppertal 1986.<br />
JOHN. A. T. ROBINSON: Das <strong>Evangelium</strong> der Ursprünge Paderborn/Wuppertal 1999.<br />
CARSTEN PETER THIEDE: Die älteste Evangelien-Handschrift? Ein Qumran-Fragment wird<br />
entschlüsselt. OA 1986. Wuppertal 4 1994<br />
CARSTEN PETER THIEDE / MATTHEW D’ANCONA: Der Jesus-Papyrus. Die Entdeckung <strong>ein</strong>er<br />
Evangelien-Handschrift aus der Zeit der Augenzeugen. München 1 1996.<br />
Nächste Termine:<br />
(jeweils 2. Donnerstag im Monat, 20:15-21:00 Uhr)<br />
Do., 12. Oktober<br />
Do., 9. November<br />
Do., 14. Dezember<br />
Do., 11. Januar<br />
II. Die Brisanz der Datierung<br />
Der Kampf der Weltanschauungen im Streit um die Datierung<br />
III. Vom Nutzen und Nachteil der Spätdatierung.<br />
Warum die Theologie k<strong>ein</strong>e Augenzeugen gebrauchen kann.<br />
IV. Ist <strong>ein</strong>e Frühdatierung möglich?<br />
Die gewagten Thesen des J.A.T. Robinson.<br />
V. Eine Evangelienparodie aus dem Jahre 62 n. Chr.<br />
Eine grundlegende Einführung in das Werk des Petronius.<br />
© copyright 2006 by Thomas Völker, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche (auch auszugsweise) Verwendung oder Verwertung der<br />
Texte, Tabellen und Bilder in Wort, Bild und Ton ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor und Recht<strong>ein</strong>haber<br />
urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und die Verarbeitung mit oder in<br />
elektronischen Systemen, sowie das Scannen und Digitalisieren, die Speicherung auf Ton- oder Datenträgern und die Verwendung in<br />
Datenbanken jeder Art.<br />
i<br />
ROBINSON (1986) 364 <strong>datiert</strong> 1Clem bereits auf „Anfang 70“.