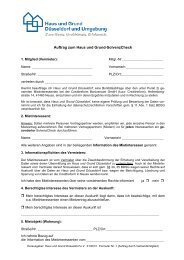Ausgabe 08/11, PDF, 3.7 MB - Haus und Grund Düsseldorf
Ausgabe 08/11, PDF, 3.7 MB - Haus und Grund Düsseldorf
Ausgabe 08/11, PDF, 3.7 MB - Haus und Grund Düsseldorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
29<br />
32<br />
RECHT+STEUER<br />
RECHT + STEUER Informationen zur Zeitung „<strong>Haus</strong> <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>“ 8/20<strong>11</strong><br />
Anspruch der Anlieger auf Gebührenreduzierung<br />
Informationen zur Zeitung „<strong>Haus</strong> <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>“ 8/20<strong>11</strong><br />
Aus dem Inhalt<br />
Umsatzmiete formularmäßig möglich<br />
Keine überraschende oder unangemessene Vereinbarung<br />
einigt werden, wie es in der Satzung<br />
vorgesehen ist. Ergibt sich,<br />
dass satzungswidrig der Winterdienst<br />
wöchentlich nicht einmal<br />
durchgeführt worden ist,<br />
sondern nur alle zwei Wochen,<br />
kann der Dienst ohne weiteres<br />
ausfallen, wenn es viermal im<br />
Frühjahr vorgekommen ist.<br />
Seite<br />
Denn die Frage, ob <strong>und</strong> in welchem<br />
Umfang nach Art <strong>und</strong><br />
Umfang erhebliche Mängel der<br />
Straßenreinigung vorliegen, die<br />
sich auf die Gebührenhöhe auswirken,<br />
kann sich nur für einen<br />
kurzen Zeitraum innerhalb des<br />
Jahres stellen. Dabei ist auch die<br />
Reinigungshäufigkeit <strong>und</strong> die<br />
Qualität der Reinigung zu<br />
berücksichtigen.<br />
Bei Anliegern ist vielfach die<br />
Vorstellung entstanden, dass es<br />
unberechtigt sei, dass die Gemeinde<br />
Gebühren für die<br />
Straßenreinigung <strong>und</strong> den Winterdienst<br />
erheben. Es würden<br />
Leistungsmängel vorliegen, die<br />
von der Gemeinde berücksichtigt<br />
werden müssten, weil von<br />
der Gemeinde keine Leistungen<br />
erbracht werden würden.<br />
Umsatzmiete formularmäßig<br />
möglich 29<br />
Geschäftsbedingungen (§§ 305<br />
c Abs. 1, 307 BGB).<br />
Allgemeine Hinweise<br />
Das Solardach blendete 29<br />
Platz fürs „liebste Kind“ 30<br />
Öffentlicher<br />
Wegeseitenkanal 31<br />
Den Bauherren fragen 31<br />
Minderwert trotz<br />
Reparatur 31<br />
Bei der Vermietung von Geschäftsräumen<br />
sind die Mietparteien<br />
anders als bei der<br />
Wohnraummiete in der Vereinbarung<br />
der Miete weitgehend<br />
frei. Eine Form stellt die Umsatzmiete<br />
dar, die sich an dem<br />
Umsatz orientiert, der in dem<br />
Mietobjekt erzielt wird. Ist diese<br />
Art vereinbart, dann hat der<br />
Mieter dem Vermieter Auskunft<br />
über die Umsätze zu erteilen.<br />
Anspruch der Anlieger auf<br />
Gebührenreduzierung 32<br />
Prüfungsmaßstäbe des<br />
OLG Brandenburg<br />
Renovierung aufgr<strong>und</strong><br />
unwirksamer Klausel 32<br />
Das OLG Brandenburg<br />
(a.a.O.) sieht ferner in der<br />
Mietabrede keine überraschende<br />
Klausel (§ 305 c Abs. 1 BGB),<br />
die zur Unwirksamkeit führt.<br />
Die Klausel weicht nicht von<br />
Mietvereinbarungen ab, die in<br />
dieser Branche – Vermietung<br />
von Ladenflächen in Bahnhöfen<br />
– üblich sind.<br />
Schließlich verneint das Gericht<br />
eine unangemessene Benachteiligung<br />
der Mieterin<br />
nach § 307 BGB. Dabei äußert<br />
es bereits Zweifel, ob eine Inhaltskontrolle<br />
nach dieser Vorschrift<br />
überhaupt in Betracht<br />
kommt. Die Umsatzmiete findet<br />
nämlich keine Regelung im<br />
Gesetz, sondern ist allein von<br />
den Mietparteien vertraglich<br />
festgelegt worden. Somit scheidet<br />
auch die Abweichung von<br />
einem gesetzlichen Leitbild aus.<br />
miete in der Regel einen weiten<br />
Spielraum haben. Ein Verstoß<br />
gegen das Gebot der Sittenwidrigkeit<br />
(§ 138 BGB) kommt nur<br />
in krassen Ausnahmefällen in<br />
Betracht.<br />
HUG 8/<strong>11</strong> Dr. H.-H. Gather<br />
Fazit:<br />
Nach all dem bleibt festzuhalten,<br />
dass die Mietparteien bei<br />
der Vereinbarung einer Umsatz-<br />
Zunächst weist das Gericht<br />
darauf hin, dass die Wirksamkeit<br />
der Vereinbarung einer<br />
Umsatzmiete nicht von der Angemessenheit<br />
von Leistung <strong>und</strong><br />
Gegenleistung abhängt. Die<br />
marktüblichen Verhältnisse<br />
spie len insofern keine Rolle.<br />
Lediglich, wenn ein „besonders<br />
grobes Missverhältnis“ zwischen<br />
Leistung <strong>und</strong> Gegenleistung<br />
besteht, kann die Vereinbarung<br />
wegen Sittenwidrigkeit<br />
nichtig sein. Davon sei aber, so<br />
wird ausgeführt, in der Regel<br />
nur auszugehen, wenn der Verkehrswert<br />
einer Leistung kaum<br />
mehr als die Hälfte des vereinbarten<br />
Preises erreiche. In dem<br />
zu entscheidenden Fall beträgt<br />
die von der Mieterin für tragbar<br />
angesehene Miete 20 Euro je<br />
Quadratmeter <strong>und</strong> die sich<br />
aus der vertraglichen Regelung<br />
ergebende Mietverpflichtung<br />
26,73 Euro.<br />
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts<br />
Gelsenkirchen<br />
vom 21.10.2010 – 13 K 283/10<br />
–besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung,<br />
wenn nach<br />
der Gebührensatzung eine Erstattung<br />
der Reinigungsgebüh -<br />
ren nur bei einem Ausfall von<br />
mehr als 10% der jährlich geschuldetenReinigungsleistungen<br />
beansprucht werden kann.<br />
men ist. Erst wenn unter dem<br />
Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit<br />
bzw. Hygiene nicht<br />
mehr hinzunehmende Unvollkommenheiten<br />
der Straßen -<br />
reinigung über einen längeren<br />
Zeitraum, d. h. zumindest über<br />
mehrere Wochen andauern, ist<br />
die Frage nach einer Gebührenermäßigung<br />
zu stellen. Nach<br />
der Auffassung der Gerichte<br />
steht in Fällen derart erheblicher<br />
Leistungsmängel eine Ermäßigung,<br />
Minderung oder ein<br />
Erlass der Gebührenforderung<br />
in Rede. Handelt es sich um die<br />
Erhebung einer Jahresgebühr,<br />
die bereits zu Beginn des Jahres<br />
entstanden ist, kann die Leistung<br />
im Wege der Durchführung<br />
der Reinigung der öffentlichen<br />
Straße für eine Minderleistung<br />
des gesamten Jahreszeitraums<br />
bewertet werden.<br />
HUG 8/<strong>11</strong> RA Dr. Otto<br />
Im Übrigen kommt es darauf<br />
an, ob die Festsetzung der<br />
Straßenreinigungsgebühr rechtmäßig<br />
ist. Erhebliche Jahresmängel<br />
dürfen am Jahresanfang<br />
noch nicht bekannt sein. Wenn<br />
Leistungsmängel später auftreten,<br />
kann der Gebührenbescheid<br />
allerdings rechtwidrig<br />
werden. Winterdienstge bühren<br />
können nicht erhoben werden,<br />
wenn die Gehwege nicht so ger-<br />
In der Rechtsprechung ist geklärt,<br />
dass Minderleistungen bei<br />
der Erfüllung der gemeindlichen<br />
Leistungspflicht bei der<br />
Straßenreinigung zu einer Minderung<br />
der Gebühren führen<br />
könnten, wenn sie nach Art<br />
<strong>und</strong> Umfang – sowohl qualitativer<br />
als auch quantitativer Art –<br />
erhebliche Mängel darstellen,<br />
wobei die Reinigung der gesamten<br />
Straße in den Blick zu neh-<br />
Renovierung aufgr<strong>und</strong> unwirksamer Klausel<br />
Mieteransprüche verjähren in sechs Monaten<br />
Das OLG Brandenburg (Hinweisbeschl.<br />
v. 07.02.20<strong>11</strong> – 3 U<br />
171/10 – Das Gr<strong>und</strong>eigentum<br />
20<strong>11</strong>, 751) setzt sich unter den<br />
verschiedenen rechtlichen As -<br />
pek ten mit der Zulässigkeit einer<br />
Umsatzmiete auseinander.<br />
Prüfungsmaßstäbe sind einmal<br />
die Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB)<br />
<strong>und</strong> zum anderen die Vorschriften<br />
des Rechts der Allgemeinen<br />
BGH äußert sich zu<br />
streitiger Rechtsfrage<br />
Das Solardach blendete<br />
Nachbarn müssen nicht alle Störungen hinnehmen<br />
Der Nutzer der Solarenergie verwies<br />
unter anderem darauf, dass<br />
die Sonneneinstrahlung immerhin<br />
Folge eines Naturereignisses<br />
<strong>und</strong> deswegen zumutbar sei.<br />
Das Urteil: Der <strong>Haus</strong>besitzer<br />
musste die Konsequenzen ziehen<br />
<strong>und</strong> seine Solaranlage etwas<br />
anders ausrichten. So entschieden<br />
es die zuständigen Zivilrichter.<br />
Die Beeinträchtigung<br />
der Nachbarn, das stellten sie<br />
zweifelsfrei fest, sei „wesentlich“.<br />
Man könne von ihnen<br />
auch nicht verlangen, sich mit<br />
Selbsthilfemaßnahmen davor<br />
zu schützen. Und schließlich<br />
komme als wesentliches Argument<br />
noch hinzu, dass der Betroffene<br />
die Reflektoren nicht<br />
ortsüblich angebracht habe. Alles<br />
in allem sei deswegen die<br />
Anlage in der bisher betriebenen<br />
Form nicht zumutbar.<br />
den. Darin sahen sie eine erhebliche<br />
Störung in der Nutzung<br />
ihrer Immobilie <strong>und</strong> wollten<br />
sich dies nicht bieten lassen.<br />
ne Nachbarn auf ihren Terrassen<br />
in den Monaten März bis<br />
Oktober täglich mindestens eine<br />
halbe St<strong>und</strong>e geblendet wur-<br />
Bei allem gesellschaftlichen<br />
Interesse <strong>und</strong> aller staatlichen<br />
Unterstützung für die Solarenergie<br />
müssen dabei doch die<br />
elementaren nachbarrechtlichen<br />
Regeln eingehalten werden.<br />
So kann nach Information<br />
des Infodienstes Recht <strong>und</strong><br />
Steuern der LBS ein entsprechendes<br />
Gerichtsurteil interpretiert<br />
werden. Anwohner hatten<br />
den Klageweg beschritten, weil<br />
sie von den Reflektoren ständig<br />
geblendet wurden.<br />
(Landgericht Heidelberg, Aktenzeichen<br />
3 S 21/<strong>08</strong>)<br />
Der Fall: Ein <strong>Haus</strong>besitzer<br />
hatte auf seinem Dach eine<br />
Photovoltaikanlage angebracht,<br />
um die Sonnenenergie nutzen<br />
zu können. Was er allerdings<br />
dabei nicht bedacht hatte: Die<br />
Reflektoren der Anlage waren so<br />
ungünstig ausgerichtet, dass sei-<br />
Abs. 2 BGB. Danach müssen<br />
die Ansprüche bis zur Beendigung<br />
des Mietvertrages<br />
entstanden sein (Schach, in:<br />
Kinne/Schach/Bieber, Miet<strong>und</strong><br />
Mietprozessrecht, 6. Aufl.<br />
§ 548 BGB Rdn. 4.)<br />
Eine analoge Anwendung<br />
von § 548 Abs. 2 BGB auf diese<br />
Fälle scheidet mangels des<br />
Vorliegens einer „planwidrigen<br />
Regelungslücke“ aus. Von<br />
ihr kann nur gesprochen werden,<br />
wenn es der Gesetzgeber<br />
bei einer Interessenabwägung<br />
für erforderlich gehalten hätte,<br />
die Anwendung der Spezialvorschrift<br />
des § 548 Abs. 2<br />
BGB auch für Ansprüche<br />
nach Vertragsende anzunehmen<br />
(vgl. u.a. i.d.S. BGH, Urt.<br />
v. 27.01.2010 – XII ZR 22/07 –<br />
Neue Zeitschrift für Miet- <strong>und</strong><br />
Wohnungsrecht 2010, 240).<br />
3. Soweit Erstattungsansprüche<br />
nach Vertragsende entstehen,<br />
dürfte die allgemeine Regelverjährung<br />
von drei Jahren<br />
(§ 195 BGB) gelten (Schach,<br />
in: Kinne/Schach/Bieber, in:<br />
a.a.O. § 548 BGB Rdn. 4).<br />
Letzte Klarheit über die Frage,<br />
welche Verjährungsfrist in Betracht<br />
kommt, kann jedoch<br />
nur eine höchstrichterliche<br />
Entscheidung bringen.<br />
Euro durchführen lassen. Später<br />
erfuhren sie, dass die Renovierungsklausel<br />
wegen eines „starren“<br />
Fristenplanes unwirksam<br />
war. Der Ehemann, dem von<br />
seiner Ehefrau die Ansprüche<br />
auf Erstattung der Kosten abgetreten<br />
worden sind, hat vom<br />
Vermieter die Kosten nebst Zinsen<br />
verlangt.<br />
bildet nur die Unkenntnis von<br />
der Gr<strong>und</strong>stücksveräußerung<br />
als tatsächliche Voraussetzung<br />
für eine Vertragsbeendigung.<br />
Weitere Anwendungsbereiche<br />
der<br />
Verjährungsregelung<br />
Hinweis:<br />
1. Durch das Hinausschieben<br />
des Beginns der kurzen Verjährungsfrist<br />
bei Renovierungen<br />
bis zum Vertragsende<br />
während eines langfristigen<br />
Mietvertrages kann es leicht<br />
nach langer Zeit noch zu Meinungsverschiedenheitenwegen<br />
einer Renovierung kommen.<br />
2. In etlichen Fällen erfolgt eine<br />
Renovierung durch den Mieter<br />
erst nach dem Ende des<br />
Mietvertrages. Hier fragt es<br />
sich, welche Verjährungsfrist<br />
bei dieser Fallgestaltung anwendbar<br />
ist. Folgt man dem<br />
Urt. des BGH v. 04.05.20<strong>11</strong><br />
(VIII ZR 195/10), so kommt<br />
die kurze Frist von sechs Monaten<br />
nicht zur Anwendung.<br />
Er geht in seiner Entscheidung<br />
davon aus, dass die Erstattungsansprüche<br />
„wäh rend des<br />
Mietverhältnisses“ entstanden<br />
sind. Dafür spricht auch § 548<br />
Auf die Frage, ob die Erstattungsansprüche<br />
rechtlich ihre<br />
Gr<strong>und</strong>lage in den Vorschriften<br />
des Mietrechts, mietvertraglichen<br />
Vereinbarungen, Geschäftsführung<br />
ohne Auftrag<br />
oder ungerechtfertigter Bereicherung<br />
haben, soll es dabei<br />
nicht ankommen. In den Mittelpunkt<br />
seiner Begründung<br />
stellt der BGH den Zweck der<br />
Spezialregelung über die kurze<br />
Verjährungsfrist, nach Been -<br />
digung des Mietverhältnisses<br />
möglichst schnell Klarheit über<br />
bestehende Ansprüche im Zusammenhang<br />
mit dem Zustand<br />
der Mietsache zu erreichen.<br />
Sachverhalt der<br />
Entscheidung<br />
Der BGH hat mit Urt. v.<br />
04.05.20<strong>11</strong> (VIII ZR 195/10 - )<br />
zu der in der Rspr. der Instanzgerichte<br />
<strong>und</strong> der Literatur umstrittenen<br />
Frage Stellung genommen,<br />
ob Erstattungsansprüche<br />
eines Mieters, der aufgr<strong>und</strong><br />
einer unwirksamen RenovierungsklauselSchönheitsreparaturen<br />
vornimmt, in sechs<br />
Monaten (§ 548 Abs. 2 BGB)<br />
oder drei Jahren (§ 195 BGB)<br />
verjähren. Das Gericht kommt<br />
zu dem Ergebnis, dass sie, wenn<br />
der Mieter „während des Mietverhältnisses“<br />
in der irrigen Annahme<br />
einer entsprechenden<br />
Verpflichtung renoviert, die<br />
kurze Frist von sechs Monaten,<br />
beginnend mit der Beendigung<br />
des Mietverhältnisses anwendbar<br />
ist. Die Verjährungsfrist erfasst<br />
nach dem Gesetzeswortlaut<br />
(§ 548 Abs. 2 BGB) „Ansprüche<br />
des Mieters auf Ersatz<br />
von Aufwendungen oder auf<br />
Gestattung der Wegnahme einer<br />
Einrichtung“.<br />
HUG 8/<strong>11</strong> Dr. H.-H. Gather<br />
Nach dem Sachverhalt der<br />
Entscheidung haben die Eheleute,<br />
die vom 01.<strong>11</strong>.2000 bis<br />
zum 31.12.2006 Mieter einer<br />
Wohnung waren, vor der Rückgabe<br />
am Ende des Mietvertrages<br />
Renovierungsarbeiten für 2.687<br />
Auf die Kenntnis des Mieters<br />
von der Unwirksamkeit der<br />
Klausel kommt es für die Verjährungsfrist<br />
nicht an, sondern<br />
allein auf die Beendigung des<br />
Mietvertrages. Eine Ausnahme