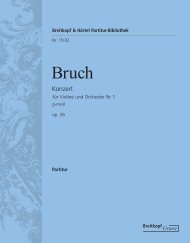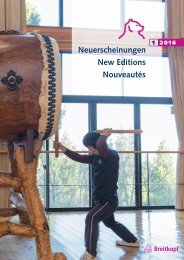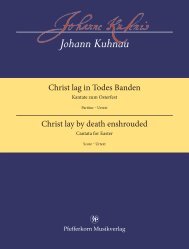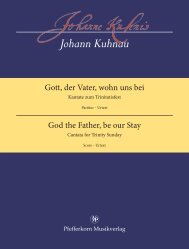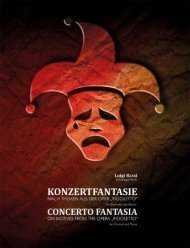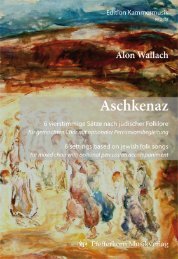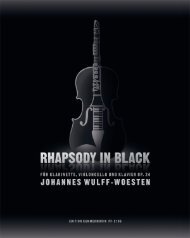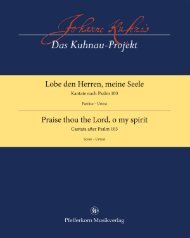Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KRITISCHER BERICHT<br />
Quellen<br />
Die vorliegende Urtextausgabe basiert auf der einzigen<br />
überlieferten Quelle A, einer Partiturhandschrift, die –<br />
zusammen mit einem weiteren Vokalwerk Johann Kuhnaus –<br />
heute in einem Band unter der Signatur Mus.ms. 12263-5<br />
in der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz,<br />
Musikabteilung mit Mendelssohn–Archiv aufbewahrt<br />
wird. Dieser ist Teil der ehemaligen Notensammlung Georg<br />
Johann Daniel Poelchaus (1773–1836). Der Vorsatz dieses<br />
Bandes enthält ein Inhaltsverzeichnis von der Hand Poelchaus,<br />
wobei die für das vorliegende Werk relevanten Eintragungen<br />
wie folgt lauten:<br />
a, Kuhnau J. (Cantor an der Thomasschule in Leipzig et<br />
Sebast Bachs | Vorgänger im Amte) | Magnificat für 5 St. mit<br />
Instr. C d. Part. von Stölzels | Hand. 15 B.<br />
Für das „Magnificat“ selbst existiert kein Vorsatz- oder<br />
Deckblatt, die einzigen verwertbaren Hinweise sind auf der<br />
ersten Partiturseite notiert. Am oberen Rand findet sich folgende<br />
Besetzungsangabe:<br />
Magnificat à 3 Clarini, Tymp: 2 Oboe, 2 Violini, 2 Viole, 5<br />
Voci e Continuo di Kuhnau.<br />
Am unteren Rand findet sich zudem nochmals – von der<br />
Hand Poelchaus – der Hinweis auf den Schreiber:<br />
Von der Hand des Capellmeisters Stölzel in Gotha<br />
Am Ende der Partitur, nach dem Schlussstrich der letzten<br />
Continuo-Zeile, befindet sich das Kürzel „D.S.G.“ für „Deo<br />
Soli Gloria“. Darüber hinaus enthält der freie Rand dieser<br />
letzten Partiturseite acht Takte einer Akkordverbindungsoder<br />
Modulationsübung, die jedoch in keiner Beziehung<br />
zum vorliegenden Werk zu stehen scheint.<br />
Die erste Edition des „Magnificat“ von Johann Kuhnau<br />
besorgte Evangeline Rimbach im Jahr 1980 für die Reihe<br />
„Recent Researches in the Music of the Baroque Era“ bei<br />
A-R Editions, Inc (Volume XXXIV). Rimbach ist eine<br />
Pionierin auf dem Gebiet der Kuhnau-Forschung, ihre<br />
Dissertation „The Church Cantatas of Johann Kuhnau“ aus<br />
dem Jahr 1966 ist bis heute eine der umfangreichsten Arbeiten<br />
zum Werk des Komponisten.<br />
Für ihre Ausgabe des „Magnificat“ stand ihr jedoch mutmaßlich<br />
nur eine minderwertige Reproduktion der Quelle<br />
zur Verfügung, so dass zahlreiche Lesarten mit der vorliegenden<br />
Urtext-Ausgabe erstmals Eingang in den Notentext<br />
finden.<br />
Rimbachs Ausgabe gilt bisher als maßgeblich für heutige<br />
Aufführungen von Johann Kuhnaus „Magnificat“, weshalb<br />
sie der hier vorgelegten Ausgabe als Referenzquelle R an die<br />
Seite gestellt wird. Besonders erwähnenswert erscheinende<br />
abweichende Lesarten finden daher auch Eingang in die<br />
Einzelanmerkungen.<br />
Die von Jörg Jacobi edierte Fassung (edition baroque,<br />
2012) lag dem Herausgeber ebenfalls vor und findet gegebenenfalls<br />
Erwähnung als Randquelle J.<br />
Anmerkungen zur Komposition<br />
Johann Kuhnaus Vertonung des „Magnificat“-Textes<br />
aus dem Lukasevangelium zählt zu seinen prachtvollsten<br />
Kompositionen. Sie weist sowohl in Besetzung als auch in<br />
Anlage und Form bereits auf das weitaus bekanntere<br />
„Magnificat“ seines Amtsnachfolgers Johann Sebastian<br />
Bach (BWV 234) und legt dadurch Zeugnis der Tradition<br />
und Entwicklung ab, in der sich Kuhnau und Bach gleichermaßen<br />
befanden.<br />
Über Zeit oder konkreten Anlass der Entstehung des Werkes<br />
ist nichts überliefert, auch die Partitur gibt dazu keinerlei<br />
verwertbare Anhaltspunkte. Zu bedenken ist jedoch: „Da<br />
Gottfried Heinrich Stölzel von 1707 bis 1710 als Student an<br />
der Leipziger Universität weilte, und in späterer Zeit wohl<br />
kaum Zugang zu Kompositionen Johann Kuhnaus hatte,<br />
dürfte dieses Werk in den Jahren vor 1711 entstanden sein.“ 1<br />
Gesichert ist überdies, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts<br />
„in den Vespergottesdiensten der beiden Hauptkirchen (St.<br />
Nikolai und St. Thomä) sowie in der Neukirche (…) Aufführungen<br />
des lateinischen Magnificat an hohen Feiertagen<br />
– namentlich an den drei Marienfesten und zu Weihnachten<br />
– mithin Bestandteile einer langjährigen Tradition“ 2 waren.<br />
Ohne Zweifel ist diese Tradition somit auch Anlass der Entstehung<br />
des vorliegenden Werkes.<br />
Berücksichtigt man dies und bezieht zu diesem Zweck<br />
weitere „Magnificat“-Vertonungen in die Überlegungen<br />
mit ein (beispielsweise Georg Philipp Telemanns Komposition<br />
von 1704 für die Leipziger Neukirche sowie das oben<br />
erwähnte Werk Johann Sebastian Bachs von 1723), so darf<br />
man in Kuhnaus „Magnificat“ wohl durchaus eines der<br />
Hauptwerke in seiner Funktion als Thomaskantor in Leipzig<br />
sehen.<br />
1 Glöckner, Andreas: Bachs Es-Dur-Magnificat BWV 243a - eine genuine<br />
Weihnachtsmusik?, in: Bach-Jahrbuch 2003, (Evang. Verlagsanstalt), S. 38,<br />
Fußnote 10<br />
2 dto., S. 37<br />
XI