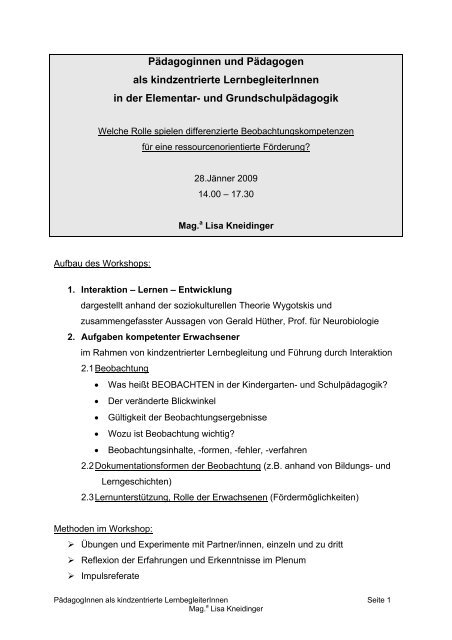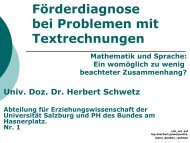Pädagoginnen und Pädagogen als kindzentrierte ...
Pädagoginnen und Pädagogen als kindzentrierte ...
Pädagoginnen und Pädagogen als kindzentrierte ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Pädagoginnen</strong> <strong>und</strong> <strong>Pädagogen</strong><br />
<strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen<br />
in der Elementar- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulpädagogik<br />
Welche Rolle spielen differenzierte Beobachtungskompetenzen<br />
Aufbau des Workshops:<br />
für eine ressourcenorientierte Förderung?<br />
28.Jänner 2009<br />
14.00 – 17.30<br />
Mag. a Lisa Kneidinger<br />
1. Interaktion – Lernen – Entwicklung<br />
dargestellt anhand der soziokulturellen Theorie Wygotskis <strong>und</strong><br />
zusammengefasster Aussagen von Gerald Hüther, Prof. für Neurobiologie<br />
2. Aufgaben kompetenter Erwachsener<br />
im Rahmen von <strong>kindzentrierte</strong>r Lernbegleitung <strong>und</strong> Führung durch Interaktion<br />
2.1 Beobachtung<br />
• Was heißt BEOBACHTEN in der Kindergarten- <strong>und</strong> Schulpädagogik?<br />
• Der veränderte Blickwinkel<br />
• Gültigkeit der Beobachtungsergebnisse<br />
• Wozu ist Beobachtung wichtig?<br />
• Beobachtungsinhalte, -formen, -fehler, -verfahren<br />
2.2 Dokumentationsformen der Beobachtung (z.B. anhand von Bildungs- <strong>und</strong><br />
Lerngeschichten)<br />
2.3 Lernunterstützung, Rolle der Erwachsenen (Fördermöglichkeiten)<br />
Methoden im Workshop:<br />
� Übungen <strong>und</strong> Experimente mit Partner/innen, einzeln <strong>und</strong> zu dritt<br />
� Reflexion der Erfahrungen <strong>und</strong> Erkenntnisse im Plenum<br />
� Impulsreferate<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 1<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
1. Interaktion – Lernen – Entwicklung<br />
dargestellt anhand der soziokulturellen Theorie Wygotskis<br />
„Das Kind ist aktiv Lernender in sozialen Zusammenhängen, in Interaktionen“<br />
Wie beeinflussen soziale <strong>und</strong> kulturelle Faktoren den Lernprozess des Kindes <strong>und</strong><br />
seine Entwicklung?<br />
Die Kindergartengruppe, die Klasse ist ein soziokulturelles System, das von innen<br />
durch die PädagogInnen <strong>und</strong> Kinder, von außen durch den sie umgebenden sozialen<br />
Kontext gestützt <strong>und</strong> beeinflusst wird.<br />
→ Gesellschaft <strong>und</strong> Kultur beeinflussen das Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsgeschehen<br />
<strong>und</strong> die Erziehungs- <strong>und</strong> Bildungsziele<br />
→ PädagogInnen vermitteln die von der Kultur geprägten Denkweisen<br />
→ Die Unterschiedlichkeit von Lerngruppen entsteht durch unterschiedlichen<br />
Erfahrungshintergr<strong>und</strong> (soziale, kulturelle, nationale Identität), individuelle<br />
Fähigkeiten (Begabungen), Persönlichkeitsmerkmale, Arbeitshaltungen,<br />
Arbeitstechniken, Lernstrategien, Motivation.<br />
Interaktion Lernen Entwicklung<br />
Keine Entwicklung ohne Lernen! Lernprozesse gehen der Entwicklung voraus!<br />
1. WIE lernt das Kind?<br />
Aspekt „Interaktion“ (Bildung durch Beziehung)<br />
• Bildungsprozesse erfolgen in Interaktion mit anderen: Nahezu alle<br />
psychischen Strukturen <strong>und</strong> kognitiven Fähigkeiten eines Kindes traten<br />
ursprünglich in Interaktionen mit anderen, kompetenteren Personen auf <strong>und</strong><br />
wurden dann internalisiert. „Vermittelt über das Soziale entsteht das<br />
Individuelle!“<br />
• Das Kind wird zum denkenden Wesen, indem es sich in Interaktionen mit<br />
Erwachsenen <strong>und</strong> anderen Kindern die Kultur seiner Gesellschaft (= Sprache,<br />
Schriftzeichen, Symbole, Wissensbestände, Denkweisen etc.) aneignet.<br />
Das Kind eignet sich somit auch die Werkzeuge des Denkens an! Es probiert<br />
diese so lange aus, bis es sie selbstständig <strong>und</strong> effektiv anwenden kann.<br />
• Geistige Funktionen bauen auf angeborenen Anlagen (Aufmerksamkeit,<br />
Wahrnehmung, Merkfähigkeit) auf, treten aber zuerst auf interpersonaler<br />
Ebene auf <strong>und</strong> werden dann durch Internalisation intrapersonal.<br />
Einschub: Gerald Hüther zur Ausbildung von Metakompetenzen <strong>und</strong> Ich-<br />
Funktionen während der Kindheit<br />
Komplexe Nervenverschaltungen, die das Denken, Handeln <strong>und</strong> Fühlen eines<br />
Menschen bestimmen, entwickeln sich nicht allein. Ihre Ausformung hängt davon ab,<br />
wie <strong>und</strong> wofür ein Mensch sein Gehirn benutzt. Entscheidend dafür sind die<br />
individuellen Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens machen konnte oder<br />
musste. Die wichtigsten Erfahrungen, die Menschen im Laufe ihres Lebens prägen,<br />
sind Erfahrungen, die sich aus dem Zusammenleben mit anderen ergeben. Der<br />
Aufbau <strong>und</strong> die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns sind daher durch soziale<br />
Beziehungserfahrungen determiniert. Das menschliche Gehirn ist ein soziales<br />
Produkt, ein Sozialorgan.<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 2<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Warum? Soziale Erfahrungen gehen mit der Aktivierung emotionaler Zentren einher<br />
– dadurch werden Botenstoffe ausgeschüttet, die zur Bahnung <strong>und</strong> Festigung der<br />
Nervenzellverschaltungen beitragen. Gefühle sind daher der entscheidende „Trigger“<br />
(Auslöser) für alle Lernprozesse. Ohne Aktivierung der emotionalen Zentren bleibt<br />
nichts im Gehirn „haften“.<br />
Keine andere Spezies kommt mit einem derart offenen, lernfähigen <strong>und</strong> durch eigene<br />
Erfahrungen in seiner Weiterentwicklung <strong>und</strong> strukturellen Ausreifung formbaren<br />
Gehirn zur Welt wie der Mensch. Nirgendwo im Tierreich sind die Nachkommen beim<br />
Erlernen dessen, was für ihr Überleben wichtig ist, so sehr <strong>und</strong> so lange auf<br />
Fürsorge, Unterstützung <strong>und</strong> Lenkung durch Erwachsene angewiesen. Und bei<br />
keiner anderen Art ist die Hirnentwicklung in solch hohem Ausmaß von der<br />
emotionalen, sozialen <strong>und</strong> intellektuellen Kompetenz dieser erwachsenen<br />
Bezugspersonen abhängig.<br />
Beispiel für eine nutzungsabhängige Stabilisierung synaptischer Netzwerke:<br />
Herausformung des „Gesangzentrums“ im Gehirn von Singvögeln: Es besteht ein<br />
Überangebot an Nervenzellkontakten. – Durch das vorbildliche Singen des<br />
Vatervogels kommt es zur Entwicklung komplexer synaptischer Verschaltungsmuster<br />
(je komplizierter der Gesang, desto komplexer das Muster).<br />
• Durch Nachahmung kann das Kind <strong>als</strong>o mehr erreichen <strong>als</strong> das, wozu es<br />
selbstständig in der Lage ist. (Die Nachahmungsleistung hängt allerdings mit<br />
seinem realen Entwicklungsniveau zusammen.)<br />
• Daraus lässt sich die Bedeutung der Vorbildfunktion Erwachsener ableiten.<br />
Durch die kompetente Anleitung erwachsener Vorbilder können Kinder ihre<br />
eigenen Fähigkeiten <strong>und</strong> Möglichkeiten erkennen <strong>und</strong> weiterentwickeln.<br />
• Bildung erfolgt ko-konstruktivistisch: kulturelles Wissen (Sprache, Denken,<br />
Problemlösestrategien etc.) wird rekonstruiert <strong>und</strong> transformiert<br />
2. WAS lernt das Kind?<br />
Aspekt „Lernen“ (Lerndispositionen, Metakognitive Kompetenzen)<br />
„Das Gehirn lernt das am besten, was ihm hilft, sich in der Welt zurecht zu finden <strong>und</strong><br />
die Probleme zu lösen, die sich dort <strong>und</strong> dabei ergeben.“ (G. Hüther)<br />
Lerndispositionen<br />
Eine Disposition<br />
ist die individuell unterschiedliche, relativ dauerhaft wirkende Bereitschaft, auf<br />
bestimmte Situationen mit spezifischen Voraussetzungen zu reagieren.<br />
Lerndispositionen, Lernvoraussetzungen<br />
= Bereitschaft des Kindes, sich alles aneignen zu wollen, was es zum Leben in der<br />
Familie, in der Umwelt <strong>und</strong> Gesellschaft benötigt!<br />
– umfassen angeborene <strong>und</strong> erworbene Komponenten<br />
– bestimmen mit ihrer Ausprägung die aktuellen Lernmöglichkeiten<br />
entscheidend mit<br />
– sind differenzierte <strong>und</strong> komplexe Orientierungs- <strong>und</strong> Handlungsmuster (eng<br />
verknüpft mit Wissen <strong>und</strong> Fertigkeiten)<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 3<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Man unterscheidet:<br />
(1) kognitive Lernvoraussetzungen<br />
o Gedächtnis (sensorisches Gedächtnis sorgt dafür, dass Informationen<br />
mit Aufmerksamkeit <strong>und</strong> Konzentration bedacht werden;<br />
Arbeitsgedächtnis sorgt dafür, dass Informationen weiterverarbeitet <strong>und</strong><br />
verstanden werden; Langzeitgedächtnis ermöglicht den Abgleich der<br />
Informationen mit bereichsspezifischem Wissen)<br />
o Lernstrategien<br />
o Metakognition (Bewusstheit <strong>und</strong> Wissen über eigene kognitive<br />
Funktionen + Kontrolle, Steuerung <strong>und</strong> Regulation der kognitiven<br />
Funktionen)<br />
(2) Motivationale Lernvoraussetzungen<br />
o Subjektive Kompetenzüberzeugungen (= Bewertung der eigenen<br />
Kompetenz, der eigenen Stärken <strong>und</strong> Schwächen)<br />
o Erfolgserwartung (verb<strong>und</strong>en mit der Bereitschaft, Lernprozesse zu<br />
beginnen <strong>und</strong> sich anzustrengen)<br />
Entwicklungsbesonderheiten zwischen vier <strong>und</strong> acht Jahren<br />
� Kindlicher Überoptimismus (Kinder glauben, dass das Einzige, was<br />
zählt, die eigene Anstrengung, nicht die Fähigkeit ist: „Es gibt nichts,<br />
das ein anderer kann, das ich nicht auch könnte, wenn ich mich nur<br />
genügend anstrenge!“)<br />
� Meinung über die eigenen Fähigkeiten (= Fähigkeitskonzept) ist bei 4-<br />
bis 6-Jährigen nicht von den bisherigen Handlungsergebnissen (z.B.<br />
bisherige Misserfolge) <strong>und</strong> durch soziale Vergleiche beeinflusst<br />
(entsteht erst zwischen sechs <strong>und</strong> acht Jahren)<br />
� Effizienzsteigerung des Arbeitsgedächtnisses – Aktivieren des inneren<br />
Nachsprechens (erst im sechsten Lebensjahr)<br />
Metakognitive Kompetenzen<br />
o Selbstwirksamkeitskonzept, Motivation, Impulskontrolle,<br />
Konzentrationsfähigkeit (Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten,<br />
Aufmerksamkeit auf die Lösung eines Problems fokussieren; bei der<br />
Lösung sich nicht von anderen Bedürfnissen überwältigen lassen)<br />
o Empathiefähigkeit, soziale <strong>und</strong> emotionale Kompetenz<br />
o Strategische Kompetenz, Flexibilität (vorausschauend denken <strong>und</strong><br />
handeln können, Fehler <strong>und</strong> Fehlentwicklungen rechtzeitig korrigieren)<br />
o Problemlösungskompetenz (komplexe Probleme durchschauen)<br />
o Handlungskompetenz (Folgen des eigenen Handelns abschätzen)<br />
Lernmethodische Kompetenz<br />
= Methoden des Lernens zum Lernen einsetzen<br />
= eigenes Lernen organisieren <strong>und</strong> regulieren können<br />
= Fähigkeit, die den Erwerb von Wissen fördert, indem beim Lernen soziale <strong>und</strong><br />
individuelle Formen der Metakognition <strong>und</strong> der Selbststeuerung eingesetzt werden.<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 4<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Metakognitiver Ansatz:<br />
hat zum Ziel, das Bewusstsein der Kinder für ihre Lernprozesse zu fördern<br />
Metakognition ist die wichtigste Voraussetzung für lernmethodische Kompetenz!<br />
Annahmen:<br />
1. Lernen <strong>und</strong> Denken sind soziale Aushandlungsprozesse.<br />
2. Individuelle Bedeutungen werden aus sozialer Übereinkunft abgeleitet.<br />
3. Aspekt: Wie erfolgt Entwicklung?<br />
Die Entwicklung des Kindes verläuft in relativ stabilen Perioden. Entwicklungskrisen<br />
am Ende einer Phase (diese entstehen durch das Zusammenkommen vieler<br />
Neubildungen) führen zu Wandlungen in der Persönlichkeit <strong>und</strong> im Bewusstsein<br />
→ Konflikte mit der sozialen Umwelt!<br />
Zone der nächsten Entwicklung:<br />
= hypothetisch angenommene Phase, in der Lernen <strong>und</strong> Entwicklung stattfinden.<br />
= Distanz zwischen Problemen, die das Kind unabhängig lösen kann <strong>und</strong><br />
Problemen, die es mit Hilfe kompetenterer Personen bewältigt!<br />
Kompetentere Personen erfassen die in Entwicklung befindlichen Fähigkeiten <strong>und</strong><br />
fördern diese gezielt. Damit wird das potentielle Entwicklungsniveau im Vergleich<br />
zum aktuellen Entwicklungsniveau stärker beachtet.<br />
„Was kann das Kind in Zusammenarbeit leisten?“ anstatt „Was kann das Kind bereits<br />
ohne fremde Hilfe leisten?“<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 5<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
2. Aufgaben der PädagogInnen <strong>als</strong> kompetente Erwachsene im Sinne von<br />
Führung durch Interaktion <strong>und</strong> Lernbegleitung<br />
2.1 Beobachtung<br />
Das kind- <strong>und</strong> ressourcenorientierte, differenzierte Beobachten <strong>und</strong> Dokumentieren<br />
kindlicher Bildungs- <strong>und</strong> Entwicklungsbewegungen bringt die notwendigen<br />
Informationen, um gezielt die Arbeit mit den individuellen Lerndispositionen,<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Potentialen des Kindes zu gestalten.<br />
Beobachten<br />
• <strong>als</strong> subjektiver Prozess der Wahrnehmung (Wie wird das Wahrgenommene<br />
mit dem Wissen über das Kind verb<strong>und</strong>en? Wird das Beobachtete mit<br />
Defiziten <strong>und</strong> Schwächen ODER mit Stärken <strong>und</strong> Ressourcen verb<strong>und</strong>en?)<br />
• Beobachtung ≠ verdeckte Ermittlung, verdeckter Lauschangriff, sondern ein<br />
offen gelegtes Interesse „Welche Haltung hat das Kind dem Lernen<br />
gegenüber?“<br />
Die Beobachtung ist eine Möglichkeit zum Erkennen, Beschreiben, Analysieren,<br />
Bewerten <strong>und</strong> Deuten von Situationen:<br />
Mit Hilfe der Beobachtung kann man Fähigkeiten <strong>und</strong> Interessen einzelner Kinder<br />
kennen lernen, ihren Entwicklungsstand einschätzen <strong>und</strong> Antworten auf die Frage<br />
erhalten „Welche Entwicklungsschritte stehen nun an? Was kann das Kind bereits<br />
mit Hilfestellung, aber noch nicht ohne leisten?“<br />
ACHTUNG: Rückschlüsse auf innere Zustände sind nicht zulässig, z.B. „Ich habe<br />
beobachtet, dass Peter sprachbegabt ist!“<br />
Beobachtungsinhalte<br />
• Interaktionen in Groß/Kleingruppe, Material- <strong>und</strong> Raumnutzung<br />
• emotionale Befindlichkeit<br />
• soziales Befinden <strong>und</strong> Verhalten einzelner Kinder<br />
• verbale, nichtverbale Kommunikation<br />
• Wahrnehmung (basal, Raumwahrnehmung, Lateralität)<br />
• Entwicklung diverser Fähigkeiten (kognitiv, fein- <strong>und</strong> grobmotorisch etc.)<br />
• besondere Vorlieben<br />
• Lern- <strong>und</strong> Arbeitsweisen<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 6<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Beobachtungsformen<br />
o teilnehmende/nicht-teilnehmende Beobachtung<br />
o systematische/spontane oder strukturierte/unstrukturierte Beobachtung<br />
o standardisierte Beobachtung<br />
o wissenschaftliche Beobachtung<br />
o Portfolioansätze<br />
Teilnehmende Beobachtung<br />
Die Beobachterin, der Beobachter ist im sozialen Feld handelnd eingeb<strong>und</strong>en.<br />
Systematische oder strukturierte Beobachtung<br />
ist planvoll, hat eine Zielsetzung, ist systematisierter <strong>und</strong> wird reflektiert.<br />
Spontane Beobachtung (freie Beobachtung, Alltagsbeobachtung, unstrukturierte<br />
Beobachtung)<br />
Die, der Beobachter/in will nichts Bestimmtes wissen, sondern ist bereit<br />
wahrzunehmen, was Kinder indirekt oder direkt über sich, ihre Erlebnisse <strong>und</strong><br />
Gedanken mitteilen. Diese Beobachtungen erfolgen ohne gezielte Fragestellung,<br />
sind situativ, zufällig, unmittelbar, spontan <strong>und</strong> vom persönlichen Interesse abhängig.<br />
Standardisierte Beobachtung<br />
ist auf den Vergleich mit Normen gerichtet <strong>und</strong> erlaubt Aussagen darüber, in<br />
welchem Verhältnis das Kind zu altersgleichen Bezugsgruppen steht.<br />
Wissenschaftliche Beobachtung<br />
ist hypothesengeleitet, systematisch, strukturiert, standardisiert. Sie wird sofort <strong>und</strong><br />
vollständig dokumentiert.<br />
Ablauf der systematischen Beobachtung (eines absichtsvollen <strong>und</strong> zielgerichteten<br />
Fokussierens auf bestimmte Merkmale)<br />
o Formulieren einer Fragestellung, Festlegen des Beobachtungsziels<br />
o Auswahl eines Beobachtungsverfahrens (Freie Schilderung, Einschätzung des<br />
Entwicklungsstands mittels eines Beobachtungsrasters,<br />
Häufigkeitsauszählung, Zeit-Personen-Gitter)<br />
o durchführen der Beobachtung <strong>und</strong> dokumentieren<br />
o auswerten <strong>und</strong> interpretieren der Daten<br />
o beantworten der Fragestellung<br />
o entwickeln eines Maßnahmenkatalogs zum weiteren pädagogischen Handeln.<br />
Folgende Aspekte müssen in der strukturierten Beobachtung beachtet werden:<br />
Aus: „Bildungsplananteil zur frühen Sprachförderung im Kindergarten“ (Pilotversion, Juni 2008)<br />
Kapitel 8 von Luise Hollerer<br />
Frage Erläuterung<br />
Ziel Weshalb wird beobachtet? Definition von Zielen, die eine Beobachtung verfolgt: z.B.<br />
Anhaltspunkte für Elterngespräche finden, Kriterien für die<br />
Zuerkennung von speziellen Fördermaßnahmen festlegen,<br />
Fokus Wer wird beobachtet?<br />
Was wird beobachtet?<br />
…<br />
Definition von Personen: z.B. Kind, Elternteil, … <strong>und</strong><br />
der genauen Kriterien, auf die sich Beobachtung richtet:<br />
z.B. sprachliche Fähigkeiten wie Aussprache, Wortschatz,<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 7<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Satzkonstruktion, Verständnis, Kontaktaufnahme …<br />
Form Wie wird beobachtet? Entscheidung, welche Form der Beobachtung gewählt wird.<br />
Für den pädagogischen Bereich im Kindergarten eignen sich:<br />
Aktive Beobachtung: Die beobachtende Person nimmt am<br />
Geschehen teil <strong>und</strong> beobachtet das Kind/die Kinder während<br />
der Durchführung der Aktivität.<br />
Passiv teilnehmende Beobachtung:<br />
Die beobachtende Person greift eine gewisse Zeit nicht in<br />
das Geschehen ein <strong>und</strong> zieht sich auf die<br />
Rahmen<br />
Wann wird beobachtet?<br />
Wie lange wird beobachtet?<br />
Wo wird beobachtet?<br />
Wo genau?<br />
Womit wird beobachtet?<br />
In welchem Setting?<br />
Durch welche Person?<br />
Beobachtungsposition zurück.<br />
Definition des Beobachtungsrahmens:<br />
Zeitpunkt: z.B. zu verschiedenen Zeiten im Tagesablauf,<br />
immer morgens, in der Abholsituation, …<br />
Zeitrahmen: für jedes Kind gleich lang, entsprechend dem<br />
Handlungsverlauf, …<br />
Ort: Kindergarten, Schule, ...<br />
Räumlichkeit: abgeschlossener Raum, in einer Ecke des<br />
Gruppenraums, …<br />
Material: freies Material, vorgegebenes oder normiertes<br />
Material aus Screeningverfahren oder Tests, …<br />
Sozialform: Einzelsetting, Kleingruppen-,<br />
Großgruppensetting, …<br />
Beobachterin / Beobachter: Kindergartenpädagog/in,<br />
Pädagog/in aus einer anderen Institution, Psycholog/in,<br />
Therapeut/in, …<br />
Ausgewählte Beobachtungsfehler<br />
„Beobachtungen liefern keine Abbilder, sondern (Re-)Konstruktionen der Wirklichkeit!<br />
(Kany & Schöler, 2007, S.108)<br />
Erster Eindruck (Primacy-Effekt)<br />
Die meisten Eindrücke, die man von einem Menschen sammelt, werden vom ersten<br />
Eindruck, den man von diesem Menschen gemacht hat, geprägt <strong>und</strong> beeinflusst<br />
(dieser erste Eindruck wirkt wie ein Wahrnehmungsfilter).<br />
Halo-Effekt<br />
Ein auffallendes Merkmal eines Menschen strahlt auf andere Persönlichkeitszüge<br />
bzw. auf die Beurteilung der gesamten Situation aus.<br />
Beispiel: Ein Kind, das ungepflegt aussieht, wird auch für weniger intelligent<br />
gehalten.<br />
Kontrastfehler<br />
Ein bestimmtes Verhalten wirkt jeweils anders, je nachdem, in welcher Umgebung<br />
(räumlich, zeitlich, personenbezogen) es wahrgenommen wird bzw. nach welchen<br />
vorangegangenen Erlebnissen es wahrgenommen wird.<br />
Self-fulfilling prophecy<br />
Entwicklung, Verhalten <strong>und</strong> Leistung von Kindern ist davon abhängig, welche<br />
Erwartungen man in sie setzt – beobachtetes Verhalten ist auch von den jeweiligen<br />
Erwartungen in diesen Menschen abhängig.<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 8<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Kategorisierungstendenzen<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe werden Personen<br />
Eigenschaften zugeschrieben, die man <strong>als</strong> typisch für diese Gruppe erachtet.<br />
Projektionsfehler<br />
Eigene positive <strong>und</strong> negative Eigenschaften werden auch anderen zugeschrieben,<br />
vor allem, wenn es äußere Ähnlichkeiten oder Sympathien gibt.<br />
Beobachtungen werden aufgr<strong>und</strong> eigener Probleme interpretiert.<br />
Beispiel: Alleinspiel wird <strong>als</strong> Schüchternheit interpretiert.<br />
Tendenz zur Mitte-Effekt<br />
Tendenz der Beurteilerin, Extremwerte zu vermeiden.<br />
Milde- oder Strenge--Effekt<br />
Positive Beobachtungsverschiebung bei vorliegender Sympathie, negative<br />
Beobachtungsergebnisse bei Antipathie.<br />
Beispiel: Aggressives Verhalten wird verständnisvoll beurteilt, wenn die Beobachterin<br />
das Kind mag.<br />
Ermüdung<br />
Die Aufmerksamkeit nimmt teils unbemerkt im Laufe der Beobachtung ab.<br />
Beobachterin oder Ansprechperson?<br />
Die Beobachterin wird abgelenkt, wenn sie auch <strong>als</strong> Ansprechperson für Kinder (bei<br />
Fragen der Kinder, bei Konflikten etc.) zur Verfügung steht.<br />
Möglichkeiten zur Verminderung der Fehleranfälligkeit:<br />
o Beobachtung erfolgt regelmäßig<br />
o Mehrer Personen beobachten das gleiche Kind <strong>und</strong> tauschen sich über die<br />
Beobachtungsergebnisse aus.<br />
Beobachtungsverfahren<br />
Mit Beobachtungsverfahren werden kontinuierlich <strong>und</strong> über einen längeren Zeitraum<br />
Erkenntnisse über Fähigkeiten eines Kindes gesammelt <strong>und</strong> dokumentiert. Sie<br />
stellen die Gr<strong>und</strong>lage für weitere individuelle Fördermaßnahmen dar.<br />
Strichliste (Häufigkeitsauszählung)<br />
Damit können präzise definierte Einzelfaktoren aus dem Strom der<br />
Kindergarten/Unterrichtsereignisse herausgehoben <strong>und</strong> deren Häufigkeit innerhalb<br />
eines bestimmten Zeitraums festgehalten werden.<br />
Zeit-Personen-Gitter<br />
Es wird in einem Raster schriftlich festgehalten, was ausgewählte Kinder zu<br />
bestimmten festgelegten Zeitpunkten im Tagesablauf/im Unterrichtsgeschehen<br />
machen/sagen.<br />
Narratives Protokoll/Freie Schilderung<br />
Dies ist eine umgangssprachliche Aufzeichnung des Geschehens innerhalb eines<br />
definierten Ausschnitts des Alltags hinsichtlich ausgewählter Kategorien (ACHTUNG:<br />
diese müssen in Zusammenhang mit der eingangs definierten Fragestellung stehen!)<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 9<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
2.2 Dokumentationsformen der Beobachtung<br />
Mit Hilfe dokumentierter Beobachtung kann die Entwicklung der Bildungsprozesse<br />
des Kindes mitverfolgt werden.<br />
Kindergarten <strong>und</strong> Schule tragen gemeinsam Bildungsverantwortung <strong>und</strong> müssen<br />
sich daher über<br />
• Bildungsbegleitung<br />
• Bildungsförderung verständigen.<br />
Lernausgangsbestimmung:<br />
Regelmäßige Beobachtung <strong>und</strong> Lernstandsfeststellung können zu Ansatzpunkten für<br />
gezielte Förderung werden<br />
Dokumentationen<br />
• geben verlässlich Einblick in Entwicklung, Interessen, Fähigkeiten <strong>und</strong><br />
Fertigkeiten<br />
• erleichtern besseres Verständnis der Perspektive des Kindes, seines<br />
Lernverhaltens „Was ist gerade die Leistung des Kindes?“<br />
• unterstützen die Reflexion <strong>und</strong> Gestaltung pädagogischer Angebote <strong>und</strong><br />
Fördermaßnahmen<br />
• sind Basis des fachlichen Austauschs<br />
• sind Gr<strong>und</strong>lage für die Information der Eltern<br />
• ermöglichen Qualitätssicherung.<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Lerngeschichten<br />
zeigen auf, was in Kindergärten <strong>und</strong> Schulen an Lernen abseits der Curricula<br />
geschieht bzw. geleistet wird <strong>und</strong> setzen den Akzent auf individuelle Lernprozesse<br />
<strong>und</strong> –fortschritte. Ziel ist die Unterstützung individueller Lernprozesse.<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> steht die Interpretation beobachteten Lernens.<br />
Wenn Kinder beim Übergang in die Volksschule einige Lerngeschichten mitnehmen<br />
können, in denen dokumentiert ist, wie sie erfolgreich lernen können, wird ihr<br />
Bewusstsein gestärkt, dass sie kompetente Lerner sind <strong>und</strong> erfolgreich mit neuen<br />
Anforderungen umgehen können.<br />
(aus: Neuß, 2007)<br />
Schritt 1: Mehrere Beobachtungen werden ohne vorweggenommenen Bewertungen<br />
notiert.<br />
Schritt 2: In der Diskussion mit Kolleginnen werden verschiedene Perspektiven<br />
eingebracht.<br />
Schritt 3: Die Diskussionsergebnisse werden in Form einer Lerngeschichte<br />
(erzählend, emotional gefärbt <strong>und</strong> unter Einbeziehen der aktuellen<br />
Interessen <strong>und</strong> Fähigkeiten der Kinder) niedergeschrieben. Es werden die<br />
Stärken <strong>und</strong> Ressourcen des Kindes festgehalten.<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 10<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
Übergang Kindergarten – Volksschule<br />
≠ punktuelles Ereignis der Einschulung, sondern ein Prozess, der ein gutes Jahr<br />
vorher beginnen kann <strong>und</strong> bis weit in das erste Schuljahr hinein zu denken ist.<br />
„guter“ Übergang:<br />
• Es sollen möglichst keine schulpflichtigen Kinder vom Schulbesuch<br />
ausgeschlossen <strong>und</strong> zurück gestellt werden.<br />
• Es sollte jedes eingeschulte Kind die bestmögliche Diagnose <strong>und</strong> Förderung<br />
<strong>als</strong> Starthilfe erhalten.<br />
Es wird individuell <strong>und</strong> flexibel auf die bereits im Kindergarten festgestellten<br />
Fähigkeiten kontinuierlich Bezug genommen (= förderdiagnostisch begründeter<br />
differenzierter <strong>und</strong> individualisierter Anfangsunterricht)<br />
Begriff der Schulfähigkeit<br />
Schulfähigkeit aus ökosystemischer Perspektive ist abhängig von vier<br />
Teilkomponenten:<br />
• Schule mit spezifischen Strukturen<br />
• Kind mit individuellen Lernvoraussetzungen<br />
• familiäre <strong>und</strong> vorschulische Lernumweltbedingungen<br />
• gesellschaftliche Situation<br />
2.3 Einzelförderung, Kleingruppenarbeit:<br />
Führung <strong>und</strong> Förderung erfolgt durch Interaktionen (!) <strong>und</strong> durch das Stellen<br />
ausgewählter Aufgaben mit dem Ziel, kulturelle Inhalte, Denkweisen zu vermitteln.<br />
Dadurch kommt das Kind in die Zone der nächsten Entwicklung (es wächst über<br />
seine bisherigen Aufgaben hinaus).<br />
Durch optimale Anleitung (diese passt sich den bisherigen Erfolgen <strong>und</strong> Misserfolgen<br />
an) → kommt es zur Weiterentwicklung.<br />
Führen durch<br />
• vorzeigen <strong>und</strong> nachahmen lassen (Modell-Lernen)<br />
• anfangen <strong>und</strong> begonnene Aufgabe dem Kind überlassen<br />
• Kind löst schwierige Aufgabe mit einem anderen, kompetenteren Kind<br />
(Teamarbeit)<br />
• Lösungsprinzip erklären, hinführende Fragen stellen, Aufgabe gliedern<br />
(Coaching)<br />
• Feedback geben<br />
• Verstärkung durch Lob <strong>und</strong> Ermutigung<br />
→ der aktuellen kindlichen Entwicklung etwas voraus sein<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 11<br />
Mag. a Lisa Kneidinger
� Das Lernen erfolgt in vier Phasen:<br />
� Zeit haben, um mit neuen Aufgaben oder Materialien vertraut zu<br />
werden<br />
� anfangs starke, später abnehmende Unterstützung durch<br />
kompetente Personen<br />
� selbstständiger Umgang mit vergleichbaren Aufgaben <strong>und</strong> durch<br />
Üben (Wiederholung)<br />
� Das Kind hat Kompetenzen erworben <strong>und</strong> ausdifferenziert, agiert<br />
eigenständig <strong>und</strong> selbstverantwortlich!<br />
Erwachsene sind<br />
• Beobachter<br />
• Gestalter von Angeboten (ermöglichen die Teilnahme an authentischen<br />
kulturellen Praktiken), kompetente Partner<br />
• Dialogpartner im Sinne eines „bildenden Dialogs“ im Gespräch durch Fragen,<br />
Erläuterungen<br />
• Teilnehmer am Lernprozess: sie beteiligen sich am Lösen von Aufgaben<br />
• Brückenbauer zwischen Bekanntem <strong>und</strong> Unbekanntem<br />
• Verhaltensmodell, Wissensvermittler<br />
Ziel ist Selbstkontrolle <strong>und</strong> Selbstregulierung von Lernprozessen!<br />
Beobachtung - Pädagnostik - Lernstandsfeststellung<br />
• geht den Weg vom vermuteten Wissen, Beurteilen <strong>und</strong> Festschreiben zum<br />
Fragen, Ergründen <strong>und</strong> Suchen!<br />
• will Menschen verstehen, nicht durchschauen!<br />
• hilft bei der Entwicklung individuell passender Angebote!<br />
Literatur:<br />
Becker-Stoll, Fabienne & Textor, Martin (Hrsg.)(2007). Die Erzieherin-Kind-Beziehung.<br />
Berlin: Cornelson SCRIPTOR<br />
Kany, Werner & Schöler, Hermann (2007). Fokus: Sprachdiagnostik. Leitfaden zur<br />
Sprachstandsbestimmung im Kindergarten. Berlin: Cornelsen SCRIPTOR<br />
Lipp-Peetz, Christine (Hrsg.)(2007). Praxis Beobachtung. Auf dem Weg zu individuellen<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsplänen. Berlin: Cornelsen SCRIPTOR<br />
Neuß, Norbert (Hrsg.)(2007). Bildungs- <strong>und</strong> Lerngeschichten im Kindergarten. Konzepte –<br />
Methoden – Beispiele. Berlin: Cornelson: SCRIPTOR<br />
Diskowski, Detlef & Hammes-Di Bernardo, Eva (Hrsg.) (2004). Lernkulturen <strong>und</strong><br />
Bildungsstandards. Kindergarten <strong>und</strong> Schule zwischen Vielfalt <strong>und</strong> Verbindlichkeit.<br />
Baltmannsweiler: Schneider Verlag<br />
Guldimann, Titus & Hauser, Bernhard (Hrsg.)(2005). Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder.<br />
Münster: Waxmann<br />
Samuelsson Pramling, Ingrid & Carlsson Aspl<strong>und</strong>, Maj (2007). Spielend lernen. Stärkung<br />
lernmethodischer Kompetenzen. Troisdorf: Bildungsverlag EINS<br />
PädagogInnen <strong>als</strong> <strong>kindzentrierte</strong> LernbegleiterInnen Seite 12<br />
Mag. a Lisa Kneidinger