- Seite 4 und 5: Bibliografische Informationen der D
- Seite 6 und 7: Wissenschaftliche Betreuung: Univ.-
- Seite 9 und 10: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 7 2
- Seite 11 und 12: 1 Einleitung 7 Medicus curat, natur
- Seite 13 und 14: 9 Der Schreiber des als Grundlage d
- Seite 15 und 16: 11 3 Die Handschrift und ihr Schrei
- Seite 17: 13 forlaufenden Paginierung von Sei
- Seite 21 und 22: 17 3.1.3 Authentizität Um Zweifel
- Seite 23 und 24: 19 In dem als Grundlage dienenden M
- Seite 25 und 26: *Da es technisch nicht möglich war
- Seite 27 und 28: 23 teils aus schriftlichen Nachrich
- Seite 29 und 30: 25 Ecke der Petersilienstraße befa
- Seite 31 und 32: 27 Abb. 11: Reisedokument für Geor
- Seite 33 und 34: 29 Abb. 12: Reisepass von Georg Wil
- Seite 35 und 36: 31 Georg Wilhelm begann schließlic
- Seite 37 und 38: 33 Wir Professoren der Königl. Pre
- Seite 39 und 40: Transkription der Examensurkunde vo
- Seite 41 und 42: 37 Abb. 17: Versorgungsanweisung f
- Seite 43 und 44: Am 09. August 1814 erhielt Schrader
- Seite 45 und 46: 41 Am 27. März 1815 starb schließ
- Seite 47 und 48: 43 Bürger-Eyd „Ick lave und schw
- Seite 49 und 50: 45 Es gab etliche Briefwechsel zwis
- Seite 51 und 52: 47 Abb. 22: Alphabetisches Verzeich
- Seite 53 und 54: 49 Abb. 23: Bestätigung der Ernenn
- Seite 55 und 56: 51 Abb. 24: Altersbild Georg Wilhel
- Seite 57 und 58: 53 • Reisepaß des Studenten der
- Seite 59 und 60: Tab. 2 (Forts. u. Schluß) 55 1844
- Seite 61 und 62: 57 er schließlich durch seine „A
- Seite 63 und 64: Tab. 3 (Forts.) • On the diseases
- Seite 65 und 66: 4 Die Königliche Pferdearzneischul
- Seite 67 und 68: 63 4.2 Der Unterricht unter Haveman
- Seite 69 und 70:
65 Verfertigung der Arzneien“. Un
- Seite 71 und 72:
5 Die Handschrift 5.1 Methodik der
- Seite 73 und 74:
69 • j = das letzte der Einheitsz
- Seite 75 und 76:
71 Spiritus, reitzender nro 40 Merc
- Seite 77 und 78:
73 Tab. 5 (Forts. u. Schluß) Von d
- Seite 79 und 80:
75 Von den äußern Krankheiten der
- Seite 81 und 82:
Seite 1 Von den Wunden. Unter Wunde
- Seite 83 und 84:
Heilung befördert. Das beste und s
- Seite 85 und 86:
hohen Grad erreichen, braucht man d
- Seite 87 und 88:
Kräuterbrühe no 7 oder man lößt
- Seite 89 und 90:
Um solche Wunden geschickt und gesc
- Seite 91 und 92:
zunächst vom Reitze hervorgebracht
- Seite 93 und 94:
Seite 19 Stichwunden. Man trifft si
- Seite 95 und 96:
Unbequemlichkeit verursachen. Seite
- Seite 97 und 98:
Thiere in Form einer Latwerge tägl
- Seite 99 und 100:
geheilt haben. Die beste Behandlung
- Seite 101 und 102:
Von den Wunden der Augen. Die Augen
- Seite 103 und 104:
und die Entzündung vermehren. Das
- Seite 105 und 106:
eine Fontanelle eines Guldens groß
- Seite 107 und 108:
Tagen. Ist das Thier nicht sehr fet
- Seite 109 und 110:
von der Salbe no 2 darauf bis zur H
- Seite 111 und 112:
machen, oder ein kleines Setaceum m
- Seite 113 und 114:
Seite 49 Da aber der Brandfleck har
- Seite 115 und 116:
angefreßenen Knochen, Bändern u.s
- Seite 117 und 118:
täglich einigemal so wie auch die
- Seite 119 und 120:
französischen und deutschen Thier
- Seite 121 und 122:
Seite 62 Wird man also vom Eigenth
- Seite 123 und 124:
Knöchelgelenk legen. Ist die Wunde
- Seite 125 und 126:
davon alle 4 Stunden 1/2 ℔, klein
- Seite 127 und 128:
können. Man erkennt, daß sich ein
- Seite 129 und 130:
125 Seite 75 Seite 75 Von den Fiste
- Seite 131 und 132:
Abfluß hat. Ist dies geschehen, so
- Seite 133 und 134:
ehaupten, daß der Grund hiervon in
- Seite 135 und 136:
schreiten, die man auf nachstehende
- Seite 137 und 138:
Speichelfisteln sind, jenachdem gro
- Seite 139 und 140:
man sieht sich auch zu weilen bei s
- Seite 141 und 142:
Von den Hodensack oder Samenstrang-
- Seite 143 und 144:
Kann an dies aber nicht, und erstre
- Seite 145 und 146:
5.3.2 Heft 2 141 Abb. 29: Titelblat
- Seite 147 und 148:
143 Abb. 30: Zeichnung Schraders zu
- Seite 149 und 150:
werden; denn die Zähne sitzen bei
- Seite 151 und 152:
denn die Zähne sitzen bei den Pfer
- Seite 153 und 154:
her. 4., Aeußerlich sieth man gew
- Seite 155 und 156:
wenn man nichts widernatürliches b
- Seite 157 und 158:
Seite 14 wenn sie mal stark strapaz
- Seite 159 und 160:
einen schaukelnden und unsichern Ga
- Seite 161 und 162:
Gewöhnlich entsteht er, wenn die P
- Seite 163 und 164:
an folgenden Zeichen: 1., Das Köth
- Seite 165 und 166:
oft bei den Fuhrmannspferden vorfä
- Seite 167 und 168:
Pferde keine Lähmung und sind von
- Seite 169 und 170:
Seite 33 Mitteln wählen welches ma
- Seite 171 und 172:
zu ziehen. Es entsteht zuweilen die
- Seite 173 und 174:
Seite 39 Von den Gallen überhaupt.
- Seite 175 und 176:
meisten zu fürchten. Die Kennzeich
- Seite 177 und 178:
der Kniebeuge statt findet. Im geme
- Seite 179 und 180:
wenigern Geschwulst des leidenden S
- Seite 181 und 182:
Gesezt aber die Mauke will ungeacht
- Seite 183 und 184:
anderen bedupft man die Feuchtwarze
- Seite 185 und 186:
heraus, so muß man statt der eben
- Seite 187 und 188:
Seite 62 so gehört sie mit zu den
- Seite 189 und 190:
Vom Spatt. Der Spatt ist eine Krank
- Seite 191 und 192:
auf die angewiesene Art rechts heru
- Seite 193 und 194:
wird, so wird in diesem Falle in de
- Seite 195 und 196:
eigentliche Ursache und den Sitz de
- Seite 197 und 198:
herunter gleiten zu können. Ist di
- Seite 199 und 200:
von Knochensäften, welche sich unt
- Seite 201 und 202:
würde gewiß von großen Nutzen se
- Seite 203 und 204:
denn der H D. Hav. hat eine Erfahru
- Seite 205 und 206:
wiederum zum Kreislauf der Säfte
- Seite 207 und 208:
5.3.3 Heft 3 203 Abb. 31: Titelblat
- Seite 209 und 210:
205 Von der Knochenausweichung Inha
- Seite 211 und 212:
Befestigunugstheile zernichtet sind
- Seite 213 und 214:
Von der Verrenkung des Halses. Obgl
- Seite 215 und 216:
nicht zusammengepreßt, oder auf ei
- Seite 217 und 218:
Seite 11 Von dem Bruch des Hufbeins
- Seite 219 und 220:
Von der Gegenwart eines zerbrochene
- Seite 221 und 222:
Seite 16 eine Schiene von Schachtel
- Seite 223 und 224:
Seite 19 zu lose noch zu fest angel
- Seite 225 und 226:
dem Finger über die Rippen herfäh
- Seite 227 und 228:
Gewalt möglich. Seite 24 Heilung v
- Seite 229 und 230:
Seite 26 Uebrigens bemerkt man nich
- Seite 231 und 232:
man Beispiele hat, daß wenn sie ni
- Seite 233 und 234:
Wolstein behauptet, daß die Nabelb
- Seite 235 und 236:
sobald sich aber der bruch einklemm
- Seite 237 und 238:
Seite 39 Der Netzbruch. Von diesem
- Seite 239 und 240:
eines gewißen Insekts erzeugt wür
- Seite 241 und 242:
diesen Fällen sowohl bei Menschen
- Seite 243 und 244:
Gästen sehr viele zugegen, so find
- Seite 245 und 246:
Waßer u. dgl. m, allein bei Pferde
- Seite 247 und 248:
esteht darin, daß dem Hunde ein kl
- Seite 249 und 250:
Wunde stark ausbrennen, um nachher
- Seite 251 und 252:
gar nicht mehr auf die Beine zu bri
- Seite 253 und 254:
mit den andern Pferden wie gewöhnl
- Seite 255 und 256:
Seite 78 Nro 3. Verschiedene Beispi
- Seite 257 und 258:
war auch derselbe, nur mit dem Unte
- Seite 259 und 260:
Seite 85 Stunde mit diesem Pferde o
- Seite 261 und 262:
Urinröhre waren fast gar nicht ges
- Seite 263 und 264:
Reuter daraufsaß, auf einem uneben
- Seite 265 und 266:
261 An dieser Stelle folgen nun 5 l
- Seite 267 und 268:
263 6.1.1 Textvergleich am Beispiel
- Seite 269 und 270:
265 6.1.1.3 Dritter Textvergleich a
- Seite 271 und 272:
267 6.1.2.2 Zweiter Textvergleich a
- Seite 273 und 274:
269 6.1.3 Textvergleich am Beispiel
- Seite 275 und 276:
271 6.1.3.3 Dritter Textvergleich a
- Seite 277 und 278:
• Prognose (Vorhersagung) • Beh
- Seite 279 und 280:
• Applocitisches Wesen (o. J.)
- Seite 281 und 282:
277 Unterrichtsgeschehen, sondern e
- Seite 283 und 284:
279 verstehen. Doch hat man wenigst
- Seite 285 und 286:
281 Wilhelm Ellenberger und Hermann
- Seite 287 und 288:
283 führen könnte, auch das beste
- Seite 289 und 290:
285 Durch das Auffinden dieses sehr
- Seite 291 und 292:
287 Abb. 34: Ende des Briefes von S
- Seite 293 und 294:
289 Nachlass, der sich im Eigentum
- Seite 295 und 296:
9 Summary 291 Urban, Kathrin: Georg
- Seite 297 und 298:
10 Anhang 293 10.1 Übersicht über
- Seite 299 und 300:
Anhang 2 (Forts.) 295 Kapitel Thema
- Seite 301 und 302:
Anhang 2 (Forts. u. Schluß) 297 Ka
- Seite 303 und 304:
299 10.4 Stammtafel der Familie Sch
- Seite 305 und 306:
301 Lorenz Meyer, Eduard (1896): Wa
- Seite 307 und 308:
303 Leipzig 1911., S. 83; Permalink
- Seite 309 und 310:
305 Abb. 22: Alphabetisches Verzeic
- Seite 311 und 312:
14 Danksagung 307 „Leider läßt


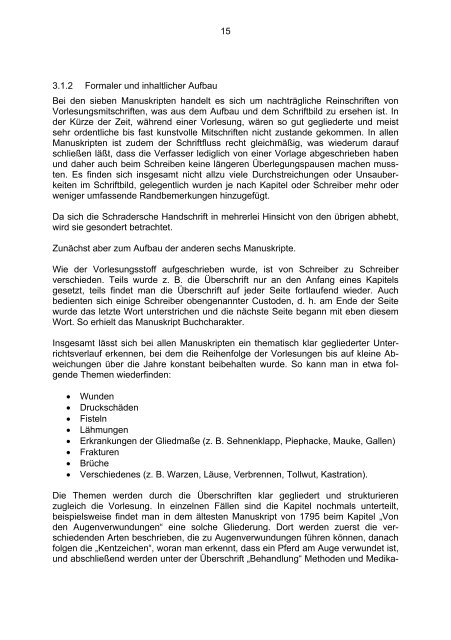



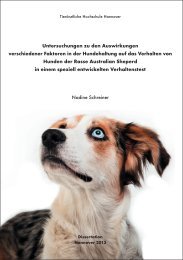



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






