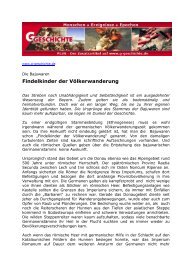Prof. Christian Feest - G/Geschichte
Prof. Christian Feest - G/Geschichte
Prof. Christian Feest - G/Geschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.g-geschichte.de<br />
„Die Möglichkeit von anderen Kulturen zu lernen, ist immer gegeben!“<br />
Interview mit <strong>Prof</strong>. Dr. <strong>Christian</strong> <strong>Feest</strong><br />
<strong>Prof</strong>. Dr. <strong>Christian</strong> <strong>Feest</strong> hat sich in den<br />
vergangenen 45 Jahren intensiv mit den Indianern<br />
Nordamerikas beschäftigt und wurde so zu einem<br />
ihrer führenden Kenner. Der ehemalige Direktor des<br />
Museums für Völkerkunde in Wien (2004-2010) ist<br />
derzeit Kurator der Ausstellung „Indianer – Die<br />
Ureinwohner Nordamerikas“ im Lokschuppen<br />
Rosenheim.<br />
Gibt es überhaupt Indianer<br />
Als Kolumbus auf dem Seeweg nach Indien auf den amerikanischen Kontinent und seine<br />
vorgelagerten Inseln stieß, hielt er die dortigen Anwohner für „Indios“. Das Wort wurde im<br />
Deutschen bis ins 19. Jahrhundert meist als „Inder“ oder „Indier“ übersetzt. Erst im 19.<br />
Jahrhundert setzte sich der heutige Sprachgebrauch „Indianer“ für die Urbevölkerungen<br />
Amerikas durch. Zur Zeit des Kolumbus hatten diese nach Tausenden zählenden Völker<br />
des Doppelkontinents keine Ahnung, dass sie etwas gemeinsam haben sollten, oder gar,<br />
dass sie „Indianer“ waren. Lange Zeit war die Bezeichnung „Indianer“ also lediglich ein<br />
Versuch der Europäer, die angetroffenen kulturelle Vielfalt auf einen Nenner zu bringen.<br />
Ein Gemeinschaftsgefühl als „Indianer“ entstand erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
auf der Grundlage der gemeinsamen Erfahrung der europäischen Eroberung und setzte<br />
sich nur langsam und niemals vollständig durch. Auch heute noch sind die Mitglieder der<br />
Stämme in erster Linie „Irokesen“ oder „Lakota“ oder „Hopi“ und nur daneben auch<br />
„Indianer“. Eine zunehmende Anzahl von Personen hat allerdings die Bindung an einen<br />
spezifischen Stamm verloren – und die sind heute eben auch nur „Indianer“.<br />
Welche falschen Klischees haben wir<br />
Es gibt natürlich keine richtigen Klischees, aber auch wenn sie falsch sind, enthalten<br />
Klischees meist einen wahren Kern. Der Irrtum besteht darin, dass man für einzelne<br />
Gruppen typische Eigenschaften auf alle „Indianer“ ausdehnt.
Wir denken uns den typischen „Indianer“ als jemanden, der eine prächtige Federhaube<br />
trägt; aber solche Federhauben gab es hauptsächlich bei den Völkern der<br />
Steppenlandschaften des zentralen Nordamerika, bei denen sie Abzeichen von<br />
Funktionären von Kriegergesellschaften waren.<br />
Ein neuzeitliches Klischee ist, dass die Indianer „Naturschützer“ und „Ökologen“ waren.<br />
Alle Völker kannten sich zwar gut mit der Natur aus, weil das Teil ihres Überlebens war,<br />
und sie gingen mit der Natur anders um, schon allein weil sie technisch gar nicht in der<br />
Lage waren, die Natur ernsthaft zu gefährden. Mit den von den Europäern eingeführten<br />
Stahlfallen trugen aber die Pelzhandel tätigen Völker auch dazu bei, ganze Tierarten in<br />
bestimmten Gebieten auszurotten. Erst aus dieser Erfahrung erwuchsen die ersten<br />
Ansätze zu Verhaltensweisen, mit denen solche Folgen vermieden werden sollten.<br />
Selbst, dass alle „Indianer“ kriegerisch waren, kann man so nicht sagen. Jede Gruppe<br />
versuchte natürlich ihr Überleben auch mit Waffengewalt zu schützen; aber manche<br />
zogen es vor, kriegerischen Konflikten auszuweichen, vor allem, wenn sie ihre<br />
Unterlegenheit erkannten. Wahrscheinlich hat sogar nur eine Minderheit der Stämme je<br />
Krieg gegen die Amerikaner geführt, aber diejenigen, die es taten haben auch besonders<br />
stark unser Bild vom „Indianer“ geprägt.<br />
Was ist das Einzigartige an der Ausstellung im Lokschuppen Rosenheim<br />
Die Ausstellung versucht, anstatt „Indianer“ zu zeigen, wo es keine gibt, anhand von<br />
einzelnen <strong>Geschichte</strong>n die kulturelle Vielfalt und die unterschiedlichen historischen<br />
Erfahrungen der Ureinwohner Nordamerikas sichtbar zu machen.<br />
Auch wenn die Ausstellung und ihr Rahmenprogramm den Aspekt der<br />
Familienfreundlichkeit und des Erlebnischarakters betont, so ist gibt es auch andere<br />
Möglichkeiten, die Ausstellung zu sehen und zu erleben, als durch Bogenschießen und<br />
Anschleichen.<br />
Die <strong>Geschichte</strong> der Urbevölkerungen Nordamerikas führt uns anschaulich vor Augen,<br />
dass das, was wir heute als Globalisierung kennen, dass genau diese<br />
Globalisierungsprozesse das Leben der nordamerikanischen Ureinwohner bereits seit<br />
500 Jahren bestimmt haben: Massive Zuwanderungsbewegungen gibt es nicht erst seit<br />
heute bei uns, sie haben Amerika in den vergangenen Jahrhunderten erst zu dem<br />
gemacht, was es heute ist. Globale Wirtschaftszusammenhänge, deren Ursachen und<br />
Auswirkungen auf der lokalen Ebene oft nicht erklärt werden können, haben auch im<br />
eingeborenen Nordamerika bislang nicht gekannte Abhängigkeiten geschaffen.<br />
Welche Veränderungen brachte der Kontakt mit den Europäern<br />
Zuerst brachte der Kontakt für die Urbevölkerungen die Möglichkeit, neue Dinge, die sie<br />
selbst nicht herstellen konnten wie etwa Glasperlen, Eisengeräte, eine Vielzahl von<br />
Textilien, Gewehre und andere nützliche Gerätschaften zu erwerben. Umgekehrt brachte<br />
der Verkauf von Tierfellen an die Pelzhändler vielfach großen Reichtum mit sich.<br />
Gleichzeitig führten die aus Europa eingeschleppten Krankheiten zu einer raschen<br />
Verminderung der Bevölkerung, zum Verlöschen ganzer Völker, beziehungsweise zur<br />
Umgruppierung von Bevölkerungen.<br />
In Gebieten mit weißer Siedlungskolonisation war rascher Landverlust eine wichtige<br />
Konsequenz. Die Stämme wurden von den besten Ländern verdrängt, um Platz für den<br />
ständigen Zustrom von Siedlern zu schaffen, so dass heute nur noch ein Prozent der<br />
Landoberfläche der USA im Besitz der Nachkommen der Urbevölkerung sind. Dort wo –<br />
wie etwa in Teilen von Kanada oder in Grönland – lange Zeit eine reine<br />
Handelskolonisation vorherrschte, blieb das Land zu einem größeren Teil in indigenem<br />
Besitz.
Schließlich war der Verlust der Souveränität und die entstehenden Abhängigkeit von den<br />
neuen Nationalstaaten eine der wichtigsten und einschneidendsten Veränderungen für<br />
die Urbevölkerungen.<br />
Gab es auch Ansätze einer friedlichen Koexistenz<br />
Die meisten europäischen Kolonialmächte gingen davon aus, dass die Urbevölkerungen<br />
ihnen dafür dankbar sein sollten, dass sie durch den Kontakt mit der Welt der Weißen in<br />
den Genuss der Segnungen der Zivilisation kämen. Und die meisten Kolonialmächte<br />
gingen auch davon aus, dass am Ende die „indianischen“ Bevölkerungen Teil der<br />
größeren Gesellschaft würden. Ausrottungskriege waren deshalb relativ selten, der<br />
Versuch, die Anpassung an westliche Normen auch mit Gewalt durchzusetzen, schon viel<br />
häufiger. In Gebieten mit Handelskolonisation heirateten viele Händler in die Stämme ein,<br />
mit denen sie Geschäfte machten, und wurden so wenigstens teilweise auch Teile dieser<br />
Gesellschaften. Und auch die Missionstätigkeit sollte zu einem friedlichen Miteinander<br />
von Urbevölkerung und Zuwanderern beitragen: Vor Gott waren am Ende alle Teil einer<br />
weltweiten Christengemeinde.<br />
Welche Folgen hatte die Missionstätigkeit<br />
Das christliche Missionsgebot war stets eines der stärksten Argumente der<br />
Kolonisatoren. Hier gab es einen göttlichen Auftrag, in alle Welt zu gehen, um die Völker<br />
zur wahren Religion zu führen. Die Auswirkungen waren freilich nicht immer im Sinne der<br />
biblischen Lehren.<br />
Wenn in der Ausstellung beschrieben wird, dass um die Mitte des 19. Jahrhunderts die<br />
Ottawa und Menominee im Gebiet der Großen Seen überwiegend Katholiken wurden und<br />
in dieser Religion auch eine Chance für wirtschaftlichen Erfolg und Anerkennung in der<br />
amerikanischen Gesellschaft sahen, dann heißt das nicht, dass das überall so der Fall<br />
war; auch wenn sich alle Völker mit dem Christentum auseinandersetzen mussten und<br />
viele am Schluss darin eine mögliche Lösung der Probleme sahen, die sich aus dem<br />
Leben in einer von den europäischen Invasoren veränderten Welt und dem<br />
Autoritätsverlust der traditionellen Religion ergaben. Vielleicht konnten die Priester der<br />
Weißen, ja jene Krankheiten heilen, die die Siedler aus Europa mitgebracht hatten, und<br />
gegen die die Medizinmänner keinen Rat wussten.<br />
Was unterscheidet Grönland von anderen Kulturen Nordamerikas<br />
Das kalte und für Europäer unwirtliche Grönland hat besonders wenig weiße Siedler<br />
angelockt, und die, die trotzdem kamen, haben sich oft genug an die für das Überleben<br />
notwendigen Praktiken der Kallaalit angepasst. Die rasche protestantische<br />
<strong>Christian</strong>isierung Westgrönlands führte auch dazu, dass die Sprache der Kallaalit rasch<br />
zur Schriftsprache wurde – Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Grönland für etwas mehr<br />
als 5000 Einwohner zwei Druckereien, die Bücher und Zeitschriften in grönländischer<br />
Sprache druckten. Vor allem in den größeren Orten entstand in diesem Umfeld eine Art<br />
bürgerliche Gesellschaft, die Eskimoisches und Europäisches vereinte. Diese Faktoren<br />
haben dazu beigetragen, dass Grönland als erstes Gebiet in Nordamerika auch<br />
politischen Autonomiestatus erlangen konnte, obwohl man das vielleicht eher bei einer<br />
bäuerlichen Bevölkerung, als bei einem Volk von Jägern und Fischern erwartet hätte.<br />
Was können wir Europäer von den Ureinwohnern Nordamerikas lernen<br />
Die Möglichkeit, von anderen Kulturen zu lernen, ist immer und überall gegeben, und in<br />
der Tat zeigen Untersuchungen, dass die Entwicklung der Menschheit stets dadurch
gefördert wurde, dass man von den Anderen etwas gelernt hat. Dabei geht es nicht<br />
darum, dass wir von den Eskimos den Kajak und den Anorak übernommen haben, von<br />
den Maisbau treibenden Völkern verschiedene Maisgerichte und von den Stämmen des<br />
östlichen Nordamerikas das Pfeifenrauchen. Es geht ganz allgemein darum, dass die<br />
Kulturen der nordamerikanischen Ureinwohner einen Teil jener Palette von Möglichkeiten<br />
repräsentieren, mit denen Menschen die allen Menschen gemeinen Probleme zu lösen<br />
versucht haben. Und wenn man aus der <strong>Geschichte</strong> des „indianischen“ Nordamerika<br />
etwas lernen möchte, so ist es, dass Überleben auch unter äußerst schwierigen<br />
Bedingungen möglich ist. Am besten sind dabei jene Völker gefahren, die einen<br />
Kompromiss zwischen der Bewahrung von Tradition und der Anpassung an eine stets<br />
verändernde Welt finden konnten.<br />
Wie sehen Sie die Zukunft der indianischen Völker und ihrer Kultur<br />
Ich bin nicht im Prophetengeschäft tätig und habe große Zweifel daran, dass man Trends,<br />
die sich aus der <strong>Geschichte</strong> ablesen lassen, linear fortschreiben kann. Die meisten<br />
Vorhersagen der Vergangenheit haben grandiosen Schiffbruch erlitten.<br />
Allgemein würde ich meinen, dass der Unterschiedlichkeit der Vergangenheit der Völker<br />
auch eine Unterschiedlichkeit der Zukunft entsprechen wird. Manche Völker werden<br />
stärker in der Lage sein, ihre Identität und traditionelle Elemente der Kultur zu erhalten,<br />
als andere. Man kann aber davon ausgehen, dass es bei allen Verschiedenheiten in der<br />
Entwicklung auch gewisse Gemeinsamkeiten geben wird. So ist der Verlust der indigenen<br />
Sprachen wohl langfristig kaum aufzuhalten sein. Allein in den vergangenen 40 Jahren ist<br />
rund ein Drittel der nordamerikanischen „Indianersprachen“ verschwunden; selbst dort,<br />
wo es noch mehr als 100.000 Sprecher gibt, zum Beispiel bei den Navajo, Cree, Ojibwa,<br />
und die absolute Zahl der Sprecher steigt, sinkt der Prozentsatz der Sprecher in der<br />
Bevölkerung.<br />
Grundsätzlich fördern Prozesse der Globalisierung nicht nur die weltweite Verbreitung<br />
von Gütern und Information und die Ortsveränderung von Personen – und damit den<br />
kulturellen Austausch. Gleichzeitig stärken dieselben Prozesses auch das Bewusstsein<br />
für die lokalen und regionalen Besonderheiten und den Wunsch, diese Besonderheiten<br />
zu erhalten. Vor diesem Hintergrund mache ich mir wenig Sorgen darüber, dass die<br />
Vielfalt der nordamerikanischen Urbevölkerungen so bald verloren gehen könnte – auch,<br />
wenn es in den nächsten Jahrzehnten immer mehr „Indianer“ geben wird, die keine<br />
Träger spezifischer Traditionen sind.<br />
Was fasziniert Sie persönlich am meisten an den Ureinwohnern Amerikas<br />
Wenn das aus den bisherigen Antworten nicht klar geworden sein sollte: Ihre kulturelle<br />
Vielfalt und ihr Überleben unter schwierigen Bedingungen.<br />
Interview: Klaus Hillingmeier