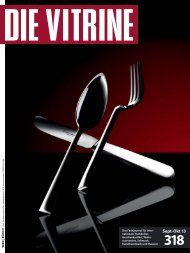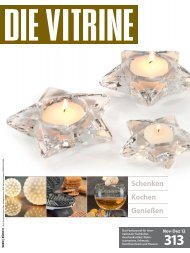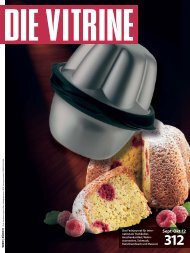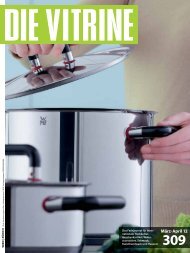on 09:00 - 20:00 Uhr on 09:00 - 20:00 Uhr - Die Vitrine
on 09:00 - 20:00 Uhr on 09:00 - 20:00 Uhr - Die Vitrine
on 09:00 - 20:00 Uhr on 09:00 - 20:00 Uhr - Die Vitrine
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jenaer Glas: Durchblick – die Küche als Labor<br />
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms zur Designgeschichte<br />
des <strong>20</strong>. Jahrhunderts zeigt das Wagner-Werk Museum<br />
Postsparkasse noch bis 18. August <strong>20</strong>12 die S<strong>on</strong>derausstellung<br />
„Durchblick – Jenaer Glas, Bauhaus und die Küche als<br />
Labor“. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte die Firma<br />
Schott in Jena ein völlig neuartiges hitzebeständiges Glas für<br />
den Haushaltsbereich. <strong>Die</strong> K<strong>on</strong>sumenten waren aber gegenüber<br />
dem undekorierten durchsichtigen Glas skeptisch. Für sie<br />
schien es eher für ein Labor als für eine Küche geeignet. Schott<br />
erkannte, dass derart moderne Produkte nicht ohne Formgestaltung<br />
und Werbung erfolgreich verkauft werden k<strong>on</strong>nten.<br />
Es beauftragte Künstler, die im benachbarten Weimar, später<br />
in Dessau am Bauhaus lehrten oder studiert hatten, um dem<br />
noch unbekannten Produkt Gestalt und Image zu geben.<br />
Beim Hauptk<strong>on</strong>kurrenten „Corning Glassworks“ in den<br />
Vereinigten Staaten wurde während des Ersten Weltkriegs<br />
ebenfalls ein hitzebeständiges Glas entwickelt, das als Haushaltsglas<br />
unter dem Handelsnamen „Pyrex“ bekannt wurde.<br />
An diesem Vorbild sollte sich nun auch der Jenaer Betrieb orientieren,<br />
um einen neuen Markt zu erschließen. Ab 1918<br />
wurde daher erstmals eine gläserne Milchflasche angeboten.<br />
Spurey: Japanische Teeinspirati<strong>on</strong>en<br />
Drei Jahre später folgten Teegläser und kurz darauf das „Durax“<br />
Backgeschirr. Schott wurde zu einem wichtigen Partner<br />
für die künstlerische Moderne. Im Auftrag der Firma Schott<br />
entwickelte Gerhard Marcks die Grundform der Kaffeemaschine<br />
„Sintrax“ aus der Kombinati<strong>on</strong> v<strong>on</strong> Zylinder und Halbkugelformen<br />
und schuf damit die erste künstlerisch gestaltete<br />
Industrieform aus Jenaer-Glas. Großen Absatz fanden die<br />
neuen Hauswirtschaftsgläser aber noch immer nicht, noch<br />
standen die K<strong>on</strong>sumenten dem Glas skeptisch gegenüber.<br />
Daher engagierte Schott 1931 Wilhelm Wagenknecht<br />
als freiberuflichen Mitarbeiter und Produktgestalter und holte<br />
László Moholy-Nagy für eine zeitgemäße Werbung nach<br />
Jena. Gemeinsam schafften sie den Durchbruch und Erfolg<br />
des Jenaer Glases. Sowohl die gestalterischen Akzente v<strong>on</strong><br />
Gerhard Marcks und vor allem v<strong>on</strong> Wilhelm Wagenfeld als<br />
auch die Ideen und Werbek<strong>on</strong>zepte v<strong>on</strong> László Moholy-Nagy<br />
werden in der Ausstellung im Wagner-Werk Museum großzügig<br />
und gek<strong>on</strong>nt präsentiert. Mit Jahresende 2<strong>00</strong>5 wurde<br />
die Haushaltsglasfertigung in Jena eingestellt. Seit 1. Jänner<br />
2<strong>00</strong>6 erfolgt die Produkti<strong>on</strong> v<strong>on</strong> Jenaer Glas durch die Zwiesel<br />
Kristallglas AG in der niederbayerischen Stadt Zwiesel.<br />
Kultur kompakt<br />
Eierbecher,<br />
Design Wilhelm<br />
Wagenfeld (o. li.)<br />
Ausschnitt aus<br />
einem der<br />
Werbek<strong>on</strong>zepte<br />
v<strong>on</strong> lászló<br />
Moholy-Nagy<br />
(o. M.)<br />
Teekanne<br />
v<strong>on</strong> Wilhelm<br />
Wagenfeld,<br />
hergestellt in<br />
Jena (o. re.)<br />
V<strong>on</strong> Oktober <strong>20</strong><strong>09</strong> bis März <strong>20</strong>10 fand im Museum für Angewandte Kunst in Wien<br />
die Ausstellung „Chawan – Teeschalen“ statt. Kurt Spurey – seit Jahrzehnten einer<br />
der profiliertesten künstlerischen Keramiker Österreichs – ließ sich v<strong>on</strong> den japanischen<br />
Teeschalen inspirieren und setzte diese in zeitgerechte künstlerische Formen<br />
um, führte das Thema aber gleichzeitig weiter. Er wählte für seine Arbeiten den japanischen<br />
Titel – obwohl seine Schalen zum Gebrauch nicht geeignet sind – aufgrund des hohen Standards der Qualität und Ästhetik der japanischen<br />
Keramik. Er bricht am Weg zur „brauchbaren Schale“ die Arbeit ab und belässt<br />
das Stadium des unvollendeten. So hat jedes Keramikobjekt seine unwiederholbare<br />
Form. Kurt Spurey verzichtet auf den Einsatz der traditi<strong>on</strong>ellen Drehscheibe. im Formen,<br />
Drücken und Schneiden kommt seine Kraft zum Ausdruck. Darüber hinaus experimentiert<br />
er mit Brand und Glasuren. Er wählt die japanische Raku-Technik für den<br />
Brand, die den „Zufall“ als Gestaltungselement für seine Arbeiten verstärkt.<br />
in vier Farben und vier Formen präsentiert Kurt Spurey bis 19. August 1<strong>20</strong> Schalen<br />
in der Schausammlung Asien des Museums für Angewandte Kunst in Wien.<br />
DIE VITRINE 311 Juli-AuGuST 12<br />
39