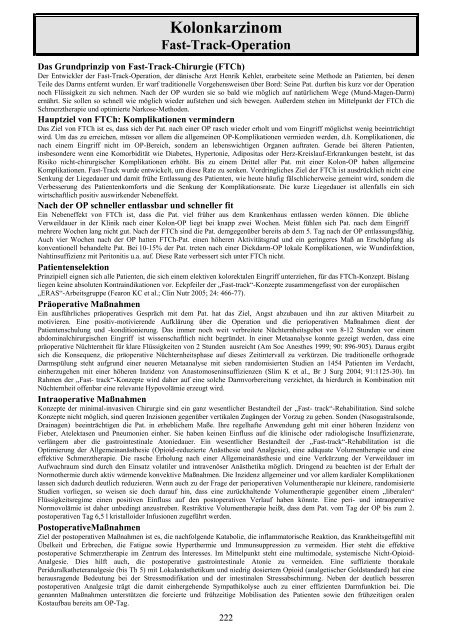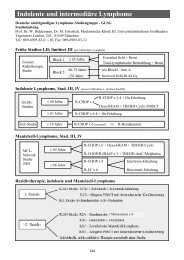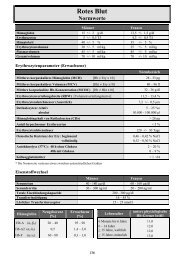Kolorektale Karzinome - Klinik für Hämatologie und Onkologie ...
Kolorektale Karzinome - Klinik für Hämatologie und Onkologie ...
Kolorektale Karzinome - Klinik für Hämatologie und Onkologie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kolonkarzinom<br />
Fast-Track-Operation<br />
Das Gr<strong>und</strong>prinzip von Fast-Track-Chirurgie (FTCh)<br />
Der Entwickler der Fast-Track-Operation, der dänische Arzt Henrik Kehlet, erarbeitete seine Methode an Patienten, bei denen<br />
Teile des Darms entfernt wurden. Er warf traditionelle Vorgehensweisen über Bord: Seine Pat. durften bis kurz vor der Operation<br />
noch Flüssigkeit zu sich nehmen. Nach der OP wurden sie so bald wie möglich auf natürlichem Wege (M<strong>und</strong>-Magen-Darm)<br />
ernährt. Sie sollen so schnell wie möglich wieder aufstehen <strong>und</strong> sich bewegen. Außerdem stehen im Mittelpunkt der FTCh die<br />
Schmerztherapie <strong>und</strong> optimierte Narkose-Methoden.<br />
Hauptziel von FTCh: Komplikationen vermindern<br />
Das Ziel von FTCh ist es, dass sich der Pat. nach einer OP rasch wieder erholt <strong>und</strong> vom Eingriff möglichst wenig beeinträchtigt<br />
wird. Um das zu erreichen, müssen vor allem die allgemeinen OP-Komplikationen vermieden werden, d.h. Komplikationen, die<br />
nach einem Eingriff nicht im OP-Bereich, sondern an lebenswichtigen Organen auftraten. Gerade bei älteren Patienten,<br />
insbesondere wenn eine Komorbidität wie Diabetes, Hypertonie, Adipositas oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht, ist das<br />
Risiko nicht-chirurgischer Komplikationen erhöht. Bis zu einem Drittel aller Pat. mit einer Kolon-OP haben allgemeine<br />
Komplikationen. Fast-Track wurde entwickelt, um diese Rate zu senken. Vordringliches Ziel der FTCh ist ausdrücklich nicht eine<br />
Senkung der Liegedauer <strong>und</strong> damit frühe Entlassung des Patienten, wie heute häufig fälschlicherweise gemeint wird, sondern die<br />
Verbesserung des Patientenkomforts <strong>und</strong> die Senkung der Komplikationsrate. Die kurze Liegedauer ist allenfalls ein sich<br />
wirtschaftlich positiv auswirkender Nebeneffekt.<br />
Nach der OP schneller entlassbar <strong>und</strong> schneller fit<br />
Ein Nebeneffekt von FTCh ist, dass die Pat. viel früher aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Die übliche<br />
Verweildauer in der <strong>Klinik</strong> nach einer Kolon-OP liegt bei knapp zwei Wochen. Meist fühlen sich Pat. nach dem Eingriff<br />
mehrere Wochen lang nicht gut. Nach der FTCh sind die Pat. demgegenüber bereits ab dem 5. Tag nach der OP entlassungsfähig.<br />
Auch vier Wochen nach der OP hatten FTCh-Pat. einen höheren Aktivitätsgrad <strong>und</strong> ein geringeres Maß an Erschöpfung als<br />
konventionell behandelte Pat. Bei 10-15% der Pat. treten nach einer Dickdarm-OP lokale Komplikationen, wie W<strong>und</strong>infektion,<br />
Nahtinsuffizienz mit Peritonitis u.a. auf. Diese Rate verbessert sich unter FTCh nicht.<br />
Patientenselektion<br />
Prinzipiell eignen sich alle Patienten, die sich einem elektiven kolorektalen Eingriff unterziehen, für das FTCh-Konzept. Bislang<br />
liegen keine absoluten Kontraindikationen vor. Eckpfeiler der „Fast-track“-Konzepte zusammengefasst von der europäischen<br />
„ERAS“-Arbeitsgruppe (Fearon KC et al.; Clin Nutr 2005; 24: 466-77).<br />
Präoperative Maßnahmen<br />
Ein ausführliches präoperatives Gespräch mit dem Pat. hat das Ziel, Angst abzubauen <strong>und</strong> ihn zur aktiven Mitarbeit zu<br />
motivieren. Eine positiv-motivierende Aufklärung über die Operation <strong>und</strong> die perioperativen Maßnahmen dient der<br />
Patientenschulung <strong>und</strong> -konditionierung. Das immer noch weit verbreitete Nüchternheitsgebot von 8-12 St<strong>und</strong>en vor einem<br />
abdominalchirurgischen Eingriff ist wissenschaftlich nicht begründet. In einer Metaanalyse konnte gezeigt werden, dass eine<br />
präoperative Nüchternheit für klare Flüssigkeiten von 2 St<strong>und</strong>en ausreicht (Am Soc Anesthes 1999; 90: 896-905). Daraus ergibt<br />
sich die Konsequenz, die präoperative Nüchternheitsphase auf dieses Zeitintervall zu verkürzen. Die traditionelle orthograde<br />
Darmspülung steht aufgr<strong>und</strong> einer neueren Metaanalyse mit sieben randomisierten Studien an 1454 Patienten im Verdacht,<br />
einherzugehen mit einer höheren Inzidenz von Anastomoseninsuffizienzen (Slim K et al., Br J Surg 2004; 91:1125-30). Im<br />
Rahmen der „Fast- track“-Konzepte wird daher auf eine solche Darmvorbereitung verzichtet, da hierdurch in Kombination mit<br />
Nüchternheit offenbar eine relevante Hypovolämie erzeugt wird.<br />
Intraoperative Maßnahmen<br />
Konzepte der minimal-invasiven Chirurgie sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der „Fast- track“-Rehabilitation. Sind solche<br />
Konzepte nicht möglich, sind queren Inzisionen gegenüber vertikalen Zugängen der Vorzug zu geben. Sonden (Nasogastralsonde,<br />
Drainagen) beeinträchtigen die Pat. in erheblichem Maße. Ihre regelhafte Anwendung geht mit einer höheren Inzidenz von<br />
Fieber, Atelektasen <strong>und</strong> Pneumonien einher. Sie haben keinen Einfluss auf die klinische oder radiologische Insuffizienzrate,<br />
verlängern aber die gastrointestinale Atoniedauer. Ein wesentlicher Bestandteil der „Fast-track“-Rehabilitation ist die<br />
Optimierung der Allgemeinanästhesie (Opioid-reduzierte Anästhesie <strong>und</strong> Analgesie), eine adäquate Volumentherapie <strong>und</strong> eine<br />
effektive Schmerztherapie. Die rasche Erholung nach einer Allgemeinanästhesie <strong>und</strong> eine Verkürzung der Verweildauer im<br />
Aufwachraum sind durch den Einsatz volatiler <strong>und</strong> intravenöser Anästhetika möglich. Dringend zu beachten ist der Erhalt der<br />
Normothermie durch aktiv wärmende konvektive Maßnahmen. Die Inzidenz allgemeiner <strong>und</strong> vor allem kardialer Komplikationen<br />
lassen sich dadurch deutlich reduzieren. Wenn auch zu der Frage der perioperativen Volumentherapie nur kleinere, randomisierte<br />
Studien vorliegen, so weisen sie doch darauf hin, dass eine zurückhaltende Volumentherapie gegenüber einem „liberalen“<br />
Flüssigkeitsregime einen positiven Einfluss auf den postoperativen Verlauf haben könnte. Eine peri- <strong>und</strong> intraoperative<br />
Normovolämie ist daher unbedingt anzustreben. Restriktive Volumentherapie heißt, dass dem Pat. vom Tag der OP bis zum 2.<br />
postoperativen Tag 6,5 l kristalloider Infusionen zugeführt werden.<br />
PostoperativeMaßnahmen<br />
Ziel der postoperativen Maßnahmen ist es, die nachfolgende Katabolie, die inflammatorische Reaktion, das Krankheitsgefühl mit<br />
Übelkeit <strong>und</strong> Erbrechen, die Fatigue sowie Hyperthermie <strong>und</strong> Immunsuppression zu vermeiden. Hier steht die effektive<br />
postoperative Schmerztherapie im Zentrum des Interesses. Im Mittelpunkt steht eine multimodale, systemische Nicht-Opioid-<br />
Analgesie. Dies hilft auch, die postoperative gastrointestinale Atonie zu vermeiden. Eine suffiziente thorakale<br />
Periduralkatheteranalgesie (bis Th 5) mit Lokalanästhetikum <strong>und</strong> niedrig dosiertem Opioid (analgetischer Goldstandard) hat eine<br />
herausragende Bedeutung bei der Stressmodifikation <strong>und</strong> der intestinalen Stressabschirmung. Neben der deutlich besseren<br />
postoperativen Analgesie trägt die damit einhergehende Sympathikolyse auch zu einer effizienten Darmfunktion bei. Die<br />
genannten Maßnahmen unterstützen die forcierte <strong>und</strong> frühzeitige Mobilisation des Patienten sowie den frühzeitigen oralen<br />
Kostaufbau bereits am OP-Tag.<br />
222