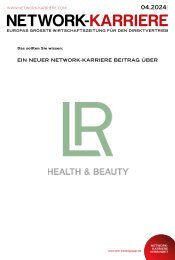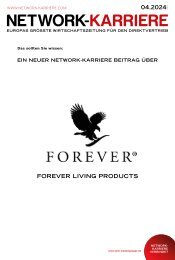Nutrition-Press
Freiheit für gesunde Nahrung - ein Schritt weiter!
Freiheit für gesunde Nahrung - ein Schritt weiter!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe Nr. 6 – Februar 2015 · 4,95 Euro · ISSN 21958505<br />
www.nutrition-press.com<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Fachzeitschrift für Mikronährstoffe<br />
Thomas Büttner<br />
Neue Rechtsprechung<br />
zur Health Claims<br />
Verordnung<br />
Delia Germeroth<br />
Fisetin – ein sekundärer<br />
Pflanzenstoff mit vielen<br />
Wirkungen<br />
Andreas Binninger<br />
Was ist gesunde<br />
Ernährung?<br />
Manfred Scheffler<br />
Freiheit und Gerechtigkeit<br />
kommen<br />
selten von allein<br />
Mikronährstoffe<br />
Vitalstoffe<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Hersteller und Vertriebe<br />
Europäischer Gerichtshof, Luxemburg<br />
Freiheit für gesunde Nahrung –<br />
ein Schritt weiter!<br />
Etappensieg für den Verbraucher erreicht
NEM e.V.<br />
Jetzt anno 2015 ist unser Verband bereits 9 Jahre für den<br />
Mittelstand der Gesundheitsbranche erfolgreich aktiv. Der<br />
jährliche Branchentreff – unsere Workshops für lebensmittelrechtliche<br />
und ernährungswissenschaftliche Themen<br />
und eben mittelstandsorientierte Themen – beschränkt<br />
sich nicht auf Erläuterungen, sondern setzt Maßstäbe für<br />
unsere Gesellschaft.<br />
✔<br />
Freiheit für<br />
gesunde Nahrung<br />
VORTEILE DER MITGLIEDSCHAFT / LEISTUNGSKATALOG<br />
Fachjuristen, Sachverständige, Institute, Labore, Rechtschutz kosten deutlich weniger:<br />
1. Teilnahme an NEM-Seminaren fast 50% günstiger.<br />
2. Verkehrsfähigkeitsprüfungen von Rezepturen .<br />
3. Verkehrsfähigkeitsprüfungen von Rohstoffen .<br />
4. Verkehrsfähigkeitsprüfungen von Kennzeichnungen / Etiketten.<br />
5. Verkehrsfähigkeitsprüfungen von wettbewerbsrechtlichen Fragen, Prüfungen von<br />
Werbebroschüren .<br />
6. Erstellung von Gutachten hinsichtlich lebensmittelrechtlicher Fragen, Geschäftsvertragsprüfung<br />
von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen etc., Prüfung von Webseiten, Online-<br />
Shops etc., Prüfung von AGBs, Vertragsgestaltung Herstellungsverträge und Vertriebsverträge.<br />
7. Juristische Beratung bei Abmahnungen durch Wettbewerber, Verbraucherverbände,<br />
Behörden etc.<br />
8. Anmeldungsberatung von Health Claims.<br />
9. Anmeldungsberatung von diätetischen Lebensmitteln.<br />
10. Beratung bei gesetzlichen Verstößen, Bußgeldern, bei strafrechtlichen Fällen.<br />
✔<br />
Größter europäischer<br />
Verband der Branche<br />
WERDEN SIE MITGLIED!<br />
Anmeldeformulare und Informationen über Mitgliedsbeiträge<br />
finden Sie unter: www.nem-ev.de<br />
✔<br />
Vertretung für<br />
den Mittelstand<br />
NEM Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren<br />
von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e. V.<br />
Horst-Uhlig-Straße 3 · D-56291 Laudert · Telefon +49 (0)6746/80298-20<br />
Telefax +49 (0)6746/80298-21 · E-Mail: info@nem-ev.de<br />
www.nem-ev.de
Editorial<br />
Freiheit und Gerechtigkeit kommen selten von allein<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />
Gute Nachrichten durch NEM – Aktivitäten<br />
1. Health Claims – überraschende Wende zeichnet sich ab!<br />
Weniger Verbote – mehr Infor ma tionsfreiheit für gesundheitsbezogene<br />
Aussagen. Der Verbraucher darf sich mit<br />
den mittelständischen Unternehmen richtig freuen.<br />
Nur noch etwas Geduld. Das Grundrecht eines Bürgers<br />
auf freie Meinungsäußerung wird wieder Gewicht bekommen.<br />
Am 06. Januar 2012 hat der NEM Verband Klage beim<br />
Europäischen Gericht einge reicht – gemeinsam mit<br />
einem Mitgliedsunternehmen. Die Gerichtsverhandlung<br />
fand am 23.10. 2014 in Luxemburg statt. Rechtsanwalt<br />
Dr. Büttner und meine Person in der Funktion als Prä si <br />
dent standen nun vor dem höchsten Gericht Europas. Ein<br />
Gefühl, das einen schon mit Stolz erfüllt, Gerechtigkeit<br />
zu erstreiten für den Ver braucher und den mittelständischen<br />
Un ternehmer – die Wirtschaftsbasis unserer<br />
Gesellschaft. Die Wirtschaftskraft in Deutschland wird<br />
durch 80 % der Mittelständler gestellt.<br />
Das Ergebnis: hier können wir nicht vorgreifen – das wäre<br />
nicht seriös. Das Urteil wurde noch nicht gesprochen. Bis<br />
zu 6 Monaten nach Gerichtsverhandlung kann es dauern,<br />
bis ein Urteil verkündet wird. Sobald das Urteil bekannt<br />
ist, wird es umgehend der Branche bekanntgegeben.<br />
2.Und jetzt kommt der 2. Streich, wie angekündigt,<br />
zu Novel Food.<br />
Früchte, Gemüse, Pilze, Gewürze, die nicht maßgeblich<br />
vor Mai 1997 im Europäischen Verkehr waren, dürfen zunächst<br />
nicht nach Europa rein, auch wenn diese Lebensmittel<br />
seit 1000 Jahren und mehr in anderen Ländern<br />
verspeist werden. Solche Lebensmittel dürfen nur auf<br />
den Markt, wenn sie über langwierige Prüf verfahren zugelassen<br />
wurden. Was für ein Schildbürgerstreich.<br />
Manfred Scheffler<br />
Präsident NEM e.V.<br />
Was die Novel Food Verordnung<br />
betrifft: hier bereitet und diskutiert<br />
man in den Behörden eine<br />
Neugestaltung. Jetzt gilt es, unseren<br />
Unmut nochmals kund<br />
zu tun. Es sollte mir keiner vorschreiben,<br />
was ich essen soll<br />
oder darf. Wir Bürger sind mündig<br />
genug, dies selbst zu entscheiden.<br />
Synthetische Lebensmittel<br />
auf Toxikologie zu prü fen,<br />
ist sicher zwingend erforderlich und genehmigungswürdig.<br />
Die Politik sollte erkennen, dass der Bürger nicht<br />
ständig bevormundet wird.<br />
Was tun wir:<br />
a) wir haben eine Petition initiiert, auf Deutsch, Englisch,<br />
Französisch (siehe www.nem-ev.de). Die wird den Europäischen<br />
Behörden etc. vorgelegt.<br />
b) wir werden Europa auffordern, den Bürger nicht für dumm<br />
zu verkaufen und gehen ins Gespräch mit den Behörden,<br />
dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat –<br />
und in die Medien.<br />
Vergessen wir nicht: wer die Macht über Lebensmittel<br />
hat, der hat die Macht über uns Bürger.<br />
Lebensmittel sind die Basis unserer Gesundheit. Fehlt der<br />
gesunde Menschen verstand bereits in der Politik und den<br />
Behörden, um dies zu erkennen?<br />
Bleiben Sie gesund und munter!<br />
Herzlichst Ihr<br />
Wir alle wissen, Zigaretten sind tödlich – sind aber auch<br />
erlaubt; besagte Lebensmittel werden erst einmal verboten.<br />
Gerade versucht man Vitalpilze zu Arzneimitteln<br />
zu machen (s. <strong>Press</strong>e mitteilung BfArM 2/15 vom<br />
06. 02. 2015) Was für ein krankhaftes Denken der Behörden<br />
und Politik. Oder sind hier andere Kräfte am Werk –<br />
na wer wohl?<br />
Manfred Scheffler<br />
Präsident NEM e.V.<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong> ist die offi zielle Zeitschrift des NEM e.V.<br />
Verband mittelständischer europäischer Hersteller und<br />
Distributoren von Nah rungs ergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten<br />
e.V.<br />
3
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Inhalt<br />
5 Neue Rechtsprechung zur Health Claims Verordnung • Dr. jur. Thomas Büttner<br />
11 Fisetin – ein sekundärer Pflanzenstoff mit vielen Wirkungen • Dipl. Troph Delia Gemeroth<br />
14 Was ist gesunde Ernährung? • Andreas Binninger<br />
16 Ergothionein in Pilzen – der oxidative Stress • Prof. Dr. Jan I. Lelley<br />
21 Alpha Liponsäure Chelatbildner bei Schwermetallbelastungen:<br />
Wissenschaftsfundierte Problemdarstellung • Strahinja Tomic<br />
26 Cayennepfeffer<br />
28 Kurkumin zur Behandlung der Atrophie bzw.<br />
tumorinduzierten Kachexie • Christopher Oelkrug, Dr. Andreas Schubert<br />
32 Chronische Erkrankungen ... und kein Ende in Sicht • Prof. Dr. Dr. Fred Harms<br />
36 Warum ist Homocystein so interessant? • Peter Abels<br />
40 Schwermetalle – Ein Revival alter Bekannter • Dr. rer. nat. Cornelia Friese-Wehr<br />
44 Indien – ein Markt für europäische Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik?!<br />
Indien – als Beschaffungsmarkt für Rohstoffe • Hon. Prof. Dr. Helmut Weidlich<br />
48 Gefahrstoffe im Griff: Neues Angebot für verbessertes Gefahrstoffmanagement• BG RCI<br />
49 eBay-Auktionen: Vorsicht beim Abbruch• ARAG<br />
Impressum<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Fachzeitschrift für Mikronährstoffe,<br />
Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel,<br />
Hersteller und Vertriebe<br />
Online-Ausgabe: ISSN 2195-8505<br />
Herausgeber: Elite Magazinverlags GmbH<br />
Boslerstraße 29 · 71088 Holzgerlingen<br />
Telefon:+49(0)7031/744-0 · Fax:+49(0)7031/744-195<br />
E-Mail: info@nutrition-press.com<br />
Chefredaktion: Bernd Seitz (V.i.S.d.P.)<br />
Leitender Redakteur: Manfred Scheffler<br />
Redaktion: Gabriele Thum M.A.<br />
Wissenschaftlicher Beirat:<br />
Dr. Gottfried Lange<br />
Prof. Dr. Kurt S. Zänker<br />
Juristischer Beirat: Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Gastautoren:<br />
Peter Abels<br />
Andreas Binninger<br />
Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Dr. rer. nat. Cornelia Friese-Wehr<br />
Dipl. Troph Delia Gemeroth<br />
Prof. Dr. Dr. Fred Harms<br />
Prof. Dr. Jan I. Lelley<br />
Christopher Oelkrug<br />
Dr. Andreas Schubert<br />
Manfred Scheffler<br />
Strahinja Tomic<br />
Hon. Prof. Dr. Helmut Weidlich<br />
Grafik/Layout: Melanie Wanner<br />
Projektleitung: Sanela Cutura<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Sandra Schneider, Telefon: +49 (0)7031/744-122<br />
E-Mail: info@nutrition-press.com<br />
Bildnachweis: fotolia.com, Peter Fuchs/shutterstock.com<br />
Erscheinungsweise: 2 mal pro Jahr:<br />
Februar, September<br />
Einzelpreis: 4,95 Euro, zzgl. Versandkosten<br />
Bestellung der Print-Ausgabe: info@nem-ev.de<br />
Print-Ausgabe: ISSN 2196-1271<br />
Online-Magazin und Media-Daten:<br />
kostenlos unter www.nutrition-press.com<br />
Printed in Germany<br />
Copyright-Hinweis: Die gesamten Inhalte des Magazins<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auf Konzept<br />
und Gestaltung: Elite Magazinverlags GmbH und NEM e.V..<br />
Vervielfältigungen jeglicher Art nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung der Elite Magazinverlags GmbH<br />
und des NEM e.V.. (alle Anschriften siehe Verlag)<br />
Offizielles Magazin des NEM e.V.:<br />
NEM Verband mittelständischer europäischer<br />
Hersteller und Distributoren von Nahrungs ergänzungsmitteln<br />
& Gesundheitsprodukten e.V.<br />
Horst-Uhlig-Str. 3, 56291 Laudert<br />
Telefon: +49 (0)6746/80 29 82 0<br />
Fax: +49 (0)6746/80 29 82 1<br />
E-Mail: info@nem-ev.de<br />
Internet: www.nem-ev.de<br />
4<br />
www.nutrition-press.com
Recht<br />
Neue Rechtsprechung<br />
zur Health Claims Verordnung<br />
Die Health Claims Verordnung 1924/2006/EG mit der VO 432/2012/<br />
EG halten nach wie vor die Lebensmittelindustrie in Atem.<br />
Die Zulässigkeit der Verwendung von nährwertbe<br />
zo genen – und gesundheitsbezogenen<br />
Aussagen für Lebensmittel ist aufgrund der gravierenden<br />
Änderungen der Rechtslage im Vergleich zu<br />
den Vorjahren ein beliebter Tummeplplatz für Abmahnvereine,<br />
Wettbewerber und Überwachungsbehörden.<br />
Nahezu jede Umverpackung, jeder Werbeflyer, jeder<br />
Internetauftritt wird kritisch auf mögliche Verstöße gegen<br />
die Health Claims Verordnung untersucht.<br />
1. Hierbei zeichnete sich in den ersten Jahren ein sehr<br />
restriktives Bild der Rechtsprechung, die die Verordnungen<br />
sehr eng und konservativ auslegte.<br />
Dies führte teilweise schon zu skurrilen Beanstandungen,<br />
wenn z.B. die Behörden sich daran störten, dass<br />
statt der Formulierung „Vitamin C trägt zur Verringerung<br />
von Müdigkeit und Ermüdung bei“ formuliert<br />
wurde „Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit<br />
und Erschöpfung bei“. Niemand wird erklären können,<br />
worin der Unterschied zwischen Müdigkeit und Ermüdung<br />
bestehen soll. Dies erst recht vor dem Hintergrund,<br />
dass die englische Formulierung des zugelassenen<br />
Claims „fatigue“ durchaus mit dem Begriff der Erschöpfung<br />
übersetzt werden kann.<br />
Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, wenn die Formulierung<br />
„Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des<br />
Immunsystems bei“ nicht gleichgesetzt werden dürfe<br />
mit der Formulierung „Vitamin C trägt zu einer gesunden<br />
Funktion des Immunsystems bei“. Denn es ist<br />
für den aufmerksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher<br />
klar, dass eine normale Funktion des Immunsystems<br />
eine gesunde Funktion des Immunsystems<br />
darstellt. Wenn die Funktion des Immunsystems nicht<br />
normal ist, kann sie auch nicht gesund sein. In einigen<br />
europäischen Ländern ist vor diesem Hintergrund auch<br />
akzeptiert, dass statt normale Funktion des Immunsystems<br />
auch „gesunde“ Funktion des Immunsystems<br />
formuliert werden kann.<br />
5
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Da nach Art. 5 Abs. 2 der VO 1924/2006/EG die Verwendung<br />
gesundheitsbezogener Angaben nur zulässig<br />
ist, wenn vom durchschnittlichen Verbraucher erwartet<br />
werden kann, dass er die positive Wirkung, wie sie in<br />
der Angabe dargestellt wird, versteht, halten wir vor<br />
diesem Hintergrund auch die Formulierung „gesund“<br />
für gleichbedeutend mit „normal“.<br />
2. Aktuell häufen sich jedoch auch Urteile, die für die<br />
Lebensmittelindustrie Licht am Ende des Health Claims<br />
Tunnels aufzeigen.<br />
So verweisen wir auf ein aktuelles Urteil des Landgerichts<br />
Würzburg vom 11. 07. 2014, Az. 1 HKO 882/14.<br />
Darin hat das Landgericht Würzburg bestätigt, dass ein<br />
Nahrungsergänzungsmittel prominent auf Inhaltsstoffe<br />
hinweisen darf, dass sie in dem Produkt enthalten sind<br />
und diese auch mit Mengenangaben in der Nährstofftabelle<br />
aufführen darf, ohne dass daraus auf eine Gesundheitsbezogenheit<br />
dieser Bestandteile des Produktes<br />
geschlossen werden darf.<br />
Überwachungsbehörden und Wettbewerbsverbände<br />
haben es in der Vergangenheit bereits beanstandet,<br />
dass z. B. die bekannten Zutaten von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
Glucosamin und Chondroitinsulfat auf<br />
Frontseiten von Nahrungsergänzungsmitteln abgebildet<br />
werden, die sich auf die GelenkGesundheit beziehen.<br />
Es ist bekannt, dass in der Vergangenheit Glucosaminsulfat<br />
und Chondroitinsulfat als Wirkstoffe für gelenkspezifi<br />
sche Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
beworben wurden. Im Rahmen der Health Claims Verordnung<br />
hatte jedoch die EFSA einen Nutzen dieser<br />
Stoffe auf der Grundlage der ihr von den jeweiligen Antragstellern<br />
vorgelegten Unterlagen als wissenschaftlich<br />
nicht ausreichend belegt qualifi ziert. Dagegen wurde<br />
z.B. für Vitamin C im Rahmen der VO 1924/2006/<br />
EG ausdrücklich anerkannt, dass Vitamin C zu einer<br />
normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion<br />
der Knochen und der normalen Knorpelfunktion beiträgt.<br />
Auch können für andere Botanicals, deren Bewertung<br />
noch zurückgestellt ist, entsprechende gelenkspezifi <br />
sche oder knorpelspezifi sche gesundheitsbezogene<br />
Aussagen weiterhin möglich sein. Eine Vielzahl von Anbietern<br />
verweist jedoch nach wie vor darauf, dass Glucosaminsulfat<br />
und Chondroitinsulfat in ihren Produkten<br />
„enthalten“ sind, ohne diesen Zutaten spezifi sche gesundheitsbezogene<br />
Wirkung zuzuschreiben.<br />
Das Landgericht Würzburg hat nun diese Praxis ausdrücklich<br />
als zulässig bestätigt.<br />
So heißt es in dem Urteil unter anderem wie folgt:<br />
„Die Angabe von Glucosamin- und Chondroitinsulfat auf<br />
der streitgegenständlichen Umverpackung der … Kapseln<br />
stellt keine „gesundheitsbezogene Angabe“ im Sinne<br />
des Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 Health Claims Verordnung dar,<br />
denn die Angabe suggeriert weder, noch bringt Sie mittelbar<br />
zum Ausdruck, dass zwischen den vorgenannten<br />
Bestandteilen des Nahrungsergänzungsmittels und der<br />
Gesundheit ein Zusammenhang besteht. … Da bezüglich<br />
der Inhaltsstoffe Glucosamin- und Chondroitinsulfat keine<br />
nähere Spezifizierung, für was die genannten Stoffe<br />
nützlich sein sollen, wie für die anderen vorgenannten<br />
Stoffe vorgenommen wird, wird ein Durchschnittsverbraucher,<br />
auf den es entscheidend ankommt, weil sich<br />
die Bewerbung der … durch die Beklagte grundsätzlich<br />
an die Gesamtheit der Verbraucher richtet … nicht davon<br />
ausgehen, dass Glucosamin- und Chondroitinsulfat eine<br />
spezifische gesundheitsbezogene Wirkung aufweisen. …<br />
Die Beklagte ist dabei allerdings nur an den von ihr selbst<br />
verwendeten Werbeaussagen zu messen, denn werbliche<br />
Äußerungen Dritter oder sonstiger Erfahrungswerte<br />
sind der Beklagten nicht zuzurechnen … Die Erwähnung<br />
der streitgegenständlichen Stoffe in der Nährwerttabelle<br />
lässt ebenso wenig auf die besondere Gesundheitsbezogenheit<br />
schließen. … Die Tatsache, dass Glucosaminund<br />
Chondroitinsulfat auf der Vorderseite der Umverpackung<br />
des Nahrungsergänzungsmittels genannt werden,<br />
ist darauf zurückzuführen, dass die … zu einem Großteil<br />
aus eben diesen Stoffen bestehen und damit zu ihren<br />
Hauptbestandteilen des Produktes zu zählen sind … Für<br />
Verbraucher kommt es auf die beworbene Wirkung des<br />
Produktes insgesamt und gerade nicht auf die Einzelheiten<br />
der chemischen Zusammensetzung an … Denn nach<br />
6
Recht<br />
beitragen, andererseits, dass sie eine ernährungsspezifische<br />
bzw. physiologische Wirkung aufweisen. In quantitativer<br />
Hinsicht sind Glucosamin- und Chondroitinsulfat<br />
charakteristisch für das streitgegenständliche Produkt,<br />
weil sie einen Großteil der Zusammensetzung ausmachen<br />
… Daneben ist die Angabe, dass die streitgegenständlichen<br />
… Kapseln Glucosamin- und Chondroitinsulfat<br />
enthalten, sachlich zutreffend. Die Angabe aller<br />
Inhaltsstoffe eines Präparates ist für den Verbraucher<br />
von überragendem Interesse, insbesondere dann, wenn<br />
eine bestimmte Zutat den Hauptbestandteil eines Erzeugnisses<br />
– wie hier Glucosaminsulfat – ausmacht.“<br />
Dieses Urteil des Landgerichts wurde vom Oberlandesgericht<br />
Bamberg mit Urteil vom 19.11.2014, Az.: 3 U<br />
159/14 bestätigt. Wir zitieren aus dem Urteil unter anderem<br />
wie folgt:<br />
Ansicht der Umverpackung darf der Verbraucher vorliegend<br />
ein Produkt erwarten, das sich positiv auf die Gesundheit<br />
seiner Gelenke auswirkt. Gerade diese beworbene<br />
Wirkung des Produktes ist vorliegend aber<br />
unstreitig, denn nachweislich unterstützen Vitamin C,<br />
Zink und Mangan gerade die Gelenkgesundheit…“<br />
Von besonderem Interesse ist ebenfalls, dass das Landgericht<br />
Würzburg bestätigt hat, dass die Angabe der<br />
Bestandteile Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat<br />
sogar eine Pfl ichtangabe für Nahrungsergänzungsmittel<br />
darstellt. Auch hierzu zitieren wir aus dem Urteil wie<br />
folgt:<br />
„Selbst wenn man dies anders sehen und das Vorliegen<br />
einer gesundheitbezogenen Angabe bejahen sollte, so<br />
würden die streitgegenständlichen Angaben als Pflichtangaben<br />
nicht dem Anwendungsbereich der Health Claims<br />
Verordnung unterfallen. Dies folgt aus Art. 1 Abs. 2 unter<br />
Abs. 1, 2 Abs. 2 Nr. 1 Health Claims Verordnung in Verbindung<br />
mit § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NemV. … Deshalb<br />
durften die streitgegenständlichen … Kapseln unter Angabe<br />
der Kategorien der Nährstoffe, die für das Erzeugnis<br />
kennzeichnend sind, in den Verkehr gebracht werden,<br />
§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NemV. Eine „Kennzeichnung“ in<br />
diesem Sinne setzt voraus, dass die fraglichen Inhaltsstoffe<br />
einerseits in quantitativer Hinsicht zur Ernährung<br />
„Eine Irreführung ist jedoch vorliegend, wie das Landgericht<br />
zu Recht ausgeführt hat, nicht zu erkennen. … Glucosaminsulfat<br />
und Chondroitinsulfat werden also in diesem<br />
Zusammenhang ausdrücklich als Wirkstoffträger<br />
nicht genannt. Aus der Umverpackung kann der (verständige)<br />
Verbraucher also nichts entnehmen, woraus sich<br />
der von dem Verfügungskläger gezogene Schluss einer<br />
gesundheitsfördernden Wirkung dieser beiden Bestandteile<br />
entnehmen lassen könnte. Dem Verbraucher wird<br />
also nichts suggeriert. Eine irreführende Bezeichnung<br />
nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 LFGB scheidet aus den vom Landgericht<br />
genannten Gründen aus. Das beworbene Produkt<br />
hat die ihm beigelegte Wirkung. … Mit den Bestandteilen<br />
des streitgegenständlichen Produktes Glucosaminsulfat<br />
und Chondroitinsulfaft wird jedoch auf der Umverpackung<br />
kein Gesundheitsbezug hergestellt, sondern diese<br />
werden, wie vorstehend erwähnt, als Inhaltsstoffe bezeichnet.<br />
Letztendlich ist die Auffassung des Landgerichts nicht zu<br />
beanstanden, dass jedenfalls die Listung der beiden Bestandteile<br />
nach § 4 Abs. 2 NemV erforderlich war.“<br />
Ebenfalls in diesem Sinne von Interesse ist ein aktuelles<br />
Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 28.08.2014,<br />
Az.: 14 C O 138/13 aus dem wir wie folgt zitieren:<br />
„Die mit dem Klageantrag … angegriffene … Angabe „B-<br />
Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und<br />
Gedächtnis“ ist zulässig. … Die Angabe „B-Vitamine und<br />
Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis“<br />
ist auf Grund der freigegebenen Health Claims für einzelne<br />
B-Vitamine und Zink, soweit sie auf diese bezogen<br />
gemacht wird, zulässig… Dabei gilt zunächst, dass der<br />
Verkehr die Angabe nicht dahingehend verstehen wird,<br />
dass für jedes einzelne B-Vitamin und für Zink jeweils<br />
sämtliche der genannten positiven Wirkungen ausgelobt<br />
werden. Denn es handelt sich ersichtlich um eine Zu<br />
7
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
sammenfassung mehrerer Bestandteile einerseits und<br />
verschiedener ausgelobter Wirkungen andererseits, so<br />
dass kein Anlass für ein solches Verständnis besteht.<br />
Dies legt auch die pauschale Bezugnahme auf B-Vitamine<br />
nahe. Denn der Verkehr wird nicht davon ausgehen,<br />
dass in dem Produkt sämtliche B-Vitamine enthalten<br />
sind, sondern erwarten, dass die dort enthaltenen Vitamine<br />
den ergänzenden Informationen entnehmen kann.<br />
Er wird gleichzeitig erwarten, dass er sich durch den weiteren<br />
Inhalt der Umverpackung bzw. der Gebrauchsinformation<br />
darüber informieren kann, welchem einzelnen<br />
Bestandteil welche der genannten positiven Wirkungen<br />
zugeschrieben wird … Die Inanspruchnahme einer positiven<br />
Wirkung auf Gehirn, Konzentration und Gedächtnis<br />
ist für die Vitamine B1, B5, B12 und Zink deshalb gerechtfertigt,<br />
weil für diese jeweils ein Health Claim betreffend<br />
eine positive Wirkung auf die psychische Funktion bzw.<br />
die geistige Leistung bzw. die kognitive Funktion freigegeben<br />
ist; für die Vitamine B1 und B12 umfasst der freigegebene<br />
Health Claim jeweils eine positive Wirkung auf<br />
das Nervensystem. Die verwendeten Angaben sind zwar<br />
nicht wortgleich mit den jeweils zugelassenen Health<br />
Claims, aber doch aus Verbrauchersicht gleichbedeutend<br />
im Sinne des Erwägungsgrundes Nr. 9 der HCVO,<br />
so dass die Benutzung nach Art. 10 HCVO zugelassen<br />
ist …<br />
Die Beklagte kann sich vorliegend auch dann auf die Zulassung<br />
der Health Claims für die einzelnen Vitamine und<br />
Nährstoffe berufen, wenn sie diese in einem Kombinationspräparat<br />
verwendet. Gegen die Auffassung der Klägerin,<br />
die Zulassung eines Health Claims für einen bestimmten<br />
Stoff greife schon dann nicht mehr, wenn<br />
dieser in einer Stoffkombination verwendet wird, spricht<br />
bereit, dass die Bedingungen für die Verwendung der Angaben<br />
für die für einzelne Stoffe zugelassene Health<br />
Claims, wie sie Gegenstand der Anlage zur VO EU-Nr.<br />
432/2012 vom 16. 05. 2012 sind, ausdrücklich die Verwendung<br />
in einer Stoffkombination vorsehen. Es besteht<br />
beispielsweise die Verwendung verschiedener Health<br />
Claims für den Einzelstoff Cholin jeweils unter der Bedingung,<br />
dass die Angabe für Lebensmittel verwendet wird,<br />
die mindestens 82,5 mg Cholin je 100 g oder 100 ml bzw.<br />
je Portion enthalten. Der Verordnungsgeber geht mithin<br />
gerade davon aus, dass eine Verwendung in einer Stoffkombination<br />
erfolgen wird, und knüpft dies lediglich an<br />
einzelne, hier unstreitig erfüllte Voraussetzungen. … Die<br />
angegriffene Werbeaussage ist auch nicht deshalb gemäß<br />
Art. 10 Abs. 1 HCVO unzulässig, weil jeweils ein Teil<br />
der angesprochenen Verkehrskreise die beanspruchte<br />
Wirkung auf „Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis“<br />
auf den Bestandteil der Ginkgo zurückführen<br />
würde, für den als Botanical (bislang) unstreitig kein entsprechender<br />
Health Claim freigegeben oder eine entsprechende<br />
Wirkung in der vorliegend empfohlenen Dosierung<br />
von der Beklagten auch nicht substantiiert<br />
behauptet worden ist. Denn bereits ein solches Verständnis<br />
jedenfalls eines Teils der angesprochenen Verkehrskreise<br />
lässt sich nicht feststellen.<br />
Der durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher,<br />
der der Werbung die in der Situation angemessene<br />
Aufmerksamkeit entgegenbringt … wird die<br />
unter … angegriffene Angabe, sobald sie sich auf der<br />
Umverpackung bzw. der Gebrauchsinformation befinden,<br />
jeweils dahingehend verstehen, dass ausschließlich<br />
den Bestandteilen „B-Vitamine und Zink“ je nach der<br />
Health Claims Verordnung genehmigten Wirkungen in der<br />
vorstehend wiedergegebenen Weise zugeschrieben werden,<br />
nicht aber auf den weiteren Bestandteil „Gingko“.<br />
Die wirkungsbezogene Werbeaussage wird nach ihrem<br />
unmissverständlichen Wortlaut ausdrücklich auf „B-Vitamine<br />
und Zink“ bezogen gemacht. An lass für ein an dem<br />
Produkt und damit an Gesundheitsfragen interessierten<br />
Verbraucher dafür, die Werbe aus sage auch auf ein anderen<br />
Produktbestandteil zu erstrecken, besteht nicht.<br />
… Die Hervorhebung des Bestandteil Gingko führt zwar<br />
dazu, dass er Ginkgo für den Hauptbestandteil des Produktes<br />
halten wird. Die Worte „B-Vitamine und Cholin“<br />
treten demgegenüber gleichzeitig aber nicht so zurück,<br />
dass sie von ihm nicht zur Kenntnis genommen würden.<br />
… Dem Ansatz, die Produktbezeichnung habe so eine<br />
starke assoziative Wirkung, dass der Verbraucher den<br />
Bestandteilen Ginkgo und Cholin gleichfalls die für die<br />
B-Vitamine und Zink ausgelobten Wirkungen zumessen<br />
würde, vermag die Kammer angesichts des eindeutigen<br />
Wortlautes der angegriffenen Angabe und dem sich auch<br />
durch den Kontext auftretenden Sprachverständnis mithin<br />
nicht zu folgen.<br />
... Da die hier angegriffene Angabe als Einführung der unmittelbaren<br />
Auflistung der auf die einzelnen Produktbestandteile<br />
bezogenen Health Claims vorangestellt ist und<br />
mit dieser räumlich in einem Kontext, wird der Verbraucher<br />
die angegriffene Angabe nicht ohne die nachfolgend<br />
wiedergegebenen, im Wortlaut dem Inhalt des<br />
Anhangs zur VO EU-Nr. 432/2012 vom 16. 05. 2012 entsprech<br />
ende Health Claims lesen. Denn es besteht kein<br />
Anlass für die Annahme, der Verbraucher, der sich mit<br />
dem „Kleingedruckten“ auf der Rückseite der Verpackungsbeilage<br />
bzw. dem Inhalt der Gebrauchsinformation<br />
befasst, werde dort nur eine Textpassage isoliert<br />
wahrnehmen, zumal die nachfolgenden Angaben teilweise<br />
noch durch Fettdruck hervorgehoben sind und deshalb<br />
besondere Aufmerksamkeit hervorrufen. Wenn der<br />
§<br />
8
Anzeige /<br />
Verbraucher aber den Text als Ganzes liest oder jedenfalls<br />
überfliegt, so kann er die hier angegriffene Textpassage<br />
in ihrem Kontext nur so verstehen, dass die positive<br />
Wirkung für Gehirn und Nerven nicht dem gesamten Produkt<br />
zugeordnet wird, sondern nur den unmittelbar nachstehend<br />
wiedergegeben einzelnen Bestandteilen.“<br />
Das Landgericht Düsseldorf hat somit klar bestätigt,<br />
dass zugelassene Health Claims auch für Kombinationsprodukte<br />
verwendet werden können. Darüber hinaus<br />
hat das Landgericht klargestellt, dass die Verbraucher<br />
die Werbetexte stets im Gesamtzusammenhang<br />
wahrnehmen und keine Werbeaussagen isoliert zu bewerten<br />
sind. Darüber hinaus hält das Landgericht auch<br />
kurze Zusammenfassungen auf der Frontseite der Verpackung<br />
für zulässig, wenn z.B. auf der Rückseite detailliertere<br />
Erläuterungen zu den einzelnen Claims erfolgen.<br />
Positiv zu bewerten ist auch, dass das Gericht für den<br />
Verbraucher vereinfachende Erläuterungen, wie „für<br />
Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis“ auch<br />
eine zulässige Umschreibung eines Claims wie „trägt<br />
zur normalen psychischen Funktion bei“ akzeptiert.<br />
§<br />
Dies entspricht schließlich auch den Maßstäben der<br />
aktuellen Rechtsprechung des BGH in seinem Urteil<br />
vom 9. Oktober 2014, Az.: I ZR 167/12 aus dem wir wie<br />
folgt zitieren:<br />
„Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die<br />
Beurteilung des Berufungsgerichts, die vom Kläger beanstandete<br />
Bezeichnung auf der Verpackung des Getränks<br />
der Beklagten sei eine Angabe im Sinne von<br />
Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-Nr. 1924/2006.<br />
9
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Dabei kann offenbleiben, ob die Beurteilung des Berufungsgericht<br />
zutrifft, die fragliche Bezeichnung sei keine<br />
nach dieser Bestimmung vom Anwendungsbereich<br />
der Verordnung EG-Nr. 1924/2006 ausgenommene obligatorische<br />
Angabe. Nicht zugestimmt werden kann<br />
jedenfalls der Beurteilung des Berufungsgerichts, die<br />
beanstandete Bezeichnung sei eine Angabe im Sinne<br />
von Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-Nummer<br />
1924/2006, wenn mit ihr zum Ausdruck gebracht<br />
werde, dass das in der Verpackung enthaltene Getränk<br />
besondere Eigenschaften besitze.<br />
Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Rechtsanwalt und<br />
lebensmittelrechtlicher<br />
Beirat des NEM e.V.<br />
… Eine solche Angabe liegt dann nicht vor, wenn eine<br />
Aussage oder Darstellung aus der Sicht der angesprochenen<br />
Verbraucher lediglich auf eine Eigenschaft eines<br />
Lebensmittels hinweist, die alle Lebensmittel der angesprochenen<br />
Gattung besitzen; in einem solchen Fall<br />
fehlt der Aussage oder Darstellung die Lenkungswirkung,<br />
deren Regulierung die Beschränkungen rechtfertigt,<br />
die die Verordnung EG-Nummer 1924/2006<br />
hinsichtlich der Verwendung nährwert- und ge sundheitsbezogener<br />
Angaben vorsieht … Informationen über<br />
Eigenschaften eines Lebensmittels stellen daher auch<br />
dann, wenn sie sich auf Nährstoffe oder andere Substanzen<br />
beziehen, keine Angaben im Sinne von Art. 2<br />
Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-Nr. 1924/2006 dar,<br />
wenn mit ihnen keine besonderen Eigenschaften des Lebensmittels<br />
herausgestellt, sondern lediglich objektive<br />
Informationen über die Beschaffenheit oder die Eigenschaft<br />
der Gattung von Lebensmitteln mitgeteilt werden,<br />
zu der das beworbene Lebensmittel gehört. Bei der in<br />
diesem Zusammenhang bei nährwertbezogenen Angaben<br />
im jeweiligen Einzelfall vorzunehmenden Abgrenzung<br />
sind Angaben über spezifische Inhaltsstoffe von<br />
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten die eine ernährungsphysiologische<br />
Funktion haben, zwar regelmäßig<br />
als Angaben über besondere Eigenschaften im Sinne von<br />
Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-Nr. 1924/2006<br />
anzusehen. Nach dem Erwägungsgrund 5 dieser Verordnung<br />
sind von der Anwendung jedoch allgemeine Bezeichnungen<br />
wie etwa „digestif“ oder „Hustenbonbon“<br />
auszunehmen, die traditionell zur Angabe einer Eigenschaft<br />
einer Kategorie von Lebensmitteln verwendet<br />
werden, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit<br />
haben können. Dementsprechend stellt eine Aussage<br />
oder Darstellung, die dem Verbraucher lediglich<br />
vermittelt, um welche Art von Lebensmittel es sich im<br />
konkreten Fall handelt, keine Angabe im Sinne von Art. 2<br />
Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-nummer 1924/2006<br />
dar.<br />
Nach diesen Maßstäben enthält die im Streitfall beanstandete<br />
Aufmachung des Produktes der Beklagten keine<br />
Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr.1 der Verordnung<br />
EG-Nummer 1924/2006. Bei der vom Berufungsgericht<br />
insoweit als maßgeblich angesehenen anregenden<br />
und stimulierenden Wirkung, auf die die Bezeichnung<br />
„Energy“ hinweist, handelt es sich aus der nach<br />
dem Erwägungsgrund 16 dieser Verordnung maßgeblichen<br />
Sicht des normal informierten, aufmerksamen und<br />
verständigen Durchschnittsverbrauchers um eine Eigenschaft,<br />
die bei jedem Energy-Drink vorliegt. … Die vom<br />
Berufungsgericht offengelassene Frage, ob der Verbraucher<br />
den Begriff „Energy“ als Abkürzung für das auf der<br />
Rückseite der Dose näher beschriebene Erfrischungsgetränk<br />
mit erhöhtem Koffeingehalt versteht, ist im Hinblick<br />
auf den Gesamteindruck, der von der vom Kläger<br />
beanstandeten Aufmachung ausgeht, zu bejahen. Es ist<br />
davon auszugehen, dass Verbraucher, die sich bei ihrer<br />
Kaufentscheidung für ein Lebensmittel nach dessen Zusammensetzung<br />
richten, regelmäßig zunächst das Zutatenverzeichnis<br />
lesen … Im Streitfall kann der angesprochene<br />
Verbraucher aus diesem Verzeichnis und den<br />
weiteren Angaben auf der beanstandeten Aufmachung<br />
des streitgegenständlichen Produktes ohne weiteres erkennen,<br />
dass es sich bei diesem Produkt um ein Mischgetränk<br />
handelt, das aus Wodka und einem Energy-Drink<br />
besteht. Die dadurch bedingte „energetische“ Wirkung<br />
dieses Getränks stellt damit einem solchen Getränk aus<br />
der Sicht des angesprochenen Verbrauchers entsprechende<br />
und deshalb keine besondere Eigenschaft im<br />
Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung EG-Nr.<br />
1924/2006 dar …“<br />
Im Ergebnis liegen somit nun mehrere aktuelle Urteile<br />
vor, die ausdrücklich bestätigen, dass die Verbraucher<br />
die Umverpackungen insgesamt wahrzunehmen haben<br />
und entgegen der bisherigen Rechtsprechung und insbesondere<br />
Behördenpraxis die Zulassungen nach der<br />
VO 1924/2006/EG und der VO 432/20012/EG doch<br />
etwas mehr Spielräume für die Werbung ermöglichen,<br />
als bisher angenommen.<br />
In jedem Einzelfall bedarf es naturgemäß einer intensiven<br />
Auseinandersetzung mit den zugelassenen Claims<br />
und der hierzu passenden Rechtsprechung.<br />
10
Ernährung / Prävention<br />
Fisetin – ein sekundärer<br />
Pflanzenstoff mit vielen<br />
Wirkungen<br />
Sekundäre Pfl anzeninhaltsstoffe oder auch Phytamine genannt,<br />
sind Naturstoffe, die von der Pfl anze nicht essentiell für die Aufrechterhaltung<br />
der Zelle benötigt werden. Jedoch haben sie einen<br />
hohen Stellenwert für den Menschen. In der Flora gibt es mannigfaltige<br />
Anwendungsgebiete. So dienen die sekun dären Pfl anzenstoffe<br />
u. a. dem Schutz vor Insektenfraß und vor UV-Strahlung.<br />
Aufgrund Ihrer Struktur werden die sekundären<br />
Pfl anzenstoffe in verschiedenen<br />
Klassen eingeteilt: Terpene, Polyphenole, stickstoffhaltige<br />
sekundäre Pfl anzenstoffe, Phytate und<br />
Proteine. Fisetin gehört zu der Gruppe der Polyphenole<br />
und ist als gelber Farbstoff, u. a. in dem Holz des<br />
Perücken strauches, den Flavonoiden zugeordnet. Diese<br />
fi ndet man vorwiegend in den äußeren Randschichten<br />
sowie den Blättern von Pfl anzen. Zudem kommt<br />
Fisetin in verschiedenen Früchten und Gemüsen vor,<br />
jedoch mit stark variiertem Gehalt (siehe Tabelle auf<br />
nächster Seite).<br />
11
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Nährstoff<br />
Gehalt an Fisetin<br />
[µg/g]<br />
Tomate 0,12<br />
Zwiebel 4,78<br />
Lotus 5,8<br />
Gurke 0,14<br />
Kiwi 2,03<br />
Pfi rsich 0,58<br />
Apfel 26,90<br />
Kakifrucht 10,50<br />
Traube 3,93<br />
Erdbeere 160,00<br />
Ein ungesunder Lebensstil und eine hohe Belastung mit<br />
Umweltgiften können jedoch dazu führen, dass der Körper<br />
nicht mehr alleine mit den freien Radikalen fertig<br />
wird und es zu einem Ungleichgewicht zwischen dem<br />
Auf und Abbau von freien Radikalen kommt.<br />
Tabelle 1: Gehalt an Fisetin in verschiedenen Früchten und<br />
Gemüsen 1<br />
Den Flavonoiden werden zahlreiche gesundheits fördernde<br />
Wirkungen nachgesagt. So sollen sie u. a.<br />
antioxidativ, antiinfl ammatorisch, antikanzerogen und immunmodulierend<br />
wirken. Diese Wirkungen werden<br />
durch Tierversuche sowie in vitro Studien bestätigt. Ihre<br />
Anwendungen auf den Menschen stehen daher in Diskussion.<br />
2, 3, 4<br />
Wirkung Fisetin<br />
Freie Radikale entstehen Tag für Tag in unserem Körper<br />
und spielen eine wichtige Rolle in zahlreichen biologischen<br />
Prozessen. Sie können jedoch auch gesundheitsschädliche<br />
Auswirkungen haben und sind u. a.<br />
an der Entstehung von Krebs, Arteriosklerose und<br />
Alzheimer beteiligt. Um einen Überschuss an freien<br />
Radikalen entgegenzuwirken, hat der Körper verschiedene<br />
Schutz mechanismen entwickelt. So gibt es zum<br />
Beispiel Antioxidantien, die freie Radikale unschädlich<br />
machen, bevor es zu Zellschäden kommen kann.<br />
Abbildung:<br />
Strukturformel Fisetin 6<br />
Literatur<br />
1 Kimira et al.: Japanese Intake of Flavonoids and Isofl avonoids from Foods. J Epidemiol 1998, 8(3): 16875.<br />
2 http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/fi setholz/24653. Spektrum Akademischer Verlag 1999, Heidelberg.<br />
3 Biesalski et al.: Ernährungsmedizin, 4. Aufl age, Thieme Verlag 2010, Stuttgart.<br />
4 Burgerstein et al.: Handbuch Nähstoffe. 12. Aufl age, Trias Verlag 2012, Stuttgart.<br />
5 Sengupta et al.: Investigations on the binding and antioxidant proerties of the plantfl avonoid fi setin in model biomembranes.<br />
FEBS Lett 570(13):7781.<br />
6 http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB8451569_EN.htm.<br />
7 Maher et al.: Flavonoid fi setin promotes ERKdependent long term potentiation and enhances memory. Proc Natl Acad<br />
Sci USA 2006, 103:1656873.<br />
8 Maher et al.: Modulation of multiple pathways involved in the maintenance of neuronal function during age by fi setin.<br />
Genes Nutr 2009, 4:297307.<br />
9 Olaharski et al.: Chromosomal malsegregation and micronucleus induction in vitro by the DNA topoisomerase II inhibitor<br />
fi setin. Mutat Res 2005, 582:7986.<br />
10Khan et al.: A novel dietary fl avonoid fi setin inhibits androgen receptor signaling and tumor growth in athymic nude<br />
mice. Cancer Res 2008, 68:855563.<br />
12
Anzeige /<br />
DETOX<br />
Dipl. Troph.<br />
Delia Germeroth<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Plantafood Medical GmbH<br />
Medizinprodukt Klasse IIa<br />
Es gibt viele natürliche Quellen von Antioxidantien, deren<br />
Aufnahme durch die Nahrung die körpereigene Abwehr<br />
unterstützen kann. Durch seine Struktur und einer<br />
Vielzahl von Hydroxylgruppen (OH) hat das Fisetin ein<br />
hohes antioxidatives Potential (Abb. 1), welches auch<br />
an einem Biomembran Modell gezeigt werden konnte. 5.<br />
Als Antioxidans spielt das Fisetin aber auch eine wichtige<br />
Rolle in der Reduktion von altersbedingtem Verfall<br />
der Hirnleistung. Zudem konnte gezeigt werden, dass<br />
durch die Gabe von Fisetin das Langzeitgedächtnis verbessert<br />
werden kann. 7, 8<br />
Einige Studien weisen darauf hin, das Fisetin verschiedene<br />
Enzyme, die an der Entstehung von Krebs beteiligt<br />
sind, hemmen kann und den Zelltod von Krebszellen<br />
9, 10<br />
induziert.<br />
Die Gruppe der Flavonoide besteht aus einer Vielzahl<br />
von Stoffen. Dazu gehört auch der gelbe Farbstoff<br />
Fisetin. In den letzten Jahren wurde immer mehr daran<br />
geforscht, die besagten Wirkungen der Stoffe nachzuweisen<br />
und ihre Wirkmechanismen zu erklären. So<br />
konnte für Fisetin schon gezeigt werden, dass es antioxidativ,<br />
neuroprodektiv und antikanzerogene Eigenschaften<br />
besitzen kann.<br />
Fisetin ist somit nicht nur ein natürliches Antioxidans,<br />
sondern besitzt auch eine Vielzahl an positiven und gesundheitsfördernden<br />
Eigenschaften!<br />
Das natürliche Vulkangestein Klinoptilolith<br />
- Zeolith bewirkt eine erhebliche<br />
Reduzierung der Schwermetallbelastung<br />
des Körpers, insbesondere bei Blei,<br />
Cadmium und Quecksilber.<br />
Erhältlich in Pulver- und Kapselform<br />
Pulver 90g<br />
23,90€ (26,56€/100g)<br />
Pulver 180g<br />
36,90€ (20,50€/100g)<br />
144 Kapseln (133,90g) 40,90€ (30,75€/100g)<br />
288 Kapseln (267,00g) 56,90€ (21,39€/100g)<br />
Medizinprodukte und<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
aus natürlichen Grundstoffen<br />
bester Qualität.<br />
PlantaVis GmbH<br />
Rosa-Luxemburg-Str. 19<br />
14482 Potsdam - Germany<br />
Telefon: +49 (0)3 31 / 70 43 96 62<br />
Telefax: +49 (0)3 31 /<br />
13<br />
70 43 96 64<br />
E-Mail: info@plantavis.de<br />
Web: www.plantavis.de
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Was ist gesunde Ernährung?<br />
Seit circa acht Jahren beschäftige ich mich<br />
persönlich mit den Themen gesunde Ernährung<br />
und Gesundheitsprävention. Und die Zahl derer,<br />
die es mir gleich tun, steigt stetig. Etliche Hilfeforen und<br />
Diskussionsgruppen sind inzwischen im Internet und<br />
den sozialen Medien entstanden. Und wenn man sie<br />
aufmerksam verfolgt sieht man, es sind meistens Gesundheitsstörungen,<br />
die den Menschen einen Anlass<br />
geben, sich mit der Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln<br />
auseinander zu setzen. Dabei habe ich<br />
den Eindruck, dass kaum ein anderes Thema derzeit<br />
so viele neue Dogmen und Mythen produziert, wie<br />
dieses. Nur allzu gerne folgen die Menschen den Versprechungen<br />
von Gesundheit, Schönheit, Jugendlichkeit<br />
und Vitalität bis ins hohe Alter. Und sie geben sehr<br />
viel Geld dafür aus.<br />
Zurecht, sollte man deshalb meinen, ertönt der Ruf<br />
nach der Wissenschaft, um die Aussagen der Ernährungs<br />
und Nahrungsergänzungsmittelbranche zu beweisen.<br />
Schließlich soll der Konsument vor unlauteren<br />
Aussagen und unnützen Ausgaben geschützt werden.<br />
Die Behörden in Europa verbieten inzwischen unter<br />
dem Deckmantel des Verbraucherschutzes immer<br />
mehr Nahrungsmittel und Produkte aus natürlichen<br />
Rohstoffen, die keinen hinreichend wissenschaftlich<br />
bewiesenen Nutzen vorweisen können. Darunter Produkte,<br />
die in anderen Teilen der Welt zum Teil auf jahrtausendealte<br />
Traditionen und Verwendung zurück blicken<br />
können und dort ohne wissenschaftlichen Nachweis<br />
wie selbstverständlich verzehrt werden. Dieses überlieferte<br />
Wissen zählt bei uns jedoch leider nicht viel, wenn<br />
es um die Befriedigung eurokratischer Interessen geht.<br />
Eine große Herausforderung für die Nahrungsergänzungsmittelbranche,<br />
die seit vielen Jahren Naturextrakte<br />
verwendet, denen gesundheitsfördernde Eigenschaften<br />
nachgesagt werden.<br />
Studien sind extrem teuer und ihr Ausgang ist oft ungewiss.<br />
Zu wenig wissen wir noch immer insbesondere<br />
über die Stoffgruppe der sekundären Pfl anzenstoffe,<br />
denen der Großteil der gesundheitlich positiven Wirkungen<br />
zugeschrieben werden muss.<br />
Das Problem der Ernährungswissenschaft auf dem<br />
Wege des Beweises ist aus meiner Sicht, dass sie zu<br />
sehr in altem Gedankengut und alten Methoden verhaftet<br />
ist. Neue Wissenschaftszweige, wie die Epigenetik<br />
und die hiermit eng verknüpfte Nutrigenetik, setzen<br />
sich nach meiner Meinung viel zu langsam durch. Noch<br />
immer herrscht die klassische Methodik vor, einzelne<br />
„Wirkstoffe“ und deren Zielstrukturen zu identifi zieren,<br />
um einen beschriebenen Gesundheitseffekt zu beweisen.<br />
Bei Vielstoffgemischen, die unsere Nahrungsmittel<br />
und Naturstoffkonzentrate nun einmal sind, ist es<br />
schlicht die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen,<br />
so vorzugehen.<br />
14
Ernährung / Prävention<br />
Gerade wenn es um gesunde Ernährung geht, stelle ich deshalb inzwischen immer<br />
öfter diese klassische Methodik der Wissenschaft infrage. Denn in der Regel sieht<br />
es so aus, dass der Beweis der Gesundheitsförderung eines Nahrungsmittels oder<br />
Konzentrates auch noch völlig aus dem sozialen Kontext herausgerissen wird. Man<br />
nimmt ein Produkt, verabreicht es einem Kollektiv von Probanden und schaut, ob der<br />
gewünschte Effekt nachzuweisen ist. Dabei scheint es mir mittlerweile sehr zweifelhaft<br />
zu sein, ob wirklich verbindliche Ergebnisse zu erzielen sind, wenn die sonstigen<br />
Lebensumstände der Probanden sich stark von den Menschen unterscheiden, aus<br />
deren Lebensraum ein Nahrungsmittel stammt.<br />
Schon die Zusammenstellung der täglichen Nahrungsmittel, hat einen erheblichen<br />
Einfl uss auf den Effekt der untersuchten Produkte. Auch bei noch so sorgfältigem<br />
Studiendesign, halte ich es schlichtweg für unmöglich, über das gesamte Probandenkollektiv<br />
identische Versuchsbedingungen darzustellen (im Übrigen sehe ich die gleiche<br />
Problematik auch bei vielen Arzneimittelstudien).<br />
Unberücksichtigt bleibt ferner die genetische Prädisposition der Probanden, die wir<br />
im Rahmen von Studien zurzeit weder untersuchen, noch ihre Bedeutung bisher<br />
in ganzem Ausmaß beurteilen können. Fest steht jedoch, die Erkenntnisse aus der<br />
epigenetischen respektive nutrigenetischen Forschung legen uns nahe, dass die<br />
Antwort auf die Frage „Was ist die richtige gesunde Ernährung?“ nicht pauschal zu<br />
beantworten ist.<br />
Weder ist der Begriff „abwechslungsreich“ im Zusammenhang mit Ernährung ausreichend<br />
defi niert, noch lässt sich eindeutig beweisen, dass einseitige Ernährung<br />
ge nerell schwer gesundheitsschädlich ist. Denn im Sinne von einseitig, ernähren sich<br />
zahlreiche Völker auf der Erde. Beispielsweise Eskimos, die von fettem Fisch leben,<br />
oder Nomaden in ZentralAfrika, die mehrere Liter Milch am Tag trinken. Beiden steht<br />
kein abwechslungsreicher Speiseplan zur Verfügung, weil es ihr Lebensraum nicht<br />
hergibt. Dennoch sind sie oftmals gesünder, als die Menschen hier bei uns. Ihre<br />
Körper sind seit Jahrtausenden an diese einseitige Form der Ernährung angepasst,<br />
während unsere Vorfahren neben der Jagd auf einen reichen Schatz an Früchten,<br />
Nüssen, Kräutern, Pilzen und Gemüsen zurückgreifen konnten.<br />
Andreas Binninger<br />
Apotheker und Fachlicher<br />
Beirat des NEM e. V.<br />
Eine Abkehr von endemischen Ernährungsformen, an die wir genetisch angepasst<br />
sind, macht nicht von heute auf morgen krank. Diabetes und andere Zivilisationskrankheiten,<br />
ent wickeln sich über viele Jahre falscher Ernährung. Welches Ausmaß<br />
epigenetische Veränderungen bei der Entstehung dieser Krankheiten haben, ist kaum<br />
abzuschätzen. Ebenso wenig wie die Zeit, der es bedarf, diese Veränderungen wieder<br />
zu reparieren. Zahlreiche Studien sind deshalb schon zum Scheitern verurteilt, weil<br />
sie schlicht nicht lange genug durchgeführt werden. Und je länger eine Studie dauert,<br />
umso schwerer wird es, einheitliche Bedingungen aufrecht zu erhalten.<br />
Wir stecken in einem großen Dilemma. Wir müssen dringend neue Methoden und<br />
Messverfahren entwickeln, um die Auswirkungen von Ernährung und Naturstoffen<br />
auf unseren Körper beweisen zu können. Es sei denn, es kehrte irgendwann wieder<br />
Vernunft bei der Politik ein.<br />
15
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Als oxidativer Stress wird ein Stoffwechselzustand bezeichnet,<br />
der durch eine hohe Konzentration von reaktiven Sauerstoffspezies<br />
gekennzeichnet ist. Dabei ist der Organismus nicht mehr imstande,<br />
die in ihm anfallenden reaktiven Sauerstoffverbindungen – dazu<br />
gehören die freien Radikale – erfolgreich durch Antioxidantien<br />
zu neutralisieren.<br />
Ergothionein in Pilzen –<br />
der oxidative Stress<br />
Die reaktiven Sauerstoffspezies entstehen<br />
durch sauerstoffabhängige Redoxreaktionen.<br />
Es handelt sich um Atome, denen ein Elektron<br />
fehlt, die aber die offene Stelle besetzen möchten und<br />
entziehen Elektronen anderen Atomen. So entstehen<br />
im Zuge einer Kettenreaktion freie Radikale.<br />
Freie Radikale sind nicht generell schädlich. Im Gegenteil,<br />
sie helfen dem Immunsystem Bakterieninfektionen<br />
zu bekämpfen und auch entartete körpereigene Zellen<br />
zu eliminieren. Solange im Organismus ein Gleichgewicht<br />
besteht, das heißt der Überschuss an gebildeten<br />
freien Radikalen durch entsprechende reduktive Gegenmaßnahmen<br />
des Organismus neutralisiert bzw.<br />
abgebaut werden, besteht keine Gefahr. An dem Abwehrprozess<br />
des Organismus von freien Radikalen sind<br />
Vi tamine (Ascorbinsäure, aTocopherol) und bestimmte<br />
Enzyme (SuperoxidDismutase, Katalase, Glutathionperoxidase<br />
u. a.) beteiligt. Wenn jedoch im Organismus<br />
eine Verschiebung in Richtung oxidativer Prozesse stattfi<br />
ndet, entsteht oxida tiver Stress.<br />
Sie entstehen in den Mitochondrien, als Nebenprodukt<br />
der Zellatmung. Sie entstehen aber auch in Entzündungsherden,<br />
wo sie Bakterien und Viren schädigen<br />
und insofern nützlich sind.<br />
Die Folgen eines oxidativen Stresses können schwerwiegend<br />
sein. Sie spielen bei der Entstehung von verschiedenen<br />
Krankheiten eine wichtige Rolle. Nachgewiesen<br />
ist, dass oxidativer Stress unter anderen bei Diabetes<br />
mellitus, Alzheimer und bei Krebs molekulare<br />
Schäden verursachen kann. Er ist maßgeblich am Alterungsprozess<br />
des Organismus beteiligt und gilt als Mitauslöser<br />
von bestimmten HerzKreislaufErkrankungen.<br />
Ferner kann der oxidative Stress Arteriosklerose, rheumatische<br />
und neurodegenerative Erkrankungen auslösen.<br />
Am oxidativen Stress sind hauptsächlich reaktive Sauerstoffspezies<br />
beteiligt. Solche sind Superoxidanionradikal,<br />
Wasserstoffperoxid, Hydroperoxid und andere.<br />
16
Ernährung / Prävention<br />
Den oxidativen Stress können neben endogenen Fa k<br />
toren auch exogene Einflüsse auslösen. Unter solchen<br />
werden UV-Strahlung, Ozon, Umweltbelastungen, Ernährungsfehler<br />
und Psychostress genannt. Die Gesamtzahl<br />
der Erkrankungen, die mit oxidativem Stress<br />
in Verbindung gebracht werden, geht über Einhundert.<br />
Natürliche Antioxidantien und Ergothionein<br />
Viele Antioxidantien kommen in Lebensmitteln vor, die<br />
vom menschlichen Organismus nicht synthetisiert werden<br />
können, sondern gezielt zugeführt werden müssen.<br />
Am besten bekannt sind die Vitamine A, C und E. Diese<br />
kommen in frischem Obst und Gemüse vor, die deshalb<br />
reichlich konsumiert werden sollten. Wichtige Antioxidantien<br />
sind Polyphenole, die in Äpfeln, Beeren (Brombeeren,<br />
schwarzen Johannesbeeren, Holunderbeeren)<br />
Tomaten, Rotwein sowie in Gewürzen wie Knoblauch<br />
und auch Kurkuma enthalten sind. Antioxidantien aus<br />
Pflanzenextrakten werden vielfach als Nahrungsergänzungsmittel<br />
supplementiert. Ein im Allgemeinen weniger<br />
bekannter natürlicher Antioxidans ist Ergothionein.<br />
Strukturformel: Ergothionein<br />
Ergothionein ist das Betain (Oxydationsprodukt) der<br />
Aminosäure L-Histidin, die an der zweiten Position des<br />
Imidazolrings eine Sulfhydrylgruppe als Schwefelsubstituenten<br />
trägt (siehe Strukturformel).<br />
Die Biosythese von Ergothionein geht von der Aminosäure<br />
L-Histidin aus, geht über das Zwischenprodukt<br />
Her zynin und wird durch den Einbau von Schwefel, der<br />
aus der Aminosäure Cystein stammt, komplettiert (Zapilko,<br />
2013).<br />
Das mit der Nahrung aufgenommene Ergothionein wird<br />
schnell resorbiert und über den Blutkreislauf in den<br />
unterschiedlichsten Körperteilen eingelagert. Aus entsprechenden<br />
Untersuchungen wissen wir, dass es im<br />
Knochenmark, in der Leber, den Nieren, der Lunge und<br />
Milz, im Herz und Dünndarm, im Harn und Sperma bis<br />
zu den roten- und weißen Blutkörperchen (Erythrozyten,<br />
Monozyten) im ganzen Körper nachweisbar ist.<br />
Vermutlich enthalten auch die Makrophagen viel Ergothionein,<br />
da sie sich aus den Monozyten entwickeln.<br />
Allerdings ist es so, dass Ergothionein eines Transports<br />
bedarf, der es ihm erlaubt, die Zellmembrane zu passieren<br />
und in das Zellinnere zu gelangen. Es handelt sich<br />
um einen hochspezifischen Transmembrantransporter,<br />
den man bisher bei allen untersuchten Tieren und auch<br />
beim Menschen gefunden hat (Zapilko, 2013).<br />
Die wichtigsten Eigenschaften von Ergothionein kann<br />
man wie folgt zusammenfassen:<br />
• Es deaktiviert Hydroxyl-Radikale und Hypochlorsäure<br />
• Durch Chelatieren verschiedener zweiwertiger metallischer<br />
Kationen verhindert es die Produktion von<br />
Radikalen<br />
• Beteiligt sich im Metallionentransport und der Regulierung<br />
der katalytisch aktiven Metalloenzyme<br />
17
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Obwohl noch lange nicht alle positiven Eigenschaften in<br />
vivo zweifelsfrei nachgewiesen sind, der Schutz der<br />
Haut vor UVStrahlen, des Gehirns vor Neurotoxinen<br />
und eine allgemeine Immunmodulation scheinen belegte<br />
Effekte von Ergothionein zu sein. Seine biologische<br />
Rolle bei Entzündungen und bestimmten Krankheitsbildern<br />
ist inzwischen hinreichend untersucht und wird<br />
zurzeit noch weiter erforscht.<br />
Pilze und Ergothionein<br />
Die Wertschätzung der Pilze als Nahrungsmittel und<br />
als Nahrungsergänzungsmittel ist in den letzten 20 Jahren<br />
sprunghaft angestiegene. War ihnen früher ein<br />
Schattendasein zugewiesen, von unspezifi schen Empfehlungen<br />
der Experten begleitet wie „Wo Gemüse<br />
passt, passen auch Pilze, nur nicht zu viel“ kümmert<br />
sich heute unter anderen die „Mushroom and Health<br />
Global Initiative“, eine weltweit aktive Organisation um<br />
die Förderung der gesundheitsbezogenen Pilzforschung<br />
und Publizierung deren Ergebnisse. „Mushrooms – a<br />
nutritious culinary star” oder „Mushrooms as a healthy<br />
substitute for meatbased dishes without loss of fl avor“<br />
sind nur zwei Berichte aus der letzten Ausgabe des<br />
Bulletins dieser Organisation. Auch das deutsche „Grüne<br />
Medienhaus“ ein Spezialist für Öffentlichkeitarbeit<br />
im Gartenbau, berichtet in seiner neusten Ausgabe<br />
über einen Aufwärtstrend für Speisepilze: „Kulturpilze<br />
werden immer beliebter. In den vergangenen sieben<br />
Jahren stieg die Einkaufsmenge frischer Champignons<br />
in Deutschland um rund ein Viertel, hat die AMI – AgrarmarktInformationsgesellschaft<br />
ermittelt.“ Und in<br />
den USA sind Champignons inzwischen zum „Superfood“<br />
avanciert. Die Gründe für diese Entwicklung sind<br />
nachvollziehbar. Die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten<br />
Forschungsarbeiten über die essentiellen<br />
Nährstoffe und bioaktiven sekundären Inhaltsstoffe der<br />
Großpilze förderten vieles positives zutage. Nach Angaben<br />
einer chinesischen Forschergruppe (Dai et al.<br />
2009), die eine Recherche über die Ergebnisse der Forschungsaktivitäten<br />
der letzten 15 Jahre hinsichtlich der<br />
therapeutischen Wirkung von Großpilzen veröffentlichte,<br />
wurden bisher insgesamt 126 solcher nachgewiesen.<br />
Und eine der bioaktiven sekundären Substanz in<br />
Pilzen ist das Ergothionen.<br />
Ergothionein wurde bereits vor mehr als 100 Jahren,<br />
konkret in 1909 entdeckt. Es wurde aus einem Pilz, der<br />
als Parasit der Roggenpfl anze gilt, dem Mutterkorn (Claviceps<br />
purpurea), isoliert. Seine Struktur wurde vier<br />
Jahre später aufgeklärt. Das Besondere an diesem Antioxidans<br />
ist, dass Pfl anzen es nicht synthetisieren können,<br />
sondern ausschließlich Bakterien und Pilze.<br />
Anfangs glaubte man, das Ergothionein nur von niederen<br />
Pilzen (Aspergillus, Alternaria, Penicillium) und einigen<br />
Bakterien synthetisiert werden kann. Spätere Untersuchungen<br />
haben jedoch gezeigt, dass auch höhere<br />
Pilze, so auch Nutzpilze (Champignon, Schopftintling,<br />
Shiitake u.a.) Ergothionein produzieren. Dieser Entdeckung<br />
kommt bei der Wertschätzung der Pilze besondere<br />
Bedeutung zu.<br />
Auch Pfl anzen enthalten Ergothionein, so z.B. die Nahrungspfl<br />
anzen (Paprika, Brokkoli, Möhren, Bohnen und<br />
Getreide), aber Pfl anzen nehmen es über die Wurzeln<br />
aus dem Boden auf. Entsprechend beeinfl ussen die<br />
Bodenbedingungen den ErgothioneinGehalt in Pfl anzen.<br />
Der Mensch nimmt Ergothionein ausschließlich<br />
über die Nahrung auf. Untersuchungen haben gezeigt,<br />
dass die Konzentration von Ergothionein im Blut nach<br />
dem Verzehr ergothioneinhaltiger Nahrung, insbesondere<br />
nach dem Konsum von Speisepilzen und<br />
Fleisch anstieg. Im Durchschnitt enthält menschliches<br />
18
Ernährung / Prävention<br />
Gewebe 12 Millimol Ergothionein. Von den tierischen<br />
Quellen gilt übrigens Hühnerleber als besonders reich<br />
an Ergothionein.<br />
Bei den Speisepilzen wurden zahlreiche Untersuchungen<br />
hinsichtlich des Ergothionein Gehaltes durchgeführt.<br />
Besonders hervorzuheben sind jene, die an der<br />
Pennsylvania State University stattgefunden haben. Einen<br />
Vergleich des Ergothionein Gehaltes verschiedener<br />
kultivierter Speisepilze zeigt Tabelle 1. Da unter den<br />
Speisepilzen der Kulturchampignon in der westlichen<br />
Hemisphäre die weitaus größte wirtschaftliche Bedeutung<br />
hat, haben die Amerikaner den Kulturchampignon<br />
näher unter die Lupe genommen und die Fruchtkörper<br />
aus ein und derselben Kultur im Jungstadium und voll<br />
ausgereift untersucht und auch eine Variante mit brauner<br />
Hutfarbe dazu genommen (Tabelle 2).<br />
In einer Publikation, deren Autoren aus mehreren Ländern<br />
zusammengearbeitet haben, wurde der ErgothioneinGehalt<br />
in Heilpilzen untersucht (Tabelle 3). Besonders<br />
viel an diesem Antioxidans fanden die Autoren<br />
beim Schopftintling (Coprinus comatus), bei der Orangengelben<br />
Puppenkeule (Cordyceps militaris) und beim<br />
Austernpilz (Pleurotus ostreatus).<br />
Unter Berücksichtigung der physiologischen Bedeutung<br />
des Ergothioneins auf den menschlichen Organismus,<br />
leisten die vorliegenden Informationen weiteren Vorschub<br />
für den Pilzkonsum. Gelten sie doch als exzellente<br />
Quelle für dieses Antioxidans, viel besser als Gemüse<br />
und Fleisch. Die Forscher der Penn State University<br />
fanden in braunen Champignons ErgothioneinWerte,<br />
die vergleichbar sind mit denen von roter Paprika und<br />
Brokkoli und viel höher liegen als die von Möhren oder<br />
grünen Bohnen. Sie sind zwölfmal höher als in Weizenkeimen<br />
und viermal höher als in Hühnerleber, die wegen<br />
seines ErgothioneinGehalts gepriesen wird. Die<br />
übrigen untersuchten Pilzarten sind übrigens noch reicher<br />
an diesem Antioxidans. Sie können in einer üblichen<br />
Verkehrsportion bis zu 40mal (!) mehr Ergothionein<br />
enthalten als Weizenkeime.<br />
Lassen Sie mich deshalb mit der Empfehlung schließen:<br />
„Eat more mushrooms<br />
and live longer“<br />
Tabelle 1: ErgothioneinGehalt verschiedener kultivierter Speisepilze.<br />
Angaben in mg/g Trockensubstanz und Standardabweichung<br />
(Tabelle 2 und 3 auf S. 20)<br />
Pilzarten<br />
Kulturchampignon<br />
(Agaricus bisporus)<br />
Kräuterseitling<br />
(Pleurotus eryngii )<br />
Ergothionein-<br />
Gehalt<br />
0,41 ± 0,18<br />
1,72 ± 0,10<br />
Maitake (Grifola frondosa) 1,84 ± 0,76<br />
Austernpilz<br />
2,01 ± 0,05<br />
(Pleurotus ostreatus)<br />
Shiitake (Lentinula edodes) 2,09 ± 0,21<br />
nach Dubost et al. 2006.<br />
19
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Tabelle 2: ErgothioneinGehalt im Kulturchampignon (Agaricus<br />
bisporus) im Jungstadium und erntereif, sowie in einer Variante<br />
von A. bisporus mit brauner Hutfarbe. Angaben in mg/g<br />
Trockensubstanz, Standardabweichung und in 100 g Frischpilz<br />
Kulturchampignons<br />
nach Dubost et al. 2006.<br />
im Jungstadium 0,47 ± 0,03 3,29<br />
voll entwickelter Fruchtkörper 0,83 ± 0,01 5,76<br />
mit brauner Hutfarbe 0,71 ± 0,01 5,06<br />
Prof. Dr. Jan I. Lelley<br />
Gesellschaft für angewandte<br />
Mykologie und Umweltstudien GmbH<br />
(GAMU), Krefeld , Deutschland<br />
Fachlicher Beirat des NEM e.V.<br />
Ergothionein-<br />
Gehalt<br />
mg/g Trockensubstanz<br />
Ergothionein-<br />
Gehalt<br />
mg in 100 g<br />
Frischpilzen<br />
Pilzarten<br />
Agaricus brasiliensis,<br />
Fruchtkörper<br />
Coprinus comatus,<br />
Fruchtkörper<br />
Cordyceps militaris,<br />
Fruchtkörper<br />
Flammulina velutipes,<br />
Fruchtkörper<br />
Ganoderma lucidum,<br />
Myzelbiomasse<br />
Grifola frondosa,<br />
Fruchtkörper<br />
Hericium erinaceus,<br />
Fruchtkörper<br />
Hericium erinaceus,<br />
Myzelbiomasse<br />
Lentinula edodes,<br />
Fruchtkörper<br />
Ophiocordyceps sinensis,<br />
Myzelbiomasse<br />
Pleurotus ostreatus,<br />
Fruchtkörper<br />
Trametes versicolor,<br />
Myzelbiomasse<br />
Tremella fuciformis,<br />
Fruchtkörper<br />
nach Cohen et al. 2014<br />
Tabelle 3: ErgothioneinGehalt in verschiedenen Heilpilzen.<br />
Angaben in Mikrogramm (µg)/g Trockensubstanz und Standardabweichung<br />
Ergothionein-<br />
Gehalt<br />
37,36 ± 1,50<br />
764,35 ± 9,12<br />
409,88 ± 27,86<br />
98,61 ± 3,99<br />
219,59 ± 10,82<br />
207,00 ± 13,69<br />
629,96 ± 36,80<br />
149,24 ± 5,51<br />
334,01 ± 10,01<br />
52,18 ± 2,75<br />
2443,53 ± 135,18<br />
119,70 ± 2,22<br />
19,49 ± 0,53<br />
Literatur<br />
• Bach, M. 2009. Identifi zierung des orthologen ErgothioneinTransporters des Zebrafi sch, Etablierung und Phänotypisierung<br />
des KnockoutModells. Dissertation, Univ. Köln, 140 S.<br />
• Cohen, N., Cohen, J., Asatian, M.D., Varshney, V.K., Yu, HT., Yang, YiChi., Li, YuH., Mau, JL. & Wasser, S.P.<br />
2014. Chemical Composition and <strong>Nutrition</strong>al and Medicinal Value of Fruit Bodies and Submerged Cultured<br />
Mycelia of CulinaryMedicinal Higher Basidiomycetes Mushrooms. Int. J. Medicinal Mushrooms, 16/3 273291.<br />
• Dubost, N.J., Beelman, B.B., Peterson, D. & Royse, D.J. 2006: Identifi cation and Quantifi cation of Ergothioneine in<br />
Cultivated Mushrooms by Liquid ChromatographyMass Spectroscopy. Int. J. Medicinal Mushrooms, 8/5, 215222.<br />
• Dai, YC., Yang, ZL., Cui, BK. et al. 2009. Species Diversity and Utilisation of Medicinal Mushrooms and Fungi<br />
in China (Rewiew). Int. J. of Medicinal Mushrooms. 11. 287302.<br />
• Lelley, J. 2008: Die Heilkraft der Pilze – Wer Pilze isst lebt länger. B.O.S.S. Medienhaus, Goch.<br />
• Mushroom and Health Global Initiative Bulletin, Issue No. 18, November 2014<br />
• Zapilko, V. 2013. Identifi zierung Ergothioneinhaltiger Zellen im Zebrabärbling Danio rerio. Dissertation, Univ.<br />
Köln, 161 S.<br />
20
Prävention<br />
Alpha Liponsäure als Chelatbildner<br />
bei Schwermetallbelastungen:<br />
Wissenschaftsfundierte<br />
Problemdarstellung<br />
1. Problematik der humanmedizinischen Entgiftung<br />
Entgiftung setzt voraus, dass 1. ein Körpersystem mit gesundheitsschädlichen Substanzen<br />
kontaminiert ist; 2. diese benannten Substanzen durch einen Chelatbildner<br />
gebunden und ausgeschieden werden können, ohne unerwünschte Umverteilung<br />
der gleichen; 3. dabei keine gesundheitsbedrohlichen Effekte entstehen.<br />
Die häufi gsten und gefährlichsten Vergiftungen durch Umweltbelastung sind heutzutage<br />
u. a. auf Schwermetalle zurückzuführen – und zwar solche, deren Formen eine<br />
hohe Lipophilie (Membranendurchgängigkeit) aufweisen. Aufgrund ihrer Depots im<br />
menschlichen Organismus kann eine toxische Schwermetallbelastung bzw. vergiftung<br />
anhand des Blutbildes nicht signifi kant erfasst werden. Dies führt dazu, dass<br />
in der Regel die Betroffenen zur Linderung der Symptomatik Medikamente verabreicht<br />
bekommen. Somit wird das ohnehin belastete Entgiftungssystem mit noch<br />
mehr „Chemie“ konfrontiert, unabhängig davon, dass dabei das primäre Problem<br />
ganz außer Acht gelassen wird.<br />
In wenigen Ausnahmefällen werden Mobilisierungstests gemacht – diese müssen<br />
dann jedoch vom Patienten selbst fi nanziert werden – die auf eine genauere Bestimmung<br />
der Schwermetallbelastung abzielen. Nach der analytisch erfassten Diagnose<br />
werden sogenannte Chelatbildner verschrieben, die zwar erfolgreich das Schwermetall<br />
mobilisieren, binden und ausscheiden können, jedoch werden im selben Chelatierungsprozess<br />
auch essentielle Mineralien und Spurenelemente ebenso „ent<br />
21
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
sorgt“, was eine gewiss durch Schwermetallbelastung<br />
begünstigte Dysmineralose nur weiterhin verschlimmert.<br />
Hautreaktionen (Juckreiz, Hautausschlag), Fieber und<br />
Schüttelfrost, Erhöhung der Transaminasen, Übelkeit,<br />
Schwindel und Blutdruckabfall (Forth, Henschler, Rummel<br />
2005) sind abhängig von der Dosis und Dauer der<br />
Behandlung unausweichliche Begleiter. Spätestens an<br />
dieser Stelle wird die Notwendigkeit einer studienbelegten<br />
Prävention zur gesundheitsschonenden Schwermetallmobilisierung,<br />
chelatierung und ausscheidung<br />
plausibel.<br />
2. Biochemische Eigenschaften von Alpha Liponsäure<br />
Alpha Liponsäure (ALA), genauer (R)Liponsäure, ist ein<br />
Naturstoff mit vitaminähnlicher Wirkung, der bereits in<br />
den 50er Jahren aus Lebergeweben isoliert und bezüglich<br />
Struktur, chemischer Eigenschaften und physiologischer<br />
Funktionen ausführlich beschrieben wurde (Burgerstein<br />
2002). Die Bezeichnung Alpha Liponsäure wird<br />
aus der strukturellen Verwandtschaft mit Fettsäuren<br />
(fett = lipo) abgeleitet. Aufgrund ihrer lipophilen Eigenschaften<br />
ist ALA deshalb in der Lage, ihre antioxidative<br />
Wirkung in bzw. an der Zellmembran zu entfalten. Ein<br />
anderer gebräuchlicher Name für ALA ist Thioctsäure.<br />
Diese Bezeichnung nimmt Bezug auf die Schwefelverbindung<br />
(griechisch theion = Schwefel) und die Säure<br />
mit einer achtgliedrigen Kohlenstoffkette (Pies 2003).<br />
Die Pharmakokinetik der ALA ist nur teilweise bekannt<br />
(Teichert, Kern, Tritschler, Ulrich, Preiss 1998). Die Aufnahme<br />
in Zellen soll bei Konzentrationen unter 100<br />
µmol/l durch ein aktives, von Na+, K+ und ATP abhängiges<br />
Transportsystem erfolgen (Totskii 1978). Sowohl<br />
Pfl anzen als auch Tiere können ALA synthetisieren. Die<br />
Methode der Herstellung ist nicht bekannt, aber es wird<br />
in den Mitochondrien laufen (Packer, Kraemer, Rimbach<br />
2001) und einiges mag von Darmbakterien produziert<br />
werden. Die normale Synthese führt nicht zu großen<br />
Mengen von freier ALA im Blutstrom (Biewenga, Haenen,<br />
Bast 1997). ALA aus der Nahrung kann an die Aminosäure<br />
Lysin gebunden sein, was ihre vollständige<br />
Abwesenheit im Blutstrom von Menschen, die nicht<br />
supplementieren, erklären mag (Biewenga, Haenen,<br />
Bast 1997).<br />
Abb. 1: Strukturformel der ALA (links)<br />
und der DHLA (rechts).<br />
Quelle: Pies 2003, S. 14<br />
Wenn ALA von außen zugeführt wird, dringt sie schnell<br />
in die Zellen ein, wo sie zu Dihydroliponsäure (DHLA)<br />
unter Nutzung von StoffwechselElektronen reduziert<br />
wird (Handelman, Han, Tritschler, Packer 1994). DHLA<br />
ist ihre reduzierte Form, die hingegen in wässerigem<br />
Milieu löslich ist, was dieses Redoxpaar so interessant<br />
macht. ALA und ihre reduzierte Form DHLA können an<br />
jedem Ort im Körper, sowohl in wässriger als auch in<br />
fettiger Umgebung, ihre chelatierende Wirkung entfalten.<br />
Daher ergänzen sich beide Formen – ALA und<br />
DHLA – ideal sowohl beim antioxidativen Schutz der<br />
Zelle vor freien Radikalen als auch beim Chelatieren<br />
von Schwermetallen (Pies 2003). Der antioxidative<br />
Schutz von ALA und ihrer reduzierten Form DHLA wird<br />
auf ihre Fähigkeit zurückgeführt, Metallionen binden<br />
und so die Produktion von freien Radikalen unterbinden<br />
zu können (Suh, Shigeno, Morrow, Cox, Rocha, Frei,<br />
Hagen 2001). An dieser Stelle wird das biochemische<br />
Wandlungs und Schutztalent dieser lipophilen Substanz<br />
deutlich.<br />
Bei erhöhtem intrazellulärem oxidativem Stress liegt<br />
das Gluthationsangebot reduziert vor, was die Entgiftungskapazität<br />
deutlich beeinträchtigt (Muss, Mellinghoff<br />
2003). Aus diesem Grund ist der folgende Befund<br />
für die beabsichtigte Entgiftung von wesentlicher Bedeutung:<br />
22
Prävention<br />
DHLA ist einerseits einer der mächtigsten Radikalenfänger,<br />
der der Zelle zur Verfügung steht, andererseits<br />
kann DHLA eine Anzahl anderer Antioxidantien regenerieren,<br />
darunter Glutathion, CoEnzym Q10 sowie das<br />
Vitamin C und E (Kagan, Serbinova, Packer 1990; Busse,<br />
Zimmer, Schopohl et al. 1992; Scholich, Murphy,<br />
Sies 1989). Somit kann angenommen werden, dass<br />
diese vielfältige antioxidative Leistung auch eine ausreichende<br />
Entgiftungskapazität erfolgreich sichern kann.<br />
Laut den Studienbefunden weist die i. v. ALAGabe bei<br />
Menschen bis zu 1200 mg und bei einer oralen Tagesdosis<br />
von bis zu 600 mg dreimal täglich keine Toxizität<br />
auf. Als seltene Nebenwirkungen von ALA werden Übelkeit<br />
und Erbrechen beschrieben. Bei der oralen Verabreichung<br />
von bis zu 1800 mg täglich sind keine Nebenwirkungen<br />
zu beobachten. Dosen von 500 1000 mg<br />
wurden auch in Placebo kontrollierten Studien gut vertragen<br />
(Patrick 2002).<br />
3. ALA als Chelatbildner von Schwermetallen<br />
Laut Jones und Cherian sollte ein idealer Chelatbildner<br />
in der Lage sein, ohne Probleme in die Zelle einzutreten,<br />
das Schwermetall aus seinem Komplex mit Metallothionein<br />
oder anderen Proteinen zu chelatieren und<br />
die Ausscheidung des Metalls zu erhöhen, ohne seine<br />
Umverteilung auf andere Organe oder Gewebe zu erhöhen.<br />
Obwohl ALA bisher in keinen klinischen Studien<br />
an Menschen als chelatierende Substanz bei Schwermetallvergiftungen<br />
getestet wurde, gibt es Hinweise<br />
darauf, dass ALA mindestens zwei der oben genannten<br />
Kriterien erfüllt, d. h. das Eindringen in die intrazelluläre<br />
Umgebung und Bindung von Metallkomplexen an andere<br />
Sulfhydryl Proteine. Endogen produzierte ALA wird<br />
an Proteine gebunden, sie kann aber auch nach exoge<br />
ner Gabe in der Zirkulation in ungebundener Form vorkommen.<br />
In dieser Form ist ALA in der Lage, chemisch<br />
zirkulierende Schwermetalle zu binden und somit die<br />
Zellschäden durch Metallvergiftung zu verhindern.<br />
Die Tatsache, dass die freie ALA die BlutHirnSchranke<br />
passieret, ist bedeutsam, weil sich manche Schwermetalle<br />
im Gehirn akkumulieren können. Aufgrund ihrer<br />
kleinen molekularen Form und ihrer starken lipophilen<br />
Eigenschaften kann ALA ohne Schwierigkeiten die Blut<br />
HirnSchranke passieren und sogar in die Zellen eindringen<br />
sowie das dort deponierte Schwermetall mobilisieren.<br />
Orale Dosen von 10 mg/kg ALA an Ratten haben<br />
Spitzenwerte in der Großhirnrinde, im Rückenmark<br />
und peripheren Nervensystem innerhalb von 30 Minuten<br />
nach der Verabreichung erreicht. Damit beweisen<br />
Studienbefunde, dass ALA alle Bereiche des ZNS erreichen<br />
kann (Patrick 2002). Andere Studien weisen darauf<br />
hin, dass ALA durch Cadmium erzeugte Leberschäden<br />
reduzieren (Muller, Menzel 1990) und Quecksilber<br />
binden sowie aus den Nieren entfernen kann (Keith,<br />
Setiarahardjo, Fernando et al. 1997).<br />
Alle Quecksilberverbindungen haben eine starke Affi <br />
nität zu sulfhydrylhaltigen Liganden (Glutathion, ALA,<br />
etc.), mit dem Ergebnis des reduzierten Glutathionspiegels.<br />
Die Effi zienz von ALA als SchwermetallKomplexbildner<br />
für Schwermetalle wurde zwar bislang nur<br />
in Tierversuchen getestet, der erwiesene Ansatz lässt<br />
allerdings vermuten, dass ihre chelatierende Fähig keit<br />
auch auf den Menschen übertragbar ist. Ebenso Gre<br />
23
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
gus et al. bestätigen anhand von Tierexperimenten den<br />
Befund, dass sowohl ALA als auch ihre reduzierte Form<br />
DHLA die Fähigkeit haben, als intra und extrazelluläres<br />
SchwermetallKomplexmittel zu wirken (Patrick 2002).<br />
Nachweislich ist ALA in der Lage, sowohl den intraals<br />
auch den extrazellulären Glutathionspiegel in den<br />
TZellkulturen, den Erythrozyten, Gliazellen und peripheren<br />
BlutLymphozyten zu erhöhen. Bei Ratten führte<br />
die orale Dosierung von 150 mg/kg pro Tag zum deutlich<br />
erhöhten Glutathionspiegel im Blut und in der Leber.<br />
Es ist nachgewiesen, dass ALA in der Lunge, den<br />
Leber und Nierenzellen von Mäusen die intrazelluläre<br />
Glu tathion um 30 bis 70 Prozent erhöhen kann, die<br />
für 11 Tage intraperitoneale Injektionen von 4, 8 oder<br />
16 mg/kg ALA erhalten haben. ALA kann durch die Erhöhung<br />
des zellulären Gluthationspiegels das Schwermetall<br />
mobilisieren und dadurch vor Zellschäden schützen.<br />
Die reduzierte Form von ALA scheint dagegen eine<br />
direkte chelatierende Wirkung zu haben (Patrick 2002).<br />
Im Blut gibt es andere schwefelhaltige Supplemente<br />
wie MSM (Methylsulfonylmethan), die ebenfalls Quecksilber<br />
und andere Schwermetalle binden und sicher<br />
über den Urin ausscheiden können. Aber MSM kann, anders<br />
als ALA, die BlutHirnSchranke nicht überwinden.<br />
Für Schwermetallgeschädigte ist von Bedeutung, dass<br />
ALA in der Lage ist, das Schwermetall zu binden, so<br />
dass es dadurch 12 bis 37 Mal schneller als normal<br />
über die Galle ausgeschieden werden kann (Patrick<br />
2002). In Tierexperimenten konnten Vergiftungen mit<br />
Quecksilber, Arsen oder Cadmium durch ALA dosisabhängig<br />
abgeschwächt oder verhindert werden. Da bei<br />
spielte die Detoxifi kation durch Chelatbildung eine<br />
Rolle (Bano, Bhatt 2007; DomanskaJanik, Bourre 1987;<br />
Ehrenthal, Prellwitz 1986). Zur genauen Festlegung der<br />
Verhaltensweise und Effektivität von ALA als Chelatbildner<br />
sind allerdings klinische Humanstudien notwendig.<br />
24
Prävention<br />
Zusammenfassung:<br />
Entgiftung zählt heutzutage immer mehr zu einer essentiellen Prävention gegen<br />
gesundheitsgefährliche Umweltgifte, zu denen ausnahmslos alle Schwermetalle<br />
zählen. Schwermetalle befi nden sich überall: In Nahrung, Wasser, Luft – selbst<br />
in der Medizin (Thiomersal, Almalgam usw.). Dies setzt eine Notwendigkeit gesundheitsförderlicher<br />
Entgiftungsmaßnahmen voraus. Wesentliche Nachteile gängiger<br />
Entgiftungsmethoden der Humanmedizin spiegeln sich in ihren z. T. erheblichen,<br />
unerwünschten Nebeneffekten wider. So werden durch alle bekannten Chelatbildner<br />
essentielle Mineralien ausgeschieden, was allergische Hautreaktionen<br />
(Juckreiz, Hautausschlag), Fieber und Schüttelfrost, Erhöhung der Transaminasen,<br />
Übelkeit, Schwindel und Blutdruckabfall hervorrufen kann (Forth, Henschler, Rummel<br />
2005). Die Notwendigkeit einer gesundheitsschonenden Schwermetallentgiftung<br />
wird immer größer. Alpha Liponsäure wurde bisher in Tierexperimenten als<br />
er folgreicher, gesundheitsschonender Chelatbildner erwiesen. Die ersten Fakten<br />
und Erkenntnisse aus randomisierten Humanstudien fehlen weiterhin.<br />
Strahinja Tomic<br />
Doktorand der Sport -<br />
wissenschaften mit<br />
S c h w e r p u n k t S p o r t -<br />
medizin<br />
Literatur:<br />
• Bano, M. Bhatt, DK. 2007. Neuroprotective Role of a novel combination of certain antioxidants on Lindane (YHCH) induced<br />
toxicity in cererbrum of mice. Res. J. Agricult. Biol. Sci., 3., 2007. S. 664 – 669. ISBN: 18161561<br />
• Biewenga, GP Haenen, GR. Bast, A. 1997. The pharmacology of the antioxidant lipoic acid, Gen Pharmacol, 29(3), 1997.<br />
S. 315 – 331. PMID: 9378235<br />
• Burgstein, L. 2002. Burgsteins Handbuch Nährstoffe. Vorbeugen und heilen durch ausgewogene Ernährung: Alles über<br />
Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe:10. Aufl age. Stuttgart: Karl F. Haug Verlag, 2002. S. 512. ISBN: 383042065X<br />
• Busse, E. Zimmer, G. Schopohl, B. et al. 1992. Infl uence of alphalipoic acid on intracellular glutathione in vitro and in vivo,<br />
ArzneimittelForschung, 42, 1992. S. 829 831. PMID: 1418040<br />
• DomanskaJanik, K. Bourre, JM. 1987. Effect of mercury on rabbit myelin CNPase in vitro. Neurotox. 8(1), 1987. S. 23 32.<br />
ISSN: 0161813X<br />
• Ehrenthal, W. – Prellwitz, W. 1986. Biochemie und Pharmakologie der Liponsäure. In: Neundörfer, B. Sailer, D. (Hrsg.): Interdisziplinäre<br />
Bestandsaufnahme der Polyneuropathien. Morphologie, Biochemie, Klinik und Therapie. Erlangen: Perimed<br />
Verlag, 1986. S.154 – 165. ISBN: 97838842290576<br />
• Forth, W. Henschler, D. Rummel, W. Förstermann, U. Starke, K. 2005. Allgemine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie:<br />
9. Aufl age. München, Urban & Fischer Verlag, 2005. S. 1189. ISBN: 3437425218<br />
• Handelman, GJ. Han, D. Tritschler, H. Packer, L. 1994. áLipoic acid reduction by mammalian cells to the dithiol form and<br />
release into the culture medium, Biochem Pharmacol, 47, 1994. S. 1725 1730 (1994). PMID: 8204089<br />
• Kagan, V. Serbinova, E. Packer, L. 1990. Antioxidant effects of ubiquinones in microsomes and mitochondria are mediated<br />
by tocopherol recycling, Biochem Biophys Res Comm, 169, 1990. S. 851 857. PMID: 2114108<br />
• Keith, RL. Setiarahardjo, I. Fernando, Q. et al. 1997. Utilization of renal slices to evaluate the effi cacy of chelating agents<br />
for removing mercury from the kidney, Toxicology, 116, 1997. S. 67 75. PMID: 9020508<br />
• Muller, L. Menzel, H. 1990. Studies on the effi cacy of lipoate and dihydrolipoate in the alteration of cadmium toxicity in<br />
isolated hepatocytes, Biochem Biophys Acta, 1052, 1990. S. 386 391. PMID: 2112957<br />
• Muss, C. – Mellinghoff, J. 2003. Sonderdruck aus GZM NetzwerkJournal – Praxis und Wissenschaft. 8. Jg. 3.<br />
• Patrick, L. 2002. Mercury toxicity and antioxidants: Part I: role of glutathione and alphalipoic acid in the treatment of mercury<br />
toxicity, Alternative Medicine Review, 7(6), 2002. S. 456 471. PMID: 12495372<br />
• Pies, J. 2003. AlphaLiponsäure – das Multitalent. Gegen freie Radikale, Umweltgifte, Zellalterung. Kirchzarten bei Freiburg:<br />
VAK Verlag, 2003. S. 78. ISBN: 3935767293<br />
• Teichert, J. Kern, J. Tritschler, HJ. Ulrich, H. Preiss R. 1998. Investigations on the pharmacokinetics of alphalipoic acid<br />
in healthy volunteers. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther., 36, 1998. S. 625 – 628 (1998). PMID: 9876998<br />
• Totskii, VN. 1978. Mechanisms and regulatory pathways of the penetration of lipoic acid into biological structures. Biokhimiya,<br />
41, 1978. S. 1094 1105. PMID: 68786<br />
• Scholich, H. Murphy, ME. Sies, H. 1989. Antioxidant activity of dihydrolipoate against microsomal lipid peroxidation and<br />
its dependence on alphatocopherol. Biochim Biophys Acta. 1989 Feb 20;1001(3):25661. PMID: 2492825<br />
• Suh, JH. Shigeno, ET. Morrow, JD. Cox, B. Rocha, AE. Frei, B. Hagen, TM. 2001. Oxidative stress in the aging rat heart<br />
is reversed by dietary supplementation with (R)(alpha)lipoic acid, Faseb J, 15(3), 2001. S. 700 706. PMID: 11259388<br />
25
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Wird auch als Chilli oder Spanischer Pfeffer bezeichnet.<br />
Entgegen seinem Namen handelt es sich jedoch um<br />
kein Pfeffergewächs (Piperaceae). Cayenne pfeffer gehört<br />
wie Kartoffeln, Tomaten und Paprika (Capsicum annuum)<br />
zur Familie der Nachtschattenge wächse (Solanaceae).<br />
Cayennepfeffer<br />
(Capsicum frutescens)<br />
Die Pfl anze ist in Südamerika heimisch. Funde in prähistorischen Grabstätten<br />
belegen, dass schon 7000 v. Chr. Kultivierungsversuche stattfanden.<br />
1492 entdeckte Christoph Kolumbus bei den Ureinwohnern Amerikas die Pfl anze<br />
und taufte diese auf den Namen Pimienta, was auf Spanisch „Pfeffer“ heißt. Seit<br />
dem 16. Jahrhundert kennt man Cayenne als feurigscharfes Gewürz auch in Europa.<br />
Die Früchte (rote, gelbe oder grüne ChilliSchoten) können frisch oder getrocknet verwendet<br />
werden. Getrocknet werden sie grob zerstoßen und zusammen mit den Samen<br />
als ChilliFlocken verwendet. Das gemahlene Pulver wird als Cayennepfeffer gehandelt<br />
Inhaltsstoffe<br />
Capsaicinoide, Vitamin C, Flavonoide und ätherisches Öl sind die wirksamkeitsbestimmenden<br />
Inhaltsstoffe des Cayennepfeffers. Carotinoide sind außerdem für die<br />
Färbung der Früchte verantwortlich. Für den charakteristischen scharfen Geschmack<br />
sind die Capsaicinoide ver ant wortlich. Nicht alle Capsaicinoide sind gleich scharf. Der<br />
scharfe Geschmack ist korrekterweise<br />
eine Schmerzempfi ndung. Durch Aktivierung<br />
des Wärme/Schmerzrezeptors<br />
Tran sient Receptor Potential Vanilloid 1<br />
(TRPV1) wird ein Schmerzsignal erzeugt,<br />
welches dem Gehirn zu hohe Temperaturen<br />
meldet. Der scharfe Geschmack wird also nicht<br />
durch das gustatorische System vermittelt. Denn die<br />
Geschmacksknospen der Zunge können nur die Geschmacksrichtungen<br />
süß, sauer, bitter, salzig und umami<br />
wahrnehmen.<br />
26
Ernährung / Prävention<br />
Es gibt insgesamt sechs Capsaicinoide, die sich in der<br />
molekularen Struktur unterscheiden. Capsaicin, Dihydrocapsaicin,<br />
Nordihydrocapsaicin, Homodihydrocapsaicin,<br />
Norcapsaicin und Homocapsaicin gehören chemisch zur<br />
Gruppe der Alkaloide und sind relativ temperaturstabil.<br />
Löslich sind sie in Alkohol und Fett, nicht aber in Wasser.<br />
Dies ist auch der Grund, warum Chilischoten stets in Öl<br />
eingelegt werden und Milchprodukte wie Trinkmilch oder<br />
Joghurt besser geeignet sind die „Flammen“ zu löschen.<br />
Capsaicin ist der Hauptvertreter aller Capsaicinoide und<br />
sitzt hauptsächlich in den Samen und den weißen Scheidewänden.<br />
Der CapsaicinGehalt variiert in Abhängigkeit<br />
von Standort, Klima, Nährstoffen und Stressfaktoren. In<br />
ungetrockneten Chilis und anderen CapsicumArten sind<br />
durchschnittlich 0,01 0,03 Prozent Capsaicin enthalten,<br />
in getrockneten 0,3 0,5 Prozent.<br />
Scoville-Einheiten – Ein Maß für die Schärfe<br />
Die diversen ChiliSorten und die daraus hergestellten<br />
Produkte zeichnen sich, in Abhängigkeit des Capsaicin<br />
Gehalts, durch eine unterschiedliche Schärfe aus. Der<br />
Pharmakologe Wilbur L. Scoville (1865 1942) entwickelte<br />
1912 das erste Verfahren zur Messung der Schärfe von<br />
Chilischoten. Gemessen wurde, wie in starker Wasserverdünnung<br />
die Schärfe des untersuchten Chilis gerade<br />
noch spürbar war. Der Grad der Verdünnung, bei dem<br />
keine Schärfe mehr festzustellen war, wurde als Sco ville<br />
Einheit (Scoville Heat Units (SHU)) angegeben. Brauchte<br />
es für 1 ml aufbereitete Chili 10 Liter (10.000 ml) Wasser,<br />
bis die Schärfe verschwand, betrug die Schärfe 10.000<br />
SHU. Die durchschnittliche Wahrnehmungsschwelle für<br />
Schärfe liegt bei ca. 16 SHU.<br />
Tab. 1 ScovielleEinheiten anhand einiger Beispiele:<br />
Scoville-Einheit<br />
Beispiel<br />
16.000 000 reines Capsaicin<br />
100.000 350.000 Habaneros<br />
30.000 50.000 Cayennepfeffer<br />
2.500 8.000 JalapeñoChili<br />
100 500 Peperoni<br />
0 10 Gemüsepaprika<br />
Die ScovilleSkala reicht von praktisch null für Paprika bis<br />
zu rund 300.000 für Habaneros. Reines Capsaicin entspricht<br />
16.000.000 Scoville.<br />
Heutzutage wird mit Hilfe der HochleistungsFlüssigchromatographie<br />
oder HPLC (High <strong>Press</strong>ure Liquid Chromatography)<br />
der Gehalt der zwei häufi gsten Capsaicinoide<br />
Capsaicin und Dihydrocapsaicin gemessen und in Scoville<br />
Heat Units umgerechnet.<br />
Wie wirkt Cayennepfeffer?<br />
Capsaicin hat eine antibakterielle und fungizide Wirkung<br />
und eignet sich deshalb z. B. hervorragend für die Konservierung<br />
von Lebensmitteln. In Pfl anzen ist Capsaicin<br />
vermutlich Bestandteil des pfl anzeneigenen Abwehrbzw.<br />
Schutzsystems. Der scharfe Geschmack hält Tiere<br />
davon ab, die Früchte zu konsumieren. Vögel hingegen<br />
sind immun, da sie die für die Schärfeempfi ndung verantwortlichen<br />
Rezeptoren nicht besitzen. So können sie<br />
ohne Probleme die Früchte mit den Kernen essen und<br />
später ausscheiden, was der Verbreitung der Capsicum<br />
Pfl anzen dient.<br />
Cayennepfeffer ist oral eingenommen wärmend, schweißtreibend<br />
und stimuliert die Speichel und Magensäuresekretion.<br />
Traditionell wird Cayennepfeffer bei Verdauungsbeschwerden,<br />
zur Kreislaufstabilisierung, Blutreinigung<br />
und zur Herzstärkung eingesetzt.<br />
Lokal aufgetragen wirkt Capsaicin zunächst wärmend,<br />
durchblutungsfördernd, reizend, gefäßerweiternd und<br />
löst Juckreiz aus. Bei längerer Anwendung ist es schmerzlindernd<br />
und juckreizlindernd. Diese schmerzlindernde<br />
Wirkung funktioniert auf Grundlage des Counterirritans<br />
Effekts, d.h. der Schmerz wird durch einen Gegenreiz gelindert.<br />
Eine hohe CapsaicinDosis hält das Gehirn irrtümlich<br />
für einen starken Schmerz, den es zu bekämpfen<br />
gilt. Das bewirkt die Ausschüttung von Endorphinen, körpereigene<br />
„Schmerzkiller“. Dies kann zu einem gesteigerten<br />
Glücksempfi nden beitragen. Dieser Zustand wird<br />
auch als „PepperHigh“ bezeichnet. Wenn Capsaicin an<br />
den Schmerzrezeptoren angreift, macht es die dort befi<br />
ndlichen Nervenendigungen zugleich unempfi ndlicher.<br />
Cayennepfeffer lindert nachweislich Muskel und Nervenschmerzen<br />
und kann eine positive Wirkung bei der<br />
Behandlung eines Hexenschusses, Juckreiz, Arthritis und<br />
Rheuma haben.<br />
Nebenwirkungen und Gegenanzeigen<br />
Die Einnahme von Cayennepfeffer in hohen Dosen kann<br />
mit starkem Augentränen, Nasenlaufen, erschwerter<br />
Harn entleerung und Brennen bei der Defäkation innerhalb<br />
von 12 Tagen einhergehen. In seltenen Fällen können<br />
Überempfi ndlichkeitsreaktionen auftreten. Nicht angewendet<br />
werden sollte Cayennepfeffer bei einer bekannten<br />
Allergie gegen Paprika.<br />
Bei lokaler Anwendung in Form von Salben gelten leichte<br />
bis mittelschwere Hautreaktionen und eine Verschlechterung<br />
der Beschwerden zu Beginn der Behandlung als<br />
normal und nehmen mit der Zeit ab.<br />
Mit freundlicher Genehmigung<br />
der Redaktion des www.vitalstoffjournal.de<br />
27
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Atrophie/Kachexie: Jährlich erkranken 490.000 Menschen in Deutschland<br />
neu an Krebs. An den Folgen versterben etwa 218.000 Menschen<br />
pro Jahr (Deutsche Krebshilfe e. V., 2012).<br />
Neben Schmerzen, Fatigue, Haarausfall und anderen körperlichen sowie psychischen<br />
Begleiterscheinungen ist der Gewichtsverlust, auch Kachexie genannt, eine<br />
schwerwiegende Folge, die durch Chemotherapie, Operation und Radiotherapie verursacht<br />
werden kann (Theologides, 1979).<br />
Unter Kachexie (zusammengesetzt aus dem Griechischen: kakos „schlecht“ und hexis:<br />
„Zustand“) versteht man die Abmagerung, Auszehrung, den Gewichtsverlust und<br />
progressive Veränderungen von lebenswichtigen Körperfunktionen (Busquets, Almendro,<br />
Barreiro, Fiqueras, Argilés, & LópezSoriano, 2005). Oft wird dieser Zustand<br />
von Appetitlosigkeit begleitet (Bosaeus, Daneryd, & Lundholm, 2002).<br />
Der Schweregrad der Kachexie ist abhängig vom Typ der Tumorerkrankung. Ein Gewichtsverlust<br />
wurde bei 30 bis 80 Prozent der Krebspatienten beobachtet (Dhanapal,<br />
Saraswathi, & Govind, 2011). Bei Pankreas und Magenkrebspatienten tritt Kachexie<br />
am häufi gsten auf, wobei Patienten mit Brustkrebs, NonHodgkinLymphomen und<br />
mit Sarkomen seltener betroffen sind (Fearon, Voss, Hustead, & Cancer Cachexia<br />
Study Group, 2006).<br />
Der tumorbedingte Gewichtsverlust ist ein wichtiger, prognostischer Faktor – je größer<br />
das Ausmaß, desto geringer ist die Überlebensdauer/chance (Dhanapal, Saraswathi,<br />
& Govind, 2011).<br />
Kurkumin zur Behandlung<br />
der Atrophie bzw. tumorinduzierten<br />
Kachexie<br />
28
Ernährung / Prävention<br />
das aber auch nicht, um den Energie und Nährstoffbedarf<br />
zu decken, kann Trinknahrung eingesetzt werden.<br />
Krebszelle<br />
Die Kachexie ist insgesamt für etwa 30 Prozent der<br />
Todesfälle bei Krebspatienten verantwortlich. Sie ist<br />
damit neben der Sepsis die zweithäufi gste Todesursache<br />
von Krebspatienten und wird durch entzündliche<br />
Prozesse ausgelöst. Die Anwendung diätischer Lebensmittel<br />
soll daher unmittelbar nach der Diagnose der<br />
Krebserkrankung beginnen, um eine mögliche Kachexie<br />
der Patienten schon im statu nascendi zu verhindern.<br />
Gegenwärtig erfolgt als Begleittherapie lediglich die<br />
Gabe hochkalorischer Nahrung, was die Progredienz<br />
der Kachexie lediglich verzögert und weitere Komplikationen<br />
(Fettleber) hervorruft. Eine Mangelernährung<br />
tritt bei 30 bis 90 Prozent aller Krebspatienten im Laufe<br />
ihrer Erkrankung auf. Darunter fallen in erster Linie<br />
Menschen mit Tumoren des MagenDarmTraktes (v. a.<br />
in der Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse oder im Magen)<br />
bzw. in der Lunge.<br />
Laut Expertenmeinung kommt es bei bis zu 85 Prozent<br />
der Patienten mit einem Tumor im Gastrointestinaltrakt<br />
im Laufe der Erkrankung zur Kachexie. Bei Lungenkrebspatienten<br />
liegt das Kachexierisiko bei 50 Prozent.<br />
Prinzipiell kann Tumorkachexie in jedem Stadium der<br />
Krebserkrankung auftreten. Meist verliert etwa die<br />
Hälfte der Patienten bereits vor der Diagnose als Folge<br />
von Appetitverlust und frühem Sättigungsgefühl Gewicht.<br />
Die eigentliche Tumorkachexie tritt aber meist in<br />
einem sehr viel späteren Stadium auf.<br />
Da bislang eine Ernährungstherapie allein keinen Erfolg<br />
versprach, wurde meist in regelmäßigen Abständen<br />
versucht, den Ernährungszustand des Patienten festzustellen,<br />
um einer Mangelernährung vorzubeugen. So<br />
kann rechtzeitig die Nahrungsmenge bzw. die täglich<br />
auf genommene Kalorienzahl erhöht werden. Genügt<br />
Bei der Verbesserung des Ernährungszustands geht es<br />
nicht allein um das Wohlbefi nden des Patienten, sondern<br />
auch um die Wirksamkeit der Krebstherapie, die<br />
unter dem Einfl uss von Mangelernährung oder Tumorkachexie<br />
verringert sein kann. So kann es nach einer<br />
Operation zu Wundheilungsstörungen durch entzündliche<br />
Reaktionen kommen, die häufi g bei tumorkachektischen<br />
Patienten auftreten. Außerdem vertragen die<br />
Patienten mit Tumorkachexie eine Chemo oder Strahlentherapie<br />
weniger gut. Eine erfolgreiche Krebsbehandlung<br />
erfordert vom Patienten viel Kraft, die ihm<br />
durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung zur<br />
Verfügung gestellt werden muss. Daher ist es entscheidend,<br />
den Gewichtsverlust rechtzeitig zu verhindern,<br />
die Therapie und Heilungschancen zu erhöhen und<br />
damit die Lebensqualität des Patienten zu verbessern.<br />
Gegenstand aktueller Forschungen ist es, Wirkstoffe<br />
gegen die verheerenden Folgen der Kachexie zu entwickeln.<br />
Die Untersuchungen werden sowohl in vitro als<br />
auch in vivo durchgeführt und basieren auf verschiedenensten<br />
Modellen.<br />
In einem in vivo Modell konnten Eley und Mitarbeiter<br />
(Eley, Russell, & Tisdale, 2007) zeigen, dass die Behand<br />
lung mit Protein Kinase R (PKR)Inhibitoren in kachektischen<br />
Mäusen, denen Fragmente<br />
eines MAC16 Tumors<br />
(Murine adeno carcinoma<br />
16) subkutan in die<br />
seitl ich e Bauchre gion<br />
trans plan tiert wurde,<br />
das Tumor <br />
wachstum hemmte<br />
und dem Gewichtsverlust<br />
entgegen<br />
wirk te. Ähnliche<br />
Ergebnisse kon n<br />
ten in der Studie von<br />
Smith und Mitarbeitern<br />
(2005) gewonnen werden.<br />
Der Leucin Meta bo lit HMB xyza<br />
(βhydro xyβmethyl bu t yrate) vermindert die Proteindegradation<br />
und stimuliert die Proteinsynthese in Skelettmuskeln.<br />
In einem weiteren in vivo KachexieModell konnte der<br />
Anstieg von infl ammatorischen Zytokinen (IL6) in Mäusen,<br />
denen die Zelllinie C26.IVX transplantiert wurde,<br />
detektiert werden. Durch die Zugabe eines monoklonalen<br />
IL6 Antikörpers konnte die IL6Aktivität inhibiert<br />
und damit die Kachexieprogression verhindert werden<br />
(Strassmann, Fong, Kenney, & Jacob, 1992).<br />
29
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Skelettmuskulatur<br />
Die Skelettmuskulatur besteht aus ca. 15 cm langen,<br />
schlauchförmigen Muskelfasern. Charakteristisch sind<br />
hierbei die vielen marginalen Zellkerne sowie die typische<br />
Querstreifung. In jeder Muskelfaser sind viele<br />
Myoblasten zusammengefügt. An der Muskelfaseroberfl<br />
äche befi nden sich einkernige, zum Teil differenzierte<br />
Myoblasten. Diese werden bei Reparaturvorgängen aktiviert,<br />
proliferieren und vereinigen sich mit anderen<br />
Satellitenzellen sowie den Muskelfasern zu neuem<br />
Muskelgewebe (Morgan & Partridge, 2003). Die Ausbildung<br />
spezifi sch funktioneller und morphologischer Eigenschaften<br />
einer Zelle nennt man Differenzierung.<br />
Dem Austritt aus dem Zellzyklus folgt die terminale Differenzierung<br />
der Muskelzelle, d. h. sie kann sich fortan<br />
nicht mehr teilen (BrandSaberi, 2005, Gehring, 1995).<br />
Kurkumin<br />
Kurkumin ist ein Bestandteil des alkoholischen Extrakts<br />
aus dem Rhizom der Pfl anze Curcuma longa, welche zu<br />
der Familie der Ingwergewächse gehört. Das Rhizom<br />
ähnelt dem des Ingwers, die Farbe des Fleisches ist<br />
intensiv gelb bis orange. Das auch Turmeric genannte<br />
Pulver wird in asiatischen Regionen z. B. als Mittel zur<br />
Wundheilung eingesetzt (Aggarwal, Sundaram, Malani,<br />
& Ichikawa, 2007).<br />
Intensive Forschungen konnten zeigen, dass Kurkumin<br />
der Wirkstoff des Pfl anzenpulvers ist. Seither wird Kurkumin<br />
auch als Farbstoff unter Bezeichnung E100 in<br />
der Industrie verwendet. Es gibt u. a. Curry und Senf die<br />
typisch gelbe Farbe.<br />
Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass Kurkumin<br />
eine antiinfl ammatorische, antiseptische, antimalarische<br />
und antioxidative Wirkung zugesprochen werden<br />
kann (zusammengefasst in (Aggarwal, Sundaram, Malani,<br />
& Ichikawa, 2007)). Die folgende Abbildung zeigt<br />
das Wirkungsspektrum von Kurkumin.<br />
Die Wirkung von Kurkumin kann in vitro durch die Aktivierung<br />
von Apoptosesignalwegen begründet werden,<br />
welche gewebe bzw. zellspezifi sch zu sein scheint.<br />
Wirkungsspektrum von Kurkumin bei verschiedenen Krank heiten (links) und auf Genebene (rechts)<br />
(Modifi ziert nach Aggarwal, Sundaram, Malani, & Ichikawa, 2007)<br />
30
Ernährung / Prävention<br />
Die Aktivierung der Caspase3 und 8 durch Kurkumin<br />
wird bei Bush und Mitarbeiter dargestellt (Bush, Cheung<br />
Jr., & Li, 2001). In einer anderen Studie wird die Aktivierung<br />
des extrinsischen Apoptosesignalweges in Magenund<br />
Darmkrebszelllinien beschrieben. Kurkumin aktiviert<br />
auch hier die Caspase8 (Moragoda, Jaszewski, &<br />
Majumdar, 2001). Ebenso kann die Regulierung der<br />
Apoptose über den intrinsischen Signalweg erfolgen.<br />
Shi und Mitarbeiter (Shi, Cai, Yao, Mao, Ming, & Ouyang,<br />
2006) konnten in ovarialen Krebszellen zeigen,<br />
dass durch Zugabe von Kurkumin die antiapoptotischen<br />
Proteine Bcl2 und BclXL herunterreguliert wurden.<br />
In in vivo Studien konnte gezeigt werden, dass Kurkumin<br />
während einer Sepsis die NFKBAktivität reduziert<br />
und somit der Muskelproteolyse entgegenwirkt (Poylin,<br />
et al., 2008). Thaloor und Mitarbeiter (1999) fanden heraus,<br />
dass Kurkumin die Muskelregeneration nach einer<br />
Verletzung stimuliert. Antikachektische Effekte von Kurkumin<br />
konnte dagegen im gastrointestinalen Tumormodell<br />
nicht gezeigt werden (Busquets, Carbó, Almendro,<br />
Quiles, LópezSoriano, & Argilés, 2001).<br />
Hat Kurkumin anti-kachektische Eigenschaften?<br />
Für die Inhibierung der Atrophie wurden daher in eigenen<br />
Studien, Muskelzellen mit verschiedenen Konzentrationen<br />
Kurkumin behandelt. Die Auswirkung auf den<br />
Zellindex (CI, Zelldurchmesser wird hierbei über den<br />
elektrischen Widerstand gemessen) wurde dabei kontinuierlich<br />
beobachtet und nach 24 h zusätzlich mikroskopisch<br />
überprüft. Der CI ist ein Maß für die Impedanz<br />
und korreliert direkt mit der Adhäsion der Muskelzelle,<br />
ihrem Differenzierungsgrad und dem zellulären elektrischen<br />
Widerstand. Es können generell keine Aussagen<br />
über eine Dosisabhängigkeit der Wirkung von Kurkumin<br />
getroffen werden. Während durch die Zugabe der Konzentration<br />
von 5µM Kurkumin am Tag 5 und 7 nach der<br />
Atrophieinduktion zunächst eine Abnahme des Zellindex<br />
(CI) hervorgerufen wurde, hatte sich dieser Prozess<br />
nach 10 Tagen normalisiert. Durch die Zugabe von 5µM<br />
über einen längeren Zeitraum stieg der CI um bis zu<br />
60 Prozent an. Das könnte heißen, dass Kurkumin über<br />
längere Zeiträume eingenommen, zu einem veränderten<br />
Muskelstoffwechsel einhergehend mit einer verstärkten<br />
Muskelbildung führt.<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Ziel unserer Forschungen ist es, sekundäre Pfl anzenstoffe<br />
auf ihre antiatrophische Wirkung auf murine<br />
C2C12Myotuben zu untersuchen. Die Ergebnisse<br />
sollen als Grundlage für die Entwicklung einer Technologieplattform<br />
dienen. Diese Plattform besteht aus<br />
einem etablierten System, welches die Bereitstellung<br />
von atrophischen Muskelzellen ermöglicht. Anschließend<br />
können verschiedene Substanzen mit antiatrophischen<br />
Eigenschaften getestet werden. Im Hinblick<br />
auf diese Zielstellung sollten die Experimente<br />
zur Atrophieinduktion mittels Dexamethason wiederholt<br />
und optimiert werden. Ebenso wird die Verwendung<br />
weiterer Substanzen zur Auslösung der Atrophie<br />
empfohlen.<br />
Durch die Zugabe von proinfl ammatorische Zytokinen<br />
wie TNF α wird die Akkumulation von Ceramid<br />
erhöht, welches u. a. die Proteinsynthese in Myotuben<br />
inhibiert (De Larichaudy, et al., 2012). In einer<br />
Studie von Eley und Mitarbeitern (2007) wird beschrieben,<br />
dass PIF (Proteolyseinduzierender Faktor)<br />
und Ang II (Angiotensin II) die Autophoshorylierung<br />
von PKR (RNAabhängige Proteinkinase) induzieren<br />
und somit die Proteinsynthese in Myotuben<br />
vermindern. Ebenso ist die erhöhte Expression von<br />
Murf1 und MAFbx ein Index für die erhöhte Proteindegradation<br />
in atrophischen Zellen (Stitt, et al.,<br />
2004).<br />
Der gleiche Effekt wird erzeugt, wenn rekombinantes<br />
Myostatin die DNA und Proteinsynthese in Myoblasten<br />
und teilweise in Myotuben inhibiert (Taylor, et al.,<br />
2001). In dieser Studie wird jedoch die Proteindegradation<br />
durch die Einbindung des radioaktivmarkierten<br />
[1 14 C] Leucins nachgewiesen. Die Verwendung<br />
des xCELLigence Systems zum Nachweis der<br />
Atrophie wäre somit eine sicherere Alternative zu<br />
den derzeit verwendeten, auf radioaktiver Markierung<br />
basierenden Methoden.<br />
Dr. Andreas Schubert (links) und Christopher Oelkrug (rechts)<br />
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI), Leipzig<br />
31
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Chronische Erkrankungen ...<br />
und kein Ende in Sicht<br />
Gestaltet sich unsere medizinische Versorgung effizient<br />
oder verspielen wir unsere Zukunft? Soll der Staat<br />
alle Aufgaben regeln oder kann nicht die Bevölkerung<br />
wichtige Funktionen übernehmen? Diese Fragen<br />
werden sehr kontrovers diskutiert. Die Antworten darauf<br />
könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie diffe rieren<br />
von Partei zu Partei, von Institution zu Institution bzw.<br />
von Lobby isten zu Lobbyisten.<br />
Was allerdings von niemandem mehr bestritten wird, ist die große Herausforderung<br />
unserer demographischen Entwicklung. Waren im Jahre<br />
1950 nicht einmal 10 Prozent unserer Bevölkerung älter als 65 Jahre, so sind im Jahre<br />
2025 fast 25 Prozent der Menschen in West-Europa über 65 Jahre alt. Nach diesen<br />
Zahlen wird die Altersstruktur in 20 Jahren ähnlich sein, wie die derzeit in Florida,<br />
von den Amerikanern liebevoll „Gods Waiting-Room“ genannt.<br />
32
Prävention<br />
Von der Akutversorgung zur Betreuung<br />
chronisch kranker Menschen – ein Paradigmenwechsel<br />
Die Konditionierung unserer Heilberufler ist auch heute<br />
noch stark geprägt durch die Zeit, in der die Akut <br />
ver sorgung im Vordergrund jeglichen Handels stand.<br />
Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts waren es in<br />
der Regel Infektionskrankheiten und Verletzungen an<br />
denen die Menschen verstarben. In den letzten 60 Jahren<br />
hat sich dieses Bild komplett gewandelt. Inzwischen<br />
versterben 9 von 10 Menschen an einer chronischen<br />
Er krankung. Aber worin liegt der entscheidende Unterschied?<br />
Ein distinktives Merkmal ist das Ausmaß<br />
des Einflusses, den der Patient auf seine Heilung oder<br />
seinen Therapieerfolg hat. Bei akuten Erkrankungen hat<br />
der Patient vergleichsweise wenig eigenen Einfluss – so<br />
ist er z. B. auf ein wirksames Antibiotikum oder auf einen<br />
guten Operateur angewiesen.<br />
Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich jedoch die<br />
Bedürfnisse der Patienten bzw. die Herausforderungen<br />
grundlegend verändert. Die Menschen kommen mit<br />
Asthma, COPD (= chronisch obstruktive Lungenerkrankung),<br />
Herzkreislauferkrankungen, Typ 2 Diabetes oder<br />
Rheuma – also chronischen Erkrankungen, mit denen<br />
sie Jahre, meist Jahrzehnte leben müssen. Neu daran<br />
ist, dass die Patienten auf ihren eigenen Therapieerfolg<br />
selber den größten Einfluss haben. Es sind die vielen<br />
kleinen alltäglichen Entscheidungen des Patienten über<br />
seine Ernährung, die Bewegung, den Umgang mit Stress,<br />
die Einnahme von Medikamenten und vieles mehr, die<br />
darüber entscheiden, wie eine chronische Krankheit<br />
verläuft. Der Arzt kann nur entscheidende Weichen<br />
stellen, aber „gehen“ muss der Patient selbst.<br />
Beispiel Typ 2 Diabetes – eine Krankheit wird<br />
zur Epidemie<br />
Die International Diabetes Federation (IDF) schätzt,<br />
dass weltweit mehr als 6 Prozent aller Menschen an<br />
Diabetes leiden. Epidemiologisch betrachtet haben wir<br />
es inzwischen mit einer globalen Epidemie zu tun. In<br />
den vergangenen Jahren stieg die Zahl der an Diabetes<br />
Typ 2 Erkrankten merklich an. Nach Schätzungen der<br />
IDF sind mittlerweile rund 10 Prozent der Deutschen,<br />
Österreicher bzw. Schweizer von Diabetes betroffen.<br />
Alleine in Deutschland werden jeden Tag 800 Menschen<br />
neu mit Typ 2 Diabetes diagnostiziert. Die Anzahl<br />
wächst in diesem Land jedes Jahr um eine Stadt mit der<br />
Größe von Karlsruhe. Während noch in den 80er Jahren<br />
fast ausschließlich ältere Menschen an Typ-2-Diabetes<br />
erkrankten, sind es heute auch zunehmend junge Erwachsene.<br />
Alleine in den Vereinigten Staaten von Amerika<br />
waren in den letzten fünf Jahren 30 Prozent der<br />
neu dia gnostizierten Typ 2 Diabetiker nicht älter als 30<br />
Jahre.<br />
Einer der größten Risikofaktoren in diesem Zusammenhang<br />
ist das Übergewicht. Etwa 15 bis 20 Prozent<br />
der Jugendlichen in Deutschland, Österreich und der<br />
Schweiz sind übergewichtig. Bei 8 Prozent ist dieses<br />
Übergewicht krankhaft (Adipositas). 85 Prozent dieser<br />
jungen Menschen werden voraussichtlich ihr gesamtes<br />
Leben an Übergewicht leiden. Ein nicht unerheblicher<br />
33
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Teil wird bereits in jungen Jahren an Typ-2-Diabetes erkranken.<br />
Das erste Mal in der Geschichte der modernen<br />
Medizin kommen wir damit an einen Punkt, an dem<br />
ein Teil der jungen Generation eine deutlich geringere<br />
Lebenserwartung hat als die Generation ihrer Eltern.<br />
Drei Viertel aller Diabetiker sterben an den Folgen eines<br />
Herzinfarktes. Schlaganfälle treten viermal häufiger, Depressionen<br />
und Parkinson etwa doppelt so oft auf wie<br />
in der Normalbevölkerung. Das Risiko einer Demenz<br />
steigt dreifach, bei zusätzlichem Bluthochdruck elffach.<br />
Alle 15 Minuten wird alleine in Deutschland eine durch<br />
Diabetes bedingte Amputation durchgeführt.In der<br />
Summe sind dies jährlich rund ebenso vie le Amputationen,<br />
wie im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges an<br />
Wehrmachtssoldaten vorgenommen wurden.<br />
Selbstmanagement der Patienten gefragt<br />
Heute zählt die Bundesrepublik Deutschland, Österreich<br />
und die Schweiz rund 8 bis 10 Millionen Menschen<br />
mit Typ 2 Diabetes. Weitere 6 Millionen sind noch gar<br />
nicht diagnostiziert. Läuft die Entwicklung so weiter,<br />
wie sie derzeit von Statten geht, werden in 20 Jahren 25<br />
Prozent der Erwachsenen in diesen Ländern Diabetiker<br />
sein. Somit werden wir im Jahre 2035 allein für Typ 2<br />
Diabetes und Adipositas so viel Geld aufbringen müssen,<br />
wie wir derzeit für das gesamte Gesundheitssystem<br />
investieren.<br />
Diabetes ist eine so genannte Selbstmanagementerkrankung.<br />
Die IDF führt den Behandlungserfolg auf bis<br />
zu 90 Prozent auf das Verhalten der Patienten zurück.<br />
Um möglichst lange gesund leben zu können, müssen<br />
Diabetiker nicht nur die Zusammenhänge zwischen Erkrankung,<br />
Ernährung und körperlichem Training kennen.<br />
Sie müssen auch die mit einer chronischen Krankheit<br />
verbundene seelische Belastung bewältigen, ihren<br />
Diabetes überwachen und die medikamentöse Behandlung<br />
in Eigenregie durchführen.<br />
Dabei bilden sich Patienten ihre eigenen Vorstellungen<br />
von ihren Erkrankungen und entwickeln als „medi zinische<br />
Laien“ so genannte „Laienhypothesen“. Diese<br />
stimmen oftmals nicht mit dem medizinischen Rat<br />
über ein, nehmen jedoch eine dominierende Rolle ein.<br />
Viele Patienten verändern die Dosis ihrer Medikamente,<br />
setzen diese ab oder nehmen sie nur bei akutem<br />
Bedarf. Für die Volkswirtschaft bedeutet das, dass sich<br />
die Zeiten der Erkrankung verlängern, sich die Heilung<br />
hinauszögert oder sogar verhindert wird. Folglich werden<br />
vermehrte Einweisungen in Praxis und Krankenhäuser<br />
verursacht, wobei nicht unerhebliche zusätzliche<br />
Kosten entstehen. Nach Schätzungen der Europäischen<br />
Stiftung für Gesundheit (Schweiz) und dem Institut<br />
für Gesundheitskommunikation und Versorgungsforschung<br />
an der Sigmund-Freud Universität in Wien<br />
belaufen sich die durch die nicht vorhandenen Selbstmanagementfähigkeiten<br />
resultierenden Folgekosten in<br />
Europa auf 200 - 300 Mrd. Euro pro Jahr. Alleine die<br />
Folgen der Drug Non-Compliance werden mit 70 Mrd.<br />
Euro jährlich beziffert.<br />
34
Prävention<br />
Zusammenfassung<br />
Bei einem Menschen mit Typ 2 Diabetes und den entsprechenden<br />
Möglichkeiten zum Selbstmanagement<br />
der Erkrankung belaufen sich die Kosten, die durch das<br />
Gesundheitssystem zu tragen, sind auf bis zu 3.000<br />
Euro pro Jahr. Ein Patient, dessen Therapie nicht erfolgreich<br />
verläuft, verursacht aufgrund der Folgekomplikationen<br />
– unabhängig vom menschlichen Leid – Kosten<br />
von bis zu 35.000 Euro pro Jahr.<br />
Die Fähigkeit zum Selbstmanagement zu fördern, erfordert<br />
dabei ein umfassendes Betreuungskonzept, das<br />
alle Heilberufl er gleichermaßen einschließt. Eine Therapie,<br />
die das hohe Maß an Eigenverantwortung berücksichtigt,<br />
benötigt eine patientenzentrierte Kommunikation.<br />
Gerade hier gilt es umzudenken. Patientenkommunikation<br />
darf sich nicht auf die bloße Verordnung<br />
von Medikamenten beschränken. Es geht um ein grundsätzliches<br />
Verständnis für die Einstellungen, Sorgen<br />
und Bedürfnisse der Erkrankten.<br />
Kein Therapeut hat seherische Fähigkeiten. Trotzdem<br />
wird innerhalb von 30 Sekunden aus einem Patienten<br />
Arzt ein ArztPatientengespräch. Daher gilt: Hinhören,<br />
nicht zuhören. 80 Prozent aller Patienten benötigen<br />
genau 2 3 Minuten ihre Probleme und Bedürfnisse zu<br />
artikulieren. Da mehr als 80 Prozent unserer Patienten<br />
mit einer chronischen Erkrankung nicht einmal 4 Stunden<br />
pro Jahr mit einem Arzt verbringen, können wir<br />
nicht davon ausgehen, dass die verbleibenden 364<br />
Tage und 20 Stunden problemlos verlaufen. Nur, wenn<br />
wir die Patienten „empowern“, können diese die Verantwortung<br />
übernehmen, die diese übernehmen müssen,<br />
damit wir auch in Zukunft das hohe Niveau der<br />
medizinischen Versorgung sichern können. Blenden wir<br />
diesen Punkt aus, dann wird die Glorie der Vergangenheit<br />
zum Stolperstein der Zukunft. In einem sich stark<br />
verändernden Gesundheitssystem sind wir nicht in der<br />
Lage die „Gesundheitsschlachten“ von morgen mit den<br />
Waffen von gestern zu schlagen.<br />
Prof. Dr. Dr. Fred Harms<br />
Leiter des Instituts für Ge sundheitskommunikation<br />
und Versorgungsforschung,<br />
Sigmund-Freud Uni versität<br />
Wien, Vize-Präsident der Europäischen<br />
Stiftung für Gesundheit, Schweiz,<br />
Fachlicher Beirat des NEM e.V.<br />
/ Anzeige /<br />
PETITION:<br />
Freiheit für gesunde Nahrung!<br />
Gesunde Ernährung ist für uns alle wichtig und darf nicht verhindert werden.<br />
Foto: © Pitopia, Ildiko Papp, 2015<br />
Europa schränkt schon seit längerem den Verzehr von Lebensmitteln<br />
durch die Novel-Food-Verordnung ein. Lebensmittel,<br />
die seit hunderten von Jahren außerhalb der EU<br />
verzehrt werden, werden künftig per se verboten und brauchen<br />
eine Genehmigung durch die Novel-Food-Verordnung.<br />
Wollen wir uns verbieten lassen, was wir essen wollen? Wir sagen<br />
NEIN und fordern: Freiheit für gesunde Nahrung!<br />
Machen Sie mit:<br />
Online-Petition unter www.nem-ev.de<br />
NEM e.V. Verband mittelständischer<br />
europäischer Hersteller und<br />
Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
& Gesundheitsprodukten<br />
e.V. 35
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Warum ist Homo cystein<br />
so interessant?<br />
Homocystein entsteht aus dem Methylierungszyklus, einem Stoffwechselweg<br />
in unserem Organismus. Dieser Stoffwechselweg dient haupts ächlich<br />
der Synthese von S-Adenosylmethionin, ein Cosubstrat fast aller Enzyme.<br />
Durch die Methylgruppen werden die Biomoleküle übertragen. Diese Methyltransferasen<br />
sind an Biosynthesen und Regulationsprozessen unseres<br />
Stoffwechsels beteiligt.<br />
Die Aminosäure Homocystein kann zu Cystein umgewandelt werden. Diese<br />
Aminosäure dient zur Synthese von Glutathion.<br />
Homocystein ist ein kurzlebiges Zwischenprodukt aus dem Stoffwechsel, wenn der<br />
Organismus mit allem gut versorgt ist und keine entsprechenden Störungen aufweist.<br />
Das bedeutet, je niedriger der Plasmaspiegel im Blut, umso besser für den Organismus.<br />
Eine Erhöhung im Plasma fi ndet dann statt, wenn die intrazelluläre Konzentration zunimmt.<br />
In diesem Falle entlastet sich die Zelle und führt das Homocystein ins Blut ab.<br />
Bei zunehmendem Anstieg im Plasma spricht man von der Hyperhomocysteinämie.<br />
Dies kann besonders mit zunehmendem Alter einhergehen.<br />
36
Ernährung / Prävention<br />
Hier können besonders die Bereiche Koronarien der kleinen<br />
Hirnaterien sowie der peripheren Arterien betroffen<br />
sein. Bereits eine geringe Erhöhung der Homocysteinkonzentration<br />
kann das Endithel schädigen, wodurch<br />
Gerinnungsprozesse ausgelöst werden.<br />
Plaque in der Arterie<br />
Eine Veränderung, die auch heute noch immer unterschätzt<br />
wird und in der täglichen Praxis wenig Beachtung<br />
fi ndet, obwohl diese Erkenntnisse seit 1962 bekannt sind.<br />
In prospektiven Kohorten Studien (Fraingham, Hordaland)<br />
konnte nachgewiesen werden, dass die Risiken für<br />
Schlaganfall, Herzinfarkt, Venentrombosen, Demenz,<br />
Osteoporose, Depression und weitere psychische<br />
Störungen zunehmen.<br />
Warum wird dieser Erkenntnis so wenig Bedeutung in<br />
der täglichen Praxis geschenkt? Ein wichtiger Grund ist<br />
sicherlich, dass hier die Prävention im Vordergrund<br />
steht und des Weiteren nicht Medikamente sondern die<br />
BVitamine zum Einsatz kommen müssen.<br />
Homocystein fördert gleich mehrere artereosklerotische<br />
Prozesse, ein Beispiel (die Oxidation von LDL,<br />
Schaumzellbildung, Thrombozytenaggreation). Homocysteinerhöhung<br />
im Plasmaspiegel kann gleichfalls als<br />
Risikofaktor für artereothrombotische Gefäßprozesse<br />
angesehen werden.<br />
Was bedeutet dies alles?<br />
Erhöhte Konzentration von Homocystein erhöht die Produktion<br />
von sehr aggressiven Sauerstoffradikalen (H 2 O 2 )<br />
und vermindert die Bildung von Stickstoffmonoxid. Diese<br />
körpereigene Substanz wirkt gefäßerweiternd. Durch<br />
H 2 O 2 ausgelöste freie Radikale können nun die Innenwände<br />
der Arterien (Endothelschicht) verletzt oder zerstört<br />
werden. Durch diese Verletzung entstehen Gerinnungsprozesse<br />
die mit Ablagerung von Blutplättchen und<br />
Fibrin einhergehen. Ist dieser Prozess einmal eingeleitet,<br />
können sich in der weiteren Entwicklung fetthaltige Substanzen<br />
ablagern und es kommt zur Plaquebildung. Der<br />
Cholesteringehalt der abgelagerten Plaques liegt bei ca.<br />
1 Prozent. Durch die ständigen Ablagerungen verengen<br />
sich die Arterien bis zum Totalverschluss.<br />
Senkt ein niedriger Homocysteinspiegel das<br />
Schlaganfallrisiko?<br />
Seit mehr als 10 Jahren wird die Hypothese diskutiert, ob<br />
ein Einfl uss von Homocystein auf das Schlaganfall oder<br />
Herzinfarktrisiko besteht.<br />
Ja, ein solches Risiko besteht neben anderen Risikofaktoren<br />
wie Rauchen, Übergewicht, hohe Blutfettwerten,<br />
Bluthochdruck. Diese Risiken kann der Betroffene selbst<br />
beeinfl ussen, nicht die Erkennung seines erhöhten Homocysteins.<br />
Hier muss eine entsprechende Untersuchung<br />
vorgenommen werden.<br />
Eine Senkung des Homocysteinspiegels um 3 umol/l<br />
lässt das Schlaganfallrisiko um 10 Prozent sinken, eine<br />
Senkung des Homocysteinspiegels um 25 Prozent lässt<br />
das Risiko um 20 Prozent sinken. Metaanalysen zeigen<br />
jedoch, dass die Risikoabschwächung erst nach ca. 3<br />
Jahren greift. Dies benötigt eine lange Behandlungszeit.<br />
Ein gesunder Wert sollte unter 10 umol/l liegen. Mit zunehmendem<br />
Alter steigt das Risiko, daher sollte hier immer<br />
eine Zeitnahe Überprüfung durchgeführt werden<br />
und nicht abwartend, ob der Wert eine steigende Tendenz<br />
aufweist.<br />
Eine sinnvolle Behandlung ist die Zuführung der Vitamine<br />
B12, B6, und Folsäure. B12 ist zudem wichtig für die Zellkernreifung.<br />
Warum besteht die Gefahr, dass B12 dem<br />
Organismus nicht mehr ausreichend zugeführt wird? Ein<br />
wichtiger Grund ist der Rückgang des Intrinsic Factor<br />
(wird im Magen gebildet) er ist ein spezielles Transportmolekühl,<br />
was von den Belegzellen neben dem Transportprotein<br />
Haptocorrin im Magen gebildet wird. Nachdem<br />
das Vitamin B12 im Magen durch Enzyme aus der<br />
37
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Nahrung gelöst wurde, wird es mit dem Haptocorrin<br />
in den Dünndarm transportiert. Hier kann dann das B12<br />
an den Intrinsic Factor angebunden werden und über<br />
entsprechende Rezeptoren in die Schleimhaut weiter<br />
in den Körper gelangen. Da in der täglichen Nahrung nur<br />
geringe Mengen von B12 vorhanden sind, wird verständlich<br />
wie wichtig ein ausreichender Intrinsic Factor ist.<br />
Ein Rückgang kann schon früh eintreten, besonders ist<br />
hier der Raucher angesprochen. Mit zunehmendem Alter,<br />
etwa ab 50 Jahre sollte auch der Homocysteinspiegel<br />
überprüft werden. Dieser sinkt mit zunehmendem Alter.<br />
Menschen, die oft unter Gastriden leiden, sollten immer<br />
ihren Homocyteinspiegel überprüfen lassen.<br />
Bei einem reduzierten Intrinsic Factor sollten die täglichen<br />
Gaben von B12 in kleinen Mehrfach-Dosen erfolgen,<br />
ein Zuviel wird nutzlos ausgeschieden.<br />
Will man eine sichere Therapie durchführen, um Homocystein<br />
abzubauen, sind gleichfalls Vitamin B6 und<br />
Folsäure sinnvoll. Nach mehr als 40 jähriger Erfahrung<br />
konnte ich den Betroffenen mit der Injektionstherapie<br />
und den späteren oralen Verabreichungen helfen. Bei<br />
den Therapien müssen die möglichen Verursacher mit<br />
therapiert werden. Hier gilt besonders der Lehrsatz<br />
„Ursachenbehandlung und nicht nur Symptome bekämpfen.“<br />
Vitamin B6 ist durchaus ein Multitalent in unserem Stoffwechsel.<br />
Unter dem Begriff Vitamin B6 sind 3 wichtige<br />
Formen vereint: Pyridoxal, Pyridoxin und Pyridoxamin.<br />
Pyridoxal-5-Phosphat ist die Form von B6 die als Coenzym<br />
in wichtigen Stoffwechselprozessen vorkommt und<br />
hat somit in unserem Stoffwechsel eine große Bedeutung.<br />
Bei Mangel an B6 sind neben dem Abbau von Homocystein<br />
in Cystein und damit die Risikosenkung für<br />
kardiovaskuläre Erkrankungen weitere Erkrankungen<br />
möglich z.B.: Hauterkrankung (Seborrhea), Depression,<br />
Erschöpfung, Verwirrtheit, Tremor, usw.<br />
Vitamin B6 bringt Verbesserung z.B.: Senkung des Homocysteinspiegels<br />
und Verringerung des kardiovaskulären<br />
Risikos, Hemmung der Virenentwicklung bei Herpes,<br />
Unterstützung des Immunsystems, positive Wirkung bei<br />
Karpaltunnelsyndrom usw.<br />
Folsäure ein weiteres wichtiges Vitamin aus der<br />
Reihe der B-Vitamine<br />
Folsäure und Vitamin B12 stehen in einer engen Beziehung.<br />
Beide Vitamine bewirken im Zusammenspiel die<br />
So sollte am Anfang immer die Injektion stehen<br />
Nach entsprechendem Aufbau des Magens mit naturheilkundlichen<br />
Mittel kann dann mit der oralen Einnahme<br />
begonnen werden. Bei Risikopatienten sollte jedoch in<br />
entsprechenden Abständen weiter eine Injektion verabreicht<br />
werden.<br />
Literatur<br />
• The American Journal of Clinical <strong>Nutrition</strong> Derminaten der Plasmagesamthomocysteinkonzentration in der Framingham offsprin –<br />
Kohorte 1, 2, 3, 4<br />
• Institut für Medizinsche - Diagnostik Berlin – Potsdam<br />
• Abels, J., Vegter, J.J.M., Woldring, M.G., Jans, J.H. and Nieweg, H.O. (1959), The Physiologie Mechanism of Vitabin B12 Absorption.<br />
• Acta Medica Skandinavia, 165: 105 - 113<br />
• Without Intrinsic Factor. David Rotter<br />
• Zentrum für Humangenetik, Homocystein Netzwerk,<br />
• Neue Risikofaktoren Universitätskrankenhaus Eppendorf – Hamburg<br />
• Deutsches Grünes Kreuz für Gesundheit e.v.<br />
• Dachliga Homocystein<br />
38
Anzeige /<br />
Ernährung / Prävention<br />
Bildung von Purin und Pyrimidin. Die Folsäure nimmt<br />
auch bei der Transformation an einigen Aminosäuren teil,<br />
so beispielweise an der Umwandlung von Homocystein<br />
zu Methionin. Durch diese Möglichkeit kann das kardiovaskuläre<br />
Risiko gesenkt werden.<br />
Folsäure-Mangel kann zu Müdigkeit, Depression, Verdauungsstörungen<br />
führen, um nur einige Bereiche aufzuführen.<br />
Es gibt keine Lagerstätte in unserem Körper, so<br />
macht sich eine Mangelernährung kurzfristig bemerkbar.<br />
Mangelerscheinungen können auch auftreten bei: Störung<br />
der Resorption im Darm, Alkoholismus, bei Einnahme<br />
bestimmter Medikamente, um auch hier nur einige zu<br />
nennen.<br />
Überprüfen wir unsere Nahrungskette<br />
Vieles ist in unserer heutigen Ernährung nicht mehr oder<br />
nur noch in abgeschwächter Form enthalten. Besonders<br />
müssen Veganer und Vegetarier auf eine unterstützende<br />
Ernährung achten, um die notwendigen Vitamine zu erhalten.<br />
Immer deutlicher wird die Zuführung von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
auf Grund solcher Erkenntnisse. Oft<br />
gibt es umfangreiche Diskussionen mit den Krankenkassen<br />
und Versicherungen oder ihrer Gutachter, ob hier<br />
eine Erstattung möglich ist, weil B-Vitamine auf Grund<br />
von Untersuchungen insbesondere bei erhöhtem Homocystein<br />
sinnvoll sind.<br />
Da hilft ein Gerichtsurteil (AZ: 30C 502/03-75):<br />
„Nahrungsergänzungsmittel, die nicht zum Zweck der<br />
Ernährung oder des Genusses verschrieben werden, sind<br />
zu erstatten.“<br />
Im medizinischen Bereich kann man über viele Dinge viele<br />
Jahrzehnte diskutieren, wenn aber vieles dafür spricht,<br />
Risiken auszuschalten, Menschen zu helfen, sie vor<br />
schweren körperlichen Schäden zu bewahren, kann die<br />
Diskussion nur im Hintergrund geführt werden. Das Gebot<br />
der Stunde ist, nach der Erfahrung und den heutigen<br />
Erkenntnissen zu helfen.<br />
Vom Rohstoff zum Fertigprodukt -<br />
Alles aus einer Hand.<br />
Wir bieten Ihnen Full-Service<br />
in den Bereichen:<br />
• Nahrungsergänzungsmittel<br />
• Diätetische Lebensmittel<br />
• Funktionelle Lebensmittel<br />
• BIO-Produkte gemäß Öko-VO<br />
• Kosmetika und<br />
• Ergänzungsfuttermittel<br />
Dreh- und Angelpunkt<br />
ist Dr. Stefan Werner.<br />
Von der Ausbildung<br />
zum Chemiker/<br />
Natur stoff chemiker<br />
bringt Dr. Werner langjährige<br />
internationale<br />
Erfahrung in der Nahrungsergänzungsmittelbranche<br />
ein. Er begegnet<br />
jeder Herausforderung mit dem Leitsatz:<br />
„Der Kunde steht im Mittelpunkt“.<br />
Innovative Produkte entwickeln – das machen<br />
wir seit 20 Jahren. Während dieser Zeit haben<br />
wir mehrere 1000 Produkte initiiert, die Produkte<br />
bis zur Markteinführung durch unsere<br />
Kunden betreut und produziert.<br />
Peter Abels<br />
Heilpraktiker,<br />
Vorsitzender des EFN – European<br />
Federation for Naturopathy E.V.<br />
und Kooperationspartner des NEM e.V.<br />
Leiter des Steinbeis-Transfer-Instituts<br />
Gesundheitsprävention, Therapie<br />
und Komplementärmedizin<br />
Fachlicher Beirat des NEM e.V.<br />
Besonders stolz sind wir auf unsere Innovationen<br />
und unseren hohen Qualitätsmaßstab, bestätigt<br />
durch einen internationalen Innovationspreis<br />
und häufi g gelobte, „für gut befundene“<br />
Produkte in deutschen Warentests.<br />
DR. WERNER PHARMAFOOD GmbH<br />
Karl-Böhm-Str. 122<br />
D-85598 Baldham<br />
Tel.: +49-(0)8106-307375<br />
39<br />
Fax.: +49-(0)8106-308769<br />
email: info@dr-werner-pharmafood.de
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Schwermetalle –<br />
Ein Revival<br />
alter Bekannter<br />
Schwermetalle stellen ein Gesundheitsrisiko dar –<br />
ein neuer ein facher Schnelltest ermöglicht Belastungsmonitoring<br />
Schwermetalle – Vorkommen<br />
Vor einigen Jahren war das Thema „Schwermetalle/<br />
Schwer metallbelastungen“ in Verbindung mit Amalgam<br />
füllungen in kariösen Zähnen in aller Munde. Die<br />
Diskussion über einen Zusammenhang zwischen einer<br />
Schwermetallbelastung und dem Abrieb im Mundbereich<br />
wurde sehr kontrovers geführt. In den nachfolgenden<br />
Jahren konnte aber doch eine messbare, wenn<br />
auch geringe Schwermetallbelastung durch Amalgam<br />
Abrieb aufgezeigt werden.<br />
Mit der zunehmenden Zahnhygiene und Verwendung<br />
von Keramikfüllungen geriet das Thema Schwermetallbelastung<br />
etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Zu<br />
Unrecht, denn Schwermetalle fi nden sich im gesamten<br />
biologischen Kreislauf. Selbst wenn das Benzin kein<br />
Blei mehr enthält, weniger Amalgam verwendet wird<br />
und die Emissionen der Schwerindustrie um 70 90<br />
Prozent deutlich gesenkt werden konnten (Umwelt<br />
Bundesamt 2014) – die Schwermetalle werden immer<br />
neu in die Umwelt eingetragen. Nahezu alle Verbrennungs<br />
und viele Produktionsprozesse emittieren<br />
schwer metallhaltige Gase oder Stäube. Bei hohen Anteilen<br />
an Cadmium, Blei oder Quecksilber kann hier ein<br />
hohes Gefährdungspotential entstehen.<br />
Mit der Einführung der neuen Energiesparlampen arbeitet<br />
sich das Thema Schwermetalle wieder nach vorn<br />
in den Blickpunkt des Interesses: bei der Produktion<br />
dieser Leuchtmittels wird u.a. das hochgiftige Quecksilber,<br />
auch der Hauptbestandteil der alten Amalgamfüllungen,<br />
verwendet.<br />
Weitestgehend unbeachtet ist die Tatsache, dass z. B.:<br />
Quecksilber in vielen Produkten verwendet wird und<br />
wurde, und somit immer wieder in den biologischen<br />
Kreislauf eingespeist wird.<br />
Der BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz<br />
Deutschland – beklagt eine hohe Schwermetallbelastung<br />
in den Mündungsbereichen großer Flüsse und im<br />
Meer. Durch die regelmäßige Ausbaggerung der Flüsse,<br />
um tiefe Fahrrinnen für die Megacontainerschiffe zu gewährleisten,<br />
fallen große Mengen als Abraum an, der in<br />
hohen Konzentrationen giftige SchwermetallCocktails<br />
enthält. Der Abraum wird häufi g im Meer verklappt, so<br />
dass ein Teil der Schwermetalle über die Nahrungskette<br />
wieder in den biologischen Kreislauf gerät.<br />
Aber Schwermetalle fi nden sich auch in kommunalen<br />
Abwässern und Klärschwämmen. Quellen sind hier z.B.:<br />
alte Bleirohre, häusliche Verbrennungsanlagen, medizinischer<br />
Bereich, Fahrbahnabrieb.<br />
Schwermetalle – chemisch gesehen<br />
Zu den Schwermetallen zählen eine ganze Reihe von<br />
Metallen. Eine genaue Defi nition für den Begriff Schwermetalle<br />
gibt es nicht. Man hat sich allgemein darauf<br />
verständigt, dass alle Metalle mit einer Dichte größer<br />
als 5 g/cm 3 zu den Schwermetallen zählen.<br />
40
Ernährung / Prävention<br />
stoffes mit der Konsequenz eines Gesundheitsrisikos<br />
ist natürlich genauso gegeben.<br />
Im nachfolgenden wird der Kreislauf der bekanntesten<br />
Schwermetalle kurz dargestellt.<br />
Auf eine detaillierte Darstellung der Toxikologie wird im<br />
Rahmen dieses Artikels verzichtet. Der Autor verweist<br />
auf die einschlägige Fachliteratur.<br />
Neben den bekannten, giftigen Schwermetallen wie<br />
z. B.: Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) oder<br />
Palladium (Pd), gehören auch die Elemente Eisen (Fe),<br />
Mangan (Mn), Kupfer (Cu), Chrom (Cr) oder Zink (Zn)<br />
dazu. Diese Metalle sind, im Gegensatz zu der erstgenannten<br />
Gruppe, in kleinen Mengen lebenswichtig für<br />
Pfl anzen, Tiere und Menschen; sie werden daher als<br />
essentielle Schwermetalle oder auch, im allgemeinen<br />
Sprachgebrauch besser bekannt, als Spurenelemente<br />
bezeichnet. Allerdings können selbst diese essentiellen<br />
Spurenelemente bereits bei leichten Überdosierungen<br />
für den menschlichen Organismus gesundheitsschädlich<br />
sein.<br />
Blei (Pb)<br />
Die Giftigkeit von Schwermetallen ist z. T. schon seit<br />
dem Altertum bekannt. Schon die Römer verwendeten<br />
Bleiverbindungen zur Entsäuerung von Wein. Bleiacetat,<br />
wegen seines süßen Geschmacks auch Bleizucker genannt,<br />
wurde bis ins 19. Jahrhundert eingesetzt und<br />
häufi g Weinen zur Geschmacksverbesserung beigemischt.<br />
Ludwig van Beethoven ist ein prominentes Opfer<br />
einer schleichenden Bleivergiftung. Seine Schwerhörigkeit<br />
und Tod sind Folge seines Konsums an billigen,<br />
mit Bleizucker versehenen Weinen.<br />
Auch heute besteht die Hauptbleibelastung über die<br />
Nahrungskette, z.B.: durch Grünkohl, kräuterhaltige<br />
Trockensuppen oder Muscheltiere. In Haushalten mit<br />
bleihaltigen Wasserleitungen ist auch eine Bleibelastung<br />
über das Trinkwasser gegeben. Die Belastung über<br />
die Luft ist eher gering. In industriellen Gebieten oder<br />
stark Feinstaubbelasteten Städten kann die Belastung<br />
über die Luft aber extrem steigen. Milchprodukte sowie<br />
ein Mangel an Vitaminen und essentiellen Spurenelementen<br />
steigert die Aufnahme von Blei, ebenso wie<br />
Fasten oder Diäten.<br />
Bleibelastung<br />
in Muscheltieren<br />
und Grünkohl<br />
Im menschlichen Stoffwechsel verdrängen die Schwermetalle<br />
mit einer höheren Dichte z. B. Quecksilber, Blei<br />
und Cadmium die wichtigen, essentiellen Schwermetalle<br />
wie z.B. Zink aus deren zellulären Bindungsstellen. In<br />
diesem Fall ist die Aufnahme von Zink beeinträchtigt,<br />
worunter die Funktion von Zellen und Entgiftungssystemen<br />
leidet.<br />
Schwermetalle in Umwelt und Nahrung<br />
Die Aufnahme von Schwermetallen erfolgt über die Umwelt<br />
oder Nahrungskette. Kritisch ist die konstante Aufnahme<br />
kleiner Mengen, die sich in den Organen und<br />
Geweben anreichern und zu einem Gesundheitsrisiko,<br />
zu einer Gesundheitsbelastung, werden können. Der<br />
medizinische Begriff „Belastung“ beinhaltet bereits das<br />
Gesundheitsrisiko, während die Umweltmedizin nicht<br />
so weit geht und unter dem Begriff „Belastung“ zunächst<br />
die bloße Anwesenheit eines Schadstoffes versteht.<br />
Aber das Risiko der Anreicherung eines Schad<br />
41
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Cadmium (Cd)<br />
Cadmium ist ein ebenfalls weitverbreitetes Metall, das<br />
in der Industrie häufi g eingesetzt wird. Das Metall fi ndet<br />
sich in Farbpigmenten, Kunststoffen, Batterien oder im<br />
Korrosionsschutz. Ähnlich wie bei Blei liegt auch hier<br />
die Hauptbelastungsquelle in der Nahrung. Mit 36 Prozent<br />
haben Weizenmehlhaltige Backwaren den höchsten<br />
Anteil an der täglichen Cadmiumaufnahme. Weitere<br />
Quellen können sein: Karotten (13 Prozent), Salat oder<br />
Kartoffeln (18 Prozent). Die Belastung des Gemüses<br />
kommt über eine Bodenbelastung durch das Ausbringen<br />
Cdhaltiger Phosphatdünger oder Klärschlämme.<br />
Über die Wurzeln werden die Schadstoffe in die Pfl anze<br />
aufgenommen. Raucher haben eine bis zu 4fach höhere<br />
CadmiumKonzentration im Blut als Nichtraucher.<br />
Quecksilber (Hg)<br />
Auch Quecksilber ist seit dem Altertum bekannt. Die<br />
griechischen Ärzte setzen es als Heilmittel ein, wegen<br />
der häufi g verwendeten toxischen Dosen allerdings mit<br />
mäßigem Erfolg. Bis ins 20. Jahrhundert wurde Quecksilber<br />
zur Behandlung der Syphilis, damals eine Volksseuche,<br />
bis zur Entdeckung des Penicillins eingesetzt.<br />
Heute werden in Deutschland jährlich noch ca. 20 Millionen<br />
Amalgamfüllungen eingesetzt; das entspricht einer<br />
Gesamtmenge an Quecksilber von ca. 10 t.<br />
Quecksilber fi ndet sich in vielen Alltagsprodukten wie<br />
Batterien, Thermostate, Thermometer, Manometer, Barometer,<br />
oder Leuchtmittel (s.o.). In Deutschland werden<br />
so jährlich 250 t Quecksilber und dessen Verbindungen<br />
verbraucht. Im biologischen Kreislauf werden<br />
durch bakterielle Zersetzung aus den schwerlöslichen,<br />
weniger giftigen anorganischen Quecksilberverbindungen<br />
leicht lösliche hochgiftige organische Quecksilberverbindungen,<br />
die sich in der Nahrungskette anreichern.<br />
Die höchsten Gehalte weisen fetthaltige Fischsorten<br />
auf.<br />
Look“Instrument dem allgemeinen Verbraucher zur<br />
Verfügung. Methodische Grundlage des Tests ist die im<br />
Falle einer Belastung entstehende Verminderung der<br />
Zinkresorption. Der Test verwendet eine indirekte Methode,<br />
um eine allgemeine Belastung aufzuzeigen.<br />
Der Test ist einfach und in wenigen Arbeitsschritten und<br />
zu Hause durchzuführen. Als Probenmaterial wird Morgenurin<br />
verwendet. Etwas Morgenurin in das Testgefäß<br />
mit Testreagenz geben, Indikatorblatt dazu – der Testansatz<br />
ist fertig. Das Testgefäß verschließen, leicht schütteln<br />
und nicht mehr als 5 Minuten warten. Die Auswertung<br />
erfolgt über eine chemische Farbreaktion. Bei ei<br />
Schwermetallmonitoring – sinnvolle Gesundheitsprophylaxe<br />
Wie dargestellt, ist das Risiko, Schwermetalle aufzunehmen<br />
vielfältig. Das Human Biomonitoring beschäftigt<br />
sich mit der Bestimmung einer StoffwechselBelastung<br />
und gegebenenfalls mit deren Folgen im Organismus.<br />
Im Rahmen eines Belastungsmonitoring werden Stoffe<br />
oder deren Verbindungen in Körperfl üssigkeiten bestimmt.<br />
Das Belastungsmonitoring erlaubt die Bewertung<br />
der individuellen Gesamtbelastungssituation. Zusammen<br />
mit der Bewertung weiterer individueller Faktoren<br />
wie Wohnsituation, Ernährungsweise, Sozialstatus,<br />
physischer Zustand kann hier ein sinnvoller Risikoindex<br />
ermittelt werden.<br />
Mit einem neuen, einfachen Schnelltest (Biomonitor<br />
SCHWERMETALLE) steht zum ersten Mal ein „First<br />
42
Ernährung / Prävention<br />
ner geringen Belastung bleibt der Test grün. Bei zunehmender<br />
Belastungskonzentration verändert sich die<br />
Farbe über grau zu rot (siehe Darstellung Farbkarte).<br />
Der Gelbbereich stellt den Grenzbereich des Tests im<br />
oberen Bereich dar. Der Test ist für den medizinischen<br />
Laien geeignet und konzipiert. Testdurchführung sowie<br />
Interpretation erfordern keine Fachkenntnisse.<br />
medizin bewegen. Durch ArbeitsplatzExposition oder<br />
andere Situationen kann es zu akuten Schwermetallver<br />
gif tungen kommen, die umgehend schulmedizinisch<br />
mit entsprechenden Maßnahmen behandelt werden<br />
müssen.<br />
Als „FirstLook“Test empfi ehlt er sich aber auch in Gesundheitsinstituten<br />
wie z. B.: Arztpraxen sowie ganzheitliche<br />
Zahnärzte mit kleinem Labor oder Heilpraktiker <br />
Praxen. Gerade bei kurmäßigen (Schwermetall) Entgiftungen<br />
kann mit diesem Test der Fortschritt der Entgiftungsmaßnahme<br />
beobachtet werden.<br />
Im Rahmen eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements<br />
ist eine regelmäßige Belastungskontrolle einmal<br />
im Monat zu empfehlen. Wegen der in der Regel geringen,<br />
aber dauernden Aufnahmemengen dauert die<br />
Anreicherung bis zur „sichtbaren“ Schwelle eine Weile.<br />
Ebenso müssen Entgiftungskuren gegebenenfalls durch <br />
aus mehrmals durchgeführt werden, um die Schwermetalle<br />
zu entfernen.<br />
Ergänzend soll dargestellt werden, dass wir uns mit<br />
dem Test im Bereich von Individual und Präventions<br />
Dr. rer. nat. Cornelia Friese-Wehr<br />
Joining HEALTH Medicare Int. GmbH<br />
Quellen:<br />
• Reichl, F., Moderne Umweltmedizin, Lehmanns Media 2011<br />
• Tomic, Str., <strong>Nutrition</strong> <strong>Press</strong> 3, 28 34, 2014<br />
www.wikipedia.de<br />
/ Anzeige /<br />
43
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Indien – ein Markt für euro -<br />
päische Nahrungsergänzungsmittel<br />
und Kosmetik?!<br />
Indien – als Beschaffungsmarkt<br />
für Rohstoffe<br />
Wer kennt sie nicht, die begehrten Rohstoffe, die seit der Antike ihren<br />
Weg vom fernen indischen Kontinent nach Europa gefunden haben<br />
und hier mit Gold aufgewogen wurden? Gewürze aus Kerala, Farben<br />
aus Madras, Tee aus Darjeeling und viele uns fremdartig erscheinende<br />
Früchte wie z. B. „Amla“ (Phyllanthus emblica).<br />
Einerseits ist Indien noch immer eines der<br />
Länder, in denen ein nicht unbedeutender<br />
Teil der Bevölkerung nicht ausreichend oder zu einseitig<br />
ernährt wird. Z. B. gibt es Reis und Linsen in allen denkbaren<br />
Würzungen, aber diese Würzerei täuscht oft nur<br />
eine Ernährungsvielfalt vor, lässt aber übersehen, dass<br />
auf vielen Tellern zu wenige Nährstoffe aus sonstigen<br />
Gemüsen, Früchten und Getreideprodukten angeboten<br />
werden. Das Land hält einen WeltSpitzenplatz beim<br />
Vorkommen ernährungsbedingten Übergewichts (Zufuhr<br />
zu vieler Kalorien) und Diabetes bei gleichzeitigen<br />
Mangelerscheinungen aufgrund zu geringer Aufnahme<br />
essentieller Nährstoffe.<br />
44
Ernährung / Kosmetik<br />
Wie steht es also um die Qualität indischer Produkte?<br />
Natürlich kann hier keine verallgemeinernde Gesamtaussage<br />
getroffen werden. Doch ein Blick in das Rapid<br />
Alert System des Zolls der EULänder (https://webgate.ec.europa.eu/rasff)<br />
zeigt, dass es an Bemängelungen<br />
für Ware indischen Ursprungs nicht fehlt. Es gibt<br />
indische Unternehmen, die eigene Fertigungsanlagen<br />
für solche Ware betreiben, die nach Europa oder USA<br />
exportiert wird, während die Ware für den innerindischen<br />
Markt in anderen Fabriken hergestellt wird. Viele<br />
indische Betriebe verfügen über die Auditbasierten<br />
Zertifi zierungen (BFS, IFS, Bio/Organic etc.), die von<br />
europäischen Kunden vorausgesetzt werden. Aber in<br />
diesem Land stoßen Auditbasierte Zertifi zierungssysteme<br />
eben an ihre Grenzen. Institut Kurz hat in den vergangenen<br />
Jahren zahlreiche indische Rohstoffe und<br />
Fertigprodukte im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel,<br />
Kosmetik und Pharmaka auf Einhaltung gesetzlicher<br />
Grenzwerte und auf Einhaltung der HerstellerSpezifi<br />
kation getestet. Als Fazit darf mit allem Respekt gezogen<br />
werden: Ob der Lieferant Zertifi zierungen hat<br />
oder nicht, es ist empfehlenswert jede einzelne importierte<br />
Charge auf Einhaltung der zugesicherten Qualität<br />
testen zu lassen. Wenn das gegeben und dem Lieferanten<br />
bekannt ist, wird gleichbleibend hervorragende<br />
Ware geliefert.<br />
Andererseits ist Indien durchaus ein nennenswerter<br />
Exporteur von Lebensmitteln und Rohstoffen für Lebensmittel,<br />
Pharmaka und Kosmetik. Fruchtpüree von<br />
Mangos der begehrten Sorte Alphonso, Curcumin, SojaProteine<br />
sind Beispiele, also das Besondere, das es<br />
nur aus Indien gibt (worauf wir später noch einmal eingehen)<br />
und auch Massenprodukte, wie sie ebenfalls<br />
aus anderen Ländern bezogen werden können. Bei letzteren<br />
entscheiden natürlich der Preis inklusive der<br />
Transport und Importkosten sowie die Einhaltung der<br />
handelsüblichen Qualität. Bei ersteren sind es vor allem<br />
die besonderen Eigenschaften der Ware sowie natürlich<br />
auch dort die Einhaltung der zugesicherten Qualität.<br />
Gibt es denn – über die handelsüblichen Rohstoffe<br />
hinaus – besondere indische Rohstoffe,<br />
die für europäische NEM-/Kosmetik-Hersteller<br />
von Interesse sein können?<br />
Nahrungsergänzungsmittel bzw. Gesundheitskosmetik,<br />
örtlich auch „Nutraceuticals“ und „Cosmeceuticals“<br />
genannt; Begriffe, die einerseits aus den Worten „<strong>Nutrition</strong>“<br />
bzw. Cosmetics und andererseits aus dem zweiten<br />
Teil von „Pharmaceuticals“ gebildet sind, haben in<br />
Indien ein wesentlich höheres Ansehen in der Bevölkerung,<br />
bei den Vertretern des Gesundheitswesens und<br />
auf regierungsamtlicher Seite als in Europa. So gibt es<br />
in den Regierungen einiger indischer Bundesstaaten<br />
eigene Abteilungen für ayurvedische Produkte („Ayush<br />
Department“), die den Auftrag haben, die Verbreitung<br />
und Anwendung solcher Nutraciticals und Cosmeceuticals<br />
zu fördern. Die Produkte werden von den zahlreichen<br />
Heilpraktikern verschrieben und entweder in<br />
Klein mengen traditionell in Handarbeit oder aber industriell<br />
hergestellt. Im indischen Recht nehmen die Nutraceuticals<br />
eine eigenständige Rolle neben den Lebensmitteln<br />
und den Arzneimitteln ein (während Nahrungsergänzungsmittel<br />
bzw. „Food for Special Groups“ [die<br />
ehemaligen bilanzierten Diäten] in Europa ja spezielle<br />
Untergruppen der Lebensmittel sind.). Dabei wird nicht<br />
zwischen schützender (NEM) oder heilender (AM) Wirkung<br />
unterschieden, sodass die in Europa übliche Abgrenzung<br />
in Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel<br />
für Indien so nicht anwendbar ist.<br />
Die Gesundheits und Heilslehren Ayurveda, Siddha<br />
und Unani gehen auf z. T. zwei bis dreitausendjährige<br />
(schriftlich verfasste) Traditionen zurück und haben Rezepte<br />
hervorgebracht, die heute z. T. spezifi sch „Ayushceuticals“<br />
genannt werden. Beispiele für solche ayurvedischen<br />
Formulierungen sind (hier identifi ziert nur mit<br />
dem „aktiven Hauptbestandteil“ und der ihm in der indischen<br />
Tradition zugeschriebene gesundheitliche Wirkung.<br />
In der Regel sind detaillierte Zubereitungsvorschriften<br />
vorhanden):<br />
• Haritaki (Terminalia Chebula): Soll die Verdauungsfunktionen<br />
unterstützen, entschlackend auf den ganzen<br />
Körper wirken, die Sehfähigkeit unterstützen.<br />
• Satvari Ghrita (Asparagus Racemosus, ein Verwandter<br />
des uns bekannten Gemüsespargels Asparagus<br />
Offi cinalis): soll stillende Mütter unterstützen.<br />
• Trikatu (Gemisch aus Piper Longum, Piper Nigrum,<br />
Zingiber Offi cinale, Phyllanthus Amarus): Soll schützende<br />
Wirkung gegen Lebererkrankungen haben.<br />
45
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
In den traditionellen Schriften (Chastras) lassen sich<br />
hunderte weitere Rezepte für solche Nutraceuticals fi n<br />
den und somit auch hunderte Kandidaten für Ausgangstoffe<br />
ggf. interessanter Nahrungsergänzungsmittel<br />
oder Gesundheitskosmetik. In Europa ist dieser Schatz<br />
an Rezepturkandidaten bisher weitgehend ignoriert<br />
worden. Auch die Pharmaindustrie hat sich hierfür nicht<br />
systematisch interessiert.<br />
Lassen sich die traditionell zugeschriebenen<br />
schützenden/heilenden Wirkungen denn nachweisen?<br />
Den „theoretischen Überbau“ der Lehren von Ayurveda,<br />
Siddha, Unani (z. B. Vata [Wind, Luft und Äther], das<br />
Bewegungsprinzip; Pitta [Feuer und Wasser], das Feuerbzw.<br />
Stoffwechselprinzip; Kapha [Erde und Wasser],<br />
das Strukturprinzip) kann man, bei allem Respekt vor<br />
der traditionellen Überlieferung, sicherlich als „nicht<br />
verifi zierbar“ bzw. „wissenschaftlich nicht weiterführend“<br />
bei Seite legen. Anders sieht es mit der gerade<br />
von indischen Fachleuten immer wieder betonten Erkenntnisbasis<br />
einer zweitausendjährigen Epidemiologie<br />
(also einer über zweitausend Jahre gesammelten empirischen<br />
Beobachtung eben dieser schützenden/heilenden<br />
Wirkung) aus. Dieser lange Beobachtungszeitraum<br />
und die Vielzahl der Fälle würden in der Tat die empirische<br />
Basis für den Wirkungsnachweis vieler europäischer<br />
Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitskosmetika<br />
und Arzneimittel bei weitem übertreffen. Leider ist<br />
diese reiche empirische Erfahrung zu den indischen<br />
Nutraceuticals zwar schriftlich aber im wissenschaftlichen<br />
Sinne nur schlecht dokumentiert. Praktisch alle<br />
Ansprüche, die man heute an empirisch verwertbare<br />
Daten stellt (z. B. Defi nition der beobachteten Fälle, beobachtete<br />
Fallzahl, Positiv und Negativergebnisse, Beschreibung<br />
der Begleitumstände) sind in aller Regel für<br />
diese indischen Rezepte nicht erfüllt, ganz zu schweigen<br />
von einer exakten chemisch/molekularbiologischen<br />
Beschreibung.<br />
Die hunderten traditionellen Ayurveda, Siddha, Unani<br />
Rezepte sind daher eine interessante Quelle für neue<br />
Nahrungsergänzungsmittel, Heilkosmetika oder auch<br />
Arzneimittel, es führt aber kein Weg daran vorbei, dass<br />
vor einem Einsatz in Europa zwei Fragenkomplexe nach<br />
den heutigen in Europa geltenden Anforderungen geklärt<br />
werden müssen:<br />
• Sind die jeweiligen Rohstoffe in Europa zugelassen?<br />
(Oder würden sie „noch nicht zugelassene“ Botanicals<br />
oder Novel Food etc. sein, die einem Zulassungsverfahren<br />
unterzogen werden müssen?)<br />
• Kann der Wirkungsnachweis gemäß heutigen europäischen<br />
Anforderungen erbracht werden? (Bekanntlich<br />
bestehen hier unterschiedliche Anforderungen<br />
an den Wirkungsnachweis für Nahrungsergänzungsmittel,<br />
Heilkosmetika, Arzneimittel). 1 )<br />
Indien – als Absatzmarkt für europäische Nahrungsergänzungsmittel<br />
Der Markt: Obwohl (oder gerade weil?) die Speisen in<br />
Indien traditionell überwiegend vegetarisch sind, gilt<br />
die Ernährung weiter Teile der indischen Bevölkerung<br />
hinsichtlich der Zufuhr an essentiellen Nährstoffen als<br />
nicht ausgewogen. (Unterschiedlich gewürzter Reis ist<br />
eben noch kein variantenreiches vegetarisches Gericht).<br />
Das wird auch von den damit befassten Behörden<br />
so beurteilt. Die zusätzliche Supplementierung<br />
durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist für<br />
die Schichten, die es sich leisten können, daher eher<br />
die Regel als die Ausnahme. Bei der Abschätzung die<br />
46<br />
1 Institut Kurz betreibt in Kooperation mit der indischen<br />
Kasturba Health Society, Sthankvasi Jain<br />
Aarandhan Dham, Mumbai 400056, ein Projekt zur<br />
„Reverse Pharmakology“ in dem für vier solcher traditioneller<br />
Formulierungen die exakte chemische<br />
und molekularbiologische Charakteri sierung und<br />
der Wirkungsnachweis erbracht werden soll.
Ernährung / Kosmetik<br />
ses derzeit schon vorhandenen Marktes in Indien hilft<br />
der folgende Vergleich weiter: Wenn in Deutschland<br />
ggf. jeder zehnte Einwohner gesundheitsbewusst und<br />
wohlhabend genug ist, um sich Nahrungsergänzungsmittel<br />
zu leisten, und wenn dies in Indien vielleicht nur<br />
auf jeden hundertsten Einwohner zutrifft, so sind es<br />
dann immer noch deutlich mehr potentielle indische<br />
Kunden (ca. 12 Mio.) als deutsche (ca. 8 Mio). Tendenz<br />
weiter rapide steigend, einerseits durch das Bevölkerungswachstum<br />
und andererseits durch den ökonomischen<br />
Aufstieg weiterer Bevölkerungsschichten. Der<br />
indische Markt für industriell gefertigte Nutraceuticals<br />
wird für 2017 auf ca. 6 Milliarden US$ geschätzt. Indische<br />
Branchenstatistiker gehen davon aus, dass dort in<br />
ca. 10 bis 15 Jahren der Markt für Nutraceuticals größer<br />
sein wird als der Pharmamarkt. Wo fi ndet man sonst<br />
noch solche Wachstumsmärkte?<br />
Für einen Absatz europäischer Produkte in Indien<br />
spricht:<br />
• Europäische (und speziell britische, schweizerische<br />
oder deutsche Produkte) genießen einen exzellenten<br />
Ruf beim Konsumenten sowie bei den dort so wichtigen<br />
Heilpraktikern<br />
• Die notwendigen Zulassungen über das zuständige<br />
föderale Ministerium (FSSAI = Food Saferty and<br />
Standards Agency of India) werden wohlwollend begleitet<br />
(siehe die oben angeführte generelle Aufgeschlossenheit<br />
der Behörden)<br />
• Eine der europäischen Health Claims Verordnung<br />
analoge Vorschrift hinsichtlich der Anforderungen an<br />
die auszulobenden Wirkungen ist zwar in Vorbereitung,<br />
aber noch (lange?) nicht in Kraft. Die bisherigen<br />
Entwürfe zeigten, dass man aus den internationalen<br />
Erfahrungen lernen will und die Anforderungen für<br />
Claims in Indien deutlich praxisnäher als beim europäischen<br />
Vorbild gestalten will<br />
• Englisch wird überall in der indischen Geschäftswelt<br />
und bei vielen Konsumenten verstanden.<br />
Zu beachten ist jedoch:<br />
• Die sprichwörtliche indische Administration wird man<br />
nur mit einem indischen Partner vor Ort erfüllen<br />
können<br />
• die im internationalen Handel üblichen kommerziellen<br />
Gepfl ogenheiten (Akkreditiv oder Vorkasse etc.) zum<br />
Selbstschutz sind unbedingt einzuhalten, werden von<br />
den indischen Partnern auch verstanden und als normal<br />
akzeptiert, weil der Rechtsweg für Europäer<br />
nicht einfach ist<br />
Hon. Prof. Dr. Helmut Weidlich<br />
• Geschäftsführender Gesellschafter der Institut Kurz GmbH<br />
• Honorarprofessor der Tamil Nadu Agricultural University,<br />
Coimbatore, India benannter Sachverständiger für Nutraceuticals<br />
der All-India Handelskammer FICCI (Federation<br />
of Indian Chambers of Commercea and Industry)<br />
sowie assoziiertes Mitglied der Tamil Nadu Ayurvedic, Siddha<br />
and Unani Drug Manufacturers Association (TASUDMA)<br />
• Fachlicher Beirat des NEM e. V.<br />
• Standortwahl ist gleichbedeutend mit Marktwahl. Die<br />
einzelnen indischen Bundesstaaten sind extrem unterschiedlich,<br />
wesentlich unterschiedlicher als die<br />
zur EUgehörenden Staaten untereinander, in Kultur,<br />
Sprache, Schrift, Kaufkraft.<br />
Die Markterkundung<br />
Eine der besten Gelegenheiten den indischen Markt für<br />
Nahrungsergänzungsmittel aus erster Hand kennen zu<br />
lernen, ist die Teilnahme als Besucher oder auch Aussteller<br />
an der alljährlichen Konferenz und Messe „Nutra<br />
India Summit“, deren 10. Ausgabe demnächst wieder<br />
vom 18. bis 20. März 2015 in Mumbai stattfi nden wird:<br />
http://www.nutraindiasummit.in/nutra_2015/index.<br />
php. Marktsegmente, Kundenpotentiale, mögliche indische<br />
Partner, Entwicklungs und Konsumententrends,<br />
alles dies wird dargestellt. An der letztjährigen gleichen<br />
Veranstaltung, der „9th Nutra India Summit“ haben alle<br />
52 Vortragende, über 50 Aussteller und 2500 Besucher,<br />
ausschließlich zum Thema „Nutraceuticals“ teilgenommen.<br />
NEM e.V. wird zusammen mit Institut Kurz auf dieser<br />
Konferenz und Messe mit eigenem Stand vertreten<br />
sein. Wir laden interessierte Mitglieder ein, ebenfalls als<br />
Besucher oder als Aussteller (jeweils zu Vorzugskonditionen)<br />
teilzunehmen. Ein reichhaltiges Hauptprogramm<br />
und interessante Nebenprogramme führen in den indischen<br />
Markt als Rohstoffl ieferant oder als Absatzmarkt<br />
für Fertigprodukte ein.<br />
Natürlich ist es auch möglich, individuell den indischen<br />
Markt zu erkunden. Wer hier Unterstützung sucht, kann<br />
sich gerne an den Vorstand des NEM e.V. oder Institut<br />
Kurz wenden.<br />
47
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Gefahrstoffe im Griff:<br />
Neues Angebot für verbessertes<br />
Gefahrstoffmanagement<br />
Der sichere Umgang mit Gefahrstoffen ist vor allem für kleine und mittlere<br />
Betriebe (KMU) oft eine besondere Herausforderung. Um ihre Mitgliedsunternehmen<br />
darin noch besser zu unterstützen, haben die Berufsgenossenschaft<br />
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) und die Berufsgenossenschaft<br />
Holz und Metall (BGHM) jetzt die gemeinsame „Geschäftsstelle Gefahrstoffinformation“<br />
gegründet.<br />
Die Geschäftsführer Ulrich Meesmann<br />
(BG RCI) und Dr. Albert Platz (BGHM)<br />
sind überzeugt, dass mit dieser Neugründung die Mitgliedsbetriebe<br />
in ihrer Kompetenz für die Prävention<br />
von betrieblichen Gesundheitsgefahren gestärkt werden.<br />
„Unser Ziel ist es, das gemeinsame Knowhow zusammenzuführen,<br />
um die bereits bestehenden Angebote<br />
zum Gefahrstoffmanagement zu bündeln, weiterzuentwickeln<br />
und zu optimieren“, erläutert Geschäftsstellenleiter<br />
Dr. rer. nat. Thomas Martin, Mitarbeiter im<br />
KompetenzCenter Wissenschaftliche Fachreferate der<br />
BG RCI.<br />
Bisher haben die beiden beteiligten Unfallversicherungsträger<br />
jeweils eigene Gefahrstoffi nformationssysteme<br />
betrieben. Das GisChem der BG RCI (www.gischem.de)<br />
beinhaltet Datenblätter mit Informationen zum sicheren<br />
Umgang mit Gefahrstoffen, interaktive Module zur Erstellung<br />
von Betriebsanweisungen sowie den GHSKon<br />
verter und den GHSGemischrechner. Die GISMET der<br />
BGHM (www.gismetonline.de) besteht aus Datenblättern<br />
und Betriebsanweisungsentwürfen. Beide Gefahrstoffi<br />
nformationssysteme orientieren sich an den speziellen<br />
Anforderungen der jeweiligen Branchen, stehen<br />
aber allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.<br />
„Durch die Kooperation können wir unser Angebot nun<br />
auf eine deutlich breitere Basis stellen und gleichzeitig<br />
Synergieeffekte nutzen, da Gesetzesänderungen oder<br />
andere Neuerungen nur noch einmal eingepfl egt werden<br />
müssen“, freut sich Dr. Wolfgang Damberg, Präventionsleiter<br />
der BGHM.<br />
In den nächsten Monaten wird die Geschäftsstelle Gefahrstoffi<br />
nformation die bisherigen Informationen überarbeiten<br />
und neu konzipieren. Das neue, gemeinsame<br />
Angebot soll Anfang 2015 zur Verfügung stehen.<br />
Weitere Informationen:<br />
Geschäftsstelle Gefahrstoffinformation<br />
c/o Berufsgenossenschaft Rohstoffe<br />
und chemische Industrie (BG RCI)<br />
KurfürstenAnlage 62<br />
69115 Heidelberg<br />
Telefon: 06221 510828360<br />
EMail: thomas.martin(at)bgrci.de<br />
Quelle: BG RCI > <strong>Press</strong>e & Medien > <strong>Press</strong>emitteilung<br />
48
eBay-Auktionen:<br />
Vorsicht beim Abbruch<br />
Sei es das zu klein gewordene Kinderfahrrad, die Designer-<br />
Jeans oder das vorletzte Handymodell: Wer etwas verkaufen<br />
möchte, tut dies heutzutage oftmals über eBay. Das Einstellen<br />
eines Artikels geht ja auch (fast) kinderleicht. Doch wie<br />
sieht es aus, wenn man sich doch nicht vom lieb gewonnenen<br />
Stück trennen mag, der Nachbar inzwischen Interesse<br />
am Kinderfahrrad bekundet oder die erhofften hohen Gebote<br />
ausbleiben?<br />
Natürlich bietet eBay die Möglichkeit, Auktionen auch wieder abzubrechen.<br />
Das geht allerdings nur unter engen Voraussetzungen,<br />
will man sich nicht hinterher Schadensersatzforderungen ausgesetzt sehen, wie das<br />
jüngste Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) zum Thema zeigt. Die ARAG Experten<br />
sagen Ihnen, was Sie bei einem Abbruch beachten sollten und informieren außerdem<br />
über die Tricks der sogenannten „Abbruchjäger“.<br />
49
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Wie funktioniert ein Vertragsschluss bei eBay?<br />
Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches<br />
(BGB) wird ein Vertrag in der Regel durch zwei übereinstimmende<br />
Willenserklärungen – Angebot und Annahme<br />
genannt – geschlossen. Beim Verkauf von Waren<br />
ist das „Angebot“ auf einer Internetseite oder –<br />
ganz klassisch – im Schaufenster dabei aber nur eine<br />
Aufforderung an den Kunden, ein Angebot im Rechtssinne<br />
abzugeben. Die Annahme und damit der Vertragsschluss<br />
erfolgt erst durch die Bestellbestätigung<br />
des Onlineshops oder an der Kasse. Bei Versteigerungen<br />
über eBay sieht dies anders aus: Laut den Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen (AGB) des Portals machen<br />
Sie, wenn Sie einen Artikel auf eBay.de einstellen,<br />
nämlich bereits ein verbindliches Angebot auf den Abschluss<br />
eines Vertrages über diesen Artikel. Bietet ein<br />
Käufer nun auf den Artikel, erklärt er damit die Annahme<br />
Ihres Angebots. Sein Gebot erlischt, wenn ein<br />
höheres Gebot abgegeben wird. Mit demjenigen, der<br />
bei Ablauf der Auktion das Höchstgebot abgegeben<br />
hat, kommt schließlich ein Vertrag zustande.<br />
Abbruch nur bei berechtigtem Grund<br />
Doch auch bei einem vorzeitigen Abbruch der Auktion<br />
durch den Verkäufer kann ein wirksamer Kaufvertrag<br />
zustande gekommen sein, sofern zu diesem Zeitpunkt<br />
bereits Gebote auf den Artikel abgegeben wurden. In<br />
diesem Fall sind Sie verpflichtet, den Artikel an den zum<br />
Zeitpunkt des Abbruchs Höchstbietenden herauszugeben.<br />
Anders sieht es nach den eBay-Regeln nur dann<br />
aus, wenn Sie einen berechtigten Grund hatten, Ihr Angebot<br />
zurückzunehmen und die schon abgegebenen<br />
Gebote zu streichen. Dabei gibt es laut den AGB zwei<br />
Arten von Gründen:<br />
Sie haben sich beim Einstellen des Artikels geirrt,<br />
d. h. es liegen die Voraussetzungen der gesetzlichen<br />
Irrtumsanfechtung (§ 119 BGB) vor. Das kann z. B. der<br />
Fall sein, wenn Sie aus Versehen einen falschen Startpreis<br />
oder Sofort-Kaufen-Preis eingegeben haben (sogenannter<br />
Erklärungsirrtum) oder den Artikel versehentlich<br />
bei eBay eingestellt haben, weil Sie ihn vorher<br />
schon verkauft hatten (sogenannter Inhaltsirrtum).<br />
Denkbar ist auch, dass Sie sich über ein entscheidendes<br />
Merkmal des Artikels geirrt haben, also etwa dachten,<br />
der angebotene Sessel sei ein Nachbau, tatsächlich<br />
handelt es sich aber um ein originales Designer-<br />
Stück (sogenannter Eigenschaftsirrtum). Dass in diesen<br />
Fällen für den Verkäufer ein berechtigter Grund vorliegt,<br />
sich von seinem Angebot zu lösen, hat Anfang des Jahres<br />
auch der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil<br />
erneut be stätigt (Az.: VIII ZR 63/13).<br />
Sie können den Artikel aus Gründen, die Sie nicht verschuldet<br />
haben, nicht an den Höchstbietenden herausgeben.<br />
Darunter fällt z. B. der Diebstahl des Artikels<br />
nach Beginn der Auktion. Aber auch, wenn Sie den Artikel<br />
verlieren oder er beschädigt wird, sind Sie berechtigt,<br />
die Auktion zu beenden. Denken Sie aber daran,<br />
dass Sie den Grund für den Abbruch im Zweifelsfall<br />
dem Höchstbietenden gegenüber nachweisen müssen!<br />
Kein Grund für eine vorzeitige Beendigung des Angebots<br />
liegt hingegen vor, wenn Sie den eingestellten Artikel<br />
während der Dauer der Auktion anderweitig verkauft<br />
oder verschenkt haben. Auch das Argument, Sie<br />
hätten es sich anders überlegt und wollten den Artikel<br />
nun doch nicht mehr verkaufen, zählt nicht. Gleiches<br />
gilt selbstverständlich für den Fall, dass Sie angesichts<br />
des Verlaufs der Auktion befürchten, den gewünschten<br />
Preis nicht erzielen zu können.<br />
50
Anzeige /<br />
Unser Praxistipp, wenn Sie eine Auktion abbrechen<br />
müssen<br />
Wenn Sie eine Auktion abbrechen, für die es schon Gebote<br />
gibt, werden die Bieter von eBay zwar über die<br />
vorzeitige Beendigung des Angebots informiert. Wenden<br />
Sie sich in diesem Fall aber dennoch selbst an den<br />
Höchstbietenden und teilen ihm Ihren (berechtigten)<br />
Grund für den Abbruch mit. So beugen Sie eventuellen<br />
Streitigkeiten vor.<br />
Das Risiko von Schadensersatzforderungen<br />
Brechen Sie eine Auktion ohne berechtigten Grund ab,<br />
sollten Sie sich klar darüber sein, dass Sie sich gegenüber<br />
dem Höchstbietenden unter Umständen schadensersatzpflichtig<br />
machen, wenn Sie den Artikel nicht<br />
herausgeben können oder wollen. Der Höchstbietende<br />
ist dann so zu stellen, als ob der Vertrag ordnungsgemäß<br />
erfüllt worden wäre. Konkret bedeutet das: Sie<br />
müssen ihm die Differenz zwischen seinem Gebot –<br />
sprich dem Kaufpreis – und dem Marktwert des Artikels,<br />
den er durch den Abbruch der Auktion nicht erhalten<br />
hat, erstatten. Je niedriger das Höchstgebot also<br />
war, desto höher kann der Schadensersatzanspruch<br />
des Höchstbietenden ausfallen.<br />
Das musste in dem eingangs bereits erwähnten Urteil<br />
des BGH nun auch der Verkäufer eines Gebrauchtwagens<br />
erfahren. Er hatte beim Einstellen des Wagens –<br />
wissentlich – ein Mindestgebot von einem Euro festgesetzt.<br />
Der klagende Käufer bot kurz nach Beginn der<br />
Auktion eben diesen einen Euro. Einige Stunden später<br />
brach der Verkäufer die Auktion ab. Per E-Mail teilte er<br />
dem Kläger als Höchstbietendem mit, er habe außerhalb<br />
der Auktion einen Käufer gefunden, der 4.200 Euro<br />
Als Lohnhersteller fertigen wir<br />
Ihnen Ihre Produktserie zu<br />
ungewöhnlichen Bedingungen<br />
als Nahrungsergänzungsmittel<br />
und vieles mehr.<br />
www.lebens-mittelmanufactur.de<br />
Lebens-Mittel MANUFACTUR GmbH<br />
Rosa-Luxemburg-Straße 19<br />
14482 Potsdam<br />
Telefon: +49 (0) 331 74094501<br />
Telefax: +49 (0) 331 74094503<br />
info@lebens-mittelmanufactur.de<br />
51
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
zahlen wolle. Daraufhin verlangte der Kläger von ihm<br />
Schadensersatz in Höhe von 5.249 Euro – ausgehend<br />
von einem Wert des Fahrzeugs von 5.250 Euro abzüglich<br />
des einen Euros, den er geboten hatte. Der BGH<br />
gab ihm jetzt Recht: Den Auktionsgegenstand zu einem<br />
Schnäppchenpreis zu erwerben, mache gerade den<br />
Reiz von Internetauktionen aus. Ein krasses Missverhältnis<br />
zwischen Höchstgebot und Marktwert führe<br />
deshalb nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages. Im Gegenteil<br />
trage der Verkäufer dieses Risiko, wenn er einen<br />
derart niedrigen Startpreis wähle und die Auktion dann<br />
auch noch ungerechtfertigt abbreche, so das Fazit der<br />
Richter (Az.: VIII ZR 42/14).<br />
Die Tricks der „Abbruchjäger“<br />
Dass sich Verkäufer bei einem unberechtigten Abbruch<br />
der Auktion schadensersatzpfl ichtig machen, nutzen in<br />
letzter Zeit auch vermehrt sogenannte „Abbruchjäger“<br />
aus. Sie geben nur zu dem Zweck Gebote ab, um bei<br />
einem Abbruch der Auktion vom Verkäufer Schadensersatz<br />
zu verlangen. Das Prinzip ist einfach: „Abbruchjäger“<br />
bieten unter wechselnden Accounts auf zahlreiche<br />
Artikel gleichzeitig. Dabei geben Sie gleich zu Beginn<br />
der Auktion ein Gebot ab, dass nahe am Marktwert<br />
des angebotenen Artikels liegt. Weil „echte“ Interessenten<br />
bei den meisten Auktionen erst kurz vor Ablauf<br />
höhere Gebote abgeben, bleiben sie so möglichst<br />
lange Höchstbietender – und lauern dann auf abgebrochene<br />
Auktionen, um anschließend vom Verkäufer<br />
Schadensersatz zu fordern. Da die „Abbruchjäger“<br />
tatsächlich aber kein Kaufi nteresse<br />
haben, ist ihre Forderung nach Schadensersatz<br />
rechtsmissbräuchlich.<br />
Das hat z. B. das Amtsgericht<br />
(AG) Alzey im Fall einer abgebrochenen<br />
Auktion über<br />
ein iPhone entschieden. Das<br />
Höchstgebot zum Zeitpunkt<br />
des Abbruchs lag zwar deutlich<br />
unter dem Marktwert.<br />
Der Höchstbietende hatte jedoch<br />
nachweislich bei mehr<br />
als 100 Auktionen auf Elektroartikel<br />
geboten und in mehreren Fällen<br />
schließlich Schadensersatz verlangt.<br />
Das Gericht ging deshalb von einem rechtsmissbräuchlichen<br />
Verhalten aus und wies seine Klage<br />
ab (Az.: 28 C 165/12).<br />
Was können Opfer von „Abbruchjägern“ tun?<br />
Haben Sie den Verdacht, Opfer eines „Abbruchjägers“<br />
geworden zu sein, sollten Sie zunächst im Internet recherchieren,<br />
ob die Forderung von einem der einschlägig<br />
bekannten und zum Teil von eBay auch bereits gesperrten<br />
Accounts kommt. Ist dies der Fall, sollten Sie<br />
dem Anspruchsteller gegenüber auf das mangelnde<br />
Kaufi nteresse verweisen. Außerdem sollten Sie in jedem<br />
Fall eBay über Ihren Verdacht informieren.<br />
Angebote bei eBay nicht vorzeitig stoppen<br />
Wer eine Ware bei eBay zum Verkauf anbietet, erklärt<br />
zum Zeitpunkt der Einstellung des Artikels und der Freischaltung<br />
des Angebots, dass er das höchste wirksam<br />
abgegebene Kaufgebot annimmt. Die logische Konsequenz<br />
daraus: Ist ein eBayVersteigerer<br />
mit den abgegebenen Geboten für seine<br />
Ware unzufrieden, hat er Pech<br />
gehabt und sollte die Auktion nicht<br />
einfach abbrechen. Auch im Fall<br />
der vorzeitigen Beendigung<br />
durch den Anbieter kommt zwischen<br />
diesem und dem Meistbietenden<br />
nämlich grundsätzlich<br />
ein Kaufvertrag zustande.<br />
ARAG Experten weisen darauf<br />
hin, dass es im Extremfall sogar<br />
Schadenersatzansprüche gegen den<br />
Verkäufer geben kann, wenn dieser das<br />
Gebot nicht akzeptieren will. So geschehen<br />
in einem konkreten Fall, in dem ein Mann seinen<br />
Wagen bei eBay verkaufen wollte. Der geschätzte Verkehrswert<br />
des Fahrzeugs lag bei 7.000 Euro. Das<br />
Höchstgebot zum Zeitpunkt des Auktionsabbruchs betrug<br />
ca. 4.500 Euro. Der Verkäufer wollte das Auto<br />
nicht ausliefern und hat es anderweitig veräußert. Der<br />
Bieter klagte. Die Richter verdonnerten den Versteigerer<br />
daraufhin zu einer Schadenersatzzahlung von rund<br />
2.500 Euro an den leer ausgegangenen Bieter – die<br />
Differenz zwischen Höchstgebot und Verkehrswert<br />
(OLG Oldenburg, AZ: 8 U 93/05).<br />
52
Abbruch der eBay-Auktion<br />
Eine wegen einer vergessenen Mindestpreisangabe abgebrochene<br />
eBayAuktion begründet auch bei einem<br />
vorhandenen Gebot keinen Vertragsschluss. Im verhandelten<br />
Fall hatte der volljährige Sohn des Beklagten<br />
über den eBayAccount seines Vaters einen Audi A4<br />
2.0 TDI ohne Angabe eines Mindestpreises angeboten.<br />
Kurz nach dem Einstellen brach er die Auktion ab und<br />
stellte den Wagen erneut ein, diesmal mit der Angabe<br />
eines Mindestpreises. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war<br />
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit einem Gebot<br />
von 7,10 Euro Höchstbietende und verlangte die Herausgabe<br />
des PKW für 7,10 Euro. Nach Meinung der Käufer<br />
war ein entsprechender Vertrag zustande gekommen.<br />
Vor Gericht hatte das keinen Erfolg, denn es war<br />
kein Kaufvertrag abgeschlossen worden. Das erste<br />
eBayAngebot des Beklagten war wirksam zurückgezogen<br />
worden. Ein bei eBay eingestelltes Angebot steht<br />
laut ARAG unter dem Vorbehalt, dass kein Widerrufsgrund<br />
nach den eBayBedingungen gegeben sei. Ein<br />
Widerrufgrund liege unter anderem dann vor, wenn dem<br />
Anbieter beim Einstellen des Angebots ein Fehler unterlaufen<br />
ist. Im vorliegenden Fall stand fest, dass dies der<br />
Fall war (OLG Hamm, Az.: 2 U 94/13).<br />
Vorzeitige Beendigung der Auktion<br />
Wird eine Ware während einer laufenden eBayAuktion<br />
beschädigt, darf der Verkäufer die Auktion trotz bereits<br />
vorliegender Angebote beenden. Im zugrunde liegenden<br />
Fall hatte ein Autobesitzer seinen Mercedes Benz A<br />
140 bei eBay eingestellt. Während die Auktion lief, ging<br />
die Zentralverriegelung des Autos kaputt. Der Verkäufer<br />
beendete daraufhin die Auktion vorzeitig. Dagegen zog<br />
der bis dahin Höchstbietende vor Gericht, hatte allerdings<br />
keinen Erfolg. Bereits das Amtsgericht entschied,<br />
dass der Verkäufer die Auktion vorzeitig beenden durfte,<br />
da laut AGB eine vorzeitige Beendigung einer Auktion<br />
erlaubt ist, wenn der zu versteigernde Artikel nicht<br />
funktioniert oder ein Teil fehlt. Bei der nach Auktionsstart<br />
kaputt gegangenen Zentralverriegelung handelte<br />
es sich um einen Mangel der Kaufsache, der auch den<br />
Käufer zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt hätte,<br />
erklären ARAG Experten die Argumentation<br />
des Gerichts (LG Bochum, Az.: 9 S 166/12).<br />
Quelle: www.arag.de > Service<br />
> Aktuelle Rechtstipps und<br />
Gerichtsurteile > Internet<br />
und Computer vom 18.11. 2014<br />
/ Anzeige /<br />
53
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Marktplatz//<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Qualität – Made in Germany<br />
www.floramed.de<br />
www.plantavis.de<br />
www.plantafood.de<br />
54<br />
//
BEKANNTMACHUNG<br />
TESTFAHRER:<br />
JETZT HEREINSCHNEIEN!<br />
SAAS-FEE | SAAS-GRUND | SAAS-ALMAGELL | SAAS-BALEN<br />
SKI- UND SNOWBOARDTEST<br />
SAAS-FEE<br />
1.10.–30.11.2015<br />
WWW.SAAS-FEE.CH/SKITEST<br />
Inserat_A4.indd 1 10.12.2014 09:26:06