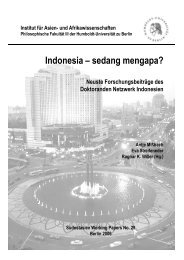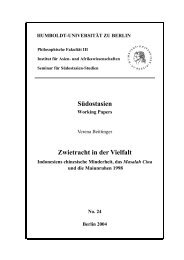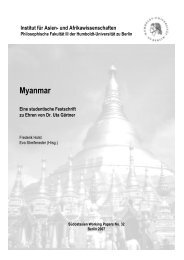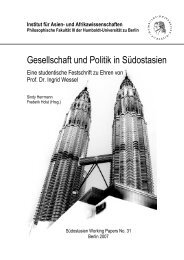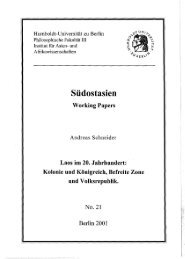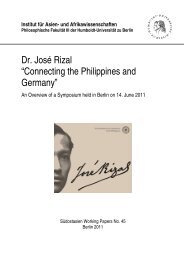Quo Vadis, Indonesien - HU Berlin
Quo Vadis, Indonesien - HU Berlin
Quo Vadis, Indonesien - HU Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 Das Ende der acehnesischen Diaspora?Antje MissbachDieser Artikel widmet sich der Frage nach dem Verbleib sogenannter conflict-generated diasporasnach Konfliktende, womit Diasporas bezeichnet werden, die aufgrund eines Konfliktes im Heimatlandentstanden sind. Anhand des Beispiels der acehnesischen communities im Ausland möchte ich den Fragennachgehen, welche Entscheidungen ihnen offen stehen, mittels welcher Kriterien sie sichentscheiden und welche Konsequenzen die jeweiligen Entscheidungen nach sich ziehen. Anlass dafürwar, dass am 15. August 2005 nach mehrmonatigen Verhandlungen zwischen Repräsentanten derUnabhängigkeitsbewegung Gerakan Aceh Merdeka (Bewegung Freies Aceh, GAM) und der indonesischenRegierung in Helsinki ein Memorandum of Understanding (MoU) abgeschlossen worden war,mit dem der fast 30-jährige bewaffnete Konflikt in Aceh endete.Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten für den Verbleib von conflict-generated diasporasnach Konfliktende. Entweder sie kehren in ihr Heimatland zurück und versuchen sich zu reintegrieren,oder sie bleiben der Heimat – aus verschiedenen Gründen, die in diesem Artikel zum Teil erörtert werdensollen – fern. Bevor ich auf die Rückkehr in die Heimat beziehungsweise den Verbleib im Auslandeingehe, möchte ich kurz einige theoretische Überlegungen zu Diasporizität darstellen sowie einenÜberblick über die Entstehung der acehnesischen Diaspora geben.Der Entstehungshintergrund der acehnesischen DiasporaSeit mehr als 20 Jahren beschäftigen sich Sozial- und Politikwissenschaftler vermehrt mit Diasporasund deren politische Beeinflussung auf die Heimat- als auch die Gastländer. Die Ansichten darüber,was nun die Grundkriterien für eine Diaspora darstellen, gehen aufgrund der anhaltenden Diskussionenteilweise weit auseinander. Ohne auf Einzelheiten dieser Debatten einzugehen, möchte ich eineDefinition vorstellen, die zwar nicht frei von Kritik ist, aber durchaus einen soliden Ausgangspunktbietet. William Safran (1991) schlug folgende sechs Punkte vor, mit denen sich Diasporas von anderenaußerhalb des Heimatlandes lebenden Personengrupppen (Wirtschaftsmigranten, Flüchtlinge, Auswanderer)abgrenzen lassen. Erstens, Mitglieder einer Diaspora oder deren Vorfahren sind von einembestimmten Ursprungsland vertrieben wurden; zweitens bewahren sie in der Fremde kollektive Erinnerungenan die Heimat (Mythen, gemeinschaftliche Errungenschaften, die konkrete geographischeVerortung) und drittens teilen sie gemeinschaftlich Gefühle von Entfremdung, weil sie sich nicht vollständigin die Gastgesellschaft integrieren wollen oder können. Viertens, Mitglieder einer Diasporahegen Hoffnungen, eines Tages in die Heimat zurückzukehren, um, fünftens, dieses Heimatland danngemeinsam wiederaufzubauen. Sechstens, in der Fremde bewahren sie Einzel- und Gruppenkontaktezu den Menschen in der Heimat (und zu den anderen Diasporagruppen in anderen Gastländern), umdas Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhalten.In meiner Dissertation, die sich mit der „Transformation der acehnesischen Diaspora und ihrer politischenBeeinflussung des Heimatkonfliktes“ beschäftigt, behauptet ich, dass die Entstehung deracehnesischen Diaspora sehr eng mit dem separatistischen Konflikt in Aceh verknüpft ist. Zwar gab esneben regen Handelsbeziehungen sowie intensivem Kultur- und Sprachaustausch seit mehreren JahrhundertenDutzende von acehnesischen Enklaven auf der Malaiischen Halbinsel. Malaya (später37