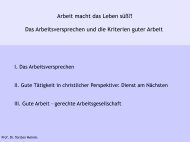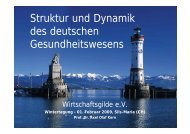Referat Lampe (Wintertagung).pdf
Referat Lampe (Wintertagung).pdf
Referat Lampe (Wintertagung).pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dr. Klaus <strong>Lampe</strong> Karl-Bieber-Höhe 29D 60437 Frankfurt/M.Tel.: ++49-69-5074122FAX: ++49-69-5074010E-Mail: KLANLAMPE@Aol.com27.0.7.2001Mehr Bio- und weniger IdeologieWer es heute wagt, einen verantwortungsbewussten, zeitgerechten Einsatz vonbiotechnologischen und vor allem gentechnischen Verfahren in der Pflanzen- und Tierzuchtzu fordern, darf einer lautstarken Opposition bestimmter Vereinigungen sicher sein. Unddennoch hat dies UNDP gewagt und sich den Zorn sehr unterschiedlicher und trotzdem imKampf gegen die Gentechnik geeinter Gruppen zugezogen. Das darf nicht davon abhalten, andie Fakten zu erinnern, die einen sachlichen Dialog möglich machen sollten.Gibt es Gemeinsamkeiten?Die überwiegende Mehrzahl aller, die mit Entwicklungsproblemen in Asien, Afrika oderLateinamerika vertraut sind, dürften sich auf folgende Fakten einigen können:• Landwirtschaftliche Entwicklung kann nur dort erfolgreich sein, wo sie in einländliches Entwicklungskonzept eingebunden ist, das seinerseits im Gleichgewicht zueiner nationalen urbanen Entwicklung steht.• Die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem Land müssen so gestaltet sein, dassMigration in Großstädte ihre Attraktivität verliert.• Landwirtschaft hat nur dort eine Zukunft, wo Einkommen erzielt werden können, diemit anderen Berufsgruppen vergleichbar sind.• Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen müssen u.a. Eigentums- undPachtbedingungen sicher stellen, die erfolgreiches Wirtschaften ermöglicht.• Landwirte müssen weltweit Zugang zu Methoden und Technologien haben, die einewirtschaftliche, ökologische und sozial-verantwortbare Produktion erlauben.• Die Landwirtschaft ist in der letzten 15 Jahren von nationalen und internationalenOrganisationen , aber auch Regierungen in unvertretbarer Weise vernachlässigtworden. Auch Vertretern der Zivilgesellschaft – wie den Kirchen und NGO’s – ist esnicht gelungen diese Entwicklung zu verhindern, zu stoppen oder umzukehren.• Landwirtschaftliche Entwicklung kann nur dann nachhaltig gefördert werden, wenndie politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen verbunden werdenmit produktionstechnischen Innovationen, die zu einer langfristig gesichertenEinkommensverbesserung führen. Dazu ist Forschung nötig, auf nationaler undinternationaler Ebene, unabhängig von den ebenso erforderlichen Investitionen derprivaten Wirtschaft.• Nur eine Synthese von traditionellem Erfahrungswissen bzw. Können und neuenwissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen mit neuem Ortientierungswissen kannsicherstellen, dass eine nachhaltige Ernährungssicherung für die wachsendeBevölkerung vor allem kapitalschwacher Regionen gewährleistet wird.
2• Traditionelle Eigentumsrechte müssen in Einklang gebracht werden mitPatentansprüchen, die sich aus modernen Züchtungen und des Einsatzes derBiotechnologie ergeben. Die letzten Jahre haben in Einzelfällen zu eklatantenFehlentwicklungen und Fehlentscheidungen geführt. Rechtsverbindliche Lösungensind bisher noch nicht gefunden worden. Die Diskussion darüber ist aber in vollemGang. Nicht verschwiegen werden sollte aber auch in diesem Zusammenhang derfreiwillige Verzicht von mehreren internationalen Agro-Industrie-Unternehmen aufPatentrechte für wichtige Verfahren und Gen-Verbindungen, die Kleinbauern inZukunft kostenlos zu gute kommen werden. Mit der Züchtung reisstengelbohrerresistenterSorten am Internationalen Reisforschungsinstitut hätte ohne Übertragungentsprechender von CIBA-Geigy gehaltener Patentrechte nicht schon 1994 begonnenwerden können. Durch einen entsprechenden Vertrag ist dem IRRI die Nutzung derspezifischen Gen-Verbindungen möglich und die unentgeltliche Nutzung in der 3.Welt gewährleistet. Ähnliches gilt für den von Potrykus und Beyer in Zürich undFreiburg entwickelten sogenannten Goldenen Reis. Er ist unter Nutzung vonPatentrechten entstanden, die von den Firmen Bayer, Monsanto, Syngenta, Zeneca undOrynova gehalten werden. Dieser Reis wird dazu beitragen, die Früherblindungunterernährter Kinder, von denen heute ca. 125 Millionen betroffen sind, zureduzieren, und er wird Kleinbauern Lizenzkosten frei zur Verfügung stehen.Diese Beispiele beweisen nicht nur, welche Möglichkeiten in einer Kooperation mit derprivaten Wirtschaft liegen. Sie demonstrieren in krasser Weise die makabre Kluft zwischenarm und reich, die Kluft zwischen Chancen und Risiken und die zwischen der Angst derArmut und der Angst des Überflusses.Wo liegen die Konfliktfelder?Kleinbauer zu sein ist für jene, die in diese Welt geboren sind, in den meisten Fällen eineLast, von der man sich so schnell es geht zu befreien wünscht. Kleinbauer ist keinwünschenswertes Berufsziel. Daran ändert auch die Verherrlichung dieses Berufsstandesdurch Teile unserer Zivilgesellschaft nichts.Die Grüne Revolution, jene technologische Entwicklung, die ihren Anfang vor 40 Jahrengenommen hat, ist für Teile unserer Gesellschaft ein unerwünschter Beweis fürproduktionstechnische Entwicklungsmöglichkeiten, die selbst in Ländern mit ungünstigenSozialstrukturen unbestreitbare Erfolge aufweisen kann. Sie haben die Lebensbedingungen inder Stadt und auf dem Land in vielen Regionen nachhaltig verbessert. Sie haben wesentlichdazu beigetragen, dass sich trotz Verdoppelung der Weltbevölkerung, das Heer der 800Millionen, die täglich Hunger plagt, nicht größer geworden ist, die Agrarproduktion und dieErträge sich aber verdoppelt bzw. verdreifacht haben. Dies nicht anzuerkennen, führt zueinem Vertrauensverlust bei all jenen Bauern, die sich um die Anerkennung ihrer besonderenLeistung betrogen fühlen, von all den nationalen Wissenschaftlern und Technikern, die dieVoraussetzung dafür geschaffen haben, ganz zu schweigen.Ohne diese Erfolge wären viele finanziell schwache Agrarstaaten gezwungen gewesen, ihreAckerflächen in den letzten 30 Jahren zu verdoppeln, um den heutigen Ernährungszustand zuerreichen. Ohne Innovationen müsste dies in den nächsten 30-40 Jahren noch einmalgeschehen. Abgesehen von dem Verlust der restlichen Waldflächen, der dort beheimatetenArtenvielfalt und der gefährlichen Nutzung besonders fragiler Ökosysteme ist dies in denmeisten Fällen überhaupt nicht möglich. Daran ändern auch die in vielen Teilen der Weltgeförderten low-external input Demonstrationsbetriebe nichts. Auch die neuste Studie v.
3Pretty, die dies beweisen soll, gehen von Rahmenbedingungen aus, die auch in Zukunft nichtzu schaffen sind.Nutzpflanzen, für die moderne Hochleistungssorten zur Verfügung stehen – wie Weizen Maisund Reis – haben in den letzten 30 Jahren weltweit eine Verbreitung erfahren, die in derAgrargeschichte bisher ohne Beispiel geblieben ist. Dies gilt auch und gerade für die kleinundkleinstbäuerlichen Betriebe in Asien. Die Systemkritik an Problemen und Rückschlägenaus der Anfangsphase der Entwicklung festzumachen, verkennt nicht nur die Situation vondamals, sondern negiert auch die Erfahrungen, die dem Einsatz aller neuen Technologien inunserer Geschichte zugrunde liegen.Zur Verteufelung der Agro-IndustrieDie Kritik an den transnationalen Agro-Industrie-Unternehmen in ihrer pauschalen Form hältkeiner sachlichen Prüfung stand. Die Wortwahl sogar christlich verpflichteter Organisationenmissachtet das 8. Gebot. Dies schadet letztlich nicht nur den betreffenden Institutionen selbst,sondern leider auch jenen, die Innovationen am dringendsten bedürfen: Der ca. 1 Milliardebäuerlicher Familienbetriebe. Einige wenige Untenehmen haben zweifelsfrei bei derVermarktung von transgenem Saatgut bzw. Nahrungspflanzen und der Durchsetzung vonPatentrechten schwere Fehler begangen. Dabei wurde ein hohes Defizit an Verantwortunggegenüber fremden Kulturen, Traditionen und Werten demonstriert. Dies als Anlass zunehmen, eine Technologie und die sie tragende Industrie zu verteufeln, die als einHoffnungsträger für dieses Jahrhundert angesehen werden muss, wird der Verantwortungnicht gerecht, die diese z. T. von der Gesellschaft finanzierten Institutionen tragen.Die Konzentration im Bereich Züchtung, Saatguterzeugung und Agrochemie bedarf deröffentlichen Beobachtung und Kontrolle. Die entsprechenden Mechanismen existieren wiejeder weiß und sie funktionieren auch. Solange der Wettbewerb zwischen den wenigenverbleibenden Unternehmen sicher gestellt bleibt, kann die Konzentration kleinbäuerlichenUnternehmen auch nützen. Gerade der wenig betuchte deutsche Autofahrer hat in den letzten40 Jahren erheblichen Nutzen aus der Konzentration der Automobilindustrie gezogen. Unterentsprechenden Voraussetzungen könnte dies auch für den Kleinbauern und die Agro-Industrie gelten. Wenn die Diffamierung der grünen Gentechnologie allerdings weiter sobetrieben wird, muss das Interesse der Wirtschaft in diese Entwicklung zwangsläufignachlassen. Die Anzeichen dafür sind bereits zu erkennen. Life - Science- Unternehmen, diemit großem Aufwand vor ca. 5 Jahren den Zusammenschluss von Forschung, Entwicklungund Produktion von Technologien für Mensch, Tier und Pflanze eingeleitet haben, sindbereits wieder dabei, sich von landwirtschaftlichen Aktivitäten zu lösen. Die Folgen sindschwerwiegend. Die öffentliche Hand hat bereits vor ca. 15 Jahren begonnen, sich aus derAgrarhilfe und später auch von der Agrarforschung zurück zu ziehen. Weder damals nochheute sind die Gründe hierfür gerechtfertigt. Agrarforschung bedarf der Kontinuität,Verlässlichkeit und einer ausgewogenen Balance staatlicher und privatwirtschaftlichgeförderter Programme. Fallen beide als Innovationszentren aus, weil andere Investitionenscheinbar kurzfristig höheren politischen bzw. wirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen, sinddie mittel- und langfristigen Folgen besonders schwerwiegend.Angst vor umwälzenden Technologien ist nicht neu. Als Karl Benz seine Fahrerlaubnis fürsein erstes Auto erhielt, hatte immer ein Mann mit einer roten Fahne vor dem Fahrzeug zulaufen. In weniger als 20 Jahren werden auch die roten Fahnen über transgene Pflanzen zurAgrargeschichte gehören. Deutschland wird nicht wie damals die Funktion der Pionier-Nationsondern des Risiko befangenen Bedenkensträgers einnehmen. Erstaunlicherweise richten sich
4die Wiederstände ebenso wie die z.T. fragwürdigen Aktionen nur gegen die grüne, nicht abergegen die „graue“(z. B. der Bodenentseuchung dienende), die “blaue“(die sich mit derFischzucht befasst) oder „ rote“(der Medizin) Gentechnik. Gentechnisch hergestellteMedikamente sind bereits allgegenwärtig und Deutschland ihr zweitgrößter Konsumentweltweit. Sie in gleicher Weise zu bekämpfen ist offensichtlich nicht opportun, weil damitmöglicherweise das Spendenaufkommen für die Gentechnik-Kritiker beeinträchtigt werdenkönnte. Dabei wird vergessen, dass jedes Jahr Millionen von Urlaubern fast überall imAusland mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln konfrontiert sind und „kontaminiert“nach Hause kommen. Wäre es nicht logisch für sie alle eine Quarantäne zu fordern? Bis jetztsind noch keine Gesundheitsschäden durch den Genuss von gentechnisch verändertenLebensmitteln nachgewiesen worden. Dabei dürften so veränderte Pflanzen den weltweitgrößten Versuchstest hinter sich haben. 1996 wurden bereits auf 1,7 Millionen Hektartransgene Pflanzen angebaut. In weniger als 5 Jahren stieg die Anbaufläche in diesem Jahr aufüber 45Millionen Hektar. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt im Vergleich hierzuinsgesamt nur über eine Ackerfläche von weniger als 12 Millionen Hektar. Weltweit gedeihendemnach in diesem Jahr auf einer viermal so großen Fläche transgene Kulturpflanzen.Haben dies all jene gewusst, die heute das UNDP wegen ihres Eintretens für eineverantwortungsbewusste, d.h. kontrollierte Nutzung der Gentechnik an den Pranger derIndustriehörigkeit stellen? Ist die 40-fache Steigerung des Einsatzes dieses neuen Saatgutes inweniger als 6 Jahren das Ergebnis von Erpressung, von Ausbeutung oder freier Entscheidungfreier Landwirte?Die grüne Gentechnik, kein Allheilmittel aber ein neuer Werkzeugkasten derPflanzenzüchtungRevolutionäre Entwicklungen der Wissenschaft und Forschung haben auch in derVergangenheit sowohl Visionäre als auch besorgte Kritiker auf den Plan gerufen. Wo dies zusachlicher Auseinadersetzung und nicht Diffamierung, zu Konsens suchendem Dialog undnicht zu an Glaubenkriege erinnernde Verbalschlachten führt, dient sie dem Fortschritt.Letztlich wird die Gentechnik weltweit wie in der Medizin ihren Einzug in die Landwirtschafthalten. Die Luxusgesellschaften des Nordens, die weniger als 13% ihres Einkommens fürLebensmittel ausgeben, sind von der Wirklichkeit jener Lichtjahre entfernt, die von wenigerals 1 oder 2 US$ leben oder auf weniger als 2 Hektar mehr als 10 Menschen ernähren müssen.Sich mit der Frankenstein-Food Terminologie auseinander zu setzen ist daher müßig.Festzuhalten bleibt: für einige Milliarden Menschen auf dieser Welt ist der Zugang zuNahrung auch im Jahr 2001 so zentral wie für uns Deutsche nach dem 2. Weltkrieg. Gesuchtwird nicht die Kartoffel, die sich ohne Fett zu Pommes Frites verarbeiten lässt, oder dasHerzinfarkt sichere Frühstücksei, zu dem auch in unseren Breiten Gentechnik-Gegner schnellgreifen würden. Nein, die grüne Gentechnik muss vornehmlich einen Beitrag zu kosten- bzw.preisgünstiger Erzeugung von ( Grund) Nahrungsmitteln leisten und dies ökologisch undsozial verträglich. Dies zu fordern und zu fördern müsste zu den zentralen Aufgaben jenerOrganisationen der Zivilgesellschaft gehören, die sich den Unterprivilegierten, dem Schutzder Umwelt und dem Friedensdienst verschrieben haben.Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Bio-, die Gentechnologie ist nicht der goldeneSchlüssel zu Überwindung von Armut und Hunger. Der Staat, die Organisationen derZivilgesellschaft, die private Wirtschaft und die Landwirtschaft selbst sind gefordert. Allesind inzwischen so miteinander verknüpft, dass der Erfolg des einen vom Erfolg des anderenabhängt. Es ist deshalb so unverständlich, wenn eine UN-Organisation diffamiert wird, weilsie das Engagement der Industrie zur Armutsbewältigung mobilisiert. Und nochunverständlicher ist es, wenn man sich einer Technologie versagt, die mit großer
5Wahrscheinlichkeit sehr wesentlich zu Umwelt- und Klimaschutz in diesem Jahrhundertbeitragen wird. Computer, Roboter, die Nanotechnik und die Biotechnologie werden diesesJahrhundert entscheidend prägen. Die Biotechnologie steht dabei ganz am Anfang einerEntwicklung, deren Bedeutung kaum abzuschätzen ist. Einige weniger bekannte Beispielesollen den zu erwartenden Weg aufzeigen.Boden und Wasser : Die Verluste an landw. Nutzfläche für urbane Räume undStrukturmaßnahmen werden auch in Zukunft nicht zu verhindern sein. Dies gilt auch ingewissem Umfang für Erosions- und Versalzungsschäden. Von beiden sind vor allem diebesten Standorte betroffen. Aus diesem Grund sind dort in Zukunft auch die größtenErtragssteigerungen pro Flächeneinheit erforderlich. Und trotzdem wird der Druck aufmarginale Standorte, wie z. B. Hanglagen, immer größer. In Zukunft werden heute nocheinjährige Nutzpflanzen, wie z.B. Reis und Mais, mehrjährige Verwandte haben, die anerosionsgefährdeten Hängen angebaut werden können. Sie dienen damit nicht nur dem Schutzvor Bodenabtrag, sie verursachen auch geringere Saatgutkosten und wesentlich geringerenArbeitsaufwand und dienen damit vornehmlich den Interessen von Klein- und Kleinstbauern.Auch Salz- und Brackwasserverträglichkeit und Toleranzen gegenüber Bodengiften sindbisher mit Methoden der traditionellen Züchtung nur in beschränktem Umfange gelungen. DieBiotechnologie eröffnet dem Pflanzenzüchter durch die Identifikation, Isolierung undTransfer von Genen Salzwasser verträglicher Wildpflanzen völlig neue Möglichkeiten.Landwirtschaft, vor allem in nichtgemäßigten Zonen, muss mit zu viel oder zu wenig Wasserleben. Nutzpflanzen an diese Bedingungen - bei gleichzeitig hoher und stabiler Ertragslage -anzupassen, ist der traditionellen Pflanzenzüchtung bisher kaum gelungen. Die Einschleusungentsprechender artverwandter oder artfremder Gene wird dies in Zukunft möglich machen.Wurzelsysteme von z.B. Sorghum, Hirse und Cassava können dann nicht nur geringsteMengen von Bodenfeuchtigkeit nutzen, sondern dies auch in einem für Pflanzenunfreundlichen Boden-Medium.Energielieferant Pflanze: Holz ist auch heute noch , vor allem für die Armen der Welt, derwichtigste Brennstoff zur Nahrungsmittelzubereitung. Er wird immer knapper und immerteurer. Schnellwachsende Hölzer, auf der Basis traditioneller Züchtungen, zeigen bereits denWeg vor, den die Gentechnik helfen kann zu beschleunigen. Die Photosynthese, dieUmwandlung von Sonnenenergie in Nahrungsmittelenergie findet auf zwei verschiedenenProzesswegen statt. Mais z.B., als sogenannte C4-Pflanze, wählt dabei eine energiesparendeAbkürzung, während andere Pflanzenarten , wie der Reis als C3-Pflanze wesentlich mehrEnergie für die gleiche Leistung aufwendet. Das 1-Liter Auto wird es in der Pflanzenzuchtnicht geben. Aber lange vor der Mitte dieses Jahrhunderts werden dem Landwirt vielewichtige Kultur-Pflanzen zur Verfügung stehen, die sich der C4-Methode bedienen und damithöhere Flächenerträge liefern. Statt immer weitersteigender Stickstoffgaben werden bessereWurzelsysteme gleichzeitig für eine Minimierung von Düngerverlusten sorgen. Mit demgleichen Ziel wird es gelingen, die Eigenschaften zur Stickstoffsammlung aus der Luft aufalle wichtigen Nahrungs-Pflanzen zu übertragen, die diese Eigenschaft heute noch nichtbesitzen. Die ersten Patente dazu sind an eine Universität in England vergeben worden unddamit in öffentlicher Hand.Die Energieerzeugung aus Biomasse durch Methangasbakterien war selbst in Deutschland inder Kriegs- und Nachkriegszeit als Alternative zu Öl und Gas gesehen worden. Der Einsatzauch in der dritten Welt scheiterte u. a. an fehlenden Methanbakterien, die sich auch beiniedrigen Temperaturen vermehren. Noch gibt es kein Projekt, das sich diese Zucht zum Ziel
6gesetzt hat. Sie wird es möglicherweise in Zukunft geben, aber nur mit Hilfe derBiotechnologie.Hybridsaatgut und Pflanzenschutz: Unser Ei und die Maisflocken zum Frühstück sind zumgroßen Teil Produkte der Hybridzüchtung, der Kreuzung von Inzuchtlinien. IhreNachkommen sind für die Vermehrung nicht geeignet. Die Gentechnik ist in der Lage, dieBeschränkungen dieser natürlichen „Terminator-Technologie“ und damit den Nachbau vonHybridsorten, auch für den Bauern zu ermöglichen.In vielen Regionen vor allem Afrikas wird die Produktion von Nahrungspflanzen neben LandoderWassermangel, auch entscheidend durch Unkraut limitiert. Und die Arbeit mit derHandhacke ist einer von vielen Gründen, die zur Landflucht führen. Deshalb wird diegentechnisch erzielte Resistenz von z. B. Mais gegen sogenannte „Totalherbizide“,totalwirkende Unkrautbekämpfungsmittel nicht als Fluch, sondern als Segen empfunden. Dieneue Sortengeneration wird sich deshalb noch schneller verbreiten als jene der ersten GrünenRevolution, die von den gleichen Gruppen bekämpft wurde, die heute gegen den Einsatz derGentechnik in der Landwirtschaft zu Felde ziehen. In ferner Zukunft - ebenfalls mit Hilfe derBiotechnologie - werden vielleicht die schnell abbaubaren Herbizide von heute ihrerseits vonPflanzensorten abgelöst werden, die ihre Unkrautbekämpfung durch entsprechendeWurzelausscheidungen selbst besorgen. Reis, Mais. Weizen, Cassava, Hirse, ausgerüstet mitSelbstverteidigungsmechanismen gegen konkurrierende Unkräuter ist heute nicht mehr alseine Idee am Horizont potenzieller Möglichkeiten. Aber wer dachte vor 30 Jahren an diezüchterischen Chancen von heute?Der weltweite Umsatz von z. T. hochgiftigen Pestiziden übersteigt heute DM 65 Milliarden.Ihr sachgerechter Einsatz erfordert Geräte und Schutzmaßnahmen, die oft inEntwicklungsländern nicht zur Verfügung stehen. Die damit verbundenen Schäden mögen inder Vergangenheit gelegentlich auch dramatisiert worden sein, die Gefahren und die Kosten,auch jene für die Umwelt sind aber oft zu hoch, lassen sich jedoch mit Hilfe der Gentechnikweiter beschränken. Bei der Schädlingsbekämpfung im Mais oder auch beim Reis sind dieErfolge bereits sichtbar. Eine ähnliche Bekämpfung von Krankheiten besonders in tropischenund subtropischen Ökosystemen wird viel zeit- und kostenaufwendiger sein und von derWirtschaft nur in Angriff genommen werden, wenn die Aussicht besteht, die nötigenInvestitionen zu amortisieren.Zuversicht ist die Mutter des Fortschritts und nicht die AngstEs wäre töricht, die Biotechnologie zu einer Innovation ohne Risiken, ohne Nebenwirkungenhochstilisieren zu wollen. Sie sind so oft vor allem in Deutschland beschrieben, übertriebenund ideologisch missbraucht worden, dass auf ihre Bedeutung hier bewusst nicht eingegangenwird. Sicher ist, dass nach heutiger Bewertung aller vorliegenden Fakten die Vorteile derBiotechnologie bei weitem überwiegen. Die sozialen und ökologischen Schäden, die ohneEinsatz dieser Technologien in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten sind, werdenunvertretbar hoch sein. Gerade aus dieser Sicht wird der Widerstand christlicher Gruppen sounverständlich und die emotional aufgeladene Sprache, wie sie „Brot für die Welt“ wählt,zeugt nicht von einer Bereitschaft zur Sachlichkeit: Biotechnologie ist ein wertfreierWissensbereich. Ihm zu unterstellen, er „verschärfe die Gerechtigkeitsproblematik“ ist nichtnur falsch sondern irreführend. „Manipuliertes“ Saatgut „natürlichem“ Saatgut gegenüber zustellen, suggeriert fälschlicherweise, dass genetisch erzeugtes Saatgut nicht natürlich sei. Esmit den Schlagworten: Patentierung, Profitinteresse und Marktmonopolen zu belegen,überschreitet die Grenzen des guten Geschmacks und der Wahrheit. Die Agro-Industrie hat in
7den letzten 50 Jahren die Produktionsmittel hergestellt und verkauft, die es ermöglichten diedoppelte Anzahl von Menschen auf unserem Planeten zu ernähren. Das legitime Interesse derIndustrie Gewinne zu erzielen, ist nur mit erfolgreichen Bauern als Abnehmer möglich.Wenn evangelische Stellen heute die Förderung der Agrarforschung zur Verbesserung derLebensbedingungen in Entwicklungsländern fordern und den staatlichen Ausstieg beklagen,müssen sie die Fragen beantworten, warum dies nicht schon vor 25 Jahren geschehen ist. Seitdamals steht den kirchlichen Entwicklungsorganisationen der Weg zur Teilnahme an derinternationalen halbstaatlichen Agrarforschungsförderung offen. Sie wurde aber stattdessenebenso vehement kritisiert wie heute jene, die sich für eine sachgerechte Nutzung derBiotechnologie und eine Kooperation mit der Wirtschaft einsetzen. Dabei ist die Industrieunabhängige Agrarforschung im Bereich Biotechnologie besonders dringend. Viele wichtigeProgramme sind für die private Wirtschaft nicht interessant. Darüber hinaus ist es nötig durchöffentlich geförderte Forschung ein Gegengewicht im Wettbewerb z. B. um Eigentumsrechtezu schaffen und die Grundlagenforschung voran zu treiben.Unglücklicherweise versichert die Leitung des evangelischen Entwicklungsdienstes(EED),„Hunger und Armut sind soziale, keine technischen Probleme“. Wenn ihr Vorsitzendererklärt: „in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit werden wir auch in Zukunft mehrder Weiterentwicklung des Wissens der Bauern zur Lösung des Welternährungsproblemstrauen als den Labors der Konzerne“, muss dem entgegen getreten werden. Verdankt diedeutsche Landwirtschaft ihren Fortschritt der letzten 50 Jahre im wesentlichen wirklich derWeiterentwicklung bäuerlichen Wissens oder den Ergebnissen von öffentlicher und privaterForschung und Entwicklung? Wollten wir die Thesen des EED ehrlichkeitshalber auf unserLand übertragen, müssten wir den Schwarzwaldbauern empfehlen, ihre Hinterwälder Kühewie vor 50 Jahren mit dem Doppeljoch vor dem Einscharflug herzutreiben. Wenn das nichtgewollt noch gemeint ist, stellt sich eine noch schwerwiegendere Frage: Ist die Erhaltung derRückständigkeit des Agrarsektors in Entwicklungsländern im Vergleich zu denIndustrieländern gewollt? Wer glorifiziert warum den Klein- und Kleinstbauernstand, der inden Heimatländern der Protagonisten schon lange auf der roten Liste steht? Warumfinanzieren bestimmte NGO-Institutionen der Industriegesellschaft vornehmlich solcheOrganisationen in Entwicklungsländern, die sich mehr oder weniger aggressiv gegen denEinsatz moderner Technologien verschrieben haben? Dagegen regt sich auch in der „DrittenWelt“ zunehmend Widerstand, selbst auf den Philippinen, einem Land, das auf Grund seinerKolonial- und Missionsgeschichte besonders empfänglich für Einflüsse von außen ist. So hatsich erst kürzlich das Philippine Centre for Investigative Journalism (PCIJ) demProblem der Beeinflussung nationaler NGO’s durch international tätige gemeinnützigeOrganisationen angenommen. Nach seinen Untersuchungen beginnen bisher kritischeNGO’s in den Philippinen nicht nur den Nutzen der „grünen“ Gentechnik zu erkennen,sondern auch die Probleme, die mit der finanziellen Förderung und damit Abhängigkeitvon außen verbunden sind. Die Bevormundung und die mit der Finanzierung aus demNorden verbundene neue Abhängigkeit macht misstrauisch. Wer „grünen“ Frieden postuliert,aber „grünen“ Krieg mit unlauteren Mitteln führt, verliert auf die Dauer jede Glaubwürdigkeitohne dass es dazu eines gegnerischen Widerstandes bedarf. Bauern, auch und geradeKleinbauern, sollten in ihrer Klugheit und Urteilsfähigkeit nicht unterschätzt werden. Auchihr Vertrauen ist nur einmal zu verlieren.AusblickDem UNDP als Weltorganisation kommt das große Verdienst zu, die Chancen erkannt zuhaben, die mit der Nutzung der Biotechnologie zur Bekämpfung von Armut und Hunger
8verbunden sind. Die vor uns liegende Aufgabe, für zusätzlich 4-5 Milliarden Menschengenügend Lebensmittel zu produzieren, die sich auch landlose Arme leisten können, verlangtden Einsatz aller politischen, wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten. Auch nur aufeine einzige, in Anbetracht der großen Herausforderungen zu verzichten, ist unverantwortlich.Das UNDP ist zu beglückwünschen für seine Bereitschaft und die Förderung einerKooperation mit der privaten Wirtschaft. In einer Zeit, in der die öffentliche Hand immerweniger bereit und in der Lage ist, sich im Bereich Forschung und Entwicklung für die „DritteWelt“ zu engagieren, muss versucht werden, die Privatwirtschaft verstärkt für einentsprechendes Engagement zu gewinnen.Die Bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika brauchen keine Angst-Propheten. ImGegenteil. Die Technologie der ersten Grünen Revolution muss für alle wichtigen Kulturenund besonders für den afrikanischen Kontinent besser genutzt werden. Wenn Landwirte invielen Regionen der „Dritten Welt“ heute statt alter Land- moderne Zuchtsorten verwenden,tun sie dies auf Grund der „Weiterentwicklung ihres Wissens“. Dies sollten alleEntwicklungsdienste zur Kenntnis nehmen und Vorsicht bei der Beurteilung der grünenGentechnik walten lassen. Der Kreis der Bio-Antagonisten, die sich in verschiedenenOrganisationen zusammengefunden haben, mag groß sein. Ihre Bedenken zu respektieren,gehört zu den Grundregeln unserer Gesellschaft, auch wenn man gelegentlich an den Motivenzweifeln mag. Die Kirchen sind dagegen einem Wertesystem verpflichtet, dessen stärkereBeachtung bei der Beurteilung der grünen Biotechnologie aus vielen Gründen dringendgeboten erscheint.Sattheit, eine zwangsläufige Folge unserer Wohlstandsgesellschaft, braucht nicht mit demVerlust an Mut, Zuversicht, Risikobereitschaft und Erfindergeist einhergehen. Dies beweistheute bereits die nachwachsende Generation, für die alte Grenzen, politische, geographische,soziale, aber auch wissenschaftliche schon lange keine Gültigkeit mehr haben. Ihnen gehörtdie Zukunft. Sie werden eine Gesellschaft gestalten, in der nicht nur Märkte undKapitalströme zusammenwachsen. In ihrer Welt werden auch die groben Unterschiedezwischen Kleinstbauern und Wohlstandsbürgern überwunden. Mit einem Austausch vonWissen und Können, Erfahrung und technischem Fortschritt wird dies gelingen. DieBiotechnologie wird daran wesentlich beteiligt sein. Man kann sich nur wünschen, dass auchdie evangelischen Kirchen dies rechtzeitig erkennen und zu ihrer verantwortungsbewusstenNutzung beitragen.epd Beitrag.doc