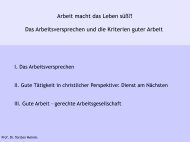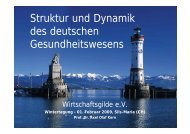"Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik".pdf
"Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik".pdf
"Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik".pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ethik im Management –Voraussetzung für nachhaltigen Unternehmenserfolg?von Joachim FetzerVortrag in der <strong>Wirtschafts</strong>gilde, Regionalgruppe Stuttgart 2,Hospitalhof Stuttgart, Evangelisches Bildungswerk, 17. September 2003Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,noch immer hört man die Aussage: "Wirtschaft <strong>und</strong> Ethik, da müssen Sie sich schon entscheiden:Wirtschaft oder Ethik." Dahinter steckt ziemlich präzise das, was Sie in der Einladung fürden heutigen Abend so formuliert haben: "Literatur <strong>und</strong> öffentliche Meinung gehen von eineminneren Widerspruch zwischen ethischem Verhalten <strong>und</strong> der Notwendigkeit aus, Gewinne zuerzielen." Ich würde etwas weniger bescheiden formulieren: Wieso eigentlich Notwendigkeit,Gewinne zu erzielen? Eine Notwendigkeit ist es allenfalls, keine dauerhaften Verluste zu machen– Investitionsrücklagen eingerechnet. Ist es nicht auch eine Lust, Gewinne zu erzielen? EineFreude, von der viele Unternehmen derzeit nur träumen können. Man kann schon fragen: Bestehteigentlich ein innerer Widerspruch zwischen der Freude am Gewinn, dem Ehrgeiz zum Unternehmenserfolgauf der einen Seite <strong>und</strong> ethischem Verhalten auf der anderen Seite? Und was isteigentlich ethisches Verhalten?Auf einer etwas gr<strong>und</strong>sätzlicheren Ebene ist dies ein altes philosophisches Thema:In der Nikomachischen Ethik fragt Aristoteles nach dem guten Leben <strong>und</strong> insbesondere nachdem, wonach der Mensch strebt. Und er formuliert: "Glückseligkeit nennen es die Leute ebensowie die Gebildeten, <strong>und</strong> sie setzen das Gut-Leben <strong>und</strong> das Sich-gut-Verhalten gleich mit demGlückseligsein." (1095 a 18) Und an anderer Stelle: "Was hindert also, jenen glückselig zu nennen,der gemäß der vollkommenen Tugend tätig <strong>und</strong> mit äußeren Gütern hinlänglich versehenist, nicht eine beliebige Zeit hindurch, sondern durch ein ganzes Leben?" (1101 a 14).Das Problem: Wie verhalten sich Tugend <strong>und</strong> äußere Güter? Das gute Leben hängt in dieserSicht durchaus von äußeren Umständen ab, von Glück <strong>und</strong> Erfolg. Viele Jahrh<strong>und</strong>erte späterwurde versucht, die Ethik auf eine autonome Basis zu stellen, unabhängig von der Empirie <strong>und</strong>den Wechselfällen des Lebens die Autonomie des individuellen Gewissens zu betonen. Für diesenVersuch steht insbesondere der Name Immanuel Kant mit dem berühmten Spitzensatz, wonachnichts allein kann gut genannt werden denn ein guter Wille. Das Gut-Leben wird aus derEthik verbannt. Das führte bei Kant zu einer geradezu komischen Rigorosität, mit der er zwischenPflicht <strong>und</strong> Neigung zu unterscheiden meinte, zwischen zweckfreiem ethischen Postulat<strong>und</strong> zweckhaft-liebender Begeisterung für das rechtes Handeln. Im Gr<strong>und</strong>e soll der würdigstemoralische Held gegen sein Herz, gegen seine innere Neigung, den kategorischen Imperativ be-J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 1
den <strong>und</strong> dann mit der Personalreduktion als Notmaßnahme ein "Turnaro<strong>und</strong>" signalisiert wird,der von den Aktienmärkten belohnt wird. Das Problem ist dann aber nicht die Entlassungswelle,so schmerzlich wie sie für die Betroffenen ist, sondern dass man es zu der Notwendigkeit einesTurnaro<strong>und</strong> hat kommen lassen. Das zu vermeiden ist natürlich leichter gesagt, als getan. Dochsie sehen: Ob Ethik <strong>und</strong> Erfolg zusammenpassen, lässt sich nicht allgemein beantworten – <strong>und</strong>v.a. hängt die Frage daran: Was ist ethisch?Ethik <strong>und</strong> KapitalmarktDie Frage stellt sich natürlich auch in einem ganzen anderen Bereich, den ich beispielhaft herauspicke:der Geldanlage in sogenannten Ethikfonds. Zur Erläuterung: Es handelt sich dabei umAktienfonds, deren Zusammensetzung nicht nur nach den klassischen Themen Sicherheit <strong>und</strong>Rendite gestaltet wird, sondern auch nach anderen Kriterien. Und dieses "andere" nennt manhäufig: ethisch. Meist verbergen sich dahinter soziale <strong>und</strong> ökologische Kriterien, oder auch bestimmteAusschlussthemen wie Pornographie, Rüstung u.ä.Dieses Thema hat in den letzten Jahren einen beträchtlichen Aufschwung erfahren, wenngleiches sich natürlich immer noch um eine Nische handelt. Das Anlagevolumen hat sich seit 1998verzehnfacht, liegt aber immernoch im Bereich unter 1%. Ein Indiz für die Etablierung einesThemas ist aber, wenn sich die Großen der Branche dessen annehmen. Vor 20 Jahren dachte manbei ethischen Geldanlagen an Investitionen in Windkraftanlagen oder bestimmte Entwicklungsprojekte.Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber es ist klar, dass bei solchen einseitigen Anlagestrategiengleichzeitig das Anlagerisiko wächst <strong>und</strong> die Rendite nicht selten abnimmt. Aus dieserZeit stammt das Bild, dass ethische Anlageformen nur derjenige wählt, der eigentlich sein Geldauch gleich spenden könnte, oder der aus Idealismus höchst riskante Anlageformen unterstützt.Das hat sich gr<strong>und</strong>legend geändert. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones hat einen Teilindex,genannt "Dow Jones Sustainability Index", der britisch Index FTSE unterhält den "FTSE 4Good". Insgesamt über 100 Fondprodukte im Bereich Nachhaltigkeit werden derzeit angeboten(www.nachhaltiges-investment.org), von der Allianz-Dresdner genauso wie von den Genossenschaftsbanken,den kirchlichen Banken oder anderen. Auch hier diskutieren Kritiker <strong>und</strong> Befürworter,ob diese Fonds <strong>und</strong> Indizes nun besser oder schlechter als die anderen performen. DieKritiker halten diese Anlagen für risikobehafteter. Denn: Natürlich gibt es ökonomisch erfolgreicheUnternehmen, die aus dem Anlageuniversum ausscheiden. Von den Deutschen Unternehmenist im FTSE4Good z.B. die BASF AG enthalten, die Bayer AG jedoch nicht. Auf der anderenSeite gilt, dass Unternehmen zusätzliche Anforderungen an ihre Informationspflicht eingehen,wenn Sie in diese Indizes <strong>und</strong> Fonds aufgenommen werden wollen. Das bedeutet größere Transparenz.Diese Unternehmen sind in ihrer Rechnungslegung eher konservativ, was ja spätestensseit dem Fall Enron wieder als Tugend entdeckt worden ist. Und natürlich kommt es auch hierstark auf die Kriterien an, auf die ich hier nicht eingehen will. Das Thema interessiert hier zunächstnur als höchst aktuelles Beispiel für die Leitdifferenz Ethik <strong>und</strong> Erfolg, hier eben: Anlage-Erfolg. Ein Widerspruch muss das heute zumindest nicht mehr sein.J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 4
Corporate Responsibility ReportingMit ihrem Geschäftsbericht 2003 hat die Allianz AG einen Corporate Responsibility Report veröffentlicht,in dem neben dem üblichen Zahlenwerk über Bildungsarbeit in Brasilien, über Stiftungsarbeit,aber auch über gesellschaftliche Entwicklungen <strong>und</strong> die Einschätzungen aus Sichtder Allianz berichtet wird. Damit folgt die Allianz einem Trend, der unter den Kommunikationsfachleutenintensiv diskutiert wird: Der sozial-ökologischen Berichterstattung. Die Öffentlichkeitsarbeitmuss – soweit sind sich viele einig – über die reinen Investor-Relations hinaus sich andie Gesellschaft im Ganzen richten. Es gibt namhafte Inititiven, die daran arbeiten, dafür globaleStandards <strong>und</strong> Leitlinien zu entwickeln. Hier stellt sich die Ethik – Erfolg – Frage in doppelterHinsicht. Zum einen gibt es Kritiker, die dies ohnehin als "nur Public Relation", nur Propagandaabtun. Und genau das sehen die Kommunikationsfachleute. Denn ein Unternehmen, das hier zuselbstbewusst auftritt, wird schnell als zynisch entlarvt. Wenn Maßnahmen der Corporate Responsibilityals ethisches Feigenblatt "entlarvt" werden – manche Publizisten <strong>und</strong> Medien sehendarin eine Herausforderung –, dann erscheint dies unter Kommunikationsgesichtspunkten alskontraproduktiv. Über dieses Wechselspiel reproduziert sich der vermeintliche Widerspuch vonEthik <strong>und</strong> Erfolg.Die EKD-Denkschrift Gemeinwohl <strong>und</strong> EigennutzAuch kirchliche Stellungnahmen kämpfen sich immer wieder an diesem Problem ab: In der<strong>Wirtschafts</strong>-Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahre 1991 heißt es:"Ist das Verfolgen eigener Interessen mit Nächstenliebe überhaupt vereinbar? ... Der Vorwurflautet, Gewinnstreben <strong>und</strong> Teilnahme am wirtschaftlichen Konkurrenzkampf seien unmoralisch."(Ziff. 148). Die Denkschrift ist natürlich darauf aus, dieses Gegensatzdenken zu überwinden,z.B. mit dem Hinweis darauf, dass die Selbstliebe ein oft übersehener Bestandteil des Nächstenliebegebotsist. (vgl. Ziff. 147). Aber das Gegensatzdenken ist so tief in unsere Tradition eingelassen,dass deren Überwindung in der Denkschrift nur sehr begrenzt gelingt. Insbesondere dieBeurteilung der Marktwirtschaft ist zwar mittlerweile eher positiv, aber doch nur dann, wenn siemit dem Attribut "sozial" versehen ist, worunter dann umfangreiche sozialstaatliche Aktivitätenverstanden werden. Ein positives Verhältnis zu wettbewerblichen Prinzipien als solche ist bisheute in der christlichen Ethik kaum vorhanden. Hier müssen noch einige konzeptionelle Hausaufgabengemacht werden. Ein theologisch geschulter Unternehmer hat in anderem Zusammenhang1925 diese zwei-Welten-Theorie auf den Punkt gebracht: „Christentum <strong>und</strong> moderne Wirtschafthaben schlechterdings nichts miteinander zu tun. Die Gr<strong>und</strong>lagen beider Lebensformenstammen aus gr<strong>und</strong>verschiedenen Wertwelten. Hier Statik, dort Dynamik, hier Zucht <strong>und</strong> Askese,dort Expansion <strong>und</strong> Begierdenreizung, ja Begierdenerzeugung, hier Ruhe <strong>und</strong> Friede, dortUnruhe, Streit, Konkurrenz, Unfrieden“.Ich habe an anderer Stelle nachzuweisen versucht, dass ein wesentlicher Teil unserer ökonomischenInstitutionen von christlichen Traditionen geprägt ist – es müssen ja nicht diejenigen desdeutschen Idealismus sein. ("Verhalten <strong>und</strong> Verhältnisse. Christliche Traditionen in ökonomischenInstitutionen", in: Nutzinger, Hans G. (Hg.): Christliche, jüdische <strong>und</strong> islamische <strong>Wirtschafts</strong>ethik,Marburg 2003, S. 45-104.) Wir dürfen uns durchaus der Zusammenhänge zwischenunseren ethischen Traditionen <strong>und</strong> unseren ökonomischen Institutionen mehr annehmen <strong>und</strong>J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 5
nicht immer von einem Gegensatz ausgehen, der dann bestenfalls harmonisierend vermitteltwerden kann. So sei auch an Max Weber erinnert, der einen engen Zusammenhang zwischen derEntstehung des modernen Kapitalismus <strong>und</strong> dem protestantischen Ethos herausgearbeitet hatte.Leistungsorientierung ist nichts unchristliches <strong>und</strong> auch nichts unethisches <strong>und</strong> eine gute Voraussetzungfür persönlichen Erfolg – sie reicht natürlich nicht aus. Selbstdisziplin <strong>und</strong> Aufrichtigkeitnicht weniger. Jedenfalls sind Lebensformen denkbar, in denen persönliche Bescheidenheit<strong>und</strong> Erfolgsorientierung sehr gut zusammengehen.Fazit: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Ethik <strong>und</strong> Erfolg, auf diese Denkweise sollten wiruns erst gar nicht einlassen. Es gibt allenfalls einen Widerspruch zwischen unterschiedlichenmoralisch-ethischen Vorstellungen <strong>und</strong> zwischen unterschiedlichen geistesgeschichtlichen Traditionen,von denen einige wenige einen solchen Widerspruch konstruieren. Diese These möchteich im zweiten Teil an einem Beispiel weiterführen <strong>und</strong> dabei auch auf Gr<strong>und</strong>positionen der modernenwirtschaftsethischen Diskussion zu sprechen kommen.2) Unternehmensverantwortung <strong>und</strong> Unternehmenserfolg, oder: Das Gewinnpinzip in derUnternehmensethikIch hatte Eingangs auf das Verhältnis von Pflicht <strong>und</strong> Neigung, auf das Verhältnis von Gut-Sein<strong>und</strong> Gut-Leben hingewiesen. Das ist natürlich für die Diskussion moderner Unternehmensethiknoch nicht ausreichend. Denn systemische Aspekte müssen in dieser Diskussion berücksichtigtwerden. Dazu gehört unbedingt, die Rolle des Marktes <strong>und</strong> des sogenannten Gewinnprinzips imRahmen von Marktwirtschaften zu bedenken. Die alten Fragen tauchen dann in anderer Formauf, nämlich als Frage. Wofür sind <strong>und</strong> sollen Unternehmen in einer Gesellschaft Verantwortungübernehmen? <strong>und</strong>: Wie verhält sich ihre bessere oder schlechtere Verantwortungsübernahme zuihrem monetären Unternehmenserfolg?Karl Homann versus Peter UlrichZum "Gewinnprinzip in der Unternehmensethik" gibt es in der deutschen Diskussion zweiHauptkontrahenten. Der eine ist Karl Homann, bis vor einiger Zeit Professor für <strong>Wirtschafts</strong>ethikam FB Betriebswirtschaftslehre der kathol. Universität Eichstädt, jetzt Professor für Philosophiein München. Der andere ist Peter Ulrich, Prof. für <strong>Wirtschafts</strong>ethik an der Universität St. Gallen.Beide Autoren unterscheiden zwei Ebenen der unternehmerischen Verantwortung:• Die unmittelbare Geschäftsethik: Was wird wie produziert? In welche Märkte gehen wir?Wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Mit Emissionen usw.? Geschäftsethik.• Die andere Ebene ist die ordnungsgpolitische Mitverantwortung: Wie wirken wir mit anBranchenvereinbarungen, in der Mitgestaltung der politischen Rahmenbedingungen?Aber bei dieser Unterscheidung enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Der eine (Homann) isteher der ordoliberalen Tradition der Väter der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet <strong>und</strong> argumentiertungefähr folgendermaßen: Aufgr<strong>und</strong> seiner gr<strong>und</strong>legend positive Einstellung zu denwettbewerblichen Rahmenordnungen in westlichen Marktwirtschaften hat Unternehmensethikbei HOMANN nur untergeordnete Funktion. Im Normalfall haben Unternehmen Spielregeln der(z.B. staatlich gesetzten) Rahmenordnung zu befolgen <strong>und</strong> ansonsten langfristige Gewinnmaxi-J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 6
"Die soziale Verantwortung des Unternehmens beginnt nicht erst jenseits seiner Geschäftstätigkeit<strong>und</strong> seiner Marktaktivitäten, sondern mitten in diesen. Wie alle Personen <strong>und</strong> Organisationenübernehmen Unternehmen in einer Gesellschaft bestimmte <strong>und</strong> damit auch begrenzte Aufgaben.In marktwirtschaftlichen Gesellschaften lassen sich vier Kerndimensionen der Unternehmensverantwortungunterscheiden:• 1) Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen anzubieten, welche der Sicherung menschlicher (Gr<strong>und</strong><strong>und</strong>Luxus-)Bedürfnisse materieller <strong>und</strong> immaterieller Natur dienen,• 2) dabei effizient zu sein, was den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen als (relativ)neu erkannter gesellschaftliche Aufgabe einschließt,• 3) in „schöpferischer Zerstörung“ Produkt- <strong>und</strong> Prozessinnovationen zu tätigen <strong>und</strong>• 4) die bei all dem entstehenden Risiken selber zu übernehmen, eine besonders häufig unterschätzteDimension der Unternehmensverantwortung.Schon innerhalb dieser Kerndimensionen ist das Potenzial an Zielkonflikten genauso beträchtlichwie die Unterschiede in der Verantwortungswahrnehmung zwischen einzelnen Unternehmen.Dass Unternehmen darüber hinaus zahlreiche weitere gesellschaftliche Aufgaben übernommenhaben oder übernehmen, darf über diese Kerndimensionen der Unternehmensverantwortungnicht hinwegtäuschen. Wenn dagegen – wie in einem Grünbuch der Europäischen Kommission –das Thema "Soziale Unternehmensverantwortung" erst bei den über diese Kerndimensionen hinausgehenden Aktivitäten einsetzt, dann zeigt das eine beträchtliche Schieflage der Diskussion."Pflichten aus eingegangenen BindungenNeben diesen Kerndimensionen der Aufgabenverantwortung gibt es noch einen anderen Aspekt,der sich aus den Bindungen ergibt, die ein Unternehmen notwendigerweise eingeht: Es schließtVerträge <strong>und</strong> agiert immer im Rahmen einer oder mehrer Rechtsordnungen. Und daher kannman aus unterschiedlichen Gründen noch anfügen:"Zur Unternehmensverantwortung gehört die Erfüllung selbst eingegangener Verträge <strong>und</strong> dieBeachtung rechtlicher Vorschriften. Die Einhaltung von Recht <strong>und</strong> Gesetz ist Teil der Wahrnehmungeigener Verantwortung <strong>und</strong> im Vollzug immer auch eine Stellungnahme <strong>und</strong> Bestätigungder Zustimmung (oder des Nicht-Widerspruchs) zu den entsprechenden Normen. Nichtalles was legitim ist, ist auch legal. Nicht alles, was legal ist, ist legitim. Sofern mit der Tätigkeit<strong>und</strong> vor allem mit dem Sitz eines Unternehmens in einem Rechtsgeltungsbereich gr<strong>und</strong>sätzlicheZustimmung zu dessen Gesetzen vorausgesetzt werden kann, ist Legalität prima facie ein guterIndikator für Legitimität – nicht mehr, aber auch nicht weniger."Unternehmensverantwortung <strong>und</strong> Gewinn: Das Preissystem als Feedback-InstrumentUnd ganz analog – so meine ich – kann man das Gewinnprinzip behandeln. In funktionierendenMarktwirtschaften ist das Preissystem ein gigantischer Feedbackmechanismus, um dem Unternehmenzu signalisieren, ob es die Kerndimensionen seiner Aufgabenverantwortung gut erfüllt.Das gilt übrigens auch für die Aufgabe, Risiken zu übernehmen. Diese vierte Dimension wirdhäufig unterschätzt. Bei den Kritikern der Marktwirschaft oder auch bei den Kritikern zeitweiseJ. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 8
exorbitanter Gewinne wird dieses Element der Aufgabenverantwortung regelmäßig <strong>und</strong> systematischmissachtet.Meine These lautet: Unter halbwegs funktionierenden Rahmenbedingungen (hier ganz mit Homann)sind hohe Gewinne, mal mehr, mal weniger schwankend, ein guter Indikator für die Erfüllungder gesellschaftlichen Aufgaben eines Unternehmens. Das Preissystem <strong>und</strong> die Gewinnorientierunghaben die Funktion, Komplexität zu reduzieren <strong>und</strong> Orientierung zu schaffen. Nichtmehr, denn die Rahmenbedingungen sind genauso wenig vollkommen, wie das Rechtssystem.Aber auch nicht weniger.Natürlich kann man dies auch anders sehen. Doch worauf man insistieren sollte, ist. "Sagt offen,wofür Ihr Unternehmen verantwortlich macht!" Ich meine, die Verantwortung von Unternehmenhat auch Grenzen: Sie sind nicht verantwortlich für das allgemeine Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter,sie sind nicht für das Kulturleben der Stadt <strong>und</strong> den Straßenbau zuständig, sie sind noch nichteinmal für genügend Ausbildungsplätze geschweige denn Arbeitsplätze zuständig. Das heißtnicht, dass sie nicht eine Verantwortung für die Nebenwirkungen ihres Handelns haben. EinUnternehmen, das in einer Region zum Quasi-Monopol-Arbeitgeber geworden ist, weil es erfolgreichwar, das hat natürlich eine Mitverantwortung dafür, dass der Rückbau in Stufen <strong>und</strong> fürdie Community bewältigbar verläuft. Das ist es, was ich vorhin mit "eingegangene Bindungen "meinte. Aber es ist nicht dafür verantwortlich, dauerhaft in einer bestimmten Region Arbeitsplätzezu schaffen. In Deutschland herrscht Freizügigkeit.Es gibt weniger einen Widerspruch zwischen Ethik <strong>und</strong> Erfolg, sondern Widersprüche zwischenden moralisch-ethischen Vorstellungen. Und an dieser Stelle werden auch die Grenzen des vonPeter Ulrich ins Zentrum gerückten Instruments des Stakeholder-Dialogs sichtbar.Fazit: Sofern Unternehmen durch ihr wirtschaftliches Handeln Gewinne realisieren, können siedavon ausgehen, dass sie in Bezug auf ihre Verantwortungswahrnahme zumindest nicht ganzfalsch liegen. Der Gewinn ist dann ein komplexitätsreduzierendes Indiz, kein moralisches Ziel.Sofern Unternehmen sich an den in einer Gesellschaft vorliegenden Bewertungen einschließlichderen ständiger Veränderung orientieren wollen, haben sie gute Gründe, ihr Handeln an der Realisierungvon Gewinnen auszurichten <strong>und</strong> diese Ausrichtung in ihre interne „Willensbestimmung“aufzunehmen. Dies kann zum Beispiel so geschehen, dass einer Teilgruppe der am Unternehmenbeteiligten Individuen der Gewinn prinzipiell zugesprochen wird <strong>und</strong> diese Teilgruppein der unternehmensinternen Entscheidungsstruktur besonderes Gewicht erhält.Grenzen des Gewinnprinzips: IndikatorenDa es sich aber nur um ein (starkes) Indiz <strong>und</strong> nicht selbst um ein oberstes moralisches Ziel handelt,gilt die Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips nur so lange, wie nicht andere Indiziendagegen sprechen. Dies festzuhalten ist deshalb wichtig, weil erstens nur in der besten aller ökonomischenModellwelten vollständige Konkurrenzmärkte ohne Informations- oder gar Machtasymmetrienbei angemessen gleicher anfänglicher Ressourcenausstattung ohne sogenannte externeEffekte tatsächlich die gesellschaftlichen Bewertungen eindeutig <strong>und</strong> fehlerfrei in Gleichgewichtspreisenzum Ausdruck bringen, <strong>und</strong> weil zweitens gar nicht gesagt ist, dass selbst solcheJ. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 9
idealiter zustandegekommenen Bewertungen mit der moralischen Auffassung eines Individuumsoder einer Gruppe übereinstimmen.Welche Indizien können die Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips stören?• Wenn die Erzielung oder Steigerung von Gewinnen die Verletzung von Gesetzen erfordernwürde, dann ist ein erstes <strong>und</strong> starkes Indiz gegeben. Das Verhältnis Gewinn gegen Gesetzist aber nicht so aufzulösen, dass prinzipiell Gewinn vor Gesetz oder Gesetz vor Gewinn zusetzen wäre. In beiden Fällen handelt es sich um Indizien! Auch Legalität ist nur ein Indiz fürLegitimität. Die Komplexitätsreduktion auf beiden Seiten funktioniert nicht. Es ist eine eigeneAntwort qua Güterabwägung oder ergänzender Indizien gefordert. Eine solche Antwort,die gleichzeitig ein eigenes Werturteil einschließt, könnte lauten: Rechtliche Regelungen, diein demokratischen Verfahren zustande gekommen sind, werden stets beachtet.• Öffentliche Kritik an Unternehmenshandlungen, z.B. Umweltverschmutzung, Standortverlagerungist ein Indiz dafür, dass die Angemessenheit des Unternehmenshandelns zumindeststrittig ist. Das Gewinnprinzip gibt auf diese Strittigkeit keine Antwort. Allerdings kanndie Abwägung der hinter dem Gewinnprinzip stehenden Aufgabenzuschreibungen zum Beispielzu dem Schluss führen, dass tatsächlich bestimmte Umweltschädigungen nicht mehrmit den Primäraufgaben in Übereinstimmung gebracht werden können, während dies bei derStandortverlagerung sehr wohl der Fall sein kann.• Öffentliche Kritik an Folgen von Unternehmenshandlungen, z.B. Rüstungsexporten inKrisengebiete, sofern diese nicht ohnehin verboten sind, ist gegenüber der unmittelbarenHandlungskritik nochmals gesondert zu diskutieren.• Der Umgang mit Informationsasymmetrien oder den spezifischen Investitionen anderer inlang anhaltenden vertraglichen Beziehungen sind typische Punkte für mögliche unternehmensethischeKonflikte, die nicht pauschal mit dem Hinweis auf das Gewinnprinzip beantwortetwerden können. Die Grenze zwischen guter Werbung <strong>und</strong> täuschender Werbung istbeispielsweise häufig ein schmaler Grat. Irreführende Werbung kann mit den hinter demGewinnprinzip stehenden Aufgaben der Unternehmung nicht legitimiert werden. Die allgemeinereKritik an der Werbung, sie erzeuge erst Bedürfnisse, die dann befriedigt werdenkönnen oder sie erzeuge die falschen Bedürfnisse, ist zwar im Rahmen allgemeiner Gesellschaftskritikdenkbar, kann als Kritik an Unternehmen mit dem Hinweis darauf zurückgewiesenwerden, dass die in der Werbung stattfindende Suche nach neuen oder veränderten Bedürfnissengerade einer der Kernaufgaben marktwirtschaftlicher Unternehmen entspricht.• Auch im Unternehmen selbst können Missstände im Umfeld oder als Konsequenz des Unternehmenshandelnswahrgenommen werden <strong>und</strong> zur Prüfung eigener Beteiligung odermöglicher Handlungsänderungen führen. Extreme Rassendiskriminierung, Zwangs- <strong>und</strong>Kinderarbeit können solche Anlässe sein. Inwiefern solche Themen im Unternehmen zurSprache kommen, hängt eng mit der von Kleinfeld eingeforderten persongerechten Unternehmenskulturzusammen. Die eigene Sensibilität des Unternehmens für solche Missständehängt jedenfalls nicht nur von den involvierten Personen, sondern von der Kommunizierbarkeitdieser Themen im Unternehmen ab.J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 10
• Ein Indiz dafür, dass das Gewinnprinzip als Indikator gesellschaftlicher Rollenzuschreibungnicht ausreicht, liegt auch dann vor, wenn die Gesellschaft oder einzelne Gruppen den Unternehmenweitere Aufgaben zuschreiben, z.B. Mitwirkung am Bildungsauftrag.Diese Indizien sagen noch nichts über notwendige Handlungsänderungen aus <strong>und</strong> schon garnicht darüber, dass aus ethischer Sicht ein Gewinnverzicht notwendig sei. Sie sind lediglichHinweise darauf, dass die Erfüllung der gesellschaftlichen Rollenanforderungen nicht mehr unstrittigist. Der Feedback-Mechanismus Gewinn <strong>und</strong> seine Richtigkeitsvermutung funktionierennicht mehr hinreichend.Die (Ver-)Antwort(ung) des Unternehmens: Wettbewerbs- <strong>und</strong> ordnungspolitische StrategienNun ist es nicht so, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen immer optimal funktionieren,das weiß selbst Karl Homann. Er hat ein idealtypisches Ablaufschema eines unternehmensethischenEntscheidungsprozesses entwickelt. Als Reaktion auf eine moralische Anforderungmüssen Unternehmen drei Fragen beantworten:1) Begründung: Ist die Anforderung ethisch gut begründet? Ist die Anforderung universalisierbaroder verbergen sich dahinter nur Gruppeninteressen.2) Prüfung der Rahmenordnung: Berücksichtigt die bestehende Rahmenordnung das moralischeAnliegen bereits? Wenn ja, dann ist – aufgr<strong>und</strong> der Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips –die Prüfung an dieser Stelle abzubrechen. Wenn nein:3) Strategiebildung: „Nur für den Fall einer defizitären Rahmenordnung ... sind die Unternehmenin der Marktwirtschaft verpflichtet, eigene Möglichkeiten zu suchen, um berechtigte moralischeAnforderungen erfüllen zu können. Welche Handlungsmöglichkeiten einem Unternehmen unterWettbewerbsbedingungen zur Verfügung stehen, hängt wesentlich davon ab, wie sich eine moralischinduzierte Verhaltensänderung auf den ökonomischen Erfolg des Unternehmens auswirkt<strong>und</strong> wie die anderen Unternehmen in der Wettbewerbssituation reagieren.“ Die mögliche Verhaltensänderungführt das Unternehmen in eines der folgenden vier Handlungsfelder:hohe moralische AkzeptanzgeringeRentabilitätIII.ökonomischerKonfliktfallIV.negativerKompatibilitätsfallI.positiverKompatibilitätsfallII.moralischerKonfliktfallhoheRentabilitätgeringe moralische AkzeptanzDer Zusammenfall von Rentabilität <strong>und</strong> moralischer Anforderung (positiver oder negativer Art)in den Feldern I <strong>und</strong> IV seien die unternehmensethisch unproblematischen Fälle. Die moralischen<strong>und</strong> ökonomischen Konfliktfälle markieren das mögliche Auseinanderfallen von Rentabi-J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 11
lität <strong>und</strong> Moral, in dem sich Unternehmen „– zumindest auf den ersten Blick – entweder für dieMoral oder für den Gewinn entscheiden müssen. In diesem moralischen Dilemma repräsentiertQuadrant II die Entscheidung für den Gewinn, Quadrant III die Entscheidung für die Moral.“Diese Entscheidung ist allerdings nicht das letzte Wort: Vielmehr können gr<strong>und</strong>sätzlich zweiStrategien zur Implementation moralischer Anliegen unter Bedingungen des Wettbewerbs zumEinsatz kommen. Wettbewerbsstrategien sind Veränderungen des Unternehmenshandelns aufder Ebene der Spielzüge: der Verzicht auf Waffenlieferungen in Krisengebiete zum Beispiel.Ordnungspolitische Strategien sind Versuche des Unternehmens, die Rahmenordnung zu beeinflussen,z.B. durch Initiativen für die allgemeine Durchsetzung eines Verbots von Waffenlieferungenin Krisengebiete.Mit Recht zeigen Homann/Blome-Drees, „daß all jene Konzeptionen von Unternehmensethikunbefriedigend bleiben <strong>und</strong> bleiben müssen, die den zweiten Typ bzw. die zweite Strategie übersehenoder vernachlässigen.“ Daraus ergeben sich Objekte der Unternehmensverantwortung aufzwei Ebenen: Unternehmensverantwortung auf der Handlungsebene <strong>und</strong> Unternehmensverantwortungals Mitverantwortung für die Rahmenordnung. „Rahmenordnung“ findet dabei eineweite Interpretation: Dazu gehören nicht nur staatliche Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen, d.h. kollektiveSelbstbindungen auf regional begrenzter gesamtgesellschaftlicher Ebene, sondern z.B. auchBranchenkodizes <strong>und</strong> andere kollektive Selbstbindungen auf nicht regional, sondern branchenbezogenerEbene.In Anwendung auf das Vier-Felder-Schema stellen Homann/Blome-Drees fest: Im Fall von QuadrantI können moralische Impulse zu Wettbewerbsstrategien führen, die letztlich zu einer Verbesserung„in nordöstlicher Richtung“ führen. Also: Ethik im Management führt zu Untenehmenserfolg.Der Skeptiker, der hier eine Funktionalisierung der Moral für ökonomische Zweckesieht, habe die moralische Legitimation des Wettbewerbs nicht verstanden.Quadrant IV ist uninteressant bzw. hier sind aus moralischen <strong>und</strong> ökonomischen Gründen Marktaustrittsstrategienzu empfehlen.Im Quadrant II besteht die Möglichkeit, mit Wettbewerbsstrategien „moralische Innovationen“zu tätigen, z.B. als erster systematisch auf Ökologieverträglichkeit zu achten mit dem Ziel, diesedann neuen Standards zu Teilen der Rahmenordnung zu machen <strong>und</strong> so den moralischen Konfliktfallin den ökonomischen Kompatibilitätsfall zu transformieren. Solche Investitionen inGlaubwürdigkeit können über einen zeitweisen Umweg über Quadrant III führen, nämlich moralischinduzierter zeitweiser Verluste. Zeitweise Verluste sind bei Investitionen nicht unüblich.In Quadrant III sind dagegen ausschließlich ordnungspolitische Strategien möglich <strong>und</strong> sinnvoll.Dies gilt nicht nur aus Unternehmenssicht, weil man verständlicherweise überleben will, sondernes gilt auch aus gesellschaftlicher Sicht. Denn Wettbewerbsstrategien im ökonomischen Konfliktfallwürden zum Verschwinden derjenigen Akteure führen, welche sich für die Moral entscheiden.Solche negative Selektion erodiert eine moralisch begründete Rahmenordnung weiter.J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 12
Ordnungspolitische Mitverantwortung von UnternehmenDie Interpretation im Spannungsfeld von Gewinn <strong>und</strong> Moral verdeckt, dass es Konflikte zwischenMoral <strong>und</strong> Moral gibt, insbesondere dann, wenn man Verantwortungsdiskurse „Wer sollwas machen <strong>und</strong> dafür eintreten?“ als Teil des Moraldiskurses versteht.Aufrichtigerweise wäre dann aber das ökonomische Kontinuum in jener Matrix anders zu benennen.Denn was ökonomisch rentabel ist <strong>und</strong> was nicht, hängt von der Rahmenordnung ab,<strong>und</strong> die ist gestaltbar. Statt "hoher/ geringer Rentabilität" wäre zu formulieren: "Unterstützung/Konterkarierungdurch die Rahmenordnung". Diese Umbenennung führt zunächst zumgleichen Ergebnis: moralische Handlungen, welche von den Strukturen der Rahmenordnung unterstütztwerden, werden belohnt <strong>und</strong> sind daher auch ökonomisch erfolgreich.Allerdings hat diese Umbennenung Auswirkungen auf das Entscheidungsschema: Denn wenndort in Schritt zwei bereits entschieden ist, dass das moralische Problem von der Rahmenordnung„gelöst“ wird, dann kommt Schritt 3 (Strategierprüfung) nicht mehr zur Anwendung. Imanderen Fall, also bei defizienter Rahmenordnung, können auf der Ebene der Handlungsalternativendie Quadranten I <strong>und</strong> IV gar nicht mehr vorkommen.Die Unterscheidung zwischen Handlungsebene <strong>und</strong> Rahmenordnung ist in einem unternehmensethischenKonzept aber so zu treffen, dass sie nicht zu einem allgemeinen Strukturkonservatismusbeiträgt oder zum Abschieben aller unternehmensethischen Probleme in die Rumpelkammerder Ordnungspolitik. Gleichzeitig muss die Unterscheidung so getroffen werden, dass moralischesHandeln nicht zu dauernder Selbstüberforderung führt <strong>und</strong> – gesellschaftlich – zur negativenSelektion.Schließlich kommt bei Homann/Blome-Drees nicht hinreichend zum Ausdruck, dass die „Prüfungder Rahmenordnung“ (Schritt 2) bereits selbst eine Aktivität ist, mit der das Unternehmenseine ordnungspolitische Mitverantwortung zum Ausdruck bringt. Dazu gehört dann eben auchdie notwendige, aber schwierige Unterscheidung zwischen Handlungs- <strong>und</strong> Rahmenordnung:Was ist die Rahmenordnung? Welche Bedeutung haben die eigenen Spielzüge für die Rahmenordnung?Die entscheidende Botschaft lautet m.E.: In komplexen Gesellschaften, systematisch in Marktwirtschaftenmit ihrer strukturellen (<strong>und</strong> gewollten!) Entkopplung der Handlungsbewertungenvon individuellen Motiven <strong>und</strong> immer in hoch interdependenten Handlungssituationen ist dermoralische Heroismus in Quadrant III kein moralisches Ziel <strong>und</strong> kein Wert in sich selbst(!). EineSituation, in der man nur aus Pflicht <strong>und</strong> nicht mehr aus Neigung das Gute tut, ist kein sinnvollesZiel.Die gr<strong>und</strong>sätzliche Regel lautet vielmehr:Strebe eine Übereinstimmung zwischen dem Handeln nach moralischen Überzeugungen<strong>und</strong> einer gesellschaftlichen Rahmenordnung an, die eben dieses Handeln positiv honoriert.Fällt beides auseinander, dann kann dies zwei Gründe haben: Unterschiedliche moralische Überzeugungenoder Defizite in der Rahmenordnung:J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 13
• Entweder unterscheiden sich deine moralischen Überzeugungen von denjenigen, die in derrelevanten gesellschaftlichen Umwelt mehrheitsfähig oder akzeptiert sind. Dies ist die Situationfür den moralischen Diskurs, der selbst in zwei Stufen zerlegt werden kann: 1) WelchenGrad der Berechtigung <strong>und</strong> welchen Typus hat eine moralische Forderung? Wie ist sie begründet– oder lässt sie sich begründen (Begründungsdiskurs)? Was ist das Verantwortungsobjekt<strong>und</strong> warum ist es ein solches? 2) Welche Verantwortungsverteilungen impliziert diesemoralische Forderung? Sind diese wünschenswert (Anwendungsdiskurs oder besser: Verantwortungsdiskursim eigentlichen Sinn)? Mit welchen Gründen ist das Objekt Gegenstandder Unternehmensverantwortung dieses oder dieser Unternehmen? Wie ist die Relation begründet?Welche gesellschaftpolitischen Folgen impliziert die moralische Forderung? Wassagt sie beispielsweise über die Bedeutung der vier Kerndimensionen der Unternehmensverantwortungaus? Ein Großteil der scheinbaren Konflikte zwischen Gewinn <strong>und</strong> Moral, zwischenunterschiedlichen Anforderungen an Unternehmen, ist auf Differenzen in der moralischenBeurteilung von Situationen <strong>und</strong> Handlungen (potentielle Verantwortungsobjekte)oder auf Differenzen in der Frage gesellschaftlicher Organisation <strong>und</strong> Steuerungssysteme(Verantwortungsrelationen) rückführbar. Diese wirtschaftsethischen Debatten können prinzipiellnicht auf unternehmensethischer Ebene aufgelöst werden. Allerdings: Auch hier kanneine Stellungnahme (Antwort) gefordert werden.• Oder es gibt einen Konsens über die moralische Beurteilung, doch die Strukturen der Rahmenordnungsind defizitär. Dann erst entsteht die von Homann gestellte Frage nach demVerhältnis von wettbewerbs- <strong>und</strong> ordnungspolitischen Strategien, welches m.E. so zu reformulierenist: Sind die Defizite der Rahmenordnung zeitweise <strong>und</strong> kurzfristig, können Wettbewerbsstrategiendiese Defizite überbrücken. Sind diese Defizite aber gr<strong>und</strong>sätzlicher Natur,so können nur ordnungspolitische Strategien zu den gewünschten Ergebnissen führen.Ausschließliche Wettbewerbsstrategien sind möglicherweise kontraproduktiv. Allerdingsmuss die Frage beantwortet oder wenigstens gestellt werden, welche Auswirkungen die eigenenHandlungen auf die Effizienz der verfolgten ordnungspolitischen Strategien haben.Diese Rekonstruktion des Entscheidungsschemas hat den Anspruch, den Homann’schen Hinweisauf die Bedeutung der Rahmenordnung unternehmensethisch zu intensivieren. Denn mit hoherWahrscheinlichkeit ergeben sich nach Durchgang durch das Schema im Quadranten III die spannendenFragen. Der Quadrant II, der moralische Konfliktfall, von dem Peter Ulrich meint, er seider zunehmend dominante Ausgangspunkt aller wirtschaftsethischen Bemühungen, bleibt in denallermeisten Fällen — leer.So besteht der einzig relevante moralische Konfliktfall in dem pauschalen Hinweis auf eine guteRahmenordnung, die vollständig <strong>und</strong> fehlerfrei alle relevanten moralischen Impulse in Preise<strong>und</strong> damit in Gewinne transformiere, weshalb jede weitere Argumentation überflüssig sei – kurz:im Abbruch des Diskurses mit Hinweis auf die anders ausgerichtete Rentabilitätsstruktur. Dermoralische Konfliktfall besteht dann nicht in verantwortungslosen Handlungen, sondern inAntwortlosigkeit.Darin liegt allerdings tatsächlich eine Versuchung <strong>und</strong> Neigung gerade in gut <strong>und</strong> wohlgeordnetenGesellschaftsstrukturen. Je optimaler eine <strong>Wirtschafts</strong>ordnung funktioniert, je verbreiteter derQuadrant I ist, je häufiger <strong>und</strong> unmittelbarer das Gewinnprinzip als komplexitätsreduzierendesJ. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 14
Orientierungsmuster eingesetzt werden kann, desto verzichtbarer ist die Notwendigkeit, moralischzu argumentieren, sich mit eigenen <strong>und</strong> anderen Wertvorstellungen auseinander zu setzen.Die Gewöhnung an diesen Mechanismus kann zu Abspaltungen oder zur Vernachlässigung derPflege moralischer Argumentationskompetenz führen. Erst unter veränderten Rahmenbedingungenmuss diese Form des Humankapitals reaktiviert werden.Zu beachten ist: Dies ist kein spezifisch wirtschaftsethisches Problem. So kann das Vertrauen aufein gut funktionierendes Rechtssystem die Erinnerung an die Differenz zwischen Buchstaben<strong>und</strong> Geist der Gesetze in den Hintergr<strong>und</strong> treten lassen. Oder: Sich in der Ausbildung moralischerNormen an Gemeinschaften zu orientieren, ist unumgänglich <strong>und</strong> selbst ein moralischesPrinzip. Gefolgschaft gegenüber Mehrheitsmeinung, Führermeinung, Mehrheitsführermeinungoder einfach Meinungsführern dagegen ist ein Abtreten des moralischen Urteils an andere.Die Fähigkeit zu moralischer Argumentation ist ebenso eine (auch ökonomische) Ressource wieder Aufbau von Glaubwürdigkeitskapital. Beides entwertet sich durch dauerhaften Nicht-Einsatz.Mit Homann/Bloome-Dress: "Daher ist es hilfreich, wenn Unternehmen nicht nur ökonomischrichtige, sondern auch begründete <strong>und</strong> begründbare Entscheidungen treffen, um eine Kultur derBegründbarkeit entstehen zu lassen.“ An dieser Stelle sind Karl Homann <strong>und</strong> Peter Ulrich garnicht mehr so weit voneinander entfernt.3) Ethik im Management <strong>und</strong> EthikmanagementDie gewachsene Bedeutung von Ethik im ManagementDie Anforderungen an die Begründungsnotwendigkeit unternehmerischen Handelns wachsen.Eine stabile <strong>und</strong> alle Probleme lösende Rahmenordnung ist wichtig, kann aber eben nicht einfachvorausgesetzt werden – schon gar nicht im internationalen Kontext. Die unternehmensethischeKonsequenz der Globalisierung ist, dass immer häufiger die eigene Antwort der handelndenSubjekte gefordert ist, zu denen eben auch Unternehmen zählen.Im zweistufigen Legitimitätskonzept von Karl Homann, kommt der Unternehmensethik nur einesituativ ergänzende Funktion zu, bei Defiziten der Rahmenordnung. Jedoch• "Empirisch ist festzustellen, dass dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis ... sich eher umkehrt.Es ist zu vermuten, dass Unternehmensethik in einem durh Dynamik, schnellen Fortschritt<strong>und</strong> Globalisierung geprägten Umfeld zunehmend zum Kernthema von <strong>Wirtschafts</strong>ethikwird; Unternehmen müssen sich zu den entscheidenden moralischen Akteuren entwickeln.Hierauf deuten jedenfalls Vielzahl <strong>und</strong> Gewichtigkeit der Defizite in der Rahmenordnunghin.• Aber auch konzeptionell ist die strikte Trennung von Ordnungs- <strong>und</strong> Unternehmensethikkaum gegeben, denn Unternehmen wirken auf verschiedenen Wegen – z.B. Einflussnahmeauf Gesetzgebungsverfahren, Schaffung von Branchenkodizes, etc. – auf die Ordnungsebene<strong>und</strong> damit die konkrete Anforderung ordnungsethischer Gr<strong>und</strong>sätze zurück." (B. Noll: <strong>Wirtschafts</strong>-<strong>und</strong> Unternehmensethik in der Marktwirtschaft, Kohlhammer 2002, 94)Das ist etwas neues <strong>und</strong> das muss man lernen. Ich interpretiere die Bemühungen um CorporateCitizenship, um Corporate Social Responsibility als Suchprozesse. Wo stehen wir als Unterneh-J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 15
men in einer veränderten Gesellschaft? Doch ist es überhaupt möglich, dass sich Unternehmenzu "moralischen Akteuren" entwickeln?Unternehmerethik ist nicht gleich UnternehmensethikIm „Kompendium Management in Banking and Finance,“ das die Frankfurter Bankakademie imletzten Jahr veröffentlicht hat gibt es einen einen Abschnitt zur Unternehmensethik. Dort heißtes:„Ein Unternehmen als Institution muss <strong>und</strong> kann moralische Verantwortung übernehmen.“Der Autor stellt fest, dass die klassische Ethik mit der Moral von Personen befasst sei <strong>und</strong> fährtfort. „Die Frage, ob diese Methodik auf eine Institution, ein Unternehmen übertragbar sei oderob sie nur für die in einem Unternehmen Tätigen als Individuen gelten könne, wurde bis indie jüngste Vergangenheit kontrovers diskutiert. Heute wird sie eindeutig mit »Ja» beantwortet.“Also „Ein Unternehmen als Institution muss <strong>und</strong> kann moralische Verantwortung übernehmen.“Doch ganz so eindeutig ist die Diskussionslage keineswegs. Zumindest im Kontext von Kirchen<strong>und</strong> Theologie ist nach wie vor die genau gegenteilige Auffassung vorherrschend. Verantwortungsei immer individuell <strong>und</strong> personal zu verstehen. Letztlich komme es doch auf dieindividuellen Menschen an. Letztlich sei immer die Person verantwortlich.Dieser Frage stand im Zentrum meiner Dissertation. Wie passt die Idee der Unternehmensverantwortungin unsere geistesgeschichtlichen Traditionen. Darauf bin ich in einem anderen Vortragim Rahmen der <strong>Wirtschafts</strong>gilde ausführlich eingegangen. (am 7.2.2002 in der RegionalgruppeRhein-Main, sh. www.wirtschaftsgilde.de)Hier sei nur das Ergebnis genannt: Das Unternehmen wird in der neueren Diskussion zunehmendals eigener Akteur wahrgenommen. Für die Verhaltensweisen des Unternehmens haben UnternehmerInnen<strong>und</strong> führende Manager eine Mitverantwortung. Nicht weniger, aber auch nichtmehr. Der Unternehmer steuert <strong>und</strong> repräsentiert gegebenenfalls das Unternehmen. Er ist esnicht.Unternehmensethik ist also nicht gleich Unternehmerethik. Unternehmerethik behandelt das Berufsethosdes Unternehmers, der Unternehmerin. Unternehmensethik dagegen ist die Ethik derOrganisationsform "Unternehmung". Genau genommen beginnt Unternehmensethik erst dort, wodas Unternehmerethos nicht mehr hinreichend ist für die moralische Bestimmung des Unternehmens.Dann fragt sich natürlich, wie ein Unternehmen Verantwortung übernehmen kann. Die Antwortlautet: Es muss seine Strukturen entsprechend gestalten. Und genau dafür hat das Managementnatürlich eine besondere Rolle. Ich habe das so formuliert, um die Parallelität zu Individuendeutlich zu machen:• Verantwortungsfähigkeit von Individuen ist Ergebnis eines Bildungsprozesses. RelativesGelingen des Bildungsprozesses ist Voraussetzung für selbstbestimmte Verantwortungsübernahme,aber nicht Voraussetzung für die Zuschreibung von Verantwortung.J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 16
• Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen ist Aufgabe eines Managementprozesses. RelativesGelingen dieses Prozesses ist Voraussetzung für selbstbestimmte Verantwortungsübernahme,aber nicht Voraussetzung für die Zuschreibung von Verantwortung.Bildungsprozesse hier, Managementprozesse da. Das ist der entscheidende Unterschied zwischenOrganisationen <strong>und</strong> Individuen. Dahinter steht die entscheidende Differenz zwischen Organisationen<strong>und</strong> Individuen: Anders als wir Menschen, fehlt Unternehmen die leib-seelischeEinheit. Ihnen fehlt das, was wir bei Menschen gewohnt sind: die menschliche Körperlichkeit,d.h. Größe bis 220 cm, Lebensalter bis 120 Jahre, meistens zwei Hände, zwei Füße, zwei Augen,zwei Ohren, aber nur ein M<strong>und</strong>. Das haben Unternehmen nicht. Und daher kommt den Individuenim Unternehmen eine Mitverantwortung für das Unternehmen zu – den leitenden Personennatürlich in erhöhtem Maße.Ethikmanagement als Teil der UnternehmensverantwortungEthik im Management betrifft dann nicht nur das moralische Verhalten von Leitungspersonen, sowichtig das ist. Sondern es betrifft die Gestaltung der Unternehmensstrukturen so, dass das Unternehmennicht nur ein moralfähiger, sondern ein moralischer Akteur wird. Diese Managementaufgabewird zunehmend als Ethikmanagement bezeichnet.Ein Beispiel. In einem Bauunternehmen sind Preisabsprachen <strong>und</strong> Besprechung Teil der faktischenUnternehmenspolitik. Das Problem kann man dem Staatsanwalt überlassen, oder mankann versuchen, ohne zu große Verluste aus dieser Situation herauszukommen. Man kann sichzurückziehen auf die Position "Wenn wir es nicht machen, sind wir weg vom Markt" oder mankann feststellen: Wir befinden uns in der Situation des moralischen Konfliktfalls, ein kurzfristigerVerzicht auf nur durch Bestechung einwerbbare Aufträge führt in den ökonomischen Konfliktfall.Welche Strategien sind möglich, um in den erwünschten Bereich des positiven Kompatibilitätsfalleszu gelangen.Die bayerische Bauindustrie hat begonnen, auf Branchenebene ein EthikManagementsystemanzubieten (www.bauindustrie-bayern.de). Durch die Teilnahme verpflichten sich die Unternehmen,durch interne Maßnahmen, die natürlich vereinbart sind, Fehlhandlungen von Mitarbeiternauszuschließen. Das ist für die teilnehmenden Unternehmen zunächst eine Wettbewerbsstrategie,von der sie nicht wissen, ob sie sich auszahlt.Wie funktioniert das?Für die teilnehmenden Unternehmen sind fünf Bausteine verbindlich:1) Verhaltensstandards legen die Gr<strong>und</strong>werte des Unternehmens fest. Diese sind die "Visitenkartedes Unternehmens".2) Verbindlich ist, dass das Werteprogramm <strong>und</strong> seine Einführung Chefsache ist. Wenn sich dieGeschäftsleitung nicht gleichermaßen auf die Gr<strong>und</strong>werte verpflichtet, dann sollte man es besserbleiben lassen.3) Die Implementation der Verhaltensstandards muss deutlich machen, dass ihre EinhaltungFirmenpolitik ist: Einbeziehung in Einstellungsgespräche, Arbeitsverträge, <strong>und</strong> -anweisungen,Anbindung an das Qualitätsmanagement, Aufnahme in Lieferantenverträge (wo möglich) usw.J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 17
4) In Schulungen oder in Arbeitsbesprechungen werden die Verhaltensstandards <strong>und</strong> möglicheKonfliktfälle <strong>und</strong> Fallstudien erörtert. Es geht schließlich um Verhaltensänderungen.5) Die externe Auditierung unterstreicht Informationsoffenheit <strong>und</strong> Ernsthaftigkeit. Sie mussnicht aufwendig sein, ist aber im System der Bauindustrie verbindlich.Nicht jedes Ethikmanagement muss verbandsmäßig organisiert sein. Es kann auch auf Selbststeuerungdurch Selbstverpflichtung des Unternehmens <strong>und</strong> entsprechende Selbstkontrolle zielen.Entscheidend: Es geht um Strukturänderungen, nicht nur um moralische Appelle.Warum macht man so etwas? Was ist der Nutzen des EthikManagements?Hier stellt sich natürlich wieder die Frage nach Ethik <strong>und</strong> Erfolg. Ob sich ein EthikManagement-System auszahlt, hängt von einer Vielzahl von internen <strong>und</strong> externen Faktoren ab. Ich möchteden Nutzen daher hier nicht bewerten, sondern greife auf die Beschreibungen von denen zurück,die es machen. Die bayerische Bauindustrie nennt drei Punkte:1) EthikManagement ist ein Führungsinstrument, neudeutsch: ein Management-Tool: Es hilftdem Unternehmer, im eigenen Haus nicht nur aufzuräumen, sondern positiv eine neue Richtungzu verankern. Es gibt den Mitarbeitern eine Richtschnur, die sie im Alltagsgeschäft brauchen.Ganz "nebenbei" entsteht eine neue Unternehmenskultur.2) EthikManagement ist Qualitätssicherung in Sachen Recht: Es entlastet den Unternehmervon einem Teil der strafrechtlichen Konsequenzen, denen er unterliegt, wenn Managementversagenzu korruptem Verhalten führt. Die Arbeitsanweisung "Das ist verboten", reicht nämlichnicht.3) EthikManagement schafft Reputation: Es kann die Beziehungen zu den Geschäftspartnernauf eine neue Basis stellen. Auch im Wettbewerb um Mitarbeiter <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en kommt es zunehmendauf Glaubwürdigkeit an.Die Entwicklung des EthikManagement ist Teil der zunehmenden Professionalisierung vonEthik im Management <strong>und</strong> steckt zweifelsfrei noch in den Kinderschuhen. Wenn aber BASF, dieFraport AG (Flughafen Frankfurt) <strong>und</strong> neuerdings die Bahn sich dieses Themas annehmen, dannist die Richtung vorgezeichnet. In den USA gibt es eine rechtsstaatliche Funktion des EthikManagements<strong>und</strong> die meisten größeren Unternehmen haben dort ein System des EthikManagements.Ganz so wird es in Deutschland (aus rechtssystematischen Gründen) nicht kommen. Dochwenn das (im B<strong>und</strong>estag beschlossene) Korruptionsregister in hoffentlich überarbeiteter Formden B<strong>und</strong>esrat passiert hat, wenn "unzuverlässige Firmen" von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossenwerden, dann wird ein zertifiziertes EthikManagement ein entscheidendes Argumentsein, von dieser Liste wieder gestrichen zu werden. Oder noch besser: dort gar nicht erst hinzugeraten.Denn auch in diesem Fall wäre es hilfreich, wenn die Rahmenordnungen diese Wettbewerbsstrategienunterstützen würden oder werden. In der Formulierung von oben: "Strebe eine Übereinstimmungzwischen dem Handeln nach moralischen Überzeugungen <strong>und</strong> einer gesellschaftlichenRahmenordnung an, die eben dieses Handeln positiv honoriert."J. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 18
Fazit• Ethik bedeutet nicht nur, Aufgaben zu erfüllen, welche andere einem zuschreiben, sondernzunächst die Klärung der eigenen Verantwortung.• Ethik im Management erfordert daher die Teilnahme am öffentlichen Diskurs über Verantwortungsverteilungenin der Gesellschaft. Das ist eher ungewohnt. Denn für den Blick aufdas Ganze, für das "Gemeinwohl" war traditionell der Staat bzw. die Politik da. Dieseschiedlich friedliche Arbeitsteilung funktioniert zunehmend weniger. Das bedeutet nicht, sichals Unternehmen von der EU-Kommission oder den Gewerkschaften alle möglichen gesellschaftlichenAufgaben aufdrücken zu lassen, zusätzlich zur selbstverständlichen Besteuerung.• Die neue Unübersichtlichkeit erfordert eine zunehmende Reflexion in den Unternehmen <strong>und</strong>Verbänden auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben. Das kann nur – zumindest ganz wesentlich– im Management geschehen <strong>und</strong> deshalb ist "Ethik im Management" in Zukunft wiedermehr gefordert.• Ethik im Management muss daher zweierlei bedeuten: Bewusste Klärung der Verantwortungsdimensionenunternehmerischen Handelns <strong>und</strong> die Implementation dieser Klärungsprozessein die Unternehmensstrukturen hinein (Ethikmanagement).• In diesem doppelten Sinne gibt es für mich keinen Zweifel, dass Ethik im Management hilfreichfür nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Ein Garant ist es keineswegs <strong>und</strong> vielleichauch keine unmittelbar notwendige Voraussetzung. Nicht nur unsere marktwirtschaftlicheRahmenordnung ist gelegentlich defizitär, sondern die Welt insgesamt ist eben nicht vollkommen.Das musste schon Hiob erfahren.Der AutorDr. Joachim Fetzer, Volkswirt <strong>und</strong> Theologe, bis 2002 Geschäftsführer des Instituts für <strong>Wirtschafts</strong>-<strong>und</strong> Unternehmensethik, promovierte mit einer Arbeit über "Die Verantwortung derUnternehmung".Informationen:www.iws-netz.dewww.dnwe.deJ. Fetzer, Ethik im Management, 17.09.2003 S. 19