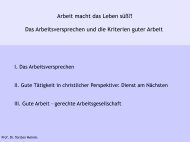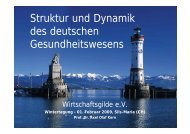Schulbuchanalyse Wirtschaftsethik.pdf
Schulbuchanalyse Wirtschaftsethik.pdf
Schulbuchanalyse Wirtschaftsethik.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wirtschaftsethik</strong> inwirtschaftskundlichen Schulbuchtextenan allgemein bildenden GymnasienDiplomarbeitVorgelegt an derUniversität MannheimLehrstuhl für WirtschaftspädagogikProf. Dr. Hermann G. EbnerVonHeike DienerOktober 2009
INHALTSVERZEICHNISABBILDUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................V1. BEDEUTUNG VON WIRTSCHAFTSETHIK IN DER WIRTSCHAFTSERZIEHUNG...11.1 Problemstellung und Zielsetzung .................................................................................11.2 Inhaltlicher Aufbau.......................................................................................................42. GRUNDLAGEN ZUM VERSTÄNDNIS DES KONSTRUKTS WIRTSCHAFTSETHIK .62.1 Grundbegriffe der Ethik – Werte und Normen, Moral und Ethik ................................62.2 Normative und deskriptive Ethik im Vergleich............................................................92.3 Ökonomik – Definition und Formen ..........................................................................102.4 Verhältnis von Ökonomik und Ethik – ein Widerspruch? .........................................132.5 Makro-, Meso- und Mikroebene, die drei Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> imÜberblick ....................................................................................................................153. SCHULBUCH ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND ................................................193.1 Funktionen des Schulbuchs ........................................................................................193.2 Zulassungsverfahren für Schulbücher ........................................................................223.3 <strong>Schulbuchanalyse</strong>n zur Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> ..........................................254. WIRTSCHAFTSETHIK – EINE QUALITATIVE INHALTSANALYSEAUSGEWÄHLTER SCHULBÜCHER...............................................................................274.1 Auswahl und Begründung der methodischen Vorgehensweise .................................274.2 Bestimmung des Untersuchungsmaterials..................................................................284.3 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring................................................324.4 Beschreibung der Kategorienentwicklung .................................................................344.5 Kategorien zur Analyse der Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern ........345. ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE..........................................385.1 Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern der Bundesländer:Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen.....................................................385.2 Vergleichende Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse .......................526. DIE NOTWENDIGKEIT DER INTEGRATION DER WIRTSCHAFTSETHIK INDEN UNTERRICHT AN ALLGEMEIN BILDENDEN GYMNASIEN ............................57LITERATURVERZEICHNIS..................................................................................................59ANHANG .................................................................................................................................65Anhang I: Auszüge aus den Schulbuchlisten...................................................................65Anhang II: Übersichtsliste der zulässigen Schulbücher....................................................75Anhang III: Inhaltsverzeichnisse der ausgewählten Schulbücher......................................77Anhang IV: Fundstellen zu den einzelnen Ergebnissen .....................................................95EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG ..................................................................................127FREIWILLIGE ERKLÄRUNG.............................................................................................128IV
ABBILDUNGSVERZEICHNISAbbildung 1: Überblick der begrifflichen Zusammenhänge......................................................8Abbildung 2: Aufbau der Ethik ..................................................................................................9Abbildung 3: Aufbau der Ökonomik........................................................................................10Abbildung 4: Drei Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> ......................................................................15Abbildung 5: Das Schulbuch als Informatorium, Paedagogicum und Politicum.....................19Abbildung 6: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse....................................................32Abbildung 7: Ablaufmodell der skalierenden Strukturierung ..................................................33Abbildung 8: Grafische Darstellung der zusammenfassenden Ergebnisse ..............................53V
1. BEDEUTUNG VON WIRTSCHAFTSETHIK IN DERWIRTSCHAFTSERZIEHUNG1.1 Problemstellung und ZielsetzungVom Normalbürger 1 über den Unternehmer bis hin zum Geistlichen und Politiker: EinGroßteil aller Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt sich aktuell mit dem Thema<strong>Wirtschaftsethik</strong>. Aber wird diese Thematik auch im Unterricht sowie in den Schulbüchernfür allgemein bildende Gymnasien aufgegriffen? Werden die Schüler auf ihre zukünftigeRolle als Teilnehmer des Berufs- und Wirtschaftslebens vorbereitet und mit Werten, Normen,Ökonomik oder der <strong>Wirtschaftsethik</strong> selbst konfrontiert? Wird ihre ethische Urteilsfähigkeitgestärkt?Bereits in früheren Jahren beschäftigte man sich schon mit dem in der letzten Zeit häufigdiskutierten Thema. So haben sich seit Beginn der 80er Jahre verschiedene „Schulen“ bzw.Richtungen entwickelt. Beispielhaft seien hier die „Moralökonomik“ von Karl Homann, die„Integrative <strong>Wirtschaftsethik</strong>“ von Peter Ulrich und die „Governanceethik“ von JosefWieland genannt. Besonders wenn es zu starken gesellschaftlichen Veränderungen kommt,wie z. B. in einer Krisenzeit oder durch die Globalisierung, rückt die Ethik wieder in denVordergrund und Wertvorstellungen werden zunehmend diskutiert.Gerade in Zeiten der Finanz- und Weltwirtschaftskrise wird die Forderung nach ethischemHandeln in der Wirtschaft immer stärker. Sogar Papst Benedikt XVI schreibt in seiner erstveröffentlichten Sozialenzyklika, dass die Wirtschaft eine menschenfreundliche Ethik braucht(vgl. Papst Benedikt XVI, 2009, S. 39) 2 . Dass Wirtschaft und Ethik zusammengehören, betontebenfalls Michael Woltering, der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständischeWirtschaft (BVMW), Kreisverband Osnabrück-Emsland-Bentheim, im Februar 2009 (vgl.Woltering, 2009). Auch der evangelische Bischof, Ratsvorsitzender der EKD (EvangelischeKirche in Deutschland) Wolfgang Huber fordert einen Werteaufschwung. Laut diesemmüssen „neue Regeln für das persönliche Verhalten in Wirtschaft und Gesellschaft“ 3aufgestellt werden, um die Krise bewältigen zu können (Huber, 2009).Im Rahmen der angewandten Ethik und als Sozialethik versucht die <strong>Wirtschaftsethik</strong> „dieethischen Prinzipien eines guten Lebens mit den Ansprüchen des Wirtschaftshandelns aufEffizienz, Nutzenwachstum und Wertsteigerung zu verbinden“ (Pieper, 2007, S. 98).Aufgrund der momentanen Lage in der Wirtschaft, sei es die Weltwirtschaftskrise, größereFusionen oder Umweltprobleme, tauchen immer mehr kritische Stimmen auf, die einegerechte und solidarische Wirtschaftsordnung fordern. „Nicht nur der einzelne istaufgefordert, die Wirtschaftlichkeit seines Handelns über das Eigeninteresse (Profitsteigerung,Gewinnmaximierung) hinaus im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Praxisselbstkritisch zu reflektieren; auch die Betriebe sollen Unternehmensethik betreiben, um damit1 Zu Beginn sei erwähnt, dass die Verwendung maskuliner Bezeichnungen für alle Personengruppen derbesseren Lesbarkeit dient. Im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit des „Bürgers“ oder „Schülers“ bzw.anderen vergleichbaren Formulierungen ist stets die weibliche Form gedanklich mit einbezogen.2 Alle Literaturangaben im Text und das Literaturverzeichnis basieren auf dem geforderten APA-Standard.Zusätzlich wird / werden bei allen Literaturverweisen im Text der Autor / die Autoren durch Kursivschrifthervorgehoben. Indirekte Zitate werden mit einem „vgl.“ eingeleitet. Zur besseren Auffindbarkeit in derverwendeten Literatur wird ebenfalls die Seitenzahl angegeben.3 Des Weiteren werden die in dieser Arbeit wörtlich zitierten Textzeilen wortgetreu aus der vorliegendenLiteratur übernommen; Rechtschreibfehler oder die alte Rechtschreibung werden beibehalten. Außerdem werdendie Hervorhebungen, sei es Fettdruck, Kursivschrift oder andere, übernommen.1
1. Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der Wirtschaftserziehungeinerseits ihrer Verantwortung sowohl gegenüber den Mitarbeitern (Führungsstil,Management, Mitspracherecht, Leistungsbewertung) als auch gegenüber den Konkurrenzbetrieben(Wettbewerbsbedingungen, Rivalitätsverhalten) nachzukommen, andererseits dieschädlichen Nebenwirkungen der Warenproduktion so weit wie möglich zu reduzieren undfür sie gemäß dem Verursacherprinzip aufzukommen.“ (Pieper, 2007, S. 98).In unserer schnelllebigen Zeit findet man kaum noch ein Handeln, das sich an Werten undNormen orientiert.Durch eine immer größer werdende individuelle Freiheit der Menschen, werden dieseautonom und verfolgen überwiegend ihr Eigeninteresse. Dabei haben sich die Individuenmehr und mehr von verschiedenen Vorgaben, vor allem von gesellschaftlichen Normensystemen,distanziert. Sie bestimmen somit selbst, wie sie leben möchten (vgl. Suchanek, 2006,S. 19f.). Aber trotz dieser Loslösung von Wertvorstellungen und Normen, darf die Moralnicht vernachlässigt werden und muss z. B. über Regelsysteme wieder integriert werden.Legt man die Theorie von Homann zugrunde, stellt die Rahmenordnung einer sozialenMarktwirtschaft den systematischen Ort der Moral dar, und diese ist entsprechend ethischgeprägt. Die Rahmenordnung bestimmt folglich die Handlungsergebnisse. Wenn diesemoralisch verwerflich sind, müssen die für alle Teilnehmer geltenden Spielregelndahingehend verändert werden, dass sie zu moralisch vertretbaren Resultaten führen. So istein individuelles, ethisches Handeln von den Wirtschaftssubjekten bei ihren wirtschaftlichenAktivitäten kaum von Nöten, allerdings sind persönliche moralische Intentionen undMotivationen für die Gestaltung des Regelsystems erforderlich (vgl. zu diesem AbsatzHomann & Blome-Drees, 1992, S. 35ff.).Doch nicht alles auf den Märkten oder innerhalb des Systems kann über Gesetze und Vorschriftengeregelt werden. Es gibt immer Handlungsspielräume für jeden einzelnen Akteur.Insbesondere wenn es um Wettbewerb geht, versucht jeder das Beste zu erreichen. Meistnimmt dabei die Gier überhand und die Teilnehmer schrecken nicht vor unethischem Handelnzurück. Es erscheint oftmals, dass beim Streben nach Profit und Macht die Wahrnehmung derMitmenschen stark in den Hintergrund rückt und ethisches Verhalten keine Berücksichtigungmehr findet. „Ob die Schließung gewinnbringender Produktionsstandorte, die möglicheSteuerhinterziehung durch Manager und Konzernchefs oder das ruinöse Wirtschafteneinzelner Geschäftsbanken auf Kosten der Steuerzahler – dem Verfall moralischer Wertescheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.“ (Woltering, 2009).Durch die Globalisierung werden verschiedene Wirtschaftssysteme und Gesellschaften weltweitmiteinander verbunden (vgl. Scherer, Blickle, Dietzfelbinger & Hütter, 2002, S. 13f.). Estreffen z. T. sehr unterschiedliche Wertvorstellungen und moralische Einstellungen aufeinander.Aufgrund dieser Heterogenität ist es nicht immer leicht, ein globales moralischesVerhalten zu erreichen, das überall Zustimmung findet. Infolgedessen kommt es evtl. zueinem Handeln, das nicht immer an ethischen Normen einer Gesellschaft orientiert ist, aber ineiner anderen Gemeinschaft als angesehen und vertretbar gilt. Hier ist es wichtig, dass eineinheitliches Regelsystem aufgebaut wird, wie z. B. die Welthandelsordnung, um überall eingerechtes Auskommen miteinander zu erreichen.Daneben muss man sich in dieser Zeit mit Themen der Nachhaltigkeit, der gesellschaftlichenund sozialen Verantwortung auseinandersetzen, um der gesamten Bevölkerung ein zukunftssicheresLeben zu ermöglichen. Von jedem Einzelnen ist ein ethisches Handeln erforderlich.Alle in Deutschland aufwachsenden Bürger verbringen einen Großteil ihres ersten Lebensabschnittesan allgemein bildenden Schulen, da gemäß den einzelnen LandesverfassungenSchulpflicht besteht. Die Schulen nehmen neben dem Bildungsauftrag einen Erziehungsauftragwahr und prägen die Heranwachsenden in der Bildungseinrichtung zusätzlich zur2
1. Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der WirtschaftserziehungFamilie bzw. zu ihrem sozialen Umfeld. So wird hier mit ein weiterer wichtiger Grundsteinfür das Leben in der Wirtschaftsgesellschaft gelegt.Im Bildungsplan 2004 Allgemein bildendes Gymnasium von Baden-Württemberg wird derallgemeine Bildungsauftrag der Schulen definiert. Dieser umfasst die persönliche, praktischeund politische Bildung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,2004, S. 11). Die heranwachsenden Jugendlichen rücken im Laufe ihrer Schulzeit immernäher an das Berufsleben heran und damit wächst die Teilnahme am wirtschaftlichen Leben,auf welches ebenfalls vorbereitet werden muss (vgl. Kaminski & Krol, 2008, S. 7). Deshalbist es sinnvoll, die wirtschaftliche Bildung in die allgemein bildenden Schulen zu integrieren.Ein eigenständiges Fach konnte sich bisher noch nicht etablieren. Es wird allerdings seitlangem von Wirtschaftsdidaktikern und der Wirtschaft gefordert (vgl. Weiß & Gartz, 1998,S. 50). Mittlerweile wurden jedoch Fächerverbünde gebildet. In Baden-Württemberg gibt esz. B. ein neues Fach: Geographie – Wirtschaft – Gemeinschaftskunde. „Angesichts derwachsenden Bedeutung und zunehmenden Komplexität wirtschaftlicher Strukturen undProzesse ist eine fundierte ökonomische Bildung Grundvoraussetzung zur Bewältigungprivater, beruflicher und gesellschaftlicher Lebenssituationen und zum Verständnis derInterdependenzen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.“ (Ministerium für Kultus,Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2004, S. 250). Die ökonomische Bildung soll dazubeitragen, die Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen, die später durch ihre sachgerechtenEntscheidungen verantwortungsvoll handeln (vgl. ebda., S. 250).Neben dem Erziehungsziel der Schulen soll außerdem die Handlungsorientierung einenwesentlichen Unterrichtsbestandteil darstellen, um die Teilnahme am wirtschaftlichen Lebenzu erleichtern. Dies begründet sich damit, dass in der Arbeitswelt immer weitere, neue oderveränderte Anforderungen entstehen. Dementsprechend soll es den Lernenden ermöglichtwerden, vollständige Handlungen auszuführen, d. h. die Zielstellung, die Planung, dieDurchführung und die Bewertung eigenständig zu übernehmen (vgl. Ebner, 1992, S. 45).Dadurch sollen die Schüler die Fähigkeit entwickeln, komplexe Situationen zu gestalten undzu bewältigen. Ganze Handlungszyklen sollen während ihres Verlaufs sowie abschließendkritisch beurteilt und ständig verbessert werden. Im Rahmen der Handlungsorientierungkönnen ebenfalls Wertmaßstäbe für zukünftige Handlungssituationen vermittelt werden, andenen eine Ausrichtung späteren Handelns möglich ist (vgl. Ebner, 1992, S. 35). Die eigeneHaltung, persönliche oder gesellschaftliche Werte und Normen beeinflussen und bestimmensomit den kompletten Prozess. Gerade bei der Durchführung von Handlungen imWirtschaftsleben, die keinen fest vorgeschriebenen Ablauf besitzen, spielen die eigenenErfahrungen und das Wissen der Ausführenden eine bedeutende Rolle. Deshalb sollte hierzuim Unterricht der benötigte Wissensaufbau stattfinden und das Zusammenspiel von ethischenund ökonomischen Komponenten dargestellt werden.Im Rahmen der Wirtschaftserziehung sollen die Schüler die ökonomischen Bedingungen ihrerExistenz und deren soziale und politische Dimension reflektieren können (vgl. Sitte, 1998).Dies gilt sowohl auf der privaten wie betrieblichen, als auch auf der volkswirtschaftlichen undglobalen Ebene. Für die individuelle Entfaltung und persönliche Lebensbewältigung sowie fürdas Fortbestehen unserer demokratischen, arbeitsteiligen Gesellschaft ist diese Qualifikationvon besonderer Bedeutung. Darum muss die Wirtschaftserziehung ein zentraler Bestandteilder Allgemeinbildung sein, und in dieser sollte die <strong>Wirtschaftsethik</strong> eine wichtigeKomponente darstellen, denn in fast jeder Situation oder Problemstellung der Wirtschaftkommen sowohl ökonomische und ethische Aspekte zum Tragen, die ihre Lösung in der<strong>Wirtschaftsethik</strong> finden.In den letzten Jahren wurde die ökonomische Bildung häufig kritisiert. Ebenso hat sie an denallgemein bildenden Schulen, vor allem an den Gymnasien, nur einen sehr geringen Stellen-3
1. Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der Wirtschaftserziehungwert (vgl. Schiller, 2006, S. 52). Kritiker bemängeln, dass insgesamt zu wenig wirtschaftlicheUnterrichtsinhalte in der Allgemeinbildung vorhanden seien. Dies liegt meist daran, dass eskein eigenständiges Schulfach für Wirtschaftskunde gibt und lediglich eine Einbettung inähnliche Fächer erfolgt, wie es das vorherige Beispiel zeigt. Oft werden die ökonomischenThemen vernachlässigt, da Politik oder Geschichte in den Vordergrund gestellt werden. Z. T.fehlt auch für ökonomische Themen die geeignete Lehrerausbildung an den Universitäten(vgl. Kaminski, 1996, S. 11), um eine fachlich und didaktisch-methodisch kompetenteUnterrichtsgestaltung zu leisten und eine geeignete Lernumgebung zu schaffen. Aufgrunddessen stellt sich nun die Frage, ob wirtschaftsethische Themen im Unterricht überhauptangemessen zum Tragen kommen?Schulbücher nehmen in diesem Zusammenhang einen hohen Stellenwert im Schulalltag ein.Sie sind an den Lehrplänen orientiert und bestimmen überwiegend die Unterrichtsinhalte. Siedienen somit der Wissensbildung der Schüler. Deshalb sollten gerade in den Schulbüchernökonomische und ethische Themen thematisiert und mittels Aufgaben fundiert werden.Dadurch wird den Schülern die Möglichkeit gegeben, ein Grundverständnis für dieWirtschaftsgesellschaft mit ihren Akteuren und ihren Interaktionen zu entwickeln.Das Ziel der Diplomarbeit ist es nun, verschiedene Schulbücher des allgemein bildendenGymnasiums auf das Thema <strong>Wirtschaftsethik</strong> zu prüfen und einen Vergleich zwischen dreiBundesländern aufzuzeigen. Hierbei soll die Bedeutung dieser Thematik in den Schulbüchernherausgefunden und die inhaltlichen Ausprägungen bzw. Schwerpunkte analysiert werden.Speziell wird dabei die Sekundarstufe II, also die Oberstufe, betrachtet, da hier die größteNähe zum Berufsleben gegeben ist. So werden die Bundesländer Baden-Württemberg,Niedersachsen und Sachsen miteinander verglichen. Dadurch wird eine grobe Abdeckung derBundesrepublik Deutschland erreicht und ein Nord-Süd- sowie ein Ost-West-Vergleichermöglicht.Weiter soll mit dieser Arbeit ein Beitrag zur Schulbuchforschung geleistet werden und einabschließendes Resümee hinsichtlich möglicher Verbesserungen gezogen werden.1.2 Inhaltlicher AufbauNach dieser Problemstellung wird die genauere Bestimmung des Konstrukts„<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ in Kapitel 2 vorgenommen. Hierbei werden Grundbegriffe der Ethikdifferenziert und die normative und deskriptive Ethik vergleichend dargestellt. Ergänzendwird die Ökonomik anhand einiger ausgewählter Grundgedanken dargelegt. Anschließenderfolgt die Analyse des Verhältnisses von Ökonomik und Ethik. In diesem Zusammenhangwird überprüft, ob es evtl. einen Widerspruch zwischen diesen beiden Disziplinen gibt. Daszweite Kapitel schließt dann mit den Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> ab, somit werden dieOrdnungs-, Unternehmens- und Individualethik voneinander abgegrenzt.In Kapitel 3 wird das Schulbuch als Untersuchungsgegenstand genauer betrachtet und seineFunktionen erläutert. Daneben werden die Zulassungsverfahren für Schulbücher der einzelnenLänder beschrieben. Abschließend wird hier der „State of Art“ aufgegriffen und bereitsdurchgeführte <strong>Schulbuchanalyse</strong>n zu diesem Thema mit ihren Ergebnissen angeführt.Die qualitative Inhaltsanalyse der ausgewählten Schulbücher findet in Kapitel 4 statt. Zuerstwird die Auswahl der methodischen Vorgehensweise begründet und die zu untersuchendenSchulbücher näher bestimmt. Als nächstes wird der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse4
1. Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der Wirtschaftserziehungnach Mayring erläutert. Nach der Beschreibung der Kategorieentwicklung erfolgt dieVorstellung der festgesetzten Analysekategorien.In Folge der Untersuchung der Schulbücher werden die Ergebnisse einzeln in Kapitel 5 dargestelltund abschließend vergleichend zusammengefasst. Diese Ergebnisse bilden dann dieBasis der nachfolgenden Interpretation.Im letzten Kapitel wird die Notwendigkeit der Integration der <strong>Wirtschaftsethik</strong> in denUnterricht an allgemein bildenden Gymnasien beschrieben und ein wertendes Fazit gegeben.5
2. GRUNDLAGEN ZUM VERSTÄNDNIS DES KONSTRUKTSWIRTSCHAFTSETHIKAls wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich die <strong>Wirtschaftsethik</strong> mit ethischen undökonomischen Fragestellungen. Legt man ihre Aufgabenstellung nach Homann und Blome-Drees zugrunde, so befasst sie sich damit, „welche moralischen Normen und Ideale unter denBedingungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft (von den Unternehmen) zur Geltunggebracht werden können“ (1992, S. 14).Die Hauptfrage der Ethik lautet: „Wie soll ich handeln?“ (Quante, 2008, S. 11). In dieserFrage steckt zum einen die Freiheit der Menschen, sich zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeitenzu entscheiden, und zum anderen wird diese eingeschränkt durch dieVerpflichtung zu handeln und sich dabei an bestimmte Vorgaben zu halten (vgl. Göbel, 2006,S. 5). Ein Teil dieser Verpflichtung ist auch abhängig von der inneren Grundhaltung desMenschen, ob er als Mensch und Person „gut“ ist (vgl. Karmasin & Litschka, 2008, S. 13).Der Zusammenhang zwischen diesen Elementen lautet: „Was wir uns wünschen (Werte,Zustände, Güter) zeigt uns was wir tun sollen (Normen und Pflichten) und wie wir sein sollen(Haltung und Tugend).“ (Karmasin & Litschka, 2008, S. 13).Ökonomik befasst sich damit, „wie die Menschen ihre Bedürfnisse angesichts knapperRessourcen befriedigen können, um so ihre eigene materielle Situation verbessern zukönnen.“ (Karmasin & Litschka, 2008, S. 18). Es geht darum, den eigenen Nutzen zumaximieren und dabei bestimmte Restriktionen zu berücksichtigen und einzuhalten. DieLösung dieses Spannungsverhältnisses erfordert die Anwendung eines ökonomischenPrinzips. Entweder wird das Minimal- oder das Maximalprinzip eingesetzt, um so eingünstiges Verhältnis von Aufwand und Ertrag zu erreichen. Folglich wird versucht, mit einemsparsamen Mitteleinsatz ein vorgegebenes Ziel zu erlangen oder umgekehrt, mit gegebenenEinsatzfaktoren den höchsten Ertrag zu erwirtschaften (vgl. Marx, 2003, S. 11)Aufgrund dieser beiden Mutterdisziplinen beschäftigt sich die <strong>Wirtschaftsethik</strong> mit der Fragestellung,„welches wirtschaftliche Handeln moralisch zu rechtfertigen ist und welches nichtund wie das als «richtig» erkannte wirtschaftliche Handeln gefördert werden kann.“ (Noll,2002, S. 34).Die nachfolgenden Unterkapitel beinhalten nun nähere Informationen zu den jeweiligenDisziplinen im Einzelnen. Diese werden dann im Punkt 2.4 zusammengeführt, in dem dasVerhältnis von Ethik und Ökonomik thematisiert wird. Im Anschluss erfolgt die genauereBetrachtung der einzelnen Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>.2.1 Grundbegriffe der Ethik – Werte und Normen, Moral und EthikIm vorangehenden Kapitel wurden die Begrifflichkeiten: „Werte“, „Normen“, „Moral“ und„Ethik“ bereits verwendet, jedoch ohne auf ihre jeweilige Definition einzugehen. Die Unterscheidungzwischen den Grundbegriffen der Ethik ist allerdings wichtig, da die Überlegungenim weiteren Verlauf dieser Arbeit darauf aufbauen werden.Jeder Mensch hat gewisse Wertvorstellungen (ökonomische, moralische, religiöse, usw.),durch die sein Handeln beeinflusst wird. Diese können sich allerdings im Laufe der Zeit verändern,so dass früher wichtige Werte z. B. durch andere ersetzt werden oder gänzlich anBedeutung verlieren. Somit wird jeder Einzelne von sich wandelnden persönlichen undgesellschaftlichen Werten geleitet, die eine gewisse Orientierungsgrundlage für die persönlichenHandlungen und Handlungsentscheidungen darstellen.6
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>In Werten findet man das wieder, was als wünschenswert von einem Individuum, einerGruppe oder einer Gesellschaft angesehen wird. Werte wie Sicherheit, Gerechtigkeit oderGleichheit sind für ein friedliches Zusammenleben in jeder Gesellschaft erforderlich. Gesundheit,Menschenwürde oder auch Wohlstand zählen z. B. zu den Grundwerten einesIndividuums. Da Werte gewisse Zielvorstellungen darstellen, sind sie Auffassungen über dieQualität der Wirklichkeit (vgl. zu diesem Absatz Noll, 2002, S. 9).Die eben beschriebenen Werte werden durch Normen in die Tat umgesetzt und dadurch verwirklicht.Es kann sein, dass ein Wert in mehreren Normen konkretisiert wird oder dass eineNorm auf mehrere Wertsetzungen zurückzuführen ist.Jeden Tag treten wir mit anderen Menschen in soziale Interaktionen. Wir entscheiden unsdabei bewusst für ein Verhalten und werden nicht instinktiv geleitet. Normen stellen entwederGebote oder Verbote dar; so werden einige Verhaltensweisen gefordert und andere sind zuvermeiden. Es werden hierbei sogenannte Sollensaussagen gebildet, die an die Einstellungjedes Einzelnen appellieren.Normen gehören zur Kategorie der Werturteile und sie informieren uns, wie wir handelnsollen. Sie lassen sich auch als Richtlinien des Verhaltens definieren, da sie unser Handelnanleiten und uns eine bestimmte Richtung vorgeben.Jede Norm ist in gewisser Weise verbindlich. Man unterscheidet zwei Arten von Normen. Esgibt moralische Normen, die auf Kann- und Sollenserwartungen beruhen und nur der sozialenAkzeptanz dienen. Dazu zählen bspw. Tischsitten oder rituelle Begrüßungsformeln. SolcheNormen werden von den Heranwachsenden automatisch übernommen, ohne dass sie expliziterlernt werden müssen. Andere moralische Normen, die auf Musserwartungen basieren, sinddurch Rechtsprechung und Gesetze verankert und müssen eingehalten werden; bei Verstoßdrohen hier Sanktionen. Allerdings setzt der Staat durch gesetzliche Vorschriften nur dasMinimum an moralischen Standards. Nicht alles kann geregelt werden, so können Dingedurchaus legal, aber eventuell ethisch verwerflich sein.Bei der Entscheidung was „gut“ oder „böse“, „recht“ oder „unrecht“ ist, stellen Normen eineHilfestellung dar. Sie beschränken uns im Verhalten, eröffnen uns dennoch ebenso Freiheitsspielräume,die ohne Regeln nicht möglich wären. Gäbe es z. B. nicht die Straßenverkehrsordnung,würde auf unseren Straßen sicherlich ein wildes Durcheinander herrschen undmanch einer würde sich nicht trauen, an solch einem Verkehrssystem teilzunehmen.Abschließend sei noch erwähnt, dass Normen auf der einen Seite Stabilität geben, sie auf deranderen Seite jedoch ebenfalls Fixierung mit sich bringen und Fortschritte hemmen können(vgl. zu diesem Abschnitt Noll, 2002, S. 9-11).Wenn man alle sozial anerkannten Werte und Normen einer Gesellschaft oder Gruppezusammenfasst, so erhält man die Definition der Moral (vgl. Karmasin & Litschka, 2008,S. 13). Sie ist Gegenstand der Ethik, die im nächsten Abschnitt genauer beschrieben wird, undlässt sich aus dem lateinischen Wort „mores“: Sitte, Charakter übersetzen. „Moral und Sittebilden einen normativen Grundrahmen aus Handlungsregeln und Wertmaßstäben für dasindividuelle Verhalten gegenüber den Mitmenschen, aber auch gegenüber der Natur und sichselbst.“ (Horn, 1996, S. 17). Somit regelt sie, was man in einer Gemeinschaft darf oder nichtdarf und was man tun oder unterlassen soll (vgl. Noll, 2002, S. 12).Im Zusammenhang mit dem Begriff der „Moral“ wird häufig synonym die Begrifflichkeit„Ethos“ gebraucht, manche Autoren verwenden diese sogar einheitlich. Jedoch besteht einUnterschied zwischen den beiden Ausdrücken. Ethos bezeichnet eher die innereVerpflichtung zur Befolgung von Normen, daher kann es als persönliches Wertgefügeverstanden werden, welches wiederum von den gesellschaftlichen Vorstellungen abweichenkann. Die Moral umfasst dann das gesamte Werte- und Normengefüge eines abgegrenztenNaturkreises (vgl. zu diesem Absatz Kreikebaum, 1996, S. 10).7
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Sowie sich die Bedeutsamkeit und die Relevanz von Werten verändern können und Normeneinen Wandel erfahren, muss die Moral ebenfalls offen für Kritik und Weiterentwicklungsein.Unter Ethik (griechisch ethos: gewohnter Ort des Lebens, Sitte, Charakter) versteht man dieLehre von der Moral. Sie geht auf Aristoteles zurück und zählt zu den philosophischenDisziplinen (Moralphilosophie). Es ist eine Lehre vom Sollen (Nicht-Dürfen) und folglicheine praktische Philosophie. Die Vertreter dieser Wissenschaft versuchen eigene und fremdeHandlungen der Menschen möglichst rational zu begründen und sie normativ-moralisch zubeurteilen. Es werden Normen für gutes und gerechtes Handeln auf methodischem Wegeentwickelt und begründet (vgl. zu diesem Absatz Horn, 1996, S. 16).„Ihr Ziel ist allein die möglichst rationale Herleitung, Definition, Begründung, Erklärung undUntersuchung von Normen und Maximen.“ (Horn, 1996, S. 18). Ethik leistet Entscheidungshilfe,indem sie über das Handeln der Menschen reflektiert und diese entscheidungsbefugtmacht. Sie sollen dabei über ihr eigenes Leben und seine Gestaltung nachdenken und zueinem verantwortlichen Handeln angeregt werden (vgl. Dietzfelbinger, 2000, S. 67). So gehtes einerseits um die Kunst der richtigen Lebensführung und andererseits um die Regeln desHandelns (vgl. Honecker, 1993, S. 249).Für die ethische Analyse werden drei Arten unterschieden. Zum einen gibt es die deskriptiveEthik und zum anderen existiert die normative Ethik. Diese beiden Ausprägungen werden imnachfolgenden Unterkapitel näher betrachtet. Daneben gibt es noch die Metaethik, die einemoderne, sprachanalytische Theorie darstellt.Der Zusammenhang dieser Grundbegriffe soll nun in einer Grafik dargestellt werden.ETHIK als Wissenschaftanalysiert, begründet, beschreibt, lehrtkonstituierenGesellschaftMoralbildet Grundlage, liefert Datenkonstituierengestaltet,begründet, lebt,lebt, wertetbeurteilt, wandeltleiten, verpflichtenfordern,schränken einIndividuumHaltungPflichtenbeurteilt,steuertbegründet,akzeptiert, legitimiertbindet sich anleiten, verpflichten,fordern Verhaltenbeziehen sich aufWertebegründenkonkretisieren, verwirklichenNormenAbbildung 1: Überblick der begrifflichen Zusammenhänge in Anlehnung an Kunze (2008, S. 24)Eine Gesellschaft besteht aus vielen Individuen, die durch unterschiedliche Werte undNormen geprägt sind. Somit wird ihre innere Haltung durch diese geformt, und es entstehteine Verpflichtung, sie einzuhalten. Die existierende Moral einer Gesellschaft setzt sich aus8
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>dem akzeptierten Werte- und Normenkanon zusammen. Sie steuert ebenfalls die Handlungender Individuen und folglich die gesamte Gesellschaft. Die Ethik analysiert nun dieseGesellschaft im Ganzen, außerdem begründet und beschreibt sie die herrschende Moral undlehrt den Menschen durch Sollensaussagen (normative Ethik). Um dies zu erreichen, müssenDaten geliefert werden, die die Ausgangsbasis für die Analyse darstellen. Diese Aufgabeübernimmt meist die deskriptive Ethik.2.2 Normative und deskriptive Ethik im VergleichEthikdeskriptive EthikInputnormative Ethik(Kern)Metaethikempirische Beschreibungvon Ethos und MoralSchaffung moralischerLeitbilder durchBedürfnisanalyseSprachanalyse undErkenntnistheorieAbbildung 2: Aufbau der Ethik in Anlehnung an Kreikebaum (1996, S. 11) und Kunze (2008, S. 33)Wie aus der obigen Darstellung ersichtlich ist, kann die Ethik unterschiedlich ausgerichtetsein. Die Metaethik geht dem logischen Gehalt von Begriffen, wie „gut“ und „richtig“, aufden Grund (vgl. Horn, 1996, S. 16). Sie ist auf einer höheren Reflexionsstufe als die beidenanderen Richtungen, die deskriptive und normative Ethik, angesiedelt.Da die deskriptive Ethik einen wichtigen Beitrag für den Kern der Ethik und daher für dienormative Ethik leistet, erfolgt zuerst eine Beschreibung dieser Moralpsychologie.Als empirische Disziplin geht es bei der deskriptiven Ethik darum, die verschiedenenGesellschaften und Gruppen dahingehend zu beobachten und zu untersuchen, welche Moralherrscht und welches Ethos vorzufinden ist. Damit erfolgt erstens eine Beschreibung dessen,was in einer Gemeinschaft als moralisch galt oder noch gilt. Zweitens werden diese Befundekritisch beurteilt und es findet eine wertende Stellungnahme statt. Als Output liefert sie dieBeschreibung der vorherrschenden moralischen Praxis, dieser dient gleichermaßen als Inputfür die normative Ethik (vgl. zu diesem Absatz Göbel, 2006, S. 12f.).Durch die Charakterisierung, Erklärung und Voraussage der Entwicklung von vorhandenenmoralischen Verhaltensweisen, Einstellungen und Überzeugungen, beschreibt die deskriptiveEthik die Moral. Dadurch ist es möglich, Veränderungen von Werten und Normen festzustellenund eine Wandlung in der Moral einer Gesellschaft zu erkennen. Daraus lassen sichdann z. B. Handlungsbedürfnisse ableiten, um bspw. dem aktuell diskutierten Werteverfall inder Wirtschaft entgegenwirken zu können.Mit dieser Ausgangslage kann die normative Ethik, als präskriptive Wissenschaft, nach denrichtigen sittlichen Sollensaussagen suchen. „Sie will begründete und verbindliche Aussagendazu machen, wie der Mensch handeln soll (Handlungsnormen oder Pflichten), was eranstreben soll (Strebensziele oder Werte/Güter) und wie er sein soll (Haltungsnormen oderTugenden).“ (Göbel, 2006, S. 13).9
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Die normative Ethik will Aussagen darüber treffen, wie sich jedes Gesellschaftsmitglied verhaltensoll, welche Handlungen es tun oder unterlassen soll, damit es seine eigenen Ziele unddie der Gemeinschaft erreichen kann. Dabei werden die gesammelten Aussagen undfestgestellten Handlungsbedürfnisse der deskriptiven Ethik als Basis verwendet, um darausSollensaussagen zu definieren, die für alle Teilnehmer moralisch akzeptabel sind.An dieser Stelle soll abschließend die ökonomische Komponente mit eingebracht werden. Dienormative Ethik trifft allgemeingültige Aussagen, ohne einen speziellen Kontext zubetrachten. Legt man einen wirtschaftlichen Aspekt zugrunde, so werden Sollensaussagengetroffen, die das wirtschaftliche Leben betreffen und dieses beeinflussen. Es werden also imRahmen einer normativen <strong>Wirtschaftsethik</strong> Maßstäbe für die Teilnehmer einer Wirtschaftsgesellschaftgesetzt, die der Gestaltung und Entwicklung dieser dienen sollen. Um solcheSollensaussagen treffen zu können, wird häufig die Frage: „Wie soll ich handeln?“beantwortet. Hierbei müssen speziell für die Ökonomik bestimmte Restriktionen, wie z. B. dieRahmenordnungen, berücksichtigt oder das angestrebte Effizienzziel immer im Auge behaltenwerden.2.3 Ökonomik – Definition und FormenAdam Smith, der wohl bekannteste Moralphilosoph und Ökonom, gilt als Begründer derklassischen Ökonomik. Diese bezeichnet man auch als Wirtschaftswissenschaft, da sie dieLehre von der Wirtschaft darstellt. Die zu untersuchende Fragestellung lautet dabei: „wie derwirtschaftende Mensch als Einzelner oder innerhalb seiner sozialen Gruppierung (Haushalt,Betrieb, Staat) das Problem der Bedarfsdeckung löste, löst und lösen kann.“ (vgl. Hartmann,2001, S. 11).Es existieren viele Definitionen zur Ökonomik, z. T. sehr unterschiedlich in ihrenAusprägungen und Ansätzen. Den gemeinsamen Nenner der meisten Ansätze bildet derAspekt der Vorteile der Individuen und somit die individuelle Nutzenmaximierung. Weitererfolgt dies immer unter Berücksichtigung knapper Ressourcen (Güter und Produktionsfaktoren).Folglich wird ein individuelles rationales Handeln nötig, um die eigenenBedürfnisse befriedigen zu können. So lautet z. B. die Definition von Karmasin und Litschka:Die Ökonomik ist die „Wissenschaft von der Bewirtschaftung knapper Ressourcen unter demPrinzip der materiellen Zweck-Mittel Optimierung und Nutzenmaximierung“ (2008, S. 18).Wirtschaftswissenschaft(Ökonomik)VolkswirtschaftslehreBetriebswirtschaftslehregesamtwirtschaftliche Betrachtungder Beziehungen und Interaktionenzwischen den teilnehmenden AkteurenZiel: Nutzenmaximierung unter der Restriktion knapper Ressourceneinzelwirtschaftliche Betrachtung derAbläufe, Beziehungen und Interaktionenim Rahmen eines UnternehmensAbbildung 3: Aufbau der Ökonomik (Quelle: eigene Darstellung)Die Disziplin unterteilt sich, wie in der vorhergehenden Abbildung ersichtlich, in zwei Hauptrichtungen:die Volkswirtschaftslehre und die Betriebswirtschaftslehre.10
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Als Teilbereich der Ökonomik befasst sich die Volkswirtschaftslehre damit, das wirtschaftlicheZusammenleben der Menschen zu erforschen, darzustellen und die vielen Beziehungender Akteure untereinander aufzuzeigen. Sie beantwortet, wie die wirtschaftlichen Einheitenuntereinander wirken und wie die Güterversorgung der Einzelnen, in Bezug auf ein Gebiet,sichergestellt oder verbessert wird. Innerhalb der Volkswirtschaftslehre unterscheidet man dieTeilbereiche der Makro- und Mikroökonomik. Erstgenannte führt die Analyse des Gesamtmarktesbzw. der Gesamtwirtschaft durch. Die Mikroökonomik betrachtet einzelne Märkteund das Verhalten einzelner Entscheidungsträger bzw. Wirtschaftsakteure.Während sich die Volkswirtschaft z. B. mit der gesamten Gesellschaft oder einer Gruppe vonUnternehmen beschäftigt, berücksichtigt die Betriebswirtschaftslehre in erster Linie dieFragestellungen, die in einem Betrieb auftreten. Es geht um Probleme und Zusammenhänge,die den gesamten betrieblichen Wertschöpfungsprozess betreffen. Daraus lässt sich erkennen,dass es nicht nur um ein einzelnes Unternehmen geht, sondern auch um die Beziehungenzwischen Unternehmen oder um die Interaktionen zwischen Unternehmen und privatenHaushalten.Neben diesen beiden Teildisziplinen beschäftigt sich die Wirtschaftswissenschaft zudem mitder Wirtschaftsgeschichte und der Wirtschaftsgeographie. Diese beiden Bereiche sollen hierlediglich als Ergänzung der beiden obigen genannt werden.„Eine moderne Wirtschaft ist gekennzeichnet durch tiefe Arbeitsteilung, anonymeAustauschprozesse, lange Produktions(um)wege unter Beteiligung vieler Akteure, durchwachsende Interdependenzen und hohe Komplexität.“ (Homann & Blome-Drees, 1992,S. 21). Aus dieser Aussage lässt sich erkennen, dass das Gesamtsystem der Wirtschaft ausvielen Einzelleistungen besteht. Es finden unzählige Interaktionen zwischen Menschen oderUnternehmen statt. Um ein gemeinsames Resultat erzielen zu können, müssen alle einandervertrauen und sich aufeinander verlassen können. Da jedes Individuum durch seine eigeneHaltung, Wertvorstellungen und Normen geprägt ist, kann es schnell zu Differenzen zwischenden Akteuren kommen. Deshalb braucht ein komplexes System, wie es das Wirtschaftssystemdarstellt, eine Rahmenordnung, in der allgemeine Regeln für den Umgang festgelegt sindund an die sich alle Teilnehmer halten müssen.„Verfassung, Gesetze, also insbesondere das öffentliche Recht, das Privatrecht und das Strafrecht,ferner die speziellen Bereiche des Wirtschaftsrechts wie das Gesellschaftsrecht, dasArbeits- und Tarifrecht, das Wettbewerbsrecht, Mitbestimmungsregelungen und der gesamteKomplex der Unternehmensverfassung, ferner die Haftungsregeln, schließlich bestimmtemoralische und kulturelle Verhaltensstandards“ (Homann & Blome-Drees, 1992, S. 23) bildendie Rahmenordnung. Dadurch, dass sich alle Teilnehmer an dieser Ordnung bzw. diesenSpielregeln orientieren und diese einhalten sollen, wird die „Verläßlichkeit der wechselseitigenVerhaltenserwartungen sichergestellt“ (Homann & Blome-Drees, 1992, S. 23).Unter Berücksichtigung dieser Regeln verfolgen die Wirtschaftssubjekte ihre eigenen Zieleund führen somit ihre Spielzüge aus. Auf dem Markt befinden sie sich unter Wettbewerbsbedingungen.Jeder muss folglich versuchen, durch Wissensaneignung einen Vorsprung zuerreichen, um gegenüber den Konkurrenten einen Vorteil zu erzielen. Sie sollen daher nachGewinn streben, der wiederum als Eintrittssignal für andere potentielle Marktteilnehmerdient. Damit wird Innovation und Investition gefördert und es findet eine Steuerung derWirtschaft zum Gemeinwohl aller statt (vgl. zu diesem Absatz Homann, 2002, S. 40f.).„Die moderne Wirtschaft ist ein – mindestens – zweistufig ausdifferenziertes Handlungssystemmit Spielregeln und Spielzügen, in dem Moral und Effizienz paradigmatisch aufunterschiedlichen Ebenen und dadurch simultan abgearbeitet werden können: die Effizienz inden Spielzügen, die Moral in den Spielregeln.“ (Homann & Blome-Drees, 1992, S. 35). Nunkönnte man vermuten, dass ein individuelles moralisches Verhalten nicht mehr von Nöten ist,11
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>doch das ist nicht der Fall. Genau diese individuelle Moral, Motivation oder Vorstellung sindfür eine moderne Gesellschaft unverzichtbar. Sie werden für die Gestaltung der Rahmenordnung,der Regeln für wirtschaftliche Handlungen, benötigt und durch diese entfaltet (vgl.Homann & Blome-Drees, 1992, S. 39f.).In der Bundesrepublik Deutschland findet man die Soziale Marktwirtschaft vor. Diese stelltein Modell der marktwirtschaftlichen Ordnung dar, welche das Soziale mit demWirtschaftlichen verbindet (vgl. Hesse, 1992, S. 34). Der Staat hat hierbei die Aufgabe denOrdnungsrahmen zu gestalten. „Im Unterschied zu anderen Konzeptionen von Marktwirtschaftläßt sie ein ausgebautes System der sozialen Sicherung, Konjunktur- undStrukturpolitik und sogar Eingriffe in Marktprozesse (z. B. Subventionen) zu.“ (Homann &Blome-Drees, 1992, S. 54). Aus wirtschaftsethischer Sicht stellt die Soziale Marktwirtschaftdas beste bislang bekannte Mittel zur Realisierung gesellschaftlicher Solidarität dar, obwohlnicht alle Probleme durch diese gelöst werden und neue Probleme entstehen können (vgl.Suchanek, 2007, S. 90f.).Innerhalb des Wirtschaftssystems treffen viele Einzelpersonen oder Gruppierungenaufeinander; so treten Staat, Unternehmen und Bürger als Wirtschaftsakteure auf. Diegenannten Institutionen und Individuen stehen in unterschiedlichster Weise miteinander inVerbindung. Sie agieren alle gemeinsam auf dem Markt, welcher durch die Rahmenordnungbestimmt und durch Marktgesetze, wie bspw. Angebot und Nachfrage, dominiert wird.Wenn mehrere Individuen miteinander in Interaktion treten, können bei der Umsetzung derjeweiligen Nutzenmaximierung Probleme entstehen. Diese beruhen auf den gemeinsamenoder gegensätzlichen Interessen oder dem strategischen Verhalten der Akteure. Es kann zuKonflikten oder zu Kooperationsmöglichkeiten kommen.„Das Grundproblem der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil wird mit dem BegriffDilemmastruktur bezeichnet. Eine Dilemmastruktur charakterisiert die Situation, in derInteressenskonflikte die Realisierung gemeinsamer Interessen verhindern.“ (Homann &Suchanek, 2005, S. 31f.). 4Gründe hierfür sind die nachfolgenden Anreizbedingungen: „Zum einen kann der einzelneAkteur die Befürchtung haben, dass sein Beitrag zur Realisierung des gemeinsamen Interessesvon dem bzw. den anderen „ausgebeutet“ wird; zum anderen kann es – spiegelbildlich dazu –sein, dass er selbst einen Anreiz hat, den Beitrag eines oder mehrerer Interaktionspartner„auszubeuten“.“ (Homann & Suchanek, 2005, S. 32).Die Problemstruktur ist folgendermaßen konzipiert: Ein Individuum soll selbst bei gleicherInteressensverfolgung ein anderes Individuum ausbeuten, so lange es sich nicht sicher seinkann, dass sich der andere ebenfalls im Sinne des gemeinsamen Vorteils verhält. Betrachtetman diesen Sachverhalt aus Sicht der Ethik, dann liegt hier eher ein unmoralisches Handelnvor. Infolgedessen benötigt man die obig beschriebene Rahmenordnung, die Regeln für dieInteraktion aufstellt und gleichzeitig moralisches Handeln von den Individuen fordert, so dassman sich auf alle Beteiligten verlassen kann.Charakteristisch für die Ökonomik und ihre Forschungszwecke ist ebenso das fiktive„Menschenbild“ des Homo oeconomicus, welches durch Adam Smith geprägt wurde (vgl.4„In einer Dilemmastruktur verhindern Informations- und Anreizprobleme, dass Investitionen in dieZusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil vorgenommen werden.“ (Suchanek, 2007, S. 52 ohne Hervorhebungübernommen). So führt in diesen Situationen ein individuelles rationales Verhalten zu einem kollektivenschlechteren Ergebnis. Z. T. können solche Dilemmastrukturen durch Spielregeln, welche durch dieRahmenordnung festgelegt werden, gelöst werden. Typischerweise werden solche Dilemmasituationen, diehäufig aufgrund von Interessenskonflikten entstehen, mit Hilfe des „Gefangenendilemmas“, ein Modell aus derSpieltheorie, erläutert. Für weiterführende Informationen s. S. 52 – 62 in Suchanek (2007): Ökonomische Ethik.12
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Riefenthaler, 2008, S. 104). Menschenbilder versuchen bestimmte Verhaltensweisen vonMenschen zu erklären. Es handelt sich hier aber nicht um einen wirklich existierendenMenschen, sondern um ein Modell. „Es ist also ein rein rationales, emotionsfreies Bild desMenschen, reduziert auf sein wirtschaftliches Verhalten, das alleine der Theoriebildung, nichtder praktischen Alltagswelt dient.“ (Dietzfelbinger, 2000, S. 150). Die Grundannahmen desModells sind die Rationalität und der Eigennutzen des Individuums. Durch diesen Homooeconomicus ist es möglich, z. B. die Funktionsweise von Institutionen zu überprüfen oderbestimmte Dilemmasituationen zu lösen.2.4 Verhältnis von Ökonomik und Ethik – ein Widerspruch?In den drei vorangehenden Unterkapiteln wurden die Ethik und die Ökonomik jeweilsgetrennt betrachtet. Die nun folgenden Ausführungen thematisieren den Zusammenhangzwischen den beiden Disziplinen. Dazu bietet sich zuerst ein kurzer Rückblick auf dieEntstehungsgeschichte der <strong>Wirtschaftsethik</strong> an. Danach werden die unterschiedlichenSichtweisen zum Verhältnis dieser Wissenschaften erläutert.Die praktische Philosophie behandelte seit ihren Anfängen zu Zeiten von Aristoteles (384 –322 v. Chr.) ökonomische und ethische Fragen wie selbstverständlich zusammen. Auch AdamSmith, der Begründer der Ökonomik, hatte eine Professur für Moralphilosophie inne, somitsind hier die beiden Bereiche ebenfalls miteinander verbunden.Erst ab Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich zwei separate Disziplinen. DieTrennung geht größtenteils auf das geforderte Werturteilsfreiheitspostulat von Max Weber(1864 – 1920) zurück. Es kam zur Arbeitsteilung und dabei entstand zum einen diephilosophische Disziplin Ethik und zum anderen die Ökonomik als wissenschaftlicheDisziplin. Die Ethik beschäftigt sich folglich mit der Suche nach Begründungen fürmoralische Verhaltensnormen und liefert eine kritische Beurteilung dieser Normen.Ökonomik soll lediglich das Wirtschaftsgeschehen beschreiben und erklären sowie wahreAussagen über die Realität gewinnen und dabei vorherrschende Ziele und Werte als gegebenbetrachten. „Eine Vermischung von Tatsachen einerseits und Wertungen und Meinungenandererseits wird für den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt eher als hinderlichangesehen.“ (Noll, 2002, S. 33).Durch die Trennung kam es zwar zum Erkenntnisfortschritt, allerdings blieben viele praktischeProbleme ungelöst, da sie beiden Disziplinen zugehörig waren und es keine gemeinsameBetrachtung mehr gab. Daraufhin wurden die Forderungen nach einer <strong>Wirtschaftsethik</strong> großund eine neue Disziplin entstand (vgl. zu diesem Abschnitt Noll, 2002, S. 33f.).Aus diesem Abschnitt wird deutlich, dass man Fragen und Probleme immer aus einer ganzheitlichenPerspektive erfassen sollte. Nur im Rahmen einer <strong>Wirtschaftsethik</strong> könnenAntworten auf ethische und ökonomische Fragestellungen gegeben werden, die für dieMenschen nützlich und hilfreich sind. Eine getrennte Erörterung würde wahrscheinlich zufalschen Ergebnissen führen und wichtige Aspekte könnten vernachlässigt werden.„So gut wie alle sozialen Probleme der Welt, nationale und internationale, ökonomische undökologische, sozial-politische und unternehmenspolitische, werden von den Menschen auchals ethische Probleme wahrgenommen und können im Rahmen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> behandeltwerden.“ (Homann & Lütge, 2004, S. 9). Obwohl von manchen Autoren, wie Weber oderKersting, angeführt wird, dass diese Wissenschaften nicht zusammengehören, sehe ichpersönlich keinen Widerspruch zwischen den beiden Disziplinen Ethik und Ökonomik.13
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Weiter lassen sich drei unterschiedliche Ansichten bzw. Verhältnisse von Ethik undÖkonomik in der Literatur finden, welche nachfolgend kurz vorgestellt werden. Jedes Modellwird von unterschiedlichen Vertretern verfolgt und es gibt kein einheitliches Verständnis überdas Verhältnis der beiden Disziplinen bzw. über die <strong>Wirtschaftsethik</strong> 5 .Das erste Verhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ethik die wissenschaftlicheAusgangsdisziplin darstellt und darum ist es eine Ethik für die Wirtschaft (vgl. Göbel, 2006,S. 63). Da es sich dabei um eine angewandte Ethik handelt, werden folglich ethischePrinzipien auf bestimmte Lebens- und Handlungsbereiche übertragen und für den speziellenKontext, hier die Ökonomik, konkretisiert (vgl. Pieper, 2007, S. 92).Dieses Modell, auch als Anwendungsmodell bezeichnet, wird von vielen kritisiert. Siesprechen diesbezüglich von einem Unterdrückungsmodell. Die Ethik beanspruche einenPrimat gegenüber der Ökonomik und unterdrücke daher jene. Das ist jedoch nicht zutreffend,da die Ethik lediglich die Basis bildet und keinen autoritären Charakter besitzt. DenMenschen sollen Hilfestellungen gegeben werden, damit sie „gut“ und „richtig“ handelnkönnen. Hierbei sollen sie Prinzipien und allgemeine Vorstellungen von erstrebenswertenZuständen auf spezielle Situationen anwenden und somit verwirklichen (vgl. zu diesemAbsatz Göbel, 2006, S. 63f.).Das klassische Gegenteil hierzu bildet die zweite Variante. Nun ist die Ökonomik alsAusgangsbasis anzusehen. Außerdem geht es um die Theorie der Moral. Das Verhaltensmodellder Wirtschaft wird dabei auf andere Lebensbereiche bezogen. Hauptsächlich steht derWert des Gemeinwohls im Vordergrund, wobei dieser innerhalb der Ökonomik als reichlicheVersorgung mit Gütern zu verstehen ist (vgl. zu diesem Absatz Göbel, 2006, S. 65f.)Ein Leitsatz des Verhältnisses lautet: „Aus ökonomischer Sicht ist ein moralisches Verhaltennur dann zu erwarten, wenn es dem Akteur Vorteile verspricht, also seinen Nutzen steigert.Umgekehrt ist Moral zur Unwirksamkeit verdammt, wenn sie dem Akteur etwas kostet.“(Göbel, 2006, S. 66). Im Rahmen dieses Ansatzes findet man überwiegend dann ein ethischesVerhalten, wenn es um die Gestaltung der Rahmenordnung geht, in die moralische Wertemiteinbezogen werden.Nach der Beschreibung dieser „zwei Welten“ geht es beim dritten Ansatz um die Integrationvon Ethik und Ökonomik. Ulrich kritisiert die beiden obigen Modelle. Er will die beidenDisziplinen durch das Konzept der sozialökonomischen Rationalität vereinen. Auf dieseWeise sollen die reine ökonomische Rationalität und die außerökonomische Moralität überwundenwerden (vgl. zu diesem Absatz Göbel, 2006, S. 73).Die integrative <strong>Wirtschaftsethik</strong> umfasst zwei Grundaufgaben: „Ihren ersten grundlegendenReflexionsgegenstand erkennt sie in der Kritik der ökonomischen Rationalität im Sinne derreinen Ökonomik (1), ihren zweiten in der Klärung einer umfassenden, (diskurs-)ethischfundierten regulativen Idee ökonomischer Vernunft, die als sozialökonomische Rationalitätsideebezeichnet werden soll (2).“ (Ulrich, 2008, S. 125).„Dieser Zustand der radikalen Versöhnung von Ethik und Ökonomik kann als Ideal angestrebtwerden, aber mit Sicherheit ist er in der heutigen Realität nicht gegeben.“ (Göbel, 2006, S.75). So findet man eher die Form der angewandten Ethik vor.5Bereits in der Problemstellung (Kapitel 1.1) wurden verschiedene Ansätze bzw. Richtungen der<strong>Wirtschaftsethik</strong> genannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit findet keine Betrachtung der unterschiedlichenAusprägungen statt. An dieser Stelle soll lediglich ein Verweis auf die weiterführende Literatur erfolgen.Innerhalb der zahlreichen Ansätze seien hier drei Hauptvertreter exemplarisch genannt:Karl Homann & Franz Blome-Drees (1992): „Wirtschafts- und Unternehmensethik“,Peter Ulrich (2008): „Integrative <strong>Wirtschaftsethik</strong>“,Josef Wieland (1999): „Die Ethik der Governance“.14
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>2.5 Makro-, Meso- und Mikroebene, die drei Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>im Überblick„<strong>Wirtschaftsethik</strong> ist Anwendung der Ethik auf den Sachbereich Wirtschaft. <strong>Wirtschaftsethik</strong>hat zu tun mit den ethischen Fragen von guten und richtigen Handlungen und Haltungensowie sittlich erwünschten Zuständen im Subsystem Wirtschaft. Bei der Beantwortung dieserFragen müssen die Interpretationszonen zwischen der Ethik und anderen Disziplinen (insbesondereder Ökonomik) und zwischen der Wirtschaft und anderen Subsystemen (insbesonderePolitik und Recht) beachtet werden.“ (Göbel, 2006, S. 79).Die <strong>Wirtschaftsethik</strong> hat ein sehr großes Aufgabengebiet. In vielen Bereichen spielt sowohldie ethische als auch die ökonomische Komponente mit. Um eine bessere Übersicht zugewährleisten und eine Trennung unterschiedlicher Aufgaben zu erreichen, werden verschiedeneDimensionen gebildet. Deshalb findet man in der Literatur häufig eine Aufteilung in dreiEbenen, um so auf unterschiedliche Aspekte und Akteure spezieller eingehen zu können.Man unterscheidet hierbei: Makroebene: befasst sich mit der wirtschaftlichen Rahmenordnung und der Gesellschaft Mesoebene: beschäftigt sich mit Unternehmen und Institutionen im Allgemeinen Mikroebene: umfasst alle Individuen und damit WirtschaftsakteureBevor eine genauere Beschreibung der einzelnen Stufen erfolgt, soll die nachfolgende grafischeDarstellung einen ersten, groben Überblick über die genannten Ebenen bieten. Sowerden die diversen Bezeichnungen der einzelnen Stufen genannt. Weiter wird immer einBeispiel gegeben, welches als Fragestellung innerhalb des jeweiligen Bereiches auftretenkann. Die angegebenen Mittel stellen die Gestaltungsmöglichkeiten auf den einzelnen Ebenendar, die dazu dienen, den gesellschaftlichen Anforderungen, wie z. B. die nach einemmoralischen Handeln, gerecht zu werden. Zugleich soll der Zusammenhang der drei Ebenenverdeutlicht werden. Da dieser eine wichtige Rolle einnimmt, erfolgt eine anschließendeErläuterung.Makroebene:Wirtschafts- / OrdnungsethikBsp.: fairer Wettbewerb und gute MarktordnungMittel: Gesetze, gesellschaftliche Gebote und WerteMesoebene:UnternehmensethikBsp.: Unternehmen als moralischer AkteurMittel: Unternehmenskodex, eigenes Verhalten als VorbildMikroebene:Individual-/ Handlungs-/Verantwortungs-/ FührungsethikBsp.: moralische VorstellungenMittel: Leitbilder, eigeneÜberzeugungen und Wertvorstellungen/ErziehungAbbildung 4: Drei Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> in Anlehnung an Dietzfelbinger (2000, S. 108) undKunze (2008, S. 89)15
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Aus der Grafik wird deutlich, dass die Makroebene die beiden anderen Ebenen mit einschließt.Die genannten Mittel zur Realisierung eines moralischen Verhaltens und Handelns inder Wirtschaft, die in diesem Bereich angesiedelt sind, finden ebenfalls Geltung für die zweianderen Teilbereiche. Ebenso wird die Mikroebene von der Mesoebene umschlossen. Da dieMakroebene übergreifend das gesamte Wirtschaftssystem darstellt, ist sie der Ausgangspunktfür die folgende Beschreibung.Auf der obersten Ebene findet sie sich als die <strong>Wirtschaftsethik</strong> wieder, die in diesemZusammenhang auch als Ordnungsethik bezeichnet wird. Hinter diesem Begriff steckt dieRahmenordnung, und diese gilt als systematischer Ort der Moral in einer Marktwirtschaft(vgl. Homann & Blome-Drees, 1992, S. 20ff.). Auf der Systemebene werden Fragen zum„gerechten“ und „sozialen“ Wirtschaftssystem und Themen, wie z. B. internationalerUmweltschutz, Wirtschaftsordnungspolitik, Arbeitslosigkeit bis hin zur Globalisierung,behandelt (vgl. Dietzfelbinger, 2000, S. 107). Infolgedessen untersucht die <strong>Wirtschaftsethik</strong>die gesamtwirtschaftlichen Handlungen im Hinblick auf ihre moralischen Konsequenzen (vgl.Kreikebaum, 1996, S. 14).Die Gestaltungsmöglichkeiten auf dieser Ebene besitzt der Staat. Durch die Gesetzgebungkann er in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen und ein soziales Miteinander zwischen deneinzelnen Wirtschaftsakteuren bewirken, regeln und kontrollieren. Die Grundgesetze und vorallem die verschiedenen Wirtschaftsgesetze helfen, einen gewissen Handlungsrahmen zuschaffen, innerhalb dessen ein moralisches Handeln möglich wird. Dabei verfolgt die<strong>Wirtschaftsethik</strong> Ziele, wie z. B. faire Strukturen, Gemeinwohlinteressen, Nachhaltigkeit,soziale Gerechtigkeit, Umweltschonung, Vorbildfunktion der Wirtschaft und Wertevermittlung(vgl. Dietzfelbinger, 2000, S. 211).Weiter spielt der kulturelle Hintergrund beim Moralverhalten eine Rolle. So beeinflussen z. B.die gesellschaftlichen Erwartungen, die Traditionen und der historische Kontext dieMotivation zu moralischem Handeln (vgl. Zimmerli & Aßländer, 2005, S. 321). Es geltennicht nur Gesetze, sondern auch gesellschaftliche Gebote oder Verbote als Richtlinien.„Rahmenordnungen sind zumeist unvollständig und defizitär, so dass sich ein moralischerAkteur nicht immer auf die Rahmenbedingungen berufen kann.“ (Noll, 2002, S. 37). Daherexistieren immer wieder Freiräume und Freiheiten bei den Handelnden. An genau diesenStellen kann die Unternehmensethik eingreifen, die auf der Mesoebene angesiedelt ist.Hierbei befinden wir uns nicht mehr auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf Unternehmensebene.Somit wird nur ein Teilbereich bzw. ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaftund damit eine einzelne Institution mit ihren Wertvorstellungen, Leitbildern und Unternehmenskodizesbetrachtet.Das Aufgabenfeld ist hier ebenfalls groß: Es geht zum einen um innerbetriebliches Verhaltenund zum anderen um das Handeln über die Unternehmensgrenzen hinaus.„Unternehmensethik muss intern wie extern eingebracht werden. Intern heißt, […] die Kulturim Unternehmen so zu gestalten, dass Mitarbeitende wie Vorgesetze in einemkommunikativen Miteinander arbeiten, ohne dabei notwendige Hierarchien aufzulösen.Extern heißt, als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.“(Dietzfelbinger, 2000, S. 106). Folglich werden Ziele, wie z. B. Kollegialität, Stärkung desVerantwortungsgefühls und Gemeinschaftsbewusstsein, im Rahmen der Mesoebene verfolgt(vgl. Dietzfelbinger, 2000, S. 183).In den letzten Jahren wurde häufig kritisiert, dass es zu wenig ethisches Verhalten in denUnternehmen gibt. Einige Beispiele sollen deshalb der Verdeutlichung dienen: Es kam zuKorruption, Steuerhinterziehung, Massenentlassung und Umweltverschmutzung. Aus diesemGrunde veröffentlichen jetzt viele Unternehmen ihre Unternehmensleitbilder, die eineethische und moralische Prägung besitzen. Sie beinhalten die Zielvorstellungen und Um-16
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>setzungsstrategien, die sich aus der Unternehmenskultur ableiten lassen. „Eine bestimmteEthik oder Philosophie des Unternehmens (Unternehmenskultur, Corporate Identity) alsNetzwerkkultur gelebten Verhaltens muss für alle an einem Unternehmen Beteiligte geltenund von allen Beteiligten gestaltet werden.“ (Dietzfelbinger, 2000, S. 182f.). Aber nicht nurdie Gestaltung und Publizierung dieser Werte und Normen ist wichtig, auch die Umsetzungund Einhaltung ist von hoher Bedeutung für die Gemeinschaft. Daher kommen z. T.„WerteManagementSysteme“ in den Firmen zum Einsatz, „die darauf abstellen, die moralischeVerfassung eines Teams oder einer Organisation und deren Leitwerte zu definieren undin der täglichen Praxis mit Leben zu füllen.“ (Wieland, 2007, S. 75). Außerdem verleihensolche Systeme durch Selbstbeschreibung und Selbstbindung einem Unternehmen eineIdentität. Dadurch signalisieren sie möglichen Kooperationspartnern und potentiellen MitgliedernErwartungssicherheit in Bezug auf ihr Handeln und Verhalten (vgl. Wieland, 2007,S. 75).„Institutionen beeinflussen jedenfalls individuelles Handeln, indem sie einen Rahmen dermöglichen Werte und Zwecke vorbestimmen, bestimmte Mittel nahelegen und mit denHandlungen bestimmte Folgen verbinden. Sie tragen zur Komplexitätsbewältigung bei durcheine Vorselektion von Handlungsmöglichkeiten.“ (Göbel, 2006, S. 84). Außerdem spielen dieindividuellen Tugenden, Werte und Normen eines Individuums auf der Mikroebene(Individualethik) eine Rolle bezüglich des moralischen Verhaltens.Jeder Mensch wird durch seine Familie und sein soziales Umfeld erzogen, beeinflusst undgeprägt. Das Individuum entwickelt eigene Vorstellungen, Gedanken und Verhaltensweisen.Es entstehen dabei Gewohnheiten und Sitten, aufgrund derer Handlungsentscheidungen getroffenund Handlungen ausgeführt werden (Handlungsebene). „Neben diesen individuellenWerten und Handlungskriterien, die das Handeln eines einzelnen Menschen leiten, gibt esgesellschaftliche Werte, die sich als allgemeiner Erfahrungsschatz in einer Gemeinschaft alssinnvoll oder notwendig herausgestellt haben, um das Leben der Menschen untereinander zuregeln. Auch diese Werte, zu denen etwa die Gerechtigkeit, die Freiheit und die Würde desMenschen gehören, beeinflussen das individuelle Handeln des Menschen, oft auch dann,wenn sich das Individuum dessen gar nicht bewusst ist.“ (Dietzfelbinger, 2000, S. 114).Ein Individuum kann als Wirtschaftsakteur die unterschiedlichsten Rollen einnehmen; so istman Konsument, Produzent oder Investor (vgl. Göbel, 2006, S. 79). In jeder Funktion sindandere Werte und Normen wichtig. Unterschiedliche Vorschriften und persönliche Interessenmüssen berücksichtigt werden.Die Mikroebene wird ebenfalls als Führungsebene bezeichnet. Dies liegt daran, dass einIndividuum z. B. in einem Unternehmen eine leitende Position inne hat und damit eineGruppe von Menschen leitet und gleichzeitig eine Vorbildfunktion übernimmt (vgl.Dietzfelbinger, 2000, S. 128). Als Vorgesetzter oder Chef stellt man große Ansprüche anseine Mitarbeiter und beeinflusst durch Vorgaben oder Anreizsituation das Handeln derPersonen. In dieser Position sowie in jeder alltäglichen Situation, übernehmen die Individueneine Verantwortungsrolle, sei es gegenüber den Mitmenschen, der Umwelt oder sich selbst.Nach den ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Ebenen, soll der Blick noch einmalauf die Abbildung 4 zu Beginn dieses Unterkapitels gerichtet werden (siehe S. 15). In derMikroebene findet man alle Individuen mit ihren eigenen Haltungen, sowie ihrem Werte- undNormengefüge. Die einzelnen Personen bilden in einer größeren Gruppe eine Institution bzw.finden sich in dieser wieder. So wird deutlich, dass die Mesoebene aus genau diesen Einzelpersonenbesteht. Da unterschiedliche Einstellungen aufeinander treffen, ist es wichtig,Regeln bzw. Leitbilder in einem Unternehmen aufzustellen, um ein gemeinsames Zielverwirklichen zu können. Alle Institutionen und somit gleichwohl alle Individuen sind in der17
2. Grundlagen zum Verständnis des Konstrukts <strong>Wirtschaftsethik</strong>Makroebene vereint und bilden diese gemeinsam ab. Auf dieser obersten Stufe werden dieGrundregeln für das Zusammenleben und gemeinsame Wirtschaften gelegt.Individuen bilden und verändern Institutionen und alle gemeinsam stellen die Gesellschaftdar. Unternehmen formen und gestalten die Rahmenordnung, welche wiederum als Handlungsbeschränkungund Vorschrift für die Unternehmen gilt. Die Entscheidungen derEinzelnen im Rahmen der Mesoebene und der Mikroebene werden folglich dadurchbeeinflusst und es bilden sich Verhaltensmodelle und Tugenden aus. Die persönlich und gesellschaftlichgeprägten Individuen agieren dann wieder im Wirtschaftssystem alsteilnehmende Akteure. Damit schließt sich der Kreislauf dieser Ebenen. Ferner zeigt er denständigen Austausch zwischen den Disziplinen Wirtschaft und Ethik auf (vgl. Honecker,1993, S. 258).18
3. SCHULBUCH ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDDer Schulalltag wird an deutschen Schulen vorwiegend durch das Schulbuch geprägt. DieLehrkräfte orientieren sich neben dem Lehrplan sehr stark an den darin dargebotenenThemen. Sie gestalten vor allem dann häufig ihren Unterricht in Anlehnung an ein Schulbuch,wenn sie fachfremd unterrichten bzw. die Inhalte während ihrer Ausbildung nicht integriertwaren. Dies trifft speziell auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersuchtenFächerkombinationen zu, da die Lehrenden meist Politik, Geschichte oder Geographiestudierten und nicht die wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Gerade in diesemZusammenhang bietet sich das Schulbuch sehr gut als Untersuchungsgegenstand an, um demZiel der Diplomarbeit, insbesondere der Frage nach der Bedeutung der <strong>Wirtschaftsethik</strong> inwirtschaftskundlichen Schulbuchtexten, nachzukommen.Vor diesem Kontext werden die Funktionen des Schulbuchs aufgegriffen und erläutert und imAnschluss daran erfolgt die Beschreibung der Schulbuchzulassungsverfahren. Weiter wird einBlick auf bereits durchgeführte Forschungsarbeiten bzw. <strong>Schulbuchanalyse</strong>n zur Thematik<strong>Wirtschaftsethik</strong> geworfen.3.1 Funktionen des SchulbuchsStein lässt dem Schulbuch drei Funktionsbestimmungen zukommen, die in der nachfolgendenGrafik dargestellt werden sollen.SchulbuchInformatorium Paedagogicum Politicum- Bereitstellung vonkontroversen Textenund unterschiedlichenMaterialien- Anstöße zur Diskussiondargebotener Inhalte,Themen und Problemegeben- Mittel und Mittlersowohl für den Inhaltsalsauch für denBeziehungsaspektschulischen Lehrensund Lernens- pädagogisches Hilfsmittelzur Unterstützungund Entlastungder Lernprozesse- Schule, Curricula undsomit auch dasSchulbuch stehen unterstaatlicher Kontrolle- repräsentiert invielfach gefilterter,vorstrukturierter undkontrollierter Weise einSelbstbild derGesellschaftAbbildung 5: Das Schulbuch als Informatorium, Paedagogicum und Politicum (Quelle: eigeneDarstellung nach Stein, 2001, S. 841f.)Das Schulbuch ist somit ein mehrdimensionales Medium, welches aufgrund der Schulbuchzulassungsverfahrenin den einzelnen Bundesländern vom Staat überwacht wird. Esübernimmt die Informationsfunktion und bietet didaktisch aufbereitetes Material für Lehrerund Schüler an. Aktuelle Problemfelder und grundlegende Zusammenhänge werdendargestellt, welche sich z. B. im Rahmen des Wirtschaftssystems ergeben. Damit präsentiertes auch die gesellschaftliche und politische Lage. Gleichzeitig trägt es zur Unterstützung des19
3. Schulbuch als UntersuchungsgegenstandInformations- und Kommunikationsprozesses im Unterrichtsverlauf bei und entlastet dieLehrpersonen bei ihrer Tätigkeit.Im Unterricht kommen die unterschiedlichsten Medien, sei es das klassische Schulbuch, derFilm, die Präsentation usw., zum Einsatz. Der Lehrer muss eine Lernumgebung schaffen, inder es den Schülern möglich ist, sich Wissen anzueignen. Dementsprechend kommen auf dieLehrperson im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung vieleAufgaben zu, die zu bewältigen sind. Auch bei diesen genannten Arbeitsabläufen könnenSchulbücher, in der Funktion als Werkzeuge, dem Lehrer gewissermaßen unterstützenddienen und ihn dabei entlasten.So versteht man unter dem Begriff „Lehren“ eine Vielzahl von Handlungen und Tätigkeiten,die den Lernprozess gestalten. Hierzu zählen z. B. das in Gang setzen, Begleiten, Fördern undKontrollieren des Prozesses. Außerdem sollen weitere Aktionen dazu führen, dass Gelerntesbehalten, übertragen und angewandt wird. Die Aufgabe der Lehrperson besteht nun darin,Unterrichtsprinzipien gezielt anzuwenden und eine Entscheidung über den Einsatz von Unterrichtsmedien,wie das Schulbuch, zu treffen. (vgl. zu diesem Absatz Hacker 1977, S. 132f.).Wenn man den Anführungen Hackers (1980, S. 14ff.) folgt, werden dem Schulbuch die hieraufgelisteten sechs Lehrfunktionen zugesprochen.1. StrukturierungsfunktionWährend der Vorbereitung auf ein neues Schuljahr, muss der Lehrer neben seiner Unterrichtsvorbereitungferner eine langfristige Planung für das Schuljahr vornehmen. Hierbeiwerden Stoffverteilungspläne z. B. in Form von Wochen- und Jahresplänen erstellt, die alsStrukturierung des Ablaufs dienen; in diesem Zusammenhang können Schulbüchergenutzt werden. „Strukturierung in diesem Sinne bedeutet: Die Gesamtmenge an Lehrinhalteneines Faches aufzuteilen und die Teile in ein sinnvolles Nacheinander zu bringen.“(Hacker, 1980, S. 15). Daneben können Schulbücher helfen, Interpretationsmuster zumVerstehen des Faches zu liefern, indem sie grundlegende Strukturen aufdecken.2. RepräsentationsfunktionDie Darstellung von Sachverhalten und Gegenständen kann im Unterricht auf unterschiedlichsteWeise erfolgen, sie ist aber z. T. abhängig von der Beschaffenheit undVerfügbarkeit dieser Subjekte. Hacker unterscheidet drei Arten von Repräsentationen inSchulbüchern: realitätsnahe, sprachliche und didaktisierte. Erstere erfolgen durch aktuelleZeitungsartikel, Verträge, Grafiken, etc. Diese Art der Darstellung dient der Herstellungdes Wirklichkeitsbezugs und der Hervorhebung der hohen Bedeutung einer Thematik.Sprachliche Repräsentationen sind Beschreibungen von Gegenständen; sie werden nurdann eingesetzt, wenn keine Möglichkeit besteht, die Realität selbst zu greifen oder zu erfassen.Als letztes sei noch die didaktisierte Repräsentation erwähnt. Hierzu zählendidaktisch aufbereitete Spielarten, wie z. B. Rollenspiele oder Projekte. So kann die Lehrpersonauf diese Anregungen zurückgreifen und sie im Unterricht sinnvoll einsetzen.3. SteuerungsfunktionBei der Planung stellt die Lehrperson Überlegungen zum Unterrichtsablauf an. Sie könnenvon der Grobplanung bis zu detaillierten Einzelschritten reichen. Für die Umsetzungdieser Überlegungen trifft sie Entscheidungen über Steuerungsmöglichkeiten: „Impulse,Fragen, Aufforderungen, Arbeitsanweisungen bis hin zu Maßnahmen und Situationen, diegeeignet sind, den Fortgang des Unterrichts zu garantieren.“ (Hacker, 1980, S. 21). Inmanchen Schulbüchern finden sich bereits solche Aktionsformen bzw. komplettstrukturierte Unterrichtsentwürfe. Allerdings werden sie von den Lehrpersonen meist nurals Anregungsfunktion für die Stundengestaltung bzw. den -ablauf angesehen oder siewerden zur Stillarbeit bzw. Hausarbeit eingesetzt.20
3. Schulbuch als Untersuchungsgegenstand4. MotivierungsfunktionEin großes Problem im Schulalltag ist es, dass die Lehrperson die Schüler unterUmständen nicht genügend motivieren kann. Dies äußert sich bei den Lernenden z. B.durch mangelnde Lernbereitschaft oder Aufmerksamkeit. Das Schulbuch kann dieseAufgabe jedoch nicht gänzlich lösen. Dies ist keineswegs überraschend, da dieses eher aufdas rezeptive Lernen ausgelegt ist, welches z. T. gerade aufgrund dieser Eigenschaft zurLangeweile führt. Durch die äußerliche Gestaltung und das Wechselspiel von Bild undText soll eine erste Motivation erfolgen. Stärker zur Motivierung sollen die in den Schulbüchernpräsentierten Lernanreize, wie bspw. Impulse für Problemlösungen undProvokationen, beitragen. Dabei muss nicht immer das Buch direkt im Unterricht eingesetztwerden, es kann auch lediglich als „Ideenlieferant“ dienen und der Lehrer kann diedargebotenen Inhalte auf andere Weise darstellen und in die Lernumgebung einbetten.Z. B. bietet sich nicht immer die Textform an, sondern der präsentierte Schulbuchinhaltkann evtl. durch ein aufgezeichnetes Gespräch oder als Film besser integriert werden.5. Differenzierungsfunktion„Differenzierung vor allem innerhalb eines Klassenverbandes bedeutet zunächst: eineGruppe ähnlich leistungsfähiger Schüler zu bilden, um diesen angemessene Lehraufgabenzu stellen.“ (Hacker, 1980, S. 24). So sollen innerhalb einer Unterrichtssituation mehrereGruppen auf unterschiedlichem Niveau unterrichtet werden. Der Lehrer kann dieseschwierige Aufgabe nicht immer alleine bewerkstelligen. Er ist oftmals auf die Hilfe desSchulbuchs angewiesen. Z. T. gibt es Lehrbücher, die bereits Aufgaben mit unterschiedlichenAnforderungsniveaus präsentieren. Es gibt z. B. Basisaufgaben, die tendenziell füralle Schüler geeignet sind, und komplexe bzw. weiterführende Aufgaben für leistungsstärkereSchüler. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Differenzierung ebenso aufanderem Wege erfolgen. Dementsprechend arbeitet eine Gruppe mit direkter Begleitungdurch die Lehrperson, die andere verwendet Arbeitsblätter und die dritte Gruppe löstAufgaben im Schulbuch. Somit unterstützen Schulbücher den Lehrer, d. h. sie entlastenihn bei der Durchführung solcher Unterrichtsarrangements.6. Übungs- und KontrollfunktionNach der Darstellung der jeweiligen Lerninhalte ist es wichtig, dass sich das Wissen beiden Schülern einprägt und es mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft werden kann. Esbietet sich an, den Lernenden ein variables und motivierendes Übungsangebot zur Verfügungzu stellen. Hierbei erfolgt die Lösung der Aufgaben durch unterschiedlicheMethoden, es werden abwechselnde Arbeitsformen eingesetzt und die Aufgabenstrukturvariiert. Weiter bieten Schulbücher häufig Merkhilfen an: „Merksätze werden abgedruckt,Auflistungen von Begriffen gegeben, Randbemerkungen und Übersichten dargestellt, mitHilfe von Graphiken, Strukturen veranschaulicht.“ (Hacker, 1980, S. 26). Allerdings ist zubeachten, dass Merksätze idealerweise im Unterrichtsverlauf gemeinsam mit der Klasseentwickelt und nicht lediglich vom Lehrer vorgetragen werden sollten. Die Darstellungvon Lösungen in Schulbüchern ist immer noch kritisch zu sehen, auch wenn sie in diesemZusammenhang der Lernerfolgskontrolle dient. Vorgegebene Lösungen werden z. T. von„faulen“ oder leistungsschwächeren Schülern „ausgenutzt“, d. h. diese umgehen die fürden Wissensaufbau sehr wichtige Eigenleistung. Der sinnvolle Umgang mit solchenLösungshilfen muss mit den Lernenden zu diesem Zweck erst trainiert werden.Viele Schulbücher übernehmen die im Vorfeld genannten und kurz erläuterten Lehrfunktionen.Um diese in den Worten von Wiater auszudrücken, sei folgendes Zitat zurFunktion des Schulbuches angeführt: „Seiner Konzeption nach dient es als didaktischesMedium in Buchform zur Planung, Initiierung, Unterstützung und Evaluation schulischerInformations- und Kommunikationsprozesse (Lernprozesse).“ (2003, S. 12).21
3. Schulbuch als UntersuchungsgegenstandDa jede Lehrperson eine bestimmte Individualität aufweist, kommt den Schulbüchern jeweilseine andere Bedeutung zu. „Neben der Funktion als Vermittler von Inhalten, Methoden,Werten können sie als Arbeitsmittel oder Nachschlagewerk eingesetzt werden. Sie dienenwahlweise der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts.“ (Imhof,1993, S. 22). Sie können als pädagogisches Hilfsmittel bezeichnet und als Medien zurUnterstützung und Entlastung schulischer Informations- und Kommunikationsprozessedefiniert werden (vgl. Lenzen, 1985, Band 4, S. 584). Schulbücher dienen somit dem Lehrerals auch dem Schüler als Informationsmittel, indem sie Inhalte, Gegenstände undProblemstellungen didaktisch aufbereitet präsentieren. Der Lehrer kann dieses Mediumnutzen und sinnvoll in den Unterricht integrieren, so kann eine Unterstützung des Kommunikationsprozessesstattfinden.Um eine „gute“ Lernumgebung zu schaffen, muss sich die Lehrperson für ein Buch entscheiden,welches ihren individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen entspricht. Die „Aufgabeder Lehrkraft ist es, dasjenige Schulbuch auszuwählen, das aufgrund seiner Möglichkeitenund seiner Struktur die von ihm intendierten Lehrfunktionen am besten zu verwirklichenhilft.“ (Imhof, 1993, S. 22). Eine Vorauswahl wird von den Schulbuchzulassungsgremiengetroffen, die nur Schulbücher für den Unterricht genehmigen, die dem Kerncurriculumentsprechen. Dieses Verfahren wird im nachfolgenden Gliederungspunkt näher erläutert.3.2 Zulassungsverfahren für Schulbücher„Schulbücher werden gesteuert von den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer und sind vonden jeweiligen bildungspolitischen Interessen geprägt. Sie sind den Zulassungsbestimmungender Kultusministerien unterworfen und stehen im Spannungsfeld von Zulassungsbeschränkungund pädagogischer Freiheit.“ (Imhof, 1993, S. 24).Bevor ein Schulbuch im Unterricht zum Einsatz kommen darf, muss es von der zuständigenStelle als ein zulässiges Buch klassifiziert werden. Dieses Zulassungsverfahren ist vonBundesland zu Bundesland verschieden. Es sollen nun für die drei, für diese Arbeit ausgewähltenLänder, jeweils die Zulassungsvoraussetzungen genannt und die jeweiligenVorgehensweisen kurz erläutert werden.In Baden-Württemberg ist die Zulassung von Lehr- und Lernmitteln in § 35a des Schulgesetzes(SchG) geregelt. Laut Absatz 1 kann das Kultusministerium die Verwendung dieserUnterrichtsmittel, speziell den Einsatz von Schulbüchern, per Rechtsverordnung von seinerZulassung abhängig machen. Die Zulassung selbst kann wiederum durch eine andere Stelleübernommen werden, so ist das Landesinstitut für Schulentwicklung für diese Aufgabezuständig (vgl. SchbZulVO 6 , 2007, § 1 (2)).Um als geeignetes Schulbuch für den Unterricht zu gelten, müssen die Zulassungsvoraussetzungennach § 35a (2) SchG 7 erfüllt werden. Diese sind jedoch in der SchbZulVO in § 5 (1)feiner ausdifferenziert und erweitert; somit soll dieser Gesetzesauszug im Rahmen dervorliegenden Arbeit genutzt werden.(1) Zulassungsvoraussetzungen sind:1. Übereinstimmung mit den durch Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetzvorgegebenen Erziehungszielen;6 SchbZulVO = Schulbuchzulassungsverordnung von Baden-Württemberg.7 Der Gesetzestext kann auf der Homepage des Landesrechts für Baden-Württemberg eingesehen werden (siehehierzu den genannten Link im Literaturverzeichnis unter SchG (1983)).22
3. Schulbuch als Untersuchungsgegenstand2. Übereinstimmung mit den Zielen, Kompetenzen und Inhalten des jeweiligenBildungsstandards oder Lehrplans sowie angemessene didaktische Aufbereitung derStoffe;3. altersgemäße und dem Prinzip des Gender Mainstreaming Rechnung tragendeAufbereitung der Inhalte sowie Gestaltung der äußeren Form;4. Einbindung von Druckbild, graphischer Gestaltung und Ausstattung in die jeweiligedidaktische Zielsetzung;5. Orientierung an gesicherten Erkenntnissen der Fachwissenschaft.Im Jahre 2007 wurde das Zulassungsverfahren für Schulbücher vereinfacht 8 . So wird einGroßteil der Schulbücher durch die Verlage selbst geprüft und nicht mehr durch einenexternen Gutachter des landeseigenen Instituts. Hierzu hat das Landesinstitut für Schulentwicklungein Merkblatt für Schulbuchverlage herausgegeben. In diesem finden sich die obiggenannten Zulassungsvoraussetzungen. Sie sind sehr detailliert ausgearbeitet und jeweils mitLeitfragen ausgestattet 9 . Also haben die Schulbuchverlage die Möglichkeit, ihre Schulbücheran den gesamten Anforderungsbedingungen auszurichten und diese selbstständig zuüberprüfen. Die Verlage geben dann einen Zulassungsantrag ab und unterzeichnen eineVerpflichtungserklärung, die die Einhaltung aller Vorgaben bestätigt. Des Weiteren kann, wiein den vorherigen Jahren, ein normales Begutachtungsverfahren durchgeführt werden (vgl. zudiesem Absatz Landesinstitut für Schulentwicklung, 2007).Alle zulässigen Schulbücher werden jedes Jahr auf der Homepage des LandesbildungsserversBaden-Württembergs nach Schularten differenziert zur Verfügung gestellt. Dadurch existiertein öffentlicher Zugang zu den Schulbuchlisten.Auch in Niedersachsen besteht für Schulbücher eine Genehmigungspflicht. Diese wurde mitdem Erlass „Genehmigung, Einführung und Benutzung von Schulbüchern an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen“ des KultusministeriumsNiedersachsen am 07.07.2000 erneut festgeschrieben.So wird ein Schulbuch nur für den Unterrichtsgebrauch zugelassen, wenn es nachfolgendeVoraussetzungen erfüllt.Ein Schulbuch wird genehmigt, wenn sein Inhalt …… nicht gegen allgemeine Verfassungsgrundsätze oder sonstige Rechtsvorschriftenverstößt,… mit dem Bildungsauftrag der Schule gemäß § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzesübereinstimmt und… mit den Anforderungen der Rahmenrichtlinien inhaltlich, didaktisch und methodischvereinbar ist und den gesicherten Erkenntnissen der fachlichen und pädagogischenForschung entspricht.(Niedersächsischer Bildungsserver, 2009, S. 4)Das Genehmigungsverfahren wird durch einen Antrag des Verlages und die Übersendung derSchulbücher an das Niedersächsische Landesinstitut für Fortbildung und Weiterbildung im8 Dieses Verfahren ist allerdings nicht für alle Fächer möglich, für den Fächerverbund Geographie – Wirtschaft –Gemeinschaftskunde an allgemein bildenden Gymnasien erfolgt das normale Begutachtungsverfahren durcheinen zuständigen Prüfer des Instituts (vgl. SchbZulVO, 2007, § 4 (2) Nr. 6).9 Siehe hierzu S. 6-11 im Merkblatt für Schulbuchverlage des Landesinstituts für Schulentwicklung (2007).23
3. Schulbuch als UntersuchungsgegenstandSchulwesen und Medienpädagogik (NLI) 10 eingeleitet. Dieses prüft das jeweilige Buch undentscheidet über die Zulassung. Eine Bekanntmachung der zulässigen Schulbücher erfolgt imRahmen der Veröffentlichung des Schulbuchverzeichnisses über die Homepage desniedersächsischen Bildungsservers (vgl. zu diesem Absatz Niedersächsischer Bildungsserver,2009, S. 5).In Sachsen werden alle Schulbücher, bevor sie zum Einsatz kommen, von der Kultusbehördeim Laufe des Zulassungsverfahrens einer Bewertung unterzogen. Das SächsischeBildungsinstitut lässt danach die zweckmäßigen Schulbücher nach Antragsstellung desSchulbuchverlags zu. Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen,welche durch das Staatsministerium für Kultus festgelegt werden. Sie lauten nach § 4Schulbuchzulassungsverordnung (SchbZulVO) von Sachsen:(1) Zulassungsvoraussetzungen sind:1. Übereinstimmung mit den durch Grundgesetz, Verfassung des Freistaates Sachsenund Schulgesetz vorgegebenen Erziehungszielen;2. Übereinstimmung mit den Zielen und Inhalten des entsprechenden Lehrplanes sowieangemessene didaktische Aufbereitung der Stoffe;3. Altersgemäßheit bei der Aufbereitung der Inhalte sowie der sprachlichen Form;4. Angebot positiver Identifikationsmöglichkeiten sowohl für Mädchen als auch fürJungen;5. Einbindung von Druckbild, graphischer Gestaltung und Ausstattung in die jeweiligedidaktische Zielsetzung;6. Orientierung an gesicherten Erkenntnissen der Fachwissenschaft;7. Vereinbarkeit mit einer wirtschaftlichen Haushaltführung.Auch in § 60 des SchG werden bereits einige dieser Voraussetzungen im Rahmen derFestlegungen zur Zulassung von Lehr- und Lernmitteln 11 genannt, auf denen wiederum die imVorfeld angeführten Punkte basieren.Als Gutachter werden Lehrkräfte aller Schularten und Fächer eingesetzt. Sie prüfen die vonden Verlagen eingereichten Bücher z. B. auf Übereinstimmung mit den Zielen und Inhaltendes entsprechenden Lehrplans, auf Altersgemäßheit, auf sachliche Richtigkeit usw. DieZulassung wird dann im Amtsblatt des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus öffentlichbekanntgegeben (vgl. zu diesem Abschnitt Sächsisches Bildungsinstitut, 2009).So lässt sich abschließend festhalten, dass ein Schulbuch immer dann zugelassen wird, wennes den Grundgesetzen und Rahmenbedingungen entspricht. Des Weiteren muss es dem10 Hierzu möchte ich auf Grundlage des Niedersächsischen Landesamts für Lehrerbildung und Schulentwicklung(2004, S. 3) ergänzen, dass gemäß Beschluss der Landesregierung v. 20.01.04 das NiedersächsischeLandesinstitut für Schulentwicklung und Bildung (NLI) und das Niedersächsische Landesprüfungsamt fürLehrämter (NLPA) zum 31.01.04 aufgelöst worden sind. Zum 01.02.04 wurde das Niedersächsische Landesamtfür Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) geschaffen, das die wesentlichen Aufgaben der aufgelöstenBehörden übernimmt. Dies gilt auch für den Betrieb des Niedersächsischen Bildungsservers (NiBiS). Somitwerden meines Erachtens die Anträge an das neue NiLS gestellt und von diesem geprüft.11 Im Schulgesetz werden lediglich drei Prüfpunkte angeführt, der erste lautet: Übereinstimmung mit denRechtsvorschriften, weiter werden noch die obigen Punkte 2 und 7 benannt.24
3. Schulbuch als Untersuchungsgegenstandallgemeinen Bildungsauftrag der Bundesrepublik Deutschland gerecht werden sowie diejeweiligen länderspezifischen Ausprägungen berücksichtigen. Das bedeutet, dass in einemguten, zulassungsfähigen Schulbuch das Kerncurriculum sowohl inhaltlich, didaktisch undmethodisch, als auch altersgemäß und in Text und Bild, entsprechend gesicherterErkenntnisse der Fachwissenschaft aufbereitet sein sollte.3.3 <strong>Schulbuchanalyse</strong>n zur Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong>Viele Schüler werden mit den gleichen Schulbüchern konfrontiert, da diese ein Massenmediumdarstellen. Außerdem dienen Schulbücher in großem Umfang als Gestaltungsmitteldes Unterrichts. Deshalb ist es sinnvoll, <strong>Schulbuchanalyse</strong>n 12 durchzuführen, um die Inhalteder Bücher näher zu betrachten. Nur durch solche empirischen Untersuchungen ist es möglichherauszufinden, mit welchen Themen die Heranwachsenden konfrontiert werden und welcheBereiche stärker in die Bildung miteinbezogen werden sollten. Schulbücher sind zwar „diezum Leben erweckten Lehrpläne“ (Kuhn & Rathmayr, 1977, S. 9), aber trotz allem werdendie geforderten Inhalte dieser auf unterschiedlichste Weise umgesetzt oder es findet je nachAutor bzw. Verlag eine mehr oder weniger starke Priorisierung einzelner Themen statt.Auch aus diesem Grunde kommen <strong>Schulbuchanalyse</strong>n zum Einsatz, welche die Umsetzungund Unterschiede zwischen den einzelnen Büchern aufzeigen und Verbesserungspotentialezur Verfügung stellen sollen. Die vorliegende Arbeit möchte hierzu ebenfalls weitereErkenntnisse liefern, denn bislang wurden nur wenige Forschungsarbeiten bezüglich derThematik „<strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern“ durchgeführt. Diese werden hier kurzvorgestellt und ihre Ergebnisse präsentiert.Im Jahre 1995 führte Schnabel-Henke im Rahmen ihrer Dissertation an der UniversitätMannheim eine Analyse von Schulbuchtexten im kaufmännischen Bereich in Baden-Württemberg durch. Hierbei wurden die Fächer Allgemeine (Betriebs-)Wirtschaftslehre,Gemeinschaftskunde bzw. Geschichte und evangelische und katholische Religion analysiert.Folgende Kategorien wurden für die Untersuchung aufgegriffen: Bedürfnis und Nachfrage,Arbeit und Angebot, sowie Markt 13 . Als Nachfrager geht es darum, die eigenen Bedürfnissezu befriedigen (als Konsument); weiter kann das Individuum als Anbieter (z. B. von Arbeitsleistung)auf den Markt treten. Letztlich wurde auch das Zusammentreffen von Angebot undNachfrage auf dem Markt betrachtet. Dies sind drei „Hauptaspekte, unter denen (1) dieethisch relevante Dimension des Phänomens Wirtschaften aufgezeigt werden kann; gleichzeitig(2) sind diese Begriffe jedoch auch von der herrschenden, ethisch defizitärenWirtschaftstheorie belegt.“ (Schnabel-Henke, 1995, S. 117).Als Ergebnis führt Schnabel-Henke Defizite in den Schulbüchern auf, die speziell in derallgemeinen Wirtschaftslehre festgestellt wurden. Dieses Resultat kann jedoch nicht alsrepräsentativ für alle Schulbücher angesehen werden, da nicht alle im Unterricht zum Einsatzkommenden Bücher analysiert werden konnten. Allerdings ist Schnabel-Henke zuzustimmen,dass es zu Verbesserungen bzw. Innovationen sowohl in Schulbüchern als auch der ihnenzugrundeliegenden Lehrpläne kommen sollte, um den bestehenden Anforderungen in derWirtschaftsgesellschaft gerecht zu werden. So werden am Ende der Dissertation einige12 Die Schulbuchforschung kann auf verschiedenste Art und Weise ausgerichtet sein und liefert unterschiedlicheErgebnisse. Weinbrenner unterscheidet drei Typen von Schulbuchforschung: (1) die prozessorientierte, (2) dieproduktorientierte und (3) die wirkungsorientierte Schulbuchforschung (vgl. 1995, S. 22f.).13 Siehe hierzu die genauen Kategoriedefinitionen in der Dissertation von Schnabel-Henke (1995) auf den Seiten117 – 122, aufgrund derer dann ein weiterer Fragenkatalog zur Analyse erstellt wurde. Dieser befindet sich aufden Seiten 124 – 127.25
3. Schulbuch als UntersuchungsgegenstandGestaltungshinweise für zukünftige Bücher gegeben und die Autorin spricht nachfolgendeEmpfehlungen aus. Im Rahmen der Betrachtung des Konsumenten werden z. B. alle Bedürfnisseals naturgemäß angesehen, obwohl sie menschliche Willensäußerungen darstellen unddurch individuelle, soziale und ökologische Aspekte geprägt sind. Dies sollte in Zukunftverdeutlicht, der Willensbildungsprozess angeregt und Denkhorizonte eröffnet werden. ImBereich der Arbeit sollte mehr auf das soziale Miteinander und die Verantwortung sowohlgegenüber den Mitmenschen als auch der Natur eingegangen werden. Weiter sollte dieAufgabe des Marktes als Koordinator des Austauschprozesses und die herrschendenFreiheiten der einzelnen Wirtschaftsakteure aufgegriffen werden.2007 wurde ebenfalls an der Universität Mannheim eine Diplomarbeit von Lauer verfasst, umdie Thematik „<strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern zur Wirtschaftslehre“ zu untersuchen. In derAnalyse wurden lediglich Schulbücher des beruflichen Schulwesens von Baden-Württembergbetrachtet. Die Repräsentativität der Ergebnisse ist hier ebenso eingeschränkt, da nur jeweilsein Schulbuch einer Schulart betrachtet wurde. Um die Inhaltsanalyse durchführen zu können,wurden folgende fünf Kategorien 14 aufgestellt: Grundfragen der Ethik, Grundwerte – Werteund Wertordnungen, Wert- und Rollenkonflikte, wirtschaftsethische Positionen sowieHandlungsspielräume in der Marktwirtschaft.Das Resultat zeigt, dass die Kategorien meist nur in sehr geringem Umfang in denSchulbüchern behandelt werden. Zudem existieren deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenenSchularten. Die ethische Grundeinstellung, die in der ersten Kategorie untersuchtwurde, wird lediglich mäßig betrachtet oder es gibt überhaupt keine Textstellen dazu. DenGrundwerten und Bedürfnissen einer Gesellschaft wird dann wiederum eine stärkereAufmerksamkeit geschenkt und so finden sich diese in allen Büchern wieder. Danebenwerden Dilemmastrukturen aufgegriffen. Die wirtschaftsethischen Positionen werdenüberwiegend vernachlässigt. In der letzten Kategorie werden lediglich die Handlungsspielräumevon Institutionen und der Gesellschaft abgedeckt, jedoch nicht auf die desIndividuums eingegangen. Aufgrund dessen fordert Lauer nach mehr Handlungskompetenzund einer aktiven und prozessorientierten Lernumgebung, um die Probleme und Situationender Realität bewältigen zu können.Da es bisher nur sehr wenige empirische Untersuchungen zum Thema „<strong>Wirtschaftsethik</strong> inSchulbüchern“ gibt, soll diese Diplomarbeit einen weiteren Forschungsbeitrag leisten. DieAktualität dieses Themas und die herrschende Wirtschaftskrise fordern eine stärkere Ausrichtungdes wirtschaftlichen Handelns an ethischen Werten. So soll dieses Thema imRahmen des Schulunterrichts aufgegriffen werden, damit die Heranwachsenden imWirtschaftssystem moralisch handeln können und dies der Solidarität aller dient. Ob dieseThematik aufgegriffen wird und welche Bedeutung ihr zu kommt, wird in Kapitel 5ausführlich dargestellt.14 Eine ausführliche Beschreibung dieser Kategorien sowie mögliche Fragestellungen zur Analyse finden sichauf den Seiten 22 – 24 in Lauer (2007).26
4. WIRTSCHAFTSETHIK – EINE QUALITATIVE INHALTSANALYSEAUSGEWÄHLTER SCHULBÜCHERBevor mit der <strong>Schulbuchanalyse</strong> begonnen werden kann, muss zuerst das Untersuchungsdesigngenauer erläutert werden, wodurch das Verfahren von anderen wissenschaftlichTätigen und Interessierten nachvollzogen werden kann. Zudem wird eine Wiederholung derempirischen Untersuchung ermöglicht.Im Nachfolgenden wird somit die Vorgehensweise der Auswahl und die Bestimmung derSchulbücher (Grundgesamtheit) dargestellt, das Analyseinstrument ausgewählt und dessenAblauf beschrieben. Abschließend folgen die Kategorieentwicklung und die Erläuterung derdaraus resultierenden Untersuchungskategorien, welche die Ausgangsbasis für diese <strong>Schulbuchanalyse</strong>darstellen.4.1 Auswahl und Begründung der methodischen VorgehensweiseZentraler Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit ist die Untersuchung von Schulbüchern vonallgemein bildenden Gymnasien. Bei der Frage welche Bundesländer in die Analyse miteinbezogenwerden sollen, sind die folgenden Überlegungen zu nennen: Baden-Württembergwurde aus Gründen des Heimat- und Universitätsstandortes als erstes Land bestimmt. Ziel istes, jedoch nicht nur den südlichen Raum Deutschlands zu betrachten und angrenzende Länderauszuwählen, sondern auch einen Blick in den Norden zu werfen. Also wurde Niedersachsenzur Auswahl hinzugefügt. Nachdem es sich um zwei westliche Bundesländer handelt, wirdSachsen als drittes Land mit in die Untersuchung aufgenommen. Damit ist räumlich der OstenDeutschlands vertreten und gleichzeitig ein „neues“ Bundesland.Betrachtet man den aktuellen INSM - Bildungsmonitor 2009 15 , der die Bildungssysteme allerBundesländer der Republik anhand unterschiedlichster Kriterien untersucht, so lässt sicherkennen, dass es sich bei den ausgewählten Bundesländern um Länder handelt, die in denTop 5 der Gesamtbewertung platziert sind. Im Handlungsfeld für Schulqualität liegen Sachsenund Baden-Württemberg ebenfalls an der Spitze, Niedersachsen belegt nur Rang 13; hierbestehen also deutliche Unterschiede. Ob sich diese Differenzen ebenso im Bereich<strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern widerspiegeln, wird die spätere Analyse ergeben.In den drei ausgewählten Bundesländern hat sich bisher kein eigenständiges Schulfach fürWirtschaft bzw. Wirtschaftskunde in den allgemein bildenden Gymnasien etabliert. Für dieAnalyse werden somit Bücher ausgewählt, die im Unterricht in einer Fächerkombination mitWirtschaft eingesetzt werden. Diese lauten für die einzelnen Bundesländer: Baden-Württemberg: Geographie – Wirtschaft – Gemeinschaftskunde Niedersachsen: Politik, Wirtschaft (Gemeinschaftskunde) Sachsen: Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung / Wirtschaft15 Der Bildungsmonitor der INSM (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) gibt einen Überblick über die Lagedes Bildungswesens in den einzelnen Ländern und dessen Entwicklung. Das übergeordnete Ziel des Bildungssystemssoll sein, das wirtschaftliche Wachstum zu verbessern. So sollen Handlungsnotwendigkeiten undFortschritte festgestellt werden. Hierbei werden 13 bildungsökonomisch relevante Handlungsfelder betrachtet:Ausgabenpriorisierung, Inputeffizienz, Betreuungsbedingungen, Förderinfrastruktur, Internationalisierung, Zeiteffizienz,Schulqualität, Bildungsarmut, Integration, Berufliche Bildung / Arbeitsmarktorientierung,Akademisierung, MINT-Förderung, Forschungsorientierung.Für weitere detaillierte Informationen empfiehlt sich der Forschungsbericht dieser Studie: http://www.insmbildungsmonitor.de/files/downloads/Bildungsmonitor%202009_Forschungsbericht.<strong>pdf</strong>.27
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherWelche Schulstufe bzw. Altersklasse soll nun analysiert werden? In dieser Arbeit wird nur dieOberstufe, also die Sekundarstufe II, betrachtet. Dies lässt sich dadurch begründen, dass indiesem Bereich die Nähe zum Berufsleben größer und die Teilnahme am Wirtschaftslebenstärker wird. Gerade bei heranwachsenden Jugendlichen sollte das Thema „<strong>Wirtschaftsethik</strong>“einen wesentlichen Stellenwert im Unterricht einnehmen, damit ein Beitrag zur Erziehungmündiger Bürger geleistet werden kann. Zudem ist es wichtig, die ethischen Grundsätze unddie Rahmenordnung sowie die verschiedenen Interaktionsformen innerhalb desWirtschaftssystems zu verinnerlichen, um innerhalb des Systems angemessene Handlungsentscheidungentreffen und Handlungen ausführen zu können.Die genaue Auswahl und Beschreibung der Schulbücher wird in Punkt 4.2 näher betrachtet.An dieser Stelle soll noch die Entscheidung und Begründung für die qualitative Inhaltsanalysenach Mayring erfolgen.Prinzipiell lassen sich die quantitative und die qualitative Inhaltsanalyse unterscheiden. Dasgemeinsame Ziel beider Verfahren ist die Analyse von Material, das aus jeglicher Art vonKommunikation stammt. Zusammenfassend will die Inhaltsanalyse fixierte Kommunikationsystematisch analysieren, d. h. regelgeleitet und theoriegeleitet vorgehen. Dabei verfolgt siedas Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Kommunikationsaspekte zu ziehen (vgl. zu diesemAbsatz Mayring, 2008, S. 11f.).Der Unterschied besteht lediglich im Messniveau bzw. Skalenniveau. Qualitative Inhaltsanalysenverwenden die Nominalskala, wohingegen die quantitative auf ordinal-, intervalloderratio-skalierte Messverfahren zurückgreift (vgl. Mayring, 2008, S. 17). Die zweiVorgehensweisen schließen sich aber nicht gegenseitig aus. So kann bei einer qualitativenAnalyse z. B. durch Häufigkeitsmessung der Ausprägungen die quantitative Komponentemitspielen und umgekehrt.Die qualitative Inhaltsanalyse hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet und sichals bewährtes Instrument behauptet, infolgedessen hat sie auch Einzug bei <strong>Schulbuchanalyse</strong>ngehalten. Im Rahmen der Arbeit wird dieses Verfahren angewandt und die qualitativenErgebnisse werden durch quantitative Ergebnisse ergänzt.4.2 Bestimmung des UntersuchungsmaterialsZuerst wurden die Schulbuchlisten 16 mit den zugelassenen Schulbüchern für das allgemeineGymnasium der drei Bundesländer im Internet betrachtet. Auf Basis dieser Informationenwurde eine Tabelle erstellt, die alle Schulbücher für die obig genannten Fächerkombinationenbeinhaltet. Hierbei wurden lediglich die zulässigen Bücher für die Sekundarstufe II ausgewählt.Diese Übersichtsliste 17 mit 37 Schulbüchern enthält jeweils den Verlag, den Buchtitelund das „Einsatz-Bundesland“ bzw. die „Einsatz-Bundesländer“.Nach Überprüfung der Liste wurde festgestellt, dass kein Buch existiert, welches in allen dreiBundesländern zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es Bücher, die immer in zwei dieserBundesländer verwendet werden können. So fällt die Auswahl auf drei solcher Bücher, umsomit einen Überblick über länderübergreifende Themen zu erhalten. Da es hier keinebesondere Wahlmöglichkeit gab, wurde kein spezielles Verfahren angewandt.16 Auszüge aus den Schulbuchlisten siehe Anhang I.17 Siehe hierzu Anhang II.28
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherWeiter soll je ein bundeslandspezifisches Schulbuch analysiert werden, um möglicheDifferenzen herausfinden zu können. Hierzu wurde eine Auswahl nach dem Titelvorgenommen, so dass zumindest ein Bezug zum Fach „Wirtschaft“ erkennbar war. Deshalbwurden Bücher, die z. B. nur geographische Bezüge in der Überschrift erkennen ließen, imVorfeld bereits ausgeschlossen. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Schulbücheraus verschiedenen Verlagen stammen. Dadurch können auch hier evtl. Unterschiedeherausgefiltert werden.Zur Analyse vorgesehene Bücher:Buch Verlag Titel BW Nieders. SachsenA Buchner Buchners Kompendium Politik x xBCDEBuchnerDudenPaetecSchöninghSchöninghWirtschaft und Politik: Im Zeitalter derGlobalisierungDuden Wirtschaft - Recht x xPolitik im Wandel: Politische Institutionenund Prozesse in der Demokratie (KS I)Politik im Wandel: Wirtschaftswelt undStaatenwelt (KS II)F Cornelsen Politik und Wirtschaft xG Militzke Gesellschaft verstehen und handeln xxxxxFür Baden-Württemberg werden zwei bundeslandspezifische Schulbücher analysiert. Wiebereits eingangs erwähnt, handelt es sich jeweils um Bücher für nur eine Kursstufe. Um denVergleich mit Sachsens und Niedersachsens Oberstufe zu gewährleisten, werden auch hierbeide Jahrgänge und somit zwei Werke betrachtet.An dieser Stelle sollen die einzelnen Bücher nun kurz vorgestellt werden. Zur späteren vereinfachtenDarstellung der Ergebnisse, werden die Bücher jeweils durch die alphabetischeNummerierung unterschieden.Buch A – Buchners Kompendium Politik2008 wurde das Buch für die gymnasiale Oberstufe in seiner ersten Auflage im BuchnerVerlag gedruckt. Es kann sowohl in Baden-Württemberg und in Niedersachsen für den zeitgemäßenPolitik- und Wirtschaftsunterricht genutzt werden und ist bereits an das neue G8 18angepasst. Das Buch umfasst sechs Kapitel 19 , die jeweils nach dem gleichen Schemaaufgebaut sind. Zuerst werden die Basisinformationen ausführlich und verständlichdargestellt; danach folgen weitere vertiefende Materialien und spezifische Arbeitsaufträge.Durch die umfassende Darstellung kann dieses Buch als Arbeitsbuch und gleichzeitig alsNachschlagewerk auf dem Weg zum Abitur eingesetzt werden. Als Themen werden diemoderne Gesellschaft, die Wirtschaftspolitik, die politische Theorie und Staatsformen, daspolitische System, die Europäische Union und die internationale Politik behandelt.18 G8 = Gymnasium, das nach der Grundschule innerhalb acht Schuljahren zum Abitur führt. Das bisherigeAbitur wird als G9 bezeichnet.19 Das detaillierte Inhaltsverzeichnis dieses Schulbuchs ist im Anhang III-A ersichtlich.29
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherBuch B – Wirtschaft und Politik: Im Zeitalter der GlobalisierungDie erste Auflage dieses Schulbuchs wurde 2005 vom Buchner Verlag herausgegeben. Esgehört zur Reihe „Buchners Themen Politik“, welche speziell für die Oberstufe desGymnasiums in Baden-Württemberg und Sachsen konzipiert ist. Durch Schüler-, ProblemundMethodenorientierung sollen neue Akzente im Unterricht gesetzt werden. Das Buch ist inzehn Kapitel 20 untergliedert. Es enthält wirtschaftliche und politische Themen, wie z. B.Wirtschaftsordnungen, Konjunktur, Beschäftigungspolitik, Globalisierung der Weltwirtschaftund Umweltpolitik. Der „Materialteil“ bildet den Einstieg in das jeweilige Thema und dieserist immer unterschiedlich gestaltet. Danach folgen Arbeitsmaterialien (Texte, Gesetze, Bilder,Karikaturen, Grafiken und Statistiken), die zur selbstständigen Erarbeitung herangezogenwerden können. Anschließend gibt es z. T. Texte, die als Diskussionsgrundlage dienen.Ebenfalls sind Arbeitsfragen integriert, die zum tieferen Verständnis beitragen sollen. Zudemwollen angegebene Internetadressen zur eigenständigen Weiterarbeit und Vertiefung anregen.Weiter befinden sich noch ein Bereich des Methodentrainings und ein Teil mit Informationenund Zusammenhängen am Ende eines jeweiligen Kapitels.Buch C – Duden Wirtschaft – RechtDie erste Auflage dieses Schulbuchs erschien 2008 im Duden Paetec Verlag. Es kann sowohlin Niedersachsen als auch in Sachsen für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe genutztwerden und ist zum Abitur führend. Die vier Hauptkapitel 21 untergliedern sich in drei eherwirtschaftlich geprägte Themen (Grundlagen des Wirtschaftens sowie Wirtschaften imBetrieb, Volkswirtschaft und Internationalisierung) und in ein Kapitel zum Thema Recht. Im„Stoffteil“ wird das Grundwissen dargestellt, welches an Beispielen erläutert und untermauertwird. Im „Mosaikteil“ werden weiterführende Informationen präsentiert, und im Teil „summasummarum“ wird jeweils eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Zusammenhängeinnerhalb einem Kapitel dargeboten. Am Ende eines Kapitels befinden sich Aufgaben aufunterschiedlichen Niveaustufen. Ergänzt wird dieses Buch durch eine CD-ROM, die zusätzlicheInformationen, wie z. B. Biografien, Gesetzestexte, Animationen oder Videos, enthält.Die jeweiligen Einsatzstellen sind im Buch durch ein CD-Symbol am Rand gekennzeichnet.Buch D – Politik im Wandel: Politische Institutionen und Prozesse in der Demokratie2006 wurde die erste Auflage dieses Schulbuchs im Schöningh Verlag veröffentlicht. Es istsowohl in Klasse 12 (G9) als auch in Klasse 11 (G8) einsetzbar. In vier Kapiteln versucht esaktuelle Zukunftsaufgaben zu erfassen. Es sollen eine sorgfältige Analyse durchgeführt, dieDiskussion von Lösungsvarianten aufgegriffen und diverse Umsetzungsmöglichkeiten zudiesen Bereichen entwickelt werden. Dabei geht es um Themen wie Demokratie,Generationengerechtigkeit, soziale Grundsicherung und Bildung 22 . Fachliche Inhalte werdenauf den Seiten zum Basiswissen beschrieben, sogenannte Methodenseiten informieren überspezifische Arbeitsmethoden. Ergänzend finden sich multiperspektivisch angelegte Arbeitsmaterialien,die eine selbstständige Bearbeitung ermöglichen sollen und unterschiedlicheNiveaustufen ansprechen. Des Weiteren folgen noch Arbeitsanregungen und Trainingsseiten,die zur Wissensvertiefung am Ende eines jeweiligen Themas angeboten werden. Hiermit sollein Beitrag zur Erziehung der Schüler zu mündigen Staatsbürgern geleistet und diemethodischen Kompetenzen der Lernenden entwickelt und erweitert werden.20 Siehe hierzu das Inhaltsverzeichnis im Anhang III-B.21 Das Inhaltsverzeichnis befindet sich im Anhang III-C.22 Für eine detaillierte Inhaltsübersicht siehe Anhang III-D.30
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherBuch E – Politik im Wandel: Wirtschaftswelt und StaatenweltWie das vorangehende Buch ist dieses ebenso im Schöningh Verlag, jedoch erst 2007, inseiner ersten Auflage erschienen. Es ist für das 13-jährige Abitur als auch für das 12-jährigeAbitur jeweils in der Abschlussklasse einsetzbar. Das Schulbuch enthält vier Kapitel mit denwichtigsten Zukunftsaufgaben: Arbeit und Globalisierung, Zukunft der Staaten, Friedenssicherungund Wirtschaftskonflikte sowie Sicherheit und Frieden angesichts von Terrorismus,Kriegen und Migration 23 . Ziel soll sein, den methodischen Kompetenzerwerb der Schüler zuunterstützen. Nach der Darstellung des Basiswissens erfolgen Methodenseiten mitErläuterungen und Anwendungsmöglichkeiten. Zu jedem Themenfeld gibt es Arbeitsmaterialen,die zur selbstständigen Arbeit genutzt werden können, Arbeitsanregungen undTrainingsseiten unterstützen diesen Prozess.Buch F – Politik und WirtschaftDieses Buch wurde 2009 komplett neu konzipiert und ist im Cornelsen Verlag erschienen. Esist ein Arbeitsbuch für die gymnasiale Oberstufe des G8 (11 / 12) von Niedersachsen, das sicham Kerncurriculum für das Gymnasium Sekundarstufe II Politik-Wirtschaft orientiert.Sowohl der Einsatz im zweistündigen Ergänzungsfach als auch im vierstündigen Prüfungsfachist möglich, auf das unterschiedliche Anforderungsniveau wird entsprechend hingewiesen.Der Buchinhalt untergliedert sich in acht Kapitel 24 , die sich an aktuellen politischenund ökonomischen Themen orientieren. So wird z. B. der politische Willens- undEntscheidungsbildungsprozess, die Soziale Marktwirtschaft, die Sicherheits- und Friedenspolitikund die Globalisierung als Herausforderung thematisiert. Mit diesem Buch soll zurFörderung der Sach-, Analyse-, Methoden- und Urteilskompetenz der Schüler beigetragenwerden. Hierzu sind die Aufgaben direkt den Informationsmaterialien (Texte, Tabellen,Schaubilder) zugeordnet und es finden sich immer wieder methodische Abschnitte, wie z. B.zur Vorgehensweise einer Karikaturanalyse.Buch G – Gesellschaft verstehen und handeln2001 ist dieses Buch zum ersten Mal erschienen und wurde 2006 nachgedruckt (MilitzkeVerlag). Es ist für die Klassen 11 – 13 des Gymnasiums in Sachsen konzipiert. Vier Kapitel 25zum Schwerpunkt Gesellschaft finden sich hier wieder. Es wird die demokratischeGrundordnung, die Gesellschaft und die Wirtschaft im Wandel sowie Europa imSpannungsfeld internationaler Politik und Wirtschaft behandelt. Quellentexte mit Fragen undAufgabenstellungen im Anschluss sowie Projektvorschläge, Übungen, Tests undInternetadressen werden jeweils durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet.Definitionen werden durch einen Rahmen hervorgehoben. Weitere wichtige Begriffe, die kurzmit ihren Definitionen beschrieben werden, findet man im Glossar. Das Schulbuch möchtedabei helfen, politische Ereignisse und Probleme auf der Grundlage solider Sachkenntnisse zubeurteilen und zur eigenständigen Meinungsbildung beitragen.23 Für eine detaillierte Inhaltsübersicht siehe Anhang III-E.24 Zur detaillierten Gliederung siehe das Inhaltsverzeichnis im Anhang III-F.25 Das Inhaltsverzeichnis befindet sich im Anhang III-G.31
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Schulbücher4.3 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach MayringDie vorliegende Untersuchung orientiert sich in ihrer Vorgehensweise an Mayring. Deshalbsoll an dieser Stelle der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse zuerst grafisch dargestellt unddanach erläutert werden.Bestimmung des Ausgangsmaterials1. Festlegung des Materials2. Analyse der Entstehungsgeschichte3. Formale Charakteristika des MaterialsFragestellung der Analyse1. Richtung der Analyse2. Theoriegeleitete Differenzierung derFragestellungBestimmung der Analysetechnik undFestlegung des konkreten AblaufmodellsInterpretation der Ergebnisse in Richtungder HauptfragestellungAbbildung 6: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (Quelle: eigene Darstellung nachMayring S. 46ff.)Aus diesem Ablaufmodell sind die einzelnen Analyseschritte und deren Reihenfolgeersichtlich. „Eben darin besteht die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderenInterpretationsverfahren, daß die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, dievorher festgelegt werden. Dadurch wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektivüberprüfbar, dadurch wird sie übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wirdsie zur wissenschaftlichen Methode.“ (Mayring, 2008, S. 53). So bietet sie sich optimal fürdie hier durchzuführende Inhaltsanalyse an.Zuerst wird das Ausgangsmaterial bestimmt. Hierbei lassen sich drei aufeinanderfolgendeSchritte unterscheiden. Erstens wird das zu untersuchende Material festgelegt. In diesem Fallewurden sieben zulässige Schulbücher aus den Bundesländern Baden-Württemberg,Niedersachsen und Sachsen aus einer Grundgesamtheit von 37 Einheiten ausgewählt.Zweitens muss immer die Entstehungsgeschichte des zu untersuchenden Materials analysiertwerden. Hier handelt es sich um Schulbücher, die durch unterschiedliche Verlagsmitarbeiterverfasst wurden und entsprechend an das jeweilige Kerncurriculum angepasst sind, dabei32
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Schulbücherverfolgen und verwirklichen sie den Bildungsauftrag. Formal lässt sich das Material als festgeschriebeneSchulbuchtexte charakterisieren. Zu dieser ersten Stufe wurden bereits imvorherigen Kapitel 4.2 die benötigten Anführungen vorgenommen.In einem nächsten Schritt folgt die Fragestellung der Analyse, bei welcher die Richtungangegeben wird und eine theoriegeleitete Differenzierung erfolgt. Dieser Arbeit liegt diebereits in der Problemstellung formulierte Forschungsfrage zugrunde: Welche Bedeutungnimmt die Thematik „<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ in Schulbuchtexten des allgemeinen bildendenGymnasiums ein? Weiter kann man diese noch dadurch ergänzen: Welche Schwerpunktewerden behandelt und welche Ausprägungen liegen vor und wie tragen diese zur Erziehungder Schüler zu mündigen Bürgern bei? Somit sind das Ziel und die Richtung der Analyse,mittels Schulbuchtexten Aussagen zur Bedeutung der <strong>Wirtschaftsethik</strong> zu treffen und durchInterpretation der Ergebnisse dementsprechend nötige Verbesserungsvorschläge abzuleitenund zu entwickeln.Die sich anschließende Bestimmung der Analysetechnik und die Festlegung des konkretenAblaufmodells kann dem folgenden Schaubild entnommen werden:Bestimmungder AnalyseeinheitenFestlegungder EinschätzungsdimensionenFormulierungvonDefinitionenBestimmungder Ausprägungen(Skalenpunkte)Materialdurchlauf:Fundstellenbezeichnungu. -bearbeitungAbbildung 7: Ablaufmodell der skalierenden Strukturierung (in Anlehnung an Mayring, 2008,S. 93)Zur Analyse der Schulbuchtexte wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das aus fünf Hauptkategorienund jeweils drei Unterpunkten besteht. Die Entwicklung selbst wird in Kapitel 4.4näher erläutert und die entstandenen Kategorien in Kapitel 4.5 angeführt. Anhand dieser wirddas Untersuchungsmaterial überprüft und die qualitativen und quantitativen Ergebnissedanach tabellarisch präsentiert. Hierzu wird als Analyseverfahren die skalierendeStrukturierung eingesetzt. Ziel ist es dabei, das Material auf einer Skala einzuschätzen (vgl.Mayring, 2008, S. 92).Als Analyseeinheiten gelten alle im Schulbuch vorkommenden Texte und somit auch dieeinzelnen Worte. Um diese Textstellen entsprechend der Kategorien überprüfen und nach denAusführungen in Kapitel 2 einschätzen zu können, wurde eine Skala entwickelt. So wurdenAusprägungen bestimmt, in welchem Umfang der zu untersuchende Begriff oder Sachverhaltthematisiert wird. Die genauen Merkmalsausprägungen befinden sich zu Beginn desKapitels 5. Der Ablauf endet mit dem Materialdurchlauf. Hierbei werden die genauen Fundstellenbezeichnet und eine Einschätzung der Textstellen sowie eine Zuordnung zu deneinzelnen Ausprägungen vorgenommen. So erfasst die Inhaltsanalyse alles, was tatsächlich„dasteht“, d. h. alles, was in Wort und Text aufgeführt ist. Weiter werden daneben Umschreibungenund eindeutige Hinweise auf die gemeinte Bedeutung als auszuwertende Textstellenbegriffen (vgl. Früh, 2007, S. 52).Abschließend erfolgt die Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung.Hierzu werden nach der detaillierten Ergebnisdarstellung in Kapitel 5.1 die Ergebnisse inKapitel 5.2 zusammengefasst. Dabei wird die Interpretation der Untersuchungsergebnissevorgenommen bzw. weitere Aussagen dazu getroffen.33
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Schulbücher4.4 Beschreibung der Kategorienentwicklung„Das Kategoriensystem ist zentraler Punkt in quantitativer Inhaltsanalyse. Aber auch in derqualitativen Inhaltsanalyse soll versucht werden, die Ziele der Analyse in Kategorien zukonkretisieren.“ (Mayring, 2008, S. 43). So liegt dieser Arbeit ebenfalls ein Kategoriensystemzugrunde, und es stellt das zentrale Instrument der Analyse dar. Dadurch wird die Analyse fürandere nachvollziehbar, d. h. die Intersubjektivität des Vorgehens ist gegeben (vgl. Mayring,2008, S. 43).Generell lassen sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zur Kategorieentwicklung unterscheiden.Zum einen gibt es das deduktive Verfahren, das sich an theoretischen Überlegungenorientiert. „Aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickeltenTheorien oder Theoriekonzepten werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozeßauf das Material hin entwickelt.“ (Mayring, 2008, S. 74f.).Zum anderen kann ein induktives Verfahren zum Einsatz kommen. Hierbei werden dieKategorien direkt aus dem Material abgeleitet, in dem ein Verallgemeinerungsprozess durchgeführtwird, ohne sich dabei auf bestehende Theoriekonzepte zu stützen (vgl. Mayring, 2008,S. 75).Um die für diese Arbeit zugrundeliegenden Kategorien zu entwickeln, kam die Kombinationbeider Verfahren zum Einsatz, da beide gewisse Vorteile mit sich bringen. Auch Früh ist füreine Kombination aus deduktiver (Prototyp für „quantitative“ Inhaltsanalysen) und induktiverVorgehensweise (Prototyp für „qualitative“ Inhaltsanalysen) (vgl. Früh 2007, S. 74). Er istfest davon überzeugt, „dass nur eine sinnvolle, die jeweiligen methodischen Stärken nutzendeVerbindung beider Sichtweisen und Strategien zu einer validen und ertragreichen Methodenentwicklungbei der Inhaltsanalyse führen kann.“ (Früh, 2007, S. 74).Die ersten vier Kategorien wurden deduktiv ermittelt. Auf Basis der in Kapitel 2beschriebenen ethischen und ökonomischen Grundlagen wurden die Hauptkategorien abgeleitet.Weiter wurden entsprechende Unterpunkte entwickelt, die diese näher bestimmen undverdeutlichen. Danach erfolgte ein Abgleich der entstandenen Kategorien mit den Untersuchungseinheiten.Dabei wurden bereits bei manchen Schulbüchern keine inhaltlichenÜbereinstimmungen zu einzelnen Prüfpunkten festgestellt. Trotzdem wurden diese Punktebeibehalten, um gerade diese Defizite später aufzeigen zu können. Eine Anpassung würde nurdie Ist-Zustände präsentieren und die Soll-Zustände bzw. die daraus entstehenden wichtigenUnterschiede vernachlässigen.Die fünfte und letzte Kategorie wurde anhand der induktiven Vorgehensweise erstellt. Diesbegründet sich damit, dass in Kapitel 2 lediglich allgemeine Grundlagen zur Thematik <strong>Wirtschaftsethik</strong>enthalten sind und dort nicht auf aktuelle Themen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>eingegangen wird. Um nun die Aktualität erfassen zu können, wurde die Hälfte der zu untersuchendenSchulbücher auf aktuelle Problem- und Beschäftigungsfelder hin untersucht undweitere drei Unterpunkte mit aufgenommen.4.5 Kategorien zur Analyse der Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> inSchulbüchernNun werden die einzelnen Hauptkategorien mit ihren Unterpunkten vorgestellt und erläutert.Es werden hiermit die zur Analyse benötigten Fragestellungen und Prüfkriterien festgelegt.34
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherKategorie 1: Ethische Grundlagen1. Werte, Wertvorstellungen und Normen2. Moral und Ethik3. Gesellschaftlicher (Werte-) WandelIn der ersten Kategorie werden die ethischen Grundlagen überprüft, da sie die Basis bzw. dasGrundverständnis für die <strong>Wirtschaftsethik</strong> bilden. So stellt sich als erstes die Frage, inwieweitWerte und Normen genannt und definiert werden. Werden verschiedene Wertvorstellungendargestellt und erläutert? Im nächsten Punkt geht es darum, ob die Begriffe Moral und Ethikzu finden sind und ob eine Beschreibung dieser erfolgt. Wie entsteht die Moral einer Gesellschaftund welchen Einfluss hat diese auf die Individuen? Im letzten Prüfungspunkt soll derWandel der Gesellschaft bezüglich ihrer Werte analysiert werden. Gibt es Textstellen, die voneinem Wertewandel sprechen oder Begründungen liefern, warum es zu einem Wandel kamoder kommen kann?Kategorie 2: Ökonomische Grundlagen1. Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftsakteure2. Ökonomische Prinzipien und Nutzenmaximierung3. Homo oeconomicus und DilemmastrukturenDie zweite Kategorie deckt die ökonomische Komponente der <strong>Wirtschaftsethik</strong> ab. So geht esim ersten Punkt darum, das Wirtschaftssystem mit seiner Rahmenordnung und seinen Wirtschaftsakteurenzu betrachten. Liefern die Schulbücher eine Definition der SozialenMarktwirtschaft und erläutern sie andere Modelle (z. B. Freie Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft)?Welche Akteure werden genannt und wird deren Verhältnis bzw.Verhalten untereinander thematisiert? Zweitens wird geprüft, ob die ökonomischenPrinzipien, also das Minimal- und Maximalprinzip, inhaltlich berücksichtigt wurden. Diesetragen zum Verständnis der Nutzenmaximierung bei und stellen deren Umsetzungsvariantendar. In diesem Zusammenhang sollte auch eine Definition des Nutzenbegriffs zu finden seinund die grundsätzliche Zielstellung der Maximierung begründet werden. Im letzten und damitdritten Punkt werden das „Menschenbild“ und diverse Dilemmastrukturen aufgegriffen. Wirdder Begriff Homo oeconomicus verwendet und definiert? Werden Dilemmastrukturen, wiez. B. das Gefangenendilemma, erläutert und mögliche Lösungsvarianten diskutiert?Kategorie 3: Verhältnis von Ethik und Ökonomik1. <strong>Wirtschaftsethik</strong>2. Vertreter und verschiedene Ansätze3. SpannungsverhältnisDie dritte Kategorie thematisiert das Verhältnis zwischen Ethik und Ökonomik und somit dieDisziplin <strong>Wirtschaftsethik</strong>. Die ersten Fragen lauten: Fällt der Begriff <strong>Wirtschaftsethik</strong>? Wird35
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Schulbücherdieser definiert und erläutert? Weshalb ist die <strong>Wirtschaftsethik</strong> in einem Wirtschaftssystemwichtig? Danach wird überprüft, ob Vertreter, wie z. B. Adam Smith, genannt oderverschiedene Ansätze, wie bspw. die integrative <strong>Wirtschaftsethik</strong>, erwähnt werden. Zuletztsoll noch das Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaft und Ethik analysiert werden. Gibt esTextstellen, die auf Situationen hinweisen, in denen ethisches und ökonomisches Verhaltennicht immer miteinander vereinbar sind?Kategorie 4: Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>1. Makroebene: Rahmenordnung, Wirtschaftsgesetze2. Mesoebene: Unternehmensethik, Leitbilder3. Mikroebene: Individuum als WirtschaftsakteurInnerhalb der Kategorie vier werden die einzelnen Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> überprüft. Alserstes wird die Makroebene untersucht. Wird die Rahmenordnung genannt und ihr Sinn undZweck erklärt? Werden verschiedene Gesetze erwähnt, Auszüge daraus präsentiert und ihreAuswirkungen erläutert? Zweitens soll auf die Mesoebene geschaut werden. Hierbei wirdnach der Definition und Begründung der Unternehmensethik gesucht. Werden Unternehmensleitbildervorgestellt und ethische Komponenten herausgearbeitet? Als drittes geht esdarum, das Individuum als Wirtschaftsakteur in seinen unterschiedlichen Rollen zu betrachten.So kann eine Person als Konsument, Produzent, Arbeiter oder Sparer agieren. Werdendiese Rollen aufgezeigt und ihr Einfluss auf das Wirtschaftssystem erläutert und diskutiert?Kategorie 5: Aktuelle Problem- bzw.Beschäftigungsfelder der <strong>Wirtschaftsethik</strong>1. Globalisierung und Weltwirtschaftsordnung2. Nachhaltigkeit und Umweltschutz3. Wirtschaftskrisen und WirtschaftskriminalitätDie letzte und somit fünfte Kategorie untersucht die aktuelle Situation und den Stellenwertder <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der Gesellschaft. Es stellen sich Fragen, ob Themen, wie die Globalisierungund die Weltwirtschaftsordnung, behandelt werden. Werden Definitionen gegeben,Folgen genannt und Handlungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Rahmenordnungaufgezeigt? Findet man Textstellen zur Nachhaltigkeit? Wird der Umgang mit den begrenztenRessourcen beschrieben und diskutiert? Ist der Umweltschutz ein Thema und werdenMöglichkeiten genannt, wie man mit der Umwelt angemessen umgehen soll? Der letzte Punktgreift die aktuelle wirtschaftliche Situation auf. Werden Wirtschaftskrisen behandelt, ihreGründe und Auswirkungen genannt und diskutiert? Wird die Wirtschaftskriminalität mit ihrenUrsachen beschrieben, werden Gegenmaßnahmen genannt oder entwickelt?Bevor nun die Ergebnisdarstellung im nächsten Kapitel erfolgt, soll an dieser Stelle noch aufdie nötigen Gütekriterien eingegangen werden. Wissenschaft lässt sich nämlich nicht alleinean den Ergebnissen messen, sondern Wissenschaftlichkeit erfordert, „den Weg zur Erkenntnisin allen Schritten offen zu legen.“ (Klammer, 2005, S. 61). Für diesen Erkenntnisweg könnenQualitätsmaßstäbe, in Form von Gütekriterien, angegeben werden (vgl. Klammer, 2005,36
4. <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter SchulbücherS. 62). Damit die in dieser Arbeit durchzuführende Analyse den wissenschaftlichenAnsprüchen gerecht wird, muss sie die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität undValidität erfüllen (vgl. Früh, 2007, S. 40 und Mayring, 2008, S. 109).Im Zusammenhang mit der Objektivität soll die Methode vom analysierenden Subjektgetrennt werden, „d. h. die Ergebnisse müssen intersubjektiv nachvollziehbar und damit auchreproduzierbar, kommunizierbar und kritisierbar sein.“ (Früh, 2007, S. 40). Um diesem erstenGütekriterium zu entsprechen, wurden in diesem vierten Kapitel die Untersuchungseinheiten,das genaue Analyseverfahren mit seinem Ablauf, sowie die Kategorieentwicklung ausführlichbeschrieben. Ebenso genügt die folgende Ergebnisdarstellung diesem Kriterium, auf welchesspäter noch einmal Bezug genommen wird.Die Reliabilität, oder als „Zuverlässigkeit“ bezeichnet, stellt ein Ausmaß dar, welches dasMessinstrument hinsichtlich seiner Messzuverlässigkeit beurteilt. Liefert ein Messinstrument,in diesem Falle das Kategoriensystem, bei der wiederholten Messung eines gleichen Objektsimmer die gleichen Werte, so ist es zuverlässig (vgl. Schnell, Hill & Esser, 2005, S. 151). Indieser Arbeit wurde das Kategoriensystem ausführlich erläutert sowie die Haupt- und Unterkategorienanhand von weiterführenden Fragen näher definiert. Somit kann ein andererForschungsinteressierter diese Kategorien einsetzen und müsste dementsprechend zu dengleichen Ergebnissen kommen.Die Validität beschäftigt sich damit, inwieweit die Kategorien das Merkmal messen, dasdurch die Untersuchung gemessen werden soll (vgl. Bortz, 2005, S. 8). Diese Arbeit möchtedie Bedeutung der <strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbuchtexten an allgemein bildenden Schulenerfassen. In diesem Kontext ist es wichtig zu erfahren, in welchem Umfang die einzelnenTeilaspekte in den Schulbüchern berücksichtigt werden. Durch die genaue Kategoriendefinitionist dieses Merkmal ebenfalls zu erkennen und dadurch erfüllt. Die zur Sicherungempfohlene Wiederholung des Instruments, d. h. die mehrmalige Verwendung des gleichenKategoriensystems für unterschiedliche Untersuchungsobjekte in mehreren Studien, konnteim Rahmen dieser Diplomarbeit nicht durchgeführt werden.37
5. ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSEAnhand des vorangehenden Kategoriensystems soll nun die Analyse der Schulbüchererfolgen. Dabei werden die einzelnen Textstellen den nachfolgend genannten Ausprägungenzugeordnet. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in diesem Kapitel in ihrenEinzelheiten dargestellt und die jeweiligen Kategorien ausgewertet. Ebenfalls werdenquantitative Aspekte miteinbezogen, so dass auch eine Häufigkeitsanalyse erfolgen kann.Abschließend findet die Interpretation dieser Resultate statt.5.1 Bedeutung von <strong>Wirtschaftsethik</strong> in Schulbüchern der Bundesländer:Baden-Württemberg, Niedersachsen und SachsenIm Vorfeld der Ergebnispräsentation, erfolgt eine Beschreibung der verschiedenen Merkmalsausprägungen.Dies ist im Zusammenhang mit der skalierenden Strukturierung, einer Formder qualitativen Inhaltsanalyse, notwendig. Außerdem dient diese Beschreibung der Sicherungder Nachvollziehbarkeit. Im Rahmen der Arbeit werden nachfolgende Ausprägungen verwendet,um die einzelnen Textstellen auf einer Skala einordnen zu können.Merkmalsausprägungen: keine Angabe: Der Begriff oder Sachverhalt kommt nicht im Schulbuchtext vor. Nennung: Der Begriff oder Sachverhalt wird lediglich erwähnt. Definition: Der Begriff oder Sachverhalt wird genannt und es erfolgt eine kurzeBeschreibung. Erläuterung: Der Begriff oder Sachverhalt wird definiert und ausführlich erklärt,Beispiele und Zusammenhänge werden genannt oder aufgezeigt. Begründung: Der Begriff oder Sachverhalt wird fundiert dargestellt und Gründe für seineExistenz angeführt. Diskussion: Der Begriff oder Sachverhalt wird mit anderen Gegebenheiten verglichen,unterschiedliche Positionen gegenübergestellt bzw. Aspekte und Meinungen angeführt.Somit lässt sich leicht erkennen, in welchem Umfang ein Begriff oder Sachverhaltthematisiert wird und in welchem Maße der <strong>Wirtschaftsethik</strong> Bedeutung geschenkt wird.Die sieben Schulbücher wurden bezüglich der einzelnen Kategorien überprüft und die Ergebnissetabellarisch festgehalten. Zuerst erfolgt dabei immer die Nennung der Kategorie, danachwird in der ersten Spalte das zu untersuchende Buch und in der zweiten Spalte dieAusprägung eingetragen. In der dritten Spalte wird eine kurze Ergänzung gegeben, um den zuuntersuchenden Begriff zu nennen bzw. zu beschreiben. Dies dient der Erhöhung der Aussagekraft.Über die Basisanforderungen hinausgehende Fundstellen werden ebenfalls in derTabelle erfasst und in Kursivschrift sowie durch den fett markierten Buchstaben desjeweiligen Buches hervorgehoben. In den letzten sechs Spalten wird zur besseren Anschaulichkeitund Übersichtlichkeit der Ergebnisse jeweils ein Kreuz für die auftretendeAusprägung gesetzt. Eine abschließende quantitative Auswertung ist daher innerhalb derzusammenfassenden Ergebnisse möglich.In der tabellarischen Übersicht erfolgt keine Angabe direkter Textstellen. Die Fundstellenwerden jedoch alle im Anhang IV (siehe S. 95ff.) mit genauer Seitenzahl und in ent-38
5. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalysesprechendem Umfang wörtlich wiedergegeben. So kann eine Überprüfung der Zuordnung zuden jeweiligen Ausprägungen erfolgen, auch dadurch ist die Intersubjektivität gegeben.Kategorie 1: Ethische GrundlagenBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterung1. Werte, Wertvorstellungen und NormenA Erläuterung von Werten (allgemein undGemeinwohl)xA Nennung von Grundwerten der EU xA Erläuterung diverser Wertvorstellungen xA Erläuterung von Normen (allgemein) xA Erläuterung des Rechtssystems xB Definition von Werten (Unternehmenswerte)B keine Angabe von Wertvorstellungen xB Definition von Normen, Rechten undRegelnC Definition von Werten (wie z. B.Sicherheit, Gerechtigkeit)xC Nennung des Begriffs Wertvorstellungen xC Nennung des sozialen Wertesystems xC Erläuterung von Normen (Regeln,Rechtsnormen)xD Nennung von Werten und Grundwerten(Parteien)xD Nennung des Begriffs Wertvorstellungen xD Definition von Norm, (Spiel-)Regeln undGesetzenxE Nennung des Begriffs globale Werte xE Nennung des Begriffs Wertorientierungen xE Nennung von Normen (Rechtsnorm) undSpielregelnxF Erläuterung der Grundwerte / Werturteile xF Definition der Wertorientierung xF Nennung des Begriffs Wertvorstellungen xF Definition von Gemeinwohl & Spielregeln& RechtsnormxG Erläuterung von Werten xG keine Angabe des Begriffs Wertvorstellungen xG Erläuterung von Normen xG Erläuterung von sozialen Normen xxxBegründungDiskussion39
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibung2. Moral und EthikA Nennung des Begriffs Moralvorstellungen xA Erläuterung von Gruppen xA Definition der EU als Wertegemeinschaft xA Nennung des Begriffs ethische Aspekte xB Nennung des Begriffs Moral xB Erläuterung Ethik (Ordnungs-, Unternehmens-,<strong>Wirtschaftsethik</strong>)C keine Angabe des Begriffs Moral xC keine Angabe des Begriffs Ethik xC Definition Recht als kulturelle Identität xD keine Angabe des Begriffs Moral xD keine Angabe des Begriffs Ethik xE keine Angabe des Begriffs Moral xE Nennung des Begriffs ethisch xF keine Angabe des Begriffs Moral xF Nennung des Begriffs ethisch xF Nennung von Verhaltensmuster undKulturxF Nennung des Begriffs Weltkultur xG Erläuterung von Moralgesetzen xG Definition von Moral xG Nennung des Begriffs ethisch xkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion3. Gesellschaftlicher (Werte-) WandelA Erläuterung des Wertewandels xA Erläuterung des Strukturwandels xB Definition gesellschaftlicher Wandel xB Erläuterung Strukturwandel xC Begründung des Arbeits- u. Strukturwandels xC Definition des Wandels von Normen xD keine Angabe zum gesellschaftlichen (Werte-)WandelxE Nennung des Gefühlswandels xF Nennung des Begriffs Wertewandel-GenerationxF Definition des gesellschaftlichen Wandels xF Definition des Strukturwandels xG Begründung des Wertewandels xG Definition des sozialen Wandels xx40
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseNach dieser tabellarischen Ergebnisübersicht erfolgt in Ergänzung eine kurze Beschreibungder jeweiligen Ergebnisse. Dieses Vorgehen wird für alle Kategorien beibehalten.Kategorie 1 untersucht die ethischen Grundlagen. So wurden die Schulbücher 26 inhaltlich aufWerte, Wertvorstellungen und Normen geprüft. Hier ist zu erkennen, dass zwei der Untersuchungsobjekte,Buch A (Baden-Württemberg und Niedersachsen) und G (Sachsen), sicheingehend mit diesen Begrifflichkeiten auseinandersetzen und eine ausführliche Erläuterunghierzu liefern. Die Bücher B, C und F geben jeweils Definitionen von Werten und Normen an,z. T. sind auch vereinzelte weiterführende Erläuterungen vorzufinden. In den Büchern D undE sind lediglich Nennungen zu finden; einmal tritt eine kurze Definitionen des Normenbegriffsauf.Bei der Überprüfung der Begriffe Moral und Ethik, lässt sich über alle Bücher und somit alledrei Bundesländer hinweg erkennen, dass kaum eine Betrachtung stattfindet und insofernüberwiegend Nennungen vorliegen. Hervorzuheben sind nur das Buch B, das als einziges eineErläuterung der Ethik wiedergibt, und das Buch G, welches eine Definition der Moral liefert.Die beiden zu untersuchenden Begriffe sind in ihrer Reinform in den Büchern C, D, E und Füberhaupt nicht vorzufinden.Als letztes wurde noch der gesellschaftliche (Werte-)Wandel analysiert. In den SchulbüchernA, C und G wird dem Wertewandel bzw. dem Strukturwandel eine ausführliche Betrachtunggeschenkt; Erläuterungen bzw. Begründungen sind dort zu finden. Die übrigen vier Untersuchungseinheitengeben jeweils Definitionen eines Wandels an. Außer in Buch D ist keineAngabe zu finden.Kategorie 2: Ökonomische GrundlagenBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion1. Soziale Marktwirtschaft und WirtschaftsakteureA Erläuterung des Wirtschaftsliberalismus xA Erläuterung d. Zentralverwaltungswirtschaft xA Begründung der Sozialen Marktwirtschaft xA Diskussion der Sozialen Marktwirtschaft(Streitgespräch)A Definition von Wirtschaftsakteuren / -xsubjektenB Definition der Wirtschaftsordnung xB Erläuterung der Marktwirtschaft (allgemeinxund d. Freien Marktwirtschaft)B Erläuterung d. Zentralverwaltungswirtschaft xB Erläuterung der Sozialen Marktwirtschaft:xLeitbild und StrukturprinzipienB Diskussion der Sozialen Marktwirtschaft xB Definition von Wirtschaftsakteuren xB Erläuterung des Staats xB Definition von Unternehmen xx26 Hier sei noch einmal auf die tabellarische Übersicht der Schulbücher mit ihrem Titel und ihrem Einsatzgebietverwiesen, die sich auf S. 29 dieser Arbeit befindet.41
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägungergänzende Beschreibung1. Soziale Marktwirtschaft und WirtschaftsakteureC Erläuterung der Wirtschaftsordnung xC Definition der Freien Marktwirtschaft xC Definition d. Zentralverwaltungswirtschaft xC Diskussion Freie Marktwirtschaft versusZentralverwaltungswirtschaftkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussionC Begründung der Sozialen Marktwirtschaft xC Erläuterung von Rahmenbedingungen derSozialen MarktwirtschaftxC Erläuterung der privaten Haushalte xC Erläuterung von Unternehmen xC Erläuterung des Staats xC Definition der übrigen Welt xC Diskussion Vergleich der unterschiedlichenWirtschaftsakteureD keine Angabe zur Freien Marktwirtschaft xD keine Angabe d. Zentralverwaltungswirtschaft xD Nennung der Sozialen Marktwirtschaft xD keine Angabe des Begriffs Wirtschaftsakteure xD Nennung des Begriffs Unternehmen xD Nennung des Begriffs Staat xE Definition der Freien Marktwirtschaft xE Definition des Begriffs Planwirtschaft xE keine Angabe zur Sozialen Marktwirtschaft xE keine Angabe des Begriffs Wirtschaftsakteure xE Definition von Unternehmen xF Erläuterung der Freien Marktwirtschaft(Wirtschaftsliberalismus)xF Nennung d. Zentralverwaltungswirtschaft xF Erläuterung der Sozialen Marktwirtschaft:Leitbild und StrukturprinzipienxF Diskussion Soziale Marktwirtschaft:Modell für die EU?xF Definition von Wirtschaftssubjekten xF Definition von Verbraucher / Anbieter &Produzent / KonsumentxG Nennung der Freien Marktwirtschaft xG Nennung d. Zentralverwaltungswirtschaft xG Erläuterung der Sozialen Marktwirtschaft xG Definition von Unternehmen (global) xG Definition von Staat xxx42
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine Angabe2. Ökonomische Prinzipien und NutzenmaximierungA Definition des Knappheitsprinzips xA Nennung des Begriffs Nutzen xA Definition des Kosten-Nutzen-Prinzips xA Definition von Nutzenmaximierung alsZielB Nennung des Begriffs Knappheit xB keine Angabe zum Nutzen xB keine Angabe zu ökonomischen Prinzipien xB Definition von Nutzenmaximierung xC Erläuterung der Knappheitsproblematik xC Erläuterung des ökonomischenVerhaltensmodellsC Erläuterung der ökonomischen Prinzipien(Minimal-, Maximal-,generelles Extremumprinzip)C Nennung des Begriffs Nutzen xC Definition von Nutzenmaximierung alsZielxD keine Angabe zur Knappheit xD keine Angabe zu ökonomischen Prinzipien xD keine Angabe zum Nutzen xD Nennung des Begriffs Kosten-Nutzen-DenkenxE Erläuterung von Wasserknappheit xE keine Angabe zu ökonomischen Prinzipien xE Nennung des Begriffs Nutzen xE Nennung von Gewinnstreben undRenditenmaximierungxE Nennung des Begriffs Kosten-Nutzen-VerteilungxF keine Angabe zur Knappheit xF keine Angabe zu ökonomischen Prinzipien xF Definition des Begriff Nutzen (politisch) xF Nennung Nutzen- u. Gewinnmaximierung xG Definition des Knappheitspostulats xG Nennung des Begriffs Nutzen xG Definition der wirtschaftlichen Vernunft xxNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussionxx43
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine Angabe3. Homo oeconomicus und DilemmastrukturenA Erläuterung des Homo oeconomicus xA Erläuterung eines Dilemmas (Beispiel) xB Erläuterung des Homo oeconomicus xB Begründung des Gefangenendilemmas(Rollenspiel)C Definition des Homo oeconomicus xC keine Angabe von Dilemmastrukturen xD keine Angabe des Homo oeconomicus xD keine Angabe von Dilemmastrukturen xE keine Angabe des Homo oeconomicus xE Definition des Feiglingsspiels xF Nennung des Homo oeconomicus xF Definition des rationalen Menschen(Wähler)xF keine Angabe von Dilemmastrukturen xG Definition des Homo oeconomicus xG keine Angabe von Dilemmastrukturen xNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussionxDie ökonomischen Grundlagen sind Untersuchungsgegenstand der zweiten Kategorie. Die inder Bundesrepublik Deutschland vorherrschende Soziale Marktwirtschaft wird in den fünfSchulbüchern A, B, C, F und G ausführlich dargestellt. Es werden Erläuterungen hierzugegeben, Begründungen für die Existenz geliefert oder sogar Diskussionen darüber geführt.Die beiden aufeinander abgestimmten baden-württembergischen Bücher schneiden hierschlecht ab, da in Buch D nur eine Nennung und in Buch E überhaupt keine Erwähnungerfolgt. Andere Formen der Wirtschaftsordnung, sei es die Freie Marktwirtschaft oder dieZentralverwaltungswirtschaft, werden ebenfalls in den obig genannten fünf Büchern definiertund z. T. näher erläutert. Buch E liefert zu den vorangehend erwähnten Wirtschaftsformenlediglich eine kurze Beschreibung und in Buch D sind hierüber keine Angaben zu finden. Dieeinzelnen Wirtschaftsakteure, wie Staat, Unternehmen und private Haushalte, werden sehrausführlich in Buch C behandelt. Es werden stets Erläuterungen angegeben. Aber auch BuchB liefert hierzu Definitionen und Erläuterungen. Die anderen Schulbücher nennen bzw.definieren jeweils den Begriff Wirtschaftsakteure bzw. Wirtschaftssubjekte.Buch C, das in Niedersachsen und Sachsen im Schulunterricht zum Einsatz kommen kann,beschreibt und erläutert ausführlich die ökonomischen Prinzipien (Minimal-, Maximal undExtremumprinzip) und die zugrundeliegende Knappheitsproblematik. Daneben wird derBegriff des Nutzens genannt und die Nutzenmaximierung definiert. Die Bücher A und Gdefinieren jeweils die Knappheit von Ressourcen und das Kosten-Nutzen-Prinzip. In den restlichenvier Schulbüchern findet man Nennungen der Begrifflichkeiten: Nutzen, Knappheitund Gewinnstreben.Abschließend wurde noch nach dem Modellmenschen Homo oeconomicus gesucht. Dieserwird in den Schulbüchern A und B ausführlich erläutert, welche beide in Baden-Württembergsowie je in einem der anderen Bundesländer eingesetzt werden können. Ebenfalls ist immereine Dilemmasituation, die erläutert bzw. sogar begründet wird, zu finden. Die Bücher C, F44
5. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyseund G definieren den Homo oeconomicus, aber keine Dilemmastruktur. In Buch D sind zubeiden Begriffen keine Angaben zu finden, in Buch E wird das „Feiglingsspiel“ definiert.Kategorie 3: Verhältnis von Ethik und ÖkonomikBuch Ausprägung ergänzende Beschreibung1. <strong>Wirtschaftsethik</strong>A keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xA Nennung v. fairen Rahmenbedingungen xB Definition von <strong>Wirtschaftsethik</strong> xC keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xC Nennung Beispiel: Ziele der OECD xD keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xD Definition des Gemeinwohls xE keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xE Nennung von sozialen Standards xF keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xF Definition des Gemeinwohls xF Definition einer gerechterenGesellschaftsordnungF Definition des fairen globalenxWirtschaftssystemG keine Angabe des Begriffs <strong>Wirtschaftsethik</strong> xG Definition des Gemeinwohls x2. Vertreter und verschiedene AnsätzeA Definition Adam Smith xA keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xB Nennung Adam Smith xB Nennung Karl Homann (Zitat) xB Definition Ordnungs- undUnternehmensethikxC Erläuterung Adam Smith (Lebenslauf) xC Nennung K. Homann / A. Suchanek(Zitat)xC keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xD Nennung Adam Smith xD keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xE Nennung Adam Smith xE keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xF Erläuterung Adam Smith xF keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xG Definition Adam Smith xG keine Angabe zu verschiedenen Ansätzen xkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussionx45
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterung3. SpannungsverhältnisA Definition des Interessensgegensatzesx(Arm - Reich)B Begründung von Moral und Eigeninteresse xB Erläuterung des Interessenkonfliktsx(Manager - Arbeitnehmer)C Definition des Interessenskonfliktsx(Bedürfnisbefriedigung)C Erläuterung des Interessenskonflikts(soziale Verantwortung)xD Definition des Interessenskonflikts xE Definition des Interessenkonflikts (HedgeFonds)xF Definition des Interessenskonflikts(Mindestlohn)xG Definition des Spannungsverhältnisses(Industrieländer und DrittexWelt)BegründungDiskussionIn Kategorie 3 wird das Verhältnis von Ethik und Ökonomik betrachtet. Als erstes wurden dieSchulbücher auf den Begriff <strong>Wirtschaftsethik</strong> hin analysiert. In sechs der Bücher wurde dieseBegrifflichkeit nicht gefunden. Lediglich in Buch B, welches für den Unterricht in Baden-Württemberg und Sachsen zugelassen ist, wird eine Definition hierfür gegeben. Bei genauererBetrachtung findet man in allen Exemplaren Nennungen bzw. Definitionen, die auf die <strong>Wirtschaftsethik</strong>hindeuten, wie z. B. faire Rahmenbedingungen, die Forderung nach einergerechteren Gesellschaftsordnung oder das Gemeinwohlinteresse.Bei den Vertretern taucht in jedem Schulbuch der Name Adam Smith auf und seine Arbeitbzw. Rolle wird z. T. definiert. Buch C und F geben weiterführende Informationen an, wiez. B. seinen Lebenslauf. Karl Homann wird in Buch B und in Buch C gemeinsam mit AndreasSuchanek zitiert. Aber es werden keine Hinweise gegeben, dass es sich um Vertreter der <strong>Wirtschaftsethik</strong>handelt. Verschiedene Ansätze sind ebenfalls nicht zu finden. Ausschließlich dieAutoren des Buchs B definieren die Ordnungs- und Unternehmensethik.Der letzte Unterpunkt untersucht das Spannungsverhältnis zwischen den beiden DisziplinenEthik und Ökonomik. Durchweg findet man in allen Schulbüchern Textstellen, die einSpannungsverhältnis definieren. Beispielhaft sei hier der Interessenkonflikt zwischen Unternehmerund Arbeitnehmer oder zwischen Arm und Reich genannt. Hervorzuheben ist dasBuch B, dieses begründet sehr ausführlich das Spannungsverhältnis zwischen Moral undEigeninteresse und auch den Interessenskonflikt im Unternehmen.Insgesamt ist diese Kategorie sehr schwach und nur in geringem Maße in den Schulbüchernvertreten.46
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseKategorie 4: Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>Buch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion1. Makroebene: Rahmenordnung, WirtschaftsgesetzeA Begründung der Sozialen Marktwirtschaft xA Definition des Grundgesetzes (div. Art.) xA Nennung des Handelsrechts xB Erläuterung der Rahmenordnung: SozialeMarktwirtschaftB Erläuterung des Grundgesetzes (div. Art.) xB keine Angabe von Wirtschaftsgesetzen xC Erläuterung von Rahmenbedingungen fürdas gesellschaftliche Umfeldmit GesetzenC Erläuterung von Wirtschaftsordnungen (allgemein,Freie Marktwirtschaft,xZentralverwaltungswirtschaft)C Begründung der Sozialen Marktwirtschaft xC Erläuterung von Rahmenbedingungen derSozialen MarktwirtschaftxC Begründung der Rechtsordnung inDeutschland (GesetzesauszugxGrundrecht)C Nennung v. diversen Wirtschaftsgesetzen(Handelsrecht, Steuerrecht,xusw.) alle auf CD-ROMD Nennung der Sozialen Marktwirtschaft xD Erläuterung des Grundgesetzes (div. Art.) xD keine Angabe von Wirtschaftsgesetzen xE keine Angabe der Sozialen Marktwirtschaft xE Nennung des Grundgesetzes xE keine Angabe von Wirtschaftsgesetzen xF Erläuterung der Rahmenordnung: SozialeMarktwirtschaftxF Definition von Spielregeln xF Erläuterung des Grundgesetzes (div. Art.) xF keine Angabe von Wirtschaftsgesetzen xG Erläuterung der Sozialen Marktwirtschaft xG Nennung der Rahmenbedingungen xG Definition des Grundgesetzes (div. Art.) xG Erläuterung des Wirtschaftsrechts xxx47
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibung2. Mesoebene: Unternehmensethik, LeitbilderA Erläuterung von multinationalen Unt. xA keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xA keine Angabe von Unternehmensleitbildern xB Definition von Unternehmenswerten xB Erläuterung der Unternehmensethik xB Nennung von Unternehmenskultur /Corporate Identityxkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussionC keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xC Erläuterung der soz. Komponente als Ziel xC Erläuterung der Personalführung xC Begründung von Corporate Responsibility xC Nennung des Begriffs Leitbild xC Erläuterung von Mitbestimmung im Unt. xC Diskussion der Mitbestimmung in der EU xD keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xD keine Angabe von Unternehmensleitbildern xE keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xE Nennung Ziel: Arbeitsplätze sichern xE Definition von Betriebsrat, Mitbestimmung,BetrVGxE keine Angabe von Unternehmensleitbildern xF keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xF Erläuterung von multinationalen Unt. xF Nennung von Mitbestimmung, BetrVG xF keine Angabe von Unternehmensleitbildern xG keine Angabe des Begriffs Unternehmensethik xG Definition von Arbeitnehmerrechten xG Definition von Mitbestimmung, BetrVG xG keine Angabe von Unternehmensleitbildern x3. Mikroebene: Individuum als WirtschaftsakteurA Nennung von Produzent & Konsument,Arbeitnehmer & ArbeitgeberxB Nennung von Produzent & Konsument xB Nennung des Begriffs Arbeitnehmer xC Definition von Anbieter und Nachfrager xC Definition von Führungskraft xD Nennung des Begriffs Arbeitnehmer xE Nennung von Produzent & Konsument xE Definition von Erwerbstätigen xF Definition von Produzent & Konsument xG Definition von Anbieter und Nachfrager x48
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseKategorie 4 überprüft die Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> im Einzelnen. Vorab sei erwähnt, dassin keinem Schulbuch ein Zusammenhang, wie er in Kapitel 2.5 dieser Arbeit dargestelltwurde, zu finden ist. Die Makroebene, die sich mit der Rahmenordnung und folglich mitWirtschaftsgesetzen auseinandersetzt, wird in den Schulbüchern in Form der Sozialen Marktwirtschaftals Wirtschaftsordnung präsentiert und meist ausführlich erläutert. Auch dasGrundgesetz, welches den übergreifenden Rahmen einer Gesellschaft bildet, ist in jedemBuch zu finden. So werden z. T. Gesetzesauszüge präsentiert und diese näher erläutert. Wirtschaftsgesetze,wie z. B. das Handelsrecht oder Steuerrecht, sind nur in Buch C zu finden; dieoriginal Gesetzestexte finden sich auf der beiliegenden CD-ROM des Schulbuchs.Mit der Unternehmensethik und den Leitbildern eines Unternehmens beschäftigt man sich aufder Mesoebene. Die beiden Bücher B und C liefern Erläuterungen zur Unternehmensethik ingenereller Form bzw. über die Personalführung und Corporate Social Responsibility. Die vierSchulbücher C, E, F und G thematisieren die Mitbestimmungsrechte in einem Unternehmenin differenzierter Weise. So reicht es von der Nennung bis hin zur Diskussion. Die beidenBücher A und D enthalten keine Angaben zur Unternehmensethik. Auszüge aus Unternehmensleitbildernsind in diesem Zusammenhang in keinem der Untersuchungsobjekte zufinden.Bei der Analyse der Mikroebene, welche sich mit dem Individuum als Wirtschaftsakteurbeschäftigt, findet man ein gleichmäßiges Bild. Alle Schulbücher nennen oder definieren denProduzenten und Konsumenten, den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder die Erwerbstätigenallgemein.Kategorie 5: Aktuelle Problem- und Beschäftigungsfelder der<strong>Wirtschaftsethik</strong>Buch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion1. Globalisierung und WeltwirtschaftsordnungA Begründung der Globalisierung xA Diskussion der Globalisierungsbedeutung xA Erläuterung der Welthandelsordnung xA Erläuterung der Welthandelsorganisation xA Erläuterung des Lissabon Vertrags xB Begründung der Globalisierung xB Diskussion der Globalisierung xB Erläuterung von transnationalen Unt. xB Definition von Global Governance xB Erläuterung der Weltwirtschaftsordnung(Institutionen)B Diskussion der Welthandelsorganisation xC Erläuterung der Globalisierung xC Begründung von internat. Verflechtungen xC Diskussion der europäischen Integration xC Erläuterung d. europ. Wettbewerbsordnung xC Erläuterung von Weltwirtschaft undWelthandelsordnungxx49
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion1. Globalisierung und WeltwirtschaftsordnungD keine Angabe des Begriffs Globalisierung xD keine Angabe zur Weltwirtschaftsordnung xE Erläuterung der Globalisierung xE Definition der Weltwirtschaftsordnung xE Definition der Welthandelsordnung xE Definition von internationalen Organisationenim Politikfeld WirtschaftE Nennung des globalen Ordnungsrahmens xF Diskussion der Globalisierung xF Nennung von wi.-pol. Zielen der EU xF Erläuterung der Lissabon Strategie xF Definition von Good Governance xF Erläuterung der Welthandelsorganisation xF Erläuterung der Weltwirtschaftsordnung(Institutionen)G Erläuterung der Globalisierung xG Definition von internationalen Verträgen x2. Nachhaltigkeit und UmweltschutzA Erläuterung der nachhaltigen Entwicklung xA Erläuterung von Umweltproblemen undHerausforderungenxA Definition des Umweltschutzes xA Nennung v. Umweltschutz-Organisation xB Definition von nachhaltiger Entwicklung xB Erläuterung d. Nachhaltigkeitsmarketings xB Nennung von Umweltschutz xB Erläuterung von Umweltpolitik xC Erläuterung von Nachhaltigkeit xC Begründung des Umweltmanagements xC Begründung des Bundesimmisionsgesetzes xC Diskussion der Weltwirtschaft und Umwelt xC Erläuterung der Umweltpolitik xD keine Angabe des Begriffs Nachhaltigkeit xD Nennung von Umweltschutz und -politik xE Definition von nachhaltiger Entwicklung xE Nennung von Umweltschutz xE Nennung von Umweltpolitik xF Diskussion von Nachhaltigkeit xF Nennung des Begriffs Umweltschutz xG keine Angabe des Begriffs Nachhaltigkeit xG Definition von Umweltschutz xxx50
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBuch Ausprägung ergänzende Beschreibungkeine AngabeNennungDefinitionErläuterungBegründungDiskussion3. Wirtschaftskrisen und WirtschaftskriminalitätA Definition der Weltwirtschaftskrise 1930 xA Definition von Finanz-, Immobilienkrise xA Erläuterung der großen Finanzmarktkrisen xA Definition von Kartellen xA Nennung des Begriffs Korruption xB Nennung der Weltwirtschaftskrise 1930 xB Nennung von Finanzkrise xB Begründung der Asienkrise xB Nennung von Korruption xB Definition v. Kartellen / Kartellverbot xB Nennung des Begriffs Schwarzarbeit xC Definition der Asienkrise xC Definition von Schwarzarbeit xC Definition von Kartellverbot, Fusionskontrolle,MissbrauchsverbotD keine Angabe zu Wirtschaftskrisen xD keine Angabe zu Wirtschaftskriminalität xE keine Angabe zu Wirtschaftskrisen xE Definition von Korruption xE Definition von Produktpiraterie xF Begründung der Banken- und Finanzkrise xF Definition von Kartell- undFusionskontrolleF Nennung des Begriffs Schwarzarbeit xG Definition der Weltwirtschaftskrise 1930 xG Definition von Kartellen xxxIn der fünften und somit letzten Kategorie werden aktuelle Problem- und Beschäftigungsfelderder <strong>Wirtschaftsethik</strong> betrachtet. Diese Kategorie entstand auf Basis der vorliegendenUntersuchungseinheiten und wurde folglich induktiv erstellt. Das Gesamtergebnis dieserKategorie fällt deshalb insgesamt positiv aus. Im ersten Unterpunkt geht es um dieGlobalisierung und die Weltwirtschaftsordnung. Die drei bundesländer-übergreifenden SchulbücherA, B und C beschäftigen sich umfassend mit dieser Thematik und liefern Textstellenmit Erläuterungen, Begründungen oder Diskussionen. So werden die Globalisierung und dieWelthandels- oder Weltwirtschaftsordnung ausführlich beschrieben. Buch D liefert keineAngabe hierzu. Die verbliebenen Schulbücher definieren bzw. erläutern ebenfalls dieGlobalisierung und die weltwirtschaftliche Rahmenordnung.Die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz sollten ebenso Bestandteil des Unterrichts sein. Sozeigt es sich auch, dass in den Schulbüchern A, B, C und F eine ausführliche Betrachtung derNachhaltigkeit vorgenommen wird. Es wird die nachhaltige Entwicklung oder das Nachhaltigkeitsmanagementerläutert oder sogar diskutiert. Buch E bietet eine Definition und nurdie Bücher D und G liefern keine Angaben. Das Thema Umweltschutz wird in Buch C sehrgroß geschrieben, es werden das Umweltmanagement und das Bundesimmisionsgesetz51
5. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalysebegründet und die Umwelt in der Weltwirtschaft diskutiert. Die restlichen sechs Büchernennen den Begriff des Umweltschutzes und definieren z. T., was darunter zu verstehen ist.Wirtschaftskrisen und Wirtschaftskriminalität spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Hierfindet man ein sehr gleichmäßiges Bild innerhalb der Ergebnisse. Bis auf Buch D liefern alleSchulbücher Definitionen zu verschiedenen Wirtschaftskrisen, sei es die aktuelle Finanzkrise,die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren oder die Asienkrise. Buch A liefert darüberhinaus eine Chronik der großen Finanzmarktkrisen, Buch B begründet die Asienkrise undBuch F begründet sogar die aktuelle Banken- und Finanzkrise. Zur Wirtschaftskriminalitätfindet man Nennungen und Definitionen von Kartellen, Korruption und Schwarzarbeit.Lediglich in Buch D sind hierzu keine Angaben gemacht worden.5.2 Vergleichende Zusammenfassung und Interpretation der ErgebnisseNachdem die Ergebnisse einzeln und sehr ausführlich präsentiert wurden und die Zitate imAnhang aufgeführt sind, erfolgt die Zusammenfassung der einzelnen Unterkategorien zu ihrerHauptkategorie. Es werden nun drei Ausprägungen unterschieden. Sie geben an, in welchemUmfang die einzelnen Bereiche behandelt wurden und welche Bedeutung sie in diesemZusammenhang einnehmen. Die Zuordnung für eine sachliche und umfassende Behandlung(hohe Bedeutung) erfährt ein Schulbuch, wenn es die Mehrzahl der Kreuze in den Kategorien„Erläuterung“, „Begründung“ und „Diskussion“ enthält. Eine knappere und lückenhafteDarstellung spiegelt die überwiegenden Vorkommnisse in den Merkmalsausprägungen„Definition“ und „Erläuterung“ wieder, wobei die Häufigkeit der „Definitionen“ ausschlaggebendist. Eine kurze bzw. keine Behandlung liegt vor, wenn hauptsächlich „keine Angaben“oder nur eine „Nennung“ erfolgt sind. In diesem Fall liegt auch nur eine geringe Bedeutungder Thematik <strong>Wirtschaftsethik</strong> vor.Zusammenfassende Merkmalsausprägungen: sachlich differenzierte und umfassende Behandlung: knappere und z. T. lückenhafte Behandlung: kurze bzw. keine Behandlung:■▣□Kategorie 1:EthischeGrundlagenKategorie 2:ÖkonomischeGrundlagenKategorie 3:Verhältnis von Ethik undÖkonomikKategorie 4:Ebenen der<strong>Wirtschaftsethik</strong>Kategorie 5:Aktuelle Problem- bzw.Beschäftigungsfelder der<strong>Wirtschaftsethik</strong>Buch A Buch B Buch C Buch D Buch E Buch F Buch G■ ▣ ▣ □ □ ▣ ■■ ■ ■ □ □ ▣ ▣□ ▣ ▣ □ □ ▣ ▣□ ▣ ■ □ □ ▣ ▣■ ■ ■ □ ▣ ■ ▣52
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseDie vorangehende Tabelle fasst die Ergebnisse der einzelnen Kategorien zusammen und bietetgleichermaßen einen Vergleich über alle analysierten Schulbücher an. So kann man auf einenBlick erkennen, welches Schulbuch inhaltlich am besten abgeschnitten hat bzw. welches ingeringstem Maße die Thematik <strong>Wirtschaftsethik</strong> berücksichtigt.Außerdem kann die Kategorie bestimmt werden, welcher nur eine geringe Beachtunggeschenkt wird und welche Themen häufiger im Unterricht behandelt werden.Bevor genauer auf die Ergebnisse eingegangen wird und eine Interpretation dieser erfolgt,werden die in der Tabelle ersichtlichen Unterschiede in den Kategorien und zwischen deneinzelnen Büchern nun noch grafisch in Form eines Diagramms dargestellt.Kategorie 1:Ethische Grundlagenkurze bzw. keineBehandlungknappere und z. T.lückenhafteBehandlungsachlich differenzierteund umfassendeBehandlungKategorie 2:ÖkonomischeGrundlagenKategorie 3:Verhältnis von Ethikund ÖkonomikKategorie 4: Ebenender <strong>Wirtschaftsethik</strong>Kategorie 5: AktuelleProblem- bzw.Beschäftigungsfelderder <strong>Wirtschaftsethik</strong>Abbildung 8: Grafische Darstellung der zusammenfassenden Ergebnisse (Quelle: eigeneDarstellung)Sowohl anhand der Tabelle als auch mittels der Grafik ist gleichermaßen gut zu erkennen,dass es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulbüchern gibt. Sei es auf Grunddes Darstellungsumfangs oder der Schwerpunktsetzung. Schulbuch C bietet die umfangreichsteund ausführlichste Behandlung und schnitt am besten in der Bewertung ab. Es wurde2008 vom Duden Paetec Verlag herausgegeben und ist für den Unterricht in Niedersachsenund Sachsen zugelassen. Mit den geringsten Übereinstimmungen bzw. wenigsten Fundstellenist das Buch D zu nennen, gefolgt von Buch E. Erstgenanntes kann in der Kursstufe I inBaden-Württemberg eingesetzt werden, und für die Kursstufe II wird das darauf aufbauendeBuch E empfohlen. Beide sind im Schöningh Verlag 2006 und 2007 erschienen und am neuenBildungsstandard und Bildungsplan ausgerichtet.53
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseBevor die Kategorien im Einzelnen zusammengefasst werden, sollen an dieser Stelle nun dieBundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen betrachtet werden. Durch dieAuswahl der drei Bundesländer sollte eine grobe Abdeckung der Bundesrepublik Deutschlanderreicht werden. Außerdem wurde ein Ländervergleich möglich, der hier kurz aufgegriffenwird.Baden-Württemberg kann die Bücher A, B, D und E im Schulunterricht einsetzen. Hiervonschneidet Buch B mit der Schulnote „gut“ ab, Buch A lässt sich als „ausreichend“ einstufenund die Bücher D und E sind „ungenügend“. Somit erscheint der Süden in einem wenigerbefriedigenden Licht.Im Norden, also in Niedersachsen, können die Bücher A, C und F von den Lehrkräftengenutzt werden. So kann das am besten abgeschnittene Buch C zum Einsatz kommen. Weiterkönnen auf das „befriedigende“ Buch F und das „ausreichende“ Buch A zurückgegriffenwerden.Für Sachsen wurden ebenfalls drei Bücher analysiert, die Schulbücher B, C und G. Das imVergleich zu den anderen Büchern „sehr gute“ Buch C kann für einen effektiven Unterrichtverwendet werden. Buch B, welches der Schulnote „gut“ entspricht, und Buch G, welches als„befriedigend“ zählt, können in der Fächerkombination ebenso gute Ergebnisse erzielen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die analysierten Schulbücher des Nordens die desSüdens übertreffen. Der Westen, mit Niedersachsen und Baden-Württemberg, tritt ein wenigin den Schatten des Ostens. Möglicherweise beruhen diese unterschiedlichen Resultate aufden verschiedenen Kerncurricula bzw. auf evtl. strengeren oder genaueren Kontrollen bei denZulassungsverfahren.Basierend auf den vorangehenden Ergebnissen, erfolgt nun die Zusammenfassung undInterpretation der Kategorien.Die ethischen Grundlagen, welche Kategorie 1 erfasst, sind von den Büchern A und G ambesten dargestellt. Werte, Wertvorstellungen und Normen werden erläutert und der mit ihnenverbundene Wertewandel skizziert; von Moral und Ethik ist ebenso die Rede. Dieses positiveErgebnis ist sicherlich auf die entsprechenden Kerncurricula zurückzuführen. Betrachtet manz. B. das Curriculum für Niedersachsen, welches mit eine Basis für Buch A bildet, dann findetman dort die entsprechenden Kompetenzanforderungen 27 (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium,2007, S. 10). So wird eine erste gute Grundlage für ein wirtschaftethischesVerständnis gelegt. Auch die Bücher B, C und F bieten hierzu Informationsmaterial für dieSchüler an. Die Bedeutung ist jedoch wesentlich geringer, da keine ausführlichenDarstellungen erfolgen und hauptsächlich kurze Definitionen dargeboten werden.Die Schulbücher D und E schneiden am schlechtesten ab. Sie nennen lediglich dieBegrifflichkeiten oder es sind keine Angaben zu finden. Im zugehörigen Bildungsplan fürBaden-Württemberg für die Fächerkombination Geographie – Wirtschaft – Gemeinschaftskunde,lassen sich ebenfalls keine entsprechenden Anforderungen finden. Allerdingssollen laut diesem die Schüler in der Oberstufe befähigt werden, „sich mit den ökonomischenExistenzbedingungen und deren sozialen, politischen, rechtlichen, ökologischen, technischenund ethischen Dimensionen auf privater, betrieblicher, volkswirtschaftlicher undweltwirtschaftlicher Ebene“ auseinander setzen zu können (Landesbildungsserver Baden-Württemberg, 2009, S. 251). Um dieses Ziel zu erreichen, müsste aber ein erstesGrundverständnis von Ethik erlangt werden. Die Konzeption und die Inhalte der SchulbücherD und E werden dieser Zielstellung jedoch nicht gerecht.27 Im Rahmen dieser Arbeit findet keine detaillierte Betrachtung der jeweiligen Bildungspläne und Kerncurriculastatt. Da diese aber die Grundlage für alle zum Einsatz kommenden Schulbücher bilden, könnten sie zumUntersuchungsaspekt in weiterführenden Forschungsarbeiten werden. Jedoch sollen auch hier an geeigneterStelle Hinweise bzw. Rückgriffe auf die Curricula erfolgen, um evtl. Sachverhalte besser begründen zu können.54
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseKategorie 2 thematisiert die ökonomischen Grundlagen. In diesem Bereich dominieren dieBücher A, B und C, welche alle drei jeweils in zwei der untersuchten Bundesländer zumEinsatz kommen können. So wird die in Deutschland herrschende Wirtschaftsordnung derSozialen Marktwirtschaft ausführlich erläutert, begründet oder diskutiert. Die verschiedenenWirtschaftsakteure werden dargestellt. Ökonomische Prinzipien, welche der persönlichenBedürfnisbefriedigung dienen, und das Eigeninteresse, in Form der Nutzenmaximierung,werden behandelt. Der Homo oeconomicus wird als Modellmensch vorgestellt und imWirtschaftsleben entstehende Dilemmastrukturen werden aufgegriffen, nicht jedoch in BuchC. Dieses Ergebnis lässt sich womöglich auf die Basis mehrerer Kerncurricula zurückführen.Die Bücher F und G bieten ebenfalls eine solide Grundlage für ein erstes wirtschaftlichesVerständnis, wobei hier die Behandlung in geringerem Umfang stattfindet. Z. B. wird inSachsen (Buch G) das Gefangenendilemma im Lehrplan lediglich in einem Wahlpflichtbereichaufgeführt, so lässt es sich begründen, dass dieses Thema nicht im Schulbuchvertreten ist (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2004/2007/2009, S. 16).Die beiden baden-württembergischen Bücher D und E bilden die „Schlusslichter“ in dieserKategorie. Diese Themen werden nur in sehr geringem Umfang behandelt oder bleiben ohnejegliche Erwähnung. Mit diesen Angaben können nahezu keine ökonomischen Grundlagen imRahmen der Fächerkombination gelegt werden, um die Schüler zu mündigen Wirtschaftsakteurenzu erziehen. Ein Blick in den Bildungsplan zeigt jedoch, dass ökonomischeSachverhalte, wie die Diskussion der Marktwirtschaft, der Umgang mit der Knappheitsproblematikoder ökonomische Verhaltensmodelle (vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg, 2009, S. 255), Unterrichtsbestandteil sein sollten. Somit müssten diese imSchulbuch integriert sein, wie es in Buch A und B der Fall ist. So setzt der Buchner Verlagdiese Anforderungen im Vergleich zum Schöningh Verlag gezielter um.Bezüglich des Verhältnisses von Wirtschaft und Ethik sei zu Beginn erwähnt, dass diesedritte Kategorie am schwächsten in den Schulbüchern repräsentiert wird. Kein Buch bieteteine umfassende Behandlung dieser Thematik, sie ist auch nicht in den Curricula zu finden.Die vier Schulbücher B, C, F und G bieten eine knappe Darstellung. Der Begriff„<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ oder ein Synonym wird nur in Buch B gefunden und definiert. Ansonstenwerden Textstellen präsentiert, die auf eine wirtschaftsethische Ausrichtung, z. B. derRahmenordnung, hindeuten. Weiter wird Adam Smith genannt, z. T. wird sein Lebenslaufpräsentiert, diverse Ansätze der <strong>Wirtschaftsethik</strong> sind nicht zu finden. Ein Spannungsverhältnisin Form von Interessenskonflikten wird in allen analysierten Schulbüchernaufgezeigt. Diese Kategorie ist in den übrigen drei Büchern unterrepräsentiert.Das Konstrukt „<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ wird zwar aktuell stark in den Medien diskutiert, aber in dieSchulbücher hat es noch keinen realen Einzug gefunden. An Universitäten, an denen dieLehrerausbildung stattfindet, werden erst nach und nach eigene Lehrstühle für Wirtschaftsbzw.Unternehmensethik eingerichtet, als Beispiel sei die Universität Mannheim genannt 28 .Kategorie 4, welche die Buchinhalte auf die Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> überprüft, nimmtebenfalls in den Schulbüchern nur einen geringen Stellenwert ein. Ausschließlich dasSchulbuch C behandelt die einzelnen Unterkategorien in entsprechend umfassendem Umfang.Aber auch hier fehlt die Darstellung der Zusammenhänge der einzelnen Ebenen im3-Schichten-Modell, denn sie ist noch nicht in den Kerncurricula verankert.28 An der Universität Mannheim wurden dieses Jahr Stiftungsprofessuren für „Corporate Governance“ und für„Unternehmensethik“ an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre eingerichtet. So können beide Seiten einerguten Unternehmensführung betrachtet werden, einerseits auf Basis betriebswirtschaftlichen Managements undauf der anderen Seite in Anbetracht kultureller Wertvorstellungen (vgl. Fakultät für Betriebswirtschaft, 2009).55
5. Ergebnisse der qualitativen InhaltsanalyseDie Bücher A, B, F und G erläutern in diesem Zusammenhang die Soziale Marktwirtschaft alsRahmenordnung und das Grundgesetz, nennen Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer odererläutern den Begriff des multinationalen Unternehmens. Auf die unterschiedlichenEigenschaften des Individuums als Wirtschaftsakteur wird nur vereinzelt Bezug genommenund so erfolgt lediglich die Definition von Konsument, Produzent, Arbeitnehmer oderArbeitgeber.Buch D und Buch E sind auch in dieser Kategorie auf den letzten Plätzen angesiedelt. Hierwerden nur vereinzelt Begrifflichkeiten genannt und somit kann kein Verständnis für dieeinzelnen Ebenen entwickelt werden, welche in Kapitel 2.5 verdeutlicht wurden.Die Erwähnung aktueller Problem- bzw. Beschäftigungsfelder der <strong>Wirtschaftsethik</strong> wirdin der fünften Kategorie überprüft. In diesem Untersuchungsbereich sind insgesamt die bestenErgebnisse zu finden. Die vier Schulbücher A, B, C und F stellen alle drei untersuchtenThemen, von der Globalisierung über die Nachhaltigkeit bis hin zu den Wirtschaftskrisen, gutdar. Diese Bereiche werden erläutert, begründet und z. T. sogar diskutiert. Die UntersuchungsobjekteA und F beinhalten bereits die jüngste Weltwirtschaftskrise.Die beiden Bücher E und G erläutern die Globalisierung, aber die Nachhaltigkeit, denUmweltschutz, die Wirtschaftskrisen oder die Wirtschaftskriminalität nennen und definierensie lediglich. Buch D enthält überwiegend keine Angaben zu diesen Themen, nur derUmweltschutz bzw. die -politik werden genannt.Nach der Betrachtung der einzelnen Kategorien lässt sich abschließend festhalten, dass BuchC am besten abgeschnitten hat und in drei Kategorien (2, 4 und 5) dominiert sowie dieKategorien 1 und 3 in mäßigem Umfang thematisiert. Wenn dieses Buch um einige Aspekteergänzt werden würde, könnte es flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschlandeingesetzt werden und würde eine sehr gute Voraussetzung dafür schaffen, dass die Schülermit dem Abitur als mündige Wirtschaftsbürger entlassen werden können.56
6. DIE NOTWENDIGKEIT DER INTEGRATION DER WIRTSCHAFTSETHIK INDEN UNTERRICHT AN ALLGEMEIN BILDENDEN GYMNASIENNachdem die ökonomische Bildung in den letzten Jahren häufig kritisiert wurde, ist das Jahr2009 von der deutschen Wirtschaft als „Jahr der ökonomischen Bildung“ ausgerufen worden.Bisherige Bemühungen, den Wirtschaftsunterricht an allgemein bildenden Schulen zuetablieren, sind bundesweit noch nicht erfolgreich umgesetzt worden. Das Motto dieses Jahressoll somit Ansporn sein, die ökonomische Bildung zu fördern und „Wirtschaft“ zu einemeigenständigen Fach werden zu lassen. Auch die Lehrerausbildungen müssten angepasstsowie ständige Fort- und Weiterbildungen in diesem Bereich angeboten werden (vgl. zudiesem Abschnitt Kaminski, 2009, S. 2).Die „Jugendstudie 2009 – Wirtschaftsverständnis und Finanzkultur“ 29 zeigt, dass die Schülerein großes Interesse an wirtschaftlichen Themen haben und ein Verständnis über wirtschaftlicheSachverhalte für sie wichtig ist (vgl. Bundesverband deutscher Banken, 2009, S. 4).Obwohl dem Thema „Wirtschaft“ in den letzten Jahren stärkere Aufmerksamkeit durch dieBildungspolitik geschenkt wurde und neue Fächerkombinationen entstanden, sind die meistenBefragten immer noch der Meinung, dass die Anstrengungen in diesem Bereich weiter verstärktwerden müssen (vgl. Bundesverband deutscher Banken, 2009, S. 10).Die Frage nach einem eigenständigen Schulfach „Wirtschaft“ findet durchweg eine großeAkzeptanz bei allen Studienteilnehmern; so sind nahezu 8 von 10 Probanden für dieEinführung des Wirtschaftsunterrichts (vgl. ebda., S. 10). Diesem Wunsch der Schüler unddem Großteil der Bevölkerung sollte in naher Zukunft nachgegangen werden und es sollteeine bessere und umfangreichere Einbettung der ökonomischen Bildung in die Allgemeinbildungerfolgen. Ebenfalls sollten wirtschaftsethische Themen einen wesentlichen Bestandteilhiervon bilden, um Zusammenhänge und Spannungsverhältnisse im Wirtschaftslebenerkennen und erfolgreich meistern zu können.Die durch diese Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass der <strong>Wirtschaftsethik</strong> einebisher eher geringe Bedeutung zukommt und sie noch keinen ausreichenden Stellenwert inden analysierten Schulbüchern eingenommen hat. Mit diesen Untersuchungsergebnissen kannkein vollständiger Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden, da aufgrund der Vielfaltnur einige Bücher analysiert wurden und der Einsatz im Schulunterricht nicht überprüftwurde 30 . Etwaige Rückschlüsse auf alle anderen zulässigen Schulbücher sind deshalb kaumoder nur äußerst eingeschränkt möglich. Allerdings präsentieren die Ergebnisse exemplarischfür die Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen, wie und in welchemUmfang die Thematik in den Lehrbüchern umgesetzt wurde.29 Das Mannheimer Institut für praxisorientierte Sozialforschung (ipos) führte im Auftrag des Bundesverbandesdeutscher Banken Anfang April 2009 die Umfrage zu dieser Studie durch. Für die Jugendstudie wurden 753Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren telefonisch befragt. Zeitgleich fand einevergleichende Befragung unter 1.003 Erwachsenen ab 18 Jahren telefonisch statt. Die Ergebnisse beider Studiensind repräsentativ, erstere für alle 14- bis 24-Jährigen in Deutschland, letztere für die wahlberechtigteBevölkerung in Deutschland (vgl. zu diesem Abschnitt Bundesverband deutscher Banken, 2009, S. 23)30 Mit in die Überlegungen wurde einbezogen, alle Gymnasien der drei Bundesländer anzuschreiben und nachdem Schulbucheinsatz in den Fächerkombinationen zu fragen. Allerdings wurde darauf aufgrund schlechterRücklaufquoten in vergangenen <strong>Schulbuchanalyse</strong>n an der Universität Mannheim und der im Diplomarbeitbearbeitungszeitraumliegenden Sommerferien verzichtet. Außerdem stehen in diesen neuen Fächerkombinationennoch nicht sehr viele Schulbücher zur Auswahl. Die hier genommene Stichprobe wird deshalb alsausreichend erachtet.57
6. Die Notwendigkeit der Integration der <strong>Wirtschaftsethik</strong> in den Unterricht an allgemeinbildenden GymnasienHier zeigt sich auf der einen Seite, dass es in einigen Schulbüchern, vor allem in Buch C mitdem Titel „Duden Wirtschaft – Recht“, gute inhaltliche Ansätze gibt, deren ständigeWeiterentwicklung aber noch notwendig erscheint. Das genannte Schulbuch, welches inNiedersachsen und Sachsen zum Einsatz kommen kann, ist von seiner Grundanlage sehr gutkonzipiert und könnte zu einem bundesweiten „Standard“ werden. Dafür müsste es allerdingsnoch um einige Themenfelder bezüglich der immer größer werdenden Bedeutung von<strong>Wirtschaftsethik</strong> ergänzt werden. Besonders wichtig wäre für diesen Aspekt, das Thema überdas Zusammenspiel der einzelnen Wirtschaftsakteure auf den unterschiedlichsten Ebenen, seies als Individuum im Unternehmen mit seinen verschiedenen Facetten oder als Marktteilnehmerauf Gesellschaftsebene, zu erfassen und zu erläutern. Die Schüler könnten dadurchdie diversen Wirkungsbereiche und Einflussmöglichkeiten ihres späteren Handelns in derWirtschaft besser abschätzen und beurteilen. Außerdem sollte zu einem ethisch, moralischenVerhalten und Handeln angeregt werden, welches dem Gemeinwohl aller dient und dabeiauch nachhaltig mit den knappen Ressourcen und der Umwelt umgeht, sowie angesichts derGlobalisierung verschiedenen Werte- und Normensystemen gerecht werden kann.Auf der anderen Seite lässt das Ergebnis dieser Arbeit erkennen, dass die beiden Bücher derReihe „Politik im Wandel“ für die Schulen in Baden-Württemberg nur einen sehr geringenBeitrag zur Thematik <strong>Wirtschaftsethik</strong> leisten. Es wird meiner Meinung nach zu stark auf diepolitischen Komponenten eingegangen und die wirtschaftlichen Aspekte, welche ebenfalls inder Fächerkombination zum Tragen kommen sollten, werden vernachlässigt. In Bezug aufdiese Tatsache erscheinen sie als Lehrbücher im Bereich Geographie – Wirtschaft – Gemeinschaftskundean allgemein bildenden Gymnasien eher ungeeignet.Diese Arbeit zeigt einige Schwachstellen bei der Umsetzung ökonomischer Themen in denanalysierten Schulbüchern auf. Ob diese Punkte nur auf die Autoren der einzelnen Verlagezurückzuführen sind, ist fraglich. Wichtig ist hier, dass die zugrundeliegenden Kerncurriculain einem nächsten Schritt untersucht werden sollten. Vor diesem Kontext dient diese Diplomarbeitals Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten, welche z. B. die diversenKerncurricula unterschiedlicher Bundesländer untersuchen. Diese bilden, wie bereits imVorfeld dargelegt, die Ausgangsbasis und gesetzliche Grundlage für die Inhalte von Schulbüchern.Darüber hinaus wäre es interessant, verschiedene Lehrwerke angrenzender Länderinnerhalb der europäischen Union zu untersuchen, um Informationen zu gewinnen, inwiefernim Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland dort das Thema „<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ bisheraufgenommen wurde. In diesem Zusammenhang könnten weitere <strong>Schulbuchanalyse</strong>ndurchgeführt werden.Da im Bereich „<strong>Wirtschaftsethik</strong>“ bisher nur wenige Forschungsarbeiten getätigt wurden,bestehen hier große Möglichkeiten in den nächsten Jahren zusätzliche Erkenntnisse zugewinnen.Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Integration der <strong>Wirtschaftsethik</strong> in den Unterrichtan allgemein bildenden Gymnasien sehr wünschenswert ist. Sie ist wichtig, damit dasErziehungsziel der Bildungsanstalten, die Schüler mit dem Abitur als mündige Staats- undWirtschaftsbürger zu entlassen, erfolgreich erreicht werden kann. Hierbei sollte eineangemessene Handlungsorientierung Hilfestellung bieten. Komplette Handlungszyklensollten in die Lernumgebungen integriert und von den Lernenden durchlaufen werden. Somitkönnen dann zukünftige Situationen des wirtschaftlichen Lebens von den Schülern erfolgreichbewältigt werden. Außerdem sollten auch Werte und Normen vermittelt werden, die auf einmoralisches Verhalten der Heranwachsenden abzielen. Dadurch kann ein effektivesZusammenarbeiten in Unternehmen und ein, trotz unterschiedlicher Bedürfnisse, in Einklangstehendes Zusammenleben in der Gesellschaft ermöglicht werden.58
LITERATURVERZEICHNISAllgemeine Literaturquellen:Bortz, J. 31 (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler (6. Auflage). Heidelberg:Springer.Dietzfelbinger, D. (2000). Aller Anfang ist leicht: Unternehmens- und <strong>Wirtschaftsethik</strong> fürdie Praxis (2. Auflage). München: Herbert Utz.Ebner, H. G. (1992). Facetten und Elemente didaktischer Handlungsorientierung. In G.Pätzold (Hrsg.), Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung (1. Auflage, S. 33 –53). Frankfurt am Main: GAFB.Früh, W. (2007). Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis (6. Auflage). Konstanz: UVK.Göbel, E. (2006). Unternehmensethik: Grundlagen und praktische Umsetzung (1. Auflage).Stuttgart: Lucius & Lucius.Hacker, H. (1977). Die Erziehungsdimension der Unterrichtsplanung. In H. Hacker & D.Poschardt (Hrsg.), Zur Lehrerfrage und Unterrichtsgestaltung: LernpsychologischeGrundlagen – pädagogische Perspektiven (1. Auflage). Hannover: Schroedel.Hacker, H. (1980). Das Schulbuch: Funktion und Verwendung im Unterricht (1. Auflage).Bad Heilbrunn / Obb: Klinkhardt.Hartmann, G. (2001). Volkswirtschaftliches Denken und Handeln (5. Auflage). Rinteln:Merkur.Hesse, H. (1992). Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für die Zukunft. In K. Homann(Hrsg.), Aktuelle Probleme der <strong>Wirtschaftsethik</strong> (1. Auflage, S. 29 – 41). Berlin: Dunckerund Humblot.Homann, K. (2002). Vorteile und Anreize: Zur Grundlegung einer Ethik der Zukunft(1. Auflage). Tübingen: Mohr Siebeck.Homann, K. & Blome-Drees, F. (1992). Wirtschafts- und Unternehmensethik (1. Auflage).Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.Homann, K. & Lütge, Ch. (2004). Einführung in die <strong>Wirtschaftsethik</strong> (1. Auflage). Münster:LIT.Homann, K. & Suchanek, A. (2005). Ökonomik: Eine Einführung (2. Auflage). Tübingen:Mohr Siebeck.31 Abweichend vom verwendeten APA-Standard wird der Name des Autors zur besseren Übersichtlichkeit durchFettmarkierung hervorgehoben.59
LiteraturverzeichnisHonecker, M. (1993). Ethik. In G. Enderle, K. Homann, M. Honecker, W. Kerber & H.Steinmann (Hrsg.), Lexikon der <strong>Wirtschaftsethik</strong> (1. Auflage, S. 249 – 258). Freiburg:Herder.Horn, K. I. (1996). Moral und Wirtschaft: Zur Synthese von Ethik und Ökonomik in dermodernen <strong>Wirtschaftsethik</strong> und zur Moral in der Wirtschaftstheorie und imOrdnungskonzept der Sozialen Marktwirtschaft (1. Auflage). Tübingen: Mohr.Imhof, U. (1993). Auswahl und Einsatz von Schulbüchern im Arbeits- undWirtschaftslehreunterricht. arbeiten + lernen / Wirtschaft, Heft 12, S. 22 – 25.Kaminski, H. (1996). Ökonomische Bildung und Gymnasium: Ziele, Inhalte, Lernkonzeptedes Ökonomieunterrichts. Initiative Wirtschaft und Gymnasium (1. Auflage). Neuwied:Luchterhand.Kaminski, H. (2009). „Jahr der ökonomischen Bildung“ ausgerufen. Was kann dabeirauskommen? Unterricht Wirtschaft, Heft 38, S. 2.Kaminski, H. & Krol, G.-J. (2008). Ökonomische Bildung: Legitimiert, etabliert,zukunftsfähig. Stand und Perspektiven (1. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.Karmasin, M. & Litschka, M. (2008). <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Theorien, Strategien, Trends(1. Auflage). Wien: LIT.Klammer, B. (2005). Empirische Sozialforschung: Eine Einführung fürKommunikationswissenschaftler und Journalisten (1. Auflage). Konstanz: UVK.Kreikebaum, H. (1996). Grundlagen der Unternehmensethik (1. Auflage). Stuttgart:Schäffer-Poeschel.Kuhn, L. & Rathmayr B. (1977). Statt einer Einleitung – 15 Jahre Schulreform – Aber dieInhalte? In L. Kuhn (Hrsg.), Schulbuch – ein Massenmedium, Informationen –Gebrauchsanweisungen – Alternativen (1. Auflage, S. 9 – 17). Wien: Jugend und Volk.Kunze, M. (2008). Unternehmensethik und Wertemanagement in Familien- undMittelstandsunternehmen: Projektorientierte Analyse, Gestaltung und Integration vonWerten und Normen (1. Auflage). Wiesbaden: Gabler.Lauer, J. W. (2007). Das Thema ‚<strong>Wirtschaftsethik</strong>’ in Schulbüchern zur Wirtschaftslehre:Eine Inhaltsanalyse ausgewählter Schulbücher. Diplomarbeit, Universität Mannheim.Lenzen, D. (Hrsg.) (1985). Enzyklopädie Erziehungswissenschaft: Handbuch und Lexikonder Erziehung in 11 Bänden und einem Registerband. Band 4: Methoden und Medien derErziehung und des Unterrichts. Stuttgart: Klett-Cotta.Marx, A. (2003). <strong>Wirtschaftsethik</strong> – Eine Vorlesung von Prof. August Marx imSommersemester 1957. In Th. Bartscher & E. Gaugler (Hrsg.), <strong>Wirtschaftsethik</strong> – EineVorlesung von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. August Marx an der Wirtschaftshochschule(Universität) Mannheim im Sommersemester 1957 (1. Auflage, S. 2 – 116). Mannheim:Forschungsstelle für Betriebswirtschaft und Sozialpraxis e. V.60
LiteraturverzeichnisMayring, Ph. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (10. Auflage).Weinheim: Beltz.Noll, B. (2002). Wirtschafts- und Unternehmensethik in der Marktwirtschaft (1. Auflage).Stuttgart: W. Kohlhammer.Pieper, A. (2007). Einführung in die Ethik (6. Auflage). Tübingen: A. Francke.Quante, M. (2008). Einführung in die Allgemeine Ethik (3. Auflage). Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft.Riefenthaler, H. (2008). Kommunizierte <strong>Wirtschaftsethik</strong> (1. Auflage). Wien: LIT.Scherer, A., Blickle, K.-H., Dietzfelbinger, D. & Hütter, G. (2002). Globalisierung undSozialstandards: Problemtatbestände, Positionen und Lösungsansätze. In A. Scherer, K.-H. Blickle, D. Dietzfelbinger, G. Hütter (Hrsg.), Globalisierung und Sozialstandards(1. Auflage, S. 11 – 21). München: Hampp.Schiller, G. (2006). Wirtschaft im Gymnasium? Unterricht Wirtschaft, Heft 27, S. 52 – 56.Schnabel-Henke, H. (1995). <strong>Wirtschaftsethik</strong> an kaufmännischen Schulen: Eine<strong>Schulbuchanalyse</strong> in konstruktiver Absicht (1. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.Schnell, R., Hill, P. & Esser, E. (2005). Methoden der empirischen Sozialforschung(7. Auflage). München: Oldenbourg.Stein, G. (2001). Schulbücher in berufsfeldbezogener Lehrerbildung und pädagogischerPraxis. In L. Roth (Hrsg.), Pädagogik – Handbuch für Studium und Praxis (2. Auflage,S. 839 – 847). München: Oldenburg.Suchanek, A. (2007). Ökonomische Ethik (2. Auflage). Tübingen: Mohr Siebeck.Suchanek, A. (2006). Gewinnstreben und Moral. In H.-J. Kaatsch & H. Rosenau (Hrsg.),<strong>Wirtschaftsethik</strong>: Gesammelte Vorträge zur Ringvorlesung <strong>Wirtschaftsethik</strong> I/II(1. Auflage, S. 17 – 30). Berlin: LIT.Ulrich, P. (2008). Integrative <strong>Wirtschaftsethik</strong>: Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie(4. Auflage). Bern: Haupt.Weinbrenner, P. (1995). Grundlagen und Methodenprobleme sozialwissenschaftlicherSchulbuchforschung. In R. Olechowski (Hrsg.), Schulbuchforschung (1. Auflage, S. 21 –45). Frankfurt am Main: Lang.Weiß, R. & Gartz, M. (1998). Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen –Ergebnisse einer schriftlichen Befragung in vier Bundesländern. In R. Weiß (Hrsg.),Wirtschaft im Unterricht – Anspruch und Realität ökonomischer Bildung (1. Auflage,S. 45 – 214). Köln: div.61
LiteraturverzeichnisWiater, W. (2003). Das Schulbuch als Gegenstand pädagogischer Forschung. In W. Wiater,(Hrsg.), Schulbuchforschung in Europa – Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive(1. Auflage, S. 11 – 22). Bad Heilbrunn / Obb: Klinkhardt.Wieland, J. (2007). Ethik im Unternehmen – Ein Widerspruch in sich selbst? In P. Grimm &R. Capurro (Hrsg.), <strong>Wirtschaftsethik</strong> in der Informationsgesellschaft: Eine Frage desVertrauens? (1. Auflage, S. 71 – 80). Stuttgart: Steiner.Zimmerli, W. Ch. & Aßländer M. S. (2005). <strong>Wirtschaftsethik</strong>. In J. Nida-Rümelin (Hrsg.),Angewandte Ethik: Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch(2. Auflage, S. 302 – 384). Stuttgart: Alfred Kröner.Schulbuchverzeichnis:Baba, A., Baba, S., Braun, M., Christiansen, A., Hesse, K., Huster, S., …, Schönwald, E.(2008). Wirtschaft Recht (K. Hesse & S. Huster, (Hrsg.), 1. Auflage). Berlin: DudenPaetec.Bauer, M., Riedel, H., Thull, B. & Wissel, M. (2005). Wirtschaft und Politik im Zeitalterder Globalisierung (1. Auflage). Bamberg: C. C. Buchner.Geisler, U., Mühler, K. & Voigt, G. (2006). Gesellschaft verstehen und handeln (U. Geisler,(Hrsg.), 1. Auflage (Nachdruck)). Leipzig: Militzke.Herzig, K., Keßner-Ammann, U., Kübler, G. & Schaechterle, L. (2006). Politik imWandel. Politische Institutionen und Prozesse in der Demokratie. Kursstufe 1 (K. Herzig& U. Keßner-Ammann (Hrsg.), 1. Auflage). Paderborn: Schöningh.Herzig, K., Keßner-Ammann, U., Kübler, G. & Schirrmeister, J. (2007). Politik imWandel. Wirtschaftswelt und Staatenwelt. Kursstufe 2 (K. Herzig & U. Keßner-Ammann(Hrsg.), 1. Auflage). Paderborn: Schöningh.Jöckel, P. (2009). Politik und Wirtschaft 11/12 Niedersachsen Oberstufe. Berlin: Cornelsen.Tschirner, M., Bauer, M., Kailitz, St., Kailitz S., Riedel, H. & Brügel, P. (2008).Kompendium Politik. Politik und Wirtschaft für die Oberstufe (1. Auflage). Bamberg: C.C. Buchner.Internetquellen:Bundesverband deutscher Banken (2009). Jugendstudie 2009 – Wirtschaftsverständnis undFinanzkultur. Verfügbar unter: http://www.bankenverband.de/pic/artikelpic/072009/2009-07-03_Demoskopie_Jugendstudie_BDB.<strong>pdf</strong> (letzter Zugriff: 02. Okt. 2009).Fakultät für Betriebswirtschaft (2009). Stiftungsprofessur für „Corporate Governance“ ander Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim. Verfügbar unter:http://www.bwl.uni-62
Literaturverzeichnismannheim.de/de/presse/pressemitteilungen/article/2009/07/12/stiftungsprofessur_corporate_governance_an_der_fakultaet_fuer_betriebswirtschaftslehre_der_universit/ (letzterZugriff: 01. Okt. 2009).FAZ (2009). Wirtschaft braucht Ethik. Verfügbar unter:http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~ED30D6B30FCE94372943F5199846F24DC~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell (letzterZugriff: 10. Juli 2009).Huber, W. (2009). Statement zur Pressekonferenz zum Wort des Rates der EKD zurFinanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Verfügbar unter:http://www.ekd.de/aktuell/090702_huber_pk_wirtschaftswort.html (letzter Zugriff: 10.Juli 2009).INSM (2009). Bildungsmonitor 2009 – Gesamtranking. Verfügbar unter: http://www.insmbildungsmonitor.de/(letzter Zugriff: 23. Aug. 2009).INSM, Plünnecke, A., Riesen, I., Stettes, O. & IW Köln (2009). Bildungsmonitor 2009 –Forschungsbericht. Verfügbar unter: http://www.insmbildungsmonitor.de/files/downloads/Bildungsmonitor%202009_Forschungsbericht.<strong>pdf</strong>(letzter Zugriff: 23. Aug. 2009).INSM, Plünnecke, A., Riesen, I., Stettes, O. & IW Köln (2009). Bildungsmonitor 2009 –Forschungsbericht (Kurzfassung). Verfügbar unter:http://www.insmbildungsmonitor.de/files/downloads/Bildungsmonitor_2009_Kurzbericht.<strong>pdf</strong>(letzterZugriff: 23. Aug. 2009).Landesbildungsserver Baden-Württemberg (2009). Bildungsstandard für Wirtschaft anallgemein bildenden Gymnasien. Verfügbar unter: http://www.bildung-staerktmenschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/Gym/Gym_W_bs.<strong>pdf</strong>(letzter Zugriff:01. Okt. 2009).Landesinstitut für Schulentwicklung (2007). Schulbuchzulassung: Merkblatt fürSchulbuchverlage über die Zulassungsvoraussetzungen von Schulbüchern für allgemeinbildende und berufliche Schulen in Baden-Württemberg. Verfügbar unter:http://www.schule-bw.de/service/schulbuchlisten/verlage/merkblatt.<strong>pdf</strong> (letzter Zugriff:30. Aug. 2009).Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2004). Bildungsplan2004 Allgemein bildendes Gymnasium von Baden-Württemberg. Verfügbar unter:http://www.bildung-staerktmenschen.de/service/downloads/Bildungsplaene/Gymnasium/Gymnasium_Bildungsplan_Gesamt.<strong>pdf</strong> (letzter Zugriff: 10. Juli 2009).Niedersächsischer Bildungsserver (2009). Niedersächsisches Schulbuchverzeichnis2010/2011 mit dem Erlass zur Genehmigung, Einführung und Benutzung vonSchulbüchern in den allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen Niedersachsensvom 07.07.2000. Verfügbar unter: http://www.nibis.de/nli1/sbv/Schulbuchverzeichnis.<strong>pdf</strong>(letzter Zugriff: 30. Aug. 2009).63
LiteraturverzeichnisNiedersächsisches Kultusministerium (2007). Kerncurriculum für das Gymnasium –gymnasiale Oberstufe, die Gesamtschule – gymnasiale Oberstufe, das Fachgymnasium,das Abendgymnasium, das Kolleg für das Fach Politik – Wirtschaft. Verfügbar unter:http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_go_powi_07_nib.<strong>pdf</strong> (letzter Zugriff: 01. Okt.2009).Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) (2004).Info – Service Medien, Kommunikation, Wissenstransfer Januar/Februar 2004. Verfügbarunter: http://www.nibis.de/nli1/chaplin/materialien/gesamtinfo_jan_2004.<strong>pdf</strong> (letzterZugriff: 30. Aug. 2009).Papst Benedikt XVI (2009). Sozialenzyklika. Verfügbar unter: http://www.stuttgarterzeitung.de/media_fast/1203/2009-089a_caritas_in_veritate-dt.<strong>pdf</strong>(letzter Zugriff: 10. Juli2009).Sächsisches Bildungsinstitut (2009). Schulbuchzulassung. Verfügbar unter:http://www.sachsen-macht-schule.de/schule/104.htm/ (letzter Zugriff: 30. Aug. 2009)Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2004/2007/2009). Lehrplan GymnasiumGemeinschaftskunde / Rechtserziehung / Wirtschaft. Verfügbar unter:http://www.sachsen-machtschule.de/apps/lehrplandb/downloads/lehrplaene/lp_gy_gemeinschaftskunde_rechtserziehung_wirtschaft_2009.<strong>pdf</strong> (letzter Zugriff: 01. Okt. 2009).SchbZulVO (1997). Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über dieZulassung von Schulbüchern (Schulbuchzulassungsverordnung) vom 07.10.1997.Verfügbar unter: http://www.revosax.sachsen.de/GetXHTML.do?sid=902551934855(letzter Zugriff: 30. Aug. 2009).SchbZulVO (2007). Verordnung des Kultusministeriums über die Zulassung vonSchulbüchern (Schulbuchzulassungsverordnung) vom 11. Januar 2007. Für Baden-Württemberg. Verfügbar unter: http://www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulBZulV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true (letzter Zugriff: 30. Aug. 2009).SchG (1983). Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August1983). Verfügbar unter: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/uxc/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-SchulGBW1983rahmen%3Ajurislr00&showdoccase=1&documentnumber=1&numberofresults=153&doc.part=X&doc.price=0.0¶mfromHL=true#focuspoint (letzter Zugriff: 30. Aug. 2009).Sitte, W. (1998). Wirtschaftserziehung. Verfügbar unter: http://www.phlinz.at/ZIP/didaktik/gw/wirt/wirt.HTM#gegenstand(letzter Zugriff: 01. Okt. 2009).Woltering, M. (2009). Wirtschaft braucht Ethik. Verfügbar unter:http://www.openpr.de/<strong>pdf</strong>/190489/Mittelstand-Wirtschaft-braucht-Ethik.<strong>pdf</strong>(letzter Zugriff: 10. Juli 2009).64
ANHANGAnhang I: Auszüge aus den SchulbuchlistenSchulbuchliste für Baden-Württemberg65
Anhang66
Anhang67
AnhangSchulbuchliste für Niedersachsen68
Anhang69
Anhang70
AnhangSchulbuchliste für Sachsen71
Anhang72
Anhang73
Anhang74
AnhangAnhang II: Übersichtsliste der zulässigen Schulbücher75
Anhang76
AnhangAnhang III: Inhaltsverzeichnisse der ausgewählten SchulbücherA. Buch A – Buchners Kompendium Politik77
Anhang78
AnhangB. Buch B – Wirtschaft und Politik: Im Zeitalter der Globalisierung79
Anhang80
AnhangC. Buch C – Duden Wirtschaft – Recht81
Anhang82
Anhang83
Anhang84
Anhang85
Anhang86
AnhangD. Buch D – Politik im Wandel: Politische Institutionen und Prozesse in derDemokratie87
Anhang88
AnhangE. Buch E – Politik im Wandel: Wirtschaftswelt und Staatenwelt89
Anhang90
AnhangF. Buch F – Politik und Wirtschaft91
Anhang92
AnhangG. Buch G – Gesellschaft verstehen und handeln93
Anhang94
AnhangAnhang IV: Fundstellen zu den einzelnen Ergebnissen (Kapitel 5.1)Kategorie 1: Ethische GrundlagenBuch Seite Textstelle1. Werte, Wertvorstellungen und NormenA 9 „Von der Norm zu unterscheiden sind die gesellschaftlichen Werte, die als Grundprinzipienoder als Leitbilder der Handlungsorientierung dienen. Die Werte beinhalten die in derGesellschaft oder auch innerhalb einer bestimmten Gruppe anerkannten gemeinsamenZielsetzungen. So ist beispielsweise die Demokratie als Wert weithin anerkannt. Um diesenWert zu verwirklichen, sind bestimmte Normen erforderlich. Dazu zählen u. a.Mehrparteiensystem, Gewaltenteilung, rechtsstaatliche Verfahren, freie und geheime Wahlenusw.“AAA 66 /67190 "Unter dem Begriff Gemeinwohl wird ein Gesamtinteresse der Bevölkerung, der Nutzen für diegesamte Gesellschaft verstanden. […] Während der politische Philosoph Jean-JacquesRousseau von einem vorgegebenen Gemeinwohl ausging, erklären Vertreter derPluralismustheorie, dass sich das Gemeinwohl nur aus einem freien und fairen Prozess derstaatlichen Willensbildung unter Einbeziehung der Interessengruppen ergeben könne. [...]"329 "Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechteeinschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allenMitgliedstaaten einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit von Männern undFrauen auszeichnet."Die sogenannten Sigma-Milieus bilden ein weiteres Modell sozialer Schichtung. Es gibt diegegenwärtigen Milieustrukturen in Deutschland, einschließlich der derzeitigen Milieugröße,wieder. Etabliertes Milieu: Konservatives Elitemilieu mit traditioneller Lebensführung.Selbstverständnis als Führungsschicht und Leistungsträger-Bewusstsein. Die Angehörigen desEtablierten Milieus sehen sich häufig als Wahrer kultureller und moralischer Werte undTraditionen. Wichtig: distinguierter Lebensstil, gute Umgangsformen, Understatement undDiskretion. Traditionelles bürgerliches Milieu: Milieu, das an traditionellen Werten,Moralvorstellungen, sozialen Regeln und Konventionen festhält. [...] Wichtig: geordnetefinanzielle und familiäre Verhältnisse. Sicherheit, angemessener (bürgerlicher)Lebensstandard. Traditionelles Arbeitermilieu: [...] Konsum-materialistisches Milieu: [...]Aufstiegsorientiertes Milieu New Money: [...] Liberal-intellektuelles Milieu: [...] Modernesbürgerliches Milieu: [...] Modernes Arbeitnehmermilieu: [...] Hedonistisches Milieu: [...]Postmodernes Milieu: [...]." Alle Schichten werden definiert und die wichtigen Werte genannt.A 8 "Die Erwartungen an das Handeln von Menschen innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet manauch als soziale Normen. Normen sind bestimmte Regeln, die von der Allgemeinheit anerkanntwerden: einander bekannte Menschen grüßen sich, bei Theateraufführungen und Konzertenverhält man sich ruhig usw. Alle diese Normen werden als selbstverständlich befolgt, ohne dasssie schriftlich fixiert sind. […]“A312 "Das Rechtssystem ist ein System verbindlicher Normen und Regeln in einem Staat. DerStaatsapparat hat das Gewaltmonopol, d.h., allein der Staat hat die Möglichkeit, die Verletzungder verbindlichen Normen und Regeln zu ahnden. Zu klären, ob ein Rechtsverstoß vorliegt undwie schwer dieser ist, ist Aufgabe der Gerichte. Sie regeln auf Grundlage der Gesetze auchKonflikte zwischen Bürgern oder zwischen Staat und Bürgern. Erst ein Rechtssystem ermöglichtdie friedliche Regelung von Konflikten. [...]"B 34 "[…] Die offene Zusammenarbeit, eine kompromisslose Geschäftsintegrität, Innovations- undLeistungsorientierung, Mitbeteiligung am Gewinn und Kapital für alle Beschäftigten sindWerte, die jedes Unternehmen aufstellen kann. Dazu brauchen wir keine neuen Gesetze,Bundestarife, Quoten oder Ideologen. [...]"B 205 "Ihre Organisationsform ist ein Netzwerk mit einer Reihe wechselseitig abhängiger undgeographisch verteilter Zentren, die von gemeinsamen Strategien, Normen und einemintensiven Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ressourcen zusammengehaltenwerden. [...]"95
AnhangBBC210 "[…] Die ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungsländern fallen umso höher aus, jebesser die demokratischen Rechte und die Arbeitsnormen, etwa das Verbot von Kinderarbeit,ausgestaltet sind. […]"288 "[…] Regeln bieten Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Sicherheit. Regeln liefern Informationen,wie sich andere verhalten sollen und wie sie sich bei hinreichender Regeldurchsetzungtatsächlich verhalten. […]"207 "Gerechtigkeit und Sicherheit sind ebenfalls als wirtschaftspolitische Grundziele zu nennen.Gerechtigkeit ist ein komplexer und daher nicht abschließend zu definierender Begriff. Eswerden verschiedene Gerechtigkeitskonzepte unterschieden: Leistungsgerechtigkeit [...]Chancengerechtigkeit [...] Ergebnisgerechtigkeit [...]. Sicherheit bedeutet aus wirtschaftlicherSicht die soziale Absicherung für alle Mitglieder der Gesellschaft gegen Not und Härtefälle."C 91 "Die soziale Komponente beinhaltet die Verpflichtung, Löhne und Gehälter zu zahlen, Steuernzu entrichten, das Leben und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützenund für ein Betriebsklima zu sorgen, das Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht und die Würdejedes Einzelnen gewährt."C 15 "Verhalten als rationales Handeln (Grafik). Was hat Vorrang? Wertvorstellungen, Abwägender Vor- und Nachteile, Entscheidung für höchsten Nutzen"C 29 "Der Begriff Arbeit hat im sozialen Wertesystem einen enormen Wandel erfahren."C 78 "Der Entwicklungsstand der Volkswirtschaft, die Rechtsordnung, Wertevorstellungen,geografische und klimatische Faktoren sowie weitere Bedingungen beeinflussen Gegenstandsowie Art und Weise der Produktion. [...] Die Werte und Normen, die für die Gesellschaftgelten, sind auch für die Unternehmen charakteristisch."C 79 "Normen regeln die Beziehungen zwischen den Wirtschaftsteilnehmern. Viele dieser Normensind rechtlich in Gesetzen festgelegt."CC300 "Alle menschlichen Gesellschaften besitzen Regeln, die ein gedeihliches Zusammenlebengewährleisten und fördern sollen. Diese Regeln beinhalten die Rechte und Pflichten dereinzelnen Personen zueinander und formen so die Handlungsspielräume und deren Grenzen.Um dieses Zusammenleben ordnend zu gestalten, müssen die Regeln von möglichst allenMitgliedern anerkannt und respektiert werden. Darüber hinaus ist es notwendig, für dieEinhaltung der Regeln Sorge zu tragen, so dass im Falle der Regelverletzung Sanktionenerfolgen müssen. [...] All diese Regeln sind Inhalt von Rechtsnormen, die in Verfassungen,Gesetzen, Verordnungen zum Ausdruck kommen. In diesem Sinne verstehen wir unter Recht einverbindliches System von Normen."306 "Rechtliche Normen (anstelle von "Rechtsnorm" kann auch vom "Rechtssatz" gesprochenwerden) bestimmen das Verhalten von Menschen in einer Gesellschaft. Sie enthaltenVerpflichtungen zu einem Tun oder auch Unterlassen."D 30 "Man spricht von Zivilcourage wenn jemand offen, ohne Rücksicht gegen sich selbst, gegenUnrecht eintritt und die Werte der Gesellschaft und der Demokratie verteidigt."D 51 "Grundprogramme enthalten die Grundwerte der Partei und legen den längerfristigenOrientierungsrahmen für politisches Handeln fest."D 48 "Parteien legitimieren sich dadurch, dass sie für bestimmte Richtungen, Ideen undWertvorstellungen einstehen, die sie im Kampf um die Macht zu verwirklichen streben."D 17 "Eine zweite Art von Theorien geht davon aus, wie etwas sein sollte (sog. normative Theorien,von Norm = Richtschnur oder Regel)."D 19 "Freilich darf keine "Tyrannei der Mehrheit", die demokratische Spielregeln verletzt, ausgeübtwerden, weil auch die Mehrheit vor Unzulänglichkeit nicht gefeit ist."D 91 "Jedes Gemeinwesen braucht feste Regeln, nach denen es bestehen und sich friedlichfortentwickeln kann. Die zahllosen unterschiedlichen Wünsche, Vorstellungen und Interessender Bürger sollen sich in Freiheit entfalten und verwirklichen können - aber nicht in Freiheitauf Kosten des anderen oder des Schwächeren, sondern in geordnetem Nebeneinander undMiteinander mit dessen Freiheit und dessen Interessen. Also muss es allgemein geltende Regelngeben, bindend für jeden Bürger, bindend auch für das Handeln der Behörden. [...] Diebedeutendsten davon enthält die Verfassung, bei uns das Grundgesetz der BundesrepublikDeutschland."EE146 "Sein Ziel ist es, durch das freiwillige Akzeptieren und Durchsetzen globaler Werte imVerantwortungsbereich seiner Mitglieder einen grundlegenden Beitrag zur Gestaltung derGlobalisierung im Sinne von Frieden und Wohlstand in der Welt zu leisten."119 "Aber [es bedarf] ganz außerordentlicher Anstrengung, um jene übergeordneten, enge Räumeübergreifenden, dauerhaften Wertorientierungen, Einstellungen und Mentalitäten zu schaffen,96
Anhangdie auch in Großräumen eine konstruktive Konfliktbearbeitung und damit friedliche Koexistenzim Sinne stabilen Friedens kognitiv und emotional absichern könnten."E 39 "Zur Erreichung dieses Ziels kommen zwei Wege in Betracht: zum einen die Verankerung vonStandards in internationalen Organisationen, zum andern Verhaltensregeln (Kodizes), dieKonzerne und Verbände einsetzen und auch kontrollieren. […] Ob und inwieweit das Bündnisverbindliche Normen setzen wird, ist noch nicht absehbar."E147 "Das zentrale Credo der „Weltföderalisten“ lautet, dass dauerhafter Frieden eine Weltordnungvoraussetzt, in der die staatliche Souveränität so weit eingeschränkt ist, dass durch eine dennationalen Regierungen übergeordnete Vollzugsgewalt globale Rechtsnormen unmittelbargegen Individuen und Gruppen durchsetzbar sind" [= sog. Global Government]."E 41 "Zudem bräuchte es „verbindliche Spielregeln für wirtschaftliches Wachstum“, etwa auf WTOoderUNO-Ebene."F214 "Gesellschaftliche Grundwerte finden sich zum Beispiel im Grundgesetz, in Gesetzestexten, inpolitischen Programmen sowie in Reden von Parlamentariern, Regierungsvertretern oderanderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Grundwerte stellen Werturteile dar undunterscheiden sich damit von Sachurteilen: [...] Werturteile beziehen sich dagegen auf das, wassein soll. [...] Es muss erkennbar sein, welche Aussagen Werturteile und welche Sachurteilesind. Dies ist die Forderung nach "Werttransparenz". [...]"F 57 "[…] [Sie] erfolgt durch die Identifikation fundamentaler Wertorientierungen, die die jeweiligvorherrschenden Lebensstile und Lebensstrategien bestimmen. Und auch die Einstellungen zuArbeit, Familie oder Konsumverhalten werden dabei genauso einbezogen wieWunschvorstellungen, Ängste oder Zukunftserwartungen."F 80 "Wie jede Politik ist auch die Wirtschaftspolitik von unterschiedlichen, z. T. kontroversen,Wertvorstellungen geleitet und unterliegt dem politischen Prozess. […]"F 46 "Ein richtig verstandener Pluralismus ist sich der Tatsache bewusst, dass das Mit- undNebeneinander der Gruppen nur dann zur Begründung eines a posteriori-Gemeinwohls zuführen vermag, wenn die Spielregeln des politischen Wettbewerbs mit Fairneß gehandhabtwerden, wenn die Rechtsnormen, die den politischen Willensbildungsprozess regeln,unverbrüchlich eingehalten werden, und wenn die Grundprinzipien gesitteten menschlichenZusammenlebens uneingeschränkt respektiert werden, die als regulative Idee den Anspruch aufuniversale Geltung zu erheben vermögen."GGGGG129 "Sozialisation bezeichnet den Prozess, durch den ein Individuum in eine Gruppe eingegliedertwird, indem es die in der Gruppe geltenden Normen in sich aufnimmt. Über die Sozialisationeignet sich das Individuum auch die Erwartungen der Gruppe, die zur Erfüllung der Normerforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die zur Kultur der Gruppe gehörendenWerte und Überzeugungen an. [...] Wichtiger Gegenstand der Sozialisation sind soziale Werte.Die sozialen Werte einer Gemeinschaft oder einer Gruppe drücken Orientierungen,Gewünschtes, Geschätztes im moralischen Sinne aus."141 "Entfaltungswerte: individuelle Freiheit, Selbstverwirklichung, Kritik, Zweifel, Spaß, geistigerWandel; Pflichtwerte: Disziplin, Anpassungsfähigkeit, Höflichkeit, unbedingte Achtung vorRecht und Gesetz, Achtung von Autorität und Eigentum, Mäßigung, Achtung der Tradition."129 "Darunter versteht man Regeln, Normen des Zusammenlebens und Organisationen (Schule,Betrieb, Gemeinde usw.). […] Sozialisation bezeichnet den Prozess, durch den ein Individuumin eine Gruppe eingegliedert wird, indem es die in der Gruppe geltenden Normen in sichaufnimmt. Über die Sozialisation eignet sich das Individuum auch die Erwartungen der Gruppe,die zur Erfüllung der Norm erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die zur Kulturder Gruppe gehörenden Werte und Überzeugungen an. [...]"285 "Normen sind im gesellschaftlichen Leben Bestimmungen zur Regelung oder Regulierung desHandelns von Menschen und sozialen Gruppen. Sie treten mit dem Anspruch auf sozialeVerbindlichkeit auf. Sie besitzen Anforderungscharakter. Ihre Einhaltung oder Durchsetzungwird durch gesellschaftliche Sanktionen verschiedener Art gesichert."135 "Normen sind Verhaltensstandards, deren Einhaltung über Sanktionen (Bestrafung) erzwungenwerden kann. Über sie wird das Zusammenleben in der Gesellschaft reguliert. Nicht alleNormen treten jedoch mit der gleichen Verbindlichkeit auf. Die Sanktionen sind sowohlqualitativ als auch in ihrer Härte unterschiedlich. So unterscheiden wir u. a. zwischenRechtsnormen und Sittennormen. Rechtsnormen sind soziale Normen, die vom Staat kraft seineralleinigen Sanktionsgewalt geschützt werden. Ihre Einhaltung ist für jeden Bürger verbindlich.Hinter ihnen steht das Gewaltmonopol des Staates. Über die Einhaltung von Sittennormenwacht die öffentliche Meinung. Ihre Verletzung ist nicht Gegenstand polizeilicher Verfolgung97
Anhangund juristischer Ahndung. [...]"2. Moral und EthikA 66 "Traditionelles bürgerliches Milieu: Milieu, das an traditionellen Werten, Moralvorstellungen,sozialen Regeln und Konventionen festhält. [...]"A 13 "Merkmale von Gruppen. Die sozialen Gruppen sind die Bausteine der Gesellschaft. TypischeMerkmale einer sozialen Gruppe sind: - gemeinsame Interessen und Ziele, - ein gemeinsamesNormen- und Wertesystem, - unterschiedliche aufeinander bezogene Rollen und Positionen, -ein "Wir-Gefühl". [...]" Weitere Erläuterungen zu Gruppentypen und Gruppenrollen folgen.AABBB 288 /289C329 "Die EU als Wertegemeinschaft. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtungder Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrungder Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören.Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durchPluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit vonMännern und Frauen auszeichnet."159 "Globalisierung die Vernetzung der Welt […] Ethische Aspekte: - Ethik des Wirtschaftens […]"In einer Grafik enthalten.288 "[...] Für die moralische Bewertung müssen wir unter modernen Bedingungen unserePerspektive verändern. Im Fokus stehen nicht die Akteure, die scheinbar moralische Übelverursachen, sondern die Regeln: Sind sie unzureichend, unvollständig oder kontraproduktiv,belohnen sie unerwünschtes Verhalten, zum Beispiel die Korruption durch steuerlicheAbsetzbarkeit von Bestechungsgeldern? Ob die Akteure aus Eigeninteresse, aus reinemGewinnstreben oder aus altruistischen Motiven handeln, ist dagegen nicht Gegenstand derBewertung. [...]290 "[…] in Institutionen als normative Muster oder Regelungen (z.B. die Vereinheitlichung vonMaßen und Gewichten; die Standardisierung von Zahlungsmitteln; die Verabredung vongeschriebenen [z.B. Gesetzen] und/oder ungeschriebenen [z.B. Tradition, Sitte, Moral]Rechtsgrundsätzen, die bei der Durchführung von Transaktionen zu beachten sind); [...]""[…] Tatsächlich lässt sich auch in einer Ordnungsethik, die auf dem Kerngedanken derRegelsteuerung moderner Gesellschaften aufbaut, ein theoretischer Ort für praktischeUnternehmensethik finden. Unternehmensethik lässt sich aufbauen auf dem Gedanken, dassInteraktion durch Regeln und Verträge nicht vollständig bestimmt ist. […] Die Verlässlichkeitwechselseitiger Verhaltenserwartung wird hier nicht durch formelle Regeln wie in der<strong>Wirtschaftsethik</strong> hergestellt, sondern durch Selbstbindung der beteiligten Unternehmen. [...]Sind die hier vorgestellten Konzeptionen von <strong>Wirtschaftsethik</strong> als Ordnungsethik und vonUnternehmensethik auf der Basis unvollständiger Verträge mit der Tradition derabendländischen Ethik kompatibel? [...] Die Ethik hingegen muss sich stärker daraufkonzentrieren, Normen nicht nur zu begründen, sondern auch Wege zu ihrer Durchsetzung zuentwerfen."300 "In diesem Sinne kann Recht als Teil der kulturellen Identität einer Gemeinschaft angesehenwerden."E 39 "Aus der „Eine-Welt-Bewegung“ heraus sind inzwischen auch zahlreiche Gütesiegelentstanden, die garantieren, dass die Produkte unter ethisch einwandfreien undsozialverträglichen Produktionsbedingungen hergestellt werden."E 79 "Die Mehrheit, das Volk, die Gesellschaft ist jetzt gefordert, gegen das rücksichtslosewettbewerbsbesessene Treiben der Wirtschaftseliten ethische Grundsätze formulieren […], eineüberlebensfähige Zukunft für kommende Generationen zu sichern."F 95 "[…] Die Nachhaltigkeitsdiskussion will u. a. die Frage beantworten, wie diese Anforderungenerfüllt werden können. Angestrebt wird ein Gleichgewicht zwischen den beiden SystemenÖkonomie und Ökologie, das ethischen Kriterien genügen soll."FF140 "[…] Den Feinden wurden zwei Angriffsarten unterstellt: Zum einen besetzten sie mit ihrenSoldaten muslimische Länder und unterdrückten die Bevölkerung (physischer Angriff). Zumanderen übertrugen sie ihre Werte und Verhaltsmuster auf muslimische Staaten undunterdrückten damit deren einheimische Kultur (psychischer Angriff)."245 "[…] die Verbreitung bestimmter kultureller Muster über elektronische Medien (Entstehungeiner "Weltkultur") […]"G 35 "Nur derjenige handelt sittlich und wahrhaft menschlich, der sich aktiv für den Sieg desSozialismus einsetzt [...] Das moralische Gesicht des neuen sozialistischen Menschen, der sich98
AnhangGGin diesem edlen Kampf um den Sieg des Sozialismus entwickelt, wird bestimmt durch dieEinhaltung der grundlegenden Moralgesetze: 1. Du sollst dich stets für die internationaleSolidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen sowie für die unverbrüchlicheVerbundenheit aller sozialistischen Länder einsetzen. [...] Diese Moralgesetze, diese Gebotesind ein fester Bestandteil unserer sozialistischen Weltanschauung."129 "Die sozialen Werte einer Gemeinschaft oder einer Gruppe drücken Orientierungen,Gewünschtes, Geschätztes im moralischen Sinne aus."281 "Die Vertreter der Aufklärung traten für Meinungsfreiheit und Toleranz ein und hielten diemenschliche Vernunft für die einzige Instanz, um sowohl über die Wahrheit als auch überNormen ethischen, politischen und sozialen Handelns zu entscheiden."3. Gesellschaftlicher (Werte-) WandelA 8 "Normen können zwischen verschiedenen Gesellschaften, aber auch innerhalb einerGesellschaft und von Gruppe zu Gruppe variieren und unterliegen einem historischen Wandel.Ein gutes Beispiel hierfür ist das Rauchen: War es in der 1950er Jahren gesellschaftlich nochvollständig anerkannt und unproblematisch, in öffentlichen Räumen eine Zigarette anzuzünden,werden Raucher heutzutage auf Raucherzonen verwiesen. Die Trennung zwischen RaucherundNichtraucherzonen galt damals noch nicht als Norm. Viele Normen sind als Gesetze oderVerordnungen schriftlich fixiert und dadurch formalisiert. Ein solches Normensystem nennenwir Recht."A 39 "Der Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit seit dem Ende der 1960er Jahre hat Millionen vonFrauen die finanzielle Unabhängigkeit gebracht und ist auch Ausdruck eines tiefgreifendengesellschaftlichen Wertewandels, der die Einstellung zur Familie deutlich verändert hat. DieFamilie ist ein Ort, der partnerschaftliche Beziehungen, Unabhängigkeit und Selbstentfaltungermöglichen soll und die Selbstaufopferung der Frau für die Familie in der Regel abgeschaffthat. An die Ehe werden dadurch immer neue und höhere Anforderungen gestellt. Sie wirdhäufig nicht mehr als eine Lebensgemeinschaft auf Dauer gesehen, sondern vielmehr alsLebensabschnittspartnerschaft. Die Ehe hat als Lebensform nicht an Bedeutung verloren,lediglich ist die Bereitschaft der Menschen geringer geworden, eine unglückliche Ehe zuführen."B 37 /38B 128 /155"[...] Es ist Sache der Politik, dieses Maß auszutarieren und den ökonomischen wiegesellschaftlichen Notwendigkeiten anzupassen. Stete Reformbedürftigkeit kennzeichnet denSozialstaat, der auf gesellschaftlichen Wandel wie neue Bedürfnisstrukturen zu reagieren hat,damit der soziale Ausgleich, den er bewirken soll, nicht selbst neue Schieflagen erzeugt. [...]""[…] Deutschland unterliegt (wie viele andere Staaten auch) einem gewaltigen wirtschaftlichenStrukturwandel vom produzierenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor. […] Die durch dentechnologischen Fortschritt oder gesellschaftliche Wandlungsprozesse ausgelöstenVeränderungen der Wirtschaft umschreiben wir mit dem Begriff Strukturwandel.Strukturwandel ist nichts Neues. Umwälzende Veränderungen. wie der Übergang von derAgrar- zur Industriegesellschaft, haben mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhunderteingesetzt und setzen sich heute im Übergang von der Industrie- zur Informations- undDienstleistungsgesellschaft beschleunigt fort. [...]"C 29 "Der Begriff Arbeit hat im sozialen Wertesystem einen enormen Wandel erfahren. Der Wandeldes Inhalts der Arbeit ist eng mit der Evolution des Menschen und der gesellschaftlichenEntwicklung verbunden. […] Mit Beginn der Industrialisierung erfuhr Arbeit eine weitere tiefgreifende Veränderung. [...] Arbeit und Gesellschaft sind seit der Industrialisierung vorwiegenddurch die Entwicklung der Technik einem dynamischen Wandel ausgesetzt. Dieser Wandelbetrifft die Arbeit unmittelbar und führt in Gesellschaft und Wirtschaft zu Strukturwandlungen.[...]"C 34 "Die Globalisierung und der zunehmende härtere Wettbewerb auf allen Märkten beschleunigtdie Veränderung der Berufs- und Arbeitswelt. Mit diesem Wandel verbunden sind neue und ofthöhere Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeitskräfte."C300 "Das Recht kann sich im Laufe der Zeit verändern, die einmal gefassten Normen sind nichtStarres. Sie passen sich an neue gesellschaftliche, wirtschaftliche oder auch technischeEntwicklungen an."E 11 "Vor dem Hintergrund des gewaltigen Wandels in jüngster Vergangenheit sind die Gefühlevieler Menschen zwiespältig. Zum einen löste die Globalisierung am Anfang derNeunzigerjahre eine weltweite Aufbruchsstimmung aus. Zum anderen lösten das rasche Tempound die Auswirkungen der Veränderungen Unsicherheit und Ängste aus, zumal gerade aus den99
Anhangklassischen Industrieländern viele Arbeitsplätze ins billigere Ausland verlagert wurden."F 63 "[…] Sie können auch die "schwierigeren", individualistischen und anspruchsvollenBürgerinnen und Bürger der Wertewandel-Generationen für politische Teilhabe aktivieren, diezwar durchaus Verantwortung in der Politik übernehmen wollen, aber in Dingen, die siepersönlich betreffen, auch direkt ungefiltert durch Parteien ihre Meinung einbringen wollen.[...]"F 69 "Der gesellschaftliche Wandel verläuft immer kapitalistischer. Er wird zunehmend von denKräften und Entscheidungsträgern der Wirtschaft gesteuert, die sich ausschließlich am Gewinnund an eigenen Wettbewerbsvorteilen orientieren und davon träumen, sie könnten ihregesamten Wettbewerber verdrängen. [...]"F 126 /127GG"Strukturwandel ist - ob politisch gefördert oder gebremst - Kennzeichen einer Marktwirtschaft.[…] Parallel dazu vollzog sich ein gesellschaftlicher und mentaler Wandel. Der steigendeLebensstandard veränderte die Kultur- und Freizeitinteressen der Menschen im Ruhrgebiet.[...]"137 "Mit der Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen, z. B. wirtschaftlichem Aufschwungund technischen Innovationen, verändern sich auch die Werte, welche die Menschen in diesenGesellschaften anerkennen und die ihnen als Orientierung dienen. In der wissenschaftlichenDiskussion wird dieser Vorgang unter verschiedenen Aspekten erklärt. [...] In den 70-er Jahrenstellte der Sozialwissenschaftler Inglehart fest, dass in den am weitesten entwickeltenwestlichen Ländern ein tiefgreifender Wandel in den Grundorientierungen der Bevölkerung vonmaterialistischen zu postmaterialistischen Werten zu beobachten ist. Ausgelöst durchwirtschaftliche Konjunktur und wissenschaftlich-technische Fortschritte, legen die Menschenweniger Wert auf materielle Dinge. Die materiellen Bedürfnisse verschwinden natürlich nicht.Auch postmaterialistisch orientierte Menschen haben Hunger, Durst, brauchen Kleidung, aberdiese Bedürfnisse dominieren nicht mehr ihr Handeln. Sie wünschen sich eher Demokratie, einesaubere Umwelt und freundliche Mitmenschen. [...]"286 "Sozialer Wandel ist die Bezeichnung sowohl für grundlegende Veränderungen der gesamtenSozialstruktur der Gesellschaft (z. B. Übergang von der Stände- zur Klassengesellschaft) alsauch innerhalb einer bestehenden Struktur (z. B. Veränderungen der sozialen Schichtung)."Kategorie 2: Ökonomische GrundlagenBuch Seite Textstelle1. Soziale Marktwirtschaft und WirtschaftsakteureA 82 / "[...] Diese liberale Geisteshaltung auf die Wirtschaft übertragen nennt man84 Wirtschaftsliberalismus. Die dem Wirtschaftsliberalismus gemäße Wirtschaftsordnung ist die„Freie Marktwirtschaft“. [...] In der freien Marktwirtschaft haben die privaten Entscheidungender Wirtschaftsakteure Vorrang. Der Staat hat lediglich die Aufgabe, ein Zahlungsmittelbereitzustellen und das Rechtssystem zu erhalten. Die Konsumenten entscheiden frei über Art,Umfang und Rangfolge der Bedürfnisse. [...] Das Modell der freien Marktwirtschaft basiert aufseinen Gedanken und fordert die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte, dieselbstständig und eigenverantwortlich eine unübersehbare Anzahl von WirtschaftsplänenA 82/88aufstellen - die privaten Haushalte Konsumpläne und die Unternehmen Produktionspläne. [...]""[…] In der Zentralverwaltungswirtschaft hingegen werden alle wirtschaftlichenEntscheidungen von staatlichen Stellen geplant. […] In der Zentralverwaltungswirtschaftwerden alle wirtschaftlichen Entscheidungen von staatlichen Stellen im Rahmen einesGesamtplans zentral festgelegt. Der Staat ermittelt den Gesamtbedarf der Volkswirtschaft undsetzt die Prioritäten über Art, Umfang und Rangfolge der zu befriedigenden Bedürfnisse fest.Die Preise werden staatlich reglementiert, ebenso die Investitionen, der vonStaatsgesellschaften betriebene Außenhandel und die behördlich festgelegten Löhne. Märkte,nach denen sich Angebot und Nachfrage über bewegliche Preise einpendeln können, gibt es nurin rudimentärer Form, illegal als Schwarzmärkte oder gar nicht. Eine wichtige Bedingung derZentralverwaltungswirtschaft besteht darin, dass die Verfügungsgewalt über dieProduktionsmittel Boden und Kapital in der Hand des Staates liegt. Daher gibt es in100
AnhangZentralverwaltungswirtschaften kein Privateigentum an Produktionsmitteln. Die Koordinationvon Bedarfs- und Produktionsplanung orientiert sich der Theorie nach am Bedarf. [...]"A 82 "Eine Zwischenform bildet die soziale Marktwirtschaft. In ihr soll die Selbststeuerung derMarktwirtschaft auf der Grundlage des Privateigentums grundsätzlich über den Markt erfolgen.Das Prinzip des freien Marktes soll aber mit dem Ziel des sozialen Ausgleichs verbundenwerden. Der Staat soll zu diesem Zweck aktiv in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen(Regulierung von Monopolen, Sicherung der Geldwertstabilität etc.) [...]"A 90 Das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft entstand gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und griffElemente des Liberalismus und der christlichen Soziallehre auf. Geistige Väter des Konzeptswaren Walter Eucken (1891 - 1950), Professor für Volkswirtschaftslehre, und Alfred Müller-Armack (1901 - 1978), später Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft. DieseWirtschaftsordnung wurde in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere durch den späterenBundeskanzler Ludwig Erhard (1897 - 1977) politisch durchgesetzt. In ihr kommt dem Staat dieAufgabe zu, die sozial unerwünschten Auswirkungen der Marktwirtschaft zu verhindern oderwenigstens anzumildern. „Sozial“ steht für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit."Marktwirtschaft" steht für wirtschaftliche Freiheit. [...] Die Aufgabe der sozialenMarktwirtschaft ist es auf Grundlage der Marktwirtschaft das Prinzip der Freiheit mit sozialerGerechtigkeit zu verknüpfen. Damit liegt die Wirtschaftsordnung zwischen den beiden Extremender auf dem Individualprinzip aufgebauten freien Marktwirtschaft und der auf demKollektivprinzip beruhenden Zentralverwaltungswirtschaft. [...]"A 92 "Unsozial oder zu sozial - ein Streitgespräch. Der FDP-Ehrenvorsitzende Otto Graf Lambsdorffund der SPD-Linke Ottmar Schreiner im Streitgespräch über die soziale Marktwirtschaft.WirtschaftsWoche: Herr Schreiner, haben Sie die soziale Marktwirtschaft positiv oder negativempfunden? Schreiner: [...] Die soziale Marktwirtschaft war ohne Zweifel die ökonomischeGrundlage für eine Gesellschaft, die sozialen Aufstieg für die anbot, die wollten und diegeistigen Voraussetzungen mitbrachten. Ich habe jedoch große Zweifel, ob dies heute noch derFall ist. Lambsdorff: [...] Im Gegensatz zu Herrn Schreiner bin ich jedoch der Ansicht, dassdiese Gesellschaftsordnung heute zu sozial geworden ist. Der Sozialstaat hat dieMarktwirtschaft in weiten Teilen außer Kraft gesetzt. [...]"A 82 "[...] der Wirtschaftsprozess durch die individuellen Entscheidungen einer Vielzahl vonWirtschaftssubjekten (private Haushalte, Unternehmen, Staat) gesteuert wird [...] In denWirtschaftsordnungen sind die Grundlagen und Rahmenbedingungen formuliert, die dieVerhaltensweisen der Wirtschaftsakteure (private Haushalte, Unternehmen, Staat) bestimmen.[...]"B 7 /23"[…] vergleichen zunächst die idealtypischen Konzepte der freien Marktwirtschaft und derZentralverwaltungswirtschaft. Chancen und Probleme, die aus diesen Wirtschaftsordnungen fürProduzenten und Konsumenten entstehen, werden deutlich. […] In Wirtschaftsordnungen sinddie Grundlagen und Rahmenbedingungen formuliert, die die Verhaltensweisen derWirtschaftsakteure (private Haushalte, Unternehmen, Staat) bestimmen. [...]"B 14 "Notwendige Voraussetzungen und damit Merkmale des marktwirtschaftlichen Modells sind vorallem die Existenz von Privateigentum generell und speziell an Produktionsmitteln sowie dieExistenz grundlegender und allgemeiner Freiheitsverbürgungen, wie allgemeineVertragsfreiheit, Freiheit der Berufs- und der Arbeitsplatzwahl, Gewerbefreiheit, Produktions-,Handels- und Konsumfreiheit. [...] Ein weiteres Merkmal marktwirtschaftlicher Ordnung isteine relative wirtschaftliche Abstinenz des Staates; [...]"B 23 "In der freien Markwirtschaft haben private Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte Vorrang.Der Staat, verstanden als die Summe der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungen,hält sich weitestgehend aus dem Wirtschaftsgeschehen heraus, er übernimmt lediglichAufsichts- und Ordnungsfunktionen. Die Konsumenten entscheiden frei über Art, Umfang undRangfolge der Bedürfnisse. Die Unternehmen richten ihre Produktion am Bedarf aus undversuchen, möglichst viele Bedürfnisse zu möglichst günstigen Bedingungen zu befriedigen. Esgilt das Prinzip der dezentralen Produktionsplanung als Teil der generellen Planungsautonomiealler Wirtschaftssubjekte. [...]B 10 "[...] Erfolgt die Steuerung des Wirtschaftsprozesses nach einem einzigen Wirtschaftsplan, soliegt der Idealtyp einer Zentralverwaltungswirtschaft vor (auch Planwirtschaft, Zwangs-Kommando-Befehlswirtschaft genannt). [...] Wird der Wirtschaftsprozess dagegen durch vieleselbstständige, autonome Wirtschaftspläne gesteuert, so liegt der Idealtyp einerVerkehrswirtschaft vor (auch Marktwirtschaft, dezentral gelenkte Wirtschaft, kapitalistischesWirtschaftssystem, Wettbewerbswirtschaft genannt). [...]"101
AnhangB 15 "Daher ist eine umfangreiche, hochqualifizierte und kostspielige staatliche Bürokratieerforderlich, die die Informationen beschafft, auswertet, Teilpläne entwirft, aufeinanderabstimmt, zum Gesamtplan zusammenfügt, die Pläne gegebenenfalls revidiert, die Einhaltungder Pläne kontrolliert und durchsetzt. Die staatliche Wirtschaftsverwaltung muss in der Lagesein, Anweisungen nicht nur zu geben, sondern ihre Durchführung zu erzwingen. Einewesentliche Voraussetzung dafür besteht darin, dass die Verfügungsrechte über die sächlichenProduktionsmittel Boden und Kapital in der Hand der Wirtschaftsverwaltung liegen. Daher gibtes in den zentralgeleiteten Volkswirtschaften kaum Privateigentum an Produktionsmitteln.Neben der Verstaatlichung der sächlichen Produktionsmittel wird die Einhaltung der staatlichverbindlich festgelegten Wirtschaftspläne mit Hilfe von Anreizinstrumenten - in der Sprache derPolitökonomie des Marxismus-Leninismus mit ökonomischen "Hebeln" wie Lohn, Prämie,öffentliche Auszeichnung, Chancen zu beruflichem und sozialem Aufstieg, leistungsabhängigenSozialleistungen, Betriebsgewinnen -, aber auch mit Hilfe von Sanktionen, also Strafen, beiVerstößen gegen den Plan oder Anweisungen, gesichert. Die grundlegenden Entscheidungenüber die Güterproduktion, über den Faktoreinsatz und über die Güterverteilung werden durchdie Zentralverwaltung getroffen. Daher werden in dem Maß in dem die Verwaltungwirtschaftliche Entscheidungen an sich zieht, die Entscheidungsmöglichkeiten derwirtschaftenden Subjekte beschränkt. [...]"B 24 /25"Das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft entstand gegen Ende des Zweiten Weltkriegs undgriff Elemente des Neoliberalismus und der christlichen Soziallehre auf. Geistige Väter desKonzepts waren Walter Eucken (1891-1950), Professor für Volkswirtschaftslehre, und AlfredMüller-Armack (1901-1978), späterer Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft.Diese Wirtschaftsordnung wurde in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere durch denBundeswirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard (1897-1977) politischdurchgesetzt. In ihr kommt dem Staat die Aufgabe zu, die sozial unerwünschten Auswirkungender Marktwirtschaft zu verhindern oder wenigstens abzumildern. "Sozial" steht für sozialeGerechtigkeit und Sicherheit, "Marktwirtschaft" steht für wirtschaftliche Freiheit. [...] Danachhat der Staat dafür zu sorgen, dass dem Wettbewerbsprinzip in der Wirtschaftsordnungumfassend Rechnung getragen wird. Wie kann jedoch das Wettbewerbsprinzip durchgesetztwerden? Wie also kann eine Wettbewerbsordnung geschaffen und erhalten werden? Euckenführt sieben Voraussetzungen an, die er konstituierende Prinzipien nennt. [...]" Diese Prinzipienwerden dann erläutert.B 23 "[...] In den Wirtschaftsordnungen sind die Grundlagen und Rahmenbedingungen formuliert,die die Verhaltensweisen der Wirtschaftsakteure (private Haushalte, Unternehmen, Staat)bestimmen. [...]"B 23 /26"Der Staat, verstanden als die Summe der Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungen,hält sich weitestgehend aus dem Wirtschaftsgeschehen heraus, er übernimmt lediglichAufsichts- und Ordnungsfunktionen. […] Wie die Übersicht auf dieser Seite zeigt, wirkt derStaat als Rahmensetzer und als Interventionist ebenso auf die großen Märkte (Arbeits-, GüterundKapitalmarkt), wie es der Staat in seiner Funktion als Unternehmer tut. Verschärft er zumBeispiel Umweltschutzgesetze, können dadurch Arbeitsplätze wegfallen, weil einigeUnternehmen nicht genug Geld für entsprechende Investitionen haben. [...]"B 40 "Unternehmen produzieren Güter, um die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Sieschaffen Arbeitsplätze, die Einkommen erzeugen. Das Einkommen der Unternehmen ist derGewinn. […]“C 174 /175CC"Die Wirtschaftsordnung eines Landes umfasst die Gesamtheit der für die Organisation einerVolkswirtschaft geltenden Regeln und zuständigen Institutionen. Sie setzt den Rahmen für denWirtschaftsprozess, in dem die Unternehmen, der Staat und die privaten Haushalte arbeitsteiligzusammenwirken. [...] Moderne Wirtschaftsordnungen werden üblicherweise nach zweiMerkmalen gruppiert: 1. nach den Eigentumsrechten an den Produktionsmitteln und 2. nachdem Planungsmechanismus. Danach werden zwei Grundtypen von Wirtschaftsordnungenunterschieden, die freie Marktwirtschaft und die Zentralverwaltungswirtschaft."175 "Die freie Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung mit dezentraler Planung und Lenkungder Wirtschaftsprozesse, die über Märkte (Angebot und Nachfrage) koordiniert werden. DieProduktionsmittel befinden sich ausschließlich in Privateigentum."175 "Die Zentralverwaltungswirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung mit zentraler Planung derProduktion, der Verteilung und Verwendung der Güter. Die wirtschaftliche Grundlage bildetdas Staatseigentum an den Produktionsmitteln."102
AnhangC 176 "Die einzelnen Wirtschaftsordnungen haben unterschiedliche Wirkungen auf denWirtschaftsprozess. Die Wirtschaftswissenschaftler haben daher die Vor- und Nachteile dieserbeiden Idealtypen zu bestimmen versucht. Zu den herausragenden Befürwortern derMarktwirtschaft gehörten im 18. Jahrhundert Adam Smith (1723-1790) und in jüngerer ZeitFriedrich August von Hayek (1889-1992). Beide hoben ihre überlegene Leistungsfähigkeit undihren Freiheitsgehalt hervor. Der wohl wichtigste radikale Kritiker der Marktwirtschaft warKarl Marx (1818-1883), der im neunzehnten Jahrhundert zugleich die Grundlagen für die Ideeder Zentralverwaltungswirtschaft legte. In den Mittelpunkt stellte er dabei die gerechtereVerteilung der Güter und den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft. Andere, gemäßigtereKritiker wiesen auf einzelne Mängel der Marktwirtschaft hin und plädierten für staatlicheAusgleichsmaßnahmen wie etwa der britische Ökonom John Maynard Keynes (1883-1946).[...]"C 179 / Mosaik-Teil: "Wirtschaftstheorien und soziale Marktwirtschaft." Hier werden nochmalsunterschiedliche Meinungen von Adam Smith, Karl Marx und Ludwig Erhard präsentiert.CCC180178 "Die reale Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland entspricht keiner der beiden imKap. 3.1.1 beschriebenen Grundtypen in Reinform. Sie wird vielmehr als sozialeMarktwirtschaft bezeichnet. Grundidee dieser Wirtschaftsordnung ist es, diemarktwirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit der Erreichung weiterer Ziele zu verbinden."181 "Die soziale Marktwirtschaft beruht auf den Grundlagen der Marktwirtschaft. DerenFunktionsfähigkeit wird durch einen staatlichen Ordnungsrahmen gewährleistet. Zugleichübernimmt der Staat eine Reihe von Aufgaben wie die soziale Absicherung, dieWettbewerbssicherung und den Umweltschutz. Großen Anteil an der konzeptionellenEntwicklung und der praktischen Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschlandnach dem Zweiten Weltkrieg hatten Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister, Alfred Müller-Armack als Wissenschaftler und Staatssekretär unter Erhard sowie die Wissenschaftler dersogenannten Freiburger Schule um den bereits erwähnte Walter Eucken. Tatsächlich war dieseKonzeption sehr erfolgreich und trug entscheidend zum deutschen "Wirtschaftswunder" nachdem Zweiten Weltkrieg bei. Die soziale Marktwirtschaft steht im Einklang mit dengrundlegenden Festlegungen der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, demGrundgesetz (GG) vom 24.05.1949, auch wenn darin keine explizite Festlegung für einebestimmte Form der Wirtschaftsordnung enthalten ist. [...]"184 "Die soziale Marktwirtschaft unterliegt bestimmten Rahmenbedingungen. Diese sind imBesonderen die politische Ordnung sowie die demografischen und geografischen Bedingungen.[…]" Es erfolgt anschließend eine einzelne Betrachtung dieser beiden Aspekte.C 21 "In amtlichen Statistiken werden als private Haushalte erfasst: Personen, die alleine wohnenund wirtschaften, sowie jede zusammenwohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildendePersonengemeinschaft. […] Der private Haushalt gilt als die kleinste Wirtschaftseinheit undverfolgt das Ziel der Nutzenmaximierung. Über die privaten Haushalte in Deutschland gibt essehr detaillierte Daten des Statistischen Bundesamts. [...]"C 24 "Die Notwendigkeit für wirtschaftliches Handeln ergibt sich aus der Knappheit der Güter,wobei Unternehmenstätigkeit zu einer größtmöglichen Bedürfnisbefriedigung führen soll.Unternehmen erstellen zu diesem Zweck Leistungen (Güter und Dienstleistungen). Als primäresUnternehmensziel wird in der Wirtschaftstheorie dabei das Streben nach Gewinnmaximierungals Konkretisierung des ökonomischen Prinzips im marktwirtschaftlichen System unterstellt.Unternehmen sind rechtliche Wirtschaftseinheiten zur Leistungserstellung (Güter,Dienstleistungen) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Sie können aus mehreren Betriebenbestehen. [...] Zur Klassifizierung von Unternehmen dienen verschiedeneUnterscheidungsmerkmale. [...]"C 26 "Der Staat umfasst die Gebietskörperschaften Bund, Länder und Gemeinden sowie dieSozialversicherungen. Der Staat nimmt in einer Volkswirtschaft eine Reihe von Aufgaben wahr.Als Ziel wird in der Wirtschaftstheorie Gemeinwohlmaximierung unterstellt. Wichtig für denvolkswirtschaftlichen Kreislauf sind v. a. die öffentlichen Haushalte. [...] Darüber hinaus istder Staat auch ein bedeutender Arbeitgeber mit rund vier Mio. Beschäftigten."C 27 "Wirtschaftseinheiten, die ihren ständigen Sitz außerhalb des betrachteten Wirtschaftsgebieteshaben, werden als übrige Welt (Ausland) bezeichnet."C 21 "Jeder Teilnehmer am Wirtschaftsleben, z.B. eine Privatperson, wird als Wirtschaftssubjektbezeichnet. Das Erkenntnisobjekt wirtschaftstheoretischer Aussagen ist die Wirtschaftseinheit,die sich aus einem oder mehreren Wirtschaftssubjekten zusammensetzen kann: - privateHaushalte, - Unternehmen, - Staat (öffentliche Haushalte), - übrige Welt (Ausland)."103
AnhangC 28 "Wirtschaftseinheiten unterscheiden sich hinsichtlich bestimmter Merkmale." Es folgt eineTabelle, die den Vergleich und die Unterschiede zwischen den vier Wirtschaftseinheitenaufzeigt.D 42 "Sie verweist aber auf eine annähernd gleichrangige Verteilung der Lasten in der Gesellschaft,jedoch ist ebenso die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft zu beachten, dieökonomische Ungleichheit akzeptiert."D 62 "So sind die Investitionsbereitschaften von Unternehmen und Kapitaleignern, die Streikfähigkeitvon Arbeitnehmern, das Konfliktpotenzial bestimmter Berufsgruppen […]"D 20 "Die Anerkennung eines allgemein gültigen Wertkodex ist unerlässlich, um dem demokratischenStaat die ihm obliegende Funktion zu ermöglichen, stets dann regulierend einzugreifen, wennkeine Gewähr dafür besteht, dass aus dem Parallelogramm der ökonomischen, sozialen undpolitischen Kräfte eine Resultante hervorgeht, die den Minimalerfordernissen einerwirtschaftlich tragbaren und sozial erträglichen Lösung der anstehenden Probleme entspricht."E126 "Das System der freien Marktwirtschaft auf Basis des Privateigentums, vereinfacht oft"Kapitalismus" genannt, hat sich nun weltweit durchgesetzt."E 28 "Bis Ende der Siebzigerjahre war die Wirtschaft des Landes nach dem Vorbild der Sowjetunionals sozialistische Planwirtschaft organisiert: Grundbesitzer waren enteignet worden, dieLandwirtschaft kollektiviert und Industrie und der Handel vollständig verstaatlicht."E 21 "Um im globalen Wettbewerb mitzuhalten und Arbeitsplätze sichern zu können, benötigenUnternehmen Kapital. […] Unternehmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden,versuchen ihre Geschäftspolitik so zu gestalten, dass ihre Aktien zu einem möglichst hohenPreis gehandelt werden. [...]"F 72 "Nach klassischer liberaler Überzeugung sorgt der Markt, also die Steuerung von Art, Preisund Menge der Sach- und Dienstleistungen über Angebot und Nachfrage, für die effizientesteAllokation (Zuweisung der Ressourcen). Der Staat sollte sich darauf beschränken,"Nachtwächterstaat" zu sein, d.h., er sollte die Gesellschaft vor Angriffen äußerer Feindeschützen und im Inneren für Recht und Ordnung sorgen. Eingriffe in die Wirtschaft, alsoWirtschafts- und Sozialpolitik, sollte der Staat nicht betreiben."F 80 "[…] Das Grundgesetz enthält einerseits in seinem Grundrechtskatalog liberale Bestimmungen,die in einer reinen Zentralverwaltungswirtschaft nicht realisiert werden könnten. […]"F 74 "Das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft entstand am Ende des Zweiten Weltkriegs. Seinegeistigen Väter sind Walter Eucken und Alfred Müller-Armack. "Sozial" steht für sozialeGerechtigkeit und Sicherheit, "Marktwirtschaft" für wirtschaftliche Freiheit. Die sozialeMarktwirtschaft hält grundsätzlich an der Souveränität des Individuums fest. [...] DasGrundziel der sozialen Marktwirtschaft heißt entsprechend: "So viel Freiheit wie möglich, soviel staatlicher Zwang wie nötig." [...]"F 74 /75F 100 /101F"Die soziale Marktwirtschaft (enthält) Strukturprinzipien, die den klassischen Liberalismus unddie freie Marktwirtschaft zu ergänzen und zu korrigieren suchen. Konstituierende Prinzipien derSozialen Marktwirtschaft bestimmen, in welcher Weise die Grundsätze der Marktwirtschaftumgesetzt werden: - Privateigentum und Vertragsfreiheit: Prinzipiell sollen dieWirtschaftssubjekte frei entscheiden können und nach ihrem eigenen Nutzen handeln.Einschränkungen von Vertragsfreiheit und Verfügungsrechten sind aber dann geboten, wenndiese nicht wettbewerbskonform eingesetzt werden. - Offenhaltung von Märkten [...]""Der Wirtschaftswissenschaftler Otmar Issing, geb. 1936: Für mich steht "LiberalerKapitalismus" als ein System, in dem in der Tat die Marktkräfte den Wirtschaftsablaufbestimmen, aber eingebettet in die Spielregeln des Rechtsstaates, mit Gesetzen, dieVertragsfreiheit und Eigentumsrechte garantieren. [...] Der von der EU definierteOrdnungsrahmen enthält soziale Normen nur in unzureichendem Maße, weil die historischeEntwicklung eine politische Union nicht zugelassen hat. [...] Das europäische Sozialmodell istkein Einheitsmodell. Trotz erheblicher Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsstaatenbestehen jedoch auch grundlegende Gemeinsamkeiten. […] Das europäische Sozialmodell stehtangesichts der marktgetriebenen Globalisierung mitten in einer ernsten Bewährungsprobe. Siezu bestehen, ist vor allem eine nationale Aufgabe. Dabei ist der sozialpolitische InnovationsundImitationswettbewerb für die europäischen Wohlfahrtsstaaten auch eineErneuerungschance."106 "In der Bevölkerung einer Volkswirtschaft werden die Wirtschaftssubjekte nach ihrer Rolle beider gesellschaftlichen Produktion in Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonenunterschieden. […] Erwerbspersonen sind: - Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis (Arbeiter,Angestellte, Beamte) - Selbstständige (Unternehmer) - Angehörige freier Berufe [...]"104
AnhangF 90 "Wettbewerb eröffnet den Marktteilnehmern Handlungs- und Wahlfreiheiten. Aufgrund derKonkurrenz unter den Anbietern haben die Verbraucher die Wahl zwischen verschiedenenAngeboten, die Arbeitnehmer die Chance, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. […]"F 260 "[…] Jeder Bürger hat zwei Seelen in seiner Brust. In seiner Eigenschaft als Produzent möchteer sein Einkommen maximieren, indem er seine Produkte zu möglichst hohen Preisen verkauft.In seiner Eigenschaft als Konsument strebt er nach größtmöglichem Nutzen, indem er sich beiWaren gleicher Qualität für das jeweils Billigste entscheidet, auch wenn es ausländischerG 185 /256GG 185 /186GG 14 /103Herkunft ist. [...]""Die Konzeption von der Sozialen Marktwirtschaft (im Gegensatz zur freien Marktwirtschaft)wurde von dem Wirtschaftswissenschaftler Alfred Müller-Armack (28.6.1901-16.3.1978)entwickelt. […] Vor allem bereitet es den meisten dieser Ländern, die den Weg von derkommunistischen Diktatur zur Demokratie und von der sozialistischen Planwirtschaft zur freienMarktwirtschaft beschreiten mussten, noch erhebliche Schwierigkeiten, den Beitrittskriterienzur Europäischen Union gerecht zu werden."171 "In der Zeit von 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa 1990 existierten in den Staaten des"Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW), zu dem u. a. die UdSSR als Führungsmachtund die DDR, Polen, Ungarn, die CSSR gehörten, einerseits, und in den westlichenIndustriestaaten mit der Führungsmacht USA andererseits grundsätzlich unterschiedlicheWirtschaftssysteme, die als Planwirtschaft oder "Zentralverwaltungswirtschaft" und alsMarktwirtschaft bezeichnet werden.""Die Auffassung von der grundsätzlichen Verantwortlichkeit des Staates für die wirtschaftlicheund soziale Entwicklung Deutschlands fand nach dem Zweiten Weltkrieg Ausdruck in demKonzept der Sozialen Marktwirtschaft, das sich am Sozialstaatspostulat des Art. 20 desGrundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland orientiert. Die soziale Marktwirtschaft will aufmarktwirtschaftlicher Grundlage das Prinzip der Freiheit mit dem des sozialen Ausgleichs undder sozialen Gerechtigkeit verbinden. [...] Als Instrumente stehen dem Staat in erster Linie diemarktwirtschaftliche Intervention und die gesetzliche Sicherung sozialer Mindeststandards(Arbeitsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht) zur Verfügung. [...] Die Konzeption von derSozialen Marktwirtschaft (im Gegensatz zur freien Marktwirtschaft) wurde von demWirtschaftswissenschaftler Alfred Müller-Armack (28.6.1901-16.3.1978) entwickelt. Sie wurdevom ersten Wirtschaftsminister der BRD, Ludwig Erhard, zum Leitgedanken deswirtschaftlichen Wiederaufbaus erhoben. [...] Die Soziale Marktwirtschaft basiert auf derFunktion eines beweglichen und sich dynamisch entwickelnden Marktes. Wenigstens in dieserHinsicht besteht eine gemeinsame Auffassung sehr vieler Wirtschaftspolitiker, dass dieMarktwirtschaft ein wirtschaftlich effizientes, ja den anderen Ordnungen überlegenes Systemsei. Die Soziale Marktwirtschaft ist angetreten mit dem Anspruch, durch denmarktwirtschaftlichen Prozess [...]"119 "Es haben sich Unternehmen gebildet, die mit der Verleihung von Arbeitnehmern weltweitoperieren. Der Vorteil dieser Firmen besteht in der hohen zeitlichen und räumlichen Flexibilitätder Arbeitnehmer für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe. […]""Zum Staat schließen sich die Menschen zusammen, um ihr Eigentum, das sie sich aufnatürliche Weise durch Arbeit erworben haben, zu schützen. Der Zusammenschluss erfolgt übereinen freiwillig und einstimmig geschlossenen Gesellschaftsvertrag. In der so gebildetenpolitischen Gemeinschaft gilt das Mehrheitsprinzip, das Locke als erster ausführlicherbegründete. […] Das Sozialstaatspostulat ist eine Art Basisnorm, der sich die Funktionsweisedes modernen Staats verpflichtet. Aus der Formulierung wird deutlich, dass es sich nur um einesehr grundsätzliche Bestimmung handelt, die der Interpretation bedarf. […]"2. Ökonomische Prinzipien und NutzenmaximierungA 80 "Das Knappheitsprinzip ist das Kernprinzip allen Wirtschaftens. Während wir grenzenloseBedürfnisse und Wünsche haben, sind die verfügbaren Ressourcen begrenzt. Von einem Gutmehr zu haben, bedeutet in der Regel, von einem anderen Gut weniger zu haben. Knappheiterzeugt Kosten: Die Wahl einer Alternative bedingt, dass die zweitbeste Alternative nichtgenutzt werden kann. [...]"A 80 "Die dadurch entstehenden Kosten bezeichnet man als Opportunitätskosten. Sie entsprechendem Nutzen, der einem dadurch entgeht, dass man die alternative Aktivität nicht ausführenkann. […]"A 80 "In wirtschaftlichen Entscheidungssituationen werden also ständig Kosten und Nutzen inRelation gesetzt (Handeln nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip). Gewählt wird immer die105
AnhangAlternative, die einen zusätzlichen Nutzen verspricht, der zumindest marginal höher ist als diezusätzlichen Kosten. [...]"A 84 "Die Haushalte streben Nutzenmaximierung an, d. h., sie wollen ihr Einkommen so ausgeben,dass möglichst viele Wünsche erfüllt werden können. Wenn der Preis eines Gutes steigt, werdendeshalb die Konsumenten die Nachfrage nach diesem Produkt verringern, im umgekehrten Fallsteigern. Weil die Unternehmen sich das Ziel der Gewinnmaximierung gesetzt haben, sind siebereit, bei höheren Preisen und somit höheren Verkaufserlösen auch mehr anzubieten als beiniedrigen. [...]"B 23 "Jede Volkswirtschaft steht vor der Aufgabe, die Grundprobleme des Wirtschaftens lösen zumüssen: Wie kann - ausgehend von einer prinzipiell angenommenen Knappheit der Güter imVergleich zu den nahezu unendlichen Bedürfnissen der Konsumenten - eine möglichst großeBedürfnisbefriedigung für alle sichergestellt werden. [...]"BB165 "Die Theorie der politischen Ökonomie nimmt an, dass Politiker in Analogie zu den üblichenWirtschaftsakteuren als rationale Nutzenmaximierer handeln. Im Streben des Politikers spieltdie Wiederwahl eine zentrale Rolle, sichert sie doch die damit verbundenen Privilegien wieEinkommen und Prestige.[...]"283 "[...] Doch die zentrale Annahme der Wirtschaftswissenschaften, dies sei der homooeconomicus, also jenes Wesen, das immer unter dem Diktat der Knappheit steht und das immerbestrebt ist, seinen Nutzen zu maximieren, wird zunehmend in Frage gestellt. [...]"C 10 "Die Tatsache, dass nicht alle Güter in so ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, umalle Bedürfnisse kostenlos zu befriedigen, bezeichnet man in der Volkswirtschaft als Knappheit.[...] Die Knappheit der Güter ist das wirtschaftliche Grundproblem und macht wirtschaftlichesHandeln des Menschen notwendig. Es werden allgemein drei Arten von Knappheitunterschieden: 1. Natürliche Knappheit […] 2. Unterproduktion […] 3. Künstliche Knappheit[...]"C 14 "Aus dem Spannungsverhältnis der Knappheit der wirtschaftlichen Güter und den unbegrenztvorhandenen Bedürfnissen leiten sich Entscheidungen der Menschen ab, da nicht alleBedürfnisse gleichzeitig befriedigt werden können. Den Nutzen, auf den der Mensch durch seineEntscheidung verzichtet, nennt man Opportunitätskosten (lat. "opportunitas" =Zweckmäßigkeit in einer Situation). [...] Dieser Entscheidungsprozess kann in einemökonomischen Verhaltensmodell dargestellt werden." Es folgt danach eine grafischeDarstellung.C 16 /17"Das ökonomische Prinzip beinhaltet den wirtschaftlichen Umgang mit knappen Ressourcen(Gütern). Wirtschaften ist notwendig, weil die Güter zur Bedürfnisbefriedigung begrenzt, dieBedürfnisse aber praktisch unbegrenzt sind. Das "ökonomische Prinzip" fordert, die knappenGüter so einzusetzen, dass ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen Bedürfnisbefriedigungund Güterverbrauch erreicht wird. Es entspricht damit dem Wirtschaftlichkeitsgebot mit denAusprägungen Minimal-, Maximal- und Optimierungsprinzip (generelles Extremumprinzip).Das ökonomische Prinzip besagt, dass ein möglichst günstiges Verhältnis von Aufwand undErtrag zu verwirklichen ist."C 16 "Minimalprinzip: Das ökonomische Handeln wird dadurch bestimmt, dass ein vorgegebenerErtrag(Output) mit einem minimalen Aufwand (Input) erzielt wird. Es gibt Schülerinnen undSchüler, die mit einem Minimum an Arbeitsaufwand das Abitur erreichen (es kommt ihnen nichtauf eine gute Note an). Sie handeln ökonomisch, dann ist es vernünftig, nur die dazu unbedingtnotwendige Menge an Arbeit zu leisten." Das Maximumprinzip und das generelleExtremumprinzip werden im gleichen Stil definiert und mit einem Beispiel erläutert.C 14 "Den Nutzen, auf den der Mensch durch seine Entscheidung verzichtet, nennt manOpportunitätskosten […]"C 15 In der Grafik wird als Ziel die Nutzenmaximierung dargestellt. "Zweck der Wirtschaft ist es,durch den handelnden Menschen immer das Bestmögliche aus den begrenzten Mitteln (knappenGütern) herauszuholen, um die persönlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen."D 10 "Für die Einführung des E-Votings dürfe aber nicht allein das Kosten-Nutzen-Denken derVerwaltung im Vordergrund stehen, warnte Brändli."E 80 "Der ökonomische Konflikt um die Ressource Wasser resultiert aus der geografischen Lage derKrisenregion. Die Region des Nahen Ostens gehört zu den wasserärmsten Gebieten der Erde.Die Möglichkeiten, die Ressource Wasser zu nutzen, sind auf beiden Seiten sehr unterschiedlichverteilt. [...]"E 99 "Weicht keiner aus, haben beide Spieler zwar die Mutprobe bestanden, ziehen jedoch darauskeinen persönlichen Nutzen, weil sie durch den Zusammenprall ihr Leben verlieren. […]"106
AnhangE 22 /23E"Wer Renditen maximiert, macht Unternehmen und ganze Volkswirtschaften effizienter, und dasnutzt am Ende allen. […] Dieses kompromisslose Gewinnstreben macht den Finanzinvestorberechenbar, anders als einen alternden Patriarchen, eine zerstrittene Eigentümerfamilie odereinen ineffizienten Großkonzern."125 "(2) die Frage der Kosten- und Nutzenverteilung, die aus der Kooperation erwächst (istsichergestellt, dass alle den gleichen Anteil vom Hirschen bekommen bzw. dass es keinen Streitdarüber gibt?)"F 57 "[…] Die persönliche Wahlentscheidung wird bestimmt durch ihren maximal zu erzielendenpolitischen Nutzen. Ein rationaler Wähler entscheidet sich demnach für diejenige Partei, vonderen Politiker er sich den größten Vorteil verspricht. (…) Ein rationaler Mensch ordnetdemnach zuerst seine Handlungsalternativen bezüglich seiner vorgegebenen Ziele. Er wähltdann die effektivste Alternative aus und kommt bei gleichen Rahmenbedingungen stets zumgleichen Ergebnis. [...]"FFG 173 /174G 132 /133G260 "[…] Jeder Bürger hat zwei Seelen in seiner Brust. In seiner Eigenschaft als Produzent möchteer sein Einkommen maximieren, indem er seine Produkte zu möglichst hohen Preisen verkauft.In seiner Eigenschaft als Konsument strebt er nach größtmöglichem Nutzen, indem er sich beiWaren gleicher Qualität für das jeweils Billigste entscheidet, auch wenn es ausländischerHerkunft ist. [...]"247 "[…] Die wichtigste ökonomische Triebkraft der Globalisierung ist das Bestreben vonUnternehmen, ihren Gewinn durch internationale Aktivitäten zu steigern. […]""Knappe Güter sind als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung, nicht "hier und jetzt" verfügbar. Esmuss etwas getan und aufgewendet werden, um sie zu erlangen. […] Wirtschaft dient derHerstellung und Vertreibung von knappen Gütern (Knappheitspostulat).""Der homo oeconomicus übertritt keine Normen um der Übertretung selbst willen, sondernwenn ihm daraus ein Nutzen erwächst. […] So wissen wir zwar oft, was das Richtige wäre, aberunser Verhalten geht in Orientierung auf den momentanen eigenen persönlichen Nutzen nichtselten in eine andere Richtung."172 "Wirtschaftliche Vernunft bedeutet ein Verhalten, das mit gegebenen Mitteln dengrößtmöglichen Erfolg oder Nutzen erreicht, oder das ein gewünschtes Ergebnis (Nutzen,Ertrag, Erfolg) mit geringstmöglichen Mitteln (Aufwand) zu erreichen sucht."3. Homo oeconomicus und DilemmastrukturenA 80 /81"Aus diesen Erkenntnissen hat die Wirtschaftswissenschaft die ökonomische Verhaltenstheorieabgeleitet. Im Zentrum dieser Theorie steht der Homo Oeconomicus als idealtypischesMenschenbild. In der klassischen Volkswirtschaftslehre ist der Homo Oeconomicus ein Modellfür die Erklärung menschlichen Verhaltens in Entscheidungssituationen. Er wird beschriebenals individueller, rationaler und egoistischer Nutzenmaximierer. Doch immer mehr melden sichauch Wirtschaftswissenschaftler zu Wort, die dieses Bild für zu wirklichkeitsfern halten, diedavon überzeugt sind, dass die tatsächlich wirtschaftlich Handelnden auch von anderenMotiven geleitet werden können: von Fairness, Vertrauen, Solidarität, ja manchmal sogar vomGegenteil des Egoismus: von Altruismus. Somit gerät der Mensch als komplexes Wesen insBlickfeld moderner Wirtschaftstheorien - als rationales und als emotionales Wesen. [...]"A 82 "Die liberalen Wissenschaftler sahen den Menschen als homo oeconomicus, als Wesen, das nurauf seinen eigenen Nutzen bedacht ist."A 81 "Eine Erkenntnis zum menschlichen Verhalten wird durch das Spiel mit dem Namen Ultimatumdeutlich. Es geht so: Freiwillige, die einander im Übrigen fremd sind, werden zu einem Spielaufgefordert, durch das sie insgesamt 100 € gewinnen können. Vor dem Spiel lernen sie dieRegeln. Das Spiel beginnt mit einem Münzwurf, durch den die Spieler ihre Rollen A und Bbekommen. Nach einem Vorschlag des Spielers A zur Aufteilung der 100 € entscheidet derSpieler B, den Vorschlag anzunehmen oder abzulehnen. So fern B ablehnt, gehen beide mit nullaus dem Spiel. Das Spiel ist damit in jedem Fall zu Ende. Denken Sie vor dem Weiterlesendarüber nach, wie Sie sich in dieser Situation verhalten würden. Wenn Sie Spieler A wären:Welche Aufteilung der 100 € würden Sie vorschlagen? Welche Vorschläge würden Sie alsSpieler B annehmen? Die konventionelle Theorie unterstellt in dieser Situation, dass die beidenrationale Wohlfahrtsmaximierer sind. Diese Unterstellung führt zu einer einfachen Voraussage:Spieler A sollte vorschlagen, dass er 99 € und Spieler B 1 € erhält. Und Spieler B sollte denVorschlag akzeptieren, da er durch die Zahlung von 1 € besser als vorher gestellt ist. Spieler Ahat wiederum keine Veranlassung, mehr als 1 € zu bieten, da er sicher ist, dass Spieler B inseinem eigenen Interesse den Vorschlag von A akzeptieren wird. Die 99 : 1 Aufteilung ist das107
AnhangB 283 /284B 264 -266Nash-Gleichgewicht. Wenn jedoch experimentelle Ökonomen das Ultimatum-Spiel mitwirklichen Menschen spielen, weichen die Ergebnisse deutlich von der Voraussage ab. SpielerB lehnt eine Zahlung von nur 1 € ab, und Spieler A weiß das. Er gibt ihm also mehr - bis hin zueiner Aufteilung 50 : 50. Häufiger sind Vorschläge von A an B, diesem 30 € oder 40 €auszuzahlen. In diesen Fällen nimmt B meist an. Was geht da vor sich? Die nahe liegendeInterpretation ist, dass die Menschen zum Teil von einem angeborenen Sinn für Fairnessangetrieben werden. Eine Aufteilung 99 : 1 wird als unfair wahrgenommen. [...] EinigeÖkonomen haben vorgeschlagen, dass die wahrgenommene Fairness in die Entlohnung vonBeschäftigten einfließen sollte. Sofern die Unternehmung ein gutes Jahr hat, können dieArbeiter (Spieler B) die Zahlung eines fairen Anteils erwarten. Die Unternehmung (Spieler A)könnte sich entscheiden mehr zu bezahlen, damit die Unternehmung nicht „bestraft“ wird durchverringerte Anstrengungen, Streik oder sogar Ausschreitungen.""[...] Doch die zentrale Annahme der Wirtschaftswissenschaften, dies sei der homooeconomicus, also jenes Wesen, das immer unter dem Diktat der Knappheit steht und das immerbestrebt ist, seinen Nutzen zu maximieren, wird zunehmend in Frage gestellt. [...] DieHypothese, dass der Mensch vor allem egoistisch und rational sei, ist eine Hypothese derÖkonomen, die lange Zeit nie getestet worden ist. Aber der Mensch war vermutlich nie sorational und so eigennützig, wie der Ökonom ihn gerne hätte in seinen Modellen. Insofern hatsich der Mensch nicht geändert, sondern die Wirtschaftswissenschaft hat sich geändert, indemsie diesen neuen Ideen und neuen empirischen Befunden Rechnung trägt und den "HomoOeconomicus" langsam verabschiedet. Denn der "Homo Oeconomicus" ist eine Fiktion, die sonicht existiert. [...]""Die Ausgangsituation: In einem Prozess seien zwei Gefangene angeklagt, die gemeinsam eineReihe von Verbrechen begangen haben. Die Beweislage des Staatsanwalts ist schlecht: OhneGeständnis kann er beide nur geringer Straftaten überführen. Daher versucht er beide alsKronzeugen gegen den jeweils anderen Angeklagten zu gewinnen. Damit ergibt sich für dieGefangenen, die sich untereinander nicht verständigen können, folgende Lage: Gestehen beide,so werden beide mit jeweils 8 Jahren schwer bestraft. Gesteht keiner, so kommen sie beide miteiner vergleichsweise geringen Strafe von 1 Jahr davon. Gesteht aber nur einer, so wird er alsKronzeuge freigesprochen, während der andere mit 10 Jahren Gefängnis sehr schwer bestraftwird. [...] Die Auswertung der Dilemmasituation: Umweltgüter wie Luft und Wasser stehenallen zur Verfügung. Im Gegensatz zu privaten Gütern schließt ihr Gebrauch andere von derNutzung zwar nicht aus. Doch werden solche Kollektivgüter wiederverwendet, ist ihre Qualitätin vielen Fällen rapide gesunken. Jedes Wirtschaftssubjekt kennt das Dilemma: Der Verbrauchvon Umwelt verspricht ihm selbst zunächst Vorteile, bringt jedoch der Gesamtheit und zuletztauch ihm selbst Nachteile. In der Spieltheorie wird jene Situation als Gefangenendilemmabezeichnet. [...]"C 15 "Homo oeconomicus, der ökonomische Mensch, ist im allgemeinsten Sinn derjenige, der inallen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Er stellt in der Wirtschaftslehre einModell dar, das auf egoistische Ziele reduziert ist, d.h. der homo oeconomicus gilt alsnutzenmaximierendes Wesen. "Es gibt keine Wesen, die mit dem Begriff des homo oeconomicusim Ganzen oder in ihrem Kern zutreffend beschrieben wären; jeder Mensch ist unendlich mehrals dieses ... Gedankenmodell je begrifflich erfassen könnte." (K. Homann / A. Suchanek)."E 99 "Beim Feiglingsspiel, Angsthase bzw. Chicken Game (englisch chicken = Feigling) handelt essich um ein Problem aus der Spieltheorie [...]: Es geht um das Szenario einer Mutprobe: ZweiSportwagen fahren mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Wer ausweicht, beweist damitseine Angst und hat das Spiel verloren. Weicht keiner aus, haben beide Spieler zwar dieMutprobe bestanden, ziehen jedoch daraus keinen persönlichen Nutzen, weil sie durch denZusammenprall ihr Leben verlieren. [...] Das Spiel mit dem Untergang wird in der Spieltheorieals ein Zweipersonenspiel mit je zwei Strategien (Ausweichen, Weiterfahren) modelliert. DieAuszahlungen (in Nutzeneinheiten) könnten wie in der nebenstehenden Auszahlungsmatrixaussehen. [...]"F147 "[…] Mit anderen Worten: "Der Homo Oeconomicus zieht in den Krieg." Der Krieg gilt alsMittel der ökonomischen Reproduktion und der Reichtumsaneignung; er wird zum Selbstzweckund Instrument ökonomischer Zweckrationalität. […]"F 57 "[…] Die persönliche Wahlentscheidung wird bestimmt durch ihren maximal zu erzielendenpolitischen Nutzen. Ein rationaler Wähler entscheidet sich demnach für diejenige Partei, vonderen Politiker er sich den größten Vorteil verspricht. (…) Ein rationaler Mensch ordnetdemnach zuerst seine Handlungsalternativen bezüglich seiner vorgegebenen Ziele. Er wähltdann die effektivste Alternative aus und kommt bei gleichen Rahmenbedingungen stets zum108
AnhangGGgleichen Ergebnis. [...]"132 "Im Unterschied zur Internalisierungsannahme, nach der Menschen sich selbst sanktionieren,indem sie bei Übertretung verinnerlichter Werte und Normen z. B. ein schlechtes Gewissenbekommen oder sich sogar körperliche Sanktionen einstellen (Schweißausbrüche, Herzrasenusw.), reagiert der homo oeconomicus nur auf äußere Sanktionen. Ihn berührt nur, wenn er vonanderen Akteuren bei einer Normübertretung ertappt wird oder wenn er vorhersieht, dass erbestraft werden könnte. Immer dann, wenn die Wahrscheinlichkeit der Bestrafung sinkt, sinktauch seine Bereitschaft, sich an Normen zu halten. Der homo oeconomicus übertritt keineNormen um der Übertretung selbst willen, sondern wenn ihm daraus ein Nutzen erwächst."283 "homo oeconomicus (lat.) ist der Mensch als ein auf den Nutzen ausgerichtetes, ökonomischkalkulierendes Wesen."Kategorie 3: Verhältnis von Ethik und ÖkonomikBuch Seite Textstelle1. <strong>Wirtschaftsethik</strong>ABC455 "Die Verantwortung der Entwicklungsländer für „good governance“ und jene derIndustrieländer für faire weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen wurde bekräftigt."289 "Die Verlässlichkeit wechselseitiger Verhaltenserwartung wird hier nicht durch formelle Regelnwie in der <strong>Wirtschaftsethik</strong> hergestellt, sondern durch Selbstbindung der beteiligtenUnternehmen. [...] Sind die hier vorgestellten Konzeptionen von <strong>Wirtschaftsethik</strong> alsOrdnungsethik und von Unternehmensethik auf der Basis unvollständiger Verträge mit derTradition der abendländischen Ethik kompatibel? [...]"279 "Von den Industrieländern sollen dabei die entscheidenden Schritte ausgehen, da sie dieWeltwirtschaft prägen. Ihr Beitrag für eine Weltordnungspolitik (Global Governance) bestehtvor allem in der: Schaffung fairer weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen(gleichberechtigte Teilnahme der Entwicklungsländer an der internationalen Arbeitsteilung),Eindämmung der weltweiten Armut, Ungerechtigkeit und Zerstörung der Umwelt (aktiveGestaltung einer sozialen und ökologisch orientierten Marktwirtschaft). Diese Aufgaben sindZielsetzungen der OECD. [...]"D 18 "Das Gemeinschaftsinteresse wird im Ergebnis als Gemeinwohl bezeichnet. […]"E 39 "Die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen der Globalisierung lösten eineDiskussion um international verbindliche soziale Standards aus, die weltweit menschenwürdigeArbeitsbedingungen gewährleisten sollen."F 33 ""Gemeinwohl muss Vorrang haben" Aus einer Stellungnahme der evangelischen Kirche, 2003:Die Kirchen treten dafür ein, dass Solidarität und Gerechtigkeit als entscheidende Maßstäbeeiner zukunftsfähigen und nachhaltigen Wirtschafts- und Sozialpolitik allgemeine Geltungerhalten. […]"F 93 "Zur Sozialen Marktwirtschaft gehört integral der soziale Ausgleich, um eine gerechtereWirtschaftsordnung mit geringeren sozialen Spannungen zu erreichen."F165 "[…] Deutschland ist Exportweltmeister. Wir, aber nicht nur wir, sind auf prosperierende,stabile Märkte weltweit angewiesen. Dann müssen wir aber auch allen Ländern die Chancegeben, an einem fairen globalen Wirtschaftssystem teilzunehmen. […] wir müssen dieinternationalen Handelsregeln fair und entwicklungsfreundlich gestalten, und wir müsseninternational verbindliche Spielregeln für grenzüberschreitend agierendeWirtschaftsunternehmen definieren. [...]"G 18 "Was das Gute ist, das im Interesse des Gemeinwohls liegt, dem Gemeinwillen entspricht unddem Wohle des Volkes dient, kann nur durch Sachverstand erkannt werden und ist nicht jedemunmittelbar zugänglich. […]"109
Anhang2. Vertreter und verschiedene AnsätzeA 84 /115"Der britische Nationalökonom Adam Smith (1723 - 1790) war fasziniert von der Erkenntnis,dass marktwirtschaftliche Systeme „selbstregulierende Systeme“ sind, die im Laufe derMenschheitsentwicklung entstanden sind. […] Der Begründer der „klassischen Ökonomie“,Adam Smith, hatte Ende des 18. Jahrhunderts die Vorstellungen von einer freien Gesellschaftaus der Politik auf die Ökonomie übertragen. [...]"B 82 "Adam Smith der diese Zusammenhänge erstmals aufzeigte, war fasziniert von der Erkenntnis,dass marktwirtschaftliche Systeme "selbst regulierende Systeme" sind, dass sie einer "innerenOrdnung" gehorchen und aus sich selbst heraus stabil sind. Er begründete das Prinzip der"unsichtbaren Hand":[...]"BB289 "Die Ökonomik muss ihren Vorteilsbegriff offen halten. Unter Vorteilen dürfen nicht nurmaterielle oder gar nur monetäre Vorteile verstanden werden, sondern es müssen sich Dingewie Gesundheit, Muße, ein gutes Leben im Sinne des Aristoteles mit ökonomischen Mittelnrekonstruieren lassen. Wenn diese Ökonomik diese methodologische Umstellung systematischvollzieht, kann sie zu einer "Fortsetzung der Ethik mit andern Mitteln" (Karl Homann) werden."289 "[…] Tatsächlich lässt sich auch in einer Ordnungsethik, die auf dem Kerngedanken derRegelsteuerung moderner Gesellschaften aufbaut, ein theoretischer Ort für praktischeUnternehmensethik finden. Unternehmensethik lässt sich aufbauen auf dem Gedanken, dassInteraktion durch Regeln und Verträge nicht vollständig bestimmt ist. […]"C 69 "Hervorragende Ökonomen wie Adam Smith, David Ricardo, Robert Owen, Charles Fouriersowie Karl Marx entwickelten ihre Lehre aus der Analyse des Industriezeitalters."C176 "Zu den herausragenden Befürwortern der Marktwirtschaft gehörten im 18. JahrhundertAdam Smith (1723-1790) und in jüngerer Zeit Friedrich August von Hayek (1889-1992)." DerLebenslauf befindet sich auf der beiliegenden CD-ROM dieses Buches, es wird daraufverwiesen.C 15 "Homo oeconomicus, der ökonomische Mensch, ist im allgemeinsten Sinn derjenige, der inallen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Er stellt in der Wirtschaftslehre einModell dar, das auf egoistische Ziele reduziert ist, d.h. der homo oeconomicus gilt alsnutzenmaximierendes Wesen. "Es gibt keine Wesen, die mit dem Begriff des homo oeconomicusim Ganzen oder in ihrem Kern zutreffend beschrieben wären; jeder Mensch ist unendlich mehrals dieses ... Gedankenmodell je begrifflich erfassen könnte." (K. Homann / A. Suchanek)."D 19 "Adam Smith (1723-1790) hat diese Idee im 18. Jahrhundert in seiner Theorie des Liberalismusweiterentwickelt, die bis heute die wesentliche Grundlage des sog. westlichen Gesellschafts-,Wirtschafts- und Staatsverständnisses ist - im Gegensatz zu den Ländern des ehemaligenOstblocks, die das Konkurrenzprinzip und den Pluralismus zugunsten des identitären Prinzipsablehnten."E 12 "Die Aussage der absoluten Kostenvorteile von Adam Smith besagt: […]"F 72 "Adam Smith (1723 - 1790) war ein schottischer Moralphilosoph und gilt als Begründer derklassischen Volkswirtschaftslehre. […] 1776 hatte Adam Smith sein Werk "Untersuchung überdie Natur und die Ursachen des Wohlstands der Nationen" veröffentlicht. [...] Für Smith hat derStaat die Aufgabe, dem Markt durch die Justiz (und ebenso durch das Militär) seine Spielregelnzu setzen und außerdem einige klar abgegrenzte öffentliche Güter bereitzustellen: Verteidigung,Verkehrswege, Bildung."G133 "Der Begründer der Nationalökonomie, der britische Philosoph und Nationalökonom AdamSmith (1723-1790), wollte den Zusammenhang zwischen dem legitimen Streben jedes Menschen,seine persönliche Lebenssituation zu verbessern, und der Wohlfahrt der Gesellschaftnachweisen."3. SpannungsverhältnisA 445 / "Der Interessengegensatz, der sich aus der unterschiedlichen ökonomischen Lage zwischen dem452 reichen Norden (v.a. Europa, Japan, Nordamerika) und dem armen Süden (v.a. Afrika,Südasien) ergibt, bestimmt auch die politischen Beziehungen und wird als Nord-Süd-Konfliktbezeichnet. Dabei umfasst der "Norden" die industrialisierten Länder, während der "Süden" dieEntwicklungsländer meint. [...] Der Gegensatz zwischen Arm und Reich wird alsUngerechtigkeit gesehen, die aus ethisch-moralischen Gründen die reichen Gesellschaften zurHilfe verpflichtet, zumal die Politik der Kolonialzeit eine Grundlage für etlicheFehlentwicklungen gebildet hat (Grenzziehungen, Ausbeutung von Bodenschätzen ...)."B 288 / "Es kommt nicht darauf an, Motive zu ergründen und sie dann zu bewerten, etwa in der Art,110
Anhang289 dass versucht wird festzustellen, wie weit Akteure aus Eigeninteresse oder aus Altruismushandeln. Es kommt vielmehr darauf an, ob die Akteure sich an die Regeln halten. Ob sie diestun, um ihren Gewinn zu maximieren, um sich an die Zehn Gebote zu halten, um ihregesellschaftliche Rolle einzunehmen oder um ihre genetische Fitness zu maximieren, ist nichtvon Bedeutung. Entscheidend ist nur: Wer die Regeln übertritt, wird bestraft. [...] Beigeeigneten Regeln kann der Einzelne davon ausgehen, dass der Andere fair spielt, wenn erselbst auch fair spielt. Ungeeignete Regeln indes bestrafen ein solches Verhalten und könnenBetrug, Umweltverschmutzung oder Korruption befördern. [...] Gerade in der Globalisierungkommt es darauf an, dass sich Unternehmen als zuverlässig präsentieren, sowohl gegenüberihren Geschäftspartnern als auch gegenüber den Kunden, die auf der ganzen Welt verteilt seinkönnen. Kein Unternehmen kann es sich leisten, seine Geschäftspartner und Kunden immerwieder über den Tisch zu ziehen. Dies wäre allenfalls eine kurzfristige Optimierung desVerhaltens. Ökonomische Kalkulation indes muss sich immer auf eine Sequenz von Handlungenbeziehen, nicht nur auf einzelne Handlungen. Jeder Akteur und jedes Unternehmen kanninvestieren, das heißt Ressourcen für künftige Zwecke aufbewahren. Solche Investitionenkönnen auch mittels ethischer Mechanismen vorgenommen werden. Ethisches Verhalten ist eineInvestition in den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. [...]"B 38 "Wen wundert eine solche dem Gemeinwesen schadende Entwicklung, wenn das Ziel heutigerManager nicht mehr vorrangig ist, das ihnen anvertraute Unternehmen so zu führen, dass alle,die darin arbeiten, an einem Strang ziehen, damit es Rendite und seinen Arbeitnehmern einAuskommen bringt, sondern ihr Erfolg und Gehalt daran gemessen wird, wie geschickt sie dasUnternehmen auf den Börsenmärkten platzieren und auf die Shareholder verteilen, um es dannim richtigen Moment profitabel zu verkaufen, und stolz dabei sind, sich damit wieder tausenderArbeitnehmer entledigt zu haben. Der arbeitende Mensch spielt bei diesem Monopoly keineRolle mehr. So gemeinte und angemaßte Freiheit verträgt sich nicht nur nicht mit der vomGrundgesetz geforderten Sozialstaatlichkeit, sie tut auch so, als stünden die Grundrechte nurdenen zu, die auf der ökonomischen Sonnenseite das Sagen haben. [...]"C 11 "In der Warenwirtschaft kommen auch nicht die menschlichen Bedürfnisse selbst zur Geltung,sondern nur jene, die kaufkräftig auf dem Markt nachgefragt werden können - eben die in derWirtschaftslehre sogenannten 'Bedarfe'. […] Die Begrenztheit viele Güter und Lebensmittelkann durch effektive Produktion immer weiter eingeschränkt werden - allerdings wird zumZwecke der Profiterwirtschaftung die Knappheit immer wieder neu erzeugt. [...]"C149 "[…] Der entstehende Interessenskonflikt bedarf eines ständigen Ausgleiches. AlleAnspruchsgruppen tragen deshalb eine große soziale Verantwortung. Probleme entstehenimmer dann, wenn Anspruchsgruppen Druck auf das Unternehmen ausüben, um zusätzlichesEinkommen aus der Wertschöpfung einzufordern, z.B., wenn der Kapitalgeber zulasten derBelegschaft, des Umweltschutzes oder der Existenzsicherung des Unternehmens kurzfristigemaximale Gewinne fordern. Wenn diesem Druck nachgegeben werden wird, müssen andereAnspruchsgruppen auf Einkommen verzichten. Die so entstandenen Probleme können bis zurExistenzgefährdung des Unternehmens führen. Die Gesellschaft erwartet von denUnternehmen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. [...]"D 61 "Durch diese ökonomische Logik werden allgemeine, außerhalb der Produktionssphäreangesiedelte Interessen strukturell benachteiligt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen umallgemeine Interessen und Bedürfnisse aus den Bereichen Umwelt, Verkehr, Freizeit etc."E 21 "Kritiker werfen den Fondsverwalter vor, diese Unternehmen rücksichtslos auf Kosten derBeschäftigten und ihrer Arbeitsplätze zu sanieren und ihre Unternehmenspolitik ausschließlichauf die zu erwartenden Verkaufsgewinne auszurichten."FG125 "[…] Der Staat kann zwar Lohnuntergrenzen setzen, aber keinem Arbeitgeber befehlen, zudiesen Löhnen Mitarbeiter zu beschäftigen. Wenn Beschäftigte mehr kosten, als sieerwirtschaften, geht der Arbeitsplatz verloren - und neue Jobs werden nicht angeboten. [...]"181 "Die kritische ökonomische Stagnation des letzten Jahrzehnts in den Industrieländern,verbunden mit der weiteren Verelendung der Länder der "Dritten Welt" (oder wie heute besserzu formulieren ist: der "globalen Peripherien") und den daraus resultierenden Konflikten undsozialen Spannungen könnte in absehbarer Zeit überwunden werden."111
AnhangKategorie 4: Ebenen der <strong>Wirtschaftsethik</strong>Buch Seite Textstelle1. Makroebene: Rahmenordnung, WirtschaftsgesetzeA 82 "Eine Zwischenform bildet die soziale Marktwirtschaft. In ihr soll die Selbststeuerung derMarktwirtschaft auf der Grundlage des Privateigentums grundsätzlich über den Markt erfolgen.Das Prinzip des freien Marktes soll aber mit dem Ziel des sozialen Ausgleichs verbundenwerden. Der Staat soll zu diesem Zweck aktiv in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen(Regulierung von Monopolen, Sicherung der Geldwertstabilität etc.) [...]"A 90 "Das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft entstand gegen Ende des Zweiten Weltkriegs undgriff Elemente des Liberalismus und der christlichen Soziallehre auf. Geistige Väter desKonzepts waren Walter Eucken (1891 - 1950), Professor für Volkswirtschaftslehre, und AlfredMüller-Armack (1901 - 1978), später Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft.Diese Wirtschaftsordnung wurde in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere durch denspäteren Bundeskanzler Ludwig Erhard (1897 - 1977) politisch durchgesetzt. In ihr kommt demStaat die Aufgabe zu, die sozial unerwünschten Auswirkungen der Marktwirtschaft zuverhindern oder wenigstens anzumildern. „Sozial" steht für soziale Gerechtigkeit undSicherheit. "Marktwirtschaft" steht für wirtschaftliche Freiheit. [...] Die Aufgabe der sozialenMarktwirtschaft ist es auf Grundlage der Marktwirtschaft das Prinzip der Freiheit mit sozialerGerechtigkeit zu verknüpfen. Damit liegt die Wirtschaftsordnung zwischen den beiden Extremender auf dem Individualprinzip aufgebauten freien Marktwirtschaft und der auf demKollektivprinzip beruhenden Zentralverwaltungswirtschaft. [...]"A 91 "Schreibt das Grundgesetz (GG) die soziale Marktwirtschaft zwingend vor? GrafischeDarstellung diverser Grundgesetze: GG Art. 2, 9, 11, 12, 14 Abs. II Freie Entfaltung derPersönlichkeit, Handlungsfreiheit, mit besonderer Bedeutung auf ökonomischem Gebiet -Unternehmens- und Gewerbefreiheit, - Wettbewerbsfreiheit, - Vertragsfreiheit [...] GG Art. 109[...] GG Art. 14 Abs. II, 15, 20 [...] Die soziale Marktwirtschaft ist verfassungsrechtlich zwarnicht vorgeschrieben, aber der Gesetzgeber ist an die Grundrechte, das Sozial- und dasRechtsstaatsgebot gebunden, d. h. die soziale Marktwirtschaft entspricht am ehestenfreiheitlichen und demokratischen Prinzipien."A 313 "Handelsrecht: Wechsel- und Scheckrecht, Aktienrecht, Gesellschaftsrecht" innerhalb einerB 24 /25Grafik."In ihr kommt dem Staat die Aufgabe zu, die sozial unerwünschten Auswirkungen derMarktwirtschaft zu verhindern oder wenigstens abzumildern. "Sozial" steht für sozialeGerechtigkeit und Sicherheit, "Marktwirtschaft" steht für wirtschaftliche Freiheit. [...] Danachhat der Staat dafür zu sorgen, dass dem Wettbewerbsprinzip in der Wirtschaftsordnungumfassend Rechnung getragen wird. Wie kann jedoch das Wettbewerbsprinzip durchgesetztwerden? Wie also kann eine Wettbewerbsordnung geschaffen und erhalten werden? Euckenführt sieben Voraussetzungen an, die er konstituierende Prinzipien nennt. [...]" Diese Prinzipienwerden dann erläutert.B 27 "Im Grundgesetz finden sich keine Entscheidungen für eine bestimmte Wirtschaftsordnung.Seine "wirtschaftspolitische Neutralität" ermöglicht es dem Gesetzgeber, die ihm jeweilssachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Die gegenwärtige Wirtschafts- undSozialordnung ist keinesfalls die verfassungsrechtlich einzig mögliche (BVerfGE 4, 8/18). [...]Die Wirtschaftspolitik muss dem Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit einerseitsund der in Art. 20 Abs. 1 getroffenen Entscheidung für den Sozialstaat andererseits gerechtwerden. Die allgemeine Handlungsfreiheit auf wirtschaftlichem Gebiet hat folgendeAuswirkungen: a) Es steht jedem frei, ob er sich wirtschaftlich betätigen will("Unternehmerfreiheit"), [...] b) Die wirtschaftliche Freiheit enthält die Wettbewerbsfreiheit,d.h. das Recht jedes Unternehmens oder Unternehmers, mit anderen Unternehmen auf demMarkt in Konkurrenz zu treten. [...]Das GG hebt selbst das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1)hervor, versteht das Eigentum nicht nur als Freiheitsrecht, sondern auch als Verpflichtung (Art.14 Abs. 2) und lässt die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen undProduktionsmitteln in Gemeineigentum zu (Art. 15). [...]"C 78 "Für das gesellschaftliche Umfeld setzt vor allem der Staat die Rahmenbedingungen. In derBundesrepublik Deutschland hat er z. B. den Schutzbereich der Tarifautonomie als staatsfreienRaum geschaffen, die Entscheidungsrechte im Unternehmen im Wesentlichen den Eigentümern112
Anhangzugebilligt, die Entscheidungskompetenz jedoch durch Mitbestimmung der Arbeitnehmerbeschränkt. Die Förderung bestimmter Wirtschaftszweige beeinflusst der Staat z. B. mit derSteuerpolitik, mit der Umweltpolitik, mit Gesetzen und Verordnungen."C 80 "– freier Wettbewerb --> Wettbewerbsrecht, – freie Arbeitsplatzwahl --> Arbeitsrecht […]"CCCC174 "Die Wirtschaftsordnung eines Landes umfasst die Gesamtheit der für die Organisation einerVolkswirtschaft geltenden Regeln und zuständigen Institutionen. Sie setzt den Rahmen für denWirtschaftsprozess, in dem die Unternehmen, der Staat und die privaten Haushalte arbeitsteiligzusammenwirken. [...] Moderne Wirtschaftsordnungen werden üblicherweise nach zweiMerkmalen gruppiert: 1. nach den Eigentumsrechten an den Produktionsmitteln und 2. nachdem Planungsmechanismus. Danach werden zwei Grundtypen von Wirtschaftsordnungenunterschieden, die freie Marktwirtschaft und die Zentralverwaltungswirtschaft."181 "Die soziale Marktwirtschaft beruht auf den Grundlagen der Marktwirtschaft. DerenFunktionsfähigkeit wird durch einen staatlichen Ordnungsrahmen gewährleistet. Zugleichübernimmt der Staat eine Reihe von Aufgaben wie die soziale Absicherung, dieWettbewerbssicherung und den Umweltschutz. Großen Anteil an der konzeptionellenEntwicklung und der praktischen Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschlandnach dem Zweiten Weltkrieg hatten Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister, Alfred Müller-Armack als Wissenschaftler und Staatssekretär unter Erhard sowie die Wissenschaftler dersogenannten Freiburger Schule um den bereits erwähnten Walter Eucken. Tatsächlich wardiese Konzeption sehr erfolgreich und trug entscheidend zum deutschen "Wirtschaftswunder"nach dem Zweiten Weltkrieg bei. Die soziale Marktwirtschaft steht im Einklang mit dengrundlegenden Festlegungen der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, demGrundgesetz (GG) vom 24.05.1949, auch wenn darin keine explizite Festlegung für einebestimmte Form der Wirtschaftsordnung enthalten ist. [...]"311 "Das Zusammenleben der Menschen und ihr Verhältnis zum Staat wird im gesetzten (positiven)Recht geregelt. Bedeutendste Rechtsquelle ist die Verfassung bzw. das Grundgesetz. An denRegelungen und Wertungen des Grundgesetzes haben sich alle anderen Gesetze, Verordnungenund Satzungen sowie die richterlichen Entscheidungen zu orientieren. Die Rechtsordnung inDeutschland wird dabei zunehmend von europäischem Recht bestimmt und beeinflusst. Dieunterschiedlichen Rechtsquellen des Rechtsstaates stehen in einem hierarchischen Verhältniszueinander."312 "Grundrechte sind elementare Rechte, die einem einzelnen Menschen zustehen und in derVerfassung verankert werden. Sie sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat und stellen zugleichGrundprinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens dar. Die Artikel 1 bis 19 desGrundgesetzes beinhalten den Grundrechtekatalog unserer Verfassung. An erster Stelle stehtals Ausprägung des Naturrechtsgedankens die Menschenwürde. In Artikel 1 heißt es: „DieWürde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung allerstaatlichen Gewalt.“ Wichtige Grundrechte: Artikel 2: Recht jedes Menschen auf freieEntfaltung seiner Persönlichkeit; Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowieUnverletzlichkeit der Freiheit [...]"C 326 "Öffentliches Recht: Europarecht, Staats- und Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht,Sozialrecht, Steuerrecht, Strafrecht, Prozessrecht …; Privatrecht: Zivilrecht: – Schuldrecht, –Sachenrecht, – Erbrecht, – Familienrecht, – Handelsrecht, – Gesellschaftsrecht, –Urheberrecht"D 42 "Sie verweist aber auf eine annähernd gleichrangige Verteilung der Lasten in der Gesellschaft,jedoch ist ebenso die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft zu beachten, dieökonomische Ungleichheit akzeptiert."D 41 /42"Leitprinzip der im Grundgesetz festgelegten staatlichen Ordnung der Bundesrepublik ist dieMenschenwürde. Art. 1 Abs. 1 GG bestimmt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zuachten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Menschenwürde ist derinnere und zugleich soziale Wert und Achtungsanspruch, der dem Menschen um seinetwillenzukommt. Sie ist jedem Menschen angeboren und unverlierbar. [...] Im Grundgesetz wird derSozialstaat nun in Art. 20 Abs. 1 GG ausdrücklich erwähnt und gefordert. Aus dieser sogenannten „Sozialstaatsklausel" lässt sich aber nicht die Einrichtung eines umfassendenWohlfahrtsstaates ableiten. [...]"E 47 "Grundgesetz von 1949, letzte Änderung 2000 […]"F 74 "[...] "Sozial" steht für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit, "Marktwirtschaft" fürwirtschaftliche Freiheit. Die soziale Marktwirtschaft hält grundsätzlich an der Souveränität desIndividuums fest. [...] Das Grundziel der sozialen Marktwirtschaft heißt entsprechend: "So viel113
AnhangFreiheit wie möglich, so viel staatlicher Zwang wie nötig." Ihre Aufgabe ist es, auf derGrundlage von Markt und Wettbewerb das Prinzip der Freiheit mit dem des sozialen Ausgleichsund der sozialen Gerechtigkeit zu verknüpfen. [...]"F 46 "Ein richtig verstandener Pluralismus ist sich der Tatsache bewusst, dass das Mit- undNebeneinander der Gruppen nur dann zur Begründung eines a posteriori-Gemeinwohls zuführen vermag, wenn die Spielregeln des politischen Wettbewerbs mit Fairneß gehandhabtwerden, wenn die Rechtsnormen, die den politischen Willensbildungsprozess regeln,unverbrüchlich eingehalten werden, und wenn die Grundprinzipien gesitteten menschlichenZusammenlebens uneingeschränkt respektiert werden, die als regulative Idee den Anspruch aufuniversale Geltung zu erheben vermögen."F 48 "Grundlage der staatlichen Ordnung: das Grundgesetz […] Art. 1 (1) Die Würde des Menschenist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. […]Art. 20 (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat[...]"F 80 "[…] Die Grundrechte in Art. 1 ff. verkörpern sowohl Ansprüche als auch Abwehrrechtegegenüber dem Staat. Die hierauf beruhende Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft istprinzipiell offen, der Staat verzichtet der Gesellschaft gegenüber auf einen Ordnungsanspruch.[...]"G 185 "Die Auffassung von der grundsätzlichen Verantwortlichkeit des Staates für die wirtschaftlicheund soziale Entwicklung Deutschlands fand nach dem Zweiten Weltkrieg Ausdruck in demKonzept der Sozialen Marktwirtschaft, das sich am Sozialstaatspostulat des Art. 20 desGrundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland orientiert. Die soziale Marktwirtschaft will aufmarktwirtschaftlicher Grundlage das Prinzip der Freiheit mit dem des sozialen Ausgleichs undder sozialen Gerechtigkeit verbinden. [...] Als Instrumente stehen dem Staat in erster Linie diemarktwirtschaftliche Intervention und die gesetzliche Sicherung sozialer MindeststandardsG 168 /170(Arbeitsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht) zur Verfügung. [...]""Die hauptsächlichen Gründe für diese Form des Handelns liegen in den sozialen undwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. […] Der Staat zieht sich aus der Wirtschaft zurück undbeschränkt sich auf die Schaffung und Kontrolle gesetzlicher Rahmenbedingungen."G 9 "Artikel 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen istVerpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das deutsche Volk bekennt sich [...] Artikel 20 (1)Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2) AlleStaatsgewalt geht vom Volke aus. [...]"G213 "Das Wirtschaftsrecht greift mit Regelungen umso stärker in die Betriebsstruktur ein, je größerdie Firma ist und je weniger ein einzelner Eigentümer persönlich haftbar gemacht werden kann.Grundlage sind das Arbeitsrecht, das Aktienrecht, das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) und dieMitbestimmungsgesetze. Zwar haben im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsordnung letztlichdie Eigentümer des Kapitals die Verfügungsgewalt über die Produktion, sie müssen jedochstrenge gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten, die derzeit im europäischen Rahmenharmonisiert werden. Betriebsverfassungsgesetz (BVG) gewährt den BeschäftigtenInformations- und Mitwirkungsrechte, die vor allem die Arbeitsbedingungen im Betriebbetreffen. Der Arbeitgeber kann nicht ohne Anhörung des gewählten Betriebsrates überEntlassungen und Einstellungen, Arbeitszeiten, grundlegende Veränderungen derArbeitsanforderungen, Urlaubspläne, Sozialeinrichtungen (Kantine, Aufenthaltsräume) oder dieSanitäreinrichtungen verfügen. Der Betriebsrat als gewählte Arbeitnehmervertretung istandererseits gesetzlich zu loyalem Verhalten gegenüber den Bedürfnissen des Betriebesverpflichtet."2. Mesoebene: Unternehmensethik, LeitbilderA 159 "Multinationale Unternehmen sind in mehreren Staaten - oft weltweit - operierende undproduzierende Konzerne, wobei die in einem Staat angesiedelte Muttergesellschaft über meistrechtlich selbstständige Tochtergesellschaften in anderen Staaten Umsätze tätigt. Dieumgangssprachlich auch "Multis" oder "Global Player" genannten Unternehmen entstehendurch internationale Kapitaltransaktionen (Direktinvestitionen). [...] Zudem wird so dieAbhängigkeit der Unternehmen von nationaler Wirtschaftspolitik und Gesetzgebung sowie vonnationalen Konjunkturschwankungen vermieden bzw. abgeschwächt. [...]"114
AnhangB 32 -34B"[...] Fortschrittliche Unternehmen wissen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit imBetrieb nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch erfolgreich macht. Je stärker ein Unternehmerselbstverantwortlich gestaltet, desto sicherer wird seine Position gegen externe, zumeistideologische Einflüsse. Die offene Zusammenarbeit, eine kompromisslose Geschäftsintegrität,Innovations- und Leistungsorientierung, Mitbeteiligung am Gewinn und Kapital für alleBeschäftigten sind Werte, die jedes Unternehmen aufstellen kann. Dazu brauchen wir keineneuen Gesetze, Bundestarife, Quoten oder Ideologen. Sechstens: Ein Unternehmen wird seinergesellschaftlichen Verantwortung gerecht, wenn es die Beziehungen seiner Mitarbeiter zuKunden, Partnern, zur Gesellschaft und innerhalb des Unternehmens durch allgemein gültigeWerte fördert. Wichtig dabei ist, dass Werte auch gelebt werden und sie uns nicht im Halsstecken bleiben, wenn wir zum Beispiel in diesen Tagen beobachten, wie Führungskräfte inWirtschaft und Politik ihre Glaubwürdigkeit durch persönliches Fehlverhalten verspielen. [...]"288 "Unternehmensethik lässt sich aufbauen auf dem Gedanken, dass Interaktion durch Regeln undVerträge nicht vollständig bestimmt ist. Es bleiben den Unternehmen nach Festlegung derRegeln immer noch unterschiedliche Wege zur Verfolgung ihres Eigeninteresses innerhalb derRegeln. Bei vielen Verträgen, die sie abschließen - und Regeln selbst sind Verträge derGesellschaft -, sind weder Leistungen und Gegenleistungen vollständig festgelegt,beispielsweise nach Inhalt und Zeitpunkt, noch ist die Vertragserfüllung immer hinreichendpräzise feststellbar und sind selbst gerechtfertigte Ansprüche immer mit hinreichenderSicherheit durchsetzbar. Die Verlässlichkeit wechselseitiger Verhaltenserwartung wird hiernicht durch formelle Regeln wie in der <strong>Wirtschaftsethik</strong> hergestellt, sondern durchSelbstbindung der beteiligten Unternehmen. Ein Unternehmen, das sich individuell aufbestimmte Maßnahmen und Verhaltensweisen festlegt, die seinen Interaktionspartnern Fairnessund Vertrauen signalisieren, bietet sich als verlässlicher Interaktionspartner dar. Es baut damiteine Reputation auf, die in der globalisierten Wirtschaft zu einem wichtigsten Kapital werdenkann. [...]"B 32 "Deutsche Manager blicken gerne, wenn sie sich ihre Gehälter ansehen, nach Amerika; aberdieser neidvolle Blick ist riskant, weil nicht nur die amerikanischen Gerichte gegen räuberischeund betrügerische Praktiken sehr schnell Anklage erheben; es existiert dort auch eine ganzandere Unternehmenskultur. [...]"B 210 "[…] Unternehmensidentität (corporate identity) […]"C 89 /91"Die Zielsetzung eines Betriebes besitzt in der Regel zwei Komponenten: – eine wirtschaftlicheKomponente und – eine soziale Komponente. [...] Die soziale Komponente beinhaltet dieVerpflichtung, Löhne und Gehälter zu zahlen, Steuern zu entrichten, das Leben und dieGesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und für ein Betriebsklima zusorgen, das Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht und die Würde jedes Einzelnen gewährt."C 140 "In engem Zusammenhang mit der Personalentwicklung steht die Planung derPersonalerhaltung. Sie befasst sich mit der Schaffung von optimalen Arbeitsbedingungen, einemguten Betriebsklima, dem Ausbau von Sozialleistungen der Unternehmen und der Betreuung derMitarbeiter. [...] Die Personalführung ist personenbezogen und umfasst alle Maßnahmen, dasVerhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen, um so Ziele und Entscheidungen auf den einzelnenEbenen des Unternehmens umzusetzen. Als Führungsmittel stehen den Vorgesetzten z. B. zurVerfügung: – materielle Mittel wie Arbeitsentgelt, betriebliche Sozialleistungen, –motivationsfördernde Mittel wie Informationen, Kommunikation, Kooperation, Delegation."C 149 /150C"Die Integration dieser Interessen in die Unternehmenstätigkeit und die Wechselbeziehungenmit den Stakeholdern bezeichnet man als Corporate Responsibility (CR). CorporateResponsibility (CR) vereint Verhaltensregeln des Unternehmens (Corporate Governance), dieökonomischen, sozialen und ökologischen Faktoren der Unternehmenstätigkeit (CorporateSocial Responsibility) sowie das bürgerliche Engagement des Unternehmens in derGesellschaft (Corporate Citizenship) im Interesse aller Anspruchsgruppen desUnternehmens."151 "Die freiwillige gesellschaftliche und soziale Verantwortung von Unternehmen (CorporateSocial Responsibility, CSR) spielt im Wirtschaftsleben eine immer wichtigere Rolle im Kampfgegen Armut, Umweltzerstörung und andere globale Probleme. Aufgaben wie Umweltschutzund Menschenrechte sowie soziale und gesellschaftliche Aufgaben, die über Rechtsvorschriftenhinausgehen, werden dabei unter dem Aspekt der globalen Vernetzung und unterBerücksichtigung der Standpunkte aller am Unternehmen beteiligten Anspruchsgruppen(Stakeholder), wie Arbeitnehmer, Anteilseigner, Kapitalgeber, Lieferanten und Kunden, auffreiwilliger Basis übernommen. Dabei muss die Tatsache, dass Unternehmen auf115
AnhangGewinnerzielung und die Befolgung von Rechtsnormen ausgerichtet sind, nicht im Widerspruchzu CSR-Zielen stehen. [...]"150 Das Wort „Leitbild“ wird in einer Grafik erwähnt unter Verhaltensregeln.CC 163 "Mitbestimmung kennzeichnet die Einflussmöglichkeiten von Arbeitnehmern aufEntscheidungen im Unternehmen. Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene wird durch dasMontan-Mitbestimmungsgesetz 1951 (Montan-MitbestG), das Betriebsverfassungsgesetz 1952und 1972 (BetrVG) und das Mitbestimmungsgesetz 1976 (MitbestG). In Aktiengesellschaften,GmbH u. Ä. mit mehr als 500 Beschäftigten wirkt das Drittelbeteiligungsgesetz von 2004. [...]"C165 "[...] Auch innerhalb der Europäischen Union sind die Mitbestimmungsregeln sehrunterschiedlich und beziehen sich vor allem auf die Rechte am Arbeitsplatz, auf dieBetriebsverfassung und die Mitbestimmung auf Unternehmensebene. In Deutschland hat dieMitbestimmung ein herausragendes Niveau erreicht, in Österreich, Dänemark, Luxemburg undSchweden sind die Arbeitnehmer/-innen mit ähnlich weitreichenden Mitbestimmungsrechtenausgestattet. Auf mittlerem Niveau ist die Mitbestimmung in Belgien, Finnland, Frankreich undGriechenland ausgeprägt, beschränkt sind die Mitbestimmungsrechte in Italien, Spanien und inenglischsprachigen Ländergruppen. [...]"E 21 "Um im globalen Wettbewerb mitzuhalten und Arbeitsplätze sichern zu können,benötigen Unternehmen Kapital."E 64 "Als Betriebsrat stehen Ihnen nach dem Betriebsverfassungsgesetz bestimmte MitbestimmungsundMitwirkungsrechte zu. Bei den Mitbestimmungsrechten kann der Vorstand erst mit IhrerZustimmung Entscheidungen umsetzen. Zu diesem Bereich gehören soziale Angelegenheiten (z.B. Beginn und Ende der Arbeitszeit, Entlohnungsgrundsätze). Ein eingeschränktesMitbestimmungsrecht haben Sie bei personellen Angelegenheiten (z. B. Einstellungen,Versetzungen, Entlassungen). [...]"F256 "Multinationale Unternehmen (MNU) können als treibende Kraft der Globalisierung betrachtetwerden. Sie verfügen über große technische und finanzielle Ressourcen, ihr Anteil amWelthandel ist außerordentlich hoch. Die MNU verfügen über zahlreiche Wettbewerbsvorteileund können durch ihre vergleichsweise hohe Mobilität stärker von Vorzügen (z.B.Steuervorteilen und Subventionsangeboten) einzelner Standorte profitieren. Gleichzeitig sind sieuntereinander einer starken Konkurrenz ausgesetzt. Durch ihre Bedeutung für Investitionen undBeschäftigung ergibt sich parallel zu ihrer ökonomischen auch ihre politische Macht. [...]"F 93 "[…] Chancengleichheit und Gleichberechtigung (etwa der Arbeitnehmer im wirtschaftlichenEntscheidungsprozess) sind sozialpolitische Ziele, die z.B. in der staatlichen Bereitstellung vonBildungseinrichtungen sowie in den Mitbestimmungsregelungen desBetriebsverfassungsgesetzes (...) ihren materiellen Ausdruck finden. [...]"GG208 "Die Rechte der Arbeitnehmer schränken notwendigerweise die Entscheidungsfreiheit desUnternehmen bzw. des Kapitaleigners ein, daher sind sie Gegenstand gesellschaftlicherAuseinandersetzungen, in denen es um Schutzrechte für die Arbeitnehmer, Mitwirkungs- undMitbestimmungsrechte im Betrieb, Rechte auf soziale Absicherung (z. B. durch dieSozialversicherungen) geht. [...]"213 "Das Wirtschaftsrecht greift mit Regelungen umso stärker in die Betriebsstruktur ein, je größerdie Firma ist und je weniger ein einzelner Eigentümer persönlich haftbar gemacht werden kann.Grundlage sind das Arbeitsrecht, das Aktienrecht, das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) und dieMitbestimmungsgesetze. Zwar haben im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsordnung letztlichdie Eigentümer des Kapitals die Verfügungsgewalt über die Produktion, sie müssen jedochstrenge gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten, die derzeit im europäischen Rahmenharmonisiert werden. Betriebsverfassungsgesetz (BVG) gewährt den BeschäftigtenInformations- und Mitwirkungsrechte, die vor allem die Arbeitsbedingungen im Betriebbetreffen. Der Arbeitgeber kann nicht ohne Anhörung des gewählten Betriebsrates überEntlassungen und Einstellungen, Arbeitszeiten, grundlegende Veränderungen derArbeitsanforderungen, Urlaubspläne, Sozialeinrichtungen (Kantine, Aufenthaltsräume) oder dieSanitäreinrichtungen verfügen. Der Betriebsrat als gewählte Arbeitnehmervertretung istandererseits gesetzlich zu loyalem Verhalten gegenüber den Bedürfnissen des Betriebesverpflichtet."3. Mikroebene: Individuum als WirtschaftsakteurA 84 "Der Markt ist das Nervenzentrum der Wirtschaft, dort treffen die Wünsche und Absichten vonKonsumenten und Produzenten aufeinander, von Arbeitgebern und -nehmern, von Vermieternund Mietern - kurz: von Angebot und Nachfrage. […]"116
AnhangB 7 "Chancen und Probleme, die aus diesen Wirtschaftsordnungen für Produzenten undKonsumenten entstehen, werden deutlich."B 51 "[...] Gerade in einer Marktwirtschaft in der Wandel und Dynamik vorherrschen, ist eher eineEntwicklung mit ständigen Veränderungen zu erwarten, da Millionen an Einzelentscheidungenvon Produzenten, Konsumenten und Arbeitnehmern getroffen sowie laufend neue Produkte undProduktionsverfahren eingeführt werden. [...]"B124 "Die Arbeitnehmer erhalten neben Löhnen und Gehältern auch Einkommen aus Kapitalanlagen,z. B. Zinsen, Dividenden, Mieten, Pachten. […]"C 24 "Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das wichtigste Abgrenzungskriterium zwischenPrivathaushalt und Unternehmen die Stellung auf den Faktor und Gütermärkten: – PrivateHaushalte bieten Faktorleistungen an (Anbieter), welche von Unternehmen nachgefragt werden(Nachfrager). – Unternehmen produzieren Güter und Dienstleistungen (Anbieter), welche vonprivaten Haushalten konsumiert werden (Nachfrager). "CC140 "Ein Leitsatz der Personalführung lautet: „Führungskraft ist, wer andere erfolgreich macht.“Dazu sind erforderlich: – Vorbildfunktion und Kompetenz ausstrahlen, – Förderung derSelbstständigkeit der Mitarbeiter, – Kommunikation und Kooperation pflegen."194 "Den Unternehmen stehen die Nachfrager gegenüber, d.h. die privaten Haushalte alsVerbraucher oder Konsumenten."D 62 "So sind die Investitionsbereitschaften von Unternehmen und Kapitaleignern, die Streikfähigkeitvon Arbeitnehmern, das Konfliktpotenzial bestimmter Berufsgruppen […]"E 33 "Ein solcher Schritt erscheint annehmbar, auch wenn den Konsumenten dadurch ein paarSchnäppchen entgehen: Produzenten in Europa und der Dritten Welt gewinnen etwas mehr Zeit,um Antworten auf die chinesische Exportmaschine zu finden."E 17 "Als "Erwerbstätige" gelten alle Arbeitnehmer und Selbstständigen sowie Beschäftigte mit Mini-Jobs (400 Euro) und Ein-Euro-Jobs."FG260 "[…] Jeder Bürger hat zwei Seelen in seiner Brust. In seiner Eigenschaft als Produzent möchteer sein Einkommen maximieren, indem er seine Produkte zu möglichst hohen Preisen verkauft.In seiner Eigenschaft als Konsument strebt er nach größtmöglichem Nutzen, indem er sich beiWaren gleicher Qualität für das jeweils Billigste entscheidet, auch wenn es ausländischerHerkunft ist. [...]"175 "Die beiden handelnden Gruppen/Personen, die sich auf den Märkten gegenüberstehen: derAnbieter, der ein Gut verkaufen, und der Nachfrager, der ein Gut kaufen will, habendiesbezüglich unterschiedliche Interessen. […]"Kategorie 5: Aktuelle Problem- bzw. Beschäftigungsfelder der<strong>Wirtschaftsethik</strong>Buch Seite Textstelle1. Globalisierung und WeltwirtschaftsordnungA 157 "Der weltwirtschaftliche Strukturwandel wird heute mit dem Schlagwort der Globalisierungbezeichnet. Die Karriere des Begriffes nach 1990 lässt sich historisch begründen: Die 1990erJahre waren durch drei einschneidende Entwicklungen gekennzeichnet, die zu einer neuenQualität der Internationalisierung der Wirtschaft führten. - Die dramatische Weiterentwicklungder Computer- und Informationstechnik ermöglichte eine neuartige, weltweit verflochteneProduktionstechnik und Logistik, z. B. sekundenschnelle weltweite Finanztransaktionen undInstant-Preisvergleiche mit der Folge eines intensivierten Kostenwettbewerbs. DerZusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa und in seinem Gefolge der Übergangvom vorwiegend politisch definierten Systemwettbewerb (zwischen Marktwirtschaft undSozialismus) zum vorwiegend ökonomisch definierten Standortwettbewerb nahezu aller Staatenmiteinander. Dieser Wettbewerb erfasste weltweit auch Provinzen und Städte. Sie alle musstensich viel intensiver als zuvor um das mobile Kapital bemühen. Die rasante wirtschaftlicheEntwicklung von Schwellenländern, allen voran die Länder Asiens, zu wichtigen Akteuren derglobalen Ökonomie. Der Begriff Globalisierung hat neben der wirtschaftlichen Dimensionzahlreiche Facetten - politische, gesellschaftlich-soziale, kulturelle und rechtliche, die eine117
AnhangA 378 -380AAABbegriffliche Klärung erschweren. Allen Dimensionen gemeinsam ist die zunehmende globaleVernetzung, Interdependenz (wechselseitige Abhängigkeit) und Entgrenzung vonLebensbereichen, die vormals relativ autonom und begrenzt gestaltet waren. [...]""Der Kritiker: Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker ist Vorsitzender der Enquete-Kommission"Globalisierung der Weltwirtschaft" des Bundestages. [...] fluter: Herr Weizsäcker, welcheChancen und Risiken liegen in der Globalisierung? von Weizsäcker: Die Globalisierung ist einzweischneidiges Schwert. Es gibt Verlierer und Gewinner dieses Prozesses. Sie beschert unszum Beispiel eine riesige Warenauswahl, aber die Vielfalt an Saatgut und Nutzpflanzen hatdramatisch abgenommen. Es gibt zwar gelbe, rote und orangene Maiskolben - aber die kommenalle vom selben Feld. Insgesamt ist es so, dass die Schwachen wenig von der Globalisierunghaben und die Starken von ihr profitieren. [...] Der Euphoriker Hans-Olaf Henkel war bis 2000Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). [...] fluter: Herr Henkel, wasbedeutet für Sie Globalisierung? Henkel: Für mich ist die Globalisierung nach der Aufklärungund der Erklärung der Menschenrechte die größte gute Nachricht für die Menschheitüberhaupt. Globalisierung bedeutet ja nicht nur, dass Waren, Güter und Dienstleistungen umdie Welt gehen. Sie beinhaltet vielmehr einen Austausch der besten Ideen. [...]"170 "Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung der Welt erfordert Möglichkeiten derBeeinflussung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen durch supranationaleOrganisationen - sei es, dass diese den Abbau von Schranken für den freien Güter- undKapitalverkehr fördern, sei es, dass regionale oder globale ökonomische Fehlentwicklungenoder Risiken korrigiert werden sollen. Supranationale Lösungen werden umso notwendiger, jemehr sich die Unternehmen internationalisieren und durch nationalstaatliche Politik kaummehr erreicht werden können. Die Versuche einer weltwirtschaftlichen Ordnungspolitik werdenunter dem Begriff der Global Economic Governance zusammengefasst. Im Zentrum der GlobalEconomic Governance-Architektur stehen dabei internationale Organisationen wie dieWelthandelsorganisation, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank."171 "Die Gründung der WTO (World Trade Organization, Welthandelsorganisation) geht auf dieInitiative der Freihandelsbefürworter zurück, welche die Meinung vertraten, dass freier undungehinderter Handel sich positiv auf den Wohlstand aller Nationen auswirkt. Daher wurdekurz nach dem Zweiten Weltkrieg das GATT (General Agreement on Tarifs and Trade)geschlossen. Seine Nachfolgerin, die WTO, nahm 1995 ihre Tätigkeit auf. Ihre 152Mitgliedstaaten (2008) haben folgende Ziele und Aufgaben: - die Liberalisierung desinternationalen Handels, - den Abbau von Handelsbeschränkungen sowie - die Schlichtung vonHandelsstreitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten. Die WTO gilt als "Hüterin desFreihandels" und schafft mit der Beseitigung von Handelshemmnissen entscheidendeVoraussetzungen für den Globalisierungsprozess. Die Organisation legt seit 1995 als einzigeinternational anerkannte Vertragsinstitution Regeln für den Welthandel fest. [...]"325 "Am 13. Dezember 2007 unterzeichneten die EU-Staats- und Regierungschefs in derportugiesischen Hauptstadt Lissabon die geplante neue Vertragsgrundlage der EuropäischenUnion. Der Vertrag von Lissabon sollte ursprünglich zum 1. Januar 2009 in Kraft treten undden bislang gültigen Vertrag von Nizza ersetzen. Vor Inkrafttreten muss er von allenMitgliedstaaten ratifiziert werden (Irland lehnte den Vertrag in einem Referendum ab). DerVertrag von Lissabon übernimmt in weiten Teilen die Bestimmungen des EuropäischenVerfassungsvertrags, auch wenn das Verfassungskonzept als solches aufgegeben wird. ZentraleAnliegen des Vertrags von Lissabon sind eine verbesserte Handlungsfähigkeit der EU-27 undeine Stärkung der demokratischen Legitimation der EU. So soll etwa die Einbeziehung derCharta der Grundrechte in den neuen Vertragstext sowie die Einführung eines EuropäischenBürgerbegehrens die Rolle der Bürger aufwerten. Außerdem werden die Kompetenzen desEuropäischen Parlaments ausgeweitet. [...]"196 "Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn die Firma, in der man arbeitet, plötzlich mit Betriebenaus Gegenden der Welt konkurriert, von denen man bisher kaum gehört hatte. Es hat mitGlobalisierung zu tun, wenn sich junge Leute, die durch die Anden wandern, aus demInternetcafe in Quito bei ihren Eltern in Oberursel melden und mal eben per E-Mail die erstendigitalen Fotos schicken. Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn wir vom PC aus unserenUrlaub buchen und wenn Studenten sich nachmittags aus dem Internet Material aus Amerikafür ihre Hausarbeit holen. Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn in dem Auto, das wir kaufen,die Teile aus vielen Ländern kommen, wenn also das "Made in Germany" manchmal nur nochfür die Idee, für die Endmontage oder für den Namen steht. [...] Von der Globalisierung sindwir alle betroffen - noch bevor alle genau wissen, wie sie eigentlich funktioniert. Darum müssenwir zu begreifen versuchen, was geschieht und warum es geschieht. Wir müssen die118
AnhangBB 215 /216BBBB 246 -248Globalisierung als politische Herausforderung verstehen und politisch handeln. Damit wir dieGlobalisierung gestalten können, brauchen wir neue politische Antworten."203 "Die Globalisierung ist ein komplizierter Prozess der durch unterschiedliche Faktorenhervorgerufen wird: Der weltweite Abbau von Handelsbeschränkungen […] und die damitverbundene Liberalisierung der Finanzmärkte gehören zu den politischen Voraussetzungen;Mikroelektronik als kommunikationstechnische Basistechnologie, gesunkene KommunikationsundTransportkosten sind technologische Faktoren; zu den gesellschaftlichen Faktoren zählendie Angleichung der Verbraucherbedürfnisse weltweit (Konvergenzthese). Hervorgerufen wirddies durch eine Angleichung des Informationsstandes der Gesellschaften durch den immereffizienteren Einsatz von Kommunikationsmitteln. Sie ermöglichen eine schnelle und weltweiteVerbreitung von Wissen, Erfahrungen und Ideen (Akkulturation). Dazu trägt auch die weltweiteReisetätigkeit bei.""In der gängigen Debatte um die "Globalisierung" mischen sich jedoch mindestens zweiKritiklinien. Die erste sieht - ganz in der Tradition linker Imperialismuskritik - in derGlobalisierung einen Prozess, der die armen Länder der "Dritten Welt" weiter in Armut undAbhängigkeit hält, indem er ihre Wachstumschancen behindert und ungleicheVerteilungsstrukturen verfestigt. Die zweite befürchtet dagegen, dass die Globalisierung denWohlstand der reichen Länder gefährdet, wenn auch - dies wiederum in antikapitalistischerKontinuität - vor allem die Interessen der Arbeiter und sozial Schwachen in den reichenLändern bedroht seien, einmal direkt durch Schwächung ihrer Marktposition, aber auchindirekt durch "Sozialabbau", also die Beschränkung sozialpolitischer Sicherungs- undKorrekturmöglichkeiten von Marktergebnissen. Die Armen in den armen Ländern müssten derökonomischen Theorie zufolge von der Globalisierung eher profitieren, da sie die Nachfragenach billiger Arbeit und damit ihren Preis erhöht. Die Reichen bzw. besser qualifiziertenArbeitnehmer in den armen Ländern müssten dagegen mit relativen Einkommenseinbußenrechnen, da sie verschärfter Konkurrenz aus den reichen Ländern ausgesetzt sind, die übereinen relativen Überfluss an Kapital und hoch qualifizierten Arbeitskräftenverfügen. [...]"205 "Schrittmacher der Globalisierung sind Unternehmen mit ausländischen Niederlassungen oderTochterunternehmen, so genannte transnationale Unternehmen. Ihre Organisationsform ist einNetzwerk mit einer Reihe wechselseitig abhängiger und geographisch verteilter Zentren, die vongemeinsamen Strategien, Normen und einem intensiven Austausch von Informationen,Erfahrungen und Ressourcen zusammengehalten werden. Mit ihren Direktinvestitionenvernetzen transnationale Unternehmen nationale Volkswirtschaften und werden damit zumHerzstück der globalen Weltwirtschaft. Transnationale Unternehmen treiben dengrenzüberschreitenden Transfer von Finanzkapital, Technologie und Managementfähigkeitenvoran. [...]"236 "Da [ein] hoher Regelungsbedarf für grenzüberschreitende Probleme gesehen wird, wird nachalternativen Steuerungsmodellen in der globalisierten Welt gesucht. Der Versuch zurBewältigung der globalen Herausforderungen wird unter dem Schlagwort Global Governancediskutiert. Grunderkenntnis ist dabei, dass sich bei Globalisierung der Probleme auch "die"Politik globalisieren muss. Dies bezieht sich nicht nur auf die Zusammenarbeit zwischen denStaaten [...], sondern auch auf die Entwicklung eines neuen Politikmodells, bei dem staatlicheund nichtstaatliche Akteure auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten. Somit meint GlobalGovernance (der Begriff grenzt sich bewusst von der Vorstellung eines Global Government -also zu einer Art "Weltregierung" - ab und ist am besten mit "Weltordnungspolitik" zuübersetzen) erstens die Neudefinition staatlicher Souveränität, zweitens die Verdichtung undVerrechtlichung der internationalen Beziehungen, drittens die Erweiterung des Kreises derAkteure über die Staaten hinaus und viertens ein neues Verständnis für Außenpolitik, bei demein normatives, am "Weltgemeinwohl" orientiertes Verständnis vorherrscht und dasgemeinsame Überlebensinteresse der gesamten Menschheit in den Vordergrund rückt. [...]"242 Den einzelnen Institutionen ist jeweils ein komplettes Unterkapitel gewidmet. "DieWelthandelsordnung WTO […] Der internationale Währungsfonds (IWF) und andereInstitutionen […]""a) Die WTO abschaffen! Die WTO hat drei große Probleme. Zunächst schwört sie auf dasfalsche Entwicklungsmodell, nämlich auf das neoliberale Modell. Sie glaubt, dass Entwicklunggleichbedeutend ist mit Wirtschaftswachstum. Ihr zweites Problem sind die enormenUnterschiede zwischen den Mitgliedern. Denn die 148 WTO-Länder sind sowohl in ihrerWirtschaftsstärke als auch im Einflussvermögen völlig ungleich. Das wird durch dieundemokratischen und undurchsichtigen Verhandlungsstrategien noch verschlimmert. Und119
Anhangdrittens tragen WTO-Vorschriften dazu bei, dass Entwicklungsländer durch wohlhabendeLänder systematisch daran gehindert werden, sich weiterzuentwickeln - zum Beispiel. [...] b)Die WTO - besser als ihr Ruf. Die Welthandelsorganisation (WTO) sei undemokratisch, siebenachteilige die ohnehin schwachen Entwicklungsländer und fungiere lediglich alsverlängerter Arm multinationaler Konzerne - Vorwürfen dieser Art sieht sich die internationaleEinrichtung immer wieder ausgesetzt. Vor allem Globalisierungsgegner haben sich mittlerweileauf die Organisation mit Sitz am Genfer See eingeschossen. [...]"C 44 Methodenseite zur Globalisierung mit Einübung von Mind-Maps. Gewinner und Verlierer derGlobalisierung, z. T. mit Entstehungsgeschichte.C256 "Globalisierung bezeichnet einen zunehmenden Welthandel, eine steigende internationaleAusrichtung von Unternehmen sowie die wachsende Bedeutung der internationalenFinanzmärkte."C 87 "Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzog sich der Prozess der zunehmendeninternationalen Verflechtung in allen Bereichen der Gesellschaft, ermöglicht durch solcheVoraussetzungen wie: – den technischen Fortschritt, insbesondere auf den Gebieten Logistik,Daten- und Informationsverarbeitung und Kommunikation, – die Liberalisierung des Handelsund der Politik und – den Aufbau internationaler Finanzmärkte und eines freienKapitalverkehrs. Für die Unternehmen ist die weltweite Verflechtung eine bedeutendeStrategie der Unternehmensentwicklung. Gekennzeichnet war dieser Prozess durch einekontinuierliche Belieferung von Auslandsmärkten durch Exporte. [...] Das Ergebnis diesesProzesses der internationalen Verflechtung ist die Herausbildung transnationalerUnternehmen, sogenannter Global Players. Deutschland ist eines der führenden Länder imProzess der weltweiten wirtschaftlichen Verflechtung. [...]"CCC269 "Chancen und Risiken des Binnenmarktes […] Chancen und Risiken der Wirtschafts- undWährungsunion […]" bei beiden Punkten werden jeweils tabellarisch die Risiken und Chancengegenübergestellt.263 "Um die Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes zu gewährleisten, wurde bereitsim EWG-Vertrag die Schaffung einer den Binnenmarkt ergänzenden Wettbewerbsordnung alsZiel festgelegt. […] Politisch kann Wettbewerb gewährleistet oder gefördert werden, indem mitgeeigneten Maßnahmen die Rahmenbedingungen für einen freien Wettbewerb geschaffenwerden. Wettbewerbspolitik umfasst alle Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Förderung desWettbewerbs dienen; sie setzt damit die Rahmenbedingungen für das Marktverhalten derWirtschaftssubjekte. [...]"274 "Um die Potenziale eines weltweiten Freihandels auszuschöpfen, müssen Staaten weltweitVerhaltensprinzipien finden und vertraglich absichern. Diesbezügliche Bemühungen fandenihre Ausgestaltung im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) und später in derWelthandelsorganisation (WTO). [...]" GATT und WTO werden anschließend ausführlicherläutert.E 10 "Als Globalisierung bezeichnet man den Prozess der zunehmenden Vernetzung von Wirtschaft,Politik und Kultur in großen Teilen der Welt in Verbindung mit einem wachsenden Austauschvon Waren, Dienstleistungen, Kapital, Menschen und Ideen. Produktion und Handel über dieGrenzen von Staaten hinweg sind nichts Neues. Das gab es in größerem Umfang bereits seit derKolonialisierung Amerikas, als zwischen Kolonien und Mutterländern ein reger Handel mitRohstoffen und Fertigwaren einsetzte. Einen neuen Schub erlebte der internationale HandelEnde des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zahlreiche technischeInnovationen (Eisenbahn, Dampfschiff, Telefon) erleichterten Kommunikation undWarenverkehr. Neue arbeitsteilige Produktionsmethoden erhöhten die Produktivität undschufen die Grundlagen für den enormen Aufschwung des internationalen Handels. [...]"E 36 "Die wirtschaftlichen Beziehungen von Staaten sind durch ein komplexes Geflecht von Regelnund Verträgen bestimmt. Die Gesamtheit aller Regeln, Vorschriften und Abkommen bezeichnetman als Weltwirtschaftsordnung. Diese untergliedert sich in die Weltwährungsordnung, die denZahlungs- und Kapitalverkehr regelt, und die Welthandelsordnung die den Güter- undDienstleistungsverkehr steuert. Die Welthandelsordnung wurde maßgeblich von der WTO(World Trade Organization, seit 1994) und ihrem Vorläufer, dem GATT (General Agreement onTariffs and Trade) gestaltet. Der WTO gehören heute (2007) 149 Staaten an. [...]"E 37 Tabellarische Darstellung der Organisationen: ASEAN, EU, G8, ILO, IWF, Mercosur, NAFTA,OECD, UNCTAD, Weltbank, WTO mit ihren jeweiligen Mitgliedern sowie Aufgaben undZiele.120
AnhangEF 243ff.127 "Auf der globalen Ebene sind Institutionen gefragt, die für spezifische Handlungsbereicheunabhängig von einzelwirtschaftlichen und einzelstaatlichen Sonderinteressen entscheiden undhandeln können (global governance). Anfänge eines globalen Ordnungsrahmens gibt es bereits,etwa in Form internationaler Institutionen (wie Welthandelsorganisation, InternationalerGerichtshof, Institutionen der UNO wie Weltarbeitsorganisation oderWeltgesundheitsorganisation) und Vereinbarungen (wie die Weltklimakonvention von 1992).[...]""Mit dem Wort Globalisierung verbinden sich bei den Menschen in allen Erdteilen Hoffnungund Ängste. […] Globalisierung ist die weltweite Verflechtung in erste Linie die wirtschaftliche.[…] Definitionen. Globalisierung ist - die "größte wirtschaftliche und gesellschaftlicheUmwälzung seit der industriellen Revolution" (Dirk Messner / Franz Nuscheler); [...]" weitereDefinition unterschiedlicher Personen werden gegeben. "Dimensionen der Globalisierung [...]Kommunikation [...], Ökonomie [...], Soziales [...], Ökologie [...], Kultur [...]. Chancen undRisiken der Globalisierung [...] Viele Gruppen in unserer Gesellschaft werden unterschiedlichvon der Globalisierung betroffen und beeinflusst. Man spricht mitunter auch vonGlobalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern. [...]" Die einzelnen Gruppen:Konsumenten, Aktienbesitzer, Arbeitnehmer, Staaten werden nun einzeln ausführlich betrachtetund diskutiert.F 79 "Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einerWirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4genannten Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische,ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohesBeschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männernund Frauen, ein beständiges nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad vonWettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Maß anUmweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und derLebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischenden Mitgliedsstaaten zu fördern."FFFFFF132 "Wenn die EU jetzt die richtigen Wirtschaftsreformen durchführt, kann sie Europa eine Zukunftin Wohlstand sichern, die soziale Gerechtigkeit aufrechterhalten und ökologischeNachhaltigkeit gewährleisten. […] Aus diesem Grund haben die Staats- und Regierungschefsder Europäischen Union auf dem Lissabonner Gipfel im März 2000 eine neue (...) Strategievorgestellt, die darauf abzielt, Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu steigern. DieseStrategie wurde als "Lissabon-Strategie" bekannt (s. auch S. 79) und deckt ein sehr breitesSpektrum politischer Maßnahmen ab. [...]"148 "Good Governance (gute Regierungsführung): gutes Steuer- und Regelungssystem einerpolitischen Einheit."165 "[…] Deutschland ist Exportweltmeister. Wir, aber nicht nur wir, sind auf prosperierende,stabile Märkte weltweit angewiesen. Dann müssen wir aber auch allen Ländern die Chancegeben, an einem fairen globalen Wirtschaftssystem teilzunehmen. […] wir müssen dieinternationalen Handelsregeln fair und entwicklungsfreundlich gestalten, und wir müsseninternational verbindliche Spielregeln für grenzüberschreitend agierendeWirtschaftsunternehmen definieren. [...]"209 "In zahlreichen multilateralen Verhandlungsrunden kamen die beteiligten Staaten überein,Handelsbeschränkungen drastisch abzubauen, und schufen mit der schlichtungs- undsanktionsbewehrten Welthandelsorganisation (WTO) eines der schlagkräftigsten Instrumenteder "global governance". Die Mitgliedschaft der WTO umfasst inzwischen fast alle Staaten derErde. Mit der Liberalisierung des Welthandels zielt die Staatengemeinschaft erfolgreich aufWachstumsimpulse und damit auf eine Mehrung weltwirtschaftlichen Wohlstands. [...] DieWelthandelsorganisation (engl. World Trade Organization, WTO) ist eine internationaleOrganisation mit Sitz in Genf, Schweiz, die sich mit der Regelung von Handels- undWirtschaftsbeziehungen beschäftigt. [...]"218 "Kernprinzipien der WTO. Angestrebtes Ziel der WTO ist der weltweite Abbau allerHandelsschranken. Zu dessen Verwirklichung bedient sich die machtvolle Organisationverschiedener Abkommen mit folgenden Grundsätzen: Das Prinzip der Gleichbehandlung derHandelspartner oder Meistbegünstigung (Most Favoured Nation, MFN) verpflichtet ein WTO-Mitglied dazu, alle handelspolitischen Vorteile, insbesondere Zollermäßigungen, die einemWTO-Mitglied gewährt werden, auch allen anderen Mitgliedern einzuräumen. [...]"228 "Die UNO […] Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) […]Internationaler Währungsfonds (IWF) […] Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich121
AnhangGGGff.(BIZ) […] Die WTO - eine Sonderorganisation der UNO […] GATT - Vorläufer und heute Teilder WTO [...]" All diese Institutionen werden jeweils in einem kurzen Text näher erläutert.116 "Globalisierung umfasst sowohl wirtschaftliche als auch soziale, kulturelle und polischeAspekte."221 "Globalisierung bezeichnet die zunehmende internationale Verflechtung der Wirtschaft, die sichaber nicht in allen Bereichen gleichmäßig und gleich schnell vollzieht. Zu unterscheiden sindGlobalisierung der Produktion: Produkte werden aus Rohstoffen und Bestandteilen("Vorprodukten") hergestellt, die auf internationalen Märkten eingekauft werden.Globalisierung der Absatzmärkte [...] Globalisierung der Kapitalmärkte [...] Globalisierungdes Geldverkehrs [...] Globalisierung der Arbeitsmärkte [...]"222 "Internationale Vertrage, z. B. das GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - aus demdie WTO (World Trade Organisation) entstanden ist - haben zum Ziel, weltweiten freienWaren-, Kapital- und Informationsverkehr durchzusetzen, Zölle, Handelshemmnisse undGrenzbarrieren für die Wirtschaft schrittweise abzuschaffen."2. Nachhaltigkeit und UmweltschutzA 453 "Das Konzept der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bezeichnetein Bewirtschaftungsprinzip, nach dem nicht mehr Holz geerntet wird, als nachwachsen kann.Nachhaltigkeit heißt konkret: Wir dürfen heute und hier nicht auf Kosten der Menschen inanderen Regionen der Erde und auf Kosten zukünftiger Generationen leben. Für den Umgangmit unserer Umwelt bedeutet das, dass mit Blick auf die heutigen und zukünftigen Generationenein sorgfältiger und effizienter Umgang mit Ressourcen gepflegt werden muss. [...]"A398 Tabellarische Darstellung: "Handlungsbereiche: Schutz der Atmosphäre und der Ozonschicht;Umweltprobleme: - Erhöhung der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase in derAtmosphäre, - Schädigung der Ozonschicht durch FCKW (Ozonloch); Folgen/Gefährdungen:[...] Zunahme von Hautkrebs, grauem Star u .a. Erkrankungen durch schädliche UV-B-Strahlen[...]" Es folgen weitere vier Handlungsbereiche.A 99 "1994 wurde der Umweltschutz als allgemeines Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen(Art. 20a), so dass eine umweltverträgliche Wirtschaftsentwicklung als weiteres Stabilitätszielangesehen werden darf."A 266 "Greenpeace, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)"BB270 "[…] Sustainable development (nachhaltige Entwicklung) ist Entwicklung ohne physischesWachstum - eine physisch stabile Wirtschaft, die eine größere Kapazität zur Befriedigungmenschlicher Bedürfnisse entwickelt durch Steigerung der Ressourceneffizienz, nicht aber durchSteigerung des Durchsatzes an Ressourcen."280 "Im Zuge dessen weitet sich das Öko-Marketing zum Nachhaltigkeits-Marketing aus.Exemplarische Beispiele für die Verquickung von Kundenbedürfnissen mit ökologischen undsozialen Anliegen sind: - Fair Trade-Produkte wie Bananen, Kaffee und Schokolade in Bio-Qualität; - Sozialwohnungen in Niedrigenergie- oder Passivhaus-Bauweise; - Textilien, derenRohstoffe aus biologischem Anbau stammen und umweltschonend hergestellt werden. Bei derProduktion wird auf Kinderarbeit verzichtet und es werden soziale Mindeststandardseingehalten. - Solaranlagen in der Dritten Welt, die Elektrizität für Menschen inabgeschiedenen, ländlichen Regionen bereitstellen, zur Verbesserung der Lebensqualitätbeitragen und dadurch möglicherweise einer weiteren Landflucht entgegenwirken."B 68 "Die Union wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage einesausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine im hohen Maßewettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschrittabzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Siefordert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt."B274 "Die wohl am stärksten einengende Form der Umweltpolitik sind Auflagen in Form vonGeboten und Verboten. Hierunter werden Vorschriften verstanden, die bestimmte Vorgabenstaatlicherseits für Emittenten und Verursacher von Umweltschäden beinhalten. Beispiele sindHöchstgrenzen für den Schwefelgehalt leichter Heizöle, Einhaltung bestimmter Grenzwerte beider Einleitung von Schadstoffen in Gewässer (Wasserhaushaltsgesetz), Vorgabe vonGrenzwerten bei der Luftverschmutzung (Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. TechnischeAnleitung Luft), Einhaltung bestimmter Normen beim Lärmschutz(Bundesimmissionsschutzverordnung, Fluglärmgesetz), Begrenzung des Phosphatgehaltes inWaschmitteln (Waschmittelgesetz). [...]"122
AnhangCCCCCC155 "Der Umweltzerstörung entgegenzuwirken ist eine der Hauptaufgaben unserer Gesellschaft undspiegelt sich in vielfältigen Kriterien und Maßnahmen zum Umweltschutz wider. Mit derAgenda 21 ist ein Entwicklungs- und Aktionspapier des 21. Jahrhunderts als eine Art Leitpapierzur nachhaltigen Entwicklung von 180 Staaten auf der „Konferenz der Vereinten Nationen überUmwelt und Entwicklung“ (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) beschlossen worden.Schwerpunkte der Agenda 21 umfassen: 1. Soziale und wirtschaftliche Dimensionen 2.Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die Entwicklung 3. Stärkung der Rollewichtiger Gruppen 4. Möglichkeiten der Umsetzung. [...]"155 "Nachhaltigkeit ist die Form des Wirtschaftens, bei der die Ressourcen so genutzt werden, dasssie sich wieder regenerieren und somit nie verbraucht werden (Kreislaufwirtschaft). Zurückgeht der Begriff Nachhaltigkeit auf Hans Carl von Carlowitz, der die Bewirtschaftung einesWaldes als nachhaltig beschrieb, wenn dem Wald immer nur so viel Holz entnommen wird, wiewieder nachwachsen kann, sodass der Wald nie ganz abgeholzt wird und sich immer wiederregenerieren kann."157 "Das Umweltmanagementsystem (UMS) legt die Zuständigkeiten, Verhaltensweisen, Abläufeund Vorgaben zur Umsetzung der Umweltpolitik im Unternehmen strukturiert fest. Bausteinedieses Systems bilden die Planung, Ausführung, Kontrolle und Optimierung der Prozesse imUnternehmen. Aufgebaut ist das Umweltmanagementsystem entsprechend den individuellenBedürfnissen des Unternehmens. Vorgaben wie die EMAS-Verordnung undUmweltmanagementnormen (ISO 14001) geben praktische Hilfestellung. Diese Vorgabenstellen Mindestanforderungen an das Umweltmanagementsystem dar, wie – die schriftlicheFestlegung einer betrieblichen Umweltpolitik, – die Festlegung von Verantwortlichkeiten fürumweltrelevante Aufgaben, – die Vorgabe von Abläufen für umweltrelevante Tätigkeiten usw.[...]"160 "Forderungen an den Umweltschutz zu stellen, ist eine wichtige Aufgabe, Umweltschutzpraxiswirksam umzusetzen, die weitaus schwierigere, denn Umweltschutz und in diesemZusammenhang die Begrenzung von Emissionen und Immissionen, stellt immer einen Eingriffin die Handlungs- und damit auch in die Gewerbefreiheit dar. Sie dürfen deshalb nicht „umihrer selbst willen“ gestellt werden, sondern nur nach dem Maß der Schädlichkeit, das heißt derEinwirkung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Diese Aufgabe erfüllt das Gesetzzum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (BImSchG), das bedeutendste praxisrelevanteRegelwerk des Umweltrechtes in der Bundesrepublik. [...]"280 "Es werden jedoch auch Nachteile der wachsenden weltwirtschaftlichen Verflechtungenkontrovers diskutiert. Neben weiter wachsenden Entwicklungsunterschieden zwischen Arm undReich sind dies insbesondere negative Folgen für die ökologische Umwelt offensichtlich. Zudemwird durch die Konkurrenz mit Ländern, die über nur geringe Umweltschutzstandards verfügen,eine Erosion bestehender Standards befürchtet. Ökologische Umwelt bezeichnet die Gesamtheitaller auf ein Lebewesen einwirkenden Ökofaktoren. Dies sind zum einen die abiotischenFaktoren Luft, Wasser und Boden sowie zum anderen die biotischen Faktoren Pflanze, Tier undMensch. [...] Luft- und Wasserverschmutzung sowie Bodenverschlechterung (Degradierung)sind die Folgen: [...] Insgesamt birgt die Umweltverschmutzung Gefahren für die menschlicheGesundheit und führt zu Artensterben. Der bedenkenlose Ressourcenverbrauch wird außerdemdazu führen, dass viele Ressourcen schon in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden."281 "Umweltpolitik bezeichnet die Gesamtheit aller politischen Handlungen zur Erhaltung oderVerbesserung der ökologischen Umwelt. Damit soll Umweltpolitik helfen, bestehendeUmweltschäden zu vermindern oder zu beseitigen und die Entstehung neuer Umweltschädenmöglichst zu vermeiden. Als eigenständiges Politikfeld hat sich die Umweltpolitik zu Beginn der1970er-Jahre herausgebildet, da sich in dieser Zeit die ökologischen Folgen einesungebremsten industriellen Wachstums deutlich zeigten. [...]"D 65 "[…] oder für die Belange der Allgemeinheit wie Umwelt- und Naturschutz (altruistischeVerbandsklage) führen."D103 "In einzelnen Politikfeldern war der Prozentsatz wesentlich höher: 66,7 Prozent derEntscheidungen in der Umweltpolitik in der 11. Wahlperiode […]"E 78 "Der Erdvertrag (Nachhaltige Entwicklung). Das Ziel dieses Vertrags ist, weltweit zu einerÜbereinkunft zu gelangen, die die negativen Folgen der Globalisierung für die Umwelt auf einMindestmaß reduziert. Dazu sind Vereinbarungen auf sehr vielen Gebieten erforderlich, die u.a. die Fragen der Emission umweltschädlicher Gase (CO2 usw.) oder des Aufbaus einernachhaltigen Landwirtschaft betreffen."123
AnhangE 36 "Globalisierungskritiker werfen ihr u. a. vor, dass sie ihre Entscheidungen ausschließlich unterhandelspolitischen Gesichtspunkten treffe dabei der Gesundheits-, Umwelt- undVerbraucherschutz auf der Strecke bliebe."E146 "Umwelt: Die Wirtschaft soll umsichtig mit ökologischen Herausforderungen umgehen,Initiativen zur Förderung eines verantwortlicheren Umgangs mit der Umwelt durchführen undsich für die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien einsetzen."E 79 "In dem größeren Raum der Region, so die Theorie hätten die Länder mehr Macht undEinflussmöglichkeiten zur Durchsetzung von eigenen Ideen im Bereich der Wirtschafts-, SozialundUmweltpolitik."F 95 "Nachhaltige Entwicklung heißt - Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, - Wahrung derLebenschancen heutiger und zukünftiger Generationen weltweit, - Integration ökologischer,ökonomischer und sozialer Belange. […] Obwohl Nachhaltigkeit inzwischen in Wissenschaftund Öffentlichkeit ein häufig gebrauchter Begriff ist, gehen die Meinungen darüber, wasdarunter zu verstehen ist, nach wie vor ziemlich weit auseinander. [...] DieNachhaltigkeitsdiskussion will u. a. die Frage beantworten, wie diese Anforderungen erfülltwerden können. Angestrebt wird ein Gleichgewicht zwischen den beiden Systemen Ökonomieund Ökologie, das ethischen Kriterien genügen soll."F 61 "[…] Probleme wie z.B. Globalisierung, die Entstehung und Nutzung neuer Technologien,Fragen der Gemeindeentwicklung, des Umweltschutzes, Klimawandels etc. werden sokontrovers diskutiert, dass herkömmliche, konventionelle Prozesse in der Politik häufig als nichtmehr ausreichend wahrgenommen werden oder es tatsächlich nicht mehr sind. [...]"F 79 "Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einerWirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4genannten Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische,ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohesBeschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männernund Frauen, ein beständiges nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad vonWettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Maß anUmweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und derLebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischenden Mitgliedsstaaten zu fördern."GG134 "Die individuellen Akteure tun ihrem hohen Niveau des Umweltbewusstseins dadurch Genüge,dass sie ihre "Umweltmoral" und ihre "Umwelteinsichten" in Situationen einlösen, die keineeinschneidenden Verhaltensänderungen erfordern, keine größeren Unbequemlichkeitenverursachen und keinen besonderen Zeitaufwand erfordern."188 "Zunehmende Bedeutung gewinnt das wirtschafts- und sozialpolitische Ziel, eine lebenswerteUmwelt zu erhalten (Umweltschutz). Das industrielle Wachstum hat bisher eine zunehmendeBelastung der Umwelt ("Umweltverschmutzung") mit sich gebracht. Die Folgen sind u. a.Auswirkungen auf die Lebenserwartung, Vernichtung von Erholungsgebieten, schwerwiegendeStörungen im ökologischen Gleichgewicht. Zwischen den Zielen "Erhaltung einer lebenswertenUmwelt" und "stetiges Wachstum" besteht ein geradezu unüberbrückbarer Zielkonflikt, soweitWachstum nahezu ausschließlich Wachstum der Produktion und des Konsums materieller Güterbetrifft. Wird dieses Wachstum jedoch gedrosselt, um die Umwelt zu schonen, droht dem Ziel"Vollbeschäftigung" und gegebenenfalls auch dem Ziel "außenwirtschaftliches Gleichgewicht"Gefahr."3. Wirtschaftskrisen und WirtschaftskriminalitätA 119 "Doch die Weltwirtschaftskrise 1929-33 beendete die "Grand Prosperity" nicht nur in den USA.Seit dem „Schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse sank Jahr für Jahr die Nachfrage. Jeweniger abgesetzt werden konnte, desto weniger wurde auch produziert. DieMassenarbeitslosigkeit erreichte bis dahin unvorstellbare Ausmaße. [...]"AA143 "Finanzkrise schwächt laut EZB Deutsche Wirtschaft (Die Welt, 20.09.2008). […] Finanzkrisemacht Banken nervös. EZB pumpt Milliarden in den Markt. Kurzfristige Finanzspritze: DieEuropäische Zentralbank stellt den Finanzmärkten rund 30 Milliarden Euro frisches Geld zurVerfügung (Süddeutsche Zeitung, 15.09.2008)"173 "Spekulative Finanztransfers können, wie die Immobilienkrise in den USA zeigte, das gesamteverflochtene Weltfinanzsystem erschüttern. […]"124
AnhangA 177 /178A 91 /277A"Chronik der großen Finanzmarktkrisen. Der Börsencrash von 1929. Während der zwanzigerJahre erlebte die Wall Street einen beispiellosen Ansturm der Anleger. Vom Glauben an einneues Zeitalter beseelt, spekulierten die Amerikaner wie wild mit Aktien und Immobilien.Erstmals wurden geschlossene Investmentfonds gegründet, die in einer Art Schneeballsystemden Wetteinsatz immer mehr erhöhten. Im Spätsommer 1929 erreichte der Börsenboom seinenHöhepunkt, am 24. Oktober platzte dann die Blase. Weil Millionen Menschen dabei ihrErspartes verloren, brach der Konsum sofort ein. Von der damals noch jungen Notenbank kamkeine Hilfe, so dass die US-Wirtschaft in eine zehnjährige Depression stürzte, die auch den Restder Welt mit in die Tiefe riss. Der Börsencrash von 1987 [...] Die Asienkrise 1997/98 [...] DerKollaps des neuen Marktes [...] Subprime Krise USA 2007/08 [...]""Vielmehr ist der Staat gefordert, Unternehmensfusionen und Kartelle zu verhindern. […]Bundeskartellamt sieht Kartellrechtsprobleme einer Fusion von Axel Springer undProSiebenSat.1. Nach bisheriger Einschätzung des Bundeskartellamts wäre derZusammenschluss der Axel Springer AG (Springer) mit der ProSiebenSat.1 Media AG(ProSiebenSat.1) kartellrechtliche nicht genehmigungsfähig. Betroffen wären von demZusammenschluss der Fernsehwerbemarkt, der Lesermarkt für Straßenverkaufszeitungen sowieder bundesweite Anzeigenmarkt für Zeitungen. Bundeskartellamtspräsident Ulf Böge: Auf dendrei betroffenen Märkten würde die Fusion von Deutschlands größtem Zeitungsverlag, der nacheigener Darstellung des Verlags auch international zu den führenden Medienunternehmenzählt, und dem TV-Unternehmen ProSiebenSat.1 nach derzeitiger Einschätzung zu einer nachdem Kartellrecht nicht genehmigungsfähigen Marktmacht führen. [...]"373 "[…] Dazu kommen vielerorts die Pest der Korruption, bad governance - katastrophaleRegierungsführung - und löchrige Bildungssysteme. […]"B 80 "Auf welch tönernen Füßen diese Theorie stand, zeigte sich in der Weltwirtschaftskrise 1929-32mit ihrer katastrophalen Massenarbeitslosigkeit. […]"B235 "Währungsschwankungen, Finanzkrisen, Rezessionen in den bedeutenden Ökonomien habenunmittelbare Auswirkungen auf andere Staaten, besonders auf Deutschland, das durch einestarke weltwirtschaftliche Verflechtung gekennzeichnet ist. […]"B 249 "Der Verlauf der Asienkrise. Nach Ansicht der meisten Autoren begann die Asienkrise am 2.Juli 1997 in Thailand, als die dortige Zentralbank den Wechselkurs der heimischen Währungfreigab, die umgehend 20 Prozent an Wert gegenüber dem US-Dollar verlor. Von Thailandausgehend griff die Asienkrise dann im Juli und August 1997 auf Indonesien, Malaysia und diePhilippinen, im November 1997 auf Südkorea über. Das Jahr 1998 brachte eine weitereVerschärfung der Krise, die sich im August 1998 auf Russland und in der Folge aufSchwellenländer außerhalb Asiens, wie Brasilien und Mexiko, ausdehnte. Der Auslöser derKrise. Was den Auslöser der Krise betrifft, so sind sich fast alle Beobachter darin einig, dassdie Asienkrise das Resultat einer panikartigen Reaktion internationaler Investoren darstellt, dieim Lauf des Jahres 1997 große Kapitalmengen aus Ostasien abzogen. Während die fünfSchwellenländer Indonesien, Thailand, Malaysia, die Philippinen und Südkorea im Jahr 1996noch insgesamt 93 Mrd. US-Dollar an privaten Kapitalzuströmen zu verzeichnen hatten, flossenim Jahr 1997 insgesamt 12,1 Mrd. US-Dollar ab. Die Differenz zwischen 1996 und 1997 betrugalso mehr als 105 Mrd. US-Dollar - eine Summe, die 11 Prozent des gesamtenBruttosozialprodukts der fünf Länder entspricht. [...]"BB 25 /28288 "Sind sie unzureichend, unvollständig oder kontraproduktiv, belohnen sie unerwünschtesVerhalten, zum Beispiel die Korruption durch steuerliche Absetzbarkeit vonBestechungsgeldern?""[...] Monopole und Kartelle können kraft ihrer Marktmacht unmittelbaren Einfluss auf diePreise nehmen. Außerdem führen sie oft zur Verringerung der Wettbewerbsintensität. Hierausfolgt, dass der Staat Kartelle oder Unternehmensfusionen, die den Wettbewerb beschränken,unterbinden muss. [...] Zwar ist nicht jede wettbewerbsbeschränkende Absprache zwischen denverschiedenen Erzeugern derselben Produkte ("Kartelle") verboten, doch darf durch siekeinesfalls ein monopolartiges Wirtschaftsgebilde entstehen."B 35 "Zusammen mit den hohen Steuern und Abgaben ist das der Boden für die Schwarzarbeit - dasUnsozialste von allem."C260 "[...] Insbesondere haben jedoch übermäßige Investitionen, Kreditaufnahmen in Fremdwährungmit mangelnder Währungsabsicherung, hohe Handelsbilanzdefizite und unterentwickelteregionale Finanzmarktstrukturen in den 1980er- und 1990er- Jahren dazu geführt, dass es 1997zu einem plötzlichen Abzug spekulativer Gelder aus der gesamten südostasiatischen Regionkam. Vom Platzen dieser Spekulationsblase („Bubble“) und der daraus resultierenden125
AnhangCCsogenannten Asienkrise waren (neben Japan und Südkorea) insbesondere die fünfGründungsmitglieder der ASEAN betroffen. [...]"222 "Schwarzarbeit bedeutet, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit unter Umgehung gesetzlicherAnmelde- und Anzeigepflichten und vor allem ohne Steuer und Sozialabgaben ausgeübt wird.Die Schätzungen über ihr Ausmaß schwanken zwischen etwa 1 und 15 Prozent des BIP. Alsbesonders betroffene Branchen gelten der Bau, das Transportgewerbe, die Gastronomie und dieFleischverarbeitung. [...]"196 "Mit einem Kartellverbot soll verhindert werden, dass die Anbieter sich untereinanderabsprechen (z. B. über den Preis) und dann nicht mehr unabhängig voneinander agieren. Mitder Fusionskontrolle soll verhindert werden, dass sich mehrere zuvor unabhängige Anbieter zueinem Unternehmen zusammenschließen und so der Wettbewerb zwischen ihnen wegfällt. Mitdem Missbrauchsverbot sollen marktbeherrschende oder Gruppen von Unternehmen darangehindert werden, kleinere Konkurrenten vom Markt zu verdrängen oder die Nachfrager z. B.durch überhöhte Preise auszubeuten."C 264 "[...] Die europäische Wettbewerbspolitik konzentriert sich auf vier wesentlicheAufgabenbereiche: 1. Missbrauchs- und Kartellverbot: Wettbewerbsbeschränkungen werdenuntersagt und die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung bekämpft. 2.Fusionskontrolle: Unternehmenszusammenschlüsse werden kontrolliert, um z. B. die Entstehungeines marktbeherrschenden Unternehmens zu verhindern. 3. Liberalisierung: Durch Monopolegeprägte Wirtschaftssektoren werden für den Wettbewerb geöffnet. 4. Kontrolle staatlicherBeihilfen: Die Vergabe staatlicher Beihilfen wird kontrolliert, um mögliche Verfälschungen desWettbewerbs durch eine unrechtmäßige Beihilfenvergabe zu verhindern. [...]"E 56 "[…] dem Ausmaß der Korruption (Häufigkeit und/oder Größe der Bestechungszahlungen) [..]"E 27 "Experten schätzen, dass rund 90 Prozent der in China verkauften Software illegal hergestelltwerden. Auch komplexere Produkte werden massenhaft, vor allem durch geschicktes Aneignenvon Know-how kopiert […]. Der Staat duldet oder fördert sogar Produktpiraterie, solange siedie wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt."F224 "Das Vertrauen in die internationale Stabilität wurde durch die Banken- und Finanzkrise mitdem Höhepunkt im Jahr 2008 kräftig erschüttert. Insbesondere das Vertrauen in dieSelbststeuerungskraft des Marktes erhielt einen kräftigen Schlag, und der Ruf nachinternationaler Regulierung der Finanzmärkte wurde stärker. [...]Mitte 2000: Die US-Immobilienmärkte boomen: [...] Februar 2007: Erste Zahlungsausfälle bei Hypothekenkrediten:[...] April 2007: Erste Opfer in den USA: [...] Mitte August 2007: Notenbanken greifen ein [...]Jahresanfang 2008: Achterbahnfahrt an den Börsen [...] Frühjahr 2008: [...] 3. Oktober 2008:Der amerikanische Gesetzgeber beschließt eine Rettungsaktion für die Banken in Form vonBürgschaften und Beteiligungen [...] 8. Oktober 2008: Die wichtigsten Zentralbanken der Weltsenken die Leitzinsen. 10./11. Oktober 2008: In einer konzentrierten Aktion sichern die Staatender Europäischen Union das Bankensystem mit Bürgschaften und Beteiligungen ab, dieBundesrepublik Deutschland sichert die deutschen Banken mit bis zu 500 Milliarden Euro."F 91 "Kernstück des GWB war ursprünglich die Verhinderung von Kartellen, d.h. vertraglichvereinbarte Verhaltensregeln zwischen selbstständigen Unternehmen, z.B. zwecks einheitlicherPreisgestaltung. In einer umfassenden Reform wurde das GWB 1973 erweitert. So wurden auchnichtvertragliche Absprachen verboten und die Fusionskontrolle für große Unternehmeneingeführt. [...] Kartellkontrolle: Das Bundeskartellamt überprüft nach §§ 1-8 GWP dieRechtmäßigkeit von Kartellen und ahndet Verstöße gegen die entsprechenden Paragrafen. [...]"FG 183 /184G115 "[…] Dieser früher auch "Sockelarbeitslosigkeit" genannte Teil der Arbeitslosigkeit wie auchdas Ausmaß der "Schwarzarbeit" bezeichneten Schattenwirtschaft hat für Sozialpolitikeralarmierende Dimensionen angenommen. […]""Die Weltwirtschaftskrise, welche die Weltwirtschaft nach dem Zusammenbruch der NewYorker Börse (Wallstreet) am "Schwarzen Freitag" (25. Oktober 1929) in ihre bisher schwersteKrise stürzte, führte zunächst in den USA zu einer Umorientierung der staatlichenWirtschaftspolitik [...] Seit der Weltwirtschaftskrise gilt die Grundeinsicht, dass Staat undGesellschaft gemeinsam die Verantwortung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklungeines Landes tragen. [...]"192 "Absprachen und Vereinbarungen (Verträge) zwischen unabhängigen Unternehmen, um sichden Markt (regional oder sektoral) aufzuteilen oder um Angebotspreise vorab gegenUnterbietung zu schützen. Solche Kartelle wurden in der Bundesrepublik Deutschland vor allemzwischen Baufirmen z. B. bei Angeboten für öffentliche Bauvorhaben (U-Bahn in Frankfurt,Flughafenneubau bei Berlin) mehrfach gerichtlich verfolgt und geahndet."126
EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNGIch versichere, dass ich die beiliegende Diplomarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzunganderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt und die den benutztenQuellen wörtlich oder inhaltlich entnommen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. DieseArbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.Seckach, 30.10.2009_____________________________Ort, Datum__________________________________Unterschrift127
FREIWILLIGE ERKLÄRUNGIch stimme ausdrücklich zu, dass meine vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik betreuteDiplomarbeit mit dem Titel<strong>Wirtschaftsethik</strong> in wirtschaftskundlichen Schulbuchtextenan allgemein bildenden Gymnasiennach Beendigung der Diplomprüfung zu wissenschaftlichen Zwecken im Bereich derBibliothek für Psychologie und Erziehungswissenschaft (BPE) im Bibliotheksbereich A 3aufgestellt und zugänglich gemacht wird (Veröffentlichungen nach § 6 Abs. 1 UrhG) undhieraus im Rahmen des § 51 UrhG zitiert werden kann.Sämtliche Verwertungsrechte nach § 15 UrhG verbleiben beim Verfasser der Arbeit.______________________________UnterschriftName: Heike DienerStraße: Fasanenweg 23Ort: 74743 SeckachMannheim, 30.10.2009128