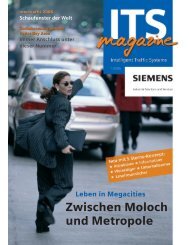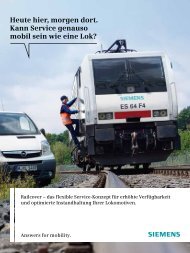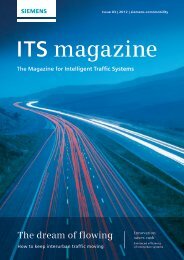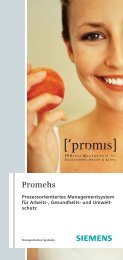SILOG News - Siemens Mobility
SILOG News - Siemens Mobility
SILOG News - Siemens Mobility
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalt<br />
Ausgabe 01/2012<br />
<strong>SILOG</strong> <strong>News</strong><br />
Automation für Post, Kurier-, Express- und Paket-Service<br />
www.siemens.com/mobility<br />
02 Jörg Ernst übernimmt<br />
Neuer Leiter von Infrastructure<br />
Logistics<br />
04 Sortierlösungen im Zentrum<br />
Jedes Sortierzentrum ist anders<br />
06 Faszinierende Technologie<br />
Mustererkennung ist mehr als<br />
Adresslesen<br />
08 Ideen schützen<br />
Patente demonstrieren Innovationskraft<br />
<strong>Siemens</strong> Paket-Entladesystem verdreifacht den Durchsatz am Tor<br />
Effizientes Paket-Entladen<br />
beginnt mit Variomove<br />
So groß und sperrig Pakete sind, so aufwändig und anstrengend war bisher ihre<br />
Entladung. Die Technologie des Variomove von <strong>Siemens</strong>, die kein Gegenstück auf<br />
dem Markt findet, setzt der Mühe ein Ende. Dafür hat <strong>Siemens</strong> Infrastructure Logistics<br />
den Innovationspreis der Logistik erhalten.<br />
Keine Frage, die Situation an den Entlade-<br />
Stellen der Distributionszentren werden<br />
angesichts erhöhter Paketströme immer<br />
häufiger zum Flaschenhals der Logistik. Wie<br />
es möglich ist, den Durchsatz an den Toren<br />
zu erhöhen, ohne mehr Personal und<br />
größere Kraftaufwände, zeigt die Innova-<br />
tion aus dem Hause <strong>Siemens</strong>. Der Inno-<br />
vations-Award für Transport und Logistik<br />
ging deshalb wie selbstverständlich an die<br />
Nürnberger und Konstanzer Ingenieure,<br />
die den mechanischen Hilfsgesellen namens<br />
Variomove mit verschiedenen Automationselementen<br />
entwickelten und zur<br />
Variomove für die effiziente LKW-Entladung<br />
Produktreife führten. Verliehen wurde der<br />
Preis auf der vergangenen Post Expo vom<br />
angesehenen Magazin Postal Technology<br />
International. Torsten Tanz fasst den verblüffenden<br />
Effekt der neuartigen Entlade-<br />
Lösung aus Nürnberg und Konstanz so<br />
zusammen: „Damit können Paketunternehmen<br />
eine Menge an Zeit, Aufwand<br />
und Kosten sparen. Schließlich müssen sie<br />
ihre Distributionszentren nicht umbauen,<br />
ihre Entladestationen nicht modifizieren<br />
und auch nicht ihr Transportkonzept ändern.“<br />
>> Seite 3<br />
<strong>News</strong>letter <strong>SILOG</strong> <strong>News</strong> 1
Editorial<br />
Jörg Ernst, Leiter Business Unit Infrastructure<br />
Logistics der <strong>Siemens</strong> AG<br />
Innovativ und vorwärtsweisend …<br />
… sind unsere Lösungen. In meiner<br />
langjährigen Tätigkeit für <strong>Siemens</strong><br />
hörte ich das immer wieder von<br />
Kunden – ob in den USA oder auf<br />
dem europäischen Kontinent. Ein<br />
schönes Lob, das uns zugleich Ansporn<br />
ist. Schließlich ist es keine<br />
Selbstverständlichkeit, dass Ideen<br />
in einem Unternehmen auf fruchtbaren<br />
Boden fallen. Noch weniger<br />
sicher ist es, dass es eine Idee bis zur<br />
Marktreife schafft. Geistesblitz und<br />
Beobachtungsgabe sind wichtige<br />
Voraussetzungen für Innovationen<br />
und Patente (S. 8). Doch genauso bedarf<br />
es engagierter Entwickler und<br />
Ingenieure, die sich der Umsetzung<br />
einer Idee bis ins Detail widmen.<br />
Und selbst wenn die Technik stimmt,<br />
ist der Weg noch nicht zu Ende. Denn<br />
erst wenn ein intelligentes Konzept<br />
wie die LKW-Entlade-Lösung (S.1)<br />
oder eine High-Tech-Komponente wie<br />
die Mustererkennung (S. 6) in einer<br />
kundenspezifischen Lösung zusammenfließen,<br />
haben Kreativität und<br />
Technik ihre Wirksamkeit bewiesen.<br />
Erst wenn unsere <strong>Siemens</strong>-Berater<br />
das beste Sortierkonzept für ein Land<br />
erarbeitet haben (S. 4), ist die reelle<br />
Leistungskraft einer Idee bewiesen.<br />
In diesem vernetzten Prozess, der auf<br />
den Ideen und den Erfahrungen vieler<br />
baut, arbeite ich gerne als neuer IL-<br />
Leiter!<br />
Ihr Jörg Ernst<br />
Wechsel im Management der <strong>Siemens</strong> Infrastructure Logistics<br />
Dr. Stefan Keh übergibt<br />
den Stab an Jörg Ernst<br />
Jörg Ernst ist neuer CEO der Infrastructure Logisics (IL). Gänzlich neu ist das Thema<br />
Postlogistik für den 45-jährigen nicht, da er bis 2001 Qualitätsleiter bei IL in Konstanz<br />
war. Und darum empfindet er den Wechsel von Nürnberg nach Kostanz durchaus<br />
als ein „nach Hause kommen“. Dr. Stefan Keh, der sieben Jahre lang an der Spitze<br />
der IL stand, verließ diese, um die Leitung der IT-Solutions innerhalb der Division<br />
<strong>Mobility</strong> and Logistics wahrzunehmen. Wie Keh, so wird auch Jörg Ernst alles daran<br />
setzen, um den Service für den Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus weiter<br />
zu steigern. Und er will Innovationen vorantreiben, die die Logistik von Waren effizienter<br />
gestalten.<br />
Seine Zeit in den USA, in Cincinnati, Ohio<br />
und Alpharetta, Georgia hat ihn geprägt.<br />
Dort lebte der gelernte Maschinenbauer<br />
Jörg Ernst mit seiner Familie von 2005 bis<br />
2009. Hier sammelte er sehr viele intensive<br />
Eindrücke. Seither fühlt er sich – ganz<br />
so, wie auch Dr. Keh – auch in den USA<br />
zu Hause.<br />
Einen großen Erfahrungsschatz, aus dem<br />
Jörg Ernst bei der Meisterung seiner neuen<br />
Aufgabe schöpfen wird, erwarb er sich<br />
auch als Leiter des Business Segments Antriebssysteme<br />
für schienengebundene<br />
Fahrzeuge. Hier traf er viele strategische<br />
Entscheidungen, die dazu beitrugen, dass<br />
u.a. auch das globale Geschäft vorangetrieben<br />
werden konnte. Ein Punkt, den<br />
Ernst auch auf seiner Agenda sieht. Weiterhin<br />
liegen auch Jörg Ernst Produktinnovationen<br />
des Stammgeschäftes sehr am<br />
Herzen. Nur so, da ist er sich sicher „lassen<br />
sich die Produkte der Zukunft entwickeln.“<br />
Das, was ihn umtreiben wird, ist<br />
es, gemeinsam mit den Mitarbeitern und<br />
Mitarbeiterinnen weltweit, Antworten darauf<br />
zu finden, „wie sich die Güter des<br />
täglichen Lebens noch effizienter und einfacher<br />
zustellen lassen.“ Denn die Herausforderungen<br />
der Zukunft, so sieht es Jörg<br />
Ernst, sind klar – als Lösungsanbieter für<br />
die Logistik von Waren geht es um die<br />
Entwicklung eines innovativen Logistik-<br />
Managements in Cities, vor allem in den<br />
boomenden Megacities. Dabei wird die IL<br />
unter der Leitung von Jörg Ernst die enge<br />
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit<br />
den Kunden weiterführen und global ausbauen.<br />
Erfahrungsschatz nutzend<br />
Bereits seit 1. Oktober 2011 leitet Dr.<br />
Torsten Caesar den Bereich der postalischen<br />
sowie der Kurier-, Express- und Paket-Lösungen.<br />
Zuvor arbeitete der promovierte<br />
Elektroingenieur in München und<br />
verantwortete dort bei <strong>Siemens</strong> Engineering<br />
und Entwicklung für Bahnelektrifizierung,<br />
Turn-Key-Systeme und intelligente<br />
Straßenverkehrssysteme. Wie für Jörg<br />
Ernst so ist auch für Dr. Caesar der Wechsel<br />
nach Konstanz ein Heimkommen. Bereits<br />
zwischen 1998 und 2007 arbeitete<br />
Torsten Caesar in Konstanz in unterschiedlichen<br />
Positionen der Entwicklung und<br />
des Projekt-Managements und lernte das<br />
Postgeschäft von Grund auf kennen und<br />
schätzen. In seiner Funktion als strategischer<br />
Kopf seines Segments wird er sich<br />
auf den Aufbau des wachsenden Paketgeschäfts<br />
konzentrieren ohne das schrumpfende<br />
aber profitablere<br />
Postgeschäft<br />
zu vernachlässigen.<br />
Dazu gehört vor allem<br />
eine eng verzahnteZusammenarbeit<br />
über Organisations-,Standort-<br />
und Landesgrenzen<br />
hinweg. > Fortsetzung: <strong>Siemens</strong> Paket-Entladesystems verdreifacht den Durchsatz<br />
Der große Vorteil der ausgezeichneten<br />
Technik ist die beschleunigte Entladung<br />
von Paketen und Stückgütern aus Transportmitteln<br />
wie Containern, LKW-Aufliegern,<br />
Wechselbehältern oder Rollbehältern.<br />
Das erhöhte Tempo bei der Entladung<br />
ist der Tatsache zu verdanken,<br />
dass mehrere Pakete als Paketstrom in<br />
ungeordnetem Zustand gleichzeitig aus<br />
dem Behälter bugsiert und über die Teleskopförderer<br />
einer Zusammenführung<br />
und danach dem Vereinzelungssystem<br />
Visicon von <strong>Siemens</strong> zugeführt werden.<br />
Die Entladebühne, die dies ermöglicht,<br />
ist eine begehbare, auf Rollen gelagerte<br />
Plattform, die vom Teleskop in das Transportmittel<br />
direkt zu den Paketstapeln geschoben<br />
wird. Es sind mehrere Gliederbänder<br />
auf dem Boden der Plattform angeordnet,<br />
die die Pakete aus dem LKW<br />
über eine Steigstrecke zum abführenden<br />
Teleskop befördern. Der Platz der Bedienkraft<br />
ist in der Mitte vorne angeordnet,<br />
um so Zugriff auf die rechts und links<br />
platzierten Rutschen zu geben. Die Rutschen<br />
mit ihrem Aufgabepunkt auf mittlerer<br />
Stapelhöhe sind nach vorn und hinten<br />
verschiebbar und können damit immer<br />
direkt an den Stapelstandort gelenkt werden.<br />
Nun braucht die Bedienkraft die Pakete<br />
nur noch auf die Rutschen zu schieben<br />
oder zu ziehen. Um den Stapelanteil,<br />
der unter der Rutschkante liegt auszuräumen,<br />
wird die Rutsche einfach nur aus<br />
dem Arbeitsbereich geschoben und die<br />
Pakete werden über die Bühnenkante auf<br />
die Gliederband-Förderer gekippt. Torsten<br />
Tanz betont: „Das bedeutet, während des<br />
gesamten Entlade-Prozesses muss kein<br />
Stückgut oder Paket mehr gehoben oder<br />
getragen werden. Die bisher notwendige,<br />
aber ergonomisch sehr ungünstige Drehbewegung<br />
der Bedienkraft unter Last entfällt<br />
komplett.“<br />
Schonend, sicher und schnell<br />
Der Vorteil für das Bedienungspersonal,<br />
das mit Hilfe des Variomove viel weniger<br />
Kraft als bisher aufzuwenden hat, ist nicht<br />
der einzige. Den Entwicklern von <strong>Siemens</strong><br />
liegt immer auch die Sicherheit der Be-<br />
dienkraft am Herzen: Mehrere Sensoren<br />
sorgen im Variomove dafür, dass der Bedienkraft<br />
während ihrer Arbeit an jeder<br />
Stelle geschützt ist. Und auch die Pakete<br />
selbst bzw. die Kunden, die sie bei der<br />
Post aufgeben, profitieren von der neuen<br />
Variomove ist ein wichtiger Baustein des „Parcel Bulk Unloading“ Konzepts<br />
<strong>Siemens</strong>-Lösung: Durch ihre elastische<br />
Konstruktion und eine spezielle dämpfende<br />
Lauffläche unter den Gliederbändern<br />
absorbiert die Bühne Stöße und Erschütterungen.<br />
Für die Logistiker eines Paketunternehmens<br />
hat das Ergebnis des neuartigen<br />
Entladekonzepts von <strong>Siemens</strong> auch deshalb<br />
besonderen Charme, weil es ihnen<br />
aus einem Dilemma heraushilft. Denn<br />
während die Paketströme anwachsen, geraten<br />
die Betriebsflächen mehr und mehr<br />
an ihre Grenzen. Der Variomove erhöht<br />
den Durchsatz pro Bedienkraft auf bis zu<br />
3000 Pakete pro Stunde und spart gleichzeitig<br />
Flächen ein. Torsten Tanz ergänzt:<br />
„Weil unsere Lösung den Gesamtsystem-<br />
Entlade-Durchsatz pro Tor verdoppelt,<br />
kann nicht allein Zeit, sondern auch Betriebsfläche<br />
eingespart werden.“ Und last<br />
but not least, können sich nicht nur die<br />
Anwender über das neue Gerät freuen,<br />
auch die Controller der Paket-Unternehmen<br />
loben das Konzept: Im Gegensatz zu<br />
andersartigen neuen Entladehilfsmitteln<br />
benötigt die <strong>Siemens</strong>-Lösung keine Modifikationen<br />
an den Toren oder den Transportmitteln.<br />
Auch aus diesem Grund zeigt<br />
ein Kosten-Nutzen-Vergleich eine bisher<br />
nicht dagewesene Effizienz. „Die Entwicklung<br />
trifft den Nerv des Marktes. Sie weist<br />
den höchsten Grad an Automation auf,<br />
der praktikabel ist,“ kommentiert Torsten<br />
Tanz.<br />
Erkennungstechnik – zu Ende gedacht<br />
Da die Pakete nun in beliebiger Orientierung<br />
auf den Paket-Sorter zulaufen, ist<br />
auch eine Weiterentwicklung der Erkennungstechnik<br />
erforderlich. Mehr-Seiten-<br />
Kamera-Tunnels, welche Bilder aller 6 Seiten<br />
des Pakets erfassen, sind bereits Stand<br />
der Technik. Neu ist jedoch die „Parcel<br />
Identification“ Lösung, die die <strong>Siemens</strong>-<br />
Ingenieure hier für die Verfolgung der Pakete<br />
bis auf den Hauptsorter einsetzen.<br />
Diese auf dem von der Großbrieftechnik<br />
her bekannten Fingerprint-Prinzip basierende<br />
Lösung ersetzt konventionelle Barcode-Scanner<br />
und öffnet die Tür zur Verarbeitung<br />
von Paketen mit Fremd-Barcodes<br />
oder sogar ohne Barcodes. <strong>Siemens</strong><br />
legt damit den technologischen Grundstein<br />
zu einer durchgängigen Paketverfolgung<br />
über die gesamte Lieferkette in einer<br />
Welt, in der Paketnetze internationaler,<br />
verflochtener und damit komplexer<br />
werden.
Land und Gebühren beeinflussen Logistik- und Sortierkonzepte für das Briefgut<br />
Mitten im Geschehen: <strong>Siemens</strong>-Maschinen<br />
sortieren, stempeln und stapeln groß und klein<br />
Zwar gleichen sich weltweit die Inhalte von Briefen, die Postkonzepte der Länder unterscheiden sich jedoch deutlich. Das<br />
wissen die Mitarbeiter des Postal and Logistics Consulting-Teams von <strong>Siemens</strong> sehr gut. Sie analysieren Post- und Verkehrsströme<br />
und bestücken die vordefinierten Sortierzentren mit den passenden Sortier-Maschinen und Zusatzanlagen. Im Fokus<br />
dieses Artikels steht die Mitte des Post-Sortierprozesses.<br />
Lösungsbeispiel für ein Sortierzentrum mit einem Open Mail Handling System für die Großbriefsortierung, zwei Integrated Reading and Video Coding Machines für<br />
die Briefsortierung inklusive Gangfolgesortierung sowie einem Culler Facer Canceller für die Vorverarbeitung von Sendungen aus Postkästen.<br />
„Im Grunde genommen ist es das Zeitfenster<br />
für die Sortierung, das letztlich<br />
bestimmt, wie viele Maschinen in welcher<br />
Ausprägung in einem Sortierzentrum arbeiten“,<br />
benennt Holger Ewert vom Postal<br />
and Logistics Consulting-Team bei <strong>Siemens</strong><br />
einen der bestimmenden Faktoren eines<br />
Post-Konzepts. Dieses Zeitfenster wiederum<br />
wird von vielen Parametern beeinflusst.<br />
Genau bei diesen Einflussgrößen<br />
beginnen die oft eklatanten Unterschiede<br />
zwischen den Post-Unternehmen der verschiedenen<br />
Staaten.<br />
Holger Ewert analysiert in seinen Projekten<br />
für ein Land die verschiedenen Einflussgrößen<br />
auf ein Postkonzept: Wie vie-<br />
le Standard- und Großbriefe durchqueren<br />
oder verlassen das Land, wie viel kosten<br />
die unterschiedlichen Formate, welche<br />
Verkehrswege stehen in welcher Qualität<br />
zur Verfügung und welche Lieferzeiten<br />
eines Briefes werden angestrebt? Am<br />
Ende all seiner Berechnungen steht eine<br />
klar umrissene Zeitspanne, die für die<br />
Sortierung bleibt. In Deutschland etwa,<br />
wo die Deutsche Post eine Servicequalität<br />
von einem Tag für 95 Prozent der Standardbriefe<br />
verspricht, beträgt die Spanne<br />
in der Regel vier bis fünf Stunden für die<br />
Abgangssortierung. Theoretisch wäre es<br />
zwar möglich, den ganzen Tag zu sortieren,<br />
da jedoch viele Großlieferanten ihre<br />
Post immer später am Tag abliefern, ist<br />
der Arbeitsvorrat erst in den Abendstunden<br />
groß genug, um die Maschinen auszulasten.<br />
Die Schweizerische Post schafft es, ihre A-<br />
Post in 97,5 Prozent der Fälle am Folgetag<br />
zuzustellen. Wohingegen die B-Post des<br />
Alpenstaates zwei Tage brauchen darf und<br />
deshalb auch weniger kostet. Diesen Fakt<br />
nutzt die Schweizerische Post dafür, B-Post<br />
im Hochregallager zu puffern und erst<br />
dann weiterzuleiten, wenn die Sortiermaschinen<br />
gerade wenig zu tun haben. Das<br />
Zwischenspeichern der Briefe sorgt für einen<br />
gleichmäßigen Auslastungsgrad der<br />
Maschinen. Am Schweizer Beispiel wird<br />
deutlich, dass die historisch gewachsenen<br />
Gebühren- und Sendungsstrukturen eines<br />
Landes direkten Einfluss auf die technische<br />
Ausstattung eines Sortierzentrums haben.<br />
„Das heißt, es gibt keinen Sortier- und Logistikplan<br />
von der Stange – jedes Postunternehmen<br />
benötigt ein auf seinen Bedarf<br />
zugeschnittenes Konzept“, erklärt Ewert.<br />
Dieses kundenspezifische Konzept erarbeiten<br />
die Prozessberater von <strong>Siemens</strong><br />
auf Basis ihres Modellierungs-Toolsets,<br />
das auf langjährigen Erfahrungen und<br />
Praxiseinsätzen aufbaut. Sind die Eingangsparameter<br />
für ein Land oder ein<br />
Service-Gebiet – etwa die Postvolumina<br />
und Postart, der Zustand der Verkehrsinfrastruktur<br />
und die Fahrpläne, die vorgegebenen<br />
Service-Level etc. – eingegeben,<br />
entwickelt das System einen Vor-<br />
schlag für ein realisierbares Szenario. Daraus<br />
können die Berater ableiten, wie der<br />
optimale Plan für ein neues Sortierzentrum<br />
aussehen sollte. In diesem Moment<br />
wird klar, welche Sortiermaschinen in<br />
welcher Anzahl benötigt werden: Zum<br />
Beispiel ein Culler Facer Canceller (CFC<br />
3004) zur Vorverarbeitung von Sendungen<br />
aus Postkästen, eine oder mehrere<br />
Integrated Reading and Video Coding<br />
Machines (IRV) für die Briefsortierung,<br />
eventuell ergänzt durch ein Open Mail<br />
Handling System (OMS) für die Sortierung<br />
von Großbriefen. Alle Maschinen<br />
gibt es in unterschiedlichen Konfigurationen<br />
und mit einer variablen Anzahl von<br />
Endstellen.<br />
Im Detail geht es um die Beantwortung<br />
von Fragen wie dieser: Wann wird wie<br />
tief sortiert, welche Leseaufgaben fallen<br />
an, welche Postleitzahlengebiete müs-<br />
sen bis wann fertig bearbeitet sein? Eine<br />
technische Stufe tiefer bestimmen die<br />
Durchsatzraten eines CFC oder eines IRV<br />
sowie die Anzahl der Zielorte und das gewählte<br />
Sortierkonzept die konkrete Konfiguration<br />
der Sortieranlage: die Anzahl<br />
der Fächer und damit die Länge der Anlagen,<br />
die Personalstärke, die für das Befüllen<br />
und Entleeren der Anlage notwendig<br />
ist und vieles mehr.<br />
Gelenkte Briefströme – im Kern der<br />
Sortierung<br />
„Grundsätzlich sind es zwei Briefströme,<br />
die im Sortierzentrum ankommen; einmal<br />
die eingesammelte ungeordnete Briefpost<br />
aus den Postbriefkästen, zum anderen die<br />
Briefe der Großauflieferer, die z.B. Werbung<br />
oder Rechnungen en masse verschicken“,<br />
erklärt Holger Ewert. In den westlichen<br />
Industrieländern stammen nur noch<br />
fünf bis sieben Prozent des Sendungsaufkommens<br />
aus Postbriefkästen, bis zu 95<br />
Prozent aller Briefe kommen von den Groß-<br />
auflieferern wie Banken oder Telekommunikationsunternehmen<br />
– oftmals bereits<br />
in vorsortierter Form und freigestempelt.<br />
Dadurch erübrigen sich manche Prozesse,<br />
die die Geschäftspost preiswerter als den<br />
Standard machen. Der gemischte Inhalt<br />
der Postsäcke landet dagegen zuerst in<br />
der Trommel des CFC, die das Gemenge in<br />
Ströme auftrennt, die von Maschinen optimal<br />
verarbeitbar sind. Diese werden entweder<br />
zur Fraktion der Standardbriefe geschleust<br />
beziehungsweise in den Bereich<br />
für die Großbriefe oder auch in die manuelle<br />
Bearbeitung, die alles aufnimmt, was<br />
als „nicht maschinenfähig“ gilt.<br />
Im Anschluss an das Aussortieren von<br />
nicht maschinenfähigen Sendungen stellt<br />
der CFC das Briefgut auf, richtet es aus,<br />
stempelt es bei Bedarf und stapelt es in<br />
die Fächer. Seit <strong>Siemens</strong> die neueste Ver-<br />
sion des CFC auf den Markt brachte, ist<br />
der Automatisierungsgrad für den Post-<br />
Mix enorm gestiegen. Die Maschine vom<br />
Typ 3004 kann jetzt auch Großbriefe aufstellen<br />
und damit für die Weiterverarbeitung<br />
im OMS vorbereiten. Holger Ewert<br />
konstatiert: „Aufgrund der gestiegenen<br />
Qualität und des Spektrums, das <strong>Siemens</strong><br />
heute automatisch sortieren kann, wird<br />
der Anteil der manuell zu bearbeitenden<br />
Briefe stetig kleiner.“<br />
Was aus dem CFC kommt – oder bereits<br />
aufgestellt in Postbehältern eintrifft –<br />
wird nun den Sortiermaschinen zugeführt:<br />
Für die Standardsendungen steht<br />
der IRV bereit, der das passende Sortierprogramm<br />
abarbeitet. Hier werden die<br />
Briefe eingegeben, vereinzelt, auf maschinenfähige<br />
Formate und Inhaltsstoffe<br />
kontrolliert, die Zieladressen gelesen und<br />
wenn nötig videocodiert, mit Barcodes<br />
bedruckt, optional gewogen und entwertet,<br />
sortiert und am Ende des Prozesses<br />
schonend in die zugewiesenen Fächer verfrachtet.<br />
Sobald ein Fach voll ist, leeren<br />
es die Bediener in die Behälter, die sich in<br />
einer Schublade direkt unter der unteren<br />
Sortierebene befinden. Anschließend<br />
weisen die Bedienkräfte dem Briefbehälter<br />
mit Hilfe eines Labels, das der „zuständige“<br />
Drucker ausspuckt, seinen weiteren<br />
Weg.<br />
Lösungsbeispiel für ein Sortierzentrum mit einem Open Mail Handling System mit zwei Eingabelinien für die Großbriefsortierung und einem Culler Facer Canceller<br />
mit allen notwendigen Funktionen für das Sortieren von Standardbriefen bis zum B4 Format.<br />
Getrennte Wege gehen die Großbriefe:<br />
Dafür hat <strong>Siemens</strong> ein Maschinenkonzept<br />
entwickelt, das das Ideal technischer Lösungen<br />
– die Automation – in Vollendung<br />
anwendet: das OMS. Angefangen beim<br />
Tray Unload Device (TUD), das dem Bediener<br />
die Beschickung des Systems wesentlich<br />
erleichtert bis zur automatischen<br />
Ausschleusung der etikettierten Behälter<br />
auf ein Fördersystem, das den richtigen<br />
Kommissionier-Bereich zum LKW ansteuert,<br />
überzeugen die OMS-Prozesse: Bei<br />
schonender Transportgeschwindigkeit erzielt<br />
der OMS hohen Durchsatz und hohe<br />
Effizienz. Anschließend fahren die Lastwagen<br />
in die vorgegebenen regionalen<br />
Zentren – auch diese Kommissionier-und<br />
Routenpläne liefern die <strong>Siemens</strong>-Berater<br />
– und geben die Post dort zur Eingangssortierung<br />
ab. „Doch das ist eine andere<br />
Geschichte“, sagt Holger Ewert und wendet<br />
sich einer seiner derzeitigen Aufgaben<br />
zu: die Entwicklung eines technischen<br />
Modernisierungskonzepts für die<br />
India Post.
Schrift- und Mustererkennung der Extraklasse mit Zukunftsideen<br />
Wer kann denn das lesen?<br />
Diese Handschrift ist für viele Leser ir-<br />
ritierend – fremde Schriftzeichen und<br />
eine eigene Logik beim Aufbau der Adresse.<br />
Und trotzdem wird die Post ihren<br />
Empfänger schnell erreichen. Die Hochautomatisierung<br />
bei der Postsortierung<br />
in vielen Ländern der Erde wäre ohne<br />
die Adress- und Mustererkennung nicht<br />
möglich. Dr. Stefan Keh, Leiter IT Solutions<br />
bei der <strong>Mobility</strong> and Logistics, war<br />
bei der Entwicklung von Anfang an mit<br />
dabei.<br />
Stimmt es, dass Sie eine wissenschaftliche<br />
Karriere einschlagen wollten, um<br />
als Professor an der Universität Studenten<br />
zu unterrichten? Warum kam<br />
alles anders?<br />
Stefan Keh: Ja – stimmt. Von Hause aus<br />
bin ich Physiker und habe mich als Wissenschaftler<br />
lange Zeit mit Elementarteilchen<br />
beschäftigt. Nach meiner Promotion und<br />
der wissenschaftlichen Arbeit an einem<br />
Forschungsprojekt bei CERN in Genf wollte<br />
ich nur zwei Jahre bei <strong>Siemens</strong> bleiben,<br />
um zu erfahren, wie die deutsche Industrie<br />
von innen aussieht. Aber dieser Ort<br />
der Hochtechnologie hat mich derart fasziniert<br />
– insbesondere das Thema Mustererkennung,<br />
dass ich meine anfänglichen<br />
Pläne fallen ließ. Zum Glück. Denn die<br />
Mustererkennung ist nach wie vor ein<br />
spannendes und wichtiges Zukunftsthema.<br />
Was ist faszinierend an der Mustererkennung?<br />
Stefan Keh: Wir Menschen können mühelos<br />
in einer Menge von Daten bestimmte<br />
Informationen selektieren, verstehen und<br />
bewerten. Das heißt, wir erkennen schnell<br />
Muster. Diese Fähigkeit ansatzweise Maschinen<br />
beizubringen, ist eine enorme<br />
Herausforderung. Der komplexe Prozess<br />
des Erkennens und Verstehens muss in<br />
eine Folge von maschinell beherrschbaren<br />
Einzelschritten unterteilt werden, um<br />
anschließend aufwendige Algorithmen<br />
zu entwickeln. Uns ging es 1970 darum,<br />
Adressleser zu entwickeln, die die Voraussetzung<br />
schafften, Postsendungen<br />
automatisch zu sortieren. Wie aufwendig<br />
dieser Prozess ist, verdeutlicht folgendes<br />
Beispiel: Einen Adressleser, der 75 Prozent<br />
einer Adresse liest und 5 Prozent Fehler<br />
machen darf, programmieren unsere<br />
Ingenieure heute an einem Wochenende.<br />
Wenn es jedoch darum geht, mindestens<br />
95 Prozent lesen zu können bei einer Fehlerrate<br />
von 0,5 Prozent, dann brauchen<br />
wir für die Entwicklung einer solchen Lösung<br />
rund 200 Informatiker, die Wochen<br />
daran entwickeln, bevor es funktioniert.<br />
Das ist ein enormer Aufwand. Lohnt<br />
sich das überhaupt?<br />
Stefan Keh: Das hat sich für uns und<br />
unsere Kunden – die Postdienstleister<br />
dieser Welt – in hohem Maße rentiert.<br />
Unternehmen unserer Branche profitieren<br />
enorm von unserer Expertise in der<br />
Mustererkennung, die sich in Kombination<br />
mit unseren Automatisierungstechnologien<br />
zur Top-Technik entfaltet.<br />
Wir können heute die Postsortierung zu<br />
großen Teilen vollautomatisch abwickeln.<br />
Mit der Konsequenz, dass die Sendungen<br />
schneller zugestellt werden und deutlich<br />
weniger Personal benötigt wird. Mit<br />
Hilfe intelligenter Informationstechnik<br />
im Hintergrund sind wir zusätzlich in der<br />
Lage, neue nutzerfreundliche Prozesse zu<br />
<strong>Siemens</strong><br />
The Galleries, Building 2<br />
Downtown Jebel Ali<br />
PO Box 2154 Dubai, UAE<br />
entwickeln – etwa die proaktive Nachsendelösung:<br />
Da die Systeme mittlerweile<br />
die ausgelesenen Adressen mit Nachsende-Datenbanken<br />
abgleichen, erreichen<br />
die Sendungen ohne den Umweg zur alten<br />
Adresse direkt den Empfänger. Damit<br />
erspart sich etwa die amerikanische Post<br />
USPS (United States Postal Service) im<br />
Jahr mehrere Millionen Irrläufer und spart<br />
eine Million Dollar pro Tag an Transportkosten<br />
für diese Umwege.<br />
Wie gut können Maschinen Handschriften<br />
lesen?<br />
Stefan Keh: Gegenwärtig sind unsere<br />
Systeme in der Lage, 90 bis 95 Prozent<br />
der handgeschriebenen Anschriften zu<br />
lesen. Vor einigen Jahren haben wir sogar<br />
den Wettbewerb im Lesen arabischer<br />
Handschriften gewonnen. Die Aufgabe<br />
bestand darin, 937 tunesische Ortsbezeichnungen<br />
fehlerfrei zu identifizieren.<br />
Das ist eine enorme erkennungstechnologische<br />
Leistung. Gemeistert haben wir<br />
die Aufgabe, weil wir erprobte Technologien<br />
und mathematische Modelle auf<br />
die Handschriftenerkennung übertragen<br />
haben. So ist es uns gelungen, in nur<br />
neun Monaten das weltbeste System für<br />
die gebundene Handschriftenerkennung<br />
zu entwickeln.<br />
Der Brief- und Großbriefmarkt ist<br />
heute ein eher stagnierender oder<br />
rückläufiger Markt. Haben Sie noch<br />
Arbeit?<br />
Stefan Keh: Ja, wir haben noch Arbeit.<br />
Was verrät unsere Handschrift?<br />
Es geht bei uns längst nicht mehr nur um<br />
Texterkennung. Es geht um Mustererkennung.<br />
Ursprünglich wurde die automatisierte<br />
Texterkennung für das Lesen von Scheckformularen<br />
eingesetzt. Das funktionierte<br />
anfangs nur, weil dafür eigens Schriftarten<br />
entwickelt wurden, die ohne großen<br />
Rechenaufwand entziffert werden konnten.<br />
Dank der gestiegenen Rechenleistung<br />
moderner Computer und verbesserter<br />
Algorithmen wurden ab Mitte der 1970er<br />
Jahre dann auch „normale“ Druckerschriftarten<br />
von den Optical Character Recognition<br />
(OCR) Systemen erkannt. Diese<br />
Innovation sorgte für die rasche Verbrei-<br />
Sind die Buchstaben einer Handschrift miteinander verbunden oder stehen<br />
sie einzeln? Neigt sich die Schrift nach links oder nach rechts? Wirkt sie<br />
regelmäßig oder eher chaotisch? Handschrift ist nicht gleich Handschrift. Ob<br />
sie, wie Schriftpsychologen meinen, Spiegel unserer Persönlichkeit ist, bleibt<br />
umstritten. Skeptiker verweisen auf Analysen, nach denen in den meisten<br />
wissenschaftlichen Studien kein Beweis für die von den Grafologen behaupteten<br />
Zusammenhänge zwischen Handschrift und Persönlichkeitsmerkmalen<br />
bestehen. Ob man nun daran glaubt oder nicht. Ein interessanter Zeitvertreib<br />
ist die Analyse der eigenen Handschrift allemal. Im Internet gibt es viele Websites,<br />
die kostenlose Selbst-Tests anbieten. In der Regel lassen sich die 15 bis<br />
20 Fragen locker in wenigen Minuten beantworten. Die Auswertungen sind<br />
oft umfangreich und erinnern durchaus an die Charakterbeschreibungen in<br />
Horoskopen: schnell denkend und effizient, gefühlsbetont und ruhelos oder<br />
ausschweifend und verloren. Übrigens, laut der Gesellschaft zur wissenschaftlichen<br />
Untersuchung von Parawissenschaften e.V. gaben 2,4 Prozent der<br />
befragten Unternehmen an, dass sie bei der Personalauswahl graphologische<br />
Gutachten zu Rate ziehen – in Frankreich sowie in der Schweiz ist die Graphologie<br />
ein wenig mehr verbreitet.<br />
Dr. Stefan Keh, Leiter IT Solutions bei der <strong>Mobility</strong> and Logistics<br />
tung der automatisierten Texterkennung –<br />
etwa bei Banken und Behörden. Auch der<br />
Postverkehr profitierte von OCR. <strong>Siemens</strong><br />
war von Anfang an mit dabei. Durch die<br />
maschinelle Erkennung der Postleitzahl<br />
und der Adresse konnten die Briefe spürbar<br />
schneller sortiert werden. Und mittlerweile<br />
können OCR-Systeme das, was<br />
noch bis vor wenigen Jahren nur der<br />
Mensch konnte: Handschriften entziffern.<br />
Es kommen hochleistungsfähige OCR-<br />
Kameras zum Einsatz, die ein klares und<br />
scharfes Bild an das OCR-System liefern.<br />
Gesucht wird dann vom System in der<br />
Datenbank mit sämtlichen Straßen- und<br />
Städtenamen das Wort, das den größten<br />
Übereinstimmungsgrad mit dem Graphen<br />
aufweist. Wie gut und schnell ARTread,<br />
das <strong>Siemens</strong>-System, das kann, bestätigte<br />
eine unabhängige Fachjury: Sie verlieh<br />
<strong>Siemens</strong> auf der ICDAR-Konferenz 2007<br />
für automatische Erkennung von arabischer<br />
Handschrift die Goldmedaille für<br />
das schnellste und präziseste System.<br />
Wir haben viel Know-how aufgebaut,<br />
das wir für verschiedene Zwecke nutzen.<br />
Auch wenn der Briefmarkt rückläufig ist<br />
– der Paketmarkt wächst rasant. Deshalb<br />
haben wir unsere Fingerprint-Methode,<br />
die ursprünglich für die Sortierung von<br />
Großbriefen entwickelt wurde, für die Paketpost<br />
weiterentwickelt. Die Lösung, die<br />
heute ein Paket an den optischen Merkmalen<br />
identifiziert, die wie der Fingerabdruck<br />
bei jedem Packstück einmalig sind,<br />
stellt eine kostengünstige Alternative<br />
zum Barcode-Druck auf Paketen dar.<br />
Zusätzlich übertragen wir unser Wissen<br />
und unsere Technologien auch in völlig<br />
neue Märkte. Dafür suchen wir uns lukrative<br />
Nischen, in denen wir mit unseren<br />
spezifischen Fähigkeiten einen möglichst<br />
großen Abstand zu den Mitbewerbern<br />
schaffen. Wir übertragen sozusagen<br />
unsere reife Technologie in andere Industrien.<br />
Haben Sie ein Beispiel?<br />
Stefan Keh: Gerne. In Großstädten mit<br />
einer Citymaut – wie beispielsweise in<br />
London – kommen unsere Systeme bereits<br />
zum Einsatz. Intelligente Kamerasysteme<br />
erfassen an den Einfallstraßen die<br />
Nummernschilder der Autos.<br />
Mithilfe einer zentralen Datenbank wird<br />
dann überprüft, ob diese für die Mautabbuchung<br />
angemeldet sind. Vor der unmittelbaren<br />
Markteinführung befinden sich<br />
weitere Systeme, die ähnlich arbeiten<br />
und beispielsweise Geschwindigkeitskontrollen<br />
über längere Strecken in Innenstädten<br />
erlauben. Im Bereich bewegte<br />
Muster und angepasste Kamerasysteme<br />
haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt.<br />
Die gilt es jetzt in ein Geschäftsmodell<br />
umzusetzen.
Patente demonstrieren Innovationskraft<br />
Mit Brief und Siegel:<br />
Patente schützen Ideen<br />
Er wollte seine Erfindung nicht ohne<br />
angemessenen Schutz offenbaren – der<br />
Architekt Filippo Bunelleschi. Denn er<br />
befürchtete, dass andere so die „Frucht<br />
seines Geistes und seiner Arbeit ohne<br />
sein Einverständnis ernten würden“. Die<br />
Republik Florenz schützte seine Erfindung<br />
damals für drei Jahre und gestand<br />
ihm das alleinige Recht zur Herstellung<br />
zu. In der Begründung aus dem Jahr<br />
1421 heißt es, dass das Patent erteilt<br />
wurde, weil der Erfinder dadurch angespornt<br />
und angeregt würde, mit größerem<br />
Eifer noch höhere Ziele und schwierigere<br />
Forschungen zu verfolgen. Damit<br />
war das erste Patent erteilt. Auch heute<br />
gilt: Wer Bahnbrechendes erfindet, der<br />
kann seine Idee als Patent vor Nachahmern<br />
schützen. Bis zu 20 Jahre lang.<br />
Patente gelten als Indikator für die Leistungs-<br />
und Innovationskraft eines Unternehmens.<br />
Die rund 58.000 Patente von<br />
<strong>Siemens</strong> stellen daher einen großen Vermögenswert<br />
dar den es zu schützen gilt.<br />
Dafür sorgen bei <strong>Siemens</strong> mehr als 400<br />
Patentspezialisten, die nichts dem Zufall<br />
überlassen. „Wir versuchen schon Jahre<br />
vor Produktionsbeginn einen Schutz mit<br />
Schlüsselpatenten aufzubauen“, erklärt<br />
Andreas Müller, verantwortlich für die<br />
Strategie in der Patentabteilung von<br />
<strong>Siemens</strong>. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang:<br />
Die detaillierten Ausformulierungen<br />
müssen den Kern der Erfindung<br />
möglichst umfassend abdecken, so dass<br />
auch naheliegende Abwandlungen geschützt<br />
sind.<br />
Innovativer denn je<br />
Die Erfindungsmeldungen pro Mitarbeiter<br />
in Forschung und Entwicklung haben<br />
sich bei <strong>Siemens</strong> seit 2001 verdoppelt.<br />
Vorangetrieben werden die Innovationen<br />
dabei von knapp 28.000 Mitarbeitern. Sie<br />
meldeten 2011 etwa 40 Erfindungen<br />
pro Arbeitstag an. <strong>Siemens</strong>-Chef Peter<br />
Löscher honorierte diese Leistung bei der<br />
Preisverleihung der Erfinder des Jahres:<br />
„Sie beweisen täglich Pioniergeist, unter-<br />
8 <strong>News</strong>letter <strong>SILOG</strong> <strong>News</strong><br />
Die patentierte Kanalweiche sorgt für störungsfreien Brieflauf<br />
nehmerisches Denken und internationale<br />
Teamarbeit – das sind genau die Faktoren,<br />
die wir brauchen um auch morgen auf<br />
den Weltmärkten erfolgreich zu sein.“<br />
Ein Beispiel: Rund um das „Parcel Bulk Processing“<br />
(siehe Seite 1 und 3) gibt es mehr<br />
als 10 Patente bzw. Patentanmeldungen.<br />
Patenterfolge in der Postsortierung<br />
Die Auszeichnung „Erfinder des Jahres“<br />
vergibt <strong>Siemens</strong> seit 1995 jährlich an<br />
zwölf Forscher und Entwickler. Zwei von<br />
ihnen, Armin Zimmermann und Dr. Peter<br />
Berdelle-Hilge, haben ihren Arbeitsplatz<br />
bei der IL in Konstanz. Zimmermann befasst<br />
sich bereits seit mehr als 25 Jahren<br />
mit der mechanischen Entwicklung von<br />
Sortiermaschinen und hat mehr als 175<br />
internationale Patente erhalten. „Mittlerweile<br />
habe ich mehr den gesamten Ablauf<br />
der Sortierung als einzelne Elemente im<br />
Fokus“, begründet Zimmermann seinen<br />
Erfolg. Eine seiner patententierten Erfindungen<br />
befindet sich in fast jeder<br />
<strong>Siemens</strong> Briefsortiermaschine – die sogenannte<br />
Kanalweiche. Diese spezielle Weiche<br />
bei der die Briefe durch die Mitte der<br />
zweigeteilten Weiche laufen verhindert<br />
Brieflaufstörungen durch erlaubt kleinere<br />
Abstände im Brieflauf und sorgt damit<br />
für einen höheren Durchsatz. Berdelle-<br />
Hilge hält mehr als 69 Einzelpatente,<br />
mehr als die Hälfte davon im Bereich der<br />
Systemarchitektur von Sortieranlagen.<br />
So hat er mit seinen Erfindungen maßgeblich<br />
zu der Entwicklung des Open Mail<br />
Handling Systems (OMS) beigetragen.<br />
Als Seniorexperte für Systemarchitektur<br />
dachte er darüber nach, wie die komplexen<br />
Großbriefsortieranlagen ihre Aufgabe<br />
effizienter erfüllen können. Ergebnis<br />
war eine neue Systemarchitektur, die<br />
es ermöglicht, das OMS auf besonders<br />
effiziente Art und Weise nacheinander für<br />
die Abgangssortierung und die Gangfolgesortierung<br />
von Großbriefen zu nutzen.