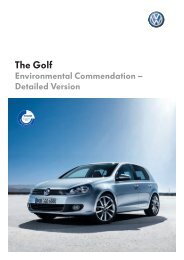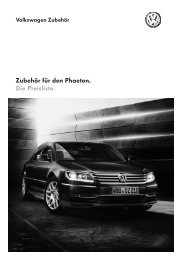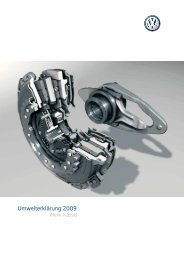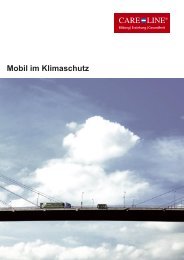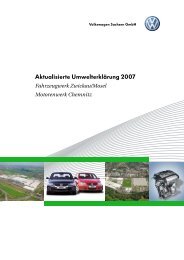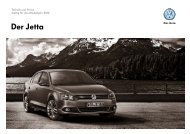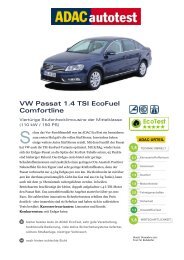Werk Kassel 2007 (6,2 MB) (PDF; 6 - Volkswagen AG
Werk Kassel 2007 (6,2 MB) (PDF; 6 - Volkswagen AG
Werk Kassel 2007 (6,2 MB) (PDF; 6 - Volkswagen AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Umwelterklärung <strong>2007</strong><br />
<strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong>
Inhalt<br />
Grundlagen<br />
4 Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
6 Umweltpolitik von <strong>Volkswagen</strong><br />
8 Umweltleistung<br />
10 Entwicklung, Produktion und Erzeugnisse<br />
16 Umweltmanagement-System<br />
20 Umweltprüfung und Ermittlung<br />
der Umweltaspekte<br />
22 Erarbeitung von Umweltprogrammen<br />
und -zielen<br />
Zum <strong>Werk</strong><br />
K 2 Standortdaten<br />
K 3 Der Standort<br />
K 6 Besonderheiten und Entwicklung<br />
K 8 Umweltaspekte und Umweltdaten<br />
Umweltdaten<br />
K 15 In-/Output<br />
K 17 Umweltprogramme<br />
K 19 Gültigkeitserklärung<br />
Anhang<br />
23 Abkürzungen und Erklärungen<br />
24 Weitere Informationen<br />
25 Impressum<br />
Die Angaben dieser Umwelterklärung beziehen sich auf das Bilanzjahr 2006. Sie enthält Teile der „Gemeinsamen<br />
Umwelterklärung <strong>2007</strong>“, die alle Daten der <strong>Werk</strong>e Wolfsburg, Braunschweig, <strong>Kassel</strong>, Emden, Salzgitter,<br />
Dresden und Hannover (<strong>Volkswagen</strong> Nutzfahrzeuge) gesammelt dokumentiert.<br />
Die „Gemeinsame Umwelterklärung <strong>2007</strong>“ erhalten Sie unter der auf der letzten Seite angegebenen Adresse<br />
bzw. zum Download unter www.volkswagen-umwelt.de.<br />
3
Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
Prof. Dr. Jochem Heizmann<br />
und Bernd Osterloh<br />
Umweltorientierte Unternehmensführung ist eine<br />
der Grundlagen unserer Unternehmenskultur. Nur<br />
wer soziale, ökonomische und ökologische Aspekte<br />
berücksichtigt, kann nachhaltig wirtschaften, umweltgerecht<br />
handeln und Beschäftigung sichern.<br />
Dies spiegelt sich auch in der Umweltpolitik von<br />
<strong>Volkswagen</strong> wider, die in der Präambel zwei wesentliche<br />
Anforderungen festschreibt:<br />
die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit<br />
unserer Produkte über den gesamten<br />
Lebenszyklus<br />
die Verringerung der Beanspruchung natürlicher<br />
Ressourcen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher<br />
Gesichtspunkte<br />
Hierzu haben wir uns – im Bewusstsein unserer gesellschaftlichen<br />
Verantwortung als weltweit tätiges<br />
Unternehmen – freiwillig verpflichtet.<br />
Die Reduktion von Kraftstoffverbrauch und CO 2 -<br />
Emissionen bestimmt zunehmend die Entwicklung<br />
von Fahrzeugantrieben ebenso wie verschärfte<br />
Abgasstandards. Bei der Verbrauchsreduzierung hat<br />
<strong>Volkswagen</strong> Maßstäbe gesetzt – genannt seien hier<br />
der doppelt aufgeladene TSI-Motor, der bei geringem<br />
Verbrauch eine hohe Leistung erbringt, und das<br />
Doppelkupplungs-Getriebe (DSG). Darüber hinaus<br />
arbeiten wir mit externen Partnern daran, die Abhängigkeit<br />
vom Energieträger Erdöl zu beenden.<br />
4<br />
Eine Übergangslösung könnte in der Beimischung<br />
von synthetischen Kraftstoffen bestehen. Diese werden<br />
beispielsweise aus Erdgas hergestellt (SynFuel)<br />
oder als SunFuel aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
wie Stroh oder Holz gewonnen. Beim Antrieb mit<br />
SunFuel emittiert das Fahrzeug nicht mehr Kohlendioxid,<br />
als vorher beim Pflanzenwachstum der<br />
Atmosphäre entzogen wurde.<br />
Ziel ist es auch, an den einzelnen Standorten in allen<br />
Betriebsbereichen effiziente, umweltschonende<br />
Fertigungsprozesse zu verwirklichen. Umweltschutz<br />
wird mehr und mehr in die Prozesse integriert; damit<br />
wird der Einsatz von nachgeschalteten Reinigungsanlagen<br />
künftig zwar nicht überflüssig, aber<br />
immer weiter verringert. Ressourcenschonung und<br />
Wirtschaftlichkeit müssen und können nach unserer<br />
Überzeugung Hand in Hand gehen.<br />
Seit 1995 beteiligt sich <strong>Volkswagen</strong> freiwillig am Öko-<br />
Audit-Verfahren der Europäischen Union. Durch die<br />
regelmäßige Durchführung von internen und externen<br />
Umweltaudits werden die Umweltmanagementsysteme<br />
ständig überprüft und weiter optimiert. Die<br />
eigenverantwortliche Festlegung von Zielen und<br />
Programmen fordert jährlich alle Organisationseinheiten<br />
der Standorte und ermöglicht die ständige<br />
Verbesserung der Umweltleistung.
Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
Prof. Dr. Jochem Heizmann<br />
und Bernd Osterloh<br />
Wirkungsvoller Umweltschutz ist jedoch nicht allein<br />
eine Frage von Technik und Organisation. Entscheidend<br />
sind vor allem die Menschen, die verantwortungsbewusst<br />
planen, bedienen und steuern.<br />
Schulungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
und Sensibilisierung zu ständiger Verbesserung haben<br />
uns auf das heutige Niveau geführt. Gute Ideen<br />
und besondere Leistungen werden mit dem internen<br />
Umweltpreis belohnt.<br />
Prof. Dr. Jochem Heizmann<br />
Konzernvorstand Produktion<br />
<strong>Volkswagen</strong><br />
Die Standorte Wolfsburg, Braunschweig, <strong>Kassel</strong>,<br />
Emden, Salzgitter, Dresden und Hannover verstehen<br />
sich als Partner für Gesellschaft und Politik, die<br />
einen offenen Dialog mit Behörden und Öffentlichkeit<br />
über bedeutende Umweltauswirkungen führen.<br />
Die vorliegende Umwelterklärung ist ein wichtiger<br />
Baustein unserer aktiven Informationspolitik.<br />
Bernd Osterloh<br />
Vorsitzender Gesamtbetriebsrat<br />
<strong>Volkswagen</strong><br />
5
Umweltpolitik von <strong>Volkswagen</strong><br />
Präambel<br />
<strong>Volkswagen</strong> entwickelt, produziert und vertreibt<br />
weltweit Automobile zur Sicherstellung individueller<br />
Mobilität. Das Unternehmen trägt Verantwortung<br />
für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit<br />
seiner Produkte und die Verringerung<br />
der Beanspruchung der natürlichen Ressourcen<br />
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.<br />
6<br />
Es macht daher umwelteffiziente fortschrittliche<br />
Technologien weltweit verfügbar und bringt sie über<br />
den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte zur<br />
Anwendung. Es ist an allen Standorten Partner für<br />
Gesellschaft und Politik bei der Ausgestaltung einer<br />
sozialen und ökologisch nachhaltigen positiven<br />
Entwicklung.
Umweltpolitik von <strong>Volkswagen</strong><br />
Grundsätze<br />
1. Es ist das erklärte Ziel von <strong>Volkswagen</strong>, bei all<br />
seinen Aktivitäten die Einwirkungen auf die Umwelt<br />
so gering wie möglich zu halten und mit den eigenen<br />
Möglichkeiten an der Lösung der regionalen<br />
und globalen Umweltprobleme mitzuwirken.<br />
2. Es ist das Ziel von <strong>Volkswagen</strong>, hochwertige<br />
Automobile anzubieten, die den Ansprüchen seiner<br />
Kunden an Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit,<br />
Sicherheit, Qualität und Komfort in gleicher<br />
Weise gerecht werden.<br />
3. Zur langfristigen Sicherung des Unternehmens<br />
und zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit<br />
erforscht und entwickelt <strong>Volkswagen</strong> ökologisch<br />
effiziente Produkte, Prozesse und Konzepte für individuelle<br />
Mobilität.<br />
4. Das Umweltmanagement von <strong>Volkswagen</strong> stellt<br />
auf der Grundlage der Umweltpolitik sicher, dass gemeinsam<br />
mit Zulieferunternehmen, Dienstleistern,<br />
Handelspartnern und Verwertungsunternehmen die<br />
Umweltverträglichkeit seiner Automobile und<br />
Fertigungsstandorte einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
unterworfen ist.<br />
5. Der Vorstand von <strong>Volkswagen</strong> überprüft regelmäßig<br />
die Einhaltung der Umweltpolitik und<br />
-ziele sowie die Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems.<br />
Dies schließt die Bewertung der<br />
erfassten umweltrelevanten Daten ein.<br />
6. Die offene und klare Information sowie der<br />
Dialog mit Kunden, Händlern und der Öffentlichkeit<br />
sind für <strong>Volkswagen</strong> selbstverständlich. Die Zusammenarbeit<br />
mit Politik und Behörden beruht auf<br />
einer handlungsorientierten und vertrauensvollen<br />
Grundhaltung und bezieht die Notfallvorsorge an<br />
den einzelnen Produktionsstandorten mit ein.<br />
7. Alle Mitarbeiter von <strong>Volkswagen</strong> werden entsprechend<br />
ihren Aufgaben im Umweltschutz informiert,<br />
qualifiziert und motiviert. Sie sind zur Umsetzung<br />
dieser Grundsätze sowie zur Erfüllung der gesetzlichen<br />
und behördlichen Auflagen im Rahmen ihrer<br />
jeweiligen Aufgabenstellung verpflichtet.<br />
7
Umweltleistung<br />
Herstellung<br />
Kraftstoffbereitstellung<br />
Fahremissionen<br />
Verwertung<br />
Umweltschutz ist für den <strong>Volkswagen</strong> Konzern auf<br />
lange Sicht kein Kosten-, sondern ein Wertschöpfungstreiber,<br />
der dem Unternehmen den Weg zu<br />
effizienteren Fertigungsprozessen und zu zukunftsfähigen<br />
Produkten weisen kann. Der <strong>Volkswagen</strong><br />
Konzern bekennt sich zum integrierten Umweltschutz.<br />
Dieser erstreckt sich auf alle Fertigungsprozesse<br />
und auf den gesamten Lebenszyklus der<br />
Produkte, wobei in die Bilanzierungen die Daten<br />
von der Rohstoffherstellung bis zur Verwertung<br />
der Altfahrzeuge eingehen („von der Wiege bis zur<br />
Bahre“). Klare Zielstellung des <strong>Volkswagen</strong> Konzerns<br />
ist es, als global engagierter Mobilitätsdienstleister<br />
umweltoptimierte Fahrzeuge aus umweltoptimierter<br />
Fertigung anzubieten.<br />
Weiterentwickelt aus ursprünglich 11 Umweltstandards,<br />
stecken inzwischen 22 Umweltgrundsätze<br />
den Rahmen für unsere Aktivitäten im betrieblichen<br />
Umweltschutz ab. Diese beinhalten strategische<br />
Leitlinien und technische Vorgaben, um weltweit ein<br />
vergleichbares Umweltniveau in unseren<br />
8<br />
70.9 %<br />
0.4 %<br />
9.1 %<br />
19.6 %<br />
Fertigungsstätten sicherzustellen. Dabei ist es das<br />
vorrangige Ziel, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle<br />
Lösungen zu realisieren, um den Einsatz von<br />
Ressourcen zu minimieren und zu einer langfristigen<br />
Kostenreduzierung beizutragen. In den Umweltgrundsätzen<br />
werden sowohl allgemeine Prinzipien<br />
als auch auf die einzelnen Prozesse bezogene, spezifische<br />
Anforderungen festgelegt.<br />
Eines der derzeit aktuellsten Umweltthemen ist der<br />
Ausstoß von klimarelevanten Treibhausgasen. Im<br />
Zusammenhang mit dem Auto geht es dabei fast<br />
ausschließlich um das Kohlendioxid (CO ). Die seit<br />
2<br />
über 10 Jahren bei <strong>Volkswagen</strong> durchgeführten Umweltbilanzierungen<br />
(gemäß ISO-Norm 14040) kommen<br />
zu dem Ergebnis, dass im Lebenszyklus eines<br />
Kraftfahrzeugs der weitaus überwiegende Teil des<br />
CO -Ausstoßes während der Nutzungsphase auftritt.<br />
2<br />
Fahremissionen und Kraftstoffherstellung machen<br />
dabei den größten Anteil aus. Das Diagramm zeigt<br />
die Verteilung der CO -Emissionen am Beispiel des<br />
2<br />
Passat Variant 2,0 TDI.
Umweltleistung<br />
Wichtig ist es, den Energieverbrauch und damit<br />
zusammenhängend den CO -Ausstoß im gesamten<br />
2<br />
Lebenszyklus eines Fahrzeugs so niedrig wie möglich<br />
zu halten.<br />
Während der Produktion werden vor allem Strom<br />
und Wärme benötigt. Einen Teil davon erzeugt<br />
<strong>Volkswagen</strong> an den Standorten in eigenen Kraftwerken,<br />
die zum Teil dem europäischen Emissionshandelssystem<br />
unterliegen. Mit zahlreichen zentralen<br />
und dezentralen Maßnahmen wird daran gearbeitet,<br />
die Fertigungsprozesse, aber auch die Infrastruktur<br />
in den <strong>Werk</strong>en noch energieeffizienter zu gestalten.<br />
Ausdruck aller Bemühungen zur ständigen Verbesserung<br />
der Umweltleistung ist die Zertifizierung aller<br />
<strong>Volkswagen</strong>-Produktionsstätten entsprechend der<br />
EMAS-Verordnung bzw. der Norm ISO 14.001.<br />
Die Reduktion aller relevanten Schadstoffemissionen<br />
und die Verminderung von Energieverbrauch<br />
und Treibhausgas-Emissionen sind vorrangige Ziele<br />
der Kraftstoff- und Antriebsstrategie von <strong>Volkswagen</strong><br />
(aktuelle Beispiele sind das Direktschaltgetriebe mit<br />
Doppelkupplung und sieben Gängen sowie die TSI-<br />
Motoren, die sehr gute Leistungswerte mit geringem<br />
Verbrauch verbinden). Kurz- und mittelfristig liegt<br />
die Konzentration auf Effizienzsteigerungen und auf<br />
CO -neutralen Biokraftstoffen der zweiten Generati-<br />
2<br />
on, die zwar aus Biomasse gewonnen werden, aber<br />
kaum in Konkurrenz zur Nahrungsmit-<br />
telproduktion stehen. Ziel dieser Strategie ist es,<br />
sparsame, agile und zugleich preislich attraktive<br />
Fahrzeuge für den breiten Markt zu schaffen.<br />
Durch Einsatz des Instruments Lebenszyklusanalyse<br />
hat sich gezeigt, dass es in Einzelfällen sinnvoll<br />
sein kann, auf energieintensivere Produktionsverfahren<br />
umzustellen. So wird im <strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong> beim<br />
Formhärten mehr Wärmeenergie verbraucht als<br />
beim konventionellen Umformen. Da die entstehenden<br />
Bauteile aber eine deutlich erhöhte Festigkeit<br />
aufweisen, wird zu ihrer Herstellung weniger Stahl<br />
benötigt und das Gewicht der Karosserie wird um 20<br />
kg reduziert. Mit jedem Passat B6 werden in der Nutzungsphase<br />
mit ca. 174 kg sehr viel mehr CO -Äqui-<br />
2<br />
valente eingespart, als für die Fertigung zusätzlich<br />
emittiert wurden.<br />
Zur Dokumentation der Umweltleistung und zur<br />
Darstellung der Verbesserungen werden auch bei<br />
<strong>Volkswagen</strong> geeignete Kennzahlen gebildet. Diese<br />
Umweltdaten werden gemäß einer internen Norm<br />
an jedem Standort ermittelt, geprüft und freigegeben.<br />
Bei der Darstellung von Kennzahlen beschränkt<br />
sich <strong>Volkswagen</strong> auf absolute Zahlen, die sich auf<br />
das jeweilige Geschäftsjahr beziehen. Die Umrechnung<br />
auf Produkteinheiten zur Bildung spezifischer<br />
Kennzahlen macht angesichts der breiten und heterogenen<br />
Produktpalette der Standorte kaum Sinn.<br />
9
Entwicklung, Produktion und Erzeugnisse<br />
Entwicklungsziele<br />
Entwicklung<br />
Bereits bei der Entwicklung von Fahrzeugen und<br />
Komponenten findet der Umweltschutz Berücksichtigung.<br />
Hierfür wurden in drei Zielfeldern Umweltziele<br />
der Technischen Entwicklung formuliert, deren<br />
Umsetzung vom Umweltschutzbeauftragten für<br />
Produkte der <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> koordiniert wird.<br />
1. Klimaschutz<br />
- Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen<br />
- Reduzierung des Verbrauchs im Fahrzyklus und<br />
vor Kunde<br />
- Besetzung der Verbrauchsleader-Position in jeder<br />
Fahrzeugklasse<br />
- Unterstützen kraftstoffsparender Fahrweisen<br />
- Mitarbeit/Bewertung umweltschonender Ver-<br />
kehrslenkungsmaßnahmen<br />
2. Ressourcenschonung<br />
- Verbessern der Ressourceneffizienz<br />
-Verfolung der bestmöglichen Recyclingfähigkeit<br />
und Kennzeichnung der verwendeten <strong>Werk</strong>stoffe<br />
10<br />
- Einsetzen nachwachsender Rohstoffe und<br />
Rezyklatmaterialien<br />
- Entwickeln und Bereitstellen alternativer Antriebstechnologien<br />
- Nutzung alternativer Kraftstoffe ermöglichen<br />
3. Gesundheitsschutz<br />
- Reduzieren limitierter und nicht limitierter<br />
Emissionen<br />
- Vermeiden der Verwendung von Gefahr- und<br />
Schadstoffen<br />
- Minimieren der Innenraum-Emissionen inklusive<br />
Geruch<br />
- Erzielen bestmöglicher Außen- und Innengeräuschwerte<br />
Diese Ziele sind der Leitfaden für die Technische<br />
Entwicklung und über Lastenhefte und<br />
Verträge auch für Entwicklungspartner und Lieferanten<br />
verbindlich.
Entwicklung, Produktion und Erzeugnisse<br />
Fahrzeugfertigung<br />
Logistik<br />
Für jedes Fahrzeug sind mehrere tausend Teile<br />
programm- und zielgerecht zusammenzuführen.<br />
Dies bedeutet exakte Produktionsplanung, präzise<br />
Organisation und termingerechten Transport. Jedes<br />
Teil muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen<br />
Einbauort sein. Großrechner steuern die Anlieferung<br />
der Einzelteile sekundengenau. Diese komplizierten<br />
Abläufe erfordern eine detaillierte Logistik. Sie<br />
beginnt im Beschaffungsbereich, der bei der Zulieferindustrie<br />
die benötigten Teile, Baugruppen und<br />
Komponenten einkauft. Größere Materialmengen<br />
werden für alle <strong>Werk</strong>e zentral beschafft. Per Bahn<br />
oder Lkw erreichen die Materialien das <strong>Werk</strong> und<br />
möglichst ohne Zwischenlagerung direkt die Produktion.<br />
Den reibungslosen Ablauf gewährleistet in<br />
allen Fertigungsstufen die <strong>Werk</strong>logistik. Ein Fließschema<br />
auf Seite 13 verdeutlicht die Abläufe, die im<br />
Folgenden beschrieben werden.<br />
Karosserie<br />
An erster Stelle in der Prozesskette steht das Presswerk.<br />
Ausgangsmaterial für die meisten Karosserieteile<br />
ist Feinblech in Rollenform (Coils). Die<br />
Bearbeitung erfolgt mit Scheren, Stanzen und<br />
Tiefziehpressen. Dabei entstehen Bodengruppen,<br />
Dächer, Rahmenprofile, Motorhauben, Heckklappen<br />
und Türen. Aus Sicht des Umweltschutzes sind<br />
hier die Anwendung großer Mengen an Zieh- und<br />
Hydraulikölen und das Auftreten von Lärm, Erschütterungen<br />
und Schwingungen besonders zu<br />
beachten. Um die Materialeffizienz des Prozesses<br />
zu optimieren und gleichzeitig die Abfallmenge zu<br />
verkleinern, wird ständig daran gearbeitet, durch<br />
Verbesserung des Zuschnitts und durch Weiternutzung<br />
von ausgestanzten Blechen die Coils möglichst<br />
gut auszunutzen.<br />
Im nächsten Arbeitsschritt fügen Automaten in<br />
nahezu selbsttätigen Fertigungslinien die Einzelteile<br />
zur Rohkarosserie. Wesentliche Fügetechnik ist das<br />
energieeffiziente Punktschweißen, es kommen aber<br />
11
Wolfsburg<br />
Braunschweig<br />
<strong>Kassel</strong><br />
Emden<br />
Salzgitter<br />
Hannover<br />
Dresden<br />
Fahrzeuge Aggregate Leichtmetallgießerei diverse Kompo-<br />
Golf/Golf-Plus,<br />
Tiguan, Touran<br />
Passat/<br />
Passat Variant<br />
Caravelle, Multivan,<br />
Transporter<br />
Phaeton<br />
Fertigung an den Standorten<br />
Getriebe, aufbereitete<br />
Motoren<br />
auch Verfahren wie Kleben und Laserschweißen zur<br />
Anwendung. Viele Maschinen werden hydraulisch<br />
betrieben. Die entsprechenden Aggregate befinden<br />
sich in Auffangwannen. Sie bewahren den Untergrund<br />
im Fall einer Betriebsstörung vor austretender<br />
Hydraulikflüssigkeit.<br />
Lackieren<br />
Nach dem Entfetten, Spülen und Passivieren erhalten<br />
die Karossen in mehreren Arbeitsgängen<br />
verschiedene Lackschichten. Sie schützen das<br />
Metall vor Korrosion und geben dem Fahrzeug die<br />
gewünschte Farbe. Besondere Umweltrelevanz haben<br />
die Lackierereien, weil sie 1. relativ viel Energie<br />
verbrauchen, 2. organische Lösemittel einsetzen und<br />
3. mit dem Lackschlamm einen gefährlichen Abfall<br />
erzeugen. Außerdem müssen große Abwassermengen<br />
behandelt werden.<br />
Deswegen wird ständig daran gearbeitet, den Wirkungsgrad<br />
des Lackauftrags zu erhöhen, den Lack<br />
also möglichst verlustarm zu applizieren. Hierbei<br />
kommen überwiegend Wasserlacke mit einem<br />
12<br />
nenten<br />
Lenkungsteile<br />
Kunststoffteile<br />
Fahrwerksteile Achsen, Lenkgetriebe,<br />
Kunststoffteile<br />
Getriebegehäuse<br />
Zylinderkurbelgehäuse<br />
Abgasanlagen<br />
Motoren Motorenkomponenten<br />
Zylinderköpfe, Saug-<br />
rohre, Fahrwerksteile<br />
Wärmetauscher<br />
Presswerk Karosseriebauteile<br />
äußerst geringen Lösemittelanteil zum Einsatz. Die<br />
oberste Schicht, der Klarlack, muss die Karosserie<br />
gegen vielfältige äußere Einflüsse schützen sowie<br />
höchsten Qualitätsanforderungen genügen und<br />
enthält deshalb einen größeren Anteil organischer<br />
Lösemittel. Beim Trocknungsprozess verdunsten die<br />
Lösemittel und werden in nachgeschalteten Anlagen<br />
verbrannt. Die dabei entstehende Wärme wird<br />
wiederum zum Beheizen des Lacktrockners genutzt.<br />
Die Lösemittelemissionen unterliegen regelmäßiger<br />
Überwachung. Alle Grenzwerte werden eingehalten<br />
bzw. unterschritten.<br />
Abschließend erfolgt die Konservierung. Dabei<br />
werden die Hohlräume mit Heißwachs geflutet – ein<br />
lösemittelfreier und deshalb umweltverträglicher<br />
Vorgang.
Gießerei<br />
Aluminium/Magnesium<br />
Einsatz von Leichtmetallschrotten<br />
Mechanische <strong>Werk</strong>stätten<br />
Getriebe, Motoren, Achsen<br />
Bremsen, Felgen, Kleinteile<br />
Härterei<br />
Konservierung, Galvanik,<br />
Tauchlackierung<br />
Kunststoffteilefertigung<br />
Stoßstange, Armaturentafel,<br />
Karosserieteile<br />
Fremdherstellung<br />
Vormontage<br />
Montage<br />
stark umweltrelevante Bereiche umweltrelevante Bereiche wenig umweltrelevante Bereiche<br />
umweltrelevante Bereiche (nicht im Verantwortungsbereich von <strong>Volkswagen</strong>)<br />
Montage<br />
Anschließend erfolgt der Zusammenbau des Fahrzeugs<br />
an weitgehend automatisierten Montagelinien.<br />
Hierbei komplettieren überwiegend vorgefertigte<br />
Baugruppen und Module (unter anderem Cockpit,<br />
Sitze, Antriebseinheit) das Automobil. So besteht<br />
beispielsweise die Antriebseinheit aus Motor, Getriebe<br />
und Vorderachse. Diese stammen überwiegend<br />
aus der Produktion anderer <strong>Werk</strong>e des Konzerns.<br />
Nach der Montage fährt das Fahrzeug mit eigenem<br />
Antrieb zu den Einstellständen. Hier prüfen Mitarbeiter<br />
die Funktion von Motor, Bremsen, Lenkung<br />
und Scheinwerfern. Auf einem Rollenprüfstand<br />
Presswerk<br />
Karosseriebau<br />
Lackiererei<br />
Hohlraum-<br />
konservierung<br />
Nachbehandlung<br />
Prüfstände<br />
absolviert das Auto eine erste Probefahrt.<br />
Bisher müssen die Fahrzeuge vor der Auslieferung<br />
an den Kunden entwachst werden, was unter Einsatz<br />
organischer Lösemittel geschieht. Zum Jahresende<br />
<strong>2007</strong> wurde deshalb die Transportkonservierung<br />
durch einen Oberflächenschutz aus Klebefolien oder<br />
Transportschutzhauben, die teilweise wiederverwendbar<br />
sind, ersetzt.<br />
Im Anschluss fahren die Automobile zur Verladerampe<br />
und per Bahn bzw. Lkw zu den Händlern.<br />
13
Entwicklung, Produktion und Erzeugnisse<br />
Komponentenfertigung<br />
Die Produktion von Komponenten ist neben der<br />
Fahrzeugherstellung ein Fertigungsschwerpunkt der<br />
Standorte. So werden zahlreiche Aggregate und Baugruppen,<br />
beispielsweise Getriebe, Motoren, Achsen,<br />
Abgasanlagen und Kunststoffteile, konzernintern<br />
hergestellt. Drei Beispiele:<br />
Getriebe<br />
Je nach Typ bestehen Getriebe aus 400 bis 800 Einzelteilen:<br />
Gehäuse, Zahnräder, Wellen, Wälzlager,<br />
Flansche, Synchronisationseinrichtungen, Schaltelemente<br />
und Kleinteile. Die Gießerei fertigt Leichtmetall-Getriebegehäuse.<br />
Hierbei wird in hohem Maß<br />
Recyclingmaterial genutzt. Zahnradrohlinge bekommen<br />
ihre Grundform in der Schmiede, wobei immer<br />
mehr versucht wird, schon hier eine möglichst endkonturnahe<br />
Form zu erreichen. Die nachfolgende<br />
Bearbeitung kann dann erheblich reduziert werden.<br />
Den nächsten Arbeitsgang – die spanabhebende<br />
Bearbeitung – leistet der Bereich Mechanik. Hierbei<br />
eingesetzte Kühlschmierstoffe werden ständig<br />
14<br />
regeneriert und so lange wie möglich wiederverwendet.<br />
Das erklärte und systematisch verfolgte<br />
Umweltziel ist hier der weitestgehende Einsatz von<br />
Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung,<br />
was technisch bei vielen, aber nicht allen<br />
Bearbeitungsschritten möglich ist. Die Folge ist die<br />
zunehmende Eliminierung großer Mengen an Kühlschmierstoffen.<br />
Anfallende Metallabfälle gelangen nach sortenreinem<br />
Trennen erneut in den Produktionskreislauf.<br />
In der Härterei erhalten Zahnräder und Wellen ihre<br />
Verschleißfestigkeit, wobei je nach Einsatzbereich<br />
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen,<br />
wie beispielsweise Einsatzhärten, Salzbadhärten,<br />
Induktionshärten und Carbonitrieren.<br />
Motoren<br />
In der mechanischen Fertigung entstehen aus angelieferten<br />
Gussteilen und Rohlingen Motorblöcke,<br />
Zylinderköpfe und Kurbelwellen. Für die spangebenden<br />
Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, Bohren,<br />
Drehen, Schleifen und Honen gilt das Gleiche wie
Entwicklung, Produktion und Erzeugnisse<br />
Komponentenfertigung<br />
für den Bereich Getriebebau: Es gelingt in immer<br />
mehr Abschnitten der mechanischen Fertigung,<br />
durch Verwendung optimierter <strong>Werk</strong>zeuge auf Verfahren<br />
umzustellen, die den Einsatz von minimalen<br />
Schmiermengen erlauben.<br />
Komponenten, die im Motor besonders großen<br />
Kräften ausgesetzt sind, erhalten durch eine chemisch-physikalische<br />
Behandlung oder mittels<br />
Plasmaverfahren eine höhere Verschleißfestigkeit.<br />
In weiteren Produktionsbereichen werden Pleuel,<br />
Nockenwellen, Ventile, Tassenstößel, Lager und eine<br />
Vielzahl weiterer Motorkomponenten gefertigt. Der<br />
Zusammenbau der Aggregate erfolgt anschließend<br />
auf Montagelinien. In Einstellständen werden die<br />
Motoren auf ihre Funktion geprüft. Die Serienüberwachung<br />
erfolgt auf Motorprüfständen. Dort finden<br />
neben einem Leistungstest auch die Messung des<br />
Verbrauchs und die Kontrolle der Emissionswerte<br />
statt. Durch den zunehmenden Einsatz von Kalttests<br />
werden hierbei Kraftstoff sowie Schadstoff- und CO - 2<br />
Emissionen eingespart.<br />
Vor dem Abtransport in die fahrzeugbauenden<br />
<strong>Werk</strong>e wird ein Teil der Aggregate mit einer Schutzschicht<br />
aus Wachs versehen, wobei keine organischen<br />
Lösemittel mehr eingesetzt werden.<br />
Kunststoffteile<br />
Die Kunststofftechnik stellt beispielsweise Kraftstofftanks,<br />
Stoßstangen, Gehäuse, Verkleidungen und<br />
Instrumententafeln her. Hier wird mit modernsten<br />
Methoden wie Mehrkomponenten-Spritzgießen,<br />
Gas-Innendruckverfahren und Hinterspritztechnik<br />
produziert. Zum Einsatz gelangt in unterschiedlicher<br />
Intensität Recyclinggranulat. Es stammt aus<br />
eigenen Produktionsabfällen.<br />
15
Umweltmanagement-System<br />
Umweltschutz hat bei <strong>Volkswagen</strong> einen festen Platz<br />
im Management. Wirkungsvolle Organisationsstrukturen<br />
im Sinne von EMAS unterstützen die nachhaltige<br />
Unternehmenstätigkeit in Forschung, Planung<br />
und Produktion. Sie werden werkübergreifend festgelegt,<br />
standortspezifisch präzisiert und umgesetzt.<br />
Organisation<br />
Sowohl Umweltmanagement-System (UMS) als<br />
auch Umweltmanagement-Handbuch der Marke<br />
<strong>Volkswagen</strong> sind für alle Standorte verbindlich. Das<br />
Handbuch fixiert zentrale Abläufe sowie Verantwortlichkeiten<br />
und definiert die Rahmenbedingungen<br />
für das Umweltmanagement der <strong>Werk</strong>e. In jedem<br />
Kapitel wird zunächst auf die allgemein geltenden<br />
Bestimmungen eingegangen. Im Anschluss werden<br />
jeweils die auf die einzelnen Standorte abgestimmten<br />
Regelungen, Zuständigkeiten und Abläufe<br />
beschrieben.<br />
Günter Damme<br />
Umweltmanagementvertreter Marke<br />
<strong>Volkswagen</strong><br />
16<br />
Konzernaufgaben<br />
Der Vorsitzende des Konzernvorstands trägt die<br />
oberste Verantwortung für das Betreiben genehmigungsbedürftiger<br />
Anlagen (§ 52a BImSchG und § 53<br />
KrW-/AbfG).<br />
Um die konzernweite Koordination aller Umweltschutzaktivitäten<br />
zu verbessern, wurde 2006 der<br />
Konzernbereich Umwelt neu organisiert. Die Ausrichtung<br />
erfolgte einerseits auf produkt- und produktionsbezogene<br />
Aspekte, die so beide zentral und<br />
„aus einer Hand“ bearbeitet werden; dazu gehört<br />
auch die Durchführung der internen Umwelt-Audits.<br />
Andererseits kümmern sich Teams zukunftsbezogen<br />
um künftige Strategien im Umweltschutz und um<br />
Konzepte zur Sicherstellung der Mobilität bei ständig<br />
steigender Belastung der Straßen.<br />
Der Leiter Umwelt zeichnet für die Aufrechterhaltung<br />
des gesamten Umweltmanagement-Systems<br />
verantwortlich. Er ist der Umweltmanagementvertreter<br />
der Marke <strong>Volkswagen</strong> und koordiniert die<br />
Umweltschutzbeauftragten der <strong>Werk</strong>e.<br />
Die Fahrzeuge der Marken <strong>Volkswagen</strong> und <strong>Volkswagen</strong><br />
Nutzfahrzeuge werden ganz überwiegend von<br />
den rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
der Technischen Entwicklung (TE) in Wolfsburg entworfen<br />
und konstruiert. Um bereits in dieser frühen<br />
Phase des Produktlebenszyklus Aspekte des Umweltschutzes<br />
zu berücksichtigen, ist bei <strong>Volkswagen</strong><br />
ein Umweltschutzbeauftragter für die Belange des<br />
Produkts eingesetzt. Seine Mitarbeiter bestimmen<br />
für jedes neue Projekt auf der Basis der bereits<br />
erwähnten Umweltziele der TE umweltrelevante<br />
Vorgaben und achten auf deren Verwirklichung.
Zentralbereiche der <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Vorstand Forschung und Entwicklung<br />
Verantwortlicher nach § 52 a BlmSchG<br />
Konzernforschung<br />
Vorsitzender Konzern-Steuerkreis Umwelt<br />
Umwelt- und Arbeitsschutz<br />
Umweltmanagementvertreter Marke <strong>Volkswagen</strong><br />
Umwelt Produktion<br />
Audit-Team<br />
Technische Entwicklung<br />
Umweltbeauftragter für das Produkt<br />
<strong>Volkswagen</strong> Logistics GmbH<br />
Gefahrgutbeauftragter<br />
Umweltmanagement-System<br />
Sogenannte Umweltpaten betreuen die Fahrzeugprojekte<br />
von den ersten Vorplanungen bis zum<br />
Produktionsstart aus Umweltsicht.<br />
Ein aktuelles Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
der Fachbereiche und die beratende<br />
Tätigkeit des Umweltschutzbeauftragten stellen<br />
die Modelle der BlueMotion-Serie dar, die in ihren<br />
jeweiligen Klassen besonders günstige Verbrauchsund<br />
Emissionswerte aufweisen. Der POLO BlueMotion<br />
ist mit 99 g CO /km der sparsamste Fünfsitzer<br />
2<br />
in Europa.<br />
Der Geschäftsbereich Technische Entwicklung<br />
erhielt bereits 1996 eines der ersten Zertifikate nach<br />
der internationalen Norm ISO 14.001.<br />
Im Konzernstrategiekreis-Umwelt (KSK-U) werden<br />
konzernweite Umweltstrategien entwickelt und es<br />
wird sichergestellt, dass die <strong>Volkswagen</strong>-Umweltgrundsätze<br />
in allen Geschäftsbereichen und an allen<br />
Standorten eingehalten werden. In diesem Gremium<br />
sind die Marken des Konzerns, die Standortregionen<br />
sowie Experten aus der Konzernzentrale vertreten.<br />
Standorte<br />
<strong>Werk</strong>management<br />
<strong>Werk</strong>leiter/Standortmanagement<br />
Umweltschutz<br />
Umweltbeauftragter<br />
und Umweltmanagementbeauftragter<br />
des<br />
Standortes<br />
<strong>Werk</strong>logik<br />
<strong>Werk</strong>koordinator Gefahrgut<br />
Fertigung<br />
Betreiber umweltrelevanter<br />
Anlagen,<br />
beauftragte Person nach<br />
GbV, Sachkundige für<br />
Umweltschutz<br />
Gemeinsam werden Umweltziele entwickelt und<br />
Maßnahmen zu deren Erreichung überwacht. Den<br />
Vorsitz im KSK-U nimmt der Leiter des Bereichs<br />
Konzernforschung wahr, Geschäftsführer ist der<br />
Leiter Umwelt.<br />
Ein weiteres wichtiges Instrument sind die Regionalkonferenzen,<br />
die den fachlichen Austausch zwischen<br />
der Konzernzentrale und den regionalen Umweltschutzbeauftragten<br />
an den lateinamerikanischen,<br />
südafrikanischen und ostasiatischen Standorten<br />
gewährleisten. Konkrete Umweltschutzmaßnahmen<br />
werden durch Sensibilisierung der Mitarbeiter,<br />
durch Know-how-Transfer und das Formulieren von<br />
Zielvereinbarungen angestoßen.<br />
Der Gefahrgutbeauftragte ist als Stabsstelle der<br />
Geschäftsführung der <strong>Volkswagen</strong> Logistics GmbH<br />
zugeordnet. Er kontrolliert zentral die Einhaltung<br />
der Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter.<br />
Unterstützung erhält er von <strong>Werk</strong>koordinatoren und<br />
beauftragten Personen nach Gefahrgutbeauftragten-<br />
Verordnung (GbV) in den einzelnen <strong>Werk</strong>en.<br />
17
Umweltmanagement-System<br />
Vorstand Forschung und Entwicklung<br />
Generalbevollmächtigter Konzernforschung<br />
KSK - U Umwelt-Marken-Ausschuss (UMA)<br />
In einem in Wolfsburg regelmäßig tagenden Arbeitskreis<br />
„Energiemanagement“ treffen sich Vertreter<br />
der über 40 Standorte des Konzerns. Hier wird über<br />
neue energiesparende Techniken berichtet und es<br />
werden Erfahrungen ausgetauscht sowie weiterführende<br />
Strategien erarbeitet.<br />
<strong>Werk</strong>aufgaben<br />
Die oberste Leitung an den Standorten (<strong>Werk</strong>leiter,<br />
Leiter des Betriebes) ist aufgrund der Organisationspflicht<br />
für die Einhaltung der Umweltpolitik und des<br />
Umweltrechts durch den Aufbau und die Umsetzung<br />
organisatorischer Strukturen und Berichtswege verantwortlich.<br />
Hierfür werden die erforderlichen Delegationsmaßnahmen<br />
getroffen. Bei Abweichungen<br />
vom Normalbetrieb sind Meldewege festgelegt.<br />
An jedem Standort ist je ein Umweltschutzbeauf-<br />
18<br />
Leiter Konzernforschung<br />
Umweltmanagementbeauftragter<br />
der Marke<br />
<strong>Volkswagen</strong><br />
Umweltbeauftragter<br />
Produkt<br />
Umweltbeauftragter<br />
Produktion<br />
Umwelt<br />
Umwelt<br />
Strategie<br />
A000 bis A-Klasse<br />
Umwelt<br />
Produkt<br />
Umweltpaten für Technische Entwicklung<br />
Umweltschutzbeauftragte der Standorte<br />
Umwelt<br />
Produktion<br />
B- bis D-Klasse Nutzfahrzeuge Module<br />
Wolfsburg Emden Hannover SZ <strong>Kassel</strong> Weitere<br />
Standorte<br />
tragter eingesetzt, der in Personalunion Betriebsbeauftragter<br />
für Immissionsschutz, für Abfall und für<br />
Gewässerschutz ist. Er kontrolliert mithilfe seiner<br />
Mitarbeiter die Wirksamkeit fertigungsbezogener<br />
Umweltschutzmaßnahmen, berät die Anlagenbetreiber,<br />
erfasst und bewertet die Umweltdaten des<br />
Standorts. Der Umweltschutzbeauftragte fungiert<br />
gleichermaßen als Umweltmanagementvertreter für<br />
das standortbezogene Umweltmanagement-System<br />
und ist in Umweltbelangen Teilnehmer der obersten<br />
Leitungsebene. Die Umweltmanagementvertreter<br />
kontrollieren die Einhaltung der umweltbezogenen<br />
Regelungen und sind federführend mit der Umsetzung<br />
standortspezifischer Umweltprogramme betraut.<br />
Sie informieren regelmäßig sowohl die oberste<br />
Leitungsebene als auch die Belegschaft und wirken<br />
so darauf hin, die Vorgaben der Umweltpolitik von<br />
<strong>Volkswagen</strong> zu erfüllen.
Umweltmanagement-System<br />
Die Sachkundigen für Umweltschutz unterstützen<br />
den Umweltschutzbeauftragten und die Betreiber<br />
der umweltrelevanten Anlagen innerhalb ihres<br />
Zuständigkeitsbereiches bei der Umsetzung des<br />
betrieblichen Umweltschutzes. Sie werden entsprechend<br />
ausgebildet und wirken im Umfeld ihres<br />
Arbeitsplatzes auf das Einhalten von Umweltgesetzen,<br />
die Berücksichtigung der Umweltpolitik<br />
von <strong>Volkswagen</strong> in der täglichen Arbeit und auf die<br />
Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung des<br />
Umweltschutzes hin.<br />
Information, Verbesserungsideen<br />
Die Mitarbeiter aller Standorte erhalten regelmäßig<br />
Unterweisungen, Schulungen und Informationen<br />
zum Umweltschutz. Sie sind über das Ideenmanagement<br />
ständig aufgefordert, an der Gestaltung von<br />
Arbeitsplätzen, Effizienzsteigerung von Arbeitsabläufen<br />
und Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes<br />
mitzuwirken. 2001 verlieh <strong>Volkswagen</strong> erstmals<br />
den seither alle zwei Jahre ausgeschriebenen<br />
internen Umweltpreis. Prämiert werden hohes<br />
persönliches Engagement von Mitarbeitern, die von<br />
sich aus die Initiative ergreifen und in ihrem Arbeitsumfeld<br />
Ideen für einen Beitrag zum Schutz der<br />
Umwelt entwickeln und auch umsetzen.<br />
Im Jahr <strong>2007</strong> wurden u. a. folgende Initiativen ausgezeichnet:<br />
- Die Entwicklung und Umsetzung eines intelligenten<br />
Energieverbrauchsmanagements in der<br />
Lackiererei im <strong>Werk</strong> Zwickau. Dadurch wurde eine<br />
Senkung von CO -Emissionen erreicht.<br />
2<br />
- Der Einsatz von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
in Aufzügen und Hebebühnen zur weiteren<br />
Verbesserung des Grundwasserschutzes.<br />
- Die Formulierung eines Abfall-Leitfadens durch<br />
Auszubildende im <strong>Werk</strong> Hannover, mit dem sie ihre<br />
Kollegen und Kolleginnen in den Ausbildungsabteilungen<br />
in ihrem betrieblichen Umweltmanagement<br />
unterstützen wollen.<br />
Ende <strong>2007</strong> fand in Wolfsburg mit großer Beteiligung<br />
aller Konzern-Standorte die dritte Umweltkonferenz<br />
statt, auf der auf Konzernebene Fortschritte<br />
im Umweltschutz, Aktionspläne und Ergebnisse der<br />
Regionalkonferenzen diskutiert wurden.<br />
Externe Wirkung<br />
Auch Lieferanten und Zulieferer werden in den Umweltschutz<br />
einbezogen. Aufbauend auf den bestehenden<br />
Vorgaben wie Materialempfehlungen und<br />
-verbote und Umweltlastenhefte wurde im Dialog<br />
mit Geschäftspartnern ein Konzept zur Nachhaltigkeit<br />
entwickelt, in das umweltbezogene und soziale<br />
Grundsätze integriert sind. Diese Anforderungen<br />
basieren auf <strong>Volkswagen</strong>-eigenen Leitlinien und<br />
orientieren sich an externen internationalen Standards,<br />
zu denen sich <strong>Volkswagen</strong> als multinationaler<br />
Konzern bekennt. Wichtige Elemente sind u. a. ein<br />
Fragebogen für einen Selbstcheck des Lieferanten,<br />
ein Unterstützungsangebot durch ein Experten-<br />
Team, fallbezogene Stichproben vor Ort, ausführliche<br />
Kommunikation über die B2B-Lieferantenplattform<br />
im Internet.<br />
Schon länger gibt es bei <strong>Volkswagen</strong> Lieferantenschulungen<br />
als ein Instrument zur Wahrnehmung<br />
der sozial-ökologischen Verantwortung. Unter dem<br />
Logo „Priorität A-Partner für Umwelt und Nachhaltigkeit“<br />
wurden in den letzten zehn Jahren über 150<br />
Trainingsmaßnahmen mit mehr als 1.500 Teilnehmern<br />
durchgeführt.<br />
19
Umweltprüfung und Ermittlung der Umweltaspekte<br />
Die ersten Umweltprüfungen an den sechs Standorten<br />
erfolgten im Zeitraum von 1995 bis 1999 durch<br />
die Konzernabteilung Umwelt Produktion. Hierbei<br />
kamen die Methoden Umwelt-Audit und U-Risk<br />
zum Einsatz. Während U-Risk im Rahmen der Erstaufnahme<br />
zur Ermittlung des anlagenbezogenen<br />
Risikopotenzials pro Standort einmal angewandt<br />
wurde (in späteren Durchläufen wurden nur die Änderungen<br />
am Standort betrachtet), handelt es sich<br />
beim Umwelt-Audit um eine kontinuierliche Methode,<br />
die jährlich erfolgt. U-Risk wurde im Jahr 2001<br />
durch ein Verfahren zur Ermittlung und Bewertung<br />
der Umweltaspekte eines Standorts abgelöst (SEBU).<br />
Umwelt-Audit<br />
Im Rahmen der Umwelt-Audits werden Umweltorganisation,<br />
Umweltrecht sowie Umwelttechnik<br />
anhand von Befragungen, Begehungen und mittels<br />
Checklisten überprüft. Die Mitglieder der Audit-<br />
Teams sind unabhängig und rhetorisch sowie technikspezifisch<br />
geschult. Die Befragung trifft sowohl<br />
das Management als auch die Mitarbeiter vor Ort.<br />
Eine Dokumentenprüfung ergänzt diese Analyse.<br />
Hierbei erfolgen auch die Sichtung der Auflagen aus<br />
Genehmigungsbescheiden und die Prüfung der Vollständigkeit<br />
gesetzlich geforderter Unterlagen, wie<br />
beispielsweise Gefahrstoffkataster und Nachweisbücher.<br />
Die Ergebnisse der Umweltprüfung münden<br />
in Handlungsempfehlungen für jede untersuchte<br />
Organisationseinheit.<br />
Zur Optimierung der Zertifizierungsverfahren wurde<br />
2006 das Konzept für eine Verbundzertifizierung entwickelt.<br />
Dabei werden für die deutschen Standorte<br />
das EMAS-Verfahren und die internationale Norm<br />
ISO 14001 zusammengeführt. Die osteuropäischen<br />
Standorte der Marken <strong>Volkswagen</strong> und<br />
20<br />
<strong>Volkswagen</strong> Nutzfahrzeuge sowie der französische<br />
Standort Molsheim (Marke Bugatti) werden mit<br />
den deutschen Fabriken im Verbund nach ISO 14001<br />
zertifiziert.<br />
EMAS-Validierungen inklusive ISO<br />
Salzgitter<br />
Wolfsburg<br />
Braunschweig<br />
Emden<br />
Hannover<br />
<strong>Kassel</strong><br />
Zwickau<br />
K-EFU<br />
Dresden<br />
Chemnitz<br />
Bratislava<br />
Molsheim<br />
TE<br />
WOB<br />
Martin<br />
Poznan<br />
Bewertung per Matrix<br />
Mit Inkrafttreten der novellierten EMAS-Verordnung<br />
erfolgte die Einführung einer neuen Methode zur<br />
Ermittlung und Bewertung wesentlicher Umweltaspekte.<br />
Im ersten Schritt dieser Methode ermittelt<br />
das Audit-Team die objektive Umweltauswirkung<br />
des Standorts. Hierfür werden Daten und Informationen<br />
erfasst und mit einem festgelegten Maßstab<br />
bewertet. Die Einstufung der datenbasierten,<br />
quantitativen Aspekte (z. B. CO -Emissionen) stützt<br />
2<br />
sich auf die Methode der ökologischen Knappheit<br />
(BUWAL 1998), für die qualitativen Aspekte (z.B. Verhalten<br />
von Fremdfirmen) wurden eigene Kriterien<br />
definiert. In einer Matrix werden die Umweltaspekte<br />
den jeweiligen Unternehmensbereichen gegenübergestellt<br />
und die Ergebnisse der Bewertung dokumentiert<br />
(vgl. Abb.). Sehr wichtige Umweltaspekte<br />
erscheinen rot, wichtige gelb und weniger wichtige<br />
grün.<br />
ISO 14001 Verbundzertifizierung
Umweltaspekt <strong>Werk</strong> gesamt <strong>Werk</strong>technik Transportwesen Lackiererei Presswerk Karosserie Montage<br />
Abfall<br />
Abwasser<br />
Abluft<br />
Wärme<br />
Strom<br />
Verkehr<br />
Geruch<br />
Lärm<br />
Altlasten<br />
Flächenversiegelung<br />
Organisation/<br />
Qualifi kation<br />
externe<br />
Dienstleister<br />
Notfallsituation<br />
Ableitung von Umweltzielen<br />
Tabelle<br />
Aus jeder Art des Wirtschaftens resultieren Umweltauswirkungen,<br />
die unvermeidbar sind. Die Farbe<br />
der Bewertung sagt aus, welche Umweltaspekte am<br />
jeweiligen Standort besondere Bedeutung besitzen.<br />
Das dargestellte Ergebnis trifft zunächst noch keine<br />
Aussage über mögliche Verbesserungspotenziale.<br />
Dies wird in einem weiteren Schritt ermittelt. Sind<br />
Verbesserungspotenziale in Abhängigkeit von der<br />
eingesetzten bis hin zur prinzipiell möglichen Technologie<br />
abzuleiten, können diese jetzt als Umweltziel<br />
formuliert werden und ins Umweltprogramm<br />
einfließen. Die Matrix liefert dem Bereich also eine<br />
Hilfestellung in der Form, dass erkannte Verbesserungspotenziale<br />
in roten Feldern mit einer größeren<br />
Priorität zu bewerten sind als solche in grünen Feldern.<br />
Die Handlungsempfehlungen aus Audit-Berichten<br />
liefern dabei zusätzliche ergänzende Hinweise.<br />
sehr wichtig wichtig weniger wichtig<br />
Beispiel<br />
Eine Lackiererei wird unter Einhaltung aller gesetzlich<br />
geforderten Grenzwerte betrieben. Das Audit-<br />
Team bewertet sie hinsichtlich des Umweltaspekts<br />
„Emissionen in die Luft“ dennoch mit rot. Ursache:<br />
In diesem Bereich fallen im Verhältnis zur restlichen<br />
Fabrik die wesentlichen Abluftemissionen an.<br />
Die Lackiererei prüft nun im Gespräch mit internen<br />
Umweltschutz-Experten und dem Umweltaudit-<br />
Team, durch welche technischen oder organisatorischen<br />
Maßnahmen der Umweltaspekt „Emissionen<br />
in die Luft“ weiter zu verbessern ist.<br />
Das Ergebnis einer solchen Untersuchung können<br />
Umweltziele sein (beispielsweise die Einführung<br />
anderer Lacksysteme oder effizienterer Auftragsverfahren).<br />
Jedoch könnte auch festgestellt werden,<br />
dass die Anlagen nach dem Stand der Technik<br />
betrieben werden und eine weitere Verringerung der<br />
Emissionen derzeit nicht möglich ist. In diesem Fall<br />
wäre es zulässig, trotz Einstufung als „sehr wichtiger<br />
Aspekt“ keine Umweltziele zu definieren.<br />
21
Erarbeitung von Umweltprogrammen und -zielen<br />
Das Umweltprogramm eines Standorts beschreibt<br />
die zur Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes<br />
vereinbarten Zielkategorien und zu deren<br />
Konkretisierung geplante Einzelziele.<br />
Um Maßnahmen schnell und effizient umzusetzen,<br />
werden von der obersten Leitung des jeweiligen<br />
Standorts Verantwortliche benannt, Zeiträume festgelegt<br />
und Budgets zugeordnet.<br />
Umweltprogramme in den <strong>Werk</strong>en der <strong>Volkswagen</strong><br />
<strong>AG</strong> weisen neun gleichrangige Zielkategorien auf:<br />
1. Verbesserung der Grundlage umweltrelevanter<br />
Daten<br />
2. Verbesserung der indirekten und der produktbezogenen<br />
Umweltaspekte<br />
3. Verbesserung der Umweltschutztechnik und des<br />
Immissionsschutzes<br />
4. Verbesserung des Boden- und Grundwasserschutzes<br />
5. Verbesserung des Abfallmanagements<br />
6. Verbesserung des Naturschutzes<br />
7. Verbesserung umweltrelevanter Ausbildungs-<br />
22<br />
und Informationsmaßnahmen<br />
8. Verbesserung der Organisation<br />
9. Ressourceneinsparung<br />
Den Status quo der einzelnen Ziele und Maßnahmen<br />
eruieren die Verantwortlichen regelmäßig mit Zielverfolgungstabellen.<br />
Sie kennzeichnen abgearbeitete<br />
Ziele mit einem Erledigungsvermerk und nehmen<br />
neue Ziele auf. Die sechs standortspezifischen Teile<br />
dieser Umwelterklärung verdeutlichen diese Vorgehensweise<br />
und enthalten das Umweltprogramm des<br />
jeweiligen Standorts in Tabellenform. Der Jahresvergleich<br />
innerhalb dieser Aufstellung macht die<br />
langfristige Entwicklung nachvollziehbar.<br />
Eventuelle Probleme, die zu verzögerter Realisierung<br />
eines Ziels führen können (beispielsweise Behinderungen<br />
durch langfristige Genehmigungsverfahren,<br />
Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung),<br />
werden in Fußnoten erläutert. Hiervon betroffene<br />
Ziele tragen eine gelbe Markierung. Abgearbeitete<br />
Ziele sind grün hinterlegt. Das Umweltprogramm<br />
wird jährlich kontrolliert und aktualisiert.
<strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong>
Standortdaten<br />
Mitarbeiter: 13.591 (Anfang <strong>2007</strong>)<br />
Produkte: Getriebe, Zylinderkurbelgehäuse,<br />
Press- und Karosserieteile,<br />
Abgasanlagen, aufbereitete<br />
Motoren und Getriebe<br />
Kapazität: u. a. 2,6 Mio. Getriebe, 82<br />
Mio. Press- und Karosserieteile,<br />
4 Mio. Abgasanlagen pro Jahr<br />
Fläche: -<strong>Werk</strong><br />
-Aggregateaufb.<br />
-Kat.-Recycling<br />
Die im Jahr <strong>2007</strong> vorgelegten aktualisierten Zahlen<br />
und Aussagen des <strong>Kassel</strong>er Teils der Umwelterklärung,<br />
die sich auf das Betrachtungsjahr 2006<br />
<strong>Werk</strong>leiter<br />
Dr. Hans-Helmut Becker<br />
K2<br />
ca. 280 Hektar<br />
185.289 m²<br />
980 m²<br />
Bebauungsgrad: ca. 38 %<br />
EMAS-Daten<br />
Erstvalidierung November 1998<br />
Revalidierung November 2001<br />
November 2004<br />
November <strong>2007</strong><br />
Überwachungsaudits November 2005<br />
November 2006<br />
beziehen, wurden durch Umweltgutachter der TÜV<br />
Nord Cert Umweltgutachter GmbH auf sachliche<br />
Richtigkeit überprüft.<br />
Umweltschutzbeauftragter<br />
Rupert Zeh
Der Standort<br />
Das <strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong> befindet sich innerhalb der Gemarkung<br />
Baunatal in einem ausgewiesenen Industriegebiet.<br />
Diese nordhessische Kleinstadt mit derzeit<br />
rund 28.000 Einwohnern liegt etwa 5 Kilometer<br />
südlich von <strong>Kassel</strong>. <strong>Volkswagen</strong> erwarb 1957 das Gelände<br />
der ehemaligen Henschel Flugmotoren GmbH.<br />
Bereits ein Jahr später begannen 25 Mitarbeiter<br />
zunächst mit der Aufbereitung von Käfer-Motoren,<br />
wenig später kamen Getriebe und andere Fahrzeugteile<br />
hinzu.<br />
Bedeutung ab 1960<br />
Einen deutlichen Aufschwung nahm die Fabrik mit<br />
Beginn der Getriebefertigung 1960.<br />
Die Zunahme der Fertigungszahlen führte dazu,<br />
dass der Standort <strong>Kassel</strong> zum sogenannten Getriebe-<br />
Leitwerk des <strong>Volkswagen</strong> Konzerns aufstieg. Kennzeichnend<br />
für diese Produktion sind Anlagen für nahezu<br />
jede Art der mechanischen Metallbearbeitung<br />
einschließlich Härtereien mit den der Störfallverordnung<br />
unterliegenden Anlagen Ammoniak- und<br />
Propangaslager. Später wurden dem Standort ein<br />
Presswerk, zwei Tauchlackieranlagen, eine Schmiede,<br />
ein großes Schmelzwerk – unter anderem für<br />
Aluminiumschrott – und eine Leichtmetallgießerei<br />
angegliedert. Das Aluminiumumschmelzwerk verarbeitet<br />
eigene sowie fremd angelieferte Schrotte mit<br />
einer Schmelzleistung von 242 t pro Tag.<br />
Dependancen<br />
Daneben gehören zu dem Standort zwei kleinere<br />
Dependancen in der Lilienthalstr. 140 in <strong>Kassel</strong> Bettenhausen<br />
(Aggregateaufbereitung) sowie auf dem<br />
Gelände von Thyssen Krupp Expersite in der Holländischen<br />
Straße 195 in <strong>Kassel</strong> Rothenditmold eine<br />
angemietete Halle für das Katalysatorenrecycling.<br />
Diese beiden Dependancen sind integraler Bestandteil<br />
der <strong>Werk</strong>organisation und mit allen wichtigen<br />
Organisationseinheiten des Standortes vernetzt.<br />
Das Katalysatorrecycling als kleine Kostenstelle<br />
gehört organisatorisch zur Abgasanlagenfertigung<br />
und die Aggregateaufbereitung ist dem Getriebebau<br />
zugeordnet. Die Entsorgung von Abfällen und von<br />
industriellen Abwässern wird über bzw. durch die<br />
OE Umweltschutz geleistet.<br />
In der Aggregateaufbereitung werden gebrauchte<br />
Motoren, Getriebe und andere Fahrzeugteile durch<br />
den Aufbereitungsprozess (Zerlegen, Reinigen etc.)<br />
für den Pkw-Betrieb wieder nutzbar gemacht. Dadurch<br />
werden energieintensive Bearbeitungsschritte<br />
(Schmelzen, Gießen etc.) einer Neuproduktion vermieden,<br />
was letztlich zur Ressourcenschonung, Material-<br />
u. Energieeffizienzsteigerung beiträgt. Durch<br />
die Verlagerung der Aggregateaufbereitung in das<br />
K3
alte Industriegebiet im <strong>Kassel</strong>er Osten (die Grundstücksfläche<br />
von 185.289 m² entspricht ca. 8 % der<br />
<strong>Werk</strong>fläche) konnten leerstehende Gebäude des<br />
Vorbesitzers weiter genutzt werden und im Gegenzug<br />
Freiflächen im <strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong> für neue, modernere<br />
Schalt- und Automatikgetriebe geschaffen werden.<br />
In der nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigten<br />
Katalysator-Recyclinganlage werden in einer<br />
980 m² großen Halle jährlich ca. 200.000 Katalysatoren<br />
und Dieselpartikelfilter sowie ca. 55.000 Katalysatoren<br />
aus der Fertigung mechanisch demontiert.<br />
Dabei anfallende metallische Wertstoffe sowie die<br />
nicht mehr gebrauchsfähigen Monolithen werden<br />
dem externen Recycling zugeführt.<br />
Eigene Trinkwassergewinnung und Abwasserbehandlung<br />
Der Standort wird durch den Betrieb fünf eigener<br />
Tiefbrunnen autark mit Trinkwasser für Produktionszwecke<br />
und sanitäre Belange versorgt. Das<br />
anfallende Abwasser wird in mehreren dezentralen<br />
Abwasservorbehandlungsanlagen dem Stand der<br />
Technik entsprechend vorbehandelt. In einer zentralen<br />
physikalisch-chemischen und biologischen Kläranlage<br />
(Ausbaugröße von 50.000 Einwohner-Gleichwerte<br />
(EGW)) wird das Abwasser unter Einhaltung<br />
der Einleitgrenzwerte in den kleinen Fluss Bauna<br />
eingeleitet. Durch langjährige gewässerbiologische<br />
Untersuchungen kann der gute Zustand der Bauna<br />
(Gewässergüteklasse 2) nachgewiesen werden.<br />
K4<br />
Seit Mitte des Jahres <strong>2007</strong> werden in der Kläranlage<br />
am Standort auch Abwässer von zwei externen Deponiebetreibern<br />
(ca. 3.000 m3 ) mit behandelt.<br />
Eigene Deponie<br />
Ferner betreibt das <strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong> auf dem Betriebsgelände<br />
eine etwa 6 ha große Deponie. Auf dieser<br />
werden werktypische Abfälle – wie z. B. Klärschlämme,<br />
Ofenausbruch sowie Bauschutt und Erdaushub<br />
– eingelagert. Die Deponie ist mit einer dem Stand<br />
der Technik entsprechenden Basis- und Oberflächenabdichtung<br />
ausgestattet.<br />
Weltweite Ersatzteilversorgung<br />
Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage am Schnittpunkt<br />
wichtiger Schienen- und Straßenverbindungen<br />
wählte <strong>Volkswagen</strong> das <strong>Werk</strong> Ende der<br />
60er-Jahre als Standort für das Original-Teile-Center<br />
(OTC) zur Versorgung des gesamten Konzern-Vertriebsnetzes.<br />
Das OTC deckt ein Sortiment von ca. 328.000 Original-Teilen<br />
ab, die täglich verfügbar sind. Aktuell<br />
werden jährlich mehr als 21 Mio. Auftragspositionen<br />
bewältigt.
Besonderheiten und Entwicklung<br />
Produkte<br />
Die Marktsituation zeigt, dass neuere Getriebegenerationen,<br />
die die Kundenansprüche an Sportlichkeit,<br />
Schaltbarkeit und Energieeffizienz miteinander<br />
verbinden, zunehmend nachgefragt werden.<br />
Ein Erfolgsmodell in diesem Zusammenhang ist das<br />
Doppelschaltgetriebe (DSG 250). Hier wurden die<br />
Produktionszahlen kontinuierlich gesteigert. Aktuell<br />
werden 1.750 Einheiten am Tag gefertigt. Auch bei<br />
anderen Getriebemodellen, z. B. der Reihe MQ 350,<br />
ist eine schrittweise Erhöhung der Tagesproduktion<br />
von 2.500 Stck./Tg. im Jahr <strong>2007</strong> auf 2.900 Stck./Tg.<br />
im Jahr 2008 bereits geplant.<br />
Darüber hinaus werden Serienanläufe für die neuen<br />
Getriebemodelle DQ 200 und DL 501 zum Jahreswechsel<br />
<strong>2007</strong>/2008 erfolgen.<br />
Dies alles führt nach heutigem Kenntnisstand zu einer<br />
Erhöhung der Getriebejahresproduktion. Im Jahr<br />
2008 ist damit zu rechnen, dass die 3-Mio.-Grenze<br />
durchbrochen wird.<br />
K6<br />
Getriebeentwicklung am Standort<br />
Die Stärkung der eigenen Kernkompetenz im Getriebebau<br />
zeigt sich auch darin, dass hierfür zurzeit<br />
eine eigene Produktentwicklung am Standort <strong>Kassel</strong><br />
aufgebaut wird. Die Getriebegeneration DQ 500, die<br />
ebenfalls ab dem Jahr 2008 in die Serienfertigung<br />
geht, ist das erste erfolgsversprechende Beispiel<br />
dieser Aktivität. Weitere Getriebemodelle werden<br />
folgen.
Weitere strategische Standortfaktoren<br />
Neben der Produktentwicklung für Getriebe ist auch<br />
die Verwendung des <strong>Werk</strong>stoffs Magnesium in der<br />
Herstellung von Getriebegehäusen ein strategischer<br />
Faktor des Standortes sowie für den Umweltschutz.<br />
Hierdurch wird ein Beitrag zur Erreichung von<br />
Gewichtsreduktionszielen am Fahrzeug erreicht.<br />
Die Magnesiumrecyclinganlage wurde im Jahr <strong>2007</strong><br />
wieder in Betrieb genommen.<br />
Genehmigungen<br />
Im Jahr 2008 läuft die bestehende Bewilligung zur<br />
Förderung von Grundwasser aus. Im Jahr <strong>2007</strong> wurde<br />
dieses Recht daher durch ein förmliches Genehmigungsverfahren<br />
mit Öffentlichkeitsbeteiligung beim<br />
Staatlichen Umweltamt neu beantragt.<br />
Auch für die Errichtung eines eigenen Getriebeprüffeldes,<br />
das im Jahr 2008 in Betrieb gehen soll,<br />
wurde im Jahr <strong>2007</strong> ein Genehmigungsverfahren neu<br />
angestoßen. Daneben wurde u. a. eine Anzeige zur<br />
Inbetriebnahme des Wertstoffplatzes für Magnesium-Recyclingmaterial<br />
eingereicht.<br />
Besondere Ereignisse<br />
Im Jahr <strong>2007</strong> wurden zum insgesamt dritten Male<br />
Umwelttage im <strong>Werk</strong> durchgeführt, bei denen unterschiedliche<br />
Umweltprojekte vorgestellt wurden.<br />
Ein hoher Grad an externer und interner Beteiligung<br />
wurde erreicht.<br />
Im Jahr 2008 feiert der Standort <strong>Kassel</strong> sein 50jähriges<br />
Bestehen. Höhepunkt der Feiern wird der<br />
Familientag sein, der am 14.06.2008 stattfindet.<br />
K7
Umweltaspekte und Umweltdaten<br />
Bedeutung und Entwicklung<br />
Die Umweltaspekte werden regelmäßig mittels eines<br />
von der Konzerneinheit Umweltplanung Produktion/Standorte<br />
entwickelten Verfahrens bewertet<br />
(siehe allgemeiner Teil Seiten 20/21).<br />
Die Entwicklung der Umweltaspekte wird entscheidend<br />
durch die Produktion beeinflusst, wenngleich<br />
ein Anstieg der Produktion nicht zwangsläufig einen<br />
Anstieg der Umweltbelastung nach sich zieht, wie<br />
auch umgekehrt ein Rückgang der Produktion nicht<br />
zu einem proportionalen Rückgang wesentlicher<br />
Umweltaspekte für den Standort führt.<br />
Allein die Betriebsbereitschaft von Ver- und Entsorgungsanlagen<br />
verursacht bereits eine relativ hohe<br />
Grundlast.<br />
Die Produkte können im Hinblick auf deren Bearbeitungsintensität<br />
sehr unterschiedlich sein.<br />
Nachfolgende Erläuterungen geben einen Überblick<br />
über die Entwicklung der Zahlen des Standortes<br />
sowie der Umweltaspekte.<br />
Produktionsvolumen<br />
Die Getriebeproduktion konnte im Jahr 2006 um<br />
mehr als 3 % gesteigert werden. Auch bei den Zylinderkurbelgehäusen<br />
war der Zuwachs mit einem Plus<br />
von knapp 9 % deutlich, während bei den Abgasanlagen<br />
ein Rückgang in etwa der gleichen Höhe zu<br />
verzeichnen war.<br />
K8<br />
Tabelle<br />
Die übrigen Fertigungseinheiten befinden sich in<br />
etwa auf Vorjahresniveau.<br />
Abfallwirtschaft<br />
Im Mai 2006 kam es auf dem Schrottplatz des Aluminiumumschmelzwerkes<br />
durch Blitzeinschlag zu<br />
einem Großbrand von Magnesiumschrotten und<br />
-abfällen. Nachfolgend mussten ca. 258 t magnesiumhaltiger<br />
Abfall in Fässer verpackt und als Sonderabfall<br />
in einer Verbrennungsanlage der Hessischen<br />
Industriemüll Gesellschaft (HIM) beseitigt<br />
werden.<br />
Am 04.07.2006 wurde der Genehmigungsbescheid<br />
des Regierungspräsidiums <strong>Kassel</strong> zum unbefristeten<br />
Weiterbetrieb der <strong>Werk</strong>deponie Baunatal als Monodeponie<br />
der Deponieklasse III erteilt.<br />
Des Weiteren wurde die Deponiesteuerung erneuert.<br />
Sämtliche Deponiedaten werden zukünftig zur<br />
Abfallumschlagstation geleitet, bearbeitet und dann<br />
in einer zentralen Datenbank abgespeichert.<br />
Im Dezember 2006 wurde ein Änderungsgenehmigungsbescheid<br />
für den Betrieb der Altkatalysatorrecyclinganlage<br />
der Business Unit Abgasanlagen am<br />
Standort Mittelfeld in <strong>Kassel</strong> eingeholt, in dem die<br />
Entsorgung der neuen Dieselpartikelfilter als Monolithenbruch<br />
geregelt ist.<br />
Das Abfallaufkommen ist im zugrunde gelegten<br />
Jahresvergleich 2005/2006 um insgesamt
Fertigungseinheiten (St.)<br />
Getriebe<br />
Zylinderkurbelgehäuse<br />
6.000.000<br />
Abgasanlagen<br />
5.000.000<br />
ca. 25 % gesunken.<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
Dabei wurden die Abfälle zur Verwertung um knapp<br />
10 % und die Abfälle zur Beseitigung um über 50 %<br />
reduziert. Diese Entwicklungen begründen sich in<br />
erster Linie mit dem starken Rückgang bei den nicht<br />
produktionsspezifischen Abfällen. Im Jahr 2005<br />
konnten relativ viele große Baumaßnahmen abgeschlossen<br />
werden (wir berichteten darüber bereits<br />
in der letzten Umwelterklärung). Im Jahr 2006 haben<br />
die bei Baumaßnahmen angefallenen Abfälle ein<br />
deutlich niedrigeres Niveau erreicht. Erwähnenswert<br />
sind hier Erneuerungen innerhalb der Halle 4<br />
Süd, Hallenstraßensanierungen in der Halle 1 sowie<br />
die Beseitigung des Brandschadens auf dem Schrottplatz.<br />
Bei Baumaßnahmen werden i. d. R. Analysen<br />
des Bauschutts vorgenommen.<br />
Unbelasteter Bauschutt wird zur Verwertung in den<br />
Straßenbau abgegeben. Bauschutt, der die Bedingungen<br />
der Deponieklasse 2 nach den Vorschriften der<br />
Technischen Anleitung Siedungsabfall (TASi) erfüllt,<br />
wird zum Deponiebau eingesetzt. Nur solche Baustellenabfälle,<br />
welche die zuvor genannten Bedingungen<br />
nicht erfüllen, werden auf der <strong>Werk</strong>deponie eingelagert.<br />
Auch bei den produktionsspezifischen Abfällen<br />
konnten z. T. deutliche Rückgänge erreicht werden.<br />
So führte beispielsweise die Inbetriebnahme eines<br />
neuen Schachtofens in der Gießerei dazu, dass ca.<br />
2004 2005 2006<br />
1.300 Tonnen Salzschlacke weniger angefallen sind<br />
als im Jahr zuvor, weil in diesem Ofen ausschließlich<br />
Rücklaufmaterial aus der eigenen Produktion eingesetzt<br />
wird, bei dem keine Salzschlacke anfällt. Im<br />
Ergebnis konnte so Sonderabfall, der ansonsten in<br />
die Verwertung abgegeben werden muss, vermieden<br />
werden.<br />
Der angefallene Gewerbeabfall zur Beseitigung<br />
konnte u. a. deshalb gesenkt werden, weil durch<br />
technische Neuinvestitionen, wie beispielsweise die<br />
Installation von Trockenabscheidern anstelle von<br />
Nassfiltern bei den Strahlanlagen, die<br />
Anfallmenge an Strahlmittelschlamm um ca. 100 t<br />
reduziert wurde.<br />
Auch der Ofenausbruch aus der Gießerei und Härterei<br />
ist im Jahresvergleich um ca. 360 t geringer ausgefallen.<br />
Im Jahr 2005 war die Anfallmenge deshalb<br />
so hoch, weil einige alte Öfen abgerissen wurden.<br />
Der Rückgang des Sonderabfalls beruht auf einer<br />
nicht näher spezifizierbaren Vielzahl abfallsenkender<br />
Maßnahmen in den verschiedenen Betriebsbereichen.<br />
K9
Abfall (t)<br />
Verwertung<br />
Beseitigung<br />
Energiebedarf und Immissionsschutz<br />
Dem leichten Anstieg des Verbrauchs elektrischer<br />
Energie (ca. 3,4 %) steht eine Senkung des Wärmeenergiebedarfs<br />
(ca. - 2,4 %) gegenüber. Beide Entwicklungen<br />
befinden sich in der Bandbreite normaler<br />
Schwankung und können auf keine bestimmten<br />
Ursachen zurückgeführt werden.<br />
Beim Erdgaseinsatz hingegen, das für Fertigungsprozesse<br />
benötigt wird, ist im Jahr 2006 ein deutlicher<br />
Anstieg um knapp 14 % zu verzeichnen, der auch<br />
die Erhöhung des CO -Ausstoßes auf der Outputsei-<br />
2<br />
te erklärt. Dies kann direkt auf die Umsetzung des<br />
Formhärtens zurückgeführt werden, wo Karosserie-<br />
Rohbauteile in speziellen Öfen erhitzt werden, bevor<br />
sie ihre endgültige Form erhalten. Damit wird eine<br />
höhere Materialfestigkeit erreicht und die aktive<br />
Sicherheit der Fahrzeuginsassen verbessert. Gleichzeitig<br />
wird für das Fahrzeug eine Gewichtsreduktion<br />
realisiert, die zur Senkung der Kraftstoffverbrauchs<br />
beiträgt.<br />
Die Emissionen an Kohlenmonoxid, Stäuben, Stickoxiden<br />
und flüchtigen organischen Verbindungen<br />
(VOC) zeigen sich gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.<br />
Ein weiterer Umweltaspekt, der durch die Diskussion<br />
um die Veränderung des Weltklimas verstärkt in<br />
den politischen Fokus und das öffentliche Interesse<br />
K10<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
2004 2005 2006<br />
rückt, ist der Einsatz chemischer Kältemittel, die<br />
bei vielen verschiedenen Einsatzgebieten im <strong>Werk</strong><br />
benötigt werden. Diese erstrecken sich von der<br />
Maschinen-, <strong>Werk</strong>stück- und Prozesskühlung in<br />
den unterschiedlichen Fertigungsbereichen über<br />
die Gebäudeklimatisierung bis hin zur Lebensmittelkühlung<br />
in den Wirtschaftsbetrieben. Der Bedarf<br />
an Kältetechnik ist kontinuierlich gestiegen. Belegt<br />
wird die Aussage zum einen durch die Anzahl der<br />
Kälteanlagen, die sich in den letzten 6 Jahren bei uns<br />
von 3.052 auf 3.942 erhöht hat, zum anderen durch<br />
die Menge an Kältemitteln, die im gleichen Zeitraum<br />
von 5.496 auf 8.720 Kilogramm gestiegen ist.<br />
Unser <strong>Werk</strong> befasst sich seit langer Zeit bereits sehr<br />
intensiv damit, das Klimapotenzial, welches durch<br />
den Einsatz von Kälteanlagen entsteht, zu bewerten<br />
und so gering wie möglich zu halten. Es wird darauf<br />
geachtet, dass nach Möglichkeit nur solche Kältemittel<br />
in neuen Anlagen eingesetzt werden, die ein<br />
möglichst geringes Treibhauspotenzial besitzen.<br />
Parallel wird darauf Wert gelegt, dass in erster Linie<br />
solche Kältemittel eingesetzt werden, die einen<br />
geringen Stromverbrauch der Anlagen erfordern,<br />
ein zweiter sehr wichtiger Aspekt im Interesse des<br />
Klimaschutzes.
Energie (MWh)<br />
Das Treibhauspotenzial (GWP-Wert) drückt aus, wie<br />
stark ein bestimmter Stoff im Falle seiner Freisetzung<br />
im Vergleich zu Kohlendioxid (CO ) zur Erd-<br />
2<br />
erwärmung beitragen kann. Die meisten Kältemittel<br />
besitzen ein relativ hohes Treibhauspotenzial. So<br />
hatten beispielsweise die in den 80er-Jahren noch<br />
sehr weitverbreiteten Fluorchlorkohlenwasserstoffe<br />
(FCKW), die auch zur Zerstörung der Ozonschicht<br />
beitragen, einen bis zu 8.500-mal so starken Treibhauseffekt<br />
wie CO . Das bedeutet, dass bei der Frei-<br />
2<br />
setzung von einem Kilogramm dieser Stoffe etwa der<br />
gleiche Effekt für die Erderwärmung resultiert wie<br />
bei der Verbrennung von knapp 3.000 Litern Heizöl.<br />
Durch Substitutionen dieser besonders kritischen<br />
FCKW-Kältemittel durch umweltfreundlichere Varianten<br />
wie H-FCKW und später die Gruppe der<br />
Abluft (t)<br />
Elektrische Energie<br />
Brennstoffeinsatz (Gas)<br />
Wärmeenergie<br />
Staub<br />
Kohlenmonoxid (x 10)<br />
Stickoxide (x 10)<br />
VOC (x 10)<br />
Kohlendioxid (x 1.000)<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
2004 2005 2006<br />
Tabelle<br />
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) oder klimaneutrale<br />
Alternativen wie Ammoniak oder Isobutan bei verschiedenen<br />
Anlagentypen konnte bereits erreicht<br />
werden, dass der durchschnittliche GWP-Wert<br />
bezogen auf alle bei uns im <strong>Werk</strong> eingesetzten Kältemittel<br />
bei etwa 1.900 pro eingesetztem Kilogramm<br />
Kältemittel liegt.<br />
Um sicherzustellen, dass möglichst wenig Kältemittel<br />
während des gesamten Anlagenbetriebs als<br />
Leckage freigesetzt wird, werden regelmäßige Dichtheitsprüfungen<br />
an den Kälteanlagen durch geschulte<br />
Fachbetriebe durchgeführt. Diese stellen auch die<br />
fachgerechte Absaugung des Kältemittels<br />
bei einer Anlagenverschrottung sicher. Durch den<br />
Einsatz der Software VDKF-LEC bei allen bei uns<br />
2004 2005 2006<br />
K11
tätigen Kälte- und Klima-Fachbetrieben sind wir ab<br />
sofort in der Lage, die durchschnittliche Leckagerate<br />
einer Kälteanlage bzw. den spezifischen Kältemittelverlust<br />
zu bestimmen. Es ist unser Ziel, eine qualitative<br />
Aussage zur Dichtheit der Anlagen in allen<br />
Einsatzgebieten zu gewinnen, um so die Klimaschutzdebatte<br />
in diesem Themenfeld mit sachlichen<br />
Argumenten zu unterstützen.<br />
Lärm<br />
Auch das Thema Lärm ist für den Standort <strong>Kassel</strong><br />
aufgrund der nahe liegenden Wohngebiete ein bedeutender<br />
Umweltaspekt.<br />
Bei Neuplanungen und relevanten Änderungen<br />
bestehender Anlagen und Gebäude werden generell<br />
schalltechnische Prognosen erstellt, um auch künftig<br />
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu gewährleisten.<br />
Die im Jahr 2006 realisierte Süd-West-Einhausung<br />
der Schrottschere (Austragsbereich) als sekundäre<br />
Schallschutzmaßnahme ist ein aktuelles Beispiel<br />
für das kontinuierliche Bestreben, die vorhandenen<br />
Lärmemissionen zu begrenzen. Das angeführte Beispiel<br />
verdeutlicht zudem die Bemühungen um eine<br />
gute Nachbarschaft mit den Anwohnern im Gebiet<br />
Kirchbauna.<br />
Wasserwirtschaft<br />
Die Frischwasserfördermenge ist im Jahresvergleich<br />
K12<br />
2005/2006 um knapp 14 % gestiegen, liegt aber immer<br />
noch ca. 4 % unter dem Niveau des Jahres 2004.<br />
Vor allem der warme Sommer 2006 hatte einen<br />
Einfluss auf die gestiegene Frischwasserfördermenge.<br />
Steigt die Temperatur, muss zunehmend mehr<br />
Frischwasser zum Ausgleich von Verdunstungsverlusten<br />
im Kühlturm nachgespeist werden.<br />
Der erreichte hohe Stand in der Abwasserreinigungstechnik<br />
wurde auch im Jahr 2006 sichergestellt. Die<br />
Abwasserbelastung ist somit im Vergleich zu anderen<br />
Umweltaspekten eher von untergeordneter<br />
Bedeutung.<br />
Die CSB-Fracht – als wichtigster Abwasserwert des<br />
<strong>Werk</strong>es – befand sich fast unverändert auf Vorjahresniveau.<br />
Bei den Frachten Gesamt-Stickstoff und Gesamt-<br />
Phosphor zeigen sich zwar prozentual deutliche<br />
Veränderungen zum Vorjahr, diese sind jedoch aus<br />
Umweltschutzsicht in ihrer Wirkung absolut unkritisch.<br />
Die Fracht Gesamt-Stickstoff ist im zugrunde gelegten<br />
Jahresvergleich um knapp 19 % angestiegen.<br />
Dennoch wurden tatsächlich nur etwa 4 % der in der<br />
Einleitererlaubnis genehmigten Menge eingeleitet.<br />
Im Einzelnen ist festzustellen, dass die Fracht an<br />
Nitrit fast unverändert dem Vorjahreswert ent-
Wasser (m 3 )<br />
Frischwasser<br />
Regenwassernutzung<br />
Abwasser<br />
spricht, während die Fracht an Ammonium sogar<br />
reduziert werden konnte. Somit ist der Anteil an Nitrat<br />
der Hauptverursacher für die beschriebene Entwicklung.<br />
Die in den Belebungsbecken ablaufenden<br />
Prozesse Nitrifikation und Denitrifikation werden<br />
naturgemäß so eingestellt, dass sich der Schadstoffabbau<br />
in erster Linie auf die Eliminierung von für<br />
Wasserorganismen giftige Substanzen konzentriert.<br />
Dies wurde durch eine sehr gute Sauerstoffzufuhr<br />
(geringe Stillstandszeiten der Lüfter) in den Belebungsbecken<br />
der Kläranlage erreicht.<br />
Bei der Fracht Gesamt-Phosphor zeigt sich im<br />
Jahresvergleich 2005/2006 ein Anstieg um ca. 35 %.<br />
Obwohl einerseits der durchschnittlich eingeleitete<br />
Mittelwert dieser Fracht pro m³ Abwasser weniger<br />
als 20 % des gesetzlich zulässigen Grenzwertes<br />
Abwasserfrachten (kg)<br />
BSB 5 (x 100)<br />
ges. Phosphor (x 10)<br />
ges. Stickstoff (x 100)<br />
CSB (x 1.000)<br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
2004 2005 2006<br />
beträgt, war andererseits auch eine Überschreitung<br />
desselben an 7 Tagen des Jahres 2006 festzustellen.<br />
Der Anstieg der Fracht erklärt sich damit, dass im<br />
Bereich der Aggregateaufbereitung bestimmte<br />
Polyphosphate als Reiniger in Waschmaschinen<br />
eingesetzt werden, die sich nicht durch die in der<br />
Kläranlage eingesetzten Betriebschemikalien (Eisen-<br />
III-Chlorid) aus dem Abwasser herausfällen lassen.<br />
In früheren Jahren war die Abwassermenge aus diesem<br />
Bereich insgesamt deutlich größer, sodass eine<br />
Verdünnung der Polyphosphate im Abwasser stattfinden<br />
konnte und das Problem nicht auftrat. Durch<br />
die Änderung der Waschtechnik (Verlängerung der<br />
Standzeiten etc.) und den damit verbundenen Rückgang<br />
der Abwassermenge fallen die Abwässer heute<br />
wesentlich konzentrierter an.<br />
2004 2005 2006<br />
K13
Tabelle<br />
Gegenmaßnahmen wurden unverzüglich nach<br />
Bekanntwerden des Problems ergriffen. Es wurde<br />
eine Ersatzstoffprüfung veranlasst und nach entsprechenden<br />
Versuchen ist nun ein phosphatfreier<br />
Reiniger im Einsatz.<br />
Verkehr<br />
Der hinsichtlich der Umweltbelastung kritische<br />
Lkw-Verkehr transportiert für den Standort etwa die<br />
gleiche Masse an Gütern wie die Bahn. Eine Erhöhung<br />
des Bahnanteils, insbesondere im Bereich der<br />
Original-Teile-Versorgung, ist ein Umweltziel der<br />
VW Logistics GmbH & Co. OHG und wurde bei der<br />
Erweiterungsplanung des Original-Teile-Centers<br />
baulich durch einen Bahnanschluss berücksichtigt.<br />
Die Umweltbelastung durch den Berufsverkehr<br />
– verursacht zum Großteil von Mitarbeitern aus dem<br />
Umland (Pendler) – wird durch Bildung von Fahrgemeinschaften<br />
verringert.<br />
Dienstleister<br />
Am Standort arbeiten zahlreiche externe Firmen,<br />
u. a. mit eigenen Lagern und <strong>Werk</strong>stätten auf dem<br />
Fremdfirmenplatz.<br />
Sie führen Tätigkeiten von teilweise erheblicher<br />
Umweltrelevanz aus. Daher muss auch dieser<br />
Umweltaspekt als sehr wichtig eingestuft werden.<br />
Die Firmen werden über ausführliche Leistungsbeschreibungen<br />
mit den relevanten Rechtsgrundlagen<br />
vertraut gemacht. Die Leistungsbeschreibungen<br />
K14<br />
sind dabei fester Bestandteil der vertraglichen<br />
Vereinbarungen und werden ergänzt durch Informationsbroschüren,<br />
die zu umweltgerechtem und<br />
sicherem Verhalten anleiten. Durch Kontrollen wird<br />
die Einhaltung der Umweltschutzanforderungen<br />
überwacht. Dies geschieht beispielsweise durch<br />
Fremdfirmenaudits, die mindestens einmal jährlich<br />
stattfinden und von der <strong>Werk</strong>technik unter Einbeziehung<br />
weiterer fachkompetenter Stellen organisiert<br />
werden.<br />
Die Umweltanforderungen an externe Lieferanten<br />
bzgl. Produkten und Produktionsverfahren beschreibt<br />
der standortübergreifende Teil<br />
(siehe Seite 10).<br />
Gefahrenpotenzial<br />
Im Jahr 2006 wurde das zuvor erarbeitete Konzept<br />
für die Umsetzung von zentralen Arbeitsanweisungen<br />
weiter konkretisiert. So wurden im Themengebiet<br />
Gewässerschutz die Überwachungsaufgaben<br />
des Labors ebenso im Detail neu geregelt wie die<br />
Betriebsvorschriften der einzelnen Prozessstufen in<br />
der zentralen Kläranlage.<br />
Den korrekten Umgang mit Gefahrgütern stellt ein<br />
Gefahrgutbeauftragter sicher. Der Gefahrgutbeauftragte<br />
veranlasst Schulungsmaßnahmen und führt<br />
regelmäßig – unterstützt durch eine Vielzahl beauftragter<br />
Personen für Gefahrgut in den relevanten<br />
Betriebsbereichen – Kontrollen durch.
Entwicklung der umweltrelevanten Input-Output-Daten<br />
Einsatzstoffe [t]<br />
2005 2006<br />
Eisen/Stahl 422.574 433.176<br />
Leichtmetall 90.747 108.695<br />
Buntmetall 14.985 13.768<br />
Zusammenbauten 11.409 12.690<br />
Umweltrelevante Hilfs- u.<br />
Betriebsstoffe<br />
39.456 38.531<br />
Glas, Keramik, Naturstoffe 2.847 3.607<br />
Verpackungsmaterial 714 834<br />
Kraftstoffe (m 3 ) 1.644 1.636<br />
Technische Gase [Nm³]<br />
Stickstoff 4.826.540 4.998.751<br />
Sauerstoff 7.487.968 6.226.806<br />
Acetylen 12.690 6.377<br />
Kohlendioxid 45.392 42.548<br />
Argon 682.493 711.404<br />
Ammoniak 394.571 428.805<br />
Energie [MWh]<br />
Elektrische Energie 515.751 1 537.873 1<br />
Brennstoffeinsatz (Gas) 153.697 2 174.994<br />
Wärmeenergie 398.891 3 394.675 3<br />
Wasser [m³]<br />
Frischwasser [m³] 925.117 4 1.067.052 5<br />
Genutztes Regenwasser [m³] 23.130 0<br />
Input – Einsatz von Stoffen und Energie<br />
Die Tabelle zeigt die Entwicklung des In- und Outputs<br />
umweltrelevanter Parameter im Vergleich der Jahre 2005<br />
und 2006.<br />
Fertigungseinheiten [St.]<br />
2005 2006<br />
Motoren 6 54.000 47.000<br />
Zylinderkurbelgehäuse 688.000 748.000<br />
Abgasanlagen 4.530.000 4.091.000<br />
Getriebe 2.545.000 2.622.000<br />
Press-/Karosseriebauteile 79.243.000 82.544.000<br />
Aggregateteile 45.009.000 44.133.000<br />
Abfälle [t]<br />
Verwertung (gesamt) 31.348 28.238<br />
Hausmüll und hausmüllähnlicher<br />
Gewerbeabfall<br />
7.222 7.185<br />
Sonderabfall 19.387 18.555<br />
Nicht produktionsspezifi scher<br />
Abfall<br />
4.739 2.499<br />
Beseitigung (gesamt) 18.231 8.552<br />
Hausmüll und hausmüllähnlicher<br />
Gewerbeabfall<br />
2.172 1.604<br />
Sonderabfall 6.121 5.833<br />
nicht produktionsspezifi scher<br />
Abfall<br />
9.938 7 1.116 8<br />
Metallischer Abfall 200.265 202.591<br />
Abwasser [m³] 702.615 9 697.476 9<br />
Abwasserfrachten (kg) 10<br />
CSB 95.806 11 95.835 11<br />
BSB 5 1.527 1.417<br />
ges. Phosphor 160 216<br />
ges. Stickstoff 869 1.033<br />
Abluft (t)<br />
Kohlendioxid 12 31.033 35.328<br />
Kohlenmonoxid 231 227<br />
Stickoxide 217 218<br />
VOC 170 170<br />
Staub 56 57<br />
Output – Entstehung von Produkten<br />
K15
Kommentare:<br />
1 Hierin sind die Verbrauchswerte der Dependancen enthalten. Im Bereich Katalysator-Recycling lag der Stromverbrauch<br />
im Jahr 2005 bei 72 MWh und im Jahr 2006 bei 71 MWh. Im Bereich Aggregateaufbereitung lag der<br />
Stromverbrauch im Jahr 2005 bei 1.004 MWh und im Jahr 2006 bei 5.516 MWh.<br />
2 In der Umwelterklärung 2006 wurde ein falscher Wert für den Gasverbrauch des Jahres 2005 dargestellt (170.049<br />
MWh). Dieser Wert wurde hier korrigiert.<br />
3 Hierin sind die Verbrauchswerte der Dependancen enthalten. Im Bereich Katalysator-Recycling lag der Wärmebedarf<br />
im Jahr 2005 bei 168 MWh und im Jahr 2006 bei 205 MWh. Im Bereich Aggregateaufbereitung lag der Bedarf<br />
an Wärme im Jahr 2005 bei 2.570 MWh und im Jahr 2006 bei 7.903 MWh.<br />
4 Hierin sind 96.635 m³ vollentsalztes Wasser enthalten. Der ebenfalls enthaltene Wasserverbrauch der Dependancen<br />
beträgt für den Bereich Katalysator-Recycling 67 m³ und für den Bereich<br />
Aggregateaufbereitung 8.300 m³.<br />
5 Hierin sind 20.619 m³ vollentsalztes Wasser enthalten. Der ebenfalls enthaltene Wasserverbrauch der Dependancen<br />
beträgt für den Bereich Katalysator-Recycling 82 m³ und für den Bereich Aggregateaufbereitung<br />
22.500 m³.<br />
6 Hierbei handelt es sich ausschließlich um aufbereitete Motoren.<br />
7 Von den separat ausgewiesenen nicht produktionsspezifischen Abfallmengen zur Beseitigung wurden ca. 490 t<br />
als Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und 9.448 t als Sonderabfall entsorgt.<br />
8 Von den separat ausgewiesenen nicht produktionsspezifischen Abfallmengen zur Beseitigung wurden ca. 557 t<br />
als Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und ca. 559 t als Sonderabfall entsorgt.<br />
9 Hierin sind die Verbrauchswerte der Dependancen enthalten. Im Bereich Katalysator-Recycling lag die Abwassermenge<br />
im Jahr 2005 bei 67 m³ und im Jahr 2006 bei 82 m³. Im Bereich Aggregateaufbereitung, die im März<br />
2005 in Betrieb gegangen ist, lag die Abwassermenge im Jahr 2005 rechnerisch bei 8.300 m³ (28 m³) und im Jahr<br />
2006 bei 22.500 m³ (3.294 m³), d. h. jeweils in Höhe der Frischwasserbezugsmenge. Alkalische und saure Abwässer<br />
(Werte in Klammern) aus diesem Bereich, die als Teilmenge im Abwasserstrom enthalten sind, werden<br />
separat erfasst und mittels Saugwagen in das <strong>Werk</strong> transportiert und in der zentralen Kläranlage aufbereitet.<br />
Das restliche Abwasser wird als Indirekteinleiter über die städtische Kanalisation einer Kläranlage der <strong>Kassel</strong>er<br />
Entwässerungsbetriebe (KEB) zugeleitet.<br />
10 Andere Abwasserparameter (Kupfer, Blei, Quecksilber, Kohlenwasserstoffe etc.) werden ebenfalls gemessen,<br />
befinden sich aber im Bereich oder unterhalb der Nachweisgrenze.<br />
11 Die Abwasserfrachten, die als Indirekteinleiter durch die Aggregateaufbereitung an die KEB abgegeben werden,<br />
sind nicht dargestellt. Der gemessene Mittelwert CSB liegt bei 123,44 mg/l. Der Einleitungsgrenzwert<br />
hingegen liegt bei 600 mg/l.<br />
12 Aus Verbrennungsprozessen im Schmelzwerk, der Lackiererei, der Härterei und der Schmiede.<br />
K16
Ziel-<br />
Nr.<br />
Ziele Maßnahme Kategorie Termin Abarbeitungsstand<br />
1 Reduzierung des Gasverbrauchs bei technischen<br />
Prozessen<br />
2 Effi zienzsteigerung von Bodensanierungsmaßnahmen<br />
durch Einführung einer ganzheitlichen<br />
Methodik<br />
3 Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der<br />
<strong>Werk</strong>fl äche als Industriestandort<br />
Einführung einer Kennzahlensystematik (Benchmark) für<br />
Schweißprozesse<br />
Erarbeitung einer Bewertungsmatrix/eines Benchmarkings<br />
für Schadensfallsanierungen<br />
Erarbeitung eines Bodensanierungskonzepts zum Abbau<br />
der CKW-Belastung im Süden der Halle 4<br />
Umsetzung des Bodensanierungskonzeptes durch Aufbau<br />
von Boden-Luft-Absauganlagen<br />
Neubau bzw. Rekonstruktion von 3 Grundwasserförderbrunnen<br />
zur Altlastensanierung<br />
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewertung der Anstrom-<br />
und Abstromverhältnisse Altlast Deponie<br />
Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Fortsetzung<br />
der Grundwasserförderung<br />
Erarbeitung eines Controllinginstruments für Wasserverbräuche<br />
1, 3 2008 1<br />
2 <strong>2007</strong><br />
2 <strong>2007</strong><br />
2 2008<br />
2 2008<br />
2 2009<br />
2 <strong>2007</strong><br />
1 2009<br />
Neubau eines zusätzlichen Trinkwasserförderbrunnens 2 2009<br />
4 Sanierung der Regenwasserkanalisation Erarbeitung und Durchführung des Sanierungskonzepts 2 <strong>2007</strong><br />
5 Reduzierung der Strahlmittelemissionen um 90 %<br />
durch Modernisierung der technischen Ausrüstung<br />
6 Reduzierung der Treibhausgasemissionen beim<br />
Schutzgaseinsatz der Gießerei um mindestens 80%<br />
7 Einleitung von Maßnahmen zur Umsetzung der<br />
konzernweiten Kältemittelstrategie<br />
8 Qualitative Verbesserung der Abwasserbehandlung<br />
im Bereich der Emulsionen<br />
9 Erstellung u. Abarbeitung eines Zeit- und Maßnahmenplans<br />
im Bereich VAwS auf der Grundlage der<br />
Sachverständigenprüfung<br />
10 Zuordnung von Abfallkosten/Mengen auf Abfallverursacher<br />
(Organisationseinheiten)<br />
11 Ausweitung der organisatorischen und technischen<br />
Aktivitäten in der Abfallwirtschaft<br />
12 Erhöhung der stoffl ichen Verwertungsquote um 10<br />
% bezogen auf die Gewerbeabfallzahlen 2005<br />
13 Erhöhung des Anteils aufbereiteter Bauteile bei<br />
allen aufbereitbaren Aggregaten (Motoren,<br />
Getriebe)<br />
Installation verbesserter Abluftreinigungstechnologie an<br />
den Strahlanlagen der Gießerei<br />
Umsetzung des Schutzgasreduktionskonzepts unter<br />
Einbeziehung technischer Alternativen<br />
Einführung von Prozessstandards für die Beschaffung<br />
und die Überwachung von Kälteanlagen<br />
Erarbeitung eines Ausstiegskonzepts für das Kältemittel<br />
R 22<br />
Erhöhung des Anteils umweltfreundlicher Kältemittel<br />
(GWP
Ziel-<br />
Nr.<br />
Ziel Maßnahme Kategorie Termin Abarbeitungsstand<br />
14 Primärenergieeinsparung je Produktionseinheit<br />
(Strom/Erdgas/Technische Wärme/Raumwärme)<br />
Aktualisiertes Umweltprogramm <strong>2007</strong><br />
Beseitigung der Druckluftleckagen in Halle 2 9 2008<br />
Austausch von 2.880 Bürofenstern 9 2009<br />
Durchführung von getriebebezogenen Lieferantenworkshops<br />
(PKO-Prozess)<br />
Erarbeitung eines Konzepts zur Verringerung von Treibhausgasemissionen<br />
Entwicklung eines standortspezifi schen neuen Logistikkonzeptes<br />
Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes bei<br />
Maschinenbeschaffungen durch verstärkte Betriebskostenbetrachtung<br />
9 <strong>2007</strong> 5<br />
9 <strong>2007</strong><br />
9 2009<br />
9 2009<br />
Kommentare:<br />
1 Die Maßnahme wurde aufgrund von Prioritätsverlagerungen auf das Jahr 2008 verschoben.<br />
2 Die Maßnahme wird aufgrund technischer Schwierigkeiten voraussichtlich erst im Verlauf des ersten Quartals<br />
2008 abgeschlossen.<br />
3 Im Jahr <strong>2007</strong> musste zunächst die Homepage Umweltschutz aktualisiert werden, eine technische Voraussetzung<br />
zur Zielerreichung.<br />
4 Die geplante Maßnahme wurde auf das Jahr 2008 verschoben. Zunächst wurde im Bereich Abwasser vorbereitend<br />
eine FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalyse) durchgeführt.<br />
5 Im Oktober <strong>2007</strong> wurde eine sogenannte Getriebe-Produkt-Klausur unter Einbindung von Lieferanten durchgeführt.<br />
neues Ziel<br />
Umweltziel ist erledigt<br />
an der Umsetzung des Umweltziels wird gearbeitet<br />
rote Zahl = Der ursprünglich geplante Termin wurde auf den angegebenen Termin nach hinten verschoben<br />
K18
Die nächste konsolidierte Umwelterklärung wird spätestens im November 2010 zur Validierung vorgelegt werden.<br />
<strong>Werk</strong> <strong>Kassel</strong><br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Rupert Zeh, Umweltschutzbeauftragter<br />
Brieffach 4400<br />
34219 Baunatal<br />
Telefon: 0561 - 490 24 80<br />
E-Mail: rupert.zeh@volkswagen.de<br />
Dieser Standort verfügt über ein Umweltmanagement-System.<br />
Die Öffentlichkeit wird im Einklang mit dem Gemeinschaftssystem<br />
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung über<br />
den betrieblichen Umweltschutz dieses Standortes unterrichtet.<br />
K19
Abkürzungen und Erklärungen<br />
AOX Adsorbierbare organische Halogenver-<br />
bindungen<br />
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
BSB Summenparameter, beschreibt die Men-<br />
5<br />
ge der unter definierten Bedingungen<br />
biologisch abbaubaren Stoffe<br />
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft<br />
(Schweiz)<br />
CKW Chlorierte Kohlenwasserstoffe<br />
CO Kohlendioxid<br />
2<br />
CO Kohlenmonoxid<br />
CSB Summenparameter, beschreibt die<br />
Menge der unter definierten Bedingungen<br />
chemisch abbaubaren Stoffe<br />
EMAS Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement<br />
und die Umweltbetriebs -<br />
prüfung (eco-management and auditscheme)<br />
FeCl Eisen(III)chlorid<br />
3<br />
FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoffe<br />
GbV Gefahrgutbeauftragtenverordnung<br />
KD Kundendienst<br />
KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />
KSS Kühlschmierstoffe<br />
LAU/HBV- Anlagen, in denen mit wassergefähr-<br />
Anlagen denden Stoffen umgegangen wird<br />
MWh Megawattstunden<br />
NOx Stickoxide<br />
OE Organisationseinheit<br />
SEBU System zur Ermittlung und Bewertung<br />
von Umweltaspekten<br />
SO2 Schwefeldioxid<br />
UF Ultrafiltration<br />
UIS Umweltinformationssystem<br />
UMS Umweltmanagement-System<br />
VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang<br />
mit wassergefährdenden Stoffen<br />
VOC Volatile organic compounds (flüchtige<br />
organische Stoffe)<br />
VBH/KTL Vorbehandlung und Kathodische<br />
Tauchlackierung; im Lackierprozess<br />
Tauchverfahren, in denen erste Korrosionsschutzschichten<br />
aufgetragen<br />
werden.<br />
23
Weitere Informationen<br />
Informationen zum Umweltschutz bei <strong>Volkswagen</strong><br />
finden Sie in weiteren Broschüren und im Internet.<br />
Der Nachhaltigkeitsbericht von <strong>Volkswagen</strong><br />
<strong>2007</strong>/2008<br />
Am 11. September <strong>2007</strong> hat die <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
unter dem Titel „Wir bewegen uns verantwortungsvoll<br />
in die Zukunft“ ihren zweiten konzernweiten<br />
Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Der Bericht umfasst<br />
alle Konzernbereiche mit den beiden Markengruppen<br />
<strong>Volkswagen</strong> und Audi, den Geschäftsbereichen<br />
Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen<br />
sowie allen Gesellschaften, an denen der Konzern<br />
mit über 50 Prozent beteiligt ist.<br />
Schwerpunkte des Konzern-Nachhaltigkeitsberichts<br />
bilden die Strategien und Maßnahmen des Konzerns<br />
zur Weiterentwicklung im Bereich Antriebe und<br />
Kraftstoffe, zur Beschäftigungssicherung sowie zur<br />
Kundenorientierung.<br />
Bestelladresse: <strong>Volkswagen</strong> Distributionsservice,<br />
Postfach 1450, 33762 Versmold<br />
www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de<br />
Informationsportal zum Umweltschutz mit Berichten,<br />
Interviews und Nachrichten. Ständig aktualisiert<br />
bietet diese Site aktuelle News, Informationen<br />
zum Umweltschutz an den internationalen Standorten<br />
von <strong>Volkswagen</strong>, Tipps zum ökologischen<br />
Fahren, Hintergrundwissen zu Themen wie Öko-Audit<br />
und nachhaltige Entwicklung, umweltbezogene<br />
Informationen zu einzelnen <strong>Volkswagen</strong>modellen<br />
und vieles mehr.<br />
24<br />
Ansprechpartner<br />
Umwelt Strategie<br />
Dr. Christiane von Finckenstein-Wang<br />
Telefon: 05361-9-72804<br />
E-Mail: christiane.von.finckenstein@volkswagen.de<br />
Öko-Audit und Umweltschutz<br />
Wissenswertes zum Thema Umweltschutz und Öko-<br />
Audit erfahren Sie beim Umweltbundesamt in Berlin.<br />
Unter anderem hält es unter der Rubrik „Umwelt<br />
im Netz“ eine umfangreiche Linkliste bereit.<br />
Umweltbundesamt<br />
Postfach 1406, 06813 Dessau<br />
Telefon: 0 340-21 03-0<br />
Internet: www.umweltbundesamt.de
Impressum<br />
Herausgeber dieser Umwelterklärung<br />
ist die <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong>. Verantwortlich<br />
für den Inhalt des standortübergreifenden<br />
Teils ist der Konzernbereich<br />
Umwelt- und Arbeitsschutz<br />
(Wolfsburg). Verantwortlich für die<br />
enthaltenen standortspezifischen Teile<br />
sind die Umweltschutzbeauftragten<br />
der jeweiligen <strong>Werk</strong>e.<br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Günter Damme<br />
Brieffach 1896<br />
38436 Wolfsburg<br />
guenter.damme@volkswagen.de<br />
Layout Konzeption / Gestaltung<br />
FOUR MOMENTS GbR - Marken. Design. Kommunikation.<br />
25
©<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Stand: Februar 2008