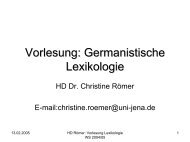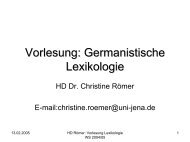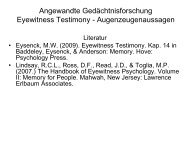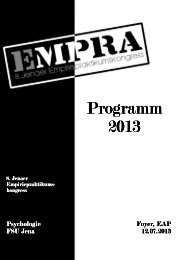Handlungsansatz zur Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur
Handlungsansatz zur Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur
Handlungsansatz zur Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wenn man <strong>Unternehmenskultur</strong> ihrem pragmatischen Sinn nach als Erzeugerin<br />
von Unternehmenskohäsion (Corporate Cohesion) versteht, also nicht als das, was<br />
alle eint, sondern als das, was Verbindung schafft, dann lässt sich das Konzept<br />
auch im interkulturellen Umfeld nutzbar machen (Rathje 2004).<br />
Diesem Ansatz liegt dann jedoch ein Verständnis von (Unternehmens-)Kultur<br />
zugrunde, das als Voraussetzung von Zusammenhalt nicht unbedingt Kohärenz<br />
fordert, sondern von grundsätzlichen Differenzen innerhalb von Kulturen ausgeht.<br />
In den Kulturwissenschaften lassen sich bereits vielfältige Ansätze hierzu finden,<br />
wie beispielweise das differenzorientierte Kulturkonzept von Hansen (Hansen<br />
2000). Auf dem Gebiet der betriebswirtschaftlichen Organisationsforschung konnte<br />
sich dieses Verständnis jedoch noch nicht durchsetzen. Eine systematische Übertragung<br />
differenzorientierter Kulturkonzepte auf den Bereich des interkulturellen<br />
Managements <strong>zur</strong> Entwicklung erfolgreicher <strong>interkultureller</strong> <strong>Unternehmenskultur</strong><br />
erscheint daher sinnvoll.<br />
Thesen <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>interkultureller</strong> <strong>Unternehmenskultur</strong><br />
am Beispiel deutscher Unternehmen in Thailand<br />
Die folgenden Ergebnisse <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>interkultureller</strong> <strong>Unternehmenskultur</strong><br />
entstanden im Rahmen eines Forschungsprojektes, das die <strong>Unternehmenskultur</strong><br />
von 13 deutschen Unternehmen in Thailand untersuchte (Rathje 2004, S. 21 ff.).<br />
Das Beispiel Deutschland – Thailand bietet dabei aufgrund des Aufeinandertreffens<br />
deutscher und thailändischer Wirtschaftskultur für eine interkulturelle Untersuchung<br />
einen sehr ergiebigen Kontrast. Unterschiede im Stil der Zusammenarbeit<br />
treten für beide Gruppen offen zu Tage, und zwar in ganz grundlegenden Bereichen<br />
der Zusammenarbeit, wie beispielsweise bei den zentralen Begriffen „Leistung“,<br />
„Verantwortung“, „Effizienz“, „Kollegialität“ oder „Konflikt“.<br />
So werden Konflikte von deutschen Managern häufig als „reinigendes Gewitter“<br />
beschrieben, also als wirksames Mittel zum Lösen von Problemen. Das Problem<br />
besteht bereits, während der Konflikt zu seiner Lösung führt. Konflikte werden<br />
von den deutschen Mitarbeitern somit eher als konstruktiv angesehen.<br />
Von den thailändischen Mitarbeitern werden Konflikte hingegen eher als „böser<br />
Geist“ beschrieben, also als eigentliches Übel, das die harmonische Zusammenarbeit<br />
bedroht. Nicht ein vom Konflikt unabhängiges Problem ist „das Problem“,<br />
sondern der Konflikt selbst: Er wird als bedrohlich empfunden und wirkt zerstörend.<br />
Diese Unterschiede sind den Beteiligten jedoch oft nicht bekannt. Im Einzelfall<br />
kann dies bedeuten, dass ein deutscher Manager von sich denkt: