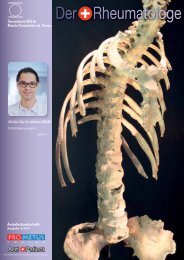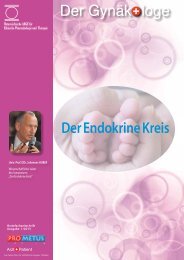Ihr Prim. Dr. Georg Pinter & Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf ... - Arzt + Kind
Ihr Prim. Dr. Georg Pinter & Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf ... - Arzt + Kind
Ihr Prim. Dr. Georg Pinter & Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf ... - Arzt + Kind
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
L I T E R A T U R<br />
Schmerzdiagnostik und -therapie<br />
bei älteren und kognitiv<br />
beeinträchtigten Patienten<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER<br />
Editorial<br />
Seite 3-5<br />
Seite 6-11<br />
foto@beigestellt<br />
foto@beigestellt<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
Editorial<br />
Seite 3-5<br />
Ärztefachzeitschrift<br />
Ausgabe 1/2012<br />
<strong>Arzt</strong>+Patient P.b.b. VNr 07Z037567 Verlagspostamt: 8330 Feldbach<br />
<strong>Arzt</strong> + Patient<br />
Geriatrie<br />
Palliativmedizin<br />
Von Anbeginn an:<br />
Im Notfall – Palliative Care<br />
Sterbehilfe in Österreich:<br />
Ein Kurzüberblick<br />
Das Experteninterview:<br />
mit <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wilfried Ilias<br />
Seite 32-34<br />
Seite 36-38<br />
Seite 12-13
L I T E R A T U R<br />
Inhalt<br />
Konzeption dieser Ausgabe:<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
2<br />
Editorial: <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR 3-5<br />
DFP-Literaturstudium<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR 6-11<br />
Das Experteninterview Oxycodon in der Schmerztherapie<br />
mit <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wilfried ILIAS<br />
12-13<br />
Osteoporosetherapie bei polymorbiden geriatrischen Patienten<br />
<strong>Dr</strong>. Heike MUCHAR 14-17<br />
Sturzassessment<br />
Ass. <strong>Dr</strong>. Stella DASKALAKIS 18-19<br />
Ernährungsassessment in der Geriatrie<br />
OÄ <strong>Dr</strong>. Barbara HOFFMANN 20-21<br />
Evidence-based medicine in der Akutgeriatrie<br />
Mag. <strong>Dr</strong>. Karl CERNIC, MAS 22-23<br />
Spitals-Report Haus der Geriatrie – Klinikum Klagenfurt am Wörthersee 24-25<br />
Palliativkonzept im Bundesland Kärnten 26-27<br />
Palliative Geriatrie<br />
OA <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.Thomas FRüHWALD 28-30<br />
Von Anbeginn an: Im Notfall – Palliative Care<br />
OA <strong>Dr</strong>. Christian WUTTI<br />
32-34<br />
Sterbehilfe in Österreich: Ein Kurzüberblick<br />
<strong>Dr</strong>. iur. Nora WALLNER-FRIEDL 36-38<br />
Ausgewählte psychologische Aspekte der Betreuung Sterbender<br />
Mag. Thomas WIENERROITHER 40-43<br />
Forschung in Palliative Care und die Rolle der Pflege<br />
Ass.-<strong>Prof</strong>. Doz. <strong>Dr</strong>. DGKS Sabine PLESCHBERGER, MPH 44-45<br />
Wissenschaftlicher Beirat des Verlags:<br />
Impressum:<br />
Verlag: Prometus Verlag<br />
Mühldorf 389, 8330 Feldbach<br />
Tel.: +43(0)3152/39582 - Fax: +43(0)1/9623359582<br />
Verlagsleitung und Herausgeber:<br />
Karin Deflorian<br />
k.deflorian@prometus.at, +43(0)664/3309197<br />
Projekt-Leitung:<br />
Clemens Lindinger<br />
c.lindinger@prometus.at, +43(0)664/5160393<br />
Laura Deflorian<br />
l.deflorian@prometus.at, +43/(0)664/5487959<br />
Claudia Weilharter<br />
c.weilharter@prometus.at, +43(0)664/5487971<br />
Redaktion:<br />
Chefredakteur: Emanuel Munkhambwa<br />
redaktion@prometus.at, +43(0)664/9191016<br />
Mag. (FH) Stefanie Senfter: st.senfter@prometus.at,<br />
<strong>Dr</strong>. Michaela Endemann, <strong>Dr</strong>. Gabriele Reinstadler, <strong>Dr</strong>. Stephan Blazek,<br />
<strong>Dr</strong>. Peter W. Ferlic, <strong>Dr</strong>. Stefan Kurath, Bernadette Fink-Schratter<br />
Büro Wien:<br />
Fröhlichgasse 10, 1230 Wien<br />
Martina Kainrath, office@prometus.at, +43(0)664/5487959<br />
Grafik+Layout: grafik@prometus.at, macgrafik@prometus.at<br />
<strong>Dr</strong>uck: <strong>Dr</strong>uckhaus Thalerhof, Graz<br />
ABO-Verwaltung: Büro Feldbach<br />
Einzelpreis: € 16,00, Jahresabo: € 80,00 inkl. Ust + Porto<br />
Bankverbindung: Bank Austria, Blz.: 12000, Kto.Nr.: 51692606901<br />
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz:<br />
Medieninhaber: Karin Deflorian, Prometus Verlag<br />
Richtung der Zeitschrift:<br />
Periodisches, medizinisch-pharmazeutisches Journal für Ärzte.<br />
Das Medium <strong>Arzt</strong>+Patient ist für den persönlichen Nutzen des<br />
Lesers konzipiert. Es werden Informationen von Experten, von<br />
wissenschaftlichen Studien und Kongressen weitergegeben. Geschützte<br />
Warennamen werden nicht immer besonders kenntlich<br />
gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines solchen Hinweises<br />
nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen<br />
handelt. Soweit in diesem Journal eine Applikation oder<br />
Dosierung angegeben wird, kann vom Verlag keine Gewähr<br />
übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten die Beipackzettel<br />
der verwendeten Präparate zu prüfen und gegebenenfalls<br />
einen Spezialisten zu konsultieren oder anhand anderer<br />
Literaturstellen auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Alle namentlich<br />
gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung<br />
der Redaktion wieder. Alle Rechte liegen beim Verlag und ohne<br />
schriftliche Genehmigung dürfen weder Nachdruck noch Vervielfältigung<br />
(auch nicht auszugsweise) gemacht werden. Die<br />
mit RB gekennzeichneten Beiträge sind entgeltliche Einschaltungen<br />
im Sinne § 26 Mediengesetz.<br />
<strong>Dr</strong>uck- und Satzfehler vorbehalten.<br />
Die Fotos in dieser Ausgabe wurden von den Autoren zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Werner ABERER, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Heidemarie ABRAHAMIAN, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Johann AUER , <strong>Dr</strong>. Bettina BALTACIS, <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> BARISANI, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Günther BERNERT,<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Robert BIRNBACHER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Lutz-Henning BLOCK, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Raphael BONELLI, <strong>Dr</strong>. Helmut BRATH, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Paul BRATUSCH-MARRAIN, <strong>Prim</strong>.<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Thomas BRÜCKE, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Hans CONCIN, Ao.<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Josef DEUTINGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wolfgang DOMEJ, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dr</strong>. h.c. Heinz DREXEL, OA <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>.<br />
<strong>Dr</strong>. Christian EGARTER, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Waltraud EMMINGER, Ao <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wolfgang EMMINGER, Ao <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wolfgang EPPEL, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Peter FASCHING, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>.<br />
<strong>Dr</strong>. E. FELLINGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. D<strong>Dr</strong>. FISCHER, <strong>Dr</strong>. Claudia FRANCESCONI, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Mario FRANCESCONI ,OA. <strong>Dr</strong>. Elisabeth FRIGO, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Monika FRITZER-SZEKERES,<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Helmut GADNER, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> GAUL, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Werner GERSTL, OA <strong>Dr</strong>. Margot GLATZ, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Winfried GRANINGER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. D<strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> GRIMM, <strong>Prim</strong>.<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Werner GRÜNBERGER, Ass. <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Brigitte HACKENBERG, OA <strong>Dr</strong>. Doina-Dafna HANDGRIFF, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Beda HARTMANN, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.- Doz. <strong>Dr</strong>. Erwin HAUSER,<br />
Ao. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Gabriele HÄUSLER, OA <strong>Dr</strong>. Kurt HEIM, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Michael HERMANN, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Franz HINTERREITER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Gerhart HITZENBERGER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz.<br />
<strong>Dr</strong>. Johann HOFBAUER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Christian HUEMER, OA <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Leo KAGER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wilhelm KAULFERSCH, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Renate KOPPENSTEINER, <strong>Prim</strong>.<br />
<strong>Dr</strong>. Gerd KORISEK, <strong>Prim</strong>. a.o. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Sybille KOZEK-LANGENECKER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Michael KREBS, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Günter J. KREJS, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Gerhard KRONIK, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>.<br />
<strong>Dr</strong>. Ernst KUBISTA <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Rainer KUNSTFELD, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Michael KUNZE, OA <strong>Dr</strong>. Wolfgang LANGE, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Burkhard LEEB, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Monika LECHLEITNER, <strong>Prim</strong>.<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Kurt LENZ, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Andreas LISCHKA, OA <strong>Dr</strong>. Margot LÖBL, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Anton LUGER, OA <strong>Dr</strong>. Wolfgang MACHOLD, OA <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Harald MANGGE, OA <strong>Dr</strong>.<br />
<strong>Georg</strong> MANN, Mag. D<strong>Dr</strong>. Wolfgang MAURER, <strong>Dr</strong>. Milen MINKOV MD, PhD, OA <strong>Dr</strong>. Christian MUSCHITZ, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Ingomar MUTZ, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Stefan NEHRER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Mathias<br />
Burkert PIESKE, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Walter PIRKER, <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Wolfgang POHL, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Claus RIEDL, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Friedrich RIFFER, <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Olaf RITTINGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.<br />
Alexander ROKITANSKY, Ass. <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Gudrun RUMPOLD-SEITLINGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Hugo RÜDIGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Ulrike SALZER-MUHAR, VR <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Hellmut SAMONIGG, <strong>Univ</strong>.-<br />
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Jolanta SCHMIDT, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Klaus SCHMITT (Präsident ÖGKJ), OA <strong>Dr</strong>. Johannes SCHUH, <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Christian SEBESTA, OA <strong>Dr</strong>. Nadja SHNAWA-AMANN, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Christian<br />
SINGER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Ronald SMETANA, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wolfgang SPERL, <strong>Univ</strong>. <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> STINGL, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Josef SYKORA, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Thomas SZEKERES, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>.<br />
<strong>Dr</strong>. Zsolt SZEPFALUSI, OA <strong>Dr</strong>. Leonhard THUN-HOHENSTEIN, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Norbert VETTER, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Dieter VOLC, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Andreas WALTER, <strong>Dr</strong>. Gabriele WASILEWICZ-STEPHANI, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>.<br />
Gerhard WEIDINGER, OA. <strong>Dr</strong>. Andreas WEISS, <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Raimund WEITGASSER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Rene WENZL, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Ursula WIEDERMANN-SCHMIDT, Ao.<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Andrea<br />
WILLFORT-EHRINGER, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Reinhard WINDHAGER, MSc, Priv.-Doz. <strong>Dr</strong>. Robert WINKER, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Andreas WINKLER, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Raimund WINTER, <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Claudia<br />
WOJNAROWSKI, <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Christian WÖBER, OA Priv.-Doz. Mag. <strong>Dr</strong>. Stefan WÖHRL, <strong>Univ</strong>.-Doz. <strong>Dr</strong>. Angela ZACHARASIEWICZ, <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Bernd ZIRM, <strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Karl ZWIAUER
Editorial<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER<br />
Haus der Geriatrie<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
foto@beigestellt<br />
Geriatrie<br />
Die Veränderung der Alterspyramide unserer<br />
Bevölkerung ergibt einen enormen Zuwachs<br />
des älteren Bevölkerungsanteiles. Der Anteil<br />
der über 6o-Jährigen betrug 1989 noch 20%<br />
und wird bis zum Jahr 2030 auf 32% ansteigen.<br />
1989 kamen auf 1.000 Erwerbstätige 368<br />
über 60-Jährige, 2030 wird diese Zahl auf 560<br />
ältere Menschen steigen.<br />
Besonders stark zunehmen wird der Anteil<br />
der über 85-Jährigen. Gerade in dieser Patientengruppe<br />
besteht ein komplexes Nebeneinander<br />
von behandelbaren Erkrankungen,<br />
beginnenden oder schon bestehenden<br />
Behinderungen, aber auch ein natürlicher<br />
physiologischer Alterungsprozess, dessen<br />
Grenzen zum Pathologischen sich in einem<br />
dynamischen Prozess befinden. Die Erwartungswahrscheinlichkeit<br />
für Erkrankungen<br />
nimmt mit steigendem Alter zu. Damit wird<br />
auch die Zahl der Behandlungsbedürftigen,<br />
insbesondere Hochbetagter bei alternden<br />
Krankheiten, Alterskrankheiten und Krankheiten<br />
im Alter stark zunehmen.<br />
Der positive Effekt einer geriatrischen Intervention<br />
konnte von Rubenstein schon 1984<br />
gezeigt werden und wurde unlängst auch in<br />
einem Cochrane Review eindrucksvoll bestätigt.<br />
Der geriatrische Patient<br />
Der geriatrische Patient ist ein biologisch älterer<br />
Patient, der durch altersbedingte Funktionseinschränkungen<br />
bei Erkrankungen akut<br />
gefährdet ist, zur Multimorbidität neigt und<br />
bei dem ein ganz besonderer Handlungsbedarf<br />
in rehabilitativer, somatopsychischer und<br />
psychosozialer Hinsicht besteht.<br />
Die Erarbeitung des Wissens um Besonderheiten<br />
der Diagnostik und Therapie älterer<br />
Menschen, das Einbeziehen medizinischer,<br />
psychologischer und soziologischer Inhalte<br />
führt uns zu einer integrativen Sicht eines<br />
sehr komplexen Wissens, welches uns hilft,<br />
kranke ältere Menschen nach akuten Ereig-<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Sehr geehrte<br />
Leserinnen und Leser!<br />
nissen in einem Prozentsatz von bis zu 70%<br />
wieder in ihre häusliche Umgebung zu integrieren<br />
(Daten aus dem Österreichischen<br />
Benchmarksystem der Akutgeriatrien).<br />
Geriatrisches Assessment<br />
Mit diesem besitzt die Geriatrie ein sehr<br />
mächtiges Instrument, um einen umfassenden<br />
Plan für die weitere Behandlung und<br />
Betreuung der Patienten aufzustellen. Das<br />
geriatrische Assessment ist ein interdisziplinärer<br />
und multidimensionaler diagnostischer<br />
Prozess zur systematischen Erfassung der<br />
medizinischen, funktionellen und psychosozialen<br />
Probleme und Ressourcen bei betagten<br />
Patienten.<br />
Die sich aus einem solchen Ansatz ergebende<br />
funktionelle Hierarchisierung von<br />
Diagnosen und der darauf abgestimmte<br />
Therapieplan sind ein wesentliches Kernelement<br />
der gesamten geriatrischen Medizin,<br />
ja es ist eigentlich die einzige geriatrische<br />
Technologie.<br />
Ein sehr wichtiger Faktor im Umgang und der<br />
erfolgreichen Bewältigung von komplexen<br />
Problemen ist die gemeinsame, strukturierte<br />
Arbeit im Team. Seine Interdisziplinarität und<br />
kommunikative Kompetenz trägt wesentlich<br />
zur erfolgreichen Arbeit in der Geriatrie bei.<br />
In dieser Ausgabe von <strong>Arzt</strong>+Patient können<br />
Sie das Haus der Geriatrie am Klinikum Klagenfurt<br />
näher kennenlernen. Fr. <strong>Dr</strong>. Daskalakis<br />
hat einen sehr informativen Artikel zum wichtigen<br />
Thema des Sturzassessment verfasst,<br />
einem wesentlichen und äußerst relevanten<br />
Thema der modernen Geriatrie. Ebenso mit<br />
einem wichtigen Thema befasst sich der Artikel<br />
von Fr. OÄ <strong>Dr</strong>. Hoffmann. Sie geht auf die<br />
notwendigen diagnostischen Schritte in der<br />
Ernährungsdiagnostik beim älteren Patienten<br />
ein.<br />
Der Artikel von Fr. <strong>Dr</strong>. Muchar zeigt die Komplexizität<br />
geriatrischen Denkens am Beispiel<br />
3
Reg. Nr. 2010-0623; Ref. Nr. DUR/pai/ADS/NOV2010/AUT001<br />
Inhalt<br />
EASY<br />
2<br />
USE<br />
Schmerzkontrolle, auf die Sie sich verlassen können (1)<br />
hilft bei neuropathischen Schmerzen (2)<br />
Tumorschmerztherapie mit Vertrauen auf den Erfolg (3)<br />
Linderung bei chronischen Rückenschmerzen (4)<br />
bessere Hautverträglichkeit (5)<br />
* IND-Regelung alle Stärken: chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind<br />
Flexibel dosierbar in den Stärken: 12 μg/h, 25 μg/h, 50 μg/h, 75 μg/h und 100 μg/h<br />
1. Milligan K et al. Evaluation of long term ef� cacy and safety of transdermal fentanyl in the treatment of chronic non-cancer pain. J Pain 2001; 2(4):197-204. 2. Dellemijn P. Prolonged Treatment<br />
with Transdermal Fentanyl in Neuropathic Pain. J Pain Symptom Manage 1998; 16: 220-229. 3. Ahmedzai S and Brooks D. Transdermal fentanyl versus sustained-release oral morphine in cancer<br />
pain: Preference, ef� cacy and quality of life. J Pain Symptom Manage 1997; 13: 254-261. 4. Simpson RK et al. Transdermal fentanyl as treatment for chronic low back pain. J Pain Symptom Manage<br />
1997; 14(4): 218-224. 5. Kress H.G. et al., Transdermal fentanyl matrix patches Matrifen and Durogesic DTrans are bioequivalent, Eur. J. n. Pharm. Biopharm, 75, (2010), 225-231; ORIGINALZITAT:<br />
3.6.4. Skin irritation The results for skin irritation indicate that the skin reactions for both transdermal patches were predominantly mild. The proportion of treatments with ‘no evidence of skin<br />
irritation’ (score = 0) increased between 73 h and 96 h after patch application (corresponding to 1 h and 24 h, respectively, after patch removal). Furthermore, the proportion of treatments with<br />
‘no skin irritation’ was greater for Durogesic DTrans than for Matrifen at all investigated time points (22% vs. 9% at 73 h, 37% vs. 17% at 84 h, and 73% vs. 50% at 96 h).<br />
Fachkurzinformation Seite 34
Editorial<br />
der Osteoporose beim multimorbiden Patienten<br />
auf, Hr. Mag. <strong>Dr</strong>. Cernic beleuchtet in<br />
seinem Beitrag das Spannungsfeld der evidence<br />
based medicine in der Geriatrie.<br />
Palliativmedizin<br />
„Der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man<br />
ihn, unerachtet aller Erfahrung, bei einem uns<br />
teurem Gegenstande nicht für möglich hält und<br />
er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes<br />
eintritt.<br />
Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die<br />
plötzlich zur Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang<br />
aus einer uns bekannten Existenz in eine<br />
andere, von der wir auch gar nichts wissen, ist<br />
etwas so Gewaltsames, dass es für die Zurückgebliebenen<br />
nicht ohne tiefste Erschütterung<br />
abgeht.” (Goethe, Feber 1830)<br />
Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung<br />
der Lebensqualität von Patienten und Familien,<br />
die mit Problemen konfrontiert sind,<br />
welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung<br />
einhergehen – und zwar durch Vorbeugen<br />
und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges<br />
Erkennen, die untadelige Einschätzung<br />
und Behandlung von Schmerzen, sowie von<br />
anderen belastenden Beschwerden körperlicher,<br />
psychosozialer und spiritueller Art (Definition<br />
von Palliative Care, WHO, 2002).<br />
Palliativmedizin und Geriatrie<br />
Wenn auch bis vor wenigen Jahren eine strukturierte<br />
palliative Therapie ausschließlich<br />
Tumorpatienten mit kurzer Lebenserwartung<br />
vorbehalten schien, so hat sich die Geria-<br />
trie schon seit ihrem Bestehen mit palliativen<br />
Konzepten beschäftigt, was angesichts der<br />
behandelten Patienten, von denen sich viele<br />
in der letzten Lebensphase befinden, nicht<br />
verwundert. Lebensqualität war und ist für<br />
den Geriater eine zentrale Herausforderung<br />
seines Tuns.<br />
Subjektiv erlebte Lebensqualität hat Vorrang<br />
vor der bloßen Lebensverlängerung. Die Aufgabe<br />
von Medizin und Pflege besteht eben<br />
nicht nur in der Heilung von Erkrankungen<br />
oder der Wiederherstellung von Gesundheit,<br />
sondern auch in der Linderung von Leiden.<br />
Ulrich Körtner sieht in der Gebrechlichkeit<br />
des älteren Menschen gleichermaßen eine<br />
individualethische, eine personalethische<br />
und eine sozialethische Herausforderung. Zur<br />
ethischen Aufgabe gehören seiner Meinung<br />
nach neben der menschlichen Zuwendung<br />
auch der seelische und auch der spirituelle<br />
Beistand, sowie wirksame Strategien gegen<br />
den sozialen Tod, gegen Vereinsamung und<br />
Depressivität.<br />
Das Verstehen der eigenen Welt und der<br />
Abläufe in der unmittelbaren Umgebung,<br />
aber auch der Kohärenzsinn, also das Gefühl<br />
des Eingebettetseins in das eigene Ich und<br />
in das soziale Umfeld sind wesentliche Elemente<br />
der Sinngebung des eigenen Lebens.<br />
Ein Kranker ist nach E. Cassel nicht einfach ein<br />
gesunder Mensch, der seine Erkrankung wie<br />
einen Rucksack am Buckel trägt.<br />
Es geht also auch darum, ob die Begrenztheit,<br />
Unvollkommenheit und Sterblichkeit<br />
des Menschen von uns anerkannt und wahrgenommen<br />
wird oder nicht. Dazu schreibt F.<br />
Vester: „Die Pyrrhussiege eines immer aufwendigeren<br />
Reparaturdienstes führen zu steigenden<br />
medizinischen Konflikten. (…) Der Schlüssel<br />
liegt nicht in seiner totalen Medikamentierung,<br />
sondern in einem neuen Verhältnis zu Gesundheit<br />
und Lebensweise aus kybernetischer Sicht.”<br />
Mit diesem Themenkreis beschäftigt sich in<br />
dieser Ausgabe Hr. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Frühwald,<br />
der einen tiefen Einblick in die Welt der palliativen<br />
Geriatrie gibt. Hr. Mag. Wienerroither<br />
beleuchtet das Thema der Betreuung Sterbender<br />
aus psychologischer, Fr. <strong>Dr</strong>. Wallner-<br />
Friedl aus rechtlicher Sicht. Ein besonders<br />
aktuelles Thema ist die Überschneidung der<br />
Notfallmedizin mit der Palliativmedizin und<br />
der Geriatrie. Dieses Thema zu bearbeiten, hat<br />
sich Hr. OA <strong>Dr</strong>. Wutti zur Aufgabe gemacht.<br />
Abgerundet und aufgewertet wird diese Ausgabe<br />
durch das so wichtige und wesentliche<br />
Thema der Pflegeforschung in der palliative<br />
care.<br />
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser<br />
Ausgabe von <strong>Arzt</strong>+Patient interessante<br />
Erkenntnisse und einen tieferen Einblick in<br />
unser Denken.<br />
<strong>Ihr</strong><br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> <strong>Pinter</strong> &<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> Likar<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
foto@beigestellt<br />
5
L I T E R A T U R<br />
L I T E R A T U R<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER<br />
Haus der Geriatrie<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel: +43(0)463/538-22667<br />
georg.pinter@kabeg.at<br />
DFP-Literatur<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel: +43(0)463/538-23703<br />
rudolf.likar@kabeg.at<br />
6<br />
foto@beigestellt<br />
foto@beigestellt<br />
Schmerzdiagnostik und -ther<br />
beeinträchtigten Patienten<br />
Einleitung<br />
Aufgrund komplexer physischer und psychischer<br />
Veränderungen im Alter stellen<br />
Schmerzmessung und Schmerztherapie für<br />
ältere und betagte Patienten eine besondere<br />
Herausforderung dar.<br />
Mit dem Alter nehmen chronisch-schmerzhafte<br />
Erkrankungen kontinuierlich zu. Je nach<br />
Untersuchung variieren die Angaben über<br />
das Vorkommen von Schmerzen bei Personen<br />
über 65 Jahren zwischen 50 und 86%.<br />
In einer Erhebung im Bundesland Kärnten<br />
gaben 53,4% der Männer und 63,6% der<br />
Frauen über 65 Jahren an, unter Schmerzen<br />
zu leiden, die Hälfte sogar unter starken bis<br />
sehr starken Schmerzen. 84,2% von ihnen tun<br />
dies bereits seit Jahren. In einer schwedischen<br />
bevölkerungsbezogenen Studie berichteten<br />
drei Viertel der über 75-jährigen Personen<br />
über chronische Schmerzen, ein <strong>Dr</strong>ittel davon<br />
über schwere und schwerste Dauerschmerzen.<br />
40 bis 80% der Bewohner von Pflegeheimen<br />
leiden unter anhaltenden, häufig nicht diagnostizierten<br />
Schmerzen. Auch in der extra-<br />
muralen Pflege ist der Anteil der Schmerzpatienten<br />
erheblich: Zwischen 40 und 50% der<br />
Patienten, die zu Hause mobile Pflegedienste<br />
in Anspruch nehmen, sind Schmerzpatienten.<br />
Schon aufgrund der demographischen Entwicklung<br />
gewinnt das Thema zunehmend<br />
an Bedeutung. Prognosen der WHO zufolge,<br />
wird die Zahl der Menschen über 60 Jahren<br />
von rund 600 Millionen im Jahr 2000 auf 1,2<br />
Milliarden bis ins Jahr 2025 ansteigen, 2050<br />
sollen bereits mehr als 2 Milliarden Menschen<br />
dieser Altersgruppe angehören. Die Gruppe<br />
der über 80-Jährigen ist die am schnellsten<br />
wachsende Bevölkerungsgruppe.<br />
Zu den wichtigsten Ursachen chronischer<br />
Schmerzen im Alter gehören degenerative<br />
Erkrankungen des Bewegungsapparates,<br />
Osteoporose, neuropathische Schmerzen wie<br />
Post-Zoster-Neuralgie oder Schmerzen, die<br />
mit Tumorleiden in Zusammenhang stehen.<br />
Weiters erwähnenswert sind Schmerzen aufgrund<br />
von Gefäßkrankheiten und Erkrankungen<br />
des rheumatischen Formenkreises, Phantomschmerzen<br />
und Insultfolgen.<br />
Abb. 1:
apie bei älteren und kognitiv<br />
Tabelle 1: BESD-Skala: Die Beobachtungskriterien im Überblick<br />
Atmung - normal<br />
- gelegentlich angestrengt atmen<br />
- kurze Phasen von Hyperventilation<br />
- lautstark angestrengt atmen<br />
- lange Phasen von Hyperventilation<br />
- Cheyne Stoke Atmung<br />
Negative Lautäußerungen - keine<br />
- gelegentliches Stöhnen und Ächzen<br />
- sich leise negativ oder missbilligend äußern<br />
- wiederholt beunruhigt rufen<br />
- lautes Stöhnen und Ächzen<br />
- weinen<br />
Gesichtsausdruck - lächelnd oder nichts sagend<br />
- trauriger Gesichtsausdruck<br />
- ängstlicher Gesichtsausdruck<br />
- sorgenvoller Blick<br />
- grimassieren<br />
Körpersprache - entspannt<br />
- angespannte Körperhaltung<br />
- nervös hin und her gehen<br />
- Nesteln<br />
- Körpersprache starr<br />
- geballte Fäuste<br />
- angezogene Knie<br />
- sich entziehen oder wegstoßen schlagen<br />
Trost - trösten nicht notwendig<br />
- Ist ablenken oder beruhigen durch Stimme oder Berührung möglich?<br />
- Ist trösten, ablenken oder beruhigen nicht möglich?<br />
Schmerzassessment<br />
Typische geriatrische Syndrome wie Immobilität,<br />
Inkontinenz, Inappetenz, Instabilität,<br />
Iatrogenität und intellektueller Abbau stehen<br />
sehr oft in Zusammenhang mit dem Thema<br />
Schmerz. Schmerzen im Alter führen zur einer<br />
Einschränkung der Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens.<br />
Der chronische Schmerz ist ein multifaktorielles<br />
Geschehen, das ein umfassendes und<br />
interdisziplinäres Therapiekonzept erfordert.<br />
Mit jedem unzureichend behandelten<br />
Schmerzdurchbruch nehmen Schmerzintensität<br />
und -folgen wie Depression, Schlafprobleme,<br />
eingeschränkte soziale Kontakte und<br />
damit verbundene Vereinsamung weiter zu<br />
(Abb. 1).<br />
Wenn Patienten kognitiv nicht beeinträchtigt<br />
sind, sollen die subjektiven Schmerzskalen<br />
von der Verbal Rating Skala (VRS) bis zur<br />
Numerischen Rating Skala (NRS) angewandt<br />
werden. Diese Skalen sind aber für demente<br />
Patienten nicht geeignet.<br />
Bei dieser Patientengruppe wird der Schmerz<br />
oft erst spät erkannt. Es liegt hier in der Erfahrung<br />
der klinisch tätigen Personen, den<br />
Schmerz richtig zu erkennen und zu behandeln.<br />
Die häufig mangelnde Schmerzerfassung bei<br />
dieser Patientengruppe hat mehrere Ursachen:<br />
Zum einen fehlen in Pflegeinrichtungen<br />
und Krankenanstalten oft die strukturellen<br />
und personellen Voraussetzungen für<br />
eine konsequente Schmerzerfassung. Dazu<br />
kommt die Schwierigkeit, bestehende und<br />
bewährte Instrumente der Schmerzmessung<br />
auf diese Gruppe anzuwenden: vor allem Verluste<br />
der kongnitiven Funktionen beeinträchtigen<br />
auch die Validität herkömmlicher diagnostischer<br />
Verfahren.<br />
Ein weiteres Problem bei dementen Patienten<br />
ist die Erfassung von Nebenwirkungen, da<br />
eine verbale Kommunikation oft nicht möglich<br />
ist. Aus diesem Grund müssen Demenzpatienten<br />
sorgfältig beobachtet werden.<br />
Ziel muss es sein, in Pflege- und Behandlungsinstitutionen<br />
ebenso wie in häuslichen Pflege-<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
settings bei allen Patienten den Schmerz als<br />
fünften Vitalparameter regelmäßig zu erheben.<br />
Denn schon durch ein standardisiertes<br />
Vorgehen bei der Schmerzerfassung ist eine<br />
deutliche Schmerzreduktion erzielbar. Die<br />
ausreichende Etablierung systematischer<br />
und regelmäßiger Schmerzmessung ist eine<br />
wesentliche Voraussetzung für die bessere<br />
schmerztherapeutische Versorgung älterer<br />
und betagter Patienten.<br />
Für verbal und kognitiv eingeschränkte Patienten<br />
sind inzwischen Scores und Skalen<br />
entwickelt worden, wie der ECPA (L' echelle<br />
comportementale pour pesonnes agés), der<br />
BESD (Beurteilung von Schmerz bei Demenz),<br />
die deutsche Fassung der PAINAD-Scale (Pain<br />
Assesement in Advanced Dementia), sowie<br />
die Doloplus-2-Skala.<br />
Die BESD-Skala etwa beruht auf einem relativ<br />
kurzen, relativ einfach durchzuführenden Test<br />
und ist vor allem für mobilere Patienten gut<br />
geeignet, sowohl chronische als auch akute<br />
Schmerzen lassen sich damit gut erfassen<br />
(Tabelle 1).<br />
Die Doloplus-2-Skala erfasst psychomotorische<br />
und psychosoziale Auswirkungen<br />
von Schmerzen in einer 30-punktigen Skala<br />
(Tabelle 2). Eine Evaluierung der deutschsprachigen<br />
Version in Kärnten kam zum Ergebnis,<br />
dass die Skala sich als tauglich zur Schmerzerfassung<br />
erweist, die Beurteilungen von<br />
Ärzten und Pflegepersonen stimmen weitgehend<br />
überein. Eine gute Einschulung auf<br />
den Test ist die Voraussetzung für die erfolgreiche<br />
Anwendung bei kognitiv beeinträchtigten<br />
Patienten. Der Score ist auch in der<br />
Verlaufsmessung reliabel, die Skala zeigt eine<br />
gute Sensitivität. Bei zunehmender Erfahrung<br />
nimmt das Ausfüllen der Skala immer weniger<br />
Zeit in Anspruch. Wenn die Möglichkeit<br />
besteht, sollte vor Ort eine Referenzperson<br />
ernannt werden.<br />
Die Erfahrungen sprechen für eine gute und<br />
einfache klinische Anwendbarkeit der Doloplus-2-Skala.<br />
Die Skala sollte von Angehörigen<br />
verschiedener Disziplinen ausgefüllt<br />
werden, und zwar unabhängig davon, ob der<br />
Patient zuhause gepflegt wird oder in einem<br />
stationären Setting.<br />
7
L I T E R A T U R<br />
Schmerztherapie im Alter<br />
DFP-Literatur<br />
Tabelle 2: Skala Doloplus-2: Beurteilungskriterien im Überblick<br />
Verbaler Schmerzausdruck - keine Äußerung<br />
- Äußerungen nur bei Patientenkontakt<br />
- gelegentliche Äußerungen<br />
- dauernde spontane Schmerzäußerungen<br />
Schonhaltung in Ruhe - keine Schonhaltung<br />
- vermeidet gelegentlich gewisse Haltungen<br />
- ständige, wirksame Schonhaltung<br />
- ständige, ungenügend wirksame Schonhaltung<br />
Bei der schmerztherapeutischen Behandlung<br />
älterer Menschen gibt es eine Reihe von<br />
Möglichkeiten, welche je nach Ursache des<br />
Schmerzes eingesetzt werden können. Diese<br />
reichen von einer medikamentösen Behandlung<br />
über physio- und ergotherapeutische<br />
Methoden und psychologischen Interventionen<br />
bis zu den invasiven Methoden und Blockaden.<br />
Zusätzlich werden neurostimulatorische<br />
Verfahren und komplementäre Ansätze<br />
eingesetzt.<br />
Besonders beim betagten Menschen sind<br />
psychosoziale Maßnahmen und das Miteinbeziehen<br />
des Umfeldes von großer Wichtigkeit.<br />
Bei der medikamentösen Therapie wird diese<br />
besonders individuell auf den Patienten<br />
abgestimmt. Angewendet wird das WHO-<br />
8<br />
Schutz von schmerzhaften<br />
Körperzonen<br />
- kein Schutz<br />
- bei Patientenkontakt ohne Hinderung von Pflege und Untersuchung<br />
- bei Patientenkontakt mit Hinderung jeglicher Handlung<br />
- Schutz auch in Ruhe, ohne direkten Kontakt<br />
Mimik - übliche Mimik<br />
- schmerzausdrückende Mimik bei Patientenkontakt<br />
- schmerzausdrückende Mimik ohne Patientenkontakt<br />
- dauernde ungewohnte, ausdruckslose Mimik<br />
Schlaf - gewohnter Schlaf<br />
- Einschlafschwierigkeiten<br />
- häufiges Erwachen (motorische Unruhe)<br />
- Schlaflosigkeit mit Auswirkungen auf den Wachzustand<br />
Waschen/Ankleiden - unveränderte gewohnte Fähigkeiten<br />
- wenig eingeschränkt<br />
- stark eingeschränkt<br />
- unmöglich, Patient wehrt sich bei jedem Versuch<br />
Bewegung/Mobilität - unverändert gewohnte Fähigkeiten<br />
- aktiv wenig vermindert<br />
- aktiv und passiv eingeschränkt<br />
- Bewegungen unmöglich, Mobilisationsversuch wird abgewehrt<br />
Kommunikation - unverändert<br />
- intensiviert<br />
- vermindert, Rückzug<br />
- Fehlen oder Abweisung jeglicher Kommunikation<br />
Soziale Aktivitäten - Teilnahme an gewohnten Aktivitäten<br />
- gewohnte Aktivitäten nur auf Anregung oder <strong>Dr</strong>ängen<br />
- teilweise Ablehnung gewohnter Aktivitäten<br />
- Ablehnung jeglicher sozialer Aktivitäten<br />
Verhaltensstörungen - gewohntes Verhalten<br />
- wiederholte Verhaltensstörungen bei Patientenkontakt<br />
- dauernde Verhaltensstörung bei Patientenkontakt<br />
- dauernde Verhaltensstörung ohne äußeren Anlass<br />
Stufenschema, wobei häufig eine Kombinationstherapie<br />
notwendig ist und einzelne Stufen<br />
auch übersprungen werden können.<br />
Besonders berücksichtigt werden muss die<br />
Multimorbidität des Patienten, seine oft eingeschränkten<br />
kognitiven Fähigkeiten, sowie<br />
psychosoziale Einschränkungen, die sehr oft<br />
Adherenceprobleme nach sich ziehen.<br />
Es empfiehlt sich darüber hinaus, vor der Verordnung<br />
von Medikamenten bei älteren Menschen,<br />
im Rahmen der Anamnese ein kurzes<br />
Medikamentenassessment durchzuführen und<br />
folgende Fragen an den Patienten zu stellen:<br />
1. Haben sie schon einmal vergessen, Medikamente<br />
einzunehmen?<br />
2. Ist ihnen gelegentlich egal, ob sie ihre Medikamente<br />
einnehmen?<br />
3. Haben sie schon selbständig Medikamentenpausen<br />
durchgeführt?<br />
4. Welche Medikamente nehmen sie derzeit<br />
ein?<br />
Bei Anwendung von Medikamenten ist die<br />
veränderte Pharmakokinetik und -dynamik<br />
zu beachten. Besonders bei multimorbiden<br />
Patienten kommt es sehr häufig zu Medikamenteninteraktionen,<br />
sodass eine Hierarchisierung<br />
der Therapienotwendigkeiten durchzuführen<br />
ist. Diese wird im geriatrischen<br />
Alltag durch ein multidimensionales geriatrisches<br />
Assessment erreicht, wobei durch<br />
eine funktionelle Diagnostik eine bessere Einschätzung<br />
der entsprechenden Therapieoptionen<br />
möglich ist.<br />
Aber auch in der Praxis können durch einfache<br />
Screeningverfahren (GDS – geriatric<br />
depression score, MMSE – mini mental examination,<br />
timed up and go test, ...) therapierelevante<br />
Zusatzinformationen gewonnen werden.<br />
Eine geriatrische Fachexpertise ist beim<br />
multimorbiden, gebrechlichen Patienten<br />
(frail elderly) unumgänglich.<br />
Gerade bei chronischen Schmerzpatienten<br />
ist eine Polypragmasie häufig anzutreffen.<br />
Eine sehr wesentliche Komorbidität stellt die<br />
Depression dar, die in bis zu 50% der betroffenen<br />
Patienten vorhanden ist und einer<br />
besonderen Beachtung und auch einer entsprechenden<br />
fachärztlichen Intervention<br />
bedarf!<br />
Beim Einsatz von NSAR (nichtsteroidalen<br />
Antirheumatika) sollte immer auf das deutlich<br />
erhöhte gastrointestinale Blutungsrisiko älterer<br />
Patienten geachtet werden. Besonders zu<br />
achten ist auf Patienten mit Herzinsuffizienz.<br />
Bei diesen können NSAR zu einer Verschlechterung<br />
der Symptomatik durch Wasserretention,<br />
Verschlechterung der Nierenfunktion<br />
und auch Verschlechterung des cardio-renal<br />
anaemia syndroms beitragen.<br />
Als Alternativpräparate in der ersten Stufe<br />
können Paracetamol und Metamizol verwendet<br />
werden. Beachten sollte man bei der intravenösen<br />
Darreichungsform von Paracetamol,<br />
dass für eine ausreichende analgetische<br />
Wirkung die Infusionsdauer unter 15 Minuten<br />
betragen sollte. Es können 4g täglich i.v. verabreicht<br />
werden, der Infusionsabstand sollte<br />
mindestens 4 Stunden betragen.<br />
Bei der intravenösen Verwendung von Metamizol<br />
ist zu beachten, dass eine zu rasche<br />
Gabe zu bedrohlichen Blutdruckabfällen führen<br />
kann, auch hier empfiehlt sich eine Kurzinfusion<br />
von 15-30 Minuten, die Tageshöchstdosis<br />
sollte 5g nicht überschreiten.
Morphine in der Geriatrie<br />
Beim Einsatz von Morphinen wiederum, ist<br />
die größere Opioidsensitivität zu beachten.<br />
Opioide mit kurzer Halbwertszeit sind primär<br />
vorzuziehen, können aber nach einer Stabilisierungsphase<br />
durchaus auf Depotpräparate,<br />
wie z.B. Pflaster umgestellt werden.<br />
Eine Kombination verschiedener Opioide ist<br />
nicht sinnvoll, ein Opioidwechsel bei starken<br />
Nebenwirkungen oder ungenügender<br />
Wirkung jedoch schon. Dabei sollte jedoch<br />
mit einer niedrigeren Dosis des nächsteingesetzten<br />
Opioids begonnen werden, wie überhaupt<br />
die Initialdosis beim älteren Menschen<br />
um 30-50% reduziert werden sollte. Wichtig<br />
ist eine individuelle Dosistitration (start low,<br />
go slow) und entsprechende Vorsicht bei<br />
gleichzeitiger Gabe von Sedativa, Antidepressiva<br />
und Neuroleptika.<br />
Die Kenntnis der Nierenfunktion ist nicht nur<br />
in der schmerztherapeutischen Versorgung<br />
älterer Menschen essentiell. Zu beachten ist<br />
dabei, dass der Kreatininwert alleine zumeist<br />
eine Unterschätzung der tatsächlichen Nierenfunktionseinschränkung<br />
nach sich zieht.<br />
In der täglichen Praxis hat sich die Abschätzung<br />
der Kreatininclearance mittels der Cockcroft-Gault-Formel<br />
bzw. die MDRD-Formel<br />
bei GFR unter 60ml/min (siehe beispielsweise<br />
unter: http://www.kidney.org/professionals/<br />
KDOQI/gfr_calculator.cfm) bewährt.<br />
Folgende Möglichkeiten bestehen bei<br />
der Opioidtherapie:<br />
Schwache Opioide:<br />
• <strong>Ihr</strong>e Indikationen sind Schmerzen mittlerer<br />
bis starker Intensität.<br />
• Schwache Opioide unterliegen nicht dem<br />
Suchtmittelgesetz.<br />
• Schwache Opioide sollen nicht bis zur letzten<br />
therapeutischen Möglichkeit ausgenutzt<br />
werden!<br />
• Um nicht in den Bereich von mehr Nebenwirkungen<br />
zu kommen, empfiehlt sich zeitgerecht<br />
der Umstieg auf ein starkes Opioid<br />
in niedriger Dosierung.<br />
Starke Opioide:<br />
Vorwiegend eingesetzt werden Morphin,<br />
Oxycodon, Hydromorphon, Buprenorphin<br />
und Fentanyl. Diese sind in verschiedenen<br />
Darreichungsformen erhältlich (i.v., sublingual,<br />
bukkal, peroral, transdermal), sodass<br />
eine sehr individuelle Therapie ermöglicht<br />
wird.<br />
Die Berechnung der Dosierung beim Wechsel<br />
eines Opioids erfolgt auf der Basis<br />
von Äquivalenztabellen (Opioid-Dosimeter),<br />
wobei die Werte auf diesen Tabellen<br />
Annäherungswerte darstellen, die an die klinische<br />
Situation angepasst werden müssen.<br />
Die Antizipation der Nebenwirkungen (Übelkeit,<br />
Erbrechen, Obstipation) ist beim alten<br />
Patienten von sehr großer Wichtigkeit und<br />
eine entsprechende Begleitmedikation<br />
zumindest in den ersten Wochen einer Therapie<br />
unbedingt erforderlich.<br />
Bewährt haben sich in der Obstipationsprophylaxe<br />
Makrogole, bei der Behandlung von<br />
Übelkeit ist beim Einsatz von Metoclopramid<br />
auf ein allfällig vorliegendes Dopaminmangelsyndrom<br />
(Mb. Parkinson, Parkinsonsyndrom,<br />
...) zu achten, da diese Substanz<br />
dann kontraindiziert ist und auf ein Alternativpräparat<br />
wie beispielsweise Domperidon<br />
gewechselt werden muss.<br />
Bei der additiven Therapie ist bei kognitiv<br />
beeinträchtigten Menschen unbedingt auf<br />
das Nebenwirkungsprofil der eingesetzten<br />
Therapeutika zu achten, wobei insbesondere<br />
ein anticholinerges Syndrom (wie es beispielsweise<br />
trizyklische Antidepressiva auslösen<br />
können) rasch erkannt werden soll. Dieses<br />
präsentiert sich durch Mundtrockenheit,<br />
Verstopfung, Miktionsstörungen, Tachycardie<br />
und unter Umständen auch durch ein Delir.<br />
Bitte beachten:<br />
Pflegebedürftige, nicht-kommunikative<br />
alte und gebrechliche Menschen verdienen<br />
unsere besondere Aufmerksamkeit. Im Verdachtsfalle<br />
ist ein Therapieversuch mit einem<br />
potenten Analgetikum bei kognitiv beeinträchtigten<br />
Patienten in der Differentialtherapie<br />
immer zu erwägen, um nicht fälschlicherweise<br />
Schmerzen durch eine nicht-indizierte<br />
beruhigende Medikation zu behandeln!<br />
Ein wesentliches Element einer guten<br />
schmerztherapeutischen Versorgung ist<br />
natürlich eine gelungene Kommunikation<br />
mit dem älteren Menschen. Stellen Sie sicher,<br />
dass <strong>Ihr</strong> Patient die Verordnung begriffen hat,<br />
dass er mit der Therapie einverstanden ist,<br />
dass er die Arzneipackung öffnen und Tabletten<br />
entnehmen kann, dass er Tabletten<br />
schlucken kann, dass er sich merken kann,<br />
ob er die Tablette schon eingenommen hat<br />
und dass er versteht, was mit der Medikation<br />
bezweckt wird. Erst dann wird <strong>Ihr</strong>e Intervention<br />
dem Patienten auch helfen können.<br />
Schmerztherapie ist eine wichtige ärztliche<br />
Aufgabe in der täglichen Praxis und erfordert<br />
gerade beim älteren Patienten viel Feingefühl<br />
und einen guten Patientenkontakt. Sie kön-<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
nen mit einer gelungenen Schmerztherapie<br />
sehr viel zu einer guten Lebensqualität <strong>Ihr</strong>er<br />
Patienten beitragen.<br />
Umfangreiche Literaturliste bei den Verfassern<br />
Autoren:<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> <strong>Pinter</strong><br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> Likar<br />
Ärztliche Herausgeber für diesen Fachartikel:<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER,<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Reviewer:<br />
● <strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. Hannes Plank<br />
● OA <strong>Dr</strong>. Walter Müller<br />
● <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Günther Bernatzky<br />
DFP-Punkte online buchen!<br />
Für Informationen zu Medikamenten bitten wir<br />
Sie sich an die Redaktion des Verlages zu wenden.<br />
9
L I T E R A T U R<br />
DFP-Literatur<br />
Der Test zum DFP-Fachartikel kann auf der E-Learning Plattform<br />
der „österreichischen akademie der ärzte“ unter<br />
www.meindfp.at absolviert werden.<br />
Alle Infos zur E-Learning Plattform finden Sie auf<br />
www.meindfp.at bzw. unter der Hotline +43(0)1/512 63 83 33.<br />
10<br />
1. Bei kognitiv beeinträchtigten Menschen wird der<br />
Schmerz am besten erfasst durch: (2 Richtige)<br />
a) Standardisiertes Vorgehen<br />
b) NRS<br />
c) VRS<br />
d) Doloplus-2-Skala<br />
2. Die Doloplus-2-Skala (1 Richtige)<br />
a) sollte nur bei hospitalisierten Patienten angewendet werden.<br />
b) sollte nur von Pflegepersonen ausgefüllt werden.<br />
c) erfasst psychomotorische und psychosoziale Auswirkungen<br />
von Schmerzen.<br />
3. Die Schmerztherapie beim älteren Menschen (3 Richtige)<br />
a) benötigt einen multimodalen Ansatz.<br />
b) muss das soziale Umfeld miteinbeziehen.<br />
c) muss die Multimorbidität berücksichtigen.<br />
d) muss sich strikt an das WHO-Stufenschema halten.<br />
2 DFP-Fachpunkte werden bei positiver (mind. 66%) Absolvierung<br />
angerechnet. <strong>Ihr</strong>e DFP-Punkte werden automatisch<br />
auf das persönliche Fortbildungskonto gebucht.<br />
<strong>Ihr</strong>e Teilnahmebestätigung finden Sie auf www.meindfp.at<br />
unter dem Menüpunkt „Meine Statistik“.<br />
Schmerzdiagnostik und -therapie bei älteren und kognitiv beeinträchtigten Patienten<br />
4. Welche der folgenden Substanzen sollten bei Herzinsuffizienz<br />
nicht eingesetzt werden? (1 Richtige)<br />
a) Paracetamol<br />
b) NSAR<br />
c) Metamizol<br />
d) Opioide<br />
5. Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (1 Richtige)<br />
a) Schwach wirksame Opioide werden bei Schmerzen mittlerer<br />
bis starker Intensität eingesetzt.<br />
b) Schwache Opioide unterliegen nicht dem Suchtmittelgesetz.<br />
c) Schwache Opioide sollen bis zur letzten therapeutischen<br />
Möglichkeit ausgenutzt werden.<br />
6. Welches der folgenden Symptome gehört nicht zu<br />
einem anticholinergen Syndrom? (1 Richtige)<br />
a) Verstopfung<br />
b) Miktionsstörungen<br />
c) Hypersalivation<br />
d) Tachycardie<br />
Diesen DFP-Test aus „<strong>Arzt</strong>+Patient” bitte<br />
ausschließlich online absolvieren, Sie erhalten<br />
sofort <strong>Ihr</strong>e Teilnahme-Bestätigung.<br />
w w w . m e i n d f p . a t
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Salzburg 22.12.2011<br />
11
Das Experteninterview<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wilfried ILIAS<br />
Leiter der Abteilung für Anästhesiologie,<br />
Intensivmedizin und Schmerztherapie<br />
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder<br />
Johannes von Gott Platz 1; 1020 Wien<br />
Tel.: +43(0)1/21121-1510<br />
wilfried.ilias@bbwien.at<br />
Prometus Verlag: Welche Anforderungen<br />
sollte eine moderne Schmerztherapie erfüllen?<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Wilfried Ilias: Zunächst<br />
muss immer wieder hinterfragt werden, ob<br />
etwas gegen die Ursache des Schmerzes<br />
unternommen werden kann und ob sich, hinsichtlich<br />
der ursächlichen Behandlungsmöglichkeiten,<br />
seit der ersten Evaluierung des<br />
Patienten bzw. seit Beginn der Therapie etwas<br />
geändert hat. Es gibt laufend Innovationen<br />
und der behandelnde <strong>Arzt</strong> muss immer wieder<br />
überprüfen, ob das, was er sich ursprünglich<br />
als Diagnose zurechtgelegt hat, auch auf<br />
Dauer zutrifft.<br />
Ziel der Schmerztherapie ist es, dem Patienten<br />
volle Bewegungsfreiheit, geistig wie<br />
körperlich, zu gewährleisten. Das heißt,<br />
die Urteils-, Reaktions- und Erlebnisfähigkeit<br />
sowie die Lebensfreude eines Patienten<br />
sollten durch die Schmerztherapie nicht<br />
beeinträchtigt sein, dennoch müssen die<br />
Schmerzen adäquat unter Kontrolle gebracht<br />
werden – das ist eine Gratwanderung, die<br />
sehr schwierig ist.<br />
12<br />
foto@beigestellt<br />
Oxycodon in der<br />
modernen Schmerztherapie<br />
Prometus: Welchen Stellenwert haben Opioidanalgetika<br />
in der Therapie von mittelschweren<br />
und schweren Schmerzen, etwa bei<br />
Tumorpatienten?<br />
W. Ilias: Einen sehr hohen Stellenwert, denn<br />
Opioide sind die synthetische bzw. natürliche<br />
Ersatzmöglichkeit für endogene Opioidrezeptoren.<br />
Das heißt, Morphium und<br />
dessen Abkömmlinge, aber auch synthetische<br />
Opioide, besetzen bereits vorhandene<br />
Rezeptoren, die der Körper üblicherweise<br />
mit Endorphinen besetzt. Nun kommt es bei<br />
chronischen Schmerzzuständen nicht nur zur<br />
Erschöpfung von Endorphinen sondern auch<br />
von anderen schmerzregulierenden Transmittersubstanzen.<br />
Auf der einen Seite muss insbesondere bei<br />
Schmerzen, die mit einer entzündlichen<br />
Komponente vergesellschaftet sind – das<br />
trifft auch auf Tumorschmerzen zu – auf die<br />
entzündliche Komponente Rücksicht genommen<br />
werden. Dazu eignen sich Antirheumatika<br />
oder Cortison, wobei erstere mittlerweile<br />
zu unterscheiden sind in solche, die spezifisch<br />
oder unspezifisch die Cyclooxygenasen<br />
inhibieren. Auf der anderen Seite benötigen<br />
wir Opioide, um die genannte Endorphinerschöpfung<br />
zu kompensieren bzw. die vorhandenen<br />
Opioidrezeptoren voll zu besetzen.<br />
Und schließlich haben wir auch die Möglichkeit<br />
über herabregulierende Mechanismen,<br />
wie die Freisetzung von Serotonin, Noradrenalin<br />
oder Gamma-Aminobuttersäure, einzugreifen:<br />
Substanzen wie Serotonin- oder<br />
Noradrenalinwiederaufnahmehemmer wirken<br />
gegen die Erschöpfung des jeweiligen<br />
Systems. Wir können mit Benzodiazepinen<br />
die GABAerge Komponente kompensieren.<br />
Weiters bestehen Blockademöglichkeiten<br />
verschiedener Kanalproteine welche für die<br />
Depolarisierung von Nervenzellen bzw. von<br />
synaptischen Endigungen verantwortlich<br />
sind. Hier können wir Kalziumkanalblocker<br />
wie Gabapentin oder Pregabalin, Natriumkanalblocker<br />
wie Carbamazepin oder Kainat-<br />
Rezeptorblocker wie Topamax® einsetzen.<br />
Die Tumorschmerztherapie erfordert also<br />
ein sehr komplexes Denken, da der Organismus<br />
Reservemechanismen eingerichtet hat.<br />
Der behandelnde <strong>Arzt</strong> muss immer überlegen,<br />
wie lange die Schmerzen schon bestehen<br />
und welche Chronifizierungsmechanismen<br />
vielleicht oder bereits sicher begonnen<br />
haben, um mit Zusatzmedikamenten, wie<br />
Antikonvulsiva oder Antidepressiva, zusätzlich<br />
die Opioid- und antiinflammatorische<br />
Therapie zu ergänzen.<br />
Prometus: Wie wirkt Oxycodon?<br />
W. Ilias: Oxycodon ist ein Opioid das einerseits<br />
den μ-Rezeptor, also auf den klassischen<br />
Morphinrezeptor, und andererseits auch auf<br />
den Kappa-Rezeptor wirkt. Der Kappa-Rezeptor<br />
ist natürlich auch ein μ-Rezeptor, er wird<br />
aber haupsächlich im Bereich des Rückenmarkes<br />
und auch im Zentralnervensystem<br />
exprimiert. Oxycodon besitzt daher eine zentrale<br />
und eine teilweise periphere Wirkkomponente.<br />
Mittels des Zusammenwirkens der<br />
Aktivierung bzw. Blockierung dieser Rezeptoren<br />
können Schmerzen etwas komplexer<br />
behandelt werden, im Vergleich zur Therapie<br />
mit reinen μ-Agonisten.<br />
Prometus: Für welche Schmerzzustände ist<br />
Oxycodon zu empfehlen?<br />
W. Ilias: Oxycodon zeichnet dadurch aus,<br />
dass es nicht nur für akute sondern auch<br />
für chronische Schmerzzustände geeignet<br />
ist – wobei die Schmerzen durchaus eine<br />
entzündliche Komponente aufweisen können.<br />
Oxycodon wirkt zwar nicht gegen die<br />
Entzündung per se, aber es kann, mit der<br />
peripheren Kappa-Rezeptorwirkung in den<br />
zentralen μ-Rezeptoren und der peripheren<br />
μ-Rezeptorwirkung, ein komplexer schmerzhemmender<br />
Mechanismus ausgenutzt werden.<br />
In den letzten 15 Jahren hat sich diesbezüglich<br />
eine Trendwende abgezeichnet, weil man<br />
begonnen hat, Opioide und die Rezeptoren<br />
besser zu verstehen. Nun ist auch genügend<br />
Evidenz dafür vorhanden, dass Opioide sehr<br />
sinnvoll und mit sehr hohem Wirkungsgrad<br />
bei neuropathischen Schmerzzuständen eingesetzt<br />
werden können – das wurde früher<br />
bestritten. Es wurde behauptet, neuropathische<br />
Schmerzzustände würden nur auf Anti-
konvulsiva und Antidepressiva ansprechen.<br />
In dieser Indikation liegt die „Number of patients<br />
to treat“ für Oxycodon bei 2,6 – ein sehr<br />
gutes Verhältnis, das eigentlich günstiger ist<br />
als jenes von Carbamazepin.<br />
Prometus: Welche Dosierungsempfehlungen<br />
sprechen Sie bei Erwachsenen und Jugendlichen<br />
bzw. älteren Patienten aus und was ist<br />
bei einer Umstellung vom Originalpräparat<br />
auf ein Oxycodon-Generikum zu beachten?<br />
W. Ilias: Im Bereich der Opioidrezeptoren<br />
liegt eine gewisse Varianz in der Empfindlichkeit<br />
der Rezeptoren gegen exogene Opioide<br />
vor, sodass man die Dosierung nicht einfach<br />
über den Daumen einschätzen kann. Bei<br />
opioidnaiven Patienten sollte keinesfalls mit<br />
einer höheren Dosis als 2x10mg begonnen<br />
werden, eine Dosissteigerung ist bei Bedarf<br />
jederzeit möglich.<br />
Insbesondere bei älteren Patienten die mit<br />
dem ersten auf dem Markt gekommenen<br />
Präparat behandelt wurden, das eine Zweischicht-Galenik<br />
hatte – d.h. ein <strong>Dr</strong>ittel der<br />
Substanz wurde aus der ersten Schicht in kurzer<br />
Zeit freigesetzt und zwei <strong>Dr</strong>ittel wurden<br />
über 12 Stunden freigesetzt – traten Probleme<br />
auf, da die sofort freigesetzte Dosis für<br />
manche Patienten zu viel war und prolongierte<br />
Zustände der Desorientierung induzierte.<br />
Die neueren Präparate haben keine<br />
Zweischicht-Galenik mehr, was aber nun<br />
den Nachteil mit sich bringt, dass sich die<br />
Anschlagzeit verlängert. Von Vorteil ist, dass<br />
es zu keiner überschießenden Blutspiegelbildung<br />
kommt und damit die, gerade für ältere<br />
Patienten, unangenehme Nebenwirkung der<br />
Desorientierung wegfällt.<br />
Die Galenik spielt also eine ganz wichtige<br />
Rolle in der Verfügbarkeit von Medikamenten.<br />
Die Wirkstoffe in Generika und Originalpräparaten<br />
sind quasi ident, zu bedenken<br />
ist aber, dass die Freisetzungsgeschwindigkeiten<br />
aus dem jeweiligen galenischen Substrat<br />
unterschiedlich sein können. Wir müssen<br />
zudem berücksichtigen, dass es bei der<br />
Herstellung der Präparate eventuell zu Wirkstoff-Konglomeraten<br />
kommt, die wesentliche<br />
Unterschiede in der Anflutungszeit verursachen<br />
können. Je mehr die Trennung in<br />
einzelne Moleküle in einer Trägersubstanz<br />
gelingt, desto gleichmäßiger wird bspw. die<br />
Freisetzung erfolgen.<br />
Es ist demnach schwer vorhersagbar wie ein<br />
Patient auf die Umstellung auf ein anderes<br />
Medikament reagieren wird. Hinzu kommt,<br />
und das darf nicht unterschätzt werden, dass<br />
der Patient an sein Medikament gewöhnt<br />
ist. Alleine die Tatsache, dass es eine andere<br />
Farbe, eine andere Form oder eine andere<br />
Packungsgröße hat, kann verunsichern.<br />
Zudem meint der Volksmund, dass etwas<br />
preislich Billigeres nicht gleich gut wirksam<br />
sein kann, wie etwas Teureres. Der folgliche<br />
Placebo- oder Nocebo-Effekt kann sich<br />
beträchtlich auf die Wirksamkeit eines Medikamentes<br />
– deren Intensität kann bis zu 30%<br />
nach oben bzw. unten abweichen – und<br />
damit auch auf das individuelle Wohlbefinden<br />
des Patienten auswirken.<br />
Mit einem aufklärenden Gespräch kann hier<br />
sehr viel erreicht werden. Der <strong>Arzt</strong> muss dem<br />
Patienten mitteilen, dass es mit der Neueinnahme<br />
bzw. Neuverordnung von Medikamenten<br />
zu einer Beeinträchtigung der<br />
Wirksamkeit bzw. auch zum Auftreten von<br />
Nebenwirkungen kommen kann. Umgekehrt<br />
ist der Patient seinerseits verpflichtet, sich<br />
regelmäßig mit dem primärverordnenden<br />
Schmerztherapeuten in Verbindung zu setzen.<br />
Das gilt insbesondere dann, wenn ein<br />
anderer <strong>Arzt</strong> ein anderes Medikament verschreibt,<br />
z.B. auf Grund der Herzkreislaufsituation,<br />
von Bluthochdruck oder Rhythmusstörung,<br />
um eruieren zu können, ob es sich mit<br />
dem jeweiligen Regime verträgt.<br />
Prometus: Welche Voraussetzungen gelten<br />
für die Langzeitanwendung von Opioiden?<br />
W. Ilias: Eine subtile Überwachung des Patienten<br />
ist unumgänglich. Sind Opioidrezepte,<br />
also spezielle Suchtgiftrezepte auszustellen,<br />
sollte man nicht auf Dauerrezepte übergehen,<br />
denn dadurch verliert der <strong>Arzt</strong> die Kontrolle<br />
über den Patienten. Der direkte Kontakt<br />
und das Gespräch ist wichtig, da der<br />
Behandler daraus ableiten kann, in welcher<br />
Situation sich der Patient befindet: ob sich am<br />
Schmerzzustand oder dem sozialem Umfeld,<br />
ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden<br />
und der Lebenssicherheit, etwas geändert<br />
hat. Mit diesen Informationen können<br />
bei Bedarf Änderungen des Therapieregimes<br />
vorgenommen werden.<br />
Unter den verschiedenen Mechanismen die<br />
es zu berücksichtigen gilt, erfordern die Langzeitnebenwirkungen<br />
besonderer Aufmerksamkeit.<br />
Unter einer Opioidtherapie kommt es<br />
immer zur Obstipation, es kann zu Harn- bzw.<br />
Blasenentleerungsstörungen und bisweilen<br />
zu Übelkeit kommen. Letztere verschwindet<br />
bei manchen Patienten nach einem gewissen<br />
Gewöhnungseffekt. Ein weiterer Mechanismus<br />
betrifft die Metabolisierung des Opioids:<br />
andere Medikamente können unter Umstän-<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
den in diesen Metabolismus eingeschaltet<br />
werden, sodass es in deren Abbau zu Engpässen<br />
kommen kann, die sich als Kumulationseffekte<br />
auswirken können.<br />
Prometus: Stellt die mögliche Toleranzentwicklung<br />
ein Problem dar?<br />
W. Ilias: Das ist eine sehr interessante Frage,<br />
da immer wieder behauptet wird, es gäbe<br />
eine Toleranzentwicklung gegen die analgetische<br />
Wirkung der Medikamente. Studien<br />
haben gezeigt, dass bei jenen Patienten,<br />
deren Schmerzpegel stabil bleibt, keine<br />
Dosissteigerung vorgenommen werden<br />
muss. Das deckt sich auch mit meiner eigenen<br />
Erfahrung mit Patienten die an chronischen<br />
Schmerzen aufgrund von muskuloskeletalen<br />
Problemen, sei es eine Degeneration oder<br />
ein Zustand nach einer Operation, leiden. Die<br />
Dosis blieb über Jahrzehnte stabil – egal ob<br />
enterale oder intrathekale Verabreichung –,<br />
es sein denn, es kam bspw. zu einem Schraubenbruch<br />
bei einer Verplattung die zu einer<br />
Steigerung des Schmerzes führte. Natürlich<br />
gibt es auch Patienten, die über die Jahre<br />
eine ständige Steigerung der Dosis benötigen,<br />
da die inkurable Schmerzursache, bspw.<br />
ein degenerativer Schaden am knöchernen<br />
Stützgerüst, zunimmt.<br />
Auch gibt es mittlerweile genügend Studien,<br />
die aufgezeigt haben, dass es zwar eine Toleranzentwicklung<br />
gegen den Effekt der Übelkeit<br />
gibt, allerdings keine gegenüber der<br />
Obstipation. D.h. die Obstipation tritt immer<br />
auf. Es gibt auch keine Toleranzentwicklung<br />
gegen die Nebenwirkung der Blasenentleerungsstörung.<br />
Prometus: Welche Vorteile hat eine alkoholunempfindliche<br />
Therapie?<br />
W. Ilias: Vor allem in unseren Regionen –<br />
und ich nehme mich da selbst nicht aus – in<br />
denen der Alkoholkonsum eine diätetische<br />
Gewohnheit ist, ist es von großer Bedeutung,<br />
dass man Medikamente so zubereitet,<br />
dass die Geschwindigkeit ihrer Freisetzung<br />
aus einer entsprechend präparierten Tablette<br />
nicht beeinträchtigt wird. Mittlerweile<br />
entsprechen die Medikamente, die derzeit in<br />
Österreich auf dem Markt sind, durchaus diesem<br />
Kriterium.<br />
Der Hintergrund: Studien zeigten, dass galenische<br />
bzw. retardierte Zubereitungen insbesondere<br />
durch konzentrierten Alkohol<br />
aufgelöst werden. Auch eine geringere Konzentration<br />
an Alkohol, die ja beim Wein zwischen<br />
9 und 15% schwankt, steigert die Löslichkeit<br />
verschiedener Substanzen. RB<br />
13
Osteoporose<br />
Osteoporosetherapie<br />
beim polymorbiden geriatrischen Patienten<br />
<strong>Dr</strong>. Heike MUcHAR<br />
Haus der Geriatrie<br />
Medizinisch geriatrische Abteilung mit<br />
Abteilung für chronisch Kranke<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43(0)463/538-22667<br />
heike.muchar@lkh-klu.at<br />
14<br />
foto@beigestellt<br />
Die Prävalenz einer Osteoporose auf<br />
Grundlage der WHO-Definition einer erniedrigten<br />
BMD, respektive einem T-Score < 2,5<br />
(der T-Score ist der in der Standardabweichung<br />
gemessene Unterschied der Knochendichte<br />
eines Patienten relativ zu einem<br />
20-jährigen Normalkollektiv), liegt bei postmenopausalen<br />
Frauen bei etwa 7% im Alter<br />
von 55 Jahren. Sie steigt auf 19% im Alter von<br />
80 Jahren an. Die Inzidenz von vertebralen<br />
und nichtvertebralen Frakturen nimmt mit<br />
dem Lebensalter exponentiell zu. Die nichtvertebralen<br />
Frakturen sind überwiegend<br />
sturzbedingt. Vertebrale Frakturen treten z.T.<br />
unter Alltagstätigkeiten auf.<br />
Die Gefahren der Osteoporose und ihrer Komplikationen<br />
werden trotz intensiver Aufklärung<br />
stark unterschätzt. In Österreich leiden<br />
etwa 750.000 Menschen an Osteoporose, es<br />
befinden sich etwa 200.000 Frauen über 50<br />
Jahren aus diesem Grund in ärztlicher Behandlung.<br />
Jährlich müssen etwa 15.000 Menschen<br />
wegen Oberschenkelhalsfrakturen stationär<br />
behandelt werden. Vorwiegend proximale<br />
Femurfrakturen führen vor allem im ersten<br />
Jahr zu einem erheblichen Verlust an Funktionsfähigkeit.<br />
Aber auch in den Folgejahren<br />
kommt es nicht zu einer vollständigen Erholung.<br />
In einer Umfrage bei norwegischen Patientinnen<br />
mit proximalen Femurfrakturen kam<br />
es nach der Fraktur zu einer Zunahme der stationären<br />
Aufnahmen in Pflegeheimen von 15%<br />
auf 30%. Betroffen waren vor allem Patienten<br />
im Alter von über 85 Jahren. Der Prozentsatz<br />
Abb. 1: Die beiden Bilder zeigen links einen gesunden Knochen mit normaler Mikroarchitektur und rechts<br />
einen osteoporotischen Knochen mit erheblich gestörter Mikroarchitektur und schon deutlich verschmälerten<br />
sowie in der Anzahl reduzierten Knochenbälkchen. Insbesondere der Verlust der immer dünner werdenden<br />
Querbälkchen verringert ganz enorm die Knochenfestigkeit und erhöht die Bruchgefahr, was diese<br />
klassische Definition anschaulich beschreibt<br />
der Patienten, die ohne Gehhilfe gehen konnten,<br />
verminderte sich von 76% auf 36%. 43%<br />
der Patienten waren nach der Fraktur nicht<br />
mehr in der Lage außer Haus zu gehen (1).<br />
Osteoporoseassoziierte Frakturen, vertebral<br />
oder extravertebral, sind bei Frauen und Männern<br />
mit einer erhöhten Mortalität verbunden.<br />
Der Mortalitätsanstieg ist in den ersten<br />
Jahren nach der Fraktur am höchsten. Hüftgelenksnahe<br />
Frakturen weisen in den ersten<br />
sechs Monaten nach der Fraktur eine deutliche<br />
Übersterblichkeit von ca. 20-25% auf (2).<br />
Das Frakturrisiko wird bei beiden Geschlechtern<br />
maßgeblich vom Lebensalter bestimmt<br />
und verdoppelt sich mit jeder Dekade. Die<br />
Assoziation des Lebensalters mit dem Frakturrisiko<br />
kommt wahrscheinlich durch die<br />
Verschlechterung der biomechanischen Faktoren<br />
der Knochenarchitektur und -qualität<br />
zustande. Diese Faktoren können jedoch derzeit<br />
noch nicht direkt prognostisch verlässlich<br />
erfasst werden. Fest steht, dass Frauen bei<br />
vergleichbarem Lebensalter und T-Score ein<br />
etwa zweimal höheres Risiko für osteoporotische<br />
Frakturen aufweisen als Männer (Abb. 1).<br />
Stellenwert der Diagnostik<br />
Eine hüftnahe Fraktur oder der Nachweis von<br />
≥ 2 typischen osteoporotischen Frakturen in<br />
einem Röntgenbild rechtfertigt die Einleitung<br />
einer medikamentösen Therapie auch ohne<br />
vorherige Durchführung einer DXA-Messung<br />
(dual energy X-ray absorptiometry-Messung),<br />
damit eine Behandlung möglichst rasch nach<br />
Diagnose der Fraktur begonnen werden<br />
kann. Gerade beim geriatrischen Patienten<br />
ist die Diagnostikmöglichkeit mittels DXA<br />
häufig erschwert, nicht nur durch mögliche<br />
dementielle Syndrome, sondern vielmehr<br />
durch bereits liegendes Osteosynthesematerial<br />
oder Rotationsskoliosen, welche eine<br />
suffiziente Analyse und T-Score-Ermittlung<br />
unmöglich machen. Neben der Diagnostik<br />
hat die DXA auch für die Therapieadhärenz<br />
Bedeutung. Die Durchführung einer Densitometrie<br />
verbessert die Compliance (3). Aus<br />
der klinischen Erfahrung ist dies jedoch auf<br />
Patienten ohne kognitives Defizit beschränkt.
Abb. 2: Das rechte Bild zeigt in der Mitte eine eingebrochene Deckplatte (roter Pfeil) am mittleren Wirbelkörper, und zwar typischerweise<br />
im Bereich der Vorderkante (schwarzer Pfeil), was neben der Höhenminderung des betroffenen Wirbelkörpers auch<br />
eine Verkrümmung der gesamten Wirbelsäule nach vorne (verstärkte Kyphose) bewirkt. Die blauen Pfeile zeigen eine gleiche<br />
Höhe der Vorder- und Hinterkante beim gesunden Wirbelkörper links. Bei dem eingebrochenen Wirbelkörper rechts hat die Höhe<br />
der Vorderkante (grüner Pfeil) auf etwa die Hälfte der ursprünglichen Höhe abgenommen (Bilder: Kyphon Inc. 2000 Kyphon Inc.)<br />
Auch beim geriatrischen Patienten sollte ein<br />
Basislabor zum Ausschluss anderer Differenzialdiagnosen<br />
durchgeführt werden. Spezifische<br />
Knochenan- und -abbauparameter<br />
haben ihren Stellenwert vorwiegend in Verlaufskontrollen,<br />
weniger in der Sicherung der<br />
Diagnose (Abb. 2).<br />
Therapeutische Überlegungen<br />
und Indikation<br />
Schwieriger als die Diagnostik einer Osteoporose<br />
beim geriatrischen Patienten ist sicherlich<br />
die Intervention bzw. die Therapie der<br />
Osteoporose. Neben interdisziplinär durchgeführter<br />
sturzpräventiver Maßnahmen zur<br />
Erhaltung der Selbständigkeit und Lebensqualität<br />
der Betroffenen ist die medikamentöse<br />
Therapie unumgänglich. Beim polymorbid<br />
geriatrischen Patienten sollten vor<br />
Beginn einer Basistherapie grundsätzliche<br />
Überlegungen angestellt werden. Die Therapie<br />
mit modernen Osteoporosetherapeutika<br />
stellt eine präventive Therapie dar. Positive<br />
Effekte auf die Frakturprävention sind frühestens<br />
nach 6 Monaten, eher nach einem Jahr<br />
zu erwarten. Es stellt sich daher die Frage,<br />
ob der Patient die positiven Effekte der Therapie<br />
erleben wird. Nimmt man die statistisch<br />
errechnete Lebenserwartung selbst<br />
Hochbetagter, kann auch die Behandlung<br />
95-Jähriger indiziert sein (Grafik 1). Allerdings<br />
stellen die geriatrischen Patienten nur einen<br />
Teil der erwähnten Bevölkerungsgruppe dar,<br />
d.h., dass die Lebenserwartung bei den geriatrischen<br />
Patienten gegenüber der Gesamtgruppe<br />
deutlich vermindert sein dürfte.<br />
Der Charlson-Comorbidity-Index erfasst die<br />
Komorbiditäten und schätzt die Mortalität<br />
in den nächsten 12 Monaten ein (4). Unter<br />
Grafik 1: Lebenserwartung in Österreich nach Alter (Quelle: Statistik Austria)<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
75 80 85 90 95 100<br />
Männer 10,23 7,56 5,39 3,73 2,66 1,95<br />
Frauen 12,31 8,92 6,17 4,13 2,87 2,08<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Berücksichtigung des Alters und der Multimorbidität<br />
lässt sich so die Therapieindikation<br />
bei geriatrischen Patienten bewerten.<br />
Osteoporosetherapie und<br />
Kontraindikation<br />
Bisphosphonate<br />
Orale Bisphosphonate als „First-line“-Therapie<br />
reduzieren nachweislich die Osteoklastenaktivität,<br />
erhöhen die Knochendichte (5) und<br />
erzielen eine erhebliche Verringerung des<br />
Risikos neuer vertebraler und extravertebraler<br />
Frakturen (6, 7, 8). Deren Wirksamkeit<br />
scheint unumstritten, dennoch ist deren peroraler<br />
Einsatz vor allem beim geriatrischen<br />
Patienten limitiert. Man denke an die GERD<br />
(Gastroesophageal reflux disease) und die<br />
verminderte Patientencompliance (ein Jahr<br />
nach Therapiebeginn nehmen nur noch 50%<br />
der Osteoporosepatienten ihre Tabletten<br />
regelmäßig ein (9)), des weiteren mögliche<br />
andere gastrointestinale Nebenwirkungen<br />
(Diarrhoe, Meteorismus und Obstipation),<br />
neurogene Schluckstörungen und, nicht zu<br />
vergessen, der fehlende Leidensdruck im frühen<br />
Krankheitsstadium stellen eine deutliche<br />
Einschränkung der oralen Verabreichungsmodalitäten<br />
von Bisphosphonaten dar.<br />
Auch die eingeschränkte Mobilität, sei es<br />
durch das fortgeschrittene Alter per se oder<br />
durch stattgehabte Fragilitätsfrakturen bei<br />
bereits manifester Osteoporose, führen<br />
ebenso wie die mögliche Beeinträchtigung<br />
kognitiver Fähigkeiten im Alter zu Problemen<br />
bei der vorschriftsmäßigen Einnahme von<br />
oralen Bisphosphonaten. Aus diesem Grund<br />
steht beispielsweise seit 2006 in Österreich<br />
auch parenteral verabreichbares Ibandronat<br />
zur Verfügung, des weiteren Zoledronat zur<br />
intravenösen Verabreichung. Dennoch ist,<br />
ob oral oder parenteral appliziert, immer auf<br />
Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen<br />
im Besonderen bei älteren Menschen<br />
zu achten.<br />
Einen wichtigen Punkt nimmt die Tatsache<br />
des möglichen Absinkens des Serumkalziumspiegels<br />
unter Bisphosphonattherapie ein.<br />
Daher sollten Bisphosphonate nicht ohne<br />
additive Gabe von Kalzium und Vitamin D<br />
appliziert werden. Bei bekannter Hypokalziämie<br />
ist die Verabreichung bis zum Elektrolytausgleich<br />
vorübergehend kontraindiziert.<br />
Betreffend unerwünschte Nebenwirkungen<br />
stehen bei parenteraler Gabe von Bisphosphonaten<br />
grippeähnliche Symptome im Rahmen<br />
des PIS (Postinjektionssyndrom) im Vordergrund.<br />
15
Osteoporose<br />
Zu erklären sind diese durch eine reversible<br />
Immunreaktion, bei der es zu einer T-Zell-<br />
Aktivierung und anschließender Produktion<br />
von IL-6 (Interleukin 6) sowie TNFα (Tumor-<br />
Nekrose-Faktor alpha) kommt. Das PIS äußert<br />
sich meist lediglich im Gefolge der Erstverabreichung.<br />
Bei Zoledronat wurde vermehrt Vorhofflimmern<br />
registriert, aseptische Kiefernekrosen<br />
sind ebenfalls beschrieben, diese scheinen<br />
jedoch nur bei Tumorpatienten unter Hochdosistherapie<br />
eine Rolle zu spielen. Außerdem<br />
gilt besonderes Augenmerk auf die relativ<br />
häufigen Nierenfunktionseinschränkungen<br />
im Alter. In gleicher Weise wie Bisphosphonate<br />
Osteoklasten schädigen, kommt es<br />
zu einer Wirkung auf Nierentubuluszellen,<br />
womit sich die potentielle Nephrotoxizität<br />
von parenteralen Bisphosphonaten erklären<br />
lässt. Zur Vermeidung unerwünschter renaler<br />
Ereignisse soll Ibandronat nicht bei einer<br />
Kreatininclearance von unter 30ml/min und<br />
Zoledronat nicht bei einer Kreatininclearance<br />
unter 35ml/min angewendet werden (10).<br />
Als weitere mögliche Nebenwirkung der Dauertherapie<br />
mit Bisphosphonaten könnte es<br />
durch die Reduktion des Knochenumbaus zu<br />
einer Akkumulation von Mikrofrakturen und<br />
somit zu einer gesteigerten skelettalen Fragilität<br />
kommen. Diese führen zu einem adynamischen<br />
Zustand des systemischen Knochens,<br />
der als „frozen bone“ bezeichnet wird<br />
und konsekutiv wiederum zu Frakturen führt.<br />
Vitamin D<br />
Auch im Bezug auf die Vitamin-D-Substitution<br />
bedarf es besonders beim geriatrischen<br />
Patientengut eingehende Kenntnisse über<br />
Vorerkrankungen und Laborbefunde. Vitamin<br />
D wird in der Haut synthetisiert und über<br />
die Leber (25-Hydroxylierung) und die Nieren<br />
(1-Hydroxylierung) in seine aktive Form, das<br />
1,25-Dihydroxy-Vitamin D, umgewandelt. In<br />
Kombination mit Kalzium ist Vitamin D das<br />
häufigste und billigste Osteoporosetherapeutikum.<br />
Die renale Umwandlung von Vitamin<br />
D in seine aktive Form lässt ab einer GFR<br />
von ca. 50ml/min deutlich nach. Die Verabreichung<br />
eines Vitamin-D-Präparates zur Verhinderung<br />
einer Osteoporose ist daher bei<br />
Patienten mit mittel- bis höhergradig reduzierter<br />
Nierenfunktion unzureichend. Es muss<br />
dann ein Vitamin D verabreicht werden, das<br />
von der Nierenfunktion unabhängig ist (Alfacalcidol,<br />
Calcitriol, Paricalcitol). Nachdem die<br />
Kalziumresorption ab einem CKD-Stadium III<br />
reduziert ist, was wiederum zu einem sekun-<br />
16<br />
dären Hyperparathyreoidismus führt, sollte<br />
Vitamin D frühzeitig substituiert werden.<br />
Vitamin D steigert die Kalzium- und Phosphatresorption<br />
und kann sowohl zu einer<br />
Hyperkalzämie wie einer Hyperphosphatämie<br />
führen. Dies beschleunigt wiederum die<br />
Kalzifikation von Gefäßen. Besonders wenn<br />
gleichzeitig kalziumhältige Phosphatbinder<br />
verabreicht werden. Andererseits besteht bei<br />
Patienten mit erniedrigtem Vitamin-D-Spiegel<br />
ebenfalls ein erhöhtes Risiko vaskulärer<br />
Komplikation. Am Knochen bewirken sehr<br />
hohe und niedrige Vitamin-D-Spiegel eine<br />
Suppression des Knochenumsatzes. Die optimale<br />
Wirkung von Vitamin D ist daher von<br />
der Dosierung abhängig. Es empfiehlt sich,<br />
darauf zu achten, dass der 25-OH-Vitamin-D-<br />
Spiegel mehr als 75nmol/l (30ng/ml) beträgt,<br />
sofern die Kalzium- und Phosphatwerte im<br />
gewünschten Zielbereich sind. Dies kann mit<br />
einer oralen Substitution von Colecalciferol<br />
(Vitamin D3) oder Ergocalciferol (Vitamin D2)<br />
erreicht werden. Zur Behandlung einer überschießenden<br />
PTH-Produktion wird zusätzlich<br />
aktives Vitamin D verabreicht. Inwiefern die<br />
Verabreichung von Kalzium einen weiteren<br />
Vorteil bringt, wurde bisher – zumindest bei<br />
Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz<br />
– nicht untersucht.<br />
HRT (hormone replacement therapy)<br />
Die HRT hat trotz der positiven Beeinflussung<br />
des Frakturrisikos keine osteologische Indikation<br />
mehr (11). Dem positiven Effekt steht<br />
ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre und<br />
thromboembolische Ereignisse sowie für das<br />
Mammakarzinom gegenüber.<br />
Calcitonin<br />
Calcitonin, ob nasal oder subcutan appliziert,<br />
scheint eine gewisse analgetische Wirkung<br />
zu haben. Eindeutige Hinweise für eine Fraktursenkung<br />
liegen jedoch nicht vor (12), eine<br />
Indikation ergibt sich bei schwerer Niereninsuffizienz<br />
(Kreatininclearence < 30ml/min).<br />
SERMs<br />
(Selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren)<br />
SERMs ergaben in Studien mit Bisphosphonaten<br />
vergleichbare Ergebnisse für jüngere Patientengruppen.<br />
Strontiumranelat<br />
Strontium ist chemisch und physikalisch eng<br />
verwandt mit Calcium und besteht aus einem<br />
organischen Anteil (Ranelinsäure) der als<br />
biologisch inaktiv gilt. Unter den Osteoporosetherapeutika<br />
ist Strontiumranelat deswegen<br />
besonders hervorzuheben, da es über<br />
einen dualen Wirkmechanismus verfügt.<br />
Es vermindert die Knochenresorption und<br />
fördert den Knochenaufbau. Über welchen<br />
Mechanismus dies geschieht, ist noch nicht<br />
vollständig geklärt (13, 14). Die orale Bioverfügbarkeit<br />
beträgt etwa 25% (15). Ein wichtiger<br />
Punkt, auf den die Patienten hinzuweisen<br />
sind, ist die Einnahme des Präparats abends<br />
etwa 2–3 Stunden nach der letzten Mahlzeit,<br />
da Calcium und calciumreiche Nahrungsmittel<br />
die Absorption hemmen (16). Für 2g Strontiumranelat<br />
konnte eine signifikante Senkung<br />
(33%) von vertebralen und nicht-vertebralen<br />
Frakturen gezeigt werden (17).<br />
In Knochendichtekontrolluntersuchungen<br />
ist zu berücksichtigen, dass etwa 50% des<br />
gemessenen Zuwachses an Knochendichte<br />
auf den Einbau von Strontium in den Knochen<br />
zurückzuführen ist und Strontium<br />
eine höhere Strahlenabsorption als Calcium<br />
aufweist. Neben unspezifischen Nebenwirkungen<br />
wie Kopfschmerzen, Übelkeit und<br />
Diarrhoe fand sich unter der Einnahme von<br />
Strontiumranelat ein erhöhtes Thromboembolierisiko<br />
sowie eine Zunahme von zentralnervösen<br />
Störungen, etwa das Bewusstsein<br />
und das Gedächtnis betreffend, aber<br />
auch Krampfanfälle, besonders bei Frauen<br />
in höherem Lebensalter. Weiters kann die<br />
Serumkonzentration der CK erhöht sein. Patientinnen<br />
mit schwerer Niereninsuffizienz<br />
(Kreatinin-Clearance unter 30ml/min) dürfen<br />
nicht behandelt werden. In wenigen Fällen<br />
kam es unter Einnahme von Strontiumranelat<br />
zum Auftreten eines DRESS-Syndroms (<strong>Dr</strong>ug<br />
Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)<br />
im Rahmen einer Hypersensitivität mit<br />
Ausschlag, Fieber, Eosinophilie und systemischer<br />
Beteiligung. Da es sich um eine potenziell<br />
lebensbedrohliche Komplikation handelt,<br />
sind die Patienten darüber aufzuklären, Protelos®<br />
nach Auftreten von Hauterscheinungen<br />
unverzüglich abzusetzen.<br />
PTH<br />
Parathormon besteht aus 84 Aminosäuren,<br />
wobei die ersten zwölf Aminosäuren über<br />
Vermittlung am Rezeptor wirken. Wirkt Parathormon<br />
längerfristig, so kommt es durch<br />
Aktivierung der Osteoklasten zur osteokatabolen<br />
Wirkung. Durch die tägliche subcutane<br />
Gabe kommt es allerdings zu einem<br />
schnellen An- und Abstieg des PTH-Spiegels
und dadurch zu einer Stimulation der Osteoblasten.<br />
Zu den physiologischen Eigenschaften<br />
des PTH zählt weiters die Zunahme der<br />
tubulären Calciumrückresorption bzw. eine<br />
indirekte Steigerung der intestinalen Calciumresorption.<br />
In Österreich sind derzeit zwei<br />
Parathormonpräparate für die Behandlung<br />
der Osteoporose zugelassen (PTH 1–34 für<br />
maximal 18 Monate und PTH 1–84 für maximal<br />
24 Monate (18, 19)). Damit steht eine<br />
osteoanabole Therapieoption zur Verfügung.<br />
Wie bereits erwähnt, greift PTH physiologischerweise<br />
in den Calciumhaushalt ein. So<br />
zeigt sich auch nach subcutaner Gabe der<br />
zugelassenen Präparate eine leichte, vorübergehende<br />
Erhöhung des Calciumspiegels,<br />
der sich nach etwa 16-24 Stunden (PTH 1–34)<br />
bzw. 20-24 Stunden (PTH 1–84) wieder normalisiert.<br />
Die Inzidenz einer Hyperkalzämie<br />
ist bei 1–84 PTH höher, deswegen wird empfohlen,<br />
die Calciumspiegel in Serum und Urin<br />
hier 1, 3 und 6 Monate nach Therapiebeginn<br />
zu kontrollieren. Da die Medikamentenapplikation<br />
subcutan erfolgt, ist eine ausführliche<br />
Einschulung der Patienten erforderlich. Für<br />
postmenopausale Frauen (bei PTH 1–34 auch<br />
für Männer) konnte unter subcutaner PTH-<br />
Gabe ein signifikanter Anstieg der Knochendichte<br />
nachgewiesen werden. Weiters zeigte<br />
sich in den Zulassungsstudien eine Senkung<br />
der vertebralen Frakturrate; auf die klinisch<br />
relevante Hüftfraktur übten beide Präparate<br />
allerdings keinen signifikanten Einfluss aus.<br />
Gegenanzeigen für eine Behandlung mit<br />
PTH sind in erster Linie eine vorbestehende<br />
Hyperkalzämie, maligne Skeletterkrankungen<br />
oder Knochenmetastasen (auch unklare<br />
Erhöhungen der AP) sowie, wie immer bei der<br />
osteoporotischen Behandlung, eine schwere<br />
Niereninsuffizienz. Nach Beendigung der 18-<br />
bzw. 24-monatigen Therapie mit PTH sollte<br />
eine weitere osteotrope Therapie begonnen<br />
werden (BPH, Strontiumranelat, etc.) (20).<br />
Denosumab<br />
Einen neuen Therapieansatz verspricht<br />
der Einsatz des monoklonalen Antikörpers<br />
Denosumab. Physiologischerweise fördert<br />
der RANK-Ligand über die Bindung an den<br />
Rezeptor RANK die Osteoklastogenese; durch<br />
Blockierung des Rezeptors mithilfe von Denosumab<br />
(bzw. in vivo durch Osteoprotegerin)<br />
kann ein Knochenabbau verhindert werden.<br />
Aufgrund der subcutanen Gabe, die lediglich<br />
zweimal jährlich erforderlich ist, ist mit einer<br />
hohen Compliance zu rechnen. Der monoklonale<br />
Antikörper gegen RANKL konnte in einer<br />
großen Studie an 7.868 postmenopausalen<br />
Frauen über einen Beobachtungszeitraum<br />
von 3 Jahren eine Senkung von vertebralen<br />
und extravertebralen Frakturen zeigen (21).<br />
Inkludiert waren Frauen von 60-90 Jahren.<br />
Ausblick<br />
Wahrscheinlich werden uns in naher Zukunft<br />
Substanzen wie der Sclerostin-Antikörper,<br />
der die Knochenneubildung hemmen soll<br />
und der Cathepsin-K-Inhibitor als Osteoklastenenzym,<br />
das an der Resorption der Knochengrundsubstanz<br />
beteiligt ist, auf ähnliche<br />
Weise zu einer gewissen Sorgsamkeit im<br />
Umgang mit Osteotherapeutka bei geriatrischen<br />
Patienten mahnen.<br />
Conclusio<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der<br />
Erfolg der Pharmakotherapie nicht nur von<br />
der Adherence des Patienten abhängt. Die<br />
BoneEVA-Studie zeigt, dass nur etwa 11%<br />
aller OsteoporosepatientInnen eine den<br />
aktuellen Leitlinien entsprechende Therapie<br />
erhalten (22), daher ist diese auch von der<br />
Awareness der Ärzte abhängig. Die Therapie<br />
der Osteoporose mit dem Ziel der Frakturvermeidung<br />
stellt gerade beim geriatrischen<br />
Patienten eine Herausforderung dar. Neben<br />
der Wahl der richtigen medikamentösen<br />
Intervention ist gerade hinsichtlich der Sturzprävention<br />
eine interdisziplinäre Sicht dieser<br />
Erkrankung unumgänglich.<br />
Literatur<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
(1) Osnes EK, Lofthus CM, Meyer HE, Falch JA, Nordsletten<br />
L, Cappelen I, Kristiansen IS, consequences of hip fracture<br />
on activities of daily life and residential needs. Osteoporos<br />
Int. 2004 Jul;15(7):567-74.<br />
(2) Alegre-Lopez J, Cordero-Guevara J, Alonso-Valdivielso<br />
JL, Fernandez-Melon J, Factors associated with mortality<br />
and functional disability after hip fracture an inception<br />
cohort study. Osteoporos Int. 2005 Jul;16(7):729-36. Epub<br />
2004 Oct 30., Jilang HX, Majumdar SR, Dick DA, Moreau,<br />
M, Raso J, Otto DD, Johnston DW, Development and initial<br />
validation of a risk score for predicting in-hospital<br />
and 1-year mortality in patients with hip fractures. J<br />
Bone Miner Res. 2005 Mar,20(3):494-500. Epub 2004 Nov.<br />
29., Smektala R, Ohmann C, Paech S, Neuhaus E, Rieger<br />
M, Schwabe W, Debold P, Deimling A, Jonas M, Hupe K,<br />
Bucker-Nott HJ, Giani J, Szucs TD, Pientka L. On the prognosis<br />
of hip fractures Assessment of mortality after hip<br />
fractures by analyzing longitudinal data from acute<br />
and rehabilitative care. Unfallchirurg. 2005 Jul 21; (Epub<br />
ahead of print).<br />
(3) http://www.osteoporose.co.at/, gesehen 6/2010<br />
(4) Charlson ME, Pompei P, Ales K, MacKenzie CR, A new<br />
method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal<br />
studies: development and validation. J Chron Dis<br />
1987;40:373-83<br />
(5) Liberman UA, Weiss SR, Bröll J, Minne HW, Quan H, Bell<br />
NH, Rodriquez-Portales J, Downs RW jr, Dequeker J, Favus<br />
M. Effect of oral alendronate on bone mineral density and<br />
the incidence of fractures in postmenopausal osteoporosis.<br />
N Engl J Med 1995,333:1437-43.<br />
(6) Recker R, Stakkestad JA, Hoiseth A, Felsenberg D, Huss<br />
H, Gilbride J, Schimmer RC, Delmas PD, Oral Ibandronate<br />
Osteoporosis Vertebral Fracture Trial in Noth America and<br />
Europe (BONE). Effects of oral Ibandronate administered<br />
daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal<br />
osteoporosis. J Bone Miner Res 2004;19:1241-9.<br />
(7) Delmas PD, Recker R, Chesnut CH III, Skag A, Stakkestad<br />
JA, Emkey R, Gilbride J, Schimmer RC, Christiansen C.<br />
Daily and intermittent oral ibandronate normalize bone<br />
turnover and provide significant reduction in vertebral<br />
fracture risk: results from the BONE study. Osteoporos Int<br />
2004;15:792-8.<br />
(8) Reginster JY, Minne HW, Sorensen OH, Hooper M, Roux<br />
C, Brandi ML, Lund B, Ethgen D, Pack S, Roumagnac I, Eastell<br />
R. Randomized trial of the effects of risedronate on<br />
vertebral fractures in women with established postmenopausal<br />
osteoporosis. Vertebral Efficacy with Resedronate<br />
Therapy (VERT) Study Group. Osteoporos Int 2000;11:83-<br />
91<br />
(9) Weycker D, et al. Osteoporos Int. 2006;17:1645-1652<br />
10 Ergebnis der randomisierten HORIZON-Studie veröffentlicht<br />
im New England Journal of Medicine (NEJM<br />
2007;356:1809-1822)<br />
(11) www.der-arzneimittelbrief.de/Jahrgang2004/Ausgabe05Seite33.htm,<br />
gesehen 6/2010<br />
(12) Chesnut CH, Silverman S, Andriano K, et al. A randomized<br />
trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal<br />
women with established osteoporosis: the prevent<br />
recurrence of osteoporotic fractures study. PROOF Study<br />
Group. Am J Med 2000;109:267-76<br />
(13) Protelos – Innovation in der Osteoporosetherapie.<br />
Dimal H-P, Journal für Mineralstoffwechsel 2006;13(Sonderheft1),6<br />
(14) Fachinformation Protelos<br />
(15) Fachinformation Protelos<br />
(16) Strontiumranelat (Protelos): Wirkstoff aktuell; Ausgabe<br />
01/2009<br />
(17) Meunier PJ, Roux C, Seeman E, et al. The effects of<br />
strontiumranelate on the risk of vertebral fracture in<br />
woman with postmenopausal osteoporosis. SOTI study.<br />
NJ Engl Med 2004;350:459-68<br />
(18) Fachinformation Forsteo<br />
(19) Fachinformation Preotact<br />
(20) Moderne Osteoporosetherapie mit PTH 1-43.<br />
Muschitz C, Der Mediziner 06/2008,34-36<br />
(21) Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al.<br />
Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal<br />
women with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-<br />
65<br />
(22) Häussler B, Gothe H, Göl D, et al. Epidermiology,<br />
treatment and costs of osteoporosis in Germany – the<br />
BoneEVA Study. Osteoporos Int 2007;18:77-84<br />
17
Verletzungen<br />
Ass. <strong>Dr</strong>. Stella DASKALAKIS<br />
Haus der Geriatrie<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisierung<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43(0)463/538-22667<br />
stella.daskalakis@kabeg.at<br />
18<br />
foto@beigestellt<br />
Sturzassessment<br />
Das Phänomen des Sturzes im Alter<br />
gehört zu einer der größten Herausforderungen<br />
an die geriatrische Medizin. Die Bedeutung<br />
des Sturzes lässt sich einerseits durch<br />
seine Häufigkeit, andererseits durch seine<br />
Komplexizität erklären, denn Stürze im geriatrischen<br />
Kontext sind selten monokausal<br />
bedingt. Eine Reihe von Faktoren tragen zur<br />
deren Manifestation bei.<br />
Statistisch gesehen erleidet jeder dritte über<br />
65 - Jährige mindestens einen Sturz pro Jahr.<br />
Die Sturzrate nimmt mit jeder Lebensdekade<br />
zu, sodass bei den 85-jährigen bereits<br />
50% betroffen sind. Die Hälfte der Betroffenen<br />
stürzt dabei öfters als einmal im Jahr. Die<br />
Sturzhäufigkeit ist bei Pflegeheimpatienten<br />
im Vergleich zu gleichaltrigen noch zu Hause<br />
lebenden Menschen höher, wohl erklärbar<br />
durch die Multimorbidität und Pflegeabhängigkeit<br />
dieser Patientengruppe.<br />
Die am meisten gefürchtete Sturzfolge ist die<br />
hüftgelenksnahe Fraktur, welche trotz der<br />
heutigen exzellenten Versorgungsmöglichkeiten<br />
weiterhin eine der häufigsten Todesursachen<br />
für Betagte und Hochbetagte darstellt.<br />
Der Sturz ist auch ohne schwerwiegende<br />
Verletzung oft der Beginn einer Negativspirale,<br />
bei der Chronifizierung von Schmerzen,<br />
Immobilität, aber auch Angst, Perspektivenlosigkeit<br />
und Depression eine Rolle spielen.<br />
Dies kann zu einem Rückzug aus dem aktiven<br />
sozialen Leben führen. Nicht selten endet<br />
diese komplexe Spirale in der Bettlägerigkeit,<br />
Pflegeabhängigkeit und Institutionalisierung<br />
des Betroffenen.<br />
Interessanterweise wird diese Problematik<br />
oft sowohl vom Patienten als auch vom<br />
behandelten <strong>Arzt</strong> nicht entsprechend wahrgenommen<br />
bzw. bagatellisiert, und nicht selten<br />
stellen erst stattgehabte Frakturen, eine<br />
Krankenhauseinweisung oder eine bereits<br />
einsetzende Immobilität den Anlass dar, sich<br />
mit der Thematik auseinanderzusetzen.<br />
Mit obiger Darstellung sollte die Dimension<br />
des Problems und die Notwendigkeit einer<br />
awareness - Bildung illustriert werden.<br />
Präventive Maßnahmen zur Verhinderung<br />
von Stürzen stellen einen Gewinn für den<br />
Patienten und seine Lebensqualität dar,<br />
wobei an dieser Stelle auch auf den sozioökonomischen<br />
und gesellschaftlichen Aspekt der<br />
Sturzprophylaxe hingewiesen werden sollte.<br />
Der erste Schritt einer Sturzprävention ist ein<br />
entsprechendes Sturzassessment, welches<br />
per se nicht Stürze verhindert kann, aber die<br />
Möglichkeit gibt, sturzgefährdete Patienten<br />
zu erkennen, ihre individuellen Risikofaktoren<br />
zu identifizieren um anschließend gezielte,<br />
individuell angepasste Maßnahmen setzen<br />
zu können.<br />
Die amerikanische und britische geriatrische<br />
Gesellschaft veröffentlichte 2010 neue Leitlinien<br />
hinsichtlich Screening, Assessment<br />
und Prävention von Stürzen. Neu ist unter<br />
anderem auch die Fokussierung auf kardiovaskuläre<br />
Probleme, wie die orthostatische<br />
Dysregulation und Rhythmusstörungen als<br />
potentielle Risikofaktoren eines Sturzes.<br />
Wesentlich ist es, alle ältere Menschen nach<br />
Stürzen im letzten Jahr und nach subjektiver<br />
Verschlechterung der Gehfähigkeit oder des<br />
Gleichgewichtes zu fragen. Wird eine der Fragen<br />
positiv beantwortet sollte eine ausführliche<br />
Erfassung der Sturzrisikofaktoren mit<br />
Hilfe eines Sturzassessments erfolgen, welches<br />
folgende Schritte beinhalten sollte:<br />
Anamnese<br />
• Genaue Befragung der Umstände, welche<br />
zum Sturz führten (Vorphase, Ereignisphase,<br />
Situation nach erfolgtem Sturz)<br />
• Genaue Medikamenten-Anamnese (mit<br />
besonderen Augenmerk auf Polypharmazie<br />
und die fall risk increasing drugs (FRID’s)<br />
wie beispielsweise psychotrope und sedierende<br />
Substanzen oder Medikamente zur<br />
Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen)<br />
• Erhebung von chronischen Erkrankungen,<br />
welche mit einer Erhöhung der Sturzgefahr<br />
assoziiert sein können (kardiovask. Formenkreis,<br />
Osteoporose, Arthrosen, <strong>Dr</strong>anginkontinenz<br />
etc.)
Klinische Untersuchung<br />
• Überprüfung des Gleichgewichtes, des<br />
Gangbildes und der Funktion der unteren<br />
Extremität mittels standardisierten Testverfahren<br />
(modifizierter Romberg-Test, Armausstrecktest,<br />
timed up and go test, Walk-<br />
Performance beim 6 Minuten Gehtest)<br />
• Erhebung eines neurologischen und des<br />
kognitiven Status, der Propriozeption, der<br />
Reflexe, der cortikalen, extrapyramidalen<br />
und cerebellären Funktionen<br />
• Überprüfung der Muskelkraft (Handgrip,<br />
chair rising Test, etc.)<br />
• Erhebung des kardiovaskulären Status<br />
durch Überprüfung der Herzfrequenz und<br />
des Herzrhythmus beim Aufstehen, Kontrolle<br />
der orthostatischen Regulation (modifiz.<br />
Schellong Test) und bei begründeten<br />
Verdacht Durchführung des Karotisdruckversuches<br />
• Grobe Überprüfung des Sehvermögens<br />
• Inspektion des Füße und des Schuhwerks<br />
Naturgemäß kann die klinische Untersuchung<br />
anhand der erhobenen Sturzanamnesedaten<br />
modifiziert werden bzw. Teilaspekte<br />
des Assessments können bei Bedarf erweitert<br />
(z.B. EEG-Untersuchung, Holter, etc.) oder<br />
weggelassen werden.<br />
Die Leitlinien empfehlen zusätzlich eine funktionelle<br />
Überprüfung der Fertigkeiten und<br />
Fähigkeiten des Betroffenen (ADL und IADL -<br />
Test) um auch die Möglichkeit der adäquaten<br />
Benützung diverser Gehhilfsmittel herauszufinden.<br />
Weiters ist eine Befragung oder vor Ort<br />
Überprüfung des häuslichen Umfeldes und der<br />
diversen Stolperfallen unbedingt erforderlich.<br />
Die meisten Studien und nicht zuletzt ein rezentes<br />
Cochrane Review weisen auf die Effektivität<br />
des Sturzassessments und der multifaktoriell<br />
angesetzten Präventionsprogramme hin, welche<br />
Medikamentenreduktion, Behandlung<br />
der sturzassoziierten Erkrankungen, Wohnraumadaptierung<br />
und auch Therapie von Herzrhythmusstörungen<br />
und der orthostatischen<br />
Dysregulation beinhalten.<br />
Ein notwendiger Teil der Sturzprävention ist<br />
das körperliche Training („Exercise“), welches<br />
sich auf Muskelkraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit<br />
und Ausdauer bezieht. Programme<br />
welche zwei oder mehrere dieser Komponenten<br />
beinhalten, reduzieren die Sturzinzidenz<br />
und die Zahl der stürzenden Personen, wobei<br />
Training in supervidierten Gruppen, Tai Chi<br />
und das individuelle Training gemäß einem<br />
entsprechenden Plan zu Hause am effektivsten<br />
ist.<br />
Kritisch anzumerken ist, dass sich die Mehrzahl<br />
der Studien auf zu Hause lebende alte<br />
Menschen beschränken und dass wenig Evidenz<br />
hinsichtlich der Verminderung der Sturzinzidenz<br />
bei Pflegeheimbewohnern oder bei<br />
demenzerkrankten Sturzpatienten vorliegt.<br />
Zusätzlich ist die Effektivität der Maßnahmen<br />
nur im strukturierten Setting einer Studie<br />
nachvollziehbar. Das Angebot an organisierten<br />
Sturzpräventionsprogrammen für ältere<br />
Menschen (außerhalb von Studien und kleinen<br />
Projekten) ist jedoch für unsere Patienten<br />
rar oder gar nicht existent.<br />
Zuletzt sollte noch auf den Effekt von Vitamin<br />
D hingewiesen werden. Der Datenlage<br />
zufolge kommt es, neben einer rezeptorunabhängigen<br />
Begünstigung des Kalziumeinstroms<br />
in die Muskelzelle, durch die Bindung<br />
Literatur<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
des aktiven Vitamin D an den Vitamin D-<br />
Rezeptor zu einer Förderung der Proteinsynthese,<br />
das letztendlich zu einer Verbesserung<br />
der Muskelkraft und zu einer Reduzierung<br />
der Sturzrate führt. Unter Vitamin D konnte<br />
im Vergleich zur Placebo oder Kalziumsubsitution<br />
das Sturzrisiko um 22% gesenkt werden,<br />
entsprechend einer NNT von 15. Vitamin<br />
D scheint ein vielversprechenden Therapiekonzept<br />
hinsichtlich Sturzprävention zu sein.<br />
Die Leitlinie der amerikanischen und britischen<br />
Gesellschaft empfiehlt eine tgl. Dosis<br />
von mindestens 800 IE, wobei die Therapiedauer<br />
und die genau Dosierung bei nachgewiesener<br />
Vitamin D-Insuffizienz noch Gegenstand<br />
von Studien ist.<br />
(1) Sturzassessment-Indikationen Instrumente ,<br />
Daniel Grob, Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital<br />
Waid, Zürich<br />
(2) 2010 AGS/BGS Clinical Practice Guidelines, Prevention<br />
of falls in older Persons<br />
(3) Medication and falls in old age, M.K. Modreker,<br />
W. von Renteln-Kruse volume 50, n 4<br />
(4) Preventing falls in elderly, Tinetti NEJM 2003;<br />
348:42-49<br />
(5) Interventions for preventing falls in older people<br />
living in the community gillespie 2009 cochrane<br />
(6) Effects of Vitamin D on falls Bischoff ferrari Jama<br />
2004<br />
Seractil forte 400 mg - Filmtabletten<br />
Zusammensetzung: Eine Filmtablette enthält 400 mg Dexibuprofen. Hilfsstoffe: Tablettenkern: Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Calcium, hochdisperses Siliciumdioxid,<br />
Talk. Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Glyceroltriacetat, Talk, Macrogol 6000. Anwendungsgebiete: Akute und chronische Arthritis, wie chronische Polyarthritis (rheumatoide<br />
Arthritis) und andere Arthrosen; entzündliche rheumatische Erkrankungen, wie Morbus Bechterew, Weichteilrheumatismus; zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen,<br />
schmerzhaften Schwellungen oder Entzündungen, wie nach Verletzungen oder Operationen. Gegenanzeigen: Dexibuprofen darf nicht angewendet werden bei Patienten: mit einer<br />
bekannten Überempfindlichkeit gegen Dexibuprofen, gegen andere NSAR oder gegen einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Bei denen Stoffe mit ähnlicher Wirkung (z.B.<br />
Acetylsalicylsäure oder andere NSAR) Asthmaanfälle, Bronchospasmen, akute Rhinitis, Nasenpolypen, Urtikaria oder angioneurotische Ödeme auslösen. Mit einer Vorgeschichte von gastrointestinalen<br />
Blutungen oder Perforationen, die im Zusammenhang mit einer vorhergehenden NSAR Therapie steht. Mit bestehenden oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen<br />
peptischen Ulzera oder Blutungen (mindestens zwei voneinander unabhängige Episoden von nachgewiesener Ulzeration oder Blutung). Mit zerebrovaskulären oder anderen aktiven<br />
Blutungen. Mit aktivem Morbus Crohn oder aktiver Colitis ulcerosa. Mit schwerer Herzinsuffizienz. Mit schwerer Nierenfunktionsstörung (GFR < 30 ml/min). Mit schwerer Leberfunktionsstörung.<br />
Ab dem sechsten Monat der Schwangerschaft. Pharmakotherapeutische Gruppe: Nichtsteroidale antiinflammatorische und antirheumatische Stoffe, Propionsäurederivate,<br />
ATCCode: M01AE14. Abgabe: ezept- und apothekenpflichtig Packungsgrößen: 10, 30, 50 Stück Kassenstatus: 10, 50 Stück: Green Box 30 Stück: No Box Zulassungsinhaber: Gebro<br />
Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn Stand der Fachkurzinformation: Dezember 2010. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit<br />
anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der<br />
19
Ernährung<br />
Ernährungsassessment in der Geriatrie<br />
OA <strong>Dr</strong>. Barbara HOffMANN<br />
Haus der Geriatrie<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43(0)463/538-22667<br />
barbara.hoffmann@kabeg.at<br />
20<br />
foto@beigestellt<br />
Eine ausgewogene Ernährung als essentielles<br />
Bedürfnis zieht sich durch alle Lebensbereiche.<br />
Insbesondere im Alter - durch<br />
eine Abnahme des Gesamtkalorienbedarfs,<br />
des Grundumsatzes sowie einer verminderten<br />
körperlichen Aktivität – ändern sich die<br />
Anforderungen, bei jedoch gleich bleibendem<br />
Bedarf an Vitaminen, Spurenelementen,<br />
Aminosäuren und Fetten.<br />
Bei fortwährend erhobener hoher Prävalenz<br />
von Mangelernährung bei geriatrischen Patienten<br />
– je nach Studíenlage liegt die Rate bei<br />
hospitalisierten Patienten bei 30-80%, bei<br />
Bewohnern von Pflegeinstitutionen sogar bei<br />
50-85% – unter den bekannten möglichen<br />
Auslösern (siehe Tabelle 1) und den resultie-<br />
Tabelle 1<br />
Ursachen der Mangelernährung<br />
1. Zahnstatus („dentition”)<br />
2. Geruchs- und Geschmacksstörungen („dysgeusia”)<br />
3. Dysphagie („dysphagia”)<br />
4. Diarrhö („diarrhea”)<br />
5. Chronische Erkrankungen („disease chronic”)<br />
6. Depression („depressions”)<br />
7. Demenz („dementia”)<br />
8. Sozialstatus („dysfunktion”)<br />
9. Medikamente („drugs”)<br />
10. Unbekannte Ursache („don`t know”)<br />
Modifiziert nach „the nine d`s of weight loss in the eldery”<br />
renden klinischen Folgen (siehe Tabelle 2)<br />
kommt einem strukturierten Ernährungsassessment<br />
eine zentrale Aufgabe zu.<br />
Tabelle 2<br />
Klinische Relevanz der<br />
Mangelernährung<br />
1. Muskulärer Abbau und Schwäche<br />
2. Immobilität und Stürze<br />
3. Osteoporose und Frakturen<br />
4. Verzögerte Wundheilung<br />
5. Decubitalulcera<br />
6. Erhöhte Infektionsneigung<br />
7. Höhere Komplikationsrate<br />
8. Längere Krankenhausaufenthalte<br />
9. Vermehrte Kosten<br />
Zur Erfassung des Ernährungsstatus stehen<br />
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:<br />
• Anthropometrische Erhebungen<br />
• Screening-Verfahren<br />
• Messung der Körperzusammensetzung<br />
• Laborparameter<br />
Zu den antropometrischen Markern zählen:<br />
Körpergröße, Körpergewicht, daraus resultierender<br />
Body Mass Index (BMI), Trizepsfaltendicke,<br />
Oberarm- und Wadenumfang, wobei<br />
bereits bei der Erhebung der Körpergröße<br />
Probleme beispielsweise durch Immobilität<br />
oder ausgeprägt degenerative Wirbelsäulenveränderung<br />
limitierend sein können.<br />
Ein Wadenumfang < 31cm (sowohl bei Frauen<br />
als auch bei Männern) korreliert mit einer<br />
reduzierten Muskelmasse. Eine ausreichende<br />
Reproduzierbarkeit der Daten ist jedoch nicht<br />
immer sicher gewährleistet.<br />
Aufgrund der bereits erwähnten Reduktion<br />
der Körpergröße im Alter sowie der veränderten<br />
Körperzusammensetzung wird bei Patienten<br />
über 65 Jahre bereits ein BMI kleiner<br />
als 22 kg/m² als Risiko für Mangelernährung<br />
angesehen, da unter diesem Wert ein erhöhtes<br />
Mortalitätsrisiko besteht. Als Normalgewichtig<br />
werden ältere Patienten mit einem<br />
BMI zwischen 22 und 26,9 kg/m² gesehen. Im<br />
Vergleich definiert die WHO Normalgewicht<br />
bei einem BMI von 18,5 bis 24,9 kg/m².<br />
Als Screening dienen einige Testverfahren,<br />
wie der Short Nutritional Assessment Questionair<br />
(SNAQ), das Nutritional Risk Screening<br />
(NRS), das Subjectiv Global Assessment (SGA)<br />
und das Mini Nutritional Assessment (MNA),<br />
wobei sich insbesonders letzteres für geriatrische<br />
Patienten bewährt hat.<br />
Das Verfahren wird unterteilt in eine Kurzform<br />
und eine Vollversion, wobei die Kurzform<br />
bereits als rasch praktikable Voranamnese bei<br />
einer Wertung kleiner oder gleich 11 Punkten<br />
den Hinweis für ein Malnutritionsrisiko gibt.<br />
Erhoben werden Ernährungsgewohnheiten,<br />
Gewichtsveränderungen, Mobilität, akute<br />
Erkrankung und neuropsychologische Prob-
leme ebenso wie der BMI. Die aufwändigere<br />
Vollversion kann angeschlossen werden oder<br />
auf weitere Assessment-Instrumente zurückgegriffen<br />
werden.<br />
Zur Messung der Körperzusammensetzung<br />
dient beispielsweise die Bioelektrische Impedanzanalyse<br />
(BIA).<br />
Hierbei wird durch die unterschiedliche Leitfähigkeit<br />
von Knochen, Muskeln, Organen<br />
und Körperfett eine Differenzierung des<br />
Körpergewichts in Körperwasser, Fettmasse<br />
und Muskelmasse möglich. Hinweise für ein<br />
Malnutritionsrisiko durch Verlust der Muskelmasse<br />
zeigen vorwiegend die reduzierte<br />
body cell mass (BCM) und ein Phasenwinkel<br />
kleiner 5° an.<br />
Zur Detektion einer Mangelernährung<br />
sowie zum gegebenenfalls weiter nötigen<br />
Monitoring im Rahmen einer eingeleiteten<br />
Ernährungstherapie stehen eine Reihe an<br />
Laborparamtern zur Verfügung (siehe Tabelle<br />
3), wobei durch deren unterschiedliche Halbwertszeiten<br />
(HWZ) zwischen Langzeitparamtern<br />
und Laborwerten zum kurzfristigeren<br />
Verlaufsmonitoring ausgewählt werden kann.<br />
Das Gesamt-Albumin mit seiner HWZ von 14<br />
bis 20 Tagen weist als geriatrischer Routineparamter<br />
bei einem Wert unter 35 g/l auf eine<br />
Mangelernährung hin mit indirekt proportionalem<br />
Schweregrad und Mortalitätsrisiko.<br />
Ebenso verhält es sich mit Transferrrin (HWZ 8<br />
bis 10 Tage) und Cholinesterase (HWZ 2 Tage)<br />
als Zeichen der eingeschränkten Lebersynthese.<br />
für engmaschigere Verlaufskontrollen<br />
scheint Präalbumin mit seiner deutlich kürze-<br />
Tabelle 3<br />
Schweregrad der Mangelernährung<br />
ren HWZ von 20 Stunden ein geeigneter Parameter<br />
zu sein, ist jedoch aus Kostengründen<br />
nicht überall routinemäßig verfügbar. Das<br />
Retinol-bindende Protein als Transportprotein<br />
weist lediglich eine HWZ von 10 Stunden<br />
auf, hat bisher aber noch nicht Eingang in ein<br />
Basislabor gefunden.<br />
Als einfach zu bestimmende Marker weisen<br />
auch eine reduzierte Lymphozytenzahl im<br />
Rahmen des roten Blutbildes auf eine Malnutrition<br />
hin, sowie ein vermindertes Cholesterin<br />
und reduzierte Triglyceride.<br />
Weitere Werte wie C-reaktives Protein (CRP)<br />
und viele Immunparameter können ebenso<br />
eine Mangelernährung aufzeigen.<br />
Im Rahmen des laufenden Benchmarkings<br />
an unserer Abteilung wird neben des Screenings<br />
der Mobilität, der Selbsthilfefähigkeit,<br />
der Kognition und der Stimmungslage jeder<br />
Patient ebenso einem Ernährungsassessment<br />
zugeführt: Jedenfalls wird neben dem<br />
Body-Mass-Index zumindest in den ersten<br />
drei Tagen ein Einfuhrprotokoll geführt – bei<br />
gefährdeten Patienten solange wie nötig.<br />
Die MNA-Kurzform als Vortest wird erhoben<br />
und ein geriatrisch zugeschnittenes Basislabor<br />
bestimmt. Bei erfassten Risikopatienten<br />
(MNA ≤ 11) wird eine Bioimpedanzanalyse<br />
angeschlossen und bei Bedarf eine gezielte<br />
Diätberatung hinzugezogen.<br />
So wiesen im Jahre 2009 61% der Patienten<br />
eine manifeste Mangelernährung bzw. ein<br />
Malnutritionsrisiko auf, 28% hatten einen BMI<br />
< 22 kg/m 2 . Nachgewiesenermaßen steigt<br />
das Risiko für eine Mangelernährung mit<br />
zunehmendem Alter noch weiter an: Von den<br />
70-bis 80-jährigen waren 53% malnutriert,<br />
bei den 80- bis 100-jährigen waren es bereits<br />
63%.<br />
Norm Mild Mäßig Schwer<br />
Albumin (g/l) 35 - 45 30 - 40 23 - 29 < 22<br />
Transferin (g/l) 2,5 - 4 1,8 - 2,4 1 - 1,7 < 1<br />
Cholinesterase (E/ml) > 7 5 - 6,9 3 - 4,9 < 2,9<br />
Präalbumin (mg/l) 250 - 400 120 - 249 100 - 119 < 100<br />
Retinol-Bindung-Protein (mg/l) 50 - 60 39 - 49 30 - 38 < 30<br />
Lymphozytenzahl / mm 3 1.800 - 4.000 1.000 - 1.799 500 - 999 < 500<br />
Quantifizierung der Malnutrition anhand von Erhährungsparametern.<br />
Modifiziert nach Morley et al, 1995; aus Biesalski et al, Ernährungsmedizin, 2004.<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Zusammenfassung<br />
Ein erheblich hoher Prozentsatz der älteren<br />
Patienten weist Hinweise für eine Mangelernährung<br />
auf. Ein konsequentes Ernährungsassessment<br />
hilft, gefährdete Patienten zu<br />
erkennen und mögliche auslösende Ursachen<br />
zu minimieren. Es dient ebenso der Planung<br />
von individuellen Interventionsmöglichkeiten.<br />
Für ein weiteres therapeutisches<br />
Vorgehen ist meist eine interdisziplinäre<br />
Therapie inklusive Zahn- und Prothesenbehandlung,<br />
Diätologie, Logopädie, Ergotherapie,<br />
Physiotherapie, Psychologie, soziale<br />
Eingliederung sowie eine adäquate Schmerz-<br />
und Krankheitsbehandlung mit angepasster<br />
Medikamentenverabreichung und –verordnung<br />
nötig.<br />
Literatur<br />
(1) SENECA Studie 1984, Edington 1996, Constans<br />
2000, Pirlich et al 2006.<br />
(2) Robbins LJ: Evaluation of weight loss in the<br />
elderly. Geriatrics 1989; 44: 31-7.<br />
(3) ESPEN Guidelines 2006<br />
(4) DGEM – Leitlinie „Enterale Ernährung“<br />
(5) AKE – Empfehlungen für die enterale und Parenterale<br />
Ernährung des Erwachsenen, Version 2008 /<br />
2010<br />
(6) Benchmarking in der Geriatrie<br />
21
Evidenzbasierte Medizin<br />
Mag. <strong>Dr</strong>. Karl cERNIc, MAS<br />
Bereichsleiter Außenkliniken<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel: +43(0)463/538-0<br />
karl.cernic@kabeg.at<br />
22<br />
foto@beigestellt<br />
Evidence-based medicine<br />
Aufgrund ihres wissenschaftlichen Charakters<br />
und stringenten Bewertungskriterien<br />
hat die EBM in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung<br />
mittlerweile einen Standard<br />
gesetzt an dem die Wirksamkeit diagnostischer<br />
und therapeutischer Maßnahmen<br />
gemessen wird. 1<br />
In Bezug auf EBM und Geriatrie taucht oftmals<br />
die Frage auf, ob dies überhaupt zusammenpasst,<br />
besonders in der konkreten Auseinandersetzung<br />
mit leitliniengestützter Diagnostik<br />
und Therapie.<br />
Die Geriatrie befasst sich mit der medizinischen,<br />
pflegerischen, therapeutischen und<br />
psychosozialen Versorgung und muss dabei<br />
die Überbehandlung (Polypragmasie), als<br />
auch die Unterbehandlung (Nihilismus) vermeiden.<br />
Eine Ablehnung von EBM ist hierbei<br />
möglicherweise ebenso ein Risiko, wie das<br />
Risiko einer Unterbehandlung. Mit der derzeit<br />
aktuellen Situation im Gesundheitswesen,<br />
die mehr Qualität und dies in Verbindung mit<br />
erhöhter Kostentransparenz fordert, rückt<br />
auch die Diskussion um die Umsetzung von<br />
EBM im Bereich der Geriatrie immer mehr in<br />
den Vordergrund. 2<br />
Anders als in den meisten Fachbereichen<br />
stellt die Anwendung der EBM im Bereich der<br />
Geriatrie die Kliniker vor besonderen Herausforderungen,<br />
da in der Versorgung von geriatrischen<br />
Patienten in vielerlei Hinsicht, sowohl<br />
die Diagnostik, Therapie als auch die Prävention<br />
betreffen, offene Fragen bestehen. Ein<br />
Teil der Fragen lässt sich mit der Anwendung<br />
von EBM, basierend auf einer guten Evidenzlage,<br />
trotz der erheblichen Heterogenität in<br />
der bisherigen Versorgung beantworten. Ein<br />
nicht unerheblich größerer Anteil an Fragen<br />
ist jedoch aufgrund der nachfolgend dargestellten<br />
speziellen Herausforderungen,<br />
mit den vor allem älteren Patienten in Studien<br />
bzw. Studien für Hochbetagte, nur teilweise<br />
bzw. unvollständig zu lösen. Dieser<br />
Umstand darf aber nicht dazu führen, dass<br />
aus der Konsequenz der Nichtverfügbarkeit<br />
wissenschaftlicher Evidenz auf dem maximalen<br />
Niveau auf die Nichtbeantwortbarkeit<br />
einer Frage geschlossen wird. Vielmehr ist<br />
die Fähigkeit des <strong>Arzt</strong>es gefordert, dass dieser<br />
sein Handeln auf Basis einer schwächeren<br />
aber vorhandenen Evidenz aufbaut und<br />
sich der Grenzen bewusst ist, die eine solche<br />
Handlungsweise mit sich bringt. 3<br />
Spezielle Hausforderung der EBM<br />
im Bereich der Geriatrie<br />
Es bestehen bezüglich der verfügbaren externen<br />
Evidenz Probleme in der Verfügbarkeit<br />
von Studien mit geriatrischen oder funktionellen<br />
Endpunkten.<br />
Häufig angewandte therapeutische Verfahren<br />
der Geriatrie wurden bisher nicht adäquat<br />
untersucht.<br />
Obwohl die Gruppe der älteren Menschen<br />
eine Großzahl der tatsächlich behandelten<br />
Patienten ausmacht, zeigt sich in Studien,<br />
dass die Gruppe der älteren Probanden,<br />
obwohl eine gute Datenlage vorhanden ist,<br />
deutlich unterrepräsentiert ist. Der Anteil an<br />
älteren Menschen nimmt in unserer Gesellschaft<br />
immer mehr zu, jedoch hat sich an der<br />
Präsentation der klinischen Studien in den<br />
letzten zehn Jahren nichts geändert. So wird<br />
die reale Situation, besonders die Lebenserwartung<br />
von erfolgreich alt gewordenen<br />
Menschen, unterschätzt. Zudem wird die<br />
oft verminderte funktionelle Reserve älterer<br />
Menschen, die unter den besonderen Belastungen<br />
einer Erkrankung oder unter der entsprechenden<br />
Therapie sichtbar werden und<br />
somit für die Beurteilung von Komplikationen<br />
eine erhebliche Bedeutung gewinnen<br />
können, wenig berücksichtigt. 4<br />
Im Folgenden sind die Grenzen<br />
der Umsetzbarkeit von EBM in der<br />
Geriatrie dargestellt:<br />
Forschungslücken<br />
In Bezug auf die Forschungslücken 5 ist festzustellen,<br />
dass die vorliegende Evidenzlage für<br />
die Therapie und Diagnostik bei älteren Men-
in der Akutgeriatrie<br />
schen schlecht ist, bis auf eine geringe Zahl<br />
an guten Studien. Bei der Literaturrecherche<br />
(z. B. Medline Recherche) fällt die Diskrepanz<br />
zwischen dem Durchschnittsalter der Patienten<br />
in den Studien und den tatsächlich im<br />
klinischen Alltag zu behandelnden Patienten<br />
auf. Warum der Ausschluss älterer Patienten<br />
in Studien erfolgt, welche auch in renommierten<br />
Zeitschriften veröffentlicht wurden, lässt<br />
sich nicht erkennen, beispielsweise werden<br />
alte Patienten in Studien zu Osteoarthrose<br />
oder des M. Parkinson, häufig Erkrankungen<br />
des höheren Lebensalter, kaum bzw. sehr alte<br />
Patienten nicht berücksichtigt. 6<br />
Umsetzung durch Ärzte<br />
Bezüglich der Umsetzung durch Ärzte fällt<br />
auf, dass ein rigider Ausschluss von Patienten<br />
mit relevanten Komorbiditäten in großen<br />
randomisierten, kontrollierten Studien (RCT),<br />
stattfindet, dies sorgt für eine mangelnde<br />
Übertragbarkeit bzw. Generalisierbarkeit.<br />
Diese Entwicklung ist auf die Dominanz der<br />
jeweiligen Fachdisziplinen zurückzuführen<br />
(z. B. Neurologie oder Kardiologie), die weitgehend<br />
darauf verzichten einen Geriater bzw.<br />
geriatrisches Wissen bereits bei der Studienplanung<br />
hinzuzuziehen. 7<br />
Die Grenzen von RCT's<br />
Die Grenzen von RCT’s sind anhand von 10<br />
Punkten zusammengefasst, wobei Eingangs<br />
zu erwähnen ist, dass die medizinische Versorgung<br />
von älteren Patienten erstreckt sich<br />
in weiten Teilen auch auf organisatorische<br />
Aspekte:<br />
1. Studienpatienten sind nicht repräsentativ<br />
für den Alltagspatienten<br />
2. Studienpatienten sind sorgfältig ausgewählt<br />
3. Studien benutzen strikte Ein- und Ausschlusskriterien<br />
4. Die Intensität und Qualität der Interventionen<br />
in Studien spiegeln die Wirklichkeit<br />
nicht wider<br />
5. Ärzte handeln unter Studienbedingungen<br />
anders<br />
6. Das Informations- und Datenmanage-<br />
ment während der Studie unterscheidet<br />
sich von der Alltagssituation<br />
7. Placebokontrollierte Studien stehen in<br />
vielen Fällen keine realistischen oder<br />
durchführbare Praxis im ärztlichen Alltag<br />
dar<br />
8. Die Ergebnisse sind so nicht in der Realität<br />
erzielbar<br />
9. Statistische Signifikanz bedeutet nicht klinische<br />
Relevanz<br />
10. Die Studiendauer ist im Allgemeinen zu<br />
kurz 8<br />
Ethik und Evidenz<br />
In Zusammenhang mit Ethik und Evidenz<br />
ist anzumerken, dass die Themen der Rationalisierung<br />
und Rationierung 9 von Gesundheitsleistungen<br />
immer mehr in den Vordergrund<br />
treten. Auf der einen Seite wird der<br />
<strong>Arzt</strong> bezüglich der Individualrationierung, d.<br />
h. Vorenthaltung von Leistungen dem Patienten<br />
gegenüber, vor große ethische Probleme<br />
gestellt, was eine massive Konfliktsituation<br />
heraufbeschwört und auf der anderen<br />
Seite wird durch die generelle Verknappung<br />
der Ressourcen im Gesundheitsbereich ein<br />
Verteilungsstreit auf gesellschaftlicher Ebene<br />
ausgetragen. In Anbetracht dieser Diskussion<br />
muss vor einer impliziten, nicht expliziten<br />
Altersrationierung im Sinne einer vermeintlich<br />
vergeblichen Ausgabe, da der Patient zu<br />
alt sei, gewarnt werden. Vielmehr ist gefordert,<br />
dass Entscheidungen über die Verteilung<br />
auf Basis der verfügbaren Daten betreffend<br />
den Nutzen, Aufwand und Schaden der<br />
einzelnen Interventionen getroffen werden.<br />
Geriatrische Interventionen sind momentan<br />
noch in der Forschung unterrepräsentiert<br />
und lassen den Spielraum für Entscheidungen<br />
zunehmend kleiner werden. So muss das<br />
Bewusstsein in der Bevölkerung, als auch bei<br />
den Heath <strong>Prof</strong>essionals geschaffen werden,<br />
dass Krankheiten mit Funktionsverlust im<br />
Alter nicht normal sind, sondern Krankheiten<br />
die eine Therapie erfordern und nicht einen<br />
irreversiblen schicksalhaften Altersschaden<br />
darstellen. 10<br />
Literatur:<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
(1) Vgl. Kunz R./ Thalau F./ Jonitz G./ Hammerstein<br />
J.: Evidenzbasierte Medizin – Eine Lücke wird<br />
geschlossen – Erstmals wird ein Aufbaukurs nach<br />
dem EbM-Curriculum angeboten; S. A2166 – 2167<br />
in: Deutsches Ärzteblatt; Nr. 101; Heft 31 – 32; 2004.<br />
(2) Vgl. Wrobel N./ Borchelt M.: Evidenzbasierte<br />
Medizin und Geriarie; DRG-Kompetenzteam Geriatrie;<br />
2006.<br />
(3) Vgl. Pientka L./ Friedrich C.: Evidenz-basierte-<br />
Medizin – Probleme und Anwendung in der Geriatrie;<br />
S. 102 – 110 in: Zeitschrift für Gerontologie und<br />
Geriatrie; Nr. 33; Steinkopff Verlag; 2000.<br />
(4) Vgl. Friedrich C. in Köbberling J.: Innere Medizin<br />
und Geriatrie – Grenzen, Ergänzungen, Überschneidungen<br />
– Bericht über eine gemeinsame Arbeitstagung<br />
von Internisten und Geriatern; S. 99: 269 – 272<br />
in: Medizinische Klinik; Nr. 5; Urban & Vogel; München;<br />
2004. Vgl. Cassel C. K./ Leipzig R./ Harvey J.<br />
C./ Larson E. B./ Meier D. E.: Geriatric Medicine – An<br />
Evidence-Based Approach; Fourth Edition; Springer<br />
Verlag; 2003.<br />
(5) Vgl. Amrhrein L./ Backes G. M.: Alter(n)sbilder und<br />
Diskurse des Alter(n)s – Anmerkung zum Stand der<br />
Forschung; S. 104 – 111 in: Zeitschrift für Gerontologie<br />
und Geriatrie; Steinkopff Verlag; Nr. 40; 2007.<br />
(6) Vgl. Pientka L./ Friedrich C.: Evidenz-basierte-<br />
Medizin – Probleme und Anwendung in der Geriatrie;<br />
S. 102 – 110 in: Zeitschrift für Gerontologie und<br />
Geriatrie; Nr. 33; Steinkopff Verlag; 2000.<br />
(7) Vgl. Pientka L./ Friedrich C.: Evidenz-basierte-<br />
Medizin – Probleme und Anwendung in der Geriatrie;<br />
S. 102 – 110 in: Zeitschrift für Gerontologie und<br />
Geriatrie; Nr. 33; Steinkopff Verlag; 2000.<br />
(8) Pientka L./ Friedrich C.: Evidenz-basierte-Medizin<br />
– Probleme und Anwendung in der Geriatrie; S.<br />
102 – 110 in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie;<br />
Nr. 33; Steinkopff Verlag; 2000.<br />
(9) Unter Rationalisierung wird verstanden: „Die<br />
Vorenthaltung von Gesundheitsleistungen, deren<br />
Nutzen für die Patienten nicht nachgewiesen ist“<br />
und unter Rationierung: „Die Vorenthaltung von<br />
Gesundheitsleistungen, deren Nutzen für den Patienten<br />
nachgewiesen ist.“ Porzolt F: Rationierung<br />
und Rationalisierung im Gesundheitssystem; S. 608<br />
– 611 in: Münch. Med. Wschr.; Nr. 138; 1996.<br />
(10) Vgl. Pientka L./ Friedrich C.: Evidenz-basierte-<br />
Medizin – Probleme und Anwendung in der Geriatrie;<br />
S. 102 – 110 in: Zeitschrift für Gerontologie und<br />
Geriatrie; Nr. 33; Steinkopff Verlag; 2000.<br />
23
Spitals-Report<br />
Haus der Geriatrie –<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Georg</strong> PINTER<br />
Hohe Mitarbeiterzufriedenheit, ausgezeichnete<br />
Teamarbeit, Wertschätzung,<br />
Respekt und natürlich die gute fachliche<br />
Betreuung der Patienten. Das sind nur einige<br />
Gründe, warum das Haus der Geriatrie am<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee von der<br />
Fachzeitschrift „CliniCum“ im Dezember 2010<br />
zur besten Spitalsabteilung in Österreich<br />
gewählt wurde.<br />
Unsere Institution besteht aus der Akutgeriatrie/Remobilisation<br />
(AG/R) mit 76 stationären<br />
und 20 tagesklinischen Betten. Weiters<br />
betreuen wir in der ebenso im Haus integrierten<br />
Abteilung für chronisch Kranke bis zu 126<br />
chronisch und komplexkranke Patienten mit<br />
durchwegs hohen Pflegestufen (durchschittlich<br />
5,8).<br />
An der AG/R werden jährlich mehr als 1.100<br />
Patienten aufgenommen, an der Tagesklinik<br />
sind es etwa 330 Patienten pro Jahr. Die<br />
<strong>Prim</strong>äraufnahmen nehmen laufend zu und<br />
betragen derzeit 64% (österreichweit liegt<br />
diese Rate bei 23%). Wir können diese Daten<br />
insofern so genau angeben, da die AG/R am<br />
Klinikum Klagenfurt an einem österreichweiten<br />
Benchmarksystem teilnimmt, in welches<br />
wir schon 4.450 Datensätze eingespielt<br />
haben. In ganz Österreich beteiligen sich derzeit<br />
18 Institutionen an diesem System. Mehr<br />
als 25.500 Datensätze können von den österreichischen<br />
Geriatern eingesehen und in verschiedenen<br />
Dimensionen beleuchtet werden.<br />
Nicht aber nur die Teilnahme an solchen qualitätsverbessernden<br />
Maßnahmen, sondern<br />
die tägliche Arbeit aller unserer vielen MitarbeiterInnen<br />
an und für unsere Patienten<br />
zeichnet das Haus der Geriatrie aus.<br />
Diese wird in hoher Quantität und Qualität<br />
geleistet. Dies bezeugen auch die Belegstage<br />
im letzten Jahr: 25.600 in der AG/R, 5100 in<br />
der Tagesklinik und 41.000 in der Abteilung<br />
für chronisch Kranke.<br />
Unsere Patienten an der AG/R sind hochaltrig.<br />
43% der Frauen und 32% der Männer sind<br />
über 85 Jahre alt. Die Aufenthaltsdauer sinkt<br />
laufend und beträgt für Akutaufnahmen 15<br />
24<br />
Tage, für Sekundäraufnahmen 21 Tage. Die<br />
Entlassungsrate nach Hause liegt bei 67%.<br />
Das Aufgabengebiet in der AG/R ist breit<br />
gestreut, hat sich aber in den letzten beiden<br />
Jahren sehr stark in Richtung Herzinsuffizienztherapie,<br />
COPD und Nachbetreuung<br />
von Schenkelhalsfrakturpatienten verlagert.<br />
Aufgrund oben genannter Altersstruktur<br />
behandeln wir viele Menschen mit Frailty,<br />
der Umgang mit geriatrischen Syndromen<br />
ist unser täglicher Alltag. Das geriatrische<br />
Assessment ist gelebte Realität, wenngleich<br />
der Aufnahme- und Entlassungsdruck an<br />
unsere MitarbeiterInnen sehr hohe Ansprüche<br />
stellt.<br />
Wir sind stolz auf unser Sturzassessment, das<br />
wir, dank der engagierten Mitarbeit von vielen<br />
im Hause auf höchstem Niveau betreiben.<br />
Ebenso geling uns bei nahezu allen Patienten<br />
ein Ernährungsscreening, einem sehr wesentlichen<br />
Punkt für das weitere Gelingen der<br />
Therapie.<br />
Wir sind stolz auf unsere innerbetriebliche<br />
Kommunikationsstruktur, um die wir uns in<br />
angespannten ökonomischen Zeiten ständig<br />
und besonders bemühen müssen.<br />
In der Abteilung für chronisch Kranke wurden<br />
in den letzten Jahren Meilensteine in der<br />
Pflege, aber auch in der medizinischen Versorgung<br />
komplex kranker und betreuungsbedürftiger<br />
PatientInnen gesetzt (Wundmanagement,<br />
Validation, basale Stimulation,<br />
Sturzprophylaxe, Medikamentenmanagement).<br />
Speziell in der Betreuung von demenzkranken<br />
Menschen wurde ein gesamtes Team<br />
nach dem integrativen Pflegemodell nach<br />
Riedl ausgebildet. Die enge Vernetzung mit<br />
der Akutgeriatrie verhindert Akutverlegungen<br />
aus dem chron. Krankenbereich in Notfallambulanzen<br />
bzw. andere Akutabteilungen,<br />
da die meisten medizinischen Probleme<br />
vor Ort gelöst werden können.<br />
Die Abteilung für chronisch Kranke am Klinikum<br />
Klagenfurt am WS ist ein sehr wichtiges<br />
Kompetenzzentrum für instabile, komplexkranke<br />
Patienten, welche aufgrund der derzeit<br />
bestehenden Ressourcenverteilung ext-<br />
ramural in einem Pflegeheim herkömmlicher<br />
Art nicht adäquat betreut werden können.<br />
Mit der Einführung des Zusatzfacharztes für<br />
Geriatrie im Sommer 2011 wurde in der österreichischen<br />
Medizin ein höchst notwendiger<br />
und überfälliger Meilenstein gesetzt. Als eines<br />
der letzten Länder in der EU hat nunmehr<br />
auch Österreich der Geriatrie einen offiziellen<br />
Status im Konzert der verschiedenen Fächer<br />
gegeben. Dies ist für uns Geriater nicht nur<br />
eine Anerkennung der vielen Aufbauarbeit in<br />
den letzten Jahren, es ist vielmehr Ansporn,<br />
unsere Ideen und Gedanken in der Ausbildung,<br />
in den verschiedensten Fachgremien<br />
und letztlich auch in das Gesundheitssystem<br />
selbst einzubringen.<br />
Einige dieser Gedanken finden sie im Editorial<br />
dieser Ausgabe von <strong>Arzt</strong> und Patient, einige<br />
weitere möchte ich Ihnen hier noch mitgeben,<br />
da sie auch sehr eng mit der Philosophie<br />
im Haus der Geriatrie am Klinikum Klagenfurt<br />
verknüpft sind:<br />
Der geriatrische Patient ist ein biologisch älterer<br />
Patient, der durch altersbedingte Funktionseinschränkungen<br />
bei Erkrankungen akut<br />
gefährdet ist, zur Multimorbidität neigt und<br />
bei dem ein ganz besonderer Handlungsbedarf<br />
in rehabilitativer, somatopsychischer und<br />
psychosozialer Hinsicht besteht.<br />
Die Erarbeitung des Wissens um Besonderheiten<br />
der Diagnostik und Therapie älterer<br />
Menschen, das Einbeziehen medizinischer,<br />
psychologischer und soziologischer Inhalte<br />
führt uns zu einer integrativen Sicht eines<br />
sehr komplexen Wissens, welches uns hilft,<br />
kranke ältere Menschen nach akuten Ereignissen<br />
in einem hohen Prozentsatz wieder<br />
in ihre häusliche Umgebung zu integrieren<br />
(siehe oben).<br />
Chronisch Kranke sind in unserem Medizinsystem<br />
über- aber auch unter- und fehlversorgt.<br />
Sie stellen aber jetzt schon die Mehrzahl<br />
der Patienten und werden in Hinblick auf<br />
die demographische Entwicklung noch weiter<br />
zunehmen.<br />
Es geht also in Zukunft auch darum, ob die<br />
Begrenztheit, Unvollkommenheit und Sterb-
lichkeit des Menschen von uns anerkannt<br />
und wahrgenommen wird oder nicht. Entscheidend<br />
dabei ist unser eigener Zugang<br />
zum Thema, entscheidend ist aber auch ein<br />
neues Miteinander aller Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter im Gesundheitswesen.<br />
Neben diesen Aspekten der ethischen, aber<br />
auch gesellschaftspolitischen Bedeutung<br />
chronisch kranker, zumeist älterer Menschen<br />
kommen noch andere Aspekte zu tragen.<br />
Da ist einmal der monokausale Ansatz, der<br />
in der Akutmedizin der zweifelsohne zu sehr<br />
großen Erfolgen geführt hat und natürlich<br />
immer noch führt, der aber oft auch unkritisch<br />
den chronisch Kranken übergestülpt<br />
wird. Diese unsystematische und unkybernetische<br />
Vorgangsweise lässt die Komplexizität<br />
der Multimorbidität außer Acht.<br />
Dieses Erspüren und Erahnen von Kausalketten,<br />
auch das Innehalten an besonderen<br />
Wendepunkten, das Begleiten des Patienten<br />
in schwierigen Situationen ist eine von vielen<br />
Visionen der Geriatrie.<br />
So wird eine ältere Dame im Krankenhaus A<br />
wegen Humerusfraktur aufgenommen und<br />
entsprechend versorgt, nach wenige Tagen<br />
an das Krankenhaus B wegen Schmerzen<br />
thorakolumbal weitertransferiert, im weiterer<br />
Folge nach Zwischenstation auf eine<br />
Rehababteilung im Krankenhaus C zur Laminektomie<br />
aufgenommen. Nach erfolgreicher<br />
Operation entwickelt unsere (instabile) Dame<br />
eine tiefe Beinvenenthrombose, daraufhin<br />
eine fragliche Pulmonalarterienembolie, auf<br />
deren Behandlung mittels Antikoagulantien<br />
ein Bauchdeckenhämatom mit hypovolämischen<br />
Schock und pulmonaler Insuffizienz.<br />
Es folgt eine Tracheostomie und letztlich das<br />
Immobilisationssyndrom. Ein klassischer Fall<br />
eines sich negativ eskalierenden Regelkreises.<br />
Konstruiert? Eben nicht – ein realer Patient,<br />
wenn auch nicht alltäglich.<br />
Wer hat nicht schon Patienten mit leicht eingeschränkter<br />
kognitiver Funktion erlebt, die<br />
auf anticholinerge Substanzen mit akuter<br />
Verwirrtheit und massiver Verschlechterung<br />
ihres Allgemeinzustandes reagiert haben?<br />
Beispiele wie diese gibt es viele, vor allem<br />
im Bereich der Multimedikation und der sich<br />
daraus ergebenden Probleme.<br />
Hier besitzt die Geriatrie mit dem geriatrischen<br />
Assessment als interdisziplinären und<br />
multidimensionalen diagnostischen Prozess<br />
zur systematischen Erfassung der medizinischen,<br />
funktionellen und psychosozialen<br />
Probleme und Ressourcen bei betagten<br />
Patienten eine sehr mächtiges Instrument,<br />
um einen umfassenden Plan für die weitere<br />
Behandlung und Betreuung der Patienten<br />
aufzustellen.<br />
Die sich aus einem solchen Ansatz ergebende<br />
funktionelle Hierarchisierung von Diagnosen<br />
und der darauf abgestimmte Therapieplan<br />
sind ein wesentliches Kernelement der gesamten<br />
geriatrischen Medizin, ja es ist eigentlich<br />
die einzige geriatrische Technologie.<br />
Ein sehr wichtiger Faktor im Umgang und der<br />
erfolgreichen Bewältigung von komplexen<br />
Problemen ist die gemeinsame, strukturierte<br />
Arbeit im Team. Seine Interdisziplinarität und<br />
kommunikative Kompetenz trägt wesentlich<br />
zur erfolgreichen Arbeit in der Geriatrie bei.<br />
Für die Prozessqualität der geriatrischen<br />
Arbeit werden folgende Leistungen als essentiell<br />
erachtet:<br />
• Anamnese<br />
• Strukturierte geriatrische Anamnese<br />
• Geriatrische Sozialanamnese<br />
• Klinischer Status und Basisdiagnostik<br />
• Geriatrisches Assessment<br />
• Weiterführende Diagnostik<br />
Erst dieses strukturierte Vorgehen, die<br />
gemeinsame Aufarbeitung und in weiterer<br />
Folge auch Darstellung der Ergebnisse macht<br />
sytsemisches Handeln in der Geriatrie erst<br />
möglich. Dann wird die Suche nach einem<br />
Hebelpunkt für die Therapie möglicherweise<br />
auch gelingen und somit ein positives Ergebnis<br />
für den Patienten erzielt werden.<br />
Bernhard Issacs sprach 1975 bei seiner<br />
Antrittsvorlesung für den Geriatrielehrstuhl in<br />
Birmingham von den vier Giganten der Geriatrie,<br />
die Pflegebedürftigkeit begünstigen:<br />
Instabilität, Immobilität, Inkontinenz, Intellektueller<br />
Abbau.<br />
Viele geriatrische Syndrome wurden in den<br />
letzten Jahren beschrieben. Die Einteilung<br />
der geriatrischen Syndrome ist noch sehr<br />
uneinheitlich. Einen Überblick gibt beispiels-<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
weise der Fachausschuss „Qualitätssicherung<br />
in der Geriatrie“:<br />
Typische geriatrische Syndrome und Fähigkeitsstörungen<br />
sind demnach: Immobilitätssyndrom,<br />
Sturzkrankheit, Kommunikationsstörungen,<br />
Failure to thrive Syndrom,<br />
Posturale Hypotension, Inkontinenz, Fähigkeitsstörungen<br />
unklarer Genese mit/ohne<br />
soziale Beeinträchtigung.<br />
Bei Durchsicht der wichtigsten Syndrome<br />
neige ich eher zu folgender Einteilung, die<br />
den pathogenetischen und fachspezifischen<br />
Ansätzen vielleicht eher entspricht.<br />
Sie mögen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser<br />
einen kleinen Einblick in die Welt des Geriaters<br />
geben:<br />
Internistische Syndrome<br />
• Exsiccose und Elektrolytstörungen<br />
• Diabetisches Spätsyndrom<br />
• Herzinsuffizienz<br />
• PAVK<br />
• akute und chronische Knochen- und<br />
Gelenkserkrankungen<br />
Neurologische Syndrome<br />
• Zerebrovaskuläre Erkrankungen<br />
• Extrapyramidalmotorische Störungen<br />
• Kommunikationsstörungen<br />
• Demenz<br />
Psychiatrische Syndrome<br />
• Antriebsstörungen<br />
• Psychosen<br />
• Akute Verwirrtheitszustände<br />
Überlappungssyndrome<br />
• Frailty<br />
• Instabilität und Sturzkrankheit<br />
• Immobilisationssyndrom<br />
• Schwindel und Synkopen<br />
• Inkontinenz<br />
• Intellektueller Abbau<br />
• Iatrogene Störungen<br />
• Ernährungsstörungen<br />
• Dekubitus<br />
• Chronischer Schmerz<br />
• Schlafstörungen<br />
foto@beigestellt<br />
25
Bundesland-Konzept<br />
Palliativkonzept im Bundesland Kärnten<br />
<strong>Prim</strong>. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Rudolf</strong> LIKAR<br />
Im Bundesland Kärnten gibt es eine Palliativstation<br />
im Krankenhaus der Barmherzigen<br />
Brüder, St. Veit/Glan, mit 6 Betten; eine Palliativstation<br />
im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
mit 14 Betten und eine weitere Palliativstationmit<br />
9 Betten sowie zusätzlichen<br />
3 Palliativbetten im Landeskrankenhaus Villach.<br />
Für die Vernetzung im extramuralen Bereich<br />
gibt es drei mobile Palliative-Care-Teams,<br />
bestehend aus Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern<br />
und Psychologen. Sie stehen allen<br />
Beteiligten als kompetente Partner bei fachlichen<br />
Fragestellungen und Problemen zur<br />
Verfügung. Das Team übernimmt keinesfalls<br />
die Funktion des Hausarztes und der<br />
Pflegedienste, sondern bietet eine fachlich<br />
orientierte Ergänzung. Das Team versteht<br />
sich als Koordinationsstelle der einzelnen<br />
Berufsgruppen im Sinne der interdisziplinären<br />
Tätigkeit. Im Bereich der Palliativstation<br />
ist das mobile Team an der Schnittstelle zwischen<br />
intra- und extra muralem Bereich tätig.<br />
Mit der Zusammenarbeit aller<br />
Dienste soll eine möglichst<br />
lange und gute Versorgung der<br />
schwerkranken Patienten zu<br />
Hause gewährleistet werden.<br />
Eine wichtige Aufgabenstellung<br />
ist die Verbreitung der Palliatividee<br />
durch ein Angebot von<br />
Fort- und Weiterbildung sowie<br />
die Gründung von Qualitätszirkeln.<br />
Mobile Palliative-Care-Teams<br />
Aufgaben, Koordination, Bedeutung<br />
Die Aufgaben der mobilen Palliative-Care-<br />
Teams sind die Unterstützung und Betreuung<br />
von Patienten, die an unheilbaren Krankheiten<br />
leiden (für die keine das Grundleiden<br />
beeinflussbare Therapie besteht), die progredient<br />
und weit fortgeschritten sind und deren<br />
Lebenserwartung demzufolge absehbar<br />
26<br />
begrenzt ist.<br />
Das mobile<br />
Team berät<br />
auf Anforderung<br />
der<br />
primär versorgenden<br />
Ärzte und<br />
Pflegekräfte<br />
in ärztlichen,<br />
pflegerischen<br />
sowie psychosozialen Fragen der Palliativbetreuung<br />
und unterstützt die Koordination der<br />
Übergänge dieser Patienten zwischen stationärer<br />
und ambulanter Behandlung.<br />
Das mobile Team betreut diese Patienten in<br />
unmittelbaren Situationen, in denen es von<br />
den primär Betreuenden dazu ersucht wird.<br />
Sowohl die Angehörigen als auch der Patient<br />
haben die Möglichkeit, das mobile Palliativteam<br />
zu kontaktieren, und danach wird die<br />
Versorgung entsprechend dem Konzept eingeleitet.<br />
Das ambulante Palliativteam ist dafür verantwortlich,<br />
dass die Schnittstelle zwischen<br />
Krankenhaus und extramuralem Bereich<br />
funktioniert, dass die Patienten entweder<br />
nach Hause entlassen oder in ein Pflegeheim<br />
(Hospizeinrichtung) aufgenommen werden<br />
können. Die Koordination der ambulanten<br />
Palliativ-Care-Teams wird vom KLINIKUM<br />
Klagenfurt am Wörthersee aus gesteuert.<br />
Auch Leistungen betreffend psychologische<br />
Betreuung sind im ambulanten Bereich nach<br />
Anforderung möglich.<br />
Diesem mobilen Palliativteam kommt eine<br />
immense Bedeutung zu, da 90 % der Menschen<br />
über 65 Jahren (eigene Umfragedaten)<br />
zu Hause ihren letzten Lebensabschnitt verbringen<br />
wollen und 96 % Schmerzfreiheit bis<br />
zum Schluss fordern.<br />
Länderspezifische Implementierung<br />
Es wird in Österreich regional bedingt unterschiedliche<br />
Wertigkeiten der Bausteine des<br />
Hospiz- und Palliativbetreuungs- konzeptes<br />
geben. Wir in Kärnten entlassen 60–70 % der<br />
Patienten von den Palliativstationen<br />
nach Hause, nur 5<br />
% werden in eine Pflegeinstitution<br />
entlassen.<br />
Daher scheint es hier nicht<br />
sinnvoll zu sein, Hospizstationen<br />
in Pflegeheime<br />
zu implementieren. Unser<br />
Konzept wird es sein, die<br />
mobilen Palliativteams zu<br />
forcieren, d. h. verbesserte<br />
personelle Ausstattung, da es der Wunsch der<br />
Patienten ist, den letzten Lebensabschnitt zu<br />
Hause verbringen zu können.<br />
Mit dem Konzept der abgestuften Hospiz-<br />
und Palliativversorgung ist es Österreich<br />
(speziell in Kärnten) im Vergleich zu Europa<br />
gelungen, ein einzigartiges System zu implementieren,<br />
das auf die Wünsche der Patienten<br />
Rücksicht nimmt, indem die Ziele für die<br />
Patienten wie Verbesserung der Lebensqualität,<br />
Autonomie der Patienten und soziale<br />
Integration umgesetzt werden können.
Fallbeispiel –<br />
mobiles Palliativteam Villach<br />
Nachstehend wird ein Fallbeispiel angeführt,<br />
das die hervorragende Zusammenarbeit zwischen<br />
den mobilen Palliativteams, den niedergelassenen<br />
Ärzten und der Hauskrankenhilfe<br />
in Kärnten widerspiegelt.<br />
Die Betreuung der Patientin erfolgte durch<br />
das mobile Palliativteam Villach.<br />
Vorstellung einer 68-jährigen Patientin durch<br />
einen Facharzt im Krankenhaus Spittal/<strong>Dr</strong>au.<br />
Im Vorjahr wurde ein Pankreaskopf-CA diagnostiziert,<br />
nach Whipple operiert und konsekutiv<br />
chemotherapiert. Zum Zeitpunkt der<br />
Kontaktaufnahme mit dem mobilen Palliativteam<br />
Villach leidet die Patientin unter Inappetenz,<br />
starkem Gewichtsverlust und ausgeprägter<br />
Schwäche. Die im KH Spittal/<strong>Dr</strong>au<br />
begonnene parenterale Ernährung soll zu<br />
Hause fortgesetzt werden.<br />
Es folgen der Aufbau eines Betreuungsnetzwerkes<br />
gemeinsam mit den hausärztlichen<br />
Kollegen, Organisation von heimparenteraler<br />
Ernährung und die Schulung der Angehörigen.<br />
Nach einer stabilen Phase kommt es<br />
erneut zur AZ-Verschlechterung und zunehmenden<br />
Schmerzen.<br />
Im Rahmen einer stationären Verlaufskontrolle<br />
finden sich ein Lokalrezidiv und disseminierte<br />
Lebermetastasen. Die Patientin<br />
wird auf eine Schmerzpumpe eingestellt. Vor<br />
Entlassung übernimmt das mobile Team die<br />
Organisation der Leasingpumpe, fertigt die<br />
Rezeptvorlage für den betreuenden Hausarzt<br />
aus, kontaktiert die Wohnortapotheke und<br />
führt die notwendigen Schulungen durch.<br />
Die Therapie der während der palliativen<br />
Betreuung zu Hause auftretenden Symptome<br />
wird im Team diskutiert und entschieden.<br />
Ebenso die erforderlichen Dosisanpassungen<br />
der patientenkontrollierten Analgesie (PCA)<br />
und der Einsatz der parenteralen Ernährung.<br />
Die Angehörigen werden in allen medizinisch-pflegerischen<br />
Fragen beraten, engmaschig<br />
psychosozial betreut und in ihrer Trauer<br />
begleitet.<br />
Durch den optimierten Einsatz der zur Verfügung<br />
stehenden Ressourcen und gelebter<br />
Interdisziplinarität konnte die Patientin ihrem<br />
Wunsch gemäß zu Hause versterben.<br />
<strong>Arzt</strong> + <strong>Kind</strong><br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
<strong>Arzt</strong> + Patient<br />
Der + Gynäkologe / Urologe<br />
Der + Internist / Rheumatologe<br />
w w w . p r o m e t u s . a t<br />
27
Palliative Geriatrie<br />
OA <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>.Thomas fRÜHWALD<br />
Abteilung für Akutgeriatrie<br />
Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem<br />
Krankenhaus Rosenhügel<br />
Wolkersbergenstrasse 1, 1130 Wien<br />
thomas.fruehwald@wienkav.at<br />
28<br />
foto@beigestellt<br />
Palliative Geriatrie<br />
Die Geriatrie wirkt im Spannungsfeld zwischen der Todesnähe und dem Sichern einer<br />
Lebensqualität unabhängig von der Länge des noch verbleibenden Lebens, zwischen<br />
Förderung der Selbständigkeit und Autonomie einerseits und Gewährleistung von<br />
Schutz, Hilfe und Betreuung andererseits. Palliative Care soll nicht nur unmittelbar am<br />
Ende des Lebens stattfinden. Jede ärztliche und pflegerische Intervention sollte auch<br />
eine palliative Dimension berücksichtigen. Das gilt insbesondere für die Geriatrie, wo<br />
wir es mit Menschen zu tun haben, die sozusagen natürlich, „normal“ dem Tod näher<br />
sind als andere, jüngere Menschen. In der Geriatrie ist die Betreuungsqualität an der<br />
Grenze zwischen „Was kann getan werden“ und „Was soll getan werden“ angesiedelt,<br />
dies verlangt ein großes Maß an Empathie, hoher fachlicher geriatrischer, palliativmedizinischer<br />
und vor allem ethischer Kompetenz. Wenn die Geriatrie mehr sein soll<br />
als nur Innere Medizin für alte Menschen, so müssen für sie auch andere Dimensionen<br />
in Betracht gezogen werden, z.B. die Palliative Care, denn diese ermöglicht einen<br />
zusätzlichen positiven Zugang zum chronisch multimorbiden, oft kognitiv beeinträchtigten,<br />
pflege- und betreuungsabhängigen, sterbenden alten Menschen.<br />
Palliative Care ist integraler Bestandteil der<br />
Geriatrie, bzw. sollte es sein... Geriatrie darf<br />
aber nicht mit Palliative Care gleichgesetzt<br />
werden. Geriatrie beinhaltet das gesamte<br />
Spektrum der Gesundheits- und Krankheitsversorgung<br />
im Alter: Gesundheitsförderung<br />
für ein gutes, möglichst behinderungsfreies<br />
Altern, Risikoerkennung und Prävention von<br />
Krankheiten, kurative Therapie, Rehabilitation<br />
mit dem Ziel der Verlängerung der aktiven<br />
Lebenserwartung durch Kompression<br />
der Morbidität, sowie die Verbesserung der<br />
Lebensqualität.<br />
Die Geriatrie erhebt den Anspruch einer<br />
ganzheitlichen Sichtweise des älteren Menschen<br />
im körperlichen, seelisch-geistigen<br />
und sozialen Bereich vor einem funktionellen<br />
Hintergrund.. Mit zunehmendem Alter wird<br />
das Risiko des gleichzeitigen Vorhandenseins<br />
mehrerer Krankheiten und deren Folgen<br />
immer größer. Zusätzlich kommt es bei einem<br />
großen Anteil der im Rahmen der demografischen<br />
Entwicklung am schnellsten anwachsenden<br />
Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen<br />
zu einer mehrdimensionalen, eine<br />
Reihe von biologischen und medizinischen<br />
sowie psychologischen und sozialen Faktoren<br />
umfassenden funktionellen Fähigkeitsstörung,<br />
die zu einer Reduktion der Kapazität<br />
auf negative Krankheits- und Umgebungseinflüsse<br />
kompensatorisch zu reagieren führt.<br />
Diese Situation - Frailty bezeichnet - macht<br />
den interdisziplinären Zugang erforderlich,<br />
den die Geriatrie bietet, sie bedeutet das Auftreten<br />
typischer geriatrischer Syndrome vor<br />
dem Hintergrund der Multimorbidität, kombiniert<br />
mit Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit, Pflegeabhängigkeit,<br />
Reduktion von Autonomie<br />
und Selbständigkeit. In ihrer ausgeprägten<br />
Form ist Frailty jedoch irreversibel, sie gilt als<br />
Vorbote des Todes (Frühwald 2008).<br />
Um eine optimale kurative, rehabilitative und<br />
palliative Betreuung älterer Menschen zu<br />
gewährleisten ist es wichtig die Zeichen und<br />
Symptome des Syndroms Frailty und auch die<br />
damit assoziierte Prognose zu kennen. Es gibt<br />
einen wachsenden Konsensus über folgende<br />
klinische Zeichen von Frailty – sie machen in<br />
ihrer Summe das Vollbild des Syndroms aus<br />
(Fried 2001, Walston 2003):<br />
• Verminderte Muskelkraft, Sarkopenie<br />
• Gewichtsverlust<br />
• Herabgesetzte physische Belastbarkeit,<br />
rasche Ermüdung, mangelnde Ausdauer<br />
• Gleichgewichtsstörung, Gangunsicherheit<br />
Die meisten geriatrischen PatientInnen sind<br />
in ihrer globalen Funktionsfähigkeit behindert:<br />
sie können kognitiv behindert sein, sie<br />
haben ein fortschreitendes Autonomiedefizit,<br />
sie können physisch behindert, immobil sein,<br />
abhängig von Hilfe bei der Verrichtung der<br />
Aktivitäten des täglichen Lebens, sie haben
ein ebenfalls fortschreitendes Selbständigkeitsdefizit,<br />
viele sind emotional behindert,<br />
depressiv, sozial behindert, vereinsamt, isoliert,<br />
materiell arm - stehen am Ende ihres<br />
Lebens.<br />
Ein weiteres wesentliches Charakteristikum<br />
geriatrischer Patienten ist die Multimorbidität,<br />
sie bedingt, dass die Therapie der Einzelerkrankungen<br />
immer eine Beurteilung<br />
der Folgen für die anderen Erkrankungen<br />
als Voraussetzung haben muss, sie verlangt<br />
deshalb nach geriatrischem Wissen und Können,<br />
nach individuell angepassten diagnostischen<br />
und therapeutischen Strategien. Eine<br />
Heilung der einzelnen diagnostizierten Leiden<br />
ist oft unrealistisch. Viele diagnostische<br />
Maßnahmen hätten keine therapeutische<br />
Konsequenz, weil man sich auf wesentliche<br />
Diagnosen und Therapien beschränken muss<br />
– dazu ist eine gut fundierte Hierarchisierung<br />
der Probleme nötig - auch eine grundlegende<br />
palliativmedizinische Kompetenz.<br />
Beim jüngeren Patienten sind die Heilung,<br />
die Rückkehr in den Erwerbsprozess und die<br />
Wiedererlangung der Normalität der Funktionen<br />
Therapie- bzw. Rehabilitationsziele.<br />
Beim älteren Patienten gelingt es nur selten<br />
ein ähnlich formuliertes Ziel anzupeilen. Viel<br />
wichtiger ist es, sich bei der Therapie- und<br />
Rehabilitationsplanung an den individuellen<br />
Ressourcen und an einer Optimierung der<br />
Lebensqualität zu orientieren.<br />
Beim älteren Patienten, bei der älteren Patientin,<br />
steht die Erhaltung der Selbständigkeit<br />
und der selbst definierten Lebensqualität im<br />
Vordergrund. Dies ist die Perspektive der Geriatrie.<br />
Der palliative Aspekt der geriatrischen<br />
Betreuung ist unbedingt zu beachten weil es<br />
der Geriatrie primär um die Verbesserung der<br />
Lebensqualität alter kranker, hilfs- und betreuungsbedürftiger<br />
Menschen geht und nicht<br />
um eine möglicherweise sinnlose Lebensverlängerung.<br />
Es kommt oft zur Konfrontation<br />
des (Hippokratischen) Gebots, Leben zu verlängern<br />
mit dem ethischen Gebot, unerträgliches<br />
Leiden zu lindern.<br />
Verschiedene Dimensionen der Geriatrie<br />
erklären ihre Spezifität im Vergleich zu anderen<br />
medizinischen Fächern. Bereits 1991<br />
wurde formuliert dass es in der Geriatrie u.a.<br />
um die Chronizität und Irreversibilität von<br />
Krankheiten, Defiziten, Behinderungen der<br />
älteren Patientinnen und Patienten bis zu<br />
deren Tod ginge. Daraus soll nicht eine defizitäre<br />
Sichtweise resultieren, kein Resignationsdenken,<br />
kein therapeutischer und reha-<br />
bilitativer Nihilismus, sondern Offenheit für<br />
neue, auch kleine Hilfsansätze, vor allem eine<br />
moderne palliative Betreuung. Die Todesnähe<br />
ist eine weitere, die Geriatrie charakterisierende<br />
Dimension. Es gilt primär das Gebot,<br />
Leiden zu verhindern, zu lindern, es geht um<br />
aktive Sterbebegleitung, um palliative Therapie<br />
und Pflege, um das Zulassen des absehbaren,<br />
nicht mehr abwendbaren Todes, die<br />
Zuwendung des Geriaters, des geriatrischen<br />
Teams, soll dem sterbenden Menschen sicher<br />
sein (Bruder 1991).<br />
In der Geriatrie ist die Betreuungsqualität<br />
an der Grenze zwischen „Was kann getan<br />
werden“ und „Was soll getan werden“ angesiedelt.<br />
Für jüngere und gesunde Personen<br />
überlappen sich diese zwei Perspektiven oft<br />
vollständig. Bei älteren Menschen kann es<br />
einen Unterschied zwischen ihnen geben –<br />
die Gründe dafür können medizinische, ethische<br />
aber auch ökonomische sein.<br />
In der Geriatrie haben wir es mit Menschen<br />
zu tun, die progredient ihrer Autonomie und<br />
Selbständigkeit verlustig werden und hilfsbedürftig<br />
werden. Und vor allem mit Menschen,<br />
die am Ende ihres Lebens stehen.<br />
Der Tod wird nicht so sehr verdrängt, er wird<br />
eher akzeptiert, bis dann leben die geriatrischen<br />
PatientInnen, es ist aber nicht so, dass<br />
sie lediglich am Leben sind, sie haben ein<br />
Leben bzw. sie sollten es haben (Loewy 2000).<br />
Dies macht die Beschäftigung mit Fragen der<br />
Ethik, das Bemühen, nach Grundlagen für ein<br />
gerechtes, sinnvolles, rationales, gutes – in<br />
einem Wort ethisches Entscheiden und Handeln<br />
gerade in der Geriatrie so wichtig.<br />
Eine der Herausforderungen bei der Betreuung<br />
dieser Patienten am Ende ihres Lebens<br />
ist, sie nicht nur institutionell zu verwahren,<br />
sie sauber und satt zu halten, sondern ihnen<br />
die Möglichkeit zu geben, in ihrer letzten<br />
Lebensphase auch positive Qualitäten zu<br />
erfahren. Die Mehrheit der Menschen die<br />
sterben sind geriatrische Patienten und Patientinnen<br />
- trotzdem sind es gerade sie, die<br />
bisher am wenigsten von den Fortschritten<br />
der Palliative Care profitieren. Dafür ist es<br />
aber nie zu spät, insbesondere in der Geriatrie<br />
(Kojer 2002).<br />
Am Lebensende, spätestens im Verlauf des<br />
Sterbeprozesses, wird der Verzicht auf lebenserhaltende<br />
Maßnahmen bzw. deren Abbruch<br />
oft geboten sein. Der betreuende <strong>Arzt</strong>, die<br />
betreuende Ärztin, wird seitens der PatientInnen<br />
oder deren Angehöriger manchmal mit<br />
der Frage, dem Verlangen nach Sterbehilfe<br />
konfrontiert. Es ist dabei zu bedenken, dass<br />
dahinter meist der Wunsch steht, so nicht<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
mehr leben zu wollen, so seinen Angehörigen<br />
nicht mehr leben zu sehen. An diesem<br />
„so“ setzt die palliative Betreuung an. Aktive<br />
Sterbebegleitung ist Kernaufgabe der palliativen<br />
Geriatrie. Ärztliches Handeln stößt jedoch<br />
an ethische und in unserer Gesellschaft auch<br />
an juridische Grenzen, wenn es um aktive Formen<br />
der Sterbehilfe geht (Schweizerische Akademie<br />
der Medizinischen Wissenschaften 2008).<br />
In vielen Bereichen gibt es eine inhaltliche<br />
Übereinstimmung zwischen der Palliativmedizin<br />
und der Geriatrie: die Palliativmedizin<br />
ist wie die Geriatrie ein Querschnittsfach.<br />
Interdisziplinarität, die Arbeit im multidisziplinären<br />
Team sind Voraussetzungen für Qualität<br />
und Effizienz in ihren Bemühungen für die<br />
individuellen Patienten und gelten als obligatorische<br />
Struktur- und Leistungsstandards<br />
(Gesundheit Österreich GmbH 2008). In beiden<br />
Fächern werden die Bedeutung guter Symptomkontrolle,<br />
das Fehlen eines absoluten<br />
kurativen Anspruchs und Berücksichtigung<br />
der Situation der Angehörigen betont.<br />
Der Wechsel vom kurativen ins palliative<br />
Paradigma des ärztlichen Handelns ist in der<br />
Geriatrie integriert - im Sinne eines der von<br />
der deutschen Bundesärztekammer formulierten<br />
Grundsätze, nach welchem die Rolle<br />
des <strong>Arzt</strong>es grundsätzlich auf die Wiederherstellung<br />
der Gesundheit und die Erhaltung<br />
des Lebens ausgerichtet sein soll, jedoch bei<br />
schwerster Erkrankung, bei kurativ aussichtsloser<br />
Prognose eine Therapiezieländerung<br />
indiziert wäre. (Bundesärztekammer 2004).<br />
Die Polarität des kurativen und des palliativen<br />
Konzeptes wird in der Geriatrie überbrückt.<br />
Voraussetzung dafür ist die Akzeptanz der<br />
Tatsache, dass man nach der Aufgabe des<br />
kurativen Ziels dem betroffenen Menschen<br />
nicht nichts mehr anzubieten hat. Im Gegenteil:<br />
wenn intensive, invasive, Maßnahmen<br />
zur Lebensverlängerung aufhören, beginnen<br />
genauso intensive Maßnahmen der palliativen<br />
Betreuung um eine relativ gute Lebensqualität<br />
bis zuletzt zu ermöglichen (Morrison<br />
2003). In diesem Spannungsfeld zwischen der<br />
Todesnähe und dem Sichern einer Lebensqualität<br />
unabhängig von der Länge des noch<br />
verbleibenden Lebens, zwischen Förderung<br />
der Selbständigkeit und Autonomie einerseits<br />
und Gewährleistung von Schutz, Hilfe<br />
und Betreuung wenn die alten Menschen<br />
selbst nicht mehr dazu in der Lage sind andererseits,<br />
bewegen sich die in der Geriatrie<br />
agierenden Berufsgruppen.<br />
Wenn die Geriatrie mehr sein soll als nur<br />
Innere Medizin für alte Menschen, so müssen<br />
für sie auch andere Dimensionen in Betracht<br />
29
Palliative Geriatrie<br />
gezogen werden, z.B. die Palliative Care, denn<br />
diese ermöglicht einen zusätzlichen positiven<br />
Zugang zum chronisch multimorbiden,<br />
oft kognitiv beeinträchtigten, pflege- und<br />
betreuungsabhängigen, sterbenden alten<br />
Menschen - damit wirkt sie dem Burnout entgegen,<br />
oder einer entwürdigenden Behandlung<br />
der alten Menschen, vor allem wenn sie<br />
in Institutionen leben und sterben müssen.<br />
Es muss aber vor der Gefahr gewarnt werden,<br />
in einen therapeutischen (kurativen) Nihilismus<br />
abzurutschen und die Geriatrie als eine<br />
kostengünstige Möglichkeit sehen, um mit<br />
den Probleme der immer größer werdenden<br />
Gruppe der hochaltrigen Menschen fertig zu<br />
werden. Dazu würde auch ein ökonomischer<br />
und sozialer <strong>Dr</strong>uck beitragen, eine in der<br />
Gesellschaft aufkeimende Altersdiskriminierung<br />
(Ageismus)! Hochbetagte, kranke Menschen<br />
leiden oft nicht an primär das Leben<br />
limitierenden Erkrankungen und Prognosen<br />
zu ihrem Todeseintritt sind sehr unsicher.<br />
Nicht alle geriatrischen Patienten befinden<br />
sich in einer terminalen Phase. Es ist nicht<br />
immer eindeutig, dass auch in der Terminalphase<br />
ein kuratives Prozedere unangebracht,<br />
sinnlos ist, insbesondere wenn es um reversible,<br />
die Lebensqualität beeinträchtigende<br />
Situationen geht (Grob 2002).<br />
Es gibt eine gegenseitige Bereicherung von<br />
Geriatrie und Palliative Care, eine „Verzahnung“<br />
durch gemeinsame Themen (Goldstein<br />
2005). Eine Reihe von Themen, die der Palliative<br />
Care eigen sind, können in die Geriatrie<br />
integriert werden und sie bereichern, ebenso<br />
kann die Geriatrie mit ihr eigenen Themen<br />
die Palliative Care sinnvoll ergänzen. Die Geriatrie<br />
kann zum Beispiel von der Palliative Care<br />
die optimale Symptomkontrolle, die Bedeutung<br />
von guten Kommunikationsfähigkeiten<br />
„lernen“, die Palliative Care von der Geriatrie<br />
u.a. das Konzept von Frailty übernehmen, die<br />
Prinzipien des geriatrischen Assessments und<br />
Kenntnisse über typische geriatrische Syndrome<br />
und deren Behandlungsmöglichkeiten.<br />
Die Todesnähe der geriatrischen Patienten<br />
ergibt sich einerseits natürlich aus der demographischen<br />
Realität, andererseits aus dem<br />
mit dem Alter steigenden Risiko für chronische<br />
Multimorbidität und geringer werdenden<br />
Kapazitäten, mit zusätzlichen akuten<br />
Krankheitsereignissen fertig zu werden. Der<br />
Tod ist in der geriatrischen Patientenpopulation<br />
viel präsenter als in jeder anderen<br />
Altersgruppe. Eine zunehmende Zahl von<br />
Menschen erreichen das Endstadium chronischer<br />
Erkrankungen, wie Herzinsuffizienz,<br />
respiratorische und zerebrale Erkrankungen<br />
– auch terminale Krebserkrankungen,<br />
die bis jetzt die vorwiegende Indikation für<br />
Palliative Care darstellten. Dieser Tatsache<br />
sollten auch zukünftige Forschungsanstrengungen<br />
der Geriatrie und der Palliative Care<br />
gerecht werden. Die Forschung sollte z.B.<br />
die Frage der Prävalenz von Symptomen,<br />
welche die Lebensqualität bei geriatrischer<br />
Multimorbidität negativ beeinflussen beantworten,<br />
ebenso die Frage nach den Faktoren<br />
des psychischen und seelischen Wohlbefindens<br />
geriatrischer Patienten. Weitere noch<br />
nicht ausreichend erforschte Themen wären<br />
die notwendigen Veränderungen der intra-<br />
und extramuralen Versorgungsstrukturen,<br />
die Belastungssituation der „informellen“,<br />
als auch der professionellen Betreuerinnen.<br />
(Goldstein 2005).<br />
Der Geriater/ die Geriaterin muss die<br />
mehrdimensionalen Probleme der geriatrischen<br />
Patienten mit Feingefühl und gleichzeitig<br />
einem Wissen um deren Komplexität<br />
erfassen. Er/sie hilft Menschen, die an einem<br />
ganz schmalen Grat zwischen Selbständig-<br />
keit und Autonomie in relativem Wohlbefinden<br />
und der Präzipitation einer oft irreversiblen<br />
Kaskade von Krankheiten, funktionellen<br />
Behinderungen bis hin zur Pflegebedürftigkeit<br />
und zum Tod wandeln. Deshalb ist für<br />
die Geriatrie wie für die Palliativmedizin eine<br />
empathische, gütige Haltung von entscheidender<br />
Bedeutung. Diese kann man nicht nur<br />
auf Basis der Theorievermittlung erlernen.<br />
Geriatrie und Palliative Care sollten deshalb<br />
Eingang in die praktische medizinische Ausbildung<br />
finden.<br />
Literatur<br />
(1) Bruder J, Lucke C, Schramm A, Tews HP, Werner<br />
H (1991): Was ist Geriatrie-Expertenkommission<br />
der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und<br />
Geriatrie und der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie;<br />
Rügheim<br />
(2) Bundesärztekammer (2004): Grundsätze der<br />
ärztlichen Sterbebegleitung, Deutsches Ärzteblatt,<br />
101,19<br />
(3) Fried LP et al (2001): Frailty in Older Adults: Evidence<br />
for a Phenotype. J.Gerontol. 56A: M1-M11<br />
(4) Frühwald T (2008): Frailty. Böhmer F. (Hg.) Geriatrie.<br />
Der ältere Patient mit seinen Besonderheiten.<br />
Wien: Böhlau Verlag, 269-278<br />
(5) Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Geschäftsbereich<br />
ÖBIG (2008): Akutgeriatrie/Remobilisation<br />
in Österreichischen Krankenanstalten. Überarbeitete<br />
Fassung auf Basis des Österr. Strukturplans<br />
Gesundheit (ÖSG) 2006, im Auftrag der Bundesgesundheitsagentur<br />
Mai 2008<br />
(6) Goldstein NE, Morrison RS (2005): The Intersection<br />
Between Geriatrics and Palliative Care: A Call<br />
for a New Research Agenda, J.Am.Ger.Soc. 53:1593-<br />
1598<br />
(7) Grob D (2002): Neue Zürcher Zeitung, 1.6.2002<br />
(8) Kojer M (Hg.) (2002): Alt, krank und verwirrt. Einführung<br />
in die Praxis der Palliativen Geriatrie. Freiburg<br />
im Breisgau: Lambertus<br />
(9) Loewy EH, Loewy RS (2000): The Ethics of Terminal<br />
Illness: Orchestrating the End of Life; Kluwer<br />
(10) Morrison RS, Meier DE (2003): Geriatric Palliative<br />
Care. Oxford <strong>Univ</strong>ersity Press<br />
(11) Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften,<br />
www.samw.ch/docs/Richtlinien/d_<br />
RL_Lebensende.pdf - Zugriff am 21.9.2008<br />
(12) Walston JD, Fried LP (2003): Frailty and its<br />
Implications for Care. In: Morrison RS, Meier DE<br />
(Eds.): Geriatric Palliative Care, pp 93-109, New<br />
York, Oxford <strong>Univ</strong>. Press<br />
ben-u-ron Saft<br />
ZUSAMMENSETZUNG: 5 ml Sirup (= 1 Messlöffel) enthalten als Wirkstoff: 200 mg Paracetamol. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat<br />
(E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Natriumcitrat, Tragant, Zitronensäure-Monohydrat, Sahne-Aroma, Gelborange S (E 110), gereinigtes Wasser. ANWEN-<br />
DUNGSGEBIETE: Fieber- und Schmerzzustände, wie z.B. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, rheumatische Schmerzen,Menstruationsbeschwer<br />
den, Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten. GEGENANZEIGEN: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Schwere<br />
Leber- und Nierenfunktionsstörungen, genetisch bedingter Mangel an Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase (Symptom: hämolytische Anämie). Bei Säuglingen<br />
darf ben-u-ron Saft nicht ein gesetzt werden. Übermäßiger bzw. chronischer Alkoholgenuß (siehe 4.5) ATC-Code: N02BE01. INHABER DER ZULASSUNG: SIGMA-<br />
PHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien. REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: Rezeptfrei mit W2, apothekenpflichtig.<br />
Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft<br />
und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.<br />
ben-u-ron 1000 mg - Tabletten<br />
QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG: Wirkstoff: 1 Tablette enthält 1000 mg Paracetamol. Sonstige Bestandteile: Carboxymethylstärke<br />
Natrium (Typ A, Ph. Eur.), Povidon (K 29-32), Stearinsäure (Ph. Eur.), Talkum, Maisstärke, gefälltes Siliciumdioxid. ANWENDUNGSGEBIETE: Symptomatische Behandlung<br />
leichter bis mäßig starker Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) und/oder Fieber. GEGENANZEIGEN: Überempfindlichkeit<br />
gegen Paracetamol oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere hepatozelluläre Insuffizienz (Child-Pugh > 9). Genetisch bedingter Mangel an Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase<br />
(Symptom: hämolytische Anämie). Chronischer Alkoholmissbrauch. ATC-Code: N02BE01. INHABER DER ZULASSUNG: SIGMAPHARM Arzneimittel<br />
GmbH, 1200 Wien. REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: Rezept- und apothekenpflichtig<br />
Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft<br />
und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.<br />
30
Thema<br />
Geriatrische Probleme<br />
in der Neurochirurgie<br />
Indikationen & Therapiemodalitäten<br />
Organisation:<br />
<strong>Univ</strong>ersitätsklinik für Neurochirurgie Graz<br />
Tagungspräsident:<br />
<strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Michael Mokry<br />
Tagungssekretär:<br />
Ao. <strong>Univ</strong>.-<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. Hans Eder<br />
www.oegnc-jahrestagung.at<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
48. Jahrestagung der<br />
Österreichischen Gesellschaft für<br />
Neurochirurgie<br />
04.– 06.<br />
Oktober 2012<br />
Seifenfabrik Graz<br />
Angergasse 41–43<br />
8010 Graz<br />
Gesamtorganisation:<br />
2380 Perchtoldsdorf<br />
Donauwörther Straße 12/1<br />
T: +43 1 869 21 23 512<br />
F: +43 1 869 21 23 510<br />
office@conventiongroup.at<br />
www.conventiongroup.at 31
Notfallmedizin<br />
Von Anbeginn an: Im Notfall – Palliative Care<br />
OA <strong>Dr</strong>. christian WUTTI<br />
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee<br />
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin<br />
Feschnigstr. 11, 9020 Klagenfurt<br />
Tel.: +43(0)463/538-34303<br />
christian.wutti@kabeg.at<br />
32<br />
foto@beigestellt<br />
Notfälle bei Palliativpatienen stellen keine<br />
Seltenheit dar. Die häusliche Versorgung<br />
von Patientinnen im weit fortgeschrittenen<br />
Stadium ihrer Erkrankung ist stark in den<br />
Vordergrund gerückt. Die sich dabei einstellenden<br />
palliativen Krisensituationen werden<br />
primär durch den organisierten Rettungs-<br />
und Notärztinnendienst versorgt(1). Hierbei<br />
werden die Helfer zunehmend mit ethischen<br />
Fragestellungen, Patientenverfügungen<br />
und palliativen Notfallbögen konfrontiert.<br />
Schwerpunkte, diese Inhalte in bestehende<br />
Ausbildungen zu integrieren, nach entsprechenden<br />
Leitlinien zu agieren, gehören noch<br />
vertieft.<br />
Gemäß ihrer Definition verfolgen Notfall- und<br />
Palliativmedizin unterschiedliche Behandlungsziele:<br />
Ziel der Palliativmedizin ist es<br />
die Lebensqualität der Patienten und ihrer<br />
Angehörigen durch symptomkontrollierende<br />
Behandlung zu verbessern (2).<br />
Gegenstand der Notfallmedizin ist die Sicherung<br />
und Wiederherstellung der Vitalfunktionen,<br />
sowie die Verhinderung von Folgeschäden<br />
bei Notfällen aller Fachgebiete (3).<br />
Vor dem Hintergrund des demographischen<br />
Wandels, der sich ändernden gesellschaftlichen<br />
Strukturen, der Diskussion über<br />
den Umgang mit Sterben und Tod, wird die<br />
Betreuung von Menschen in ihrer letzten<br />
Lebensphase zu einer Herausforderung für<br />
das Gesundheitswesen und für unsere Gesellschaft.<br />
Dieser Entwicklung wurde in Österreich<br />
Rechnung getragen und die extramuralen<br />
Betreuungsangebote wurden sukzessive ausgebaut.<br />
Dadurch wird es vielen Menschen<br />
ermöglicht in ihrer weit fortgeschrittenen<br />
Erkrankung auch die terminale Lebensphase<br />
in privatem häuslichen vertrautem Umfeld zu<br />
durchleben. Dies entspricht auch meist dem<br />
formulierten Willen der Betroffenen (4).<br />
Vielfach verbindet sich bei Eintritt von palliativmedizinischen<br />
Krisensituationen, oder des<br />
tatsächlichen Sterbens, der Wunsch nach palliativer<br />
Behandlung und eine Ablehnung von<br />
Interventionen oder Maßnahmen, die eine<br />
Verlängerung des Leidensweges nach sich<br />
ziehen. Die idealisierte Vorstellung des friedvollen<br />
Sterbens zu Hause, wird in der Realität<br />
oft durch akut einsetzende Krisen und der<br />
sich daraus ergebenden aufwendigen medizinischen<br />
Behandlung in Frage gestellt.<br />
Palliativmedizinische Problemstellungen<br />
betreffen vor allem Schmerzexazerbationen,<br />
Angst, Unruhe, Dyspnoe, Krampfanfälle (5).<br />
Diese Symptome sind für die Betroffenen und<br />
ihre Betreuer zeitkritisch. Eigene Problemlösungsstrategien<br />
fehlen, daher besteht die<br />
Notwendigkeit externer Hilfe. Diese besteht<br />
in den meisten Fällen im hinzuziehen des<br />
organisierten Rettungsdienstes, mit regionalen<br />
Unterschieden. Je urbaner, desto mehr<br />
Rettungsdienst, je ländlicher desto mehr primäre<br />
Betreuer (Ärzte für AM etc.).<br />
Der Leitstellendisponent ist gemäß der strukturierten<br />
Notfallabfrage, durch die Stichworte<br />
wie: Bewußtseinsstörung, Atemnot,<br />
unstillbare Schmerzen etc., verpflichtet, der<br />
Ausrückordnung entsprechend, das Notarzteinsatzfahrzeug<br />
und den Rettungswagen<br />
einzusetzen.<br />
Eine Erhebung im Rahmen des Projektes „Palliative<br />
Care im Rettungsdienst“ (6) der Wiener<br />
Rettung hat gezeigt, dass etwa 5% der Notfalleinsätze<br />
im Jahr 2008, Palliativpatienten<br />
galten. Diese Zahlen konnten auch für Kärnten<br />
nach einer Befragung der Kärntner Notärzte<br />
bestätigt werden (7).<br />
Als größte Herausforderungen in der Versorgung<br />
von Palliativpatienten wurden Prozesse<br />
der ethischen Entscheidungsfindung, juristische<br />
Aspekte, Widersprüche zwischen Notfallmedizin<br />
und Palliative Care, der Umgang<br />
mit Angehörigen und Unklarheiten zwischen<br />
Angehörigen und Patienten gesehen.<br />
Weiters wird die Situation durch fehlendes<br />
Wissen über die Patienten, aber auch durch<br />
fehlendes Know-how der Notärzte erschwert.<br />
Als besonders belastend jedoch wird der<br />
organisatorische Mehraufwand, fehlende<br />
Zeitressourcen und vor allem fehlende<br />
Kooperationsstrukturen gesehen (6).<br />
Notfallmedizinisches Handeln in einer palliativmedizinisch<br />
geprägten Krisensituation
Tabelle 1: Übersicht über Systematic Reviews/Leitlinien (mod. nach Haberland, Müller-Busch)<br />
Thema Systwmatic Reviews/Leitlinien (Auswahl) Bemerkung<br />
Tumorschmerz Empfehlungen zur Therapie von Tumorschmerzen<br />
(9, 21)<br />
• Forschungsinstrumente und Schmerzerfassung<br />
• Durchbruchsschmerz<br />
• Behandlungsstrategien von Opioidnebenwirkungen<br />
• Morphin und alternative Opioide und deren<br />
Applikationswege in der Behandlung von<br />
Tumorschmerzen<br />
Dyspnoe Medikamentöse Therapie zur Behandlung der<br />
Atemnot bei onkologischen Patienten (10)<br />
Sauerstoff zur Behandlung der Atemnot bei<br />
onkologischen Patienten (11)<br />
Übelkeit und Erbrechen Efficacy of antiemetics in the treatment of nausea<br />
in patients with far-advanced cancer (12)<br />
Obstipation Ileus Behandlung von Obstipation bei Palliativpatienten:<br />
Empfehlungen für die klinische Praxis (13)<br />
Clinical practice recommendations for the<br />
management of bowel obstruction in patients<br />
with end-stage cancer (14)<br />
Verwirrtheit/ Delirium/<br />
Depression<br />
The Management of Depression in Palliative<br />
Care, European Clinical guidelines<br />
ist von rettungsmedizinischen Algorithmen<br />
geprägt und von der palliativmedizinischen<br />
und rechtlichen Expertise des Notfallteams<br />
abhängig (8).<br />
Der Notarzt steht in dieser speziellen Einsatzsituation<br />
im Konflikt zwischen einer - vermeintlich<br />
- zeit- und zuwendungsintensiven<br />
Behandlung und die, dem Notfallwesen entsprechende,<br />
schnelle Wiederherstellung der<br />
Einsatzbereitschaft.<br />
Dabei konnten Untersuchungen aus Deutschland<br />
klar belegen: Je erfahrener und speziell<br />
Therapieempfehlungen der<br />
Arzneimittelkommission<br />
der deutschen Ärzteschaft<br />
EAPC-Konsensusstatement*<br />
Systematic Review<br />
Syystematic Review und<br />
Metanalyse<br />
Systematic Review<br />
Leitlinie<br />
EAPC-Konsensusstatement*<br />
EAPC-Konsensusstatement*<br />
Fatigue Fatigue in palliative care patients – an EAPC<br />
approach (15)<br />
EAPC-Konsensusstatement*<br />
Angst --- Keine aktuellen Systematic<br />
Reviews<br />
Kommunikation/ Therapieentscheidungen<br />
Evidence-Based Recommendations for Information<br />
and Care Planning in Cancer Care (16)<br />
Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter. Patientenverfügung<br />
Palliative Sedierung EAPC recommended framework for the use of<br />
sedation in palliative care (17)<br />
End of life care<br />
pathways<br />
Ernährung und Flüssigkeit<br />
Evidence-Based Recommendations<br />
Seit 1. Juni 2006 Patientenverfügungs-Gesetz<br />
(PatVG)<br />
EAPC-Konsensusstatement*<br />
Prognostic Factors in Advanced Cancer Patients EAPC-Konsensusstatement*<br />
Liverpool care pathway of the dying (18,19) Handlungsempfehlung<br />
Künstliche Ernährung und Flüssigkeitsversorgung<br />
* EAPC Konsensstatement; www.eapcnet.org/publications/eapcpub.htm<br />
Leitfaden des Bayerischen<br />
Landespflegeausschusses<br />
2008<br />
ausgebildet die Notfallmediziner, desto weniger<br />
unangebrachte Klinikeinweisungen wurden<br />
veranlasst und auch der Zeitaufwand vor<br />
Ort zeigte zu sogenannten „alltäglichen“ Notfalleinsätzen,<br />
keine wesentliche Verlängerung<br />
(20). Ebenso zeigte sich: je besser die Patienten<br />
und die Angehörigen auf eine eventuelle<br />
Notfallsituation vorbereitet wurden, desto<br />
adäquater wurde mit der Rettungsleitstelle<br />
kommuniziert und desto treffender wurden<br />
die Einsatzindikationen gestellt.<br />
Grundvoraussetzung dafür ist eine vorab Vernetzung<br />
aller in der Betreuung Beteiligten:<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Stationäre Einrichtungen, primäre Betreuer<br />
(ärztlich und pflegerisch), ambulante Palliativdienste,<br />
Rettungsdienste und Angehörige.<br />
Diese Kooperation kann ein wesentlicher präventiver<br />
Faktor sein um aus Sicht der Betroffenen,<br />
adäquat und medizinisch-ethisch, dem<br />
PatientInnenwillen entsprechend, korrekt zu<br />
handeln.<br />
Eine schriftliche Stellungnahme der Patienten<br />
ist erstrebenswert und sollte rechtzeitig,<br />
vorausschauend formuliert werden und diese<br />
Willensdarlegung muss den NotfallhelferInnen<br />
zeitgerecht zur Verfügung stehen.<br />
Dafür geeignete Instrumente stellen die Patientenverfügung,<br />
die Vorsorgevollmacht oder<br />
ein „palliativer Krisenbogen“ z.B. der Göttinger<br />
Palliativnotfallbogen, (22) dar. Mit einer<br />
Patientenverfügung kann eine medizinische<br />
Behandlung im Vorhinein abgelehnt werden.<br />
Aus der Patientenverfügung soll hervorgehen,<br />
welche medizinischen Behandlungen<br />
abgelehnt werden. Dem Verfügungsrecht<br />
in einer Patientenverfügung sind Grenzen<br />
gesetzt: So ist etwa eine medizinische Notfall-Versorgung<br />
trotzdem gewährleistet („...,<br />
sofern der mit der Suche nach einer Patientenverfügung<br />
verbundene Zeitaufwand das<br />
Leben oder die Gesundheit des Patienten<br />
ernstlich gefährdet.“ – so der Gesetzestext).<br />
Eine schon errichtete Patientenverfügung<br />
kann jederzeit widerrufen werden.<br />
Damit die Patientenverfügung eines Patienten<br />
auch aufgefunden wird, ist sie in der Krankengeschichte<br />
zu dokumentieren. Darüber<br />
hinaus empfiehlt es sich eine Ausfertigung<br />
bei Angehörigen oder sonstigen nahe stehenden<br />
Personen, sowie dem Hausarzt usw.<br />
zu deponieren und eine Hinweiskarte mit sich<br />
zu tragen, welche auf das Bestehen einer Patientenverfügung<br />
hinweist.<br />
Im Bundesgesetz vom 1. 6. 2006 sind die Voraussetzungen<br />
für die Errichtung von Patientenverfügungen<br />
geregelt. Neben der (schon<br />
bisher) „beachtlichen Patientenverfügung“<br />
gibt es nun auch eine sogenannte „verbindliche<br />
Patientenverfügung“, an die ganz<br />
bestimmte Form-Voraussetzungen geknüpft<br />
sind:<br />
• eine umfangreiche ärztliche Aufklärung<br />
• die formelle Errichtung vor einem Notar,<br />
einem Rechtsanwalt oder bei der Patientenvertretung<br />
• eine Begrenzung der Wirksamkeit für max.<br />
fünf Jahre (verlängerbar)<br />
Beachtliche und verbindliche Patientenverfügungen<br />
unterscheiden sich dadurch, dass die<br />
beachtliche Patientenverfügung eine bloße<br />
33
Notfallmedizin<br />
Abb. 1: Göttinger Palliativnotfallbogen © C.H.R.Wiese<br />
Orientierungshilfe für die Ermittlung des Patientenwillens<br />
darstellt, während die verbindliche<br />
Patientenverfügung <strong>Arzt</strong> und Pflegepersonal<br />
ebenso wie Angehörige an den darin<br />
festgesetzten Willen des Patienten tatsächlich<br />
bindet.<br />
Solange man selbst seinen Willen unbeeinträchtigt<br />
äußern kann, bindet eine schriftliche<br />
Patientenverfügung nicht.<br />
Die notfallmedizinische Behandlung von<br />
Palliativpatienten in Krisensituationen unterscheidet<br />
sich nur unwesentlich im Vergleich<br />
zur übrigen Notfallmedizin. Auch in diesem<br />
speziellen medizinischen Fachgebiet gibt es<br />
klare Handlungsempfehlungen, die teilweise<br />
in Form von Leitlinienempfehlungen vorliegen<br />
und in Tabelle 1 gelistet sind.<br />
Aufgrund der bisherigen Entwicklung, ist<br />
anzunehmen, dass Notfallhelfer vermehrt<br />
mit palliativen Situationen konfrontiert werden.<br />
Daher ist zu fordern, dass palliativmedizinische<br />
Inhalte in bestehende Ausbildungen<br />
verstärkt integriert werden.<br />
Vor allem sind ethische, rechtliche und psychosoziale<br />
Aspekte zu beleuchten.<br />
Fazit für die Praxis:<br />
Die Begleitung und Therapie von Patienten<br />
in Notfallsituationen mit fortgeschrittenen<br />
Erkrankungen ist oft eine komplexe Herausforderung.<br />
Leitlinienempfehlungen können nicht<br />
immer direkt übertragen werden, sie sind<br />
aber als hilfreiche Basis zu sehen, um für<br />
einen Patienten die bestmögliche Therapie<br />
in seiner Erkrankungssituation zu finden.<br />
Die enge Zusammenarbeit zwischen stationären<br />
Einrichtungen, HausärztInnen, Palliative<br />
care Teams und Notärtzen ist auszubauen<br />
und sicher zustellen.<br />
Die Integration vorhandener palliativmedizinischer<br />
Strukturen in notfallmedizinische<br />
Bereiche ist zu fordern und zu vertiefen.<br />
Literatur<br />
(1) Wiese C.H.R et al, Supp Care Cancer Vol 18,10,<br />
1287-1292<br />
(2) WHO, Definition Palliative Care<br />
(3) Adams HA, AINS 2000:35; 485-486<br />
(4) Gronemeyer R, Heller A (2008) Sterben und Tod in<br />
Europa. In Heller A, Knop M (Hrsg.) Die Kunst des Sterbens,<br />
IFF Wien, <strong>Univ</strong>ersität Klagenfurt, Düsseldorf,<br />
Wien, S 110-125<br />
(5) Nauck F. et al, Lancet Oncol 2008; 9: 1086–91<br />
(6) Heimerl, Zdrahal, Projektgruppe palliative Care im<br />
Rettungsdienst, IFF Klagenfurt, Wien, 2008<br />
(7) Taubinger, Obmann, Likar: Palliativmedizin und<br />
Rettungsdienst - sind wir für den Notfall vorbereitet,<br />
Poster OPG 2011<br />
(8) Wiese C.H.R. et al, Anästhesist 2011, DOI 10.1007/<br />
s00101-010-1831-6<br />
(9) Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft.<br />
Empfeh- lungen zur Therapie von Tumorschmerzen.<br />
AVP 2007; 34, Sonderheft 1<br />
(10) Viola R, Kiteley C. Lloyd NS et al. The management<br />
of dyspnea in cancer patients: a systematic review.<br />
Support Care Cancer 2008;16:329–337<br />
(11) Uronis HE, Currow DC, McCrory DC et al. Oxygen<br />
for relief of dyspnea in mildly- or non-hypoxaemic<br />
patients with cancer: a systematic review and metaanalysis.<br />
Br J Cancer 2008;98:294–299<br />
(12) Glare P, Pereira G, Kristjanson LJ, et al. Systematic<br />
review of the efficacy of antiemetics in the treatment<br />
of nausea in patients with far-advanced cancer. Support<br />
Care Cancer (2004) 12:432–440<br />
(13) Larkin PJ, Sykes NP, Centero C, et al. The management<br />
of constipation in palliative care: clinical practice<br />
recommendations. Palliat Med 2008 Oct;22(7):796–<br />
807<br />
(14) Ripamonti C, Twycross R, Baines M, et al. Clinical<br />
practice recommendations for the management of<br />
bowel obstruction in patients with end-stage cancer.<br />
Supportive Care of Cancer 2001; 9: 223–233<br />
(15) Radbruch L, Strasser F, Elsner F, et al. Fatigue in<br />
palliative care patients – an EAPC approach. Palliat<br />
Medicine 2008; 22: 13–32<br />
(16) Walling A, Loren KA, Dy SM et al. Evidence-Based<br />
Recommendations for Information and Care Planning<br />
in Cancer Care. J Clin Oncol 2008;26:3896–3902<br />
(17) Cherny NI, Radbruch L, The board of the EAPC.<br />
European Association for Palliative Care (EAPC)<br />
recommended framework for the use of sedation in<br />
palliative care. Palliat Med 2009; 23(7):581–593<br />
(18) Ellershaw J. Care of the dying: what a difference<br />
an LCP makes! Pall Med 2007;21:365–368<br />
(19) Simon ST, Martens M, Sachse M, et al. Sterbebegleitung<br />
im Krankenhaus – erste Erfahrungen mit<br />
dem „Liverpool Care Pathway“ (LCP) in Deutschland.<br />
Dtsch Md Wochenschr 2009;134:1399–1404<br />
(20) Wiese CH.R. et al.;Support Care Cancer (2009)<br />
17:1499–1506<br />
(21) Azevedo São Leão Ferreira K, Kimura M, Jacobsen<br />
Teixeira M. The WHO analgesic ladder for cancer pain<br />
control, twenty years of use. How much pain relief<br />
does one get from using it? Support Care Cancer 2006;<br />
14 (11):1086–1093<br />
(22) C. Wiese et al.: Göttinger Palliativkrisenbogen:<br />
Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgung<br />
von ambulanten Palliativpatienten. DMW Deutsche<br />
Medizinische Wochenschrift 2008 ;133 (18): S. 972-976<br />
Durogesic 12μg/h-Depotpflaster, Durogesic 25μg/h-Depotpflaster, Durogesic 50μg/h-Depotpflaster, Durogesic 75μg/h-Depotpflaster, Durogesic 100μg/h-Depotpflaster.<br />
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Durogesic 12μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 5,25 cm² Wirkfläche enthält 2,1 mg Fentanyl (entsprechend 12,5 μg/h Wirkstoff-Freisetzung).<br />
Durogesic 25μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 10,5cm² Wirkfläche enthält 4,2mg Fentanyl (entsprechend 25μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 50μg/h: 1 Transdermales<br />
Pflaster mit 21cm² Wirkfläche enthält 8,4mg Fentanyl (entsprechend 50μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 75μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 31,5cm² Wirkfläche enthält 12,6mg<br />
Fentanyl (entsprechend 75μg/h Wirkstoff-Freisetzung). Durogesic 100μg/h: 1 Transdermales Pflaster mit 42cm² Wirkfläche enthält 16,8mg Fentanyl (entsprechend 100μg/h Wirkstoff-<br />
Freisetzung). Sonstige Bestandteile: Trägerschicht: Polyethylenterephthalat/Ethylvinylacetat-Folie, Orange (Durogesic 12μg/h)/Rote (Durogesic 25μg/h)/Grüne (Durogesic 50μg/h)/<br />
Blaue (Durogesic 75μg/h)/Graue (Durogesic 100μg/h) <strong>Dr</strong>ucktinte. Wirkstoffhaltige Schicht: Adhäsives Polyacrylat. Schutzfolie: Polyesterfolie, silikonisiert. Anwendungsgebiet: Durogesic<br />
12μg/h: Chronische Schmerzen, die nur mit Opiatanalgetika ausreichend behandelt werden können und einer längeren, kontinuierlichen Behandlung bedürfen bei Patienten ab 2<br />
Jahren. Durogesic 25-100μg/h: Chronische Schmerzen, die nur mit Opiatanalgetika ausreichend behandelt werden können und einer längeren, kontinuierlichen Behandlung bedürfen.<br />
Hinweis: In den durchgeführten Studien war eine Zusatzmedikation mit schnellfreisetzenden morphinhaltigen Arzneimitteln bei fast allen Patienten zur Kupierung von Schmerzspitzen<br />
erforderlich. Gegenanzeigen: Durogesic darf nicht angewendet werden: Bei kurzfristigen Schmerzzuständen, zB: nach operativen Eingriffen. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen<br />
den Wirkstoff Fentanyl, gegen andere Opiate oder gegen sonstige Bestandteile des Pflasters. Bei gleichzeitiger Anwendung von Monoaminooxidase (MAO) – Hemmern oder innerhalb von<br />
14 Tagen nach Beendigung einer Therapie mit MAO – Hemmern. Bei schwer beeinträchtigter ZNS-Funktion. Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die<br />
Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und sonstige Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und zu Gewöhnungseffekten und Abhängigkeit sind der veröffentlichten Fachinformation<br />
zu entnehmen. Abgabe: SG, apothekenpflichtig ATC Code: N02AB03. Zulassungsinhaber: Janssen-Cilag Pharma, 1232 Wien.<br />
34
Fachkurzinformation Seite 30<br />
<strong>Arzt</strong> <strong>Arzt</strong> Patient<br />
Patient<br />
Bei Schmerzen ... immer die passende Darreichungsform<br />
353
Sterbehilfe<br />
Sterbehilfe in Österreich – ein Kurzüberblick<br />
über den Rahmen des rechtlich Zulässigen<br />
<strong>Dr</strong>. iur. Nora WALLNER-fRIEDL<br />
ist Richteramtsanwärterin im Sprengel des<br />
Oberlandesgerichts Wien und wissenschaftliche<br />
Assistentin am Institut für Europäisches<br />
Schadenersatzrecht (ETL) der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften.<br />
Kontaktadresse:<br />
Oberlandesgericht Wien<br />
Schmerlingplatz 11, 1016 Wien<br />
Institut für Europäisches Schadenersatzrecht<br />
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften<br />
Reichsratsstraße 17/2, 1010 Wien<br />
Einleitung<br />
Ärzte stehen regelmäßig vor der Situation,<br />
dass es nicht (mehr) darum<br />
geht, Leben zu retten, sondern ihren<br />
Patienten das Sterben erträglicher zu<br />
machen. Dabei tauchen immer wieder<br />
Unsicherheiten auf, was rechtlich<br />
erlaubt und möglich ist und was nicht.<br />
Der vorliegende Beitrag soll dem juristischen<br />
Laien einen Kurzüberblick über<br />
die rechtlichen Bestimmungen und<br />
die Grenzen des rechtlich Zulässigen<br />
geben.<br />
36<br />
foto@beigestellt<br />
Wesentliche rechtliche<br />
Bestimmungen<br />
Das Spannungsfeld, in dem sich die Diskussion<br />
über die Sterbehilfe befindet, nämlich<br />
dem Konflikt zwischen dem Recht auf Leben,<br />
dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten<br />
und der Fürsorgepflicht des <strong>Arzt</strong>es, zeigt<br />
sich – sehr vereinfacht und reduziert – in folgenden<br />
Bestimmungen der österreichischen<br />
Rechtsordnung:<br />
Eines der höchstrangigen Rechtsgüter unserer<br />
Rechtsordnung ist das Leben, das von<br />
der Empfängnis (bedingt durch Lebendgeburt)<br />
bis zum Eintritt des (Hirn-)Todes<br />
geschützt werden soll. Das ergibt sich schon<br />
daraus, dass das österreichische Strafgesetzbuch<br />
(StGB) in seinem ersten Abschnitt über<br />
die diversen strafbaren Handlungen solche<br />
gegen Leib und Leben regelt (§§ 75 ff StGB).<br />
So sieht § 77 StGB die Strafbarkeit der Tötung<br />
auf Verlangen vor (1), § 78 StGB bestimmt die<br />
Strafbarkeit der Mitwirkung am Selbstmord.<br />
Zwar muss ein (erfolgloser) Selbstmörder<br />
in Österreich keine Bestrafung befürchten,<br />
jedoch derjenige, der dabei „mitwirkt“ (2) –<br />
die Beihilfe zum Selbstmord bzw. der assistierte<br />
Suizid sind somit in Österreich strafbar.<br />
All diese Delikte können nicht nur durch positives<br />
Tun, sondern grundsätzlich auch durch<br />
Unterlassen begangen werden (3). Auch die<br />
unterlassene Hilfeleistung ist gemäß § 95<br />
StGB strafbar.<br />
Diese Bestimmungen schützen das Rechtsgut<br />
Leben, es sind somit auch lebensverkürzende<br />
Maßnahmen an Sterbenden oder unheilbar<br />
Kranken grundsätzlich davon mit umfasst (4).<br />
Sinn und Zweck der strafrechtlichen Bestimmungen<br />
im Rahmen der Sterbehilfe ist,<br />
dass nicht immer nur von fürsorglichen und<br />
wohlmeinenden Ärzten und Angehörigen<br />
ausgegangen werden kann, sondern unter<br />
Umständen auch andere Interessen mit hinein<br />
spielen, wie die Aussicht auf ein rascheres<br />
Erbe, eine hohe Belastung durch die Pflege<br />
des Patienten, Ärzte, die neue Therapien<br />
erforschen oder Krankenkassen, die Geld sparen<br />
wollen.<br />
Gleichzeitig räumt unsere Rechtsordnung<br />
dem freien Willen des Einzelnen, also seiner<br />
Autonomie einen großen Stellenwert ein (5) .<br />
Der Mensch soll über seinen Körper und somit<br />
auch über sein eigenes Sterben bestimmen<br />
können und es soll ihm ein menschenwürdiges<br />
Sterben ermöglicht werden. Daher macht<br />
sich gemäß § 110 StGB strafbar, „[w]er einen<br />
anderen ohne dessen Einwilligung, wenn<br />
auch nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft,<br />
behandelt“ (eigenmächtige Heilbehandlung).<br />
Diese Regelung ist als Ausfluss<br />
des Prinzips des free and informed consent<br />
zu verstehen (6). Das Selbstbestimmungsrecht<br />
des Patienten, der einwilligungsfähig ist<br />
und dem <strong>Arzt</strong> (in welcher Form auch immer)<br />
mitteilt, dass er keine (weitere) Behandlung<br />
möchte, führt also dazu, dass der <strong>Arzt</strong> nicht<br />
nur nicht mehr behandeln muss, sondern<br />
gar nicht mehr behandeln darf. Der <strong>Arzt</strong> hat<br />
also nicht nur das Recht, sondern sogar die<br />
Pflicht, die Behandlung abzubrechen oder<br />
gar nicht erst zu beginnen (7), der Patient hat<br />
ein uneingeschränktes Vetorecht (8).<br />
Dem Prinzip der Autonomie und der Selbstbestimmung<br />
wird mittlerweile auch verstärkt<br />
durch das Patientenverfügungs-Gesetz<br />
(PatVG) (9) sowie durch die Regelungen über<br />
die Vorsorgevollmacht in den §§ 284f bis 284h<br />
ABGB (10) Rechnung getragen. Diese Regelungen<br />
dienen zum einen dem Schutz des<br />
Patienten, zum anderen bieten sie für den Fall<br />
der Einwilligungs-, Urteils- oder Äußerungsunfähigkeit<br />
des Patienten auch Klarstellung<br />
und Sicherheit für die behandelnden Ärzte,<br />
das Pflegepersonal und die Angehörigen.<br />
Durch die Patientenverfügung kann ein Patient<br />
für den Fall, dass er später nicht mehr einsichts-,<br />
urteils- oder äußerungsfähig ist, im<br />
Vorhinein die Ablehnung bestimmter medizinischer<br />
Behandlungen festlegen. Es muss<br />
aus der Patientenverfügung klar hervorgehen,<br />
welche medizinischen Behandlungen<br />
konkret abgelehnt werden bzw. muss sich<br />
das aus dem Gesamtzusammenhang der Verfügung<br />
ergeben (§ 4 PatVG). Zudem muss<br />
die Patientenverfügung nach dokumentierter,<br />
umfassender ärztlicher Aufklärung (§ 5<br />
PatVG) vor einem Rechtsanwalt, Notar oder<br />
einem rechtskundigen Mitarbeiter einer<br />
gesetzlich anerkannten Patientenvertre-
tung errichtet werden (§ 6 PatVG), um für<br />
jedermann, insbesondere aber natürlich für<br />
behandelnde Ärzte und Pflegepersonal verbindlich<br />
zu sein. Weiters muss sie, um ihre Verbindlichkeit<br />
zu behalten, spätestens alle fünf<br />
Jahre erneuert werden (§ 7 PatVG). Sie verliert<br />
jedoch nicht ihre Verbindlichkeit, solange der<br />
Patient sie mangels Einsichts-, Urteils- oder<br />
Äußerungsfähigkeit nicht erneuern kann (§<br />
7 Abs 3 PatVG). Selbst wenn die Patientenverfügung<br />
jedoch nicht alle dieser Kriterien<br />
erfüllt, ist sie dennoch beachtlich (§ 8 PatVG).<br />
Sie ist umso mehr zu beachten, je mehr sie<br />
den zuvor angeführten Kriterien entspricht (§<br />
9 PatVG). (11) Der Patient kann jedoch keine<br />
aktive Sterbehilfe anordnen, da eine Patientenverfügung<br />
unter anderem dann unwirksam<br />
ist, wenn ihr Inhalt strafrechtlich unzulässig<br />
ist (§ 10 Abs 1 Z 2 PatVG). Das ergibt sich<br />
auch eindeutig aus den Gesetzesmaterialien<br />
zum PatVG: „Der Entwurf berührt nicht die<br />
strafrechtlichen Verbote der Mitwirkung am<br />
Selbstmord und der Tötung auf Verlangen.<br />
Die so genannte „aktive Sterbehilfe“ bleibt<br />
weiterhin verboten. Ein in Form einer Patientenverfügung<br />
geäußerter Wunsch nach „aktiver<br />
Sterbehilfe“ ist auch künftig nicht beachtlich.“<br />
(12)<br />
Zu berücksichtigen ist weiters, dass eine Patientenverfügung<br />
jederzeit vom Patienten<br />
widerrufen werden kann. Es genügt, wenn<br />
der Patient zu erkennen gibt, dass er daran<br />
nicht mehr gebunden sein will (§ 10 Abs 2<br />
PatVG). Die Gesetzesmaterialien zum PatVG<br />
sehen hierzu ausdrücklich vor, dass der Patient<br />
die von ihm getroffene Verfügung jederzeit<br />
formfrei widerrufen kann und dafür nicht<br />
einmal erforderlich ist, dass er noch einsichts-<br />
und urteilsfähig ist. Der Widerruf kann nicht<br />
nur ausdrücklich (schriftlich oder mündlich),<br />
sondern auch durch ein schlüssiges Verhalten<br />
(also durch Handlungen, die eindeutig als<br />
Widerruf anzusehen sind) erklärt werden. Die<br />
Gesetzesmaterialien nennen hier als Beispiel<br />
die Vernichtung der Verfügung durch Zerreißen.<br />
(13)<br />
Auch durch eine Vorsorgevollmacht kann für<br />
den Fall einer späteren fehlenden Einsichts-,<br />
Urteils- und Äußerungsfähigkeit vorgesorgt<br />
werden, indem der Patient eine bestimmte<br />
Person zum Bevollmächtigten erklärt und<br />
die Angelegenheiten, zu deren Besorgung<br />
er bevollmächtigt, bestimmt anführt. Soll<br />
die Vorsorgevollmacht auch Einwilligungen<br />
in medizinische Behandlungen im Sinn des<br />
§ 283 Abs 2 ABGB – das sind medizinische<br />
Behandlungen, die gewöhnlich mit einer<br />
schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung<br />
der körperlichen Unversehrtheit oder<br />
der Persönlichkeit verbunden sind – umfassen,<br />
muss sie unter ausdrücklicher Bezeichnung<br />
dieser Angelegenheiten vor einem<br />
Rechtsanwalt, einem Notar oder bei Gericht<br />
errichtet werden (§ 284f ABGB).<br />
Unterscheidung aktive – passive<br />
– indirekte Sterbehilfe –<br />
was ist nun erlaubt? (14)<br />
Aktive Sterbehilfe (oft auch direkte aktive<br />
Sterbehilfe genannt) ist in Österreich weiterhin<br />
verboten und strafbar, auch wenn der<br />
Patient dies wünscht oder anordnet. Darunter<br />
ist jede aktive Form der Tötung auf Verlangen<br />
und der Beihilfe zum Suizid zu verstehen. Der<br />
Patient würde aufgrund der aktiven Handlung<br />
sterben. Es ist somit nicht nur verboten,<br />
einem Patienten beispielsweise Gift zu verabreichen<br />
und dadurch den Tod herbeizuführen,<br />
sondern auch, ihm zu helfen, sich selbst<br />
zu töten, indem ihm das Gift „bloß“ zur Verfügung<br />
gestellt wird, er sich dieses selbst verabreicht<br />
und sich damit selbst tötet. (15)<br />
Unter passiver Sterbehilfe wird das Unterlassen<br />
lebenserhaltender Maßnahmen bzw. das<br />
Zulassen des Sterbens auf Wunsch des Patienten<br />
verstanden. Der Patient stirbt aufgrund<br />
der Krankheit selbst, dem Sterbevorgang wird<br />
sein Lauf gelassen. Unterlassen wird also eine<br />
weitere künstliche, wenn auch medizinisch<br />
mögliche Lebensverlängerung. Dass diese<br />
Unterlassung der (weiteren) Behandlung<br />
oder Ernährung oft ein aktives Tun bzw. Tätigwerden<br />
bedeutet, wie das Abschalten oder<br />
die Entfernung eines Gerätes, also z.B. die<br />
Absetzung der künstlichen Beatmung oder<br />
künstlichen Ernährung oder das Abschalten<br />
einer Herz-Lungen-Maschine, ändert an der<br />
Zulässigkeit bzw. dem Gebot zu diesem Handeln<br />
nichts. (16) Derartiges Handeln ist nicht<br />
als aktive Sterbehilfe zu qualifizieren, sondern<br />
als Unterlassen einer medizinischen Behandlung<br />
und soll die Verlängerung von Leid vermeiden.<br />
Zwar ist der <strong>Arzt</strong> aufgrund seiner<br />
Garantenstellung gemäß § 2 StGB grundsätzlich<br />
zur Lebenserhaltung seines Patienten<br />
verpflichtet, diese Pflicht endet jedoch dann,<br />
wenn der Patient eine (weitere) Behandlung<br />
ablehnt. Die passive Sterbehilfe auf Wunsch<br />
des Patienten ist also straflos.<br />
Als indirekte Sterbehilfe (oft auch indirekte<br />
aktive Sterbehilfe genannt) wird die mögliche<br />
Verkürzung der Lebensdauer des Patienten<br />
durch Schmerz- und Symptomtherapie verstanden.<br />
Diese Verkürzung des Lebens des<br />
Patienten ist nicht intendiert und nicht Ziel<br />
der Therapie, sondern einfach eine mögliche<br />
Konsequenz und wird als sozial adäquat<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
angesehen. Es gibt kein Gebot der Lebenserhaltung<br />
um jeden Preis, vielmehr kann eine<br />
Schmerzbehandlung geboten sein, weshalb<br />
auch diese Form der Sterbehilfe nicht strafbar<br />
ist. (17) Es muss jedoch darauf geachtet<br />
werden, dadurch nicht in Wahrheit aktive<br />
Sterbehilfe zu betreiben (18). Es sind daher<br />
bei der Schmerztherapie die Regeln der<br />
medizinischen Wissenschaft einzuhalten und<br />
Schmerzmittelverabreichung in der medizinisch<br />
intendierten Dosierung vorzunehmen.<br />
(19)<br />
Solange der Patient einsichts-, urteils- und<br />
äußerungsfähig ist und seinen Willen, eine<br />
medizinische Behandlung abzubrechen oder<br />
gar nicht erst zu beginnen, kundtut, ist der<br />
<strong>Arzt</strong> an diese Willensäußerung gebunden<br />
und hat entsprechend zu handeln. Die Patientenautonomie<br />
begrenzt somit die ärztliche<br />
Behandlungspflicht. Der <strong>Arzt</strong> hat sich<br />
dem Wunsch des Patienten zu beugen, auch<br />
wenn er anderer Meinung ist, die Behandlung<br />
medizinisch indiziert ist und/oder der<br />
Patient ohne diese Behandlung voraussichtlich<br />
sterben wird. Es ist also auch ein objektiv<br />
unvernünftiger Wille des Patienten zu beachten<br />
und zu befolgen (20). Der Patient kann<br />
jedoch, wie bereits ausgeführt, keine aktive<br />
Sterbehilfe „anordnen“.<br />
Ist der Patient nicht mehr einsichts-, urteils-<br />
und äußerungsfähig, ist zu prüfen, ob eine<br />
antizipierte Patientenentscheidung, also eine<br />
Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht,<br />
mit der ein Stellvertreter bestimmt<br />
wurde, der (auch) zur Entscheidung über<br />
medizinische Behandlungen ermächtigt ist,<br />
vorliegt.<br />
Relativ unproblematisch stellt sich die Situation<br />
naturgemäß bei einer verbindlichen Patientenverfügung<br />
dar. Auch hier gilt, dass Ärzte<br />
und Angehörige an den Willen des Patienten<br />
gebunden sind und gegebenenfalls eine<br />
Behandlung gar nicht durchgeführt werden<br />
darf oder abgebrochen werden muss. Zudem<br />
ist zu beachten, ob der Patient durch sein Verhalten<br />
im nunmehr einwilligungsunfähigen<br />
Zustand allenfalls zum Ausdruck bringt, dass<br />
er die Patientenverfügung widerruft. Dass er<br />
dabei nicht mehr einsichts- und urteilsfähig<br />
ist, tut, wie bereits oben ausgeführt, dem keinen<br />
Abbruch.<br />
Etwas diffiziler wird es, wenn „nur“ eine<br />
beachtliche Patientenverfügung vorliegt. Je<br />
nachdem, in welchem Umfang die Patientenverfügung<br />
die formellen und inhaltlichen Voraussetzungen<br />
erfüllt, inwieweit sie also auf<br />
die spezielle Krankheit des Patienten Bezug<br />
nimmt, der Patient die Folgen seiner Verfügung<br />
im Zeitpunkt der Errichtung einschät-<br />
37
Sterbehilfe<br />
zen konnte, wie konkret er die medizinischen<br />
Behandlungen, die er ablehnt, benannte, wie<br />
umfassend die vorherige ärztliche Aufklärung<br />
war, wie häufig die Patientenverfügung<br />
erneuert wurde oder wie lange die letzte<br />
Erneuerung zurückliegt, ist der Wille des Patienten<br />
zu beachten. Die Gesetzesmaterialien<br />
zum PatVG sehen ausdrücklich vor, dass auch<br />
eine nicht verbindliche Patientenverfügung<br />
zu beachten ist, nämlich als ein wesentliches<br />
Hilfsmittel für die Ermittlung des relevanten<br />
Patientenwillens. (21)<br />
Auch bei einer Vorsorgevollmacht kann, wenn<br />
der Patient seinem Bevollmächtigten einen<br />
entsprechenden ausdrücklichen Auftrag<br />
erteilt hat und die Formvorschriften eingehalten<br />
wurden, eine Behandlungsablehnung<br />
durch den Vorsorgebevollmächtigten angeordnet<br />
werden, wenn dies eindeutig dem<br />
subjektiven Willen des Patienten Genüge<br />
tut. Bei Unsicherheiten, ob die Behandlungsverweigerung<br />
dem Wohl des Patienten und<br />
insbesondere seinem Willen entspricht, wäre<br />
jedoch ein gerichtliches Sachwalterschaftsverfahren<br />
einzuleiten (22). Die Rechtslage ist<br />
hier nicht so eindeutig, wie im Bereich der<br />
Patientenverfügung.<br />
Vor besondere Schwierigkeiten werden Ärzte<br />
und Angehörige gestellt, wenn ein Patient<br />
seinen Willen im Vorhinein nicht geäußert hat<br />
und dazu nun auch nicht mehr im Stande ist.<br />
Dann ist auf den mutmaßlichen Willen des<br />
Patienten abzustellen, wobei hier auf Grund<br />
des gebotenen Schutzes des Lebens entsprechende<br />
Zurückhaltung geboten ist. Auf<br />
diesen mutmaßlichen Willen ist dann abzustellen,<br />
wenn der Patient grundsätzlich eine<br />
ärztliche Behandlung verweigern könnte,<br />
dazu jedoch nicht mehr in der Lage ist, weil er<br />
handlungsunfähig ist, aber nach den Umständen<br />
des Falls und bei Würdigung der Interessenslage<br />
seine Ablehnung der Behandlung<br />
zu erwarten wäre.<br />
Wie ist dieser mutmaßliche Wille jedoch<br />
zu ermitteln? Die Gesetzesmaterialien zum<br />
PatVG sehen für den Fall einer bloß beachtlichen<br />
Patientenverfügung vor, dass „[i]n solchen<br />
Fällen […] aufgrund einer sorgfältigen<br />
Abwägung aller Umstände des Einzelfalls<br />
ermittelt werden [muss], wie der Betroffene<br />
in der gegebenen Situation entscheiden<br />
würde, wenn er seinen Willen noch kundtun<br />
könnte. Dazu muss nach Anhaltspunkten<br />
gesucht werden, die seinen Willen erkennen<br />
lassen. Diese Anhaltspunkte müssen bewertet<br />
und gegeneinander abgewogen werden.<br />
Dazu gehören etwa die religiöse oder<br />
weltanschauliche Überzeugung, persönliche<br />
Wertvorstellungen des Patienten, aber auch<br />
38<br />
frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen.“<br />
Eben solche Anhaltspunkte sind auch<br />
bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens<br />
heranzuziehen, wobei für die Einschätzung<br />
des mutmaßlichen Willens nach Ansicht des<br />
Obersten Gerichtshofs (OGH) primär entscheidend<br />
ist, ob und wie sich der Patient<br />
dazu vor Verlust seiner Einwilligungsfähigkeit<br />
mündlich oder schriftlich entsprechend<br />
geäußert hat. (23) Es darf bei der Beurteilung<br />
des mutmaßlichen Willens auch nur auf den<br />
Willen des Patienten abgestellt werden, nicht<br />
jedoch auf Wertvorstellungen der Gesellschaft<br />
oder anderer Personen, wie z.B. der<br />
Angehörigen, Sachwalter oder pflegenden<br />
Personen. (24)<br />
Auch eine Vertretungsbefugnis nächster<br />
Angehöriger nach § 284b ABGB im Rahmen<br />
der passiven Sterbehilfe reicht jedenfalls<br />
nicht aus, da gemäß Abs 3 dieser Bestimmung<br />
nur die Zustimmung zu medizinischen<br />
Behandlungen erteilt werden kann, sofern<br />
diese nicht gewöhnlich mit einer schweren<br />
oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen<br />
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit<br />
verbunden sind.<br />
Ist auch der mutmaßliche Wille nicht feststellbar,<br />
gilt im Zweifel der Grundsatz in dubio pro<br />
vita, also der Vorrang des Lebensschutzes und<br />
der Wille, durch eine medizinische Behandlung<br />
weiterzuleben. (25) Eine passive Sterbehilfe<br />
wäre also auch in diesem Fall strafbar<br />
(26), da ohne entsprechende Anhaltspunkte<br />
nicht davon ausgegangen werden kann und<br />
darf, dass der Patient eine solche will. Alle Entscheidungen<br />
haben sich mangels eines feststellbaren<br />
mutmaßlichen Willens am Wohl<br />
des Patienten zu orientieren. (27)<br />
Literatur<br />
(1) § 77 StGB: „Wer einen anderen auf dessen ernstliches<br />
und eindringliches Verlangen tötet, ist mit<br />
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren<br />
zu bestrafen.“<br />
(2) § 78 StGB: „Wer einen anderen dazu verleitet,<br />
sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist<br />
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf<br />
Jahren zu bestrafen.“ Anders ist die Rechtslage in<br />
Deutschland, wo es einen derartigen Straftatbestand<br />
gar nicht gibt, bzw. in der Schweiz, wo die Beihilfe<br />
zum Selbstmord nach Art 115 schwStGB dann<br />
straffrei ist, wenn sie nicht aus „selbstsüchtigen<br />
Gründen“ geschieht.<br />
(3) Ein Unterlassen ist allerdings gemäß § 2 StGB<br />
nur dann strafbar, wenn den Unterlassenden eine<br />
so genannte Garantenpflicht trifft, er also „zufolge<br />
einer ihn im besonderen treffenden Verpflichtung<br />
durch die Rechtsordnung dazu verhalten ist“ und<br />
außerdem „die Unterlassung der Erfolgsabwendung<br />
einer Verwirklichung des gesetzlichen Tatbildes<br />
durch ein Tun gleich zu halten ist“. Ärzte und Pflegepersonal<br />
nehmen regelmäßig diese Garantenstellung<br />
im Rahmen des Behandlungsvertrages ein.<br />
Siehe dazu Moos in WK-StGB² Vor §§ 75-79 Rz 31, 34.<br />
(4) Ausführlicher zu den strafrechtlichen Aspekten<br />
des Themas „Sterbehilfe“ siehe z. B. Moos in WK-<br />
StGB² Vor §§ 75-79; Burgstaller, Sterbehilfe und<br />
Strafrecht in Österreich, JAP 2009/2010/21, 200<br />
ff; Kert, Sterbehilfe. Der rechtliche Rahmen für das<br />
Ende des Lebens, JAP 2005/2006/34.<br />
(5) Das lässt sich unter anderem aus § 16 ABGB<br />
ableiten, der die generelle Anerkennung der Persönlichkeit<br />
als Grundwert regelt, also den Schutz<br />
der Persönlichkeit und der daraus abzuleitenden<br />
Rechte; siehe dazu z. B. Koch in KBB³ § 16.<br />
(6) Kopetzki, Einleitung und Abbruch der medizinischen<br />
Behandlung beim einwilligungsunfähigen<br />
Patienten. Praktische Auswirkungen der gesetzlichen<br />
Neuerungen durch PatVG und SWRÄG, iFamZ<br />
2007, 197 (198).<br />
(7) OGH 7.7.2008 6 Ob 286/07p, Punkt 3.4.1. Siehe<br />
dazu auch Bernat, Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht<br />
bei einwilligungsunfähigen Patienten,<br />
Anmerkungen zu OGH 7.7.2008, 6 Ob 286/07p, JBl<br />
2009, 129 ff (129); Burgstaller, JAP 2009/2010/21,<br />
202.<br />
(8) Kopetzki, iFamZ 2007, 198; Moos in WK-StGB²<br />
Vor §§ 75-79 Rz 32.<br />
(9) In Kraft seit 1.6.2006, BGBl I 2006/55.<br />
(10) Eingeführt durch das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz<br />
2006 (SWRÄG 2006), in Kraft seit<br />
1.7.2007, BGBl I 2006/92.<br />
(11) § 9 PatVG: „Eine beachtliche Patientenverfügung<br />
ist bei der Ermittlung des Patientenwillens<br />
umso mehr zu beachten, je eher sie die Voraussetzungen<br />
einer verbindlichen Patientenverfügung<br />
erfüllt. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen,<br />
inwieweit der Patient die Krankheitssituation, auf<br />
die sich die Patientenverfügung bezieht, sowie<br />
deren Folgen im Errichtungszeitpunkt einschätzen<br />
konnte, wie konkret die medizinischen Behandlungen,<br />
die Gegenstand der Ablehnung sind, beschrieben<br />
sind, wie umfassend eine der Errichtung vorangegangene<br />
ärztliche Aufklärung war, inwieweit die<br />
Verfügung von den Formvorschriften für eine verbindliche<br />
Patientenverfügung abweicht, wie häufig<br />
die Patientenverfügung erneuert wurde und wie<br />
lange die letzte Erneuerung zurückliegt.“<br />
(12) RV 1299 BlgNR 22. GP 1, siehe auch ebenda S<br />
9: „In Österreich ist die „aktive direkte Sterbehilfe“<br />
verboten. Das soll auch so bleiben. Deshalb ist der<br />
in einer Patientenverfügung artikulierte Wunsch<br />
nach einer solchen aktiven direkten Sterbehilfe<br />
nicht bindend.“<br />
(13) RV 1299 BlgNR 22. GP 9.<br />
(14) Die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt<br />
schlägt in ihrer Stellungnahme vor, von diesen<br />
Begriffen abzugehen: „Empfehlungen zur Terminologie<br />
medizinischer Entscheidungen am Lebensende",<br />
abrufbar unter http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=46713<br />
(3.3.2012).<br />
(15) Ein Vorgehen, wie es von Organisationen in der<br />
Schweiz (z. B. EXIT oder DIGNITAS) durchgeführt<br />
und legal Beihilfe zum Selbstmord geleistet wird, ist<br />
in Österreich also jedenfalls verboten und strafbar.<br />
Siehe dazu z.B. Moos in WK-StGB² Vor §§ 75-79 Rz 22.<br />
(16) Kopetzki, Abbruch lebenserhaltender Sondenernährung<br />
auf Grundlage des Patientenwillens<br />
auch bei „aktivem Tun“ nicht strafbar, RdM<br />
2010/91; Burgstaller, JAP 2009/2010/21, 201;<br />
Kopetzki, iFamZ 2007, 197.<br />
(17) Moos in WK-StGB² Vor §§ 75-79 Rz 23 ff.<br />
(18) Eisl, Medizinisch assistiertes Sterben als<br />
ethisch-rechtliche Herausforderung. Handlungs-<br />
und Entscheidungsprobleme bei Patientenautonomie<br />
und Palliativversorgung, iFamZ 2008, 136<br />
(137); Kert, JAP 2005/2006/34.<br />
(19) Kert, JAP 2005/2006/34; Moos in WK-StGB² Vor<br />
§§ 75-79 Rz 23.<br />
(20) Kopetzki, iFamZ 2007, 198.<br />
(21) RV 1299 BlgNR 22. GP 8.<br />
(22) Kopetzki, iFamZ 2007, 200.<br />
(23) OGH 6 Ob 286/07p, Punkt 3.4.6.<br />
(24) OGH 6 Ob 286/07p, Punkt 3.4.8.<br />
(25) OGH 6 Ob 286/07p, Punkt 3.4.4.<br />
(26) Moos in WK-StGB² Vor §§ 75-79 Rz 37.<br />
(27) Zum aktuellen Meinungsstand bezüglich<br />
unvertretener oder besachwalteter Patienten, der<br />
nötigen Entscheidungskriterien sowie einer allenfalls<br />
notwendigen gerichtlichen Genehmigung<br />
eines lebensbeendenden Behandlungsabbruchs<br />
siehe Kopetzki, iFamZ 2007, 201.
20. Jahrestagung<br />
der Deutschen Interdisiplinären Gesellschaft für<br />
Außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V.<br />
Termin<br />
26. 04. 2012 - 28. 04. 2012<br />
Tagungsort<br />
Kongress Palais, Horger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für<br />
Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.<br />
Zielpublikum<br />
Pneumologen, Pflegepersonal, Intensivmediziner, Spezialisten für Bronchialerkrankungen,<br />
Notfallmediziner, Internisten, Anästhesiologen<br />
Veranstalter Kontakt<br />
Karlsruher Straße 3, 79108 Freiburg, Deutschland<br />
Tel.: +49(0)761/69699-0<br />
Fax: +49(0)761/69699-11<br />
www.intercongress.de<br />
info.freiburg@intercongress.de<br />
Kursinhalte<br />
• Entwöhnung von der invasiven Beatmung<br />
• Neurotraumotologie und Neurologie<br />
• Was können wir lernen aus der Pädiatrie?<br />
• Organisation der Beatmung<br />
• Selbstbestimmtes Leben mit Beatmung<br />
• Palliation im Umfeld der Beatmungsmedizin<br />
• Workshops, Fallkonferenzen und Diskussionsforen<br />
für Betroffene, Angehörige und alle<br />
Berufsgruppen<br />
7. Beatmungssymposium<br />
39
Psychologische Aspekte<br />
Ausgewählte psychologische Aspekte der<br />
Betreuung Sterbender<br />
Mag. Thomas WIENERROITHER<br />
Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe<br />
Fachlicher Leiter Bereich Klinische Psychologie<br />
Landeskrankenhaus Vöcklabruck<br />
OÖ Gesundheits- und Spitals-AG<br />
<strong>Dr</strong>. Wilhelm-Bock-Straße 1, 4840 Vöcklabruck<br />
Tel.: +43 (0)50 55471 35200<br />
thomas.wienerroither@gespag.at<br />
40<br />
foto@beigestellt<br />
Einleitung<br />
Wenn man sich diesem Thema vorbehaltlos<br />
nähert, müsste man anmerken, dass wir<br />
immer sterbende Menschen betreuen, da ja<br />
mit dem Zeitpunkt der Zeugung der Kreislauf<br />
des Lebens impliziert ist – und somit auch das<br />
Sterben als „lebenslanger Prozess“. Als LeserIn<br />
werden Sie mir allerdings Recht geben, dass<br />
Sie sich in diesem Augenblick (hoffentlich)<br />
nicht so fühlen. Dies liegt vor allem daran,<br />
dass wir unsere eigene Endlichkeit, wenngleich<br />
kognitiv darüber bewusst, in eine<br />
ferne, nicht erreichbare Zukunft projizieren,<br />
was einem gewissen Selbstschutz dient. Wie<br />
aber verhält es sich bei Sterbenden?<br />
Eine mögliche Betrachtung des<br />
Sterbens aus Sicht des Patienten<br />
Folgt man dem salutogenetischen Denkmodell<br />
von Antonovsky, so besteht jeder Mensch<br />
aus einem Teil „Gesundheit“ und einem Teil<br />
„Krankheit“ (siehe Abb. 1).<br />
Abb. 1: vereinfachte graphische Darstellung des salutogenetischen<br />
Modells nach Antanovsky<br />
Je nach dem, worauf unsere Wahrnehmung<br />
primär gerichtet ist, kann sich dieses Bild<br />
ändern – was jedenfalls nach Diagnosemitteilung<br />
einer schweren Erkrankung nahezu<br />
immer passiert, sodass die Verführung groß<br />
wird, den Menschen über die Summe seiner<br />
Symptome – und damit über seine Krankheit<br />
zu definieren (siehe Abb. 2).<br />
So kann es vorkommen, dass sich die meis-<br />
Abb. 2: Salutogenese: Krankheit rückt in den Vordergrund<br />
der Wahrnehmung<br />
ten Gespräche und persönlichen Kontakte<br />
der PatientInnen nahezu ausschließlich um<br />
die gezeigten Krankheitsmerkmale drehen,<br />
und ein vorher gelebter Alltag kaum noch<br />
möglich wird. Aber auch körperliche Einschränkungen<br />
wie Fatique, Nausea, Schmerzen<br />
u. dgl. zwingen zu einer anderen Lebensführung<br />
und konfrontieren häufig mit dem<br />
Krank-Sein.<br />
In diesem Stadium haben Betroffenen immer<br />
noch den Strohhalm einer möglichen Heilung<br />
in der Hand, auch wenn dieser oft mit<br />
beschwerlichen und nebenwirkungsreichen<br />
Therapien verbunden ist. Dieses Bild kann<br />
sich mit der Prognosemitteilung „infaust“<br />
ändern, sodass nun die Themen Tod und Sterben<br />
in den Vordergrund rücken (siehe Abb. 3).<br />
Die eigene Endlichkeit und das damit verbundene<br />
Sterben werden zur erlebten Realität.<br />
Geisler L. (2008) schreibt: „Das emotionale<br />
Abb. 3: Adaption Salutogenese: Tod und Sterben werden<br />
in der Wahrnehmung vordergründig
Grundrauschen des Patienten wird bestimmt<br />
durch Ängste und Ungewissheiten, die im<br />
Gegensatz zur kognitiven Gewissheit des<br />
bald Sterbenmüssens stehen. Daraus können<br />
existenzielle Spannungsphasen resultieren,<br />
auf deren Bewältigung, ja nicht einmal mit<br />
deren Befassung, die wenigsten Menschen<br />
vorbereitet sind“ (Vgl. Caspar, M. & Weber, M.:<br />
2010, S.170)<br />
Dennoch findet man trotz durchgeführter<br />
Aufklärung häufig noch die Hoffnung auf Heilung.<br />
In einer Studie von Burns et.al. (2007)<br />
gaben beispielsweise nur 33% der befragten<br />
Palliativpatienten und deren engste Bezugsperson<br />
an, über den nicht-kurativen Zweck<br />
der durchgeführten Therapie Bescheid zu<br />
wissen. 15% der Paarungen gaben einen<br />
unterschiedlichen Kenntnisstand an.<br />
An dieser Stelle scheint es wichtig anzumerken,<br />
dass dies nicht ausschließlich an einer<br />
unvollständigen oder „zu schonenden“ Aufklärung<br />
liegen mag. Vielmehr ist man auch<br />
mit zum Teil unbewussten Verdrängungsmechanismen<br />
konfrontiert – und es wäre nicht<br />
nur unmenschlich, sondern psychologisch<br />
höchst fraglich, diese Abwehr mit allen Mitteln<br />
immer aufbrechen zu versuchen, da<br />
damit der Realität des Selbstschutzes als<br />
augenblicklich wichtige individuelle Überlebensstrategie<br />
nicht in ausreichendem Maße<br />
Rechnung getragen werden würde. Eine<br />
„mehrphasige“ Patienteninformation, welche<br />
diesem Phänomen Rechnung trägt, wäre hier<br />
wünschenswerter.<br />
Kübler-Ross (2001) beschrieb diese Adaptionsstufe<br />
als „Nicht-wahrhaben-wollen“. Folgt<br />
man ihren Ausführungen, so käme dann der<br />
Zorn, das Verhandeln mit dem Schicksal, die<br />
Depression und Schluss endlich die Zustimmung.<br />
Hier ist allerdings anzumerken, dass<br />
sie keineswegs ein präskriptives Modell,<br />
sondern ein deskriptives in den Raum stellte<br />
– der kolportierte Phasenverlauf muss also<br />
weder in dieser Reihenfolge stattfinden, noch<br />
treten alle Stufen tatsächlich auf. Dennoch<br />
möchte ich im Speziellen auf zwei erwähnte<br />
Phänomene eingehen: Zum einen dem Zorn:<br />
Psychodynamisch erklärt Kübler-Ross diesen<br />
als eine Wut auf den im Raum stehenden und<br />
unabänderlichen Tod (Kübler-Ross, E. 2001).<br />
Dieser ist aber nicht angreifbar, die Emotion<br />
ist jedoch spürbar und will ausagiert werden.<br />
Meist sind es tragende Beziehungen,<br />
welche dazu benutzt werden können, d.h. es<br />
sind mehrfach Angehörige und/oder nahe<br />
medizinische Betreuungspersonen damit<br />
konfrontiert. Eine gute und fundierte Psycho-<br />
edukation der Betroffenen kann hier für Entspannung<br />
sorgen.<br />
Zum anderen die Depression: Folgt man<br />
Kübler-Ross, so kann diese als ein Teil einer<br />
„gesunden“ psychischen Adaption an schwierige<br />
Lebensumstände verstanden werden,<br />
was sich auch im ICD-10 unter dem Begriff<br />
„Anpassungsstörung“ (F 43.2x) finden lässt<br />
(Dilling, H. et.al., 2005). Nach Martin Fegg<br />
(2012) ist die Prävalenz der Depression bei<br />
Palliativ-Patienten zwei bis viermal höher,<br />
als in der Normalpopulation. Aus psychologischer<br />
Sicht ist hier ein genaues differenzialdiagnostisches<br />
Vorgehen zur Unterscheidung<br />
zwischen adäquater (antizipatorischer)<br />
Trauer, Anpassungsstörung im Sinne einer<br />
nicht pathologischen Anpassungsleistung<br />
und einer behandlungsbedürftigen Depression<br />
unabdingbar (Fegg, M. 2012).<br />
Eine systemische Betrachtung<br />
Alle Menschen leben in Systemen, also in<br />
unterschiedlichen sozialen Verbindungen<br />
und Überschneidungen (Abb. 4 zeigt eine<br />
vereinfachte Darstellung).<br />
Dabei ist gut erkennbar, dass die helfenden<br />
Berufsgruppen idealerweise außerhalb dieses<br />
Systems stehen, sodass ein guter Über-<br />
Freunde<br />
Familie<br />
Patient<br />
Helfer /<br />
<strong>Prof</strong>essionisten<br />
Abb. 4: Vereinfachte Darstellung eines möglichen Patienten-Helfer-Systems<br />
blick gewährleistet werden kann. Gerade<br />
in der Arbeit mit totkranken und sterbenden<br />
Menschen bietet sich eine systemische<br />
Betrachtungsweise an, sodass nicht nur der<br />
Patient, sondern auch seine Lebensbereiche<br />
berücksichtigt werden können. Mag. Monika<br />
Brandstätter konnte in ihrem Beitrag an der<br />
letztjährigen Tagung der Deutschen Palliativgesellschaft<br />
in <strong>Dr</strong>esden gut zeigen, dass z.B.<br />
Angehörige kaum um Unterstützung bitten.<br />
Dies liegt großteils daran, dass es meist einen<br />
längeren Betreuungsprozess gibt, welcher<br />
sich u.U. schon über mehrere Jahre hinwegstreckt.<br />
Dabei vergessen Bezugspersonen<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
häufig auf eigene wichtige Bedürfnisse – sie<br />
versuchen sozusagen bestmöglich zu funktionieren<br />
(Brandstätter, M. 2010). Wenn aber<br />
Angehörige, Freunde und sonstige wichtige<br />
soziale Unterstützungen drohen wegzubrechen<br />
(z.B. Burnout), riskiert man den Verlust<br />
wichtiger notwendiger Ressourcen zur<br />
Bewältigung schwieriger Lebenssituationen,<br />
weshalb ein aktives Zugehen und Miteinbinden<br />
sowie ggf. Entlasten des gesamten Familiensystems<br />
notwendig scheint.<br />
Eine weitere Gefahr stellt eine zu große Nähe<br />
der <strong>Prof</strong>essionisten dar, vor allem wenn diese<br />
Teil des Systems werden (siehe Abb. 5).<br />
Dies birgt zum einen die Gefahr, dass Essentielles<br />
übersehen werden kann (z.B. die Rolle<br />
der Freunde und deren Familienbezug, Solidarisierung<br />
mit Konfliktparteien, etc.), zum<br />
Freunde<br />
Familie<br />
Patient<br />
Helfer /<br />
<strong>Prof</strong>essionisten<br />
Abb. 5: Vereinfachte Darstellung: Helfer als Teil des Patienten-Systems<br />
anderen riskiert man Übertragungs- und<br />
Gegenübertragungsphänomene, welche<br />
sich in diesem Kontext eher kontraproduktiv<br />
erweisen können, wie folgendes Helfer-<br />
Fallbeispiel von Tausch, D. (1993, S. 12) zeigt:<br />
„Ich hatte z.B.: ein Problem mit mir selbst<br />
gehabt. Zeitweise schien es, als ob sich der<br />
Zustand des Mannes tatsächlich zum Guten<br />
wenden könnte. In uns keimte gegen alle<br />
Vernunft so etwas wie Hoffnung auf das viel<br />
beschworene Wunder. Das war eine Zeit, in<br />
der ich selbst begann den Gedanken an den<br />
Tod zu verdrängen. Ich empfand fast wie eine<br />
Angehörige und hatte Furcht, wenn mir das<br />
Sterben dieses Mannes in den Sinn kam!“ Hier<br />
kann ein supervisorischer Prozess für eigene<br />
Klarheit sorgen, um die notwendige Linie<br />
zwischen empathischem Mitfühlen und Mitleiden<br />
wieder richtigzustellen.<br />
Mit dem Tod des Patienten kommt es zu einer<br />
Änderung des Systems – eine Lücke klafft auf,<br />
sodass eine Neuorientierung des gesamten<br />
Verbundes notwendig wird (siehe Abb. 6).<br />
Dies bedeutet häufig auch eine Neuaufteilung<br />
familiärer Aufgaben, Rollen und Tätig-<br />
41
Psychologische Aspekte<br />
Freunde<br />
Familie<br />
keiten, was durchaus vorbereitend mit allen<br />
Beteiligten vor dem Tod des Patienten aufgebaut<br />
werden kann, wenngleich dies ausschließlich<br />
im Verantwortungsbereich des<br />
Familiensystems liegt. Notwendig scheint<br />
hier die Unterstützung und Förderung einer<br />
offenen und ehrlichen gegenseitigen Kommunikation,<br />
die Schaffung eines wertfreien<br />
und wertschätzenden Raumes, sowie Psychoedukation<br />
und ggf. weitere Aufklärungsgespräche,<br />
sodass alle Beteiligten vom gleichen<br />
Wissensstand ausgehen können. In der Praxis<br />
erweisen sich hier Familienkonferenzen im<br />
Beisein des Patienten als hilfreich.<br />
Es zeigt aber auch die Notwendigkeit einer<br />
Nachsorge. Dies kann einerseits eine fundierte<br />
Trauerbegleitung beinhalten, aber<br />
auch Unterstützung im (Wieder-) Erlangen<br />
alltäglicher Fertigkeiten und Fähigkeiten.<br />
Umgang mit Belastungen<br />
Helfer /<br />
<strong>Prof</strong>essionisten<br />
Abb. 6: einfache systemische Betrachtung nach dem<br />
Ableben des/der PatientIn<br />
Einer Studie von Müller, M. et al. (2010)<br />
zufolge geben Mitarbeiter auf Palliativ-Care-<br />
Einheiten die in Abb. 7 angeführten Belastungen<br />
an, wobei der nichterfüllte Anspruch an<br />
die Palliativmedizin am Häufigsten genannt<br />
wurde, gefolgt von einer besonderen Beziehung<br />
zum Patienten.<br />
Unter dem nicht-erfüllten Anspruch an die<br />
Palliativmedizin gaben 22,5% psycho-soziale,<br />
21,5% medizinische, 20,6% Zeit-/Personalmangel,<br />
16% spirituelle, 11,7% pflegerische<br />
Gründe und 8,1% Probleme der Symptomkontrolle<br />
an.<br />
Dies weist darauf hin, dass vor allem im Psycho-Sozialen<br />
Bereich eine hohe Erwartungshaltung<br />
an Palliativ-Care zu bestehen scheint,<br />
was durchaus mit einer eigenen, vielleicht<br />
auch idealisierten Erwartung an ein besonders<br />
friedliches Sterben in Verbindung stehen<br />
kann. Durch die Nicht-Erfüllung dieses inneren<br />
Bildes kann es zur Infragestellung der eigenen<br />
42<br />
Weltsicht und damit zu psychischen Belastungen<br />
kommen.<br />
Müller M. (2007, S. 422) drückt dies wie<br />
folgt aus: „Im Kontext der beruflichen Arbeit<br />
bedeutet dies, zunächst anzuerkennen, dass<br />
nicht nur die Tatsache des Sterbens, sondern<br />
auch die individuelle Art und Weise des Sterbens<br />
eines Patienten nicht im Kompetenzbereich<br />
der helfenden Person liegt. Die Realität<br />
zu akzeptieren heißt auch, dass die jeweiligen<br />
Kommunikationsmuster eines Patienten, sein<br />
systemisches Eingebunden sein [sic] in die<br />
jeweils eigenen Umwelt, die Art, sein Sterben<br />
zu bewältigen oder auch genauso gut<br />
nicht zu bewältigen, vom Begleiter nicht nur<br />
erlaubt, sondern gewürdigt werden und dass<br />
nicht erwartet wird, dass der Patient den Tod<br />
des Begleiters stirbt, sondern seinen persönlichen,<br />
eigenen, ihm allein gehörenden Tod<br />
sterben darf. Der Anspruch des Begleiters<br />
an sich selber, mit seiner Arbeit, ja mit seiner<br />
ganzen Person zu einem besonders guten,<br />
friedlichen, spirituellen, versöhnten und<br />
annehmendem Sterben beizutragen, erhöht<br />
das Risiko eines erschwerten Umgangs mit<br />
Verlusten, die naturgemäß einen anderen<br />
Verlauf nahmen, ja nehmen mussten.“ Die<br />
Autorinnen empfehlen daher in ihrer Studie,<br />
dass palliativmedizinische Teams die eigenen<br />
Ansprüche an die eigene Praxis thematisieren<br />
und gegebenenfalls relativieren sollten (Müller,<br />
M. et al. 2010).<br />
Belastungen im Team<br />
Schuldgefühle<br />
Zeitdauer der Arbeit in alliativ Care<br />
kurze Begleitungsdauer (< 3 Tage)<br />
Erinnerung an Todesfälle im eigenen Umfeld<br />
Lebenskrisen<br />
unerwartetes Versterben<br />
Belastung von Kollegen<br />
besondere Beziehung zu Angehörigen<br />
Häufung von Todesfällen in einer Zeiteinheit<br />
besondere Beziehung zum Patienten<br />
Anspruch der Palliativmedizin<br />
Abb. 7: Belastungsfaktoren im Umgang mit Sterbenden nach Müller, M. et.al. (2010, S. 230)<br />
Abb. 8 zeigt Belastungssymtome im Team,<br />
wobei hier die Überredseligkeit am Häufigsten<br />
genannt wurde. Dies kann sich z.B. in<br />
langatmigen Ausführungen über Patienten in<br />
Teambesprechungen äußern, wo der pflege-<br />
bzw. therapierelevante Informationsgehalt<br />
minimal bis nicht mehr präsent ist. Aber auch<br />
Reizbarkeit und erhöhte Spannungen zwischen<br />
den Berufsgruppen können ein Hinweis<br />
auf ein „zu-viel-Tod“ im Team sein. Auch<br />
hier scheint ein externer supervisorischer<br />
Prozess hilfreich. Müller, M. et al. (2010) eruierten<br />
in ihrer Umfrage einen Wert von 4,4<br />
Todesfällen pro Woche, welcher als kritische<br />
Grenze wahrgenommen wurde, wobei auch<br />
die Abfolge einen Einfluss auf die subjektive<br />
Belastung habe, wonach eine unmittelbare<br />
Aneinanderreihung als beschwerender wahrgenommen<br />
werde.<br />
Mögliche Belastungssymptome<br />
von Helfern bei „so viel Tod“<br />
„Und wenn die Last nicht mehr tragbar und<br />
das Mitfühlen in Sarkasmus oder Unerreichbarkeit<br />
sich wandelt, dann ist es Zeit, dem<br />
eigenen Tod des Begleiter Daseins [sic] zuvorzukommen<br />
und innezuhalten“ (Schnegg, M.<br />
2000, zit. nach Müller, M. 2007, S. 420)<br />
Lang, K. (2006) führt in seiner Übersicht über<br />
mögliche spezifische Belastungsfaktoren in<br />
der Arbeit mit Sterbenden folgende Punkte<br />
an:<br />
• Miterleben von körperlichem und geistigem<br />
Verfall<br />
• Begrenztheit eigener Möglichkeiten<br />
• Schuldgefühle<br />
• Schwierige ethische Fragestellungen<br />
• Belastungen durch Patienten oder Angehörige
Ablehnung sonst üblicher Rituale<br />
kein Einlassen auf andere/neue Patienten<br />
keineUnterstützung<br />
Dienst nach Vorschrift<br />
Vorwürfe<br />
Verweigerung von Neuaufnahmen<br />
Sprachlosigkeit<br />
Rückzug<br />
vermehrte Streitigkeiten<br />
Zynismus<br />
erhöhte Spannungen zwischen den Berufsgruppen<br />
Reizbarkeit<br />
Überredseligkeit<br />
Abb. 8: Belastungssymptome im Team bei „zu-viel-Tod“ nach Müller, M. et.al. (2010, S. 230)<br />
• Sterben und Häufung von Todesfällen<br />
• Infrage stellen der eigenen Weltsicht<br />
Als mögliche Reaktionen der Begleiter auf die<br />
ständige Konfrontation mit Tod und Sterben<br />
benennt Müller, M. (2007, S. 421) folgendes:<br />
• Abwehrstrategien in Form kühl-professioneller<br />
Zu Gewandtheit [sic], d.h. sich nicht<br />
auf eine Beziehung einzulassen, aber das<br />
Notwendige an Pflege, Behandlung und<br />
Beratung zu leisten<br />
• Schuldgefühle wegen emotionaler Distanz<br />
• Verbrüderung und Verschwesterung mit<br />
Patienten (alles für sie tun)<br />
• Ideologisierung der Hospiz- und Palliativarbeit<br />
• Liebäugeln mit Euthanasiegedanken<br />
• Spiritualisierung der Erlebnisse (krampfhafte<br />
Überhöhung von Sterbeerfahrung in<br />
einen übergeordneten Kontext)<br />
• Extremes Sich-Versichern der eigenen<br />
Lebendigkeit als Gegenbewegung (Sexualisierung<br />
des Privatlebens, Suchtverhalten,<br />
Gewalt)<br />
• Ohnmacht und Überforderung<br />
• Schwärzester Humor<br />
• Verlassen des Arbeitsplatzes.<br />
Warum brennen nicht alle Helfer aus?<br />
Nach Durchsicht der angeführten möglichen<br />
Belastungsfaktoren ist es eigentlich verwunderlich,<br />
dass nicht jede/r BetreuerIn von<br />
todkranken und sterbenden Menschen ausbrennt.<br />
Und in der Tat nutzte der Großteil der<br />
von Müller, M. et.al. (2010) Befragten die Möglichkeit<br />
des Freitextes, explizit auf die persönliche<br />
Bereicherung ihrer palliativen Tätigkeit<br />
hinzuweisen.<br />
Das Infrage stellen der eigenen Weltsicht<br />
kann zu einem neuen, persönlich bereicherndem<br />
Bild im Sinne einer neuen Lebensphilosophie<br />
führen, wo Tod und Sterben an Schrecken<br />
verlieren und als Teil eines jeden Lebens<br />
wertgeschätzt und akzeptiert werden können.<br />
Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit<br />
kann auch als Anstoß einer Selbstreflexion<br />
dienen, sodass ein bewussteres und tieferes<br />
Leben möglich wird.<br />
Auch das Ermöglichen von Sterben in Würde<br />
sowie die intensive Begegnung mit Menschen<br />
in Grenzsituationen und das damit verbundene<br />
gegenseitige und tiefe Vertrauen<br />
wird von Helfern als bereichernd erlebt.<br />
Um all das zu ermöglichen erfordert es allerdings<br />
gewisser struktureller Rahmenbedingungen<br />
wie ausreichende zeitliche und personelle<br />
Ressourcen, Interdisziplinarität im<br />
Sinne einer gelebten gegenseitigen persönlichen<br />
und fachlichen Wertschätzung sowie<br />
der Möglichkeit der fachlichen und persönlichen<br />
Weiterbildung wie z.B.: in Form von<br />
Lehrgängen und Supervision – um nur einige<br />
zu nennen. (Wienerroither, T. 2010)<br />
Zusammenfassung<br />
Die kognitive Gewissheit der menschlichen<br />
Endlichkeit wird für schwerkranke und sterbende<br />
Menschen zur erlebten Realität. Die<br />
Themen Krankheit, Sterben und Tod rücken<br />
in den Vordergrund, sodass ein „normaler“<br />
Alltag nur noch schwer möglich wird. Dies<br />
stellt auch die Bezugspersonen sowie die professionellen<br />
Helfer vor besondere Herausforderungen,<br />
welche kaum mehr monodisziplinär<br />
ausreichend erfüllbar erscheinen, sodass<br />
ein inter- und multiprofessionelles Vorgehen<br />
Literatur<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
anzustreben ist. Aus psychologischer Sicht<br />
sind neben dem Patienten auch dessen<br />
Bezugssysteme, die betreuenden Teams als<br />
auch die eigene Psychohygiene zu berücksichtigen<br />
– vor allem bei häufiger Konfrontation<br />
mit den Themen Sterben und Tod. In Palliativ-Care<br />
tätige Berufsgruppen sollten ihre<br />
eigenen Ansprüche an die eigene Praxis und<br />
damit assoziierte innere Wert- sowie Weltbilder<br />
regelmäßig überprüfen und ggf. relativieren.<br />
Trotz der Schwere und der Menge an<br />
möglichen Belastungen kann die Arbeit mit<br />
Sterbenden als sehr bereichernd erlebt werden.<br />
(1) Bradstätter, M. (2010): Belastungen minimieren –<br />
Psychotherapeutische Unterstützung von Angehörigen.<br />
Vortrag im Rahmen des deutschen Palliativ-Kongresses<br />
2010, 11. September 2010, <strong>Dr</strong>esden.<br />
(2) Burns, C.M. Broonm, D.H. Smith, W.T. Dear, K. Craft,<br />
P.S. (2007): Fluctuating awareness of treatment goals<br />
among patients and their caregivers: a longitudinal<br />
study of a dynamic process. In: Supportive Care in<br />
Cancer, 15, 2, S. 187 – 196.<br />
(3) Caspar, M. & Weber, M. (2010): Kommunikation in<br />
der Palliativmedizin. In: Zeitschrift für Palliativmedizin,<br />
11, S. 167 – 179.<br />
(4) Dilling H., Mombour W., Schmidt M. H. (2005):<br />
Internationale Klassifikation psychischer Störungen.<br />
ICD-10-Kapitel V (F). klinisch-diagnostische Leitlinien.<br />
5. durchgesehene und ergänzte Auflage, Bern, Verlag<br />
Hans Huber.<br />
(5) Fegg, M. (2012): Depression. In: Schnell, M. W.,<br />
Schulz, C. (Hrsg.), Basiswissen Palliativmedizin, Heidelberg,<br />
Springer Medizin Verlag.<br />
(6) Geisler, L. (2008): Kommunikation in der Palliativmedizin.<br />
In: Hoefert, H. Hellermann, W. (Hrsg). Kommunikation<br />
als Erfolgsfaktor im Krankenhaus. Heidelberg,<br />
Economica, S. 131 - 149<br />
(7) Kübler-Ross, E. (2001): Interviews mit Sterbenden.<br />
Vollständige Taschenbuchausgabe, <strong>Dr</strong>oemersche<br />
Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.: München.<br />
(8) Lang, K. (2006): Auswirkungen der Arbeit mit<br />
Schwerkranken und Sterbenden auf professionelle<br />
und ehrenamtliche Helfer – zwischen Belastung und<br />
Bereicherung. In: Koch U., Lang K., Mehnert A., Schmeling-Kludas<br />
C (Hrsg). Die Begleitung schwer kranker<br />
und sterbender Menschen. Grundlagen und Anwendungshilfen<br />
für Berufsgruppen in der Palliativversorgung,<br />
Stuttgart, Schattauer GMBH, S. 237 – 255.<br />
(9) Müller, M. (2007): Vom Umgang mit Abschied und<br />
Trauer der Fachkräfte. In: Knipping, C. (Hrsg). Lehrbuch<br />
Palliative Care, CH, Verlag Hans Huber Hogrefe<br />
AG, S. 420 – 424.<br />
(10) Müller, M. Pfister, D. Markett S., Jaspers, B. (2010):<br />
Wie viel Tod verträgt das Team?. Eine bundesweite<br />
Befragung der Palliativstationen in Deutschland. In:<br />
Zeitschrift für Palliativmedizin, 11, S. 227 – 233.<br />
(11) Schnegg, M. (2000): Wieviel Tod verträgt der<br />
Mensch?. Von einem Seelsorger. In: Die Hospiz-Zeitschrift,<br />
6, S. 13 – 15.<br />
(12) Tausch, D. (2004): Sterbenden nahe sein. Was<br />
können wir noch tun?. Gekürzte und aktualisierte<br />
Neuausgabe, Verlag Herder: Freiburg.<br />
(13) Wienerroither, T. (2010): Burnout-Belastung im<br />
interdisziplinären Palliativ-Care-Setting. Gibt es ein<br />
erhöhtes Burnout-Risiko bei der Arbeit mit Schwerkranken<br />
und Sterbenden? Burnout-Theorien, Belastungsfaktoren<br />
und positive Einflussgrößen. Fachbereichsarbeit<br />
im Rahmen des Interdisziplinären<br />
Lehrganges für Palliativpflege am BFI-Linz.<br />
43
Forschung + Pflege<br />
Ass.-<strong>Prof</strong>. Doz. <strong>Dr</strong>. DGKS<br />
Sabine PLEScHBERGER, MPH<br />
Alpen-Adria-<strong>Univ</strong>ersität Klagenfurt<br />
Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung<br />
(IFF), Wien<br />
Abteilung Palliative Care und OrganisationsEthik<br />
Schottenfeldgasse 29/4/I; 1070 Wien<br />
Tel.: +43(0)1/5224000-104<br />
Fax: +43(0)1/5224000 178<br />
sabine.pleschberger@aau.at<br />
www.aau.at<br />
44<br />
foto@beigestellt<br />
Forschung in Palliative Care<br />
und die Rolle der Pflege<br />
Zitat<br />
„Ich bin froh, dass die bei uns eingerichtete <strong>Prof</strong>essur eine <strong>Prof</strong>essur für Palliative Care ist und<br />
nicht nur für palliative Medizin. Vielleicht denken manche Menschen da: naja, das ist ja eher eine<br />
weiche Lösung. Aber deshalb haben wir schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass exakte<br />
wissenschaftliche Untersuchungen mit der Freundschaft des Herzens einhergehen müssen …<br />
Und das war wohl das ungewöhnliche an unserer Vision, dass es nicht nur um eine fürsorgliche<br />
Gemeinschaft ging. Es ging auch um eine wissenschaftliche, forschende, lehrende Gemeinschaft,<br />
beide Aspekte gehören bei uns untrennbar zusammen.“ Cicely Saunders 1999, S. 91<br />
Mit diesen Worten beschrieb Cicely Saunders,<br />
die Gründerin der Hospizbewegung,<br />
in einem Interview die dahinter liegende<br />
Idee. Auf dieser Grundlage hat sich Palliative<br />
Care in England auch entwickelt. Das weltberühmte<br />
St. Christopher‘s Hospiz, eröffnet<br />
1967 in London, war von Anfang an auch eine<br />
Forschungseinrichtung und Stätte für Lehre<br />
und Weiterbildung. Saunders selbst war ja<br />
Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin<br />
und hat die Forschung in Palliative Care<br />
ausgehend von der Schmerztherapie weitgehend<br />
interdisziplinär vorangetrieben. Heute<br />
sind sämtliche Berufsgruppen und Disziplinen<br />
daran beteiligt, allen voran die Medizin<br />
und die Pflege.<br />
Im internationalen Vergleich nimmt Großbritannien<br />
bis heute eine herausragende Rolle<br />
in Palliative Care ein, so auch in der Pflegeforschung<br />
auf diesem Gebiet:<br />
• Die größte Anzahl an Publikationen zu<br />
Palliativpflegeforschung ist britischen<br />
Ursprungs, in der Reihung folgen die USA,<br />
Australien und Kanada (Wilkes 1998).<br />
• Die Pflege bildete laut einem Bericht<br />
des nationalen Forschungsrats mit 34%<br />
die größte Gruppe unter den Palliative-<br />
Care-Forschern in UK, und zahlreiche Forschungsgruppen<br />
(>10 Mitarbeiter) werden<br />
von Pflegewissenschaftern geleitet (NCRI<br />
2004).<br />
• Auch wenn die Pflegeforschung im Kontext<br />
des britischen Gesundheitssystems<br />
nur einen relativ kleinen Beitrag leistet, so<br />
wird bescheinigt, dass diese Forschung im<br />
Gebiet von Palliative Care auf einem besonders<br />
hohen Qualitätsniveau angesiedelt ist<br />
(Rafferty & Traynor 2006).<br />
Die respektablen Forschungsleistungen<br />
unterstreichen die Etablierung von Pflegewissenschaft<br />
in Palliative Care auf internationaler<br />
Ebene. Sie lässt sich zudem an der Ein-<br />
richtung spezifischer Lehrstühle für Palliative<br />
Nursing erkennen. Pionierrollen haben dafür<br />
Margareth O’Connor (2003; Melbourne AUS),<br />
Jane Seymour (2005; Nottingham UK) und<br />
Phil Larkin (2008; Dublin, Irland) übernommen.<br />
Weitere Indikatoren sind die umfassenden<br />
Lehrbücher zu Palliative Care mit spezifischer<br />
Pflegeperspektive – exemplarisch<br />
sei hier das „Textbook of Palliative Nursing“<br />
mit über tausend Seiten, in dritter Auflage<br />
herausgegeben von Betty Ferrel und Nessa<br />
Coyle genannt – sowie die wissenschaftliche<br />
Zeitschrift „International Journal of Palliative<br />
Nursing“.<br />
Im deutschsprachigen Raum allerdings spielen<br />
weder die Pflegeforschung in Palliative<br />
Care noch Palliative Care in der Pflegeforschung<br />
eine wesentliche Rolle. Obwohl die<br />
Pflege im Alltag der palliativen Versorgung<br />
eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. WHO<br />
1990), fehlt eine wissenschaftliche Reflexion<br />
auf diese Praxis bis dato weitgehend. Neben<br />
der Entwicklung von Palliative Care als interdisziplinäres<br />
Gebiet ist die wesentliche Ursache<br />
für diese Diskrepanz in der verzögerten<br />
Akademisierung der Pflege im gesamten<br />
deutschsprachigen Raum zu suchen. Wo die<br />
Pflegeforschung generell noch in den <strong>Kind</strong>erschuhen<br />
steckt, darf es auch nicht verwundern,<br />
dass sie im spezialisierten Bereich von<br />
Palliative Care unterrepräsentiert ist. Dennoch<br />
wäre gerade dieser Bereich prädestiniert<br />
dafür, die Notwendigkeit und Wirkung<br />
von Pflegeforschung deutlich zu machen.<br />
Im Vergleich zur Medizin schließlich weist<br />
die Pflege historisch eine nahezu ungebrochene<br />
Kontinuität in der Zuständigkeit für die<br />
Versorgung von sterbenden Menschen auf<br />
(Heller 1996). Auch über den engen Fokus auf<br />
Menschen am Lebensende hinaus gedacht<br />
stellt Palliative Care eine Kerndomäne der<br />
Pflege dar (Pleschberger 2010).
Pflegeforschung in Palliative Care ist in zwei<br />
Bereichen zu denken: Zum Einen ist es wichtig,<br />
die Perspektive der Pflege in der interdisziplinären<br />
Palliative-Care-Forschung zu<br />
verstärken. Diese inter- und transdisziplinäre<br />
Forschung in Palliative Care umfasst etwa<br />
die Bearbeitung komplexer Fragestellungen<br />
(Grande & Ingleton 2009, Ferrel et al. 2011):<br />
Etwa jene nach den Bedingungen des Sterbens<br />
zuhause, die Situation der Angehörigen,<br />
klinische Aspekte wie das Symptom-Management<br />
oder der Umgang mit prophylaktischen<br />
Maßnahmen bei Palliativpatienten. Die Evaluierung<br />
und Qualitätssicherung von Angeboten<br />
und Dienstleistungen ist ebenfalls ein<br />
wichtiger Aufgabenbereich interdisziplinärer<br />
Forschung in Palliative Care (ebd.).<br />
Zum Anderen soll durch einen stärker eigenständigen<br />
Pflegeforschungsbereich dem<br />
Anliegen der Entwicklung guter Pflegepraxis<br />
in Palliative Care Rechnung getragen werden.<br />
Welche Interventionen setzt die Pflege<br />
mit welcher Wirkung? Dabei geht es auch<br />
darum, das Wissen rund um die bedeutsamen<br />
Aspekte von Haltung und Beziehung zu<br />
erweitern, eine wichtige Domäne der Pflegewissenschaft<br />
wie auch internationale Studien<br />
belegen (Johnston 2005, Skilbeck & Payne<br />
2005). Dazu gehört auch eine systematische<br />
Auseinandersetzung mit der Rolle der Pflege<br />
im multiprofessionellen spezialisierten Palliative-Care-Team.<br />
Soll das Berufsbild der Palliativpflege<br />
auf jenes einer Advanced Practice<br />
Nurse ausgerichtet werden? Solche Fragen<br />
können nur aus der Perspektive der Pflege<br />
bearbeitet werden.<br />
Wenn es um Pflegeforschung in Palliative<br />
Care geht, darf eines nicht vergessen werden:<br />
Viele Patientinnen und Patienten erhalten<br />
gute Palliativpflege von Pflegekräften, die<br />
keinerlei spezialisiertes Wissen für sich beanspruchen<br />
(Larkin 2009). Trotz des zunehmenden<br />
Trends nach Spezialisierung hat sich die<br />
Forschung gerade an den alltäglichen Problemen<br />
und Herausforderungen aller Pflegenden<br />
zu orientieren. Eine solche praxisorientierte<br />
Forschung (Reitinger Hg 2008) jedoch<br />
vermag durchaus, die Praxis zu verändern.<br />
Vorausgesetzt es bestehen gute und tragfähige<br />
Kooperationsbeziehungen zwischen<br />
Forschung und Praxis. Solche Beziehungen<br />
müssen in Österreich erst wachsen, und Vorurteile<br />
einer Unvereinbarkeit von „Theorie<br />
und Praxis“ überwunden werden. Eine praxisorientierte<br />
Pflegeforschung in Palliative Care<br />
könnte dies befördern, ganz im Sinne von<br />
Cicely Saunders.<br />
Die spezialisierten Angebote haben zahlreiche<br />
(Pflege-)Expertinnen in der palliativen<br />
Versorgung und hospizlichen Begleitung hervorgebracht,<br />
die sich auch über die Angebote<br />
in Palliative Care akademisiert haben. Es geht<br />
nun darum, die wissenschaftliche Reflexion<br />
auf diese Prozesse in Gang zu bringen und die<br />
Möglichkeiten auszuloten, die sich zwischen<br />
der bewährten Brückenfunktion für die multiprofessionelle<br />
Zusammenarbeit einerseits<br />
und der Entwicklung einer eigenständigen<br />
professionellen Palliativpflege andererseits<br />
auftun. Dazu sind vielfältige Anstrengungen<br />
und Maßnahmen erforderlich. Allen voran<br />
muss zunächst eine solide Basis für Pflegeforschung<br />
in Österreich geschaffen werden, die<br />
derzeitige akademische Infrastruktur kann<br />
nicht als zufrieden stellend eingestuft werden<br />
(Rappold 2009). In weiterer Folge hat<br />
die Pflegewissenschaft schließlich verstärkt<br />
ihr Augenmerk auf den interdisziplinären<br />
Bereich Palliative Care zu richten, damit die<br />
Leistungen der Pflege sowohl auf praktischer<br />
als auch auf wissenschaftlicher Ebene stärker<br />
wahrgenommen werden können.<br />
Zusammenfassung<br />
International ist Pflegeforschung mittlerweile<br />
gut etabliert, Großbritannien nimmt bis<br />
heute eine herausragende Rolle darin ein. Im<br />
deutschsprachigen Raum allerdings spielen<br />
Pflegeforschung in Palliative Care sowie Palliative<br />
Care in der Pflegeforschung noch kaum<br />
eine Rolle. Das hat unter Anderem mit der<br />
verzögerten Akademisierung der Pflege zu<br />
tun. Gerade weil die Pflege in der Praxis von<br />
Palliative Care eine zentrale Rolle einnimmt,<br />
ist das Fehlen einer wissenschaftlichen Reflexion<br />
auf diese Praxis höchst problematisch.<br />
Um diese Lücke zu füllen sind vielfältige<br />
Anstrengungen und Maßnahmen erforderlich,<br />
allen voran eine solide Basis für Pflegeforschung<br />
generell zu schaffen, die sich im<br />
Besonderen verstärkt dem zukünftig bedeutsamen<br />
Bereich Palliative Care richtet.<br />
Literatur<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
(1) Ferrell B et al. (2011), Nursing Research. In: Ferrell<br />
Betty and Coyle Nessa (Eds.): Textbook of Palliative<br />
Nursing. Oxford: Oxford <strong>Univ</strong>ersity Press, 1211-1216<br />
(2) Grande G & Ingleton C (2009), Research in palliative<br />
care. In: Payne Sheila, Seymour Jane and Ingleton<br />
Christine (Eds.): Palliative Care Nursing. Principles and<br />
Evidence for Practice. 2nd ed., Maydenhead: Open<br />
<strong>Univ</strong>ersity Press<br />
(3) Heller Andreas (1996b): “Da ist die Schwester nicht<br />
weggegangen von dem Bett...” Berufsgeschichtliche<br />
Aspekte der Pflege von Sterbenden im Krankenhaus<br />
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Seidl Elisabeth<br />
und Steppe Hilde (Hg.): Zur Sozialgeschichte<br />
der Pflege in Österreich. Krankenschwestern erzählen<br />
über die Zeit von 1920 bis 1950. Pflegewissenschaft<br />
heute. Band 4. Wien: Verlag Maudrich, 192-211<br />
(4) Heller Andreas (2000): Berufsübergreifende Herausforderungen<br />
des Umgangs mit Ster benden in den<br />
Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens. In:<br />
Heller Andreas, Heimerl Katharina und Metz Christian<br />
(Hg.): Kultur des Sterbens. Bedingungen für das<br />
Lebensende gestalten. 2. überarb. Aufl. (1994). Freiburg<br />
im Breisgau: Lambertus, 106-127<br />
(5) Kaasa S, et al., Palliative Medicine 2006; 20(8), 727-<br />
34<br />
(6) Johnston Bridget (2005): Introduction to palliative<br />
care: overview of nursing developments. In: Lugton<br />
Jean and McIntyre Rosemary (Eds.): Palliative Care.<br />
The nursing role. 2nd ed., Edinburgh et al.: Elsevier,<br />
1-32<br />
(7) Larkin Phil J: Nurses and Nurse Praciticioners.<br />
Chapter 49. In: Caraceni A. et al. (Eds.): Palliative Medicine.<br />
Saunders, Elsevier 2009, Philadelphia, 265-268<br />
(8) National Cancer Research Institute (NCRI) (2004):<br />
Supportive and palliative care in the UK: Report of the<br />
NCRI Strategic Planning Group on supportive and Palliative<br />
Care.<br />
(9) Rappold Elisabeth (2009): Pflegewissenschaft in<br />
Österreich - eine Standortbestimmung. In: Mayer<br />
Hanna (Hg.): Pflegewissenschaft - von der Ausnahme<br />
zur Normalität. Ein Beitrag zur inhaltlichen und<br />
methodischen Standortbestimmung. Wien: Facultas,<br />
10-24<br />
(10) Rafferty AM & Traynor M; Journal of Advanced<br />
Nursing 2006; 56(1):2-4<br />
(11) Reitinger Elisabeth (Hg.) (2008): Transdisziplinäre<br />
Praxis. Forschen im Sozial- und Gesundheitswesen.<br />
Heidelberg: Carl-Auer Verlag<br />
(12) Skilbeck J & Payne S; Journal of Advanced Nursing<br />
2003; 43(5), 521-530<br />
(13) Wilkes L; International Journal of Palliative Nursing<br />
1998; 4(3): 128-34<br />
Seractil forte 400 mg - Filmtabletten<br />
Zusammensetzung: Eine Filmtablette enthält 400 mg Dexibuprofen. Hilfsstoffe: Tablettenkern: Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Calcium, hochdisperses<br />
Siliciumdioxid, Talk. Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E171), Glyceroltriacetat, Talk, Macrogol 6000. Anwendungsgebiete: Akute und chronische<br />
Arthritis, wie chronische Polyarthritis (rheumatoide Arthritis) und andere Arthrosen; entzündliche rheumatische Erkrankungen, wie Morbus Bechterew, Weichteilrheumatismus;<br />
zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen, schmerzhaften Schwellungen oder Entzündungen, wie nach Verletzungen oder Operationen. Gegenanzeigen:<br />
Dexibuprofen darf nicht angewendet werden bei Patienten: - mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Dexibuprofen, gegen andere NSAR oder gegen<br />
einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. - bei denen Stoffe mit ähnlicher Wirkung (z.B. Acetylsalicylsäure oder andere NSAR) Asthmaanfälle, Bronchospasmen,<br />
akute Rhinitis, Nasenpolypen, Urtikaria oder angioneurotische Ödeme auslösen. - mit einer Vorgeschichte von gastrointestinalen Blutungen oder Perforationen,<br />
die im Zusammenhang mit einer vorhergehenden NSAR Therapie steht. - mit bestehenden oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen peptischen Ulzera oder<br />
Blutungen (mindestens zwei voneinander unabhängige Episoden von nachgewiesener Ulzeration oder Blutung). - mit zerebrovaskulären oder anderen aktiven Blutungen.<br />
- mit aktivem Morbus Crohn oder aktiver Colitis ulcerosa. - mit schwerer Herzinsuffizienz. - mit schwerer Nierenfunktionsstörung (GFR < 30 ml/min). - mit schwerer<br />
Leberfunktionsstörung. - ab dem sechsten Monat der Schwangerschaft. Pharmakotherapeutische Gruppe: Nichtsteroidale antiinflammatorische und antirheumatische<br />
Stoffe, Propionsäurederivate, ATCCode: M01AE14. Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig Packungsgrößen: 10, 30, 50 Stück Kassenstatus: 10, 50 Stück: Green<br />
Box 30 Stück: No Box Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn Stand der Fachkurzinformation: Dezember 2010 Angaben zu Warnhinweisen und<br />
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen<br />
sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.<br />
45
Inhalt<br />
<strong>Dr</strong>. Sparefein<br />
<strong>Dr</strong>. Sparefein Sparefein<br />
Europa kracht wie eine Kaisersemmel.<br />
Egal, wie Sie über Politiker denken – klar<br />
ist, uns erwarten 5 Jahre Sparpakete, die<br />
auch das Gesundheitssystem in vielen<br />
Details treffen werden. Sparen wird jetzt<br />
hip und Bürgerpflicht. Die Redaktion<br />
bat den Obmann des Österreichischen<br />
Generikaverbandes Bernd Leiter um einen<br />
Kommentar zum richtigen Wie.<br />
„Jeder Österreicher sieht, dass<br />
Produkte des täglichen Bedarfs<br />
nahezu stetig teurer werden.<br />
Bei neu entwickelten Arznei-<br />
mitteln geht es uns ebenso;<br />
der Preis der frisch zugelasse-<br />
nen Originalsubstanzen steigt<br />
im Durchschnitt von Jahr zu Jahr.<br />
Dafür habe ich persönlich viel Verständ-<br />
nis, denn die forschende Industrie<br />
unternimmt gewaltige Anstrengungen,<br />
um bisher nicht ausreichend versorg-<br />
ten Patientengruppen mit „orphan<br />
diseases” gute Therapeutika anzubieten.<br />
Ganz anders ist das bei generischen Arzneimittel<br />
ohne Patentschutz: Der Wett-<br />
bewerb unter den Herstellern führt immer<br />
wieder zu einem „Preisverfall“. Es<br />
können bei bestimmten Krankheiten<br />
ohne Mehrkosten bis vier Mal so viele<br />
Patienten behandelt werden und das bei<br />
gleicher hoher Qualität.<br />
Als Generika-Hersteller setzen wir auf<br />
anerkannte und erprobte Arzneimittel.<br />
Wir sind auf das Feintuning von anwendungsfreundlichen<br />
Medikamenten spe-<br />
zialisiert. Fortschritte der pharmazeuti-<br />
schen Technologie ermöglichen verträg-<br />
liche Hilfsstoffe, zusätzliche Dosierungs-<br />
stärken und patientenfreundliche Darrei-<br />
chungsformen. Die Auswahlmöglichkeiten<br />
wurden wesentlich verbessert. Die<br />
Vielfalt der Generika erlaubt es heute, die<br />
Arzneimitteltherapie der Patienten individuell<br />
und damit möglichst optimal zu<br />
gestalten. Das dient der Therapietreue<br />
der Patienten und entlastet so die Versicherungen<br />
zusätzlich.”<br />
Bernd Leiter<br />
office@generikaverband.at<br />
46<br />
MedNews<br />
LDL ist nicht präzise genug ...<br />
Es ist schon ein paar Jahre her,<br />
dass das Gesamtcholesterin<br />
als Marker für die Atherio-<br />
sklerose gegolten hat. Seither<br />
wird HDL und LDL unterschieden.<br />
Jetzt rüttelt der<br />
Lipidologe <strong>Prof</strong>. Oravec an<br />
dem Dogma. Er hat nachgewiesen,<br />
dass viele Patienten<br />
mit erhöhtem LDL bloß die<br />
Subfraktionen 1 und 2 (also<br />
gutes LDL) besitzen – ohne<br />
jedes atherogene Risiko. Andere<br />
(evtl. gar mit scheinbar<br />
"normalem" LDL) haben die gefähr-<br />
lichen Subfraktionen 3-7 und brauchen<br />
dringend eine (andere) Therapie. Die<br />
Analyse der Subfraktionen bietet das<br />
Zitat der Woche:<br />
" Ohne Krafttraining<br />
jede Woche gibt es<br />
kein gesundes Altern."<br />
Die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien<br />
<strong>Dr</strong>. Angelika Rosenberger-Spitzy<br />
Influenza –<br />
Richtigstellung<br />
Ärzten wurde gern erzählt, dass in den<br />
Wochen der Influenza-Epidemie eine<br />
jährliche „Übersterblichkeit” von bis zu<br />
6.000 Alten zu beobachten sei. Die AGES<br />
hat jetzt neun Jahre überprüft und tatsächlich<br />
eine auffallend erhöhte Mortalität<br />
beobachtet: allerdings „nur” 1.000 bis<br />
1.200 zusätzliche Todesfälle, meistens in<br />
den ersten Monaten des Jahres.<br />
VLDL MID LDL HDL<br />
C B A 1 2 3 4 5 6 7<br />
wissenschaftliche Labor <strong>Dr</strong>. Dostal mit<br />
dem Lipoprint-System (siehe Grafik):<br />
1190 Wien, Tel. 01 – 368 24 72<br />
www.labor-dostal.at<br />
Multi-potente<br />
Laktobazillen?<br />
Gute probiotische Arzneimittel wie bei-<br />
spielsweise Antibiophilus® (Lactobacillus<br />
Casei Rhamnosus) wirken weitgehend<br />
bakterio- bzw. virostatisch, wie neue<br />
In-vitro-Studien belegen. Das Probiotikum<br />
verhindert u. a. die Vermehrung ver-<br />
schiedener E. coli, von Salmonellen,<br />
Pseudomonas, Clostridium difficile und<br />
sogar von Rotaviren. Der erstaunliche<br />
Wirkmechanismus gegen eine Vielzahl<br />
ganz unterschiedlicher Pathogene ist<br />
von den Mikrobiologen noch nicht in<br />
allen Facetten dechiffriert. Trotz der multiplen<br />
Wirkkraft ist Antibiophilus ausgezeichnet<br />
verträglich – sogar bei empfindlichen<br />
oder immunschwachen Patienten.<br />
Ob diese Pathogene per räumliche<br />
Verdrängung an der Mucosa, durch<br />
Nahrungs-Konkurrenz<br />
oder durch Bacteriocine<br />
bekämpft wer-<br />
den, wird noch erforscht.<br />
Evident ist,<br />
dass Antibiophilus<br />
die Wirkung der<br />
antibiotischen Therapie<br />
verbessert<br />
und die Regeneration<br />
beschleunigt.
Junge Mediziner sind demnächst<br />
zum Kräfte-Messen aufgefordert. Bei<br />
unklarer Schmerzsymptomatik sind auf<br />
der Website „Mediziner der Zukunft“<br />
die besten Schritte zur Differentialdiagnose<br />
gefragt. Der „Sportplatz“ im Web<br />
wird vom Schweizer Arzneimittelher-<br />
steller Novartis zur Verfügung gestellt.<br />
Als Schiedsrichterin bestimmt <strong>Prof</strong>.<br />
Sabine Sator-Katzenschlager, die die<br />
Akupunktur- und Schmerzambulanz im<br />
Wiener AKH leitet, die sportlichen Regeln<br />
und damit die Sieger.<br />
Wer wird Rookie of the Year?<br />
Im neuen Web-Portal vernetzen sich<br />
Jungmediziner mit ihren Kollegen in virtuellen<br />
Teams. Sie diagnostizieren und<br />
behandeln realitätsnahe Patientenfälle.<br />
Sie vertiefen ihr Fachwissen in modern-<br />
sten E-Learning-Modulen und erfahren<br />
Wissenswertes über Therapieoptionen.<br />
In diesem „Trainingscamp für Differentialdiagnosen“<br />
hat die Redaktion mit<br />
kniffligen Fällen der Schmerzsymptomatik<br />
begonnen. Andere Indikationen<br />
werden sukzessive folgen, Novartis<br />
sucht dabei immer die Zusammenarbeit<br />
mit Top-Experten. Für die Mediziner,<br />
die ihr Diagnose-Wissen testen wollen,<br />
schaffen diese die „Spielregeln“ für ein<br />
hartes Match zwischen den Youngstern.<br />
Schon jetzt können Teams aus zwei bis<br />
fünf Medizinern gegeneinander um den<br />
Doz. Margot Schmitz<br />
<strong>Arzt</strong> Patient<br />
Sieg spielen. In jeder Indikation wird die<br />
Gruppe mit den meisten Punkten „Rookie<br />
of the Year“, ihre Ergebnisse werden<br />
publiziert.<br />
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis<br />
sucht eine langfristige Partner-<br />
schaft zur Medizin, welche beide Tei-<br />
le befruchtet. Deshalb sind auch Tur-<br />
nusärzte auf der neuen Website mehr<br />
als willkommen. Alle jungen Ärzte<br />
perfektionieren sich im Training on-thejob,<br />
um in Stress-Situationen Automatismen<br />
der wichtigsten Algorith-men ganz<br />
intus zu haben.<br />
Der Eintritt ist frei:<br />
www.medizinerderzukunft.at<br />
Mit freundlicher Unterstützung der<br />
Novartis Pharma GmbH<br />
Nostalgie ist<br />
ein Zeichen der<br />
Depression<br />
„Es ist oft ein Verdrängen der schmerzhaften<br />
Gegenwart, wie schon Woody<br />
Allen in seinem Melodram über Paris be-<br />
merkt. Der Versuch, die Zeit auf- und<br />
festzuhalten, ist daher das Gegenteil von<br />
„panta rhei” des griechischen Denkers<br />
Heraklit. In der Verklärung der Vergangenheit<br />
steckt der aussichtslose Versuch,<br />
sich den Veränderungen alles Lebendigen<br />
zu entziehen.<br />
Künstler greifen oft zur Nostalgie, um<br />
durch die Veränderung der Wirklichkeit<br />
die Intensität der Emotionen spürbar<br />
und sichtbar zu machen. Der Film Midnight<br />
in Paris ist zugleich ein Manifest<br />
des Eskapismus, des Heimwehs nach<br />
einer tieferen und bedeutungsvolleren<br />
Welt. Die Idylle über Hirten und Vieh am<br />
Attersee von Friedrich Gauermann 1852<br />
(links) spielt mit der Sehnsucht nach einer<br />
Welt, die wir längst verloren haben.<br />
Kunst und depressive Verstimmug sind<br />
siamesische Zwillinge. Die nostalgische<br />
Verklärung der <strong>Kind</strong>heit findet sich typischerweise<br />
sehr oft bei Alzheimer-Patienten.”<br />
47
GPB.SER 120101<br />
wieder mobil mit ...<br />
Seractil ®<br />
®<br />
Seractil forte<br />
die Kraft gegen Schmerz und Entzündung<br />
Fachkurzinformation Seite 45