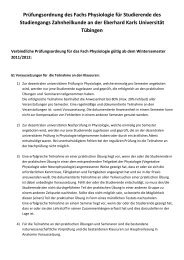Versuch 5: Atmung
Versuch 5: Atmung
Versuch 5: Atmung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2 <strong>Versuch</strong> 5: <strong>Atmung</strong><br />
– Statische Messung: Volumenmessungen zur Bestimmung der Kapazität des<br />
Atemraumes.<br />
– Dynamische Messungen: Bestimmung der Atemzeitvolumina und des Zeitbedarfs<br />
der Ventilation.<br />
In der Klinik wird heute die Lungenfunktionsdiagnostik vorzugsweise mit dem<br />
Verfahren der Pneumotachographie durchgeführt. Das Messprinzip der Pneumotachographie<br />
besteht darin, dass die Atemluft durch ein feinmaschiges Metallnetz<br />
oder parallel geschaltete feine Glasröhrchen, die einen definierten Strömungswiderstand<br />
(R) verkörpern, strömt, und vor sowie hinter dem Widerstand<br />
die Drücke (PV) bzw. (PH) gemessen werden. Da eine laminare Strömung vorausgesetzt<br />
werden darf, sind Druckdifferenz und Atemstromstärke � V zueinander<br />
proportional:<br />
P H<br />
�<br />
V<br />
�<br />
P V<br />
Messkopf<br />
P � P<br />
R<br />
V H<br />
Filter Mundstück<br />
Abb. 5-1 Die <strong>Versuch</strong>sperson atmet über Mundstück und Filter durch einen genau definierten<br />
Strömungswiderstand R, der Hauptbestandteil des Messkopfes ist.<br />
Über zwei Schläuche, die mit dem PowerLab-System verbunden sind, werden<br />
die Drücke PV bzw. PH vor bzw. hinter dem Widerstand erfasst, um daraus<br />
mit Gl. [1] den Atemfluß zu bestimmen.<br />
[1]<br />
5.1 Lungenfunktionsprüfung 3<br />
Durch Integration der Atemstromstärke �<br />
V über der Zeit kann auf das Atemvolumen<br />
geschlossen werden:<br />
V � � V dt � [2]<br />
<strong>Versuch</strong>sgang<br />
Die <strong>Versuch</strong>sperson (VP) atmet mit aufgesetzter Nasenklemme durch den Spirometermesskopf,<br />
der an PowerLab angeschlossen ist. Die zur Druckdifferenz<br />
PV–PH proportionale Atemstromstärke wird fortlaufend integriert. Damit lässt<br />
sich der Zeitverlauf des resultierenden Atemvolumens aufzeichnen.<br />
Jedes der zur Spirometrie vorgesehenen Atemmanöver ist in aufrechter Körperhaltung<br />
durchzuführen und sollte immer aus der Ruheatmung heraus begonnen<br />
werden.<br />
Das Untersuchungsprogramm, das die Bestimmung des inspiratorischen<br />
und exspiratorischen Reservevolumens, der Vitalkapazität, des Atemminutenvolumens<br />
und der Einsekundenkapazität nach Tiffeneau umfasst, ist in Abb. 5-2 in<br />
Form eines Volumenzeitdiagramms wiedergegeben. Sämtliche Volumenmesswerte<br />
sind mit einem aus den aktuellen Umgebungsbedingungen errechneten Umrechnungsfaktor<br />
k (s. S. 4 „Umrechnung der Atemvolumina auf STPD-Bedingungen“)<br />
zu multiplizieren, um auf STPD-Bedingungen zu normieren. Die Ergebnisse<br />
sind in das entsprechende Protokollblatt einzutragen und mit den<br />
Normwerten, die aus den am Arbeitsplatz ausliegenden Nomogrammen abzulesen<br />
sind, zu vergleichen.<br />
Im Einzelnen sind folgende Volumina bzw. Kapazitäten aus den der Messung<br />
direkt zugänglichen Grössen zu berechnen (s. Ergebnisprotokoll):<br />
Atemminutenvolumen AMV = AZV � f<br />
Vitalkapazität VC = ERV + AZV + IRV<br />
Totale Lungenkapazität TLC = VC + RV<br />
Einsekundenkapazität ESC = FEV1/VC<br />
Um eine obstruktive Ventilationsstörung zu simulieren, soll die <strong>Versuch</strong>sperson<br />
über einen in Serie zum Messkopf geschalteten dünnen Schlauch atmen und unter<br />
dieser Atemwegsbehinderung den Tiffeneau-Test wiederholen.<br />
Eine restriktive Ventilationsstörung erfährt die <strong>Versuch</strong>sperson ansatzweise,<br />
wenn sie in stark nach vorn gebeugter Haltung mit einwärts gedrehten Schultern<br />
atmet. In diesem Fall ist die Vitalkapazität eingeschränkt.