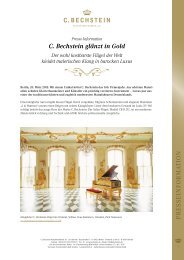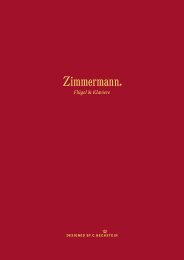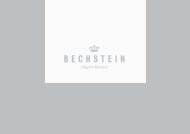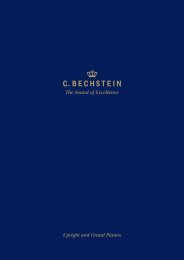C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
21<br />
<strong>Bechstein</strong> vor <strong>der</strong> Londoner Nie<strong>der</strong>lassung in <strong>der</strong> Wigmore Street. Ein <strong>Bechstein</strong>-Konzertflügel wird in den deutschen Reichstag geliefert. Vorreiter für Hightech. Visionär: das <strong>Bechstein</strong>-Moór-Doppelklavier. Nobelpreisträger Nernst baut für <strong>Bechstein</strong> ein Elektroniksystem.<br />
fernden Münchner Verlegersgattin Elsa<br />
Bruckmann erfunden wurde <strong>–</strong> Winifred<br />
Wagner, die Schwiegertochter des Komponisten,<br />
ersann ihn jedenfalls nicht.<br />
1924 sagte Helene <strong>Bechstein</strong> vor <strong>der</strong><br />
Münchner Polizei aus, sie habe Hitler<br />
Mittel zur Verfügung gestellt. Mit ihrer<br />
Hilfe sowie <strong>der</strong> Unterstützung durch<br />
Elsa Bruckmann und die Industriellengattin<br />
von Seydlitz konnte Hitler<br />
1923 Sicherheiten für ein Darlehen des<br />
Bremer Kaffeerösters Richard Frank<br />
hinterlegen, um aus dem „Völkischen<br />
Beobachter“ eine Tageszeitung zu machen.<br />
Zeitgleich sandte die Bayreuther<br />
Festspiel-Sybille Winifred Wagner<br />
Hitler jenes Papier in die Haft, auf dem<br />
dieser 1924 „Mein Kampf“ schrieb.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde<br />
Helene <strong>Bechstein</strong> von <strong>der</strong> Spruchkammer<br />
zu 30.000 Mark verurteilt. Sie<br />
blieb bis zu ihrem Tod 1951 am Fuße<br />
des Obersalzbergs wohnen.<br />
Die Vermutung freilich, die Klavierfabrik<br />
C. <strong>Bechstein</strong> habe in den 30er<br />
Jahren von <strong>der</strong> Nähe eines Teils <strong>der</strong><br />
Familie zu den nationalsozialistischen<br />
Machthabern profitiert, wird durch<br />
einen Blick auf die Produktionszahlen<br />
wi<strong>der</strong>legt. In den 30er Jahren ging es<br />
<strong>Bechstein</strong> ebenso schlecht wie den<br />
meisten deutschen Klavierherstellern.<br />
In den 20er Jahren hatte nach dem<br />
Ende <strong>der</strong> Inflation noch die Hoffnung<br />
geblüht. An einen Export in ein so<br />
wichtiges Land wie Großbritannien<br />
war allerdings angesichts <strong>der</strong> hohen<br />
Zölle und Steuern kaum zu denken.<br />
Mit <strong>der</strong> jungen Sowjetunion war auch<br />
nicht ins Geschäft zu kommen <strong>–</strong> dort<br />
gab es schlicht ein Einfuhrverbot. Die<br />
USA schieden zunächst aus mehreren<br />
Gründen als Markt aus. Erst im Herbst<br />
1928 konnte man Verbindungen zu den<br />
Vereinigten Staaten knüpfen. Am 18.<br />
Dezember erschien in <strong>der</strong> deutschsprachigen<br />
Zeitung „New Yorker Herold“<br />
ein Artikel in <strong>der</strong> Reihe „New Yorker<br />
Spaziergänge“:<br />
„Wenn ein Haus vom Range des Wanamaker’schen<br />
öffentlich erklärt, dass<br />
es sich dadurch geehrt fühlt, einen<br />
bestimmten Artikel in New York<br />
vertreten und ihn allein vertreten zu<br />
dürfen, so weiß es sicher, was es nun<br />
sagt <strong>–</strong> und je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> diese Worte liest,<br />
ist überzeugt, dass es sich nur um etwas<br />
ganz Beson<strong>der</strong>s handeln könne. So<br />
ging auch es auch dem Spaziergänger <strong>–</strong><br />
und daher war er hocherfreut, in jenem<br />
Artikel einen heißgeliebten Bekannten<br />
wie<strong>der</strong> zu begrüßen, den einzigen Ge-<br />
Der <strong>Bechstein</strong>-Kultur-Film: „Vom Werden eines Flügels“.<br />
nossen vieler unvergesslicher Stunden:<br />
den <strong>Bechstein</strong>flügel …“.<br />
Der „Spaziergänger“ konnte sogar feststellen,<br />
dass das Instrument während<br />
des Transports auf See die Stimmung<br />
gehalten hatte. „Wanamakers“ feierten<br />
das Ereignis mit Pressekonferenz und<br />
großem Empfang für die Society.<br />
Im Mai 1929 wählte man ein neues<br />
Verkehrsmittel für einen Chippendale-<br />
Flügel: das Luftschiff „Graf Zeppelin“.<br />
Im gleichen Monat reiste von Berlin<br />
aus ein vergoldeter Flügel mit Malereien<br />
à la Watteau zur Weltausstellung in<br />
Barcelona. Es ging ja nicht allen Menschen<br />
gleichermaßen schlecht. Der spanische<br />
Repräsentant war zuversichtlich,<br />
den Flügel sofort nach dessen Ankunft<br />
an einen Bankier verkaufen zu können.<br />
Die Frage <strong>der</strong> Konvertibilität hatte man<br />
schon seit längerem etwas kompliziert<br />
regeln müssen: „Für unsere Verkäufe<br />
gilt <strong>der</strong> Wert <strong>der</strong> Reichsmark gleich<br />
1/2790 kg Feingold zum Preise <strong>der</strong><br />
Londoner Notierung vom Tage des<br />
Verkaufs o<strong>der</strong> 10/42 U.S.A. Dollar nach<br />
unserer Wahl… .“<br />
Die 20er Jahre waren natürlich auch<br />
die großen Jahre <strong>der</strong> Transatlantik-<br />
Schifffahrt. Und da diente mancher<br />
<strong>Bechstein</strong>, festgezurrt gegen die<br />
Unwägbarkeiten <strong>der</strong> Weltmeere, auf<br />
manchem Ocean Liner dem Luxus-<br />
Erlebnis <strong>der</strong> Passagiere. Schiffe wie<br />
die „Bremen“ waren so etwas wie die<br />
„Kleine Nachtmusik“ und <strong>der</strong> „Fliegende<br />
Hollän<strong>der</strong>“ in einem <strong>–</strong> Festspiele mit<br />
fester Ankunftszeit.<br />
In diesen zu Beginn wie an ihrem<br />
Ende wirtschaftlich schwierigen 20er<br />
Jahren hielten vor allem die Pianisten<br />
an „ihrem“ <strong>Bechstein</strong> fest, ob sie nun<br />
Ferruccio Busoni hießen o<strong>der</strong> Artur<br />
Schnabel, Wilhelm Backhaus o<strong>der</strong><br />
Alfred Cortot, o<strong>der</strong> <strong>der</strong> unvergessene<br />
Grandseigneur Emil von Sauer, einer<br />
<strong>der</strong> elegantesten Liszt-Interpreten.<br />
Wenn ein Komponist wie Ferruccio<br />
Busoni, dessen Sensitivität ausschließlich<br />
vom Klang des Klaviers geprägt<br />
war, einen „Entwurf einer neuen<br />
Ästhetik <strong>der</strong> Tonkunst“ geschrieben<br />
hatte, so kann man davon ausgehen,<br />
dass er seine ästhetischen Vorstellungen<br />
an seinem Flügel entwickelt hat.<br />
Artur Schnabels grandiose und extrem<br />
„mo<strong>der</strong>ne“ Sonate für Violine solo aus<br />
dem Jahr 1919 entstand natürlich in<br />
engem Kontakt zu Schnabels Kammermusikpartner<br />
und Freund Carl Flesch;<br />
aber letztlich muss man annehmen,<br />
dass Schnabel die Sonate, ebenso wie<br />
sein fulminantes 1. Streichquartett, an<br />
seinem „<strong>Bechstein</strong>“ komponierte, so<br />
wie unzählige Komponisten gerade <strong>der</strong><br />
beginnenden Mo<strong>der</strong>ne verfuhren. Ein<br />
revolutionäres Kompositionsverfahren<br />
wie die sogenannte Zwölfton-Methode<br />
ging sogar dezidiert von den zwölf<br />
Halbtönen <strong>der</strong> Klavier-Oktave aus und<br />
damit von <strong>der</strong> gleichmäßigschwebend<br />
temperierten Stimmung.<br />
<strong>Bechstein</strong> selbst gab sich innovativ.<br />
Man hatte natürlich ständig verbessert,<br />
auch wenn das mo<strong>der</strong>ne Pianoforte <strong>–</strong> ob<br />
Flügel o<strong>der</strong> Pianino <strong>–</strong> im wesentlichen<br />
Ende <strong>der</strong> 1870er Jahre fertig entwickelt<br />
war. Selbstverständlich baute man auch<br />
Instrumente für das Welte-Mignon-System,<br />
für jene Papierrollen-Automatik,<br />
die den Pianisten überflüssig machen<br />
sollte. Dadurch blieben uns beispielsweise<br />
Aufnahmen mit dem großen<br />
Eugen d’Albert erhalten, einem eingeschworenen<br />
<strong>Bechstein</strong>-Pianisten („Alles<br />
habe ich diesen herrlichen Flügeln zu<br />
verdanken …“). Doch <strong>Bechstein</strong> wandte<br />
sich auch dem neuen Medium Film zu,<br />
das, solange es sich um den Stummfilm<br />
handelte, mit dem Pianoforte eng<br />
verbunden war. In ungezählten Kinos<br />
sorgte <strong>der</strong> Pianist für den akustischemotionalen<br />
Hintergrund. 1926 nun<br />
wurde ein <strong>Bechstein</strong>-Kulturfilm<br />
gedreht: „Vom Werden eines Flügels“.<br />
Er sollte „das Interesse für das Klavier<br />
im Allgemeinen … för<strong>der</strong>n und somit<br />
<strong>der</strong> gesamten musikalischen Welt und<br />
unserer Industrie … dienen“. Der Film<br />
war steuerfrei. Die längste Fassung<br />
dauerte 40 Minuten und wurde geliefert<br />
mit „Reichszensur- und Lampekarte“.<br />
Eine wirkliche Neuerung war 1929 <strong>der</strong><br />
Flügel nach dem System des ungarischen<br />
Pianisten und Tüftlers Emánuel<br />
Moór: Zwei gekoppelte Manuale wie<br />
bei einer Orgel, das obere eine Oktave<br />
höher. Und natürlich eine gedoppelte<br />
akustische Anlage. Moór pries seine<br />
Erfindung vor allem als ideales Instrument<br />
zur Interpretation <strong>der</strong> Werke von<br />
Johann Sebastian Bach. Das Monstrum<br />
hieß „<strong>Bechstein</strong>-Moór-Doppelklavier“;<br />
es erzeugte Begeisterung und rote<br />
Zahlen.<br />
Eine an<strong>der</strong>e Entwicklung verhieß mehr<br />
Erfolg. Sie war freilich <strong>der</strong> Zeit weit<br />
voraus <strong>–</strong> zu weit. Dazu kooperierte<br />
<strong>Bechstein</strong> mit dem Physiker Hermann<br />
Walther Nernst, <strong>der</strong> 1920 den Nobelpreis<br />
für Chemie erhalten hatte und<br />
als einer <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> physikalischen<br />
Chemie gilt. Nernst formulierte<br />
unter an<strong>der</strong>em den 3. Hauptsatz<br />
<strong>der</strong> Thermodynamik und definierte<br />
damit den sogenannten absoluten<br />
Nullpunkt; ferner entwickelte er die<br />
„Nernstlampe“, die ein nahezu weißes<br />
Licht abgibt. Für die Ausführung <strong>der</strong><br />
elektrotechnischen Seite des ultramo<strong>der</strong>nen<br />
Instruments waren Siemens &<br />
Halske zuständig, und so entstand <strong>der</strong><br />
„Neo-<strong>Bechstein</strong>-Flügel“ o<strong>der</strong> „Siemens-<br />
Nernst-Flügel“, ein Stutzflügel ohne<br />
Resonanzboden und mit dünnen Saiten,<br />
die jeweils in Fünfergruppen über eine<br />
Art Mikrofon-Kapsel geführt waren.<br />
Erzeugt wurde <strong>der</strong> Ton über extrem<br />
leichte „Mikrohämmer“. Das Instrument<br />
war nur 1,40 m lang. Das rechte<br />
Pedal diente <strong>der</strong> Lautstärkeregelung;<br />
mit dem linken Pedal konnte man den<br />
Effekt eines Cembalo- o<strong>der</strong> Celesta-<br />
Tons erzeugen: „Ferner werden ein<br />
22