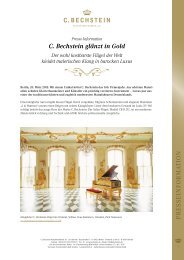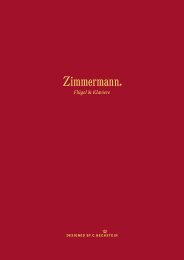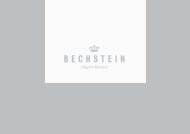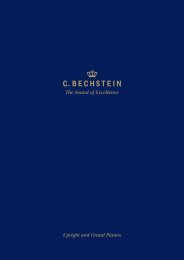C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
25<br />
Freud und Leid: Wilhelm Backhaus spielte zum hun<strong>der</strong>tjährigen Firmenjubliäum (oben).<br />
Unten: Zerstörte Fabriken machten <strong>Bechstein</strong> während des Wie<strong>der</strong>aufbaus nach 1945 lieferunfähig.<br />
Schon knapp zwei Jahre später wurde<br />
die Hun<strong>der</strong>tjahrfeier glanzvoll begangen.<br />
Der Titaniapalast, <strong>der</strong> auch den<br />
Berliner Philharmonikern mit ihrem<br />
damaligen Chefdirigenten Wilhelm<br />
Furtwängler als Konzertsaal diente,<br />
war überfüllt, als Wilhelm Backhaus<br />
am 21. November 1953 dort ein reines<br />
Beethoven-Programm spielte: fünf<br />
Sonaten einschließlich <strong>der</strong> Opus 111<br />
als tiefsinnigem Finale.<br />
In diesen Jahren blieben die Absatzzahlen<br />
zwar in verhältnismäßig<br />
bescheidenen Dimensionen, doch<br />
konnte man unmittelbar an die alten<br />
Qualitätsstandards wie<strong>der</strong> anknüpfen.<br />
1954 kaufte <strong>der</strong> Dirigent Sergiu Celibidache<br />
für seine Wohnung in Mexico<br />
City einen Stutzflügel und zeigte sich<br />
begeistert. Übrigens wurde 1957 <strong>der</strong><br />
dritte <strong>Bechstein</strong> seit Kriegsende nach<br />
Japan exportiert; <strong>der</strong> Käufer war die<br />
Firma Yamaha, die den Konzertflügel<br />
in ihrer Musikhalle aufstellte.<br />
In Europa war das Vertrauen in die<br />
wachsende Wirtschaftskraft so groß,<br />
dass <strong>der</strong> <strong>Bechstein</strong>-Aufsichtsrat bereits<br />
im Oktober 1954 beschloss, eine<br />
zweite Fabrik zu bauen. Nur wenige<br />
Monate später zeichnete sich durch<br />
die Absichtserklärung von Messina die<br />
künftige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
ab. Als im Oktober 1959 auf<br />
dem neu erschlossenen Industriegelände<br />
Killisfeld am Rand von Karlsruhe<br />
Richtfest gefeiert wurde, war die<br />
EWG, die Vorläuferin <strong>der</strong> heutigen EU,<br />
bereits durch die Römischen Verträge<br />
Realität geworden.<br />
Die Entscheidung für das Zweigwerk<br />
in Karlsruhe <strong>–</strong> dort verfügte man über<br />
eine Produktionsfläche von 1.800<br />
Quadratmetern <strong>–</strong> erwies sich als richtig.<br />
Denn durch den Bau <strong>der</strong> Berliner Mauer<br />
im August 1961 war man in <strong>der</strong> alten<br />
Hauptstadt abgeschnitten. Vor allem<br />
wurden auch die Arbeitskräfte knapp.<br />
In den späten 60er Jahren erreichte die<br />
jährliche Produktion insgesamt etwa<br />
1.000 Instrumente, gefertigt in Berlin<br />
und Karlsruhe; <strong>der</strong> Gesamtumsatz<br />
betrug rund 4,5 Millionen Mark. Sogar<br />
noch ein weiterer Standort entstand, in<br />
Eschelbronn. Mehr als die Hälfte <strong>der</strong><br />
Instrumente wurde exportiert. Wer<br />
damals einen <strong>Bechstein</strong> haben wollte,<br />
musste mehr als ein halbes Jahr warten.<br />
Leonard Bernstein <strong>–</strong> weltberühmter Dirigent, Komponist und Pianist <strong>–</strong> tourte mit <strong>Bechstein</strong>.<br />
Erneut er<strong>lebt</strong>e <strong>Bechstein</strong> so etwas wie<br />
eine Renaissance. 1971 spielte Leonard<br />
Bernstein bei seiner Deutschlandtournee<br />
mit den Wiener Philharmonikern<br />
Ravels G-Dur-Klavierkonzert ausschließlich<br />
auf einem <strong>Bechstein</strong>, und<br />
einer <strong>der</strong> ganz großen Virtuosen, Jorge<br />
Bolet, bevorzugte grundsätzlich das<br />
Berliner Konzertinstrument.<br />
1973 wurde unter <strong>der</strong> Fe<strong>der</strong>führung<br />
von Baldwin die Aktiengesellschaft in<br />
eine GmbH umgewandelt. Der kaufmännische<br />
Vorstand Wilhelm Arndt<br />
wurde nach dem Ausscheiden von Max<br />
Matthias alleiniger Geschäftsführer.<br />
Einerseits fielen nun die wichtigen<br />
Entscheidungen in den USA, eben<br />
beim Mehrheitsgesellschafter Baldwin.<br />
An<strong>der</strong>seits eröffnete dies neue Chancen<br />
auf dem amerikanischen Markt. Mit<br />
einem neu konzipierten Konzertflügel,<br />
dem Modell EN, reagierte <strong>Bechstein</strong><br />
auf die immer größer werdenden Konzerthallen<br />
und, wenn man so will, auf<br />
ein sich wandelndes Verständnis von<br />
Kultur. Nicht zuletzt etliche <strong>der</strong> großen<br />
Jazzpianisten waren von den Möglichkeiten<br />
dieses Instruments begeistert,<br />
woran sich vielleicht auch absehen<br />
lässt, wie sehr sich die Musikkultur<br />
seit den Tagen eines Hans von Bülow<br />
verän<strong>der</strong>t hatte.<br />
Das Firmenjubiläum 1978 wurde<br />
standesgemäß begangen. Man feierte<br />
die 125 Jahre <strong>Bechstein</strong> auf <strong>der</strong> Insel<br />
West-Berlin, wo sich die Verhältnisse<br />
einigermaßen normalisiert hatten und<br />
wohin ja auch erhebliche Zuschüsse<br />
aus Bonn flossen. Es gab gleich mehrere<br />
Konzerte <strong>–</strong> mit dem jungen Christian<br />
Zacharias, mit dem Duo Alfons und<br />
Aloys Kontarsky und mit dem Tastentitanen<br />
Shura Cherkassky.<br />
Als Geschäftsführer Wilhelm Arndt<br />
1984 in den Ruhestand ging, war <strong>Bechstein</strong><br />
intensiv bemüht, neue Märkte zu<br />
erschließen. Es herrschte <strong>der</strong> Boom <strong>der</strong><br />
Thatcher-Ära; das schnelle Geld, das an<br />
<strong>der</strong> London Stock Exchange verdient<br />
wurde, brachte eine neue Klasse <strong>der</strong><br />
Luxusverdiener hervor. Doch <strong>der</strong> Flügel<br />
in <strong>der</strong> großzügigen Eigentumswohnung<br />
war nicht mehr das unbedingte<br />
„Must“ wie in früheren Zeiten. 1986<br />
gingen die Geschäfte bei <strong>Bechstein</strong><br />
schlecht.<br />
Diesmal wurde daraus ein radikaler<br />
Neuanfang, am ehesten vergleichbar mit<br />
jenem Beginn, den 1853 Carl <strong>Bechstein</strong><br />
gewagt hatte <strong>–</strong> nur war das Risiko noch<br />
höher. Der 38-jährige Karl Schulze,<br />
Klavierbaumeister und Inhaber des<br />
Oldenburger Musikhauses „Piano Sprenger“,<br />
hatte schon zweimal von Baldwin<br />
das Angebot erhalten, als Geschäftsführer<br />
die Verantwortung bei <strong>Bechstein</strong> zu<br />
übernehmen. Doch Schulze entschloss<br />
sich, dem amerikanischen Eigner Baldwin<br />
die Berliner Traditionsmarke ganz<br />
abzukaufen und erarbeitete mit einer<br />
Berliner Bank ein Finanzierungskonzept.<br />
Im Mai 1986 war <strong>der</strong> Transfer perfekt.<br />
Das Konzept griff; die Reorganisation<br />
des Unternehmens gelang innerhalb<br />
kurzer Zeit. Karl Schulze zielte mit<br />
<strong>Bechstein</strong> kompromisslos auf das obere<br />
Preissegment und hatte Erfolg. Schon<br />
nach <strong>der</strong> Übernahme betonte er in<br />
einem Brief an die Händler, <strong>Bechstein</strong><br />
solle bleiben, „was es <strong>–</strong> in aller Welt <strong>–</strong><br />
von jeher war: ein Name mit Klang“. Zur<br />
Musikmesse im Frühjahr 1987 präsentierte<br />
man das neue Flügelmodell K mit<br />
einer Länge von 1,58 Metern. Der Umsatz<br />
schnellte von zuletzt zehn Millionen<br />
Mark auf 14 Millionen hinauf.<br />
Karl Schulze kaufte <strong>Bechstein</strong> 1986.<br />
26