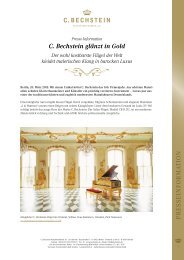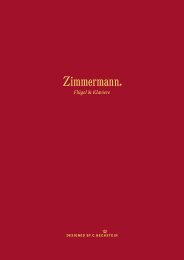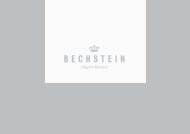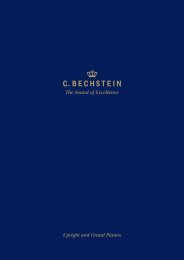C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
C. Bechstein – der Mythos lebt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
13<br />
Leipzig vorzuweisen hatte; und Blüthner,<br />
ebenfalls in Leipzig, war seit 1853<br />
bereits bei Nummer 2.500 angelangt.<br />
Steinway & Sons in New York und<br />
Braunschweig, die 1853 in Amerika mit<br />
Nummer 483 begonnen hatten <strong>–</strong> die<br />
vorangegangenen Instrumente waren<br />
ausschließlich in Deutschland gebaut<br />
worden <strong>–</strong>, hatten bereits dreitausend<br />
Instrumente gefertigt.<br />
Carl <strong>Bechstein</strong> war also zunächst nicht<br />
unbedingt vom kommerziellen Erfolg<br />
verwöhnt. Es war wohl in erster Linie<br />
die künstlerisch-ästhetische Idee, die<br />
ihn trieb. <strong>Bechstein</strong> wollte einen neuen<br />
Klavierklang. Und so berichtet Bülow<br />
Ende 1860 in einem Brief an Liszt, er<br />
habe für die h-Moll-Sonate in Leipzig<br />
einen „ultrasublimen <strong>Bechstein</strong>“ zur<br />
Verfügung gehabt. Über Jahrzehnte<br />
hinweg sollte <strong>der</strong> „<strong>Bechstein</strong>“ mit<br />
seinem Klang den Fortgang <strong>der</strong> Musik<br />
nachhaltig beeinflussen. Unzählige<br />
Kompositionen sind an ihm nie<strong>der</strong>geschrieben<br />
worden.<br />
Zwei Jahre später kommt ein erneuter<br />
Durchbruch. Auf <strong>der</strong> Londoner Industrieausstellung<br />
von 1862 gibt es gegen<br />
die übermächtige englische Konkurrenz<br />
und <strong>der</strong>en gute Verbindungen zur<br />
Ausstellungsleitung Sieger-Medaillen:<br />
„Die Instrumente <strong>Bechstein</strong>s zeichnen<br />
sich durch eminente Frische und<br />
Freiheit des Tones, Annehmlichkeit <strong>der</strong><br />
Spielart und Gleichheit <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Register aus und dürften selbst<br />
<strong>der</strong> kräftigsten Behandlung Wi<strong>der</strong>stand<br />
leisten.“ Über die Ausstellung wurde<br />
auch ein amtlicher Bericht im Auftrag<br />
<strong>der</strong> Kommission <strong>der</strong> Deutschen<br />
Zollvereins-Regierungen angefertigt:<br />
„C. <strong>Bechstein</strong>, Hoflieferant Sr. Majestät<br />
des Königs, dessen Geschäft erst im<br />
August 1856 gegründet wurde, aber<br />
in <strong>der</strong> kurzen Zeit von sechs Jahren<br />
sich zu einer solchen Höhe empor<br />
geschwungen hat, dass er mit 90 Arbeitern<br />
gegen 300 Instrumente, darunter<br />
allein 140 Flügel jährlich fabriziert<br />
und nach Amerika, Asien, England<br />
und Russland ausführt, hatte 2 ganz<br />
ausgezeichnete Flügel geschickt. (…)<br />
Wir berichten mit Freuden, dass seine<br />
Flügel eine große Anzahl von Freunden<br />
in London gefunden haben und<br />
glauben hoffen zu dürfen, dass sie in<br />
England Verbreitung finden…“.<br />
In dieser Zeit, in <strong>der</strong> sich das mo<strong>der</strong>ne<br />
Klavier endgültig entwickelte, gehörte<br />
es zum guten Ton, dass die einzelnen<br />
Firmen energisch darauf bedacht waren,<br />
bedeutende Interpreten an sich zu<br />
binden. Bülow, <strong>der</strong> in solchen Angelegenheiten<br />
von einer entwaffnenden<br />
Offenheit sein konnte, genoss die ausgesprochen<br />
liebenswürdigen Umgangsformen<br />
des Klavierfabrikanten Ludwig<br />
Bösendorfer in Wien. In Russland<br />
spielte er die Flügel <strong>der</strong> renommierten<br />
Petersburger Firma Becker und äußerte<br />
sich sogar vor <strong>Bechstein</strong> lobend über<br />
<strong>der</strong>en Klang und vor allem Spielart. Es<br />
hatte auch über verschiedene Seiten<br />
Annäherungsversuche zwischen<br />
Theodor Steinweg und Bülow gegeben,<br />
und Bülow hatte mehr als einmal<br />
überlegt, ob er nicht in Kontakt zu dem<br />
Braunschweiger Unternehmen treten<br />
sollte. Doch als man ihn, nachdem er<br />
sich 1863 nach einem Konzert in Berlin<br />
lobend über einen Steinway-Flügel geäußert<br />
hatte, zu vereinnahmen suchte,<br />
verbat er sich <strong>der</strong>lei ausdrücklich und<br />
deklarierte öffentlich seine Vorliebe für<br />
das „<strong>Bechstein</strong>’sche Farbenklavier“,<br />
freilich nicht ohne seinen großen<br />
Respekt vor dem Konkurrenzfabrikat<br />
deutlich zu machen.<br />
Über Generationen hinweg<br />
sollte <strong>der</strong> „<strong>Bechstein</strong>“ mit<br />
seinem Klang den<br />
Fortgang <strong>der</strong> Musik<br />
nachhaltig beeinflussen.<br />
Zu Beginn <strong>der</strong> 1860er Jahre beginnt nun<br />
also auch das Unternehmen <strong>Bechstein</strong><br />
zu florieren. <strong>Bechstein</strong> hatte nach dem<br />
Tod Peraus 1861, <strong>der</strong> auch das Ende<br />
<strong>der</strong> Perau’schen Klaviermanufaktur<br />
bedeutete, die eigene Fabrikation in die<br />
Johannisstr. 4 verlegt, auf zwei Grundstücke,<br />
die sich bis zur Ziegelstraße<br />
hinzogen. Ein dort stehendes älteres<br />
Gebäude sollte in den neuen Komplex<br />
einzubezogen werden. In <strong>der</strong> Behrenstraße<br />
56 blieben das Magazin und das<br />
Lager, die erst 1867 auf ein weiteres<br />
Grundstück Johannisstr. 5 umzogen.<br />
Einen Teil des benötigten Kapitals<br />
für den Umzug hatte sich <strong>Bechstein</strong><br />
geliehen. Doch kurz nach dem Umbau<br />
brach ein Brand aus und vernichtete<br />
nahezu alles. Fast hätte dies das Ende<br />
des Unternehmens bedeutet. Doch<br />
noch einmal sprangen Freunde ein<br />
und liehen Geld. Auch Bülow trug dazu<br />
bei, denn er erwähnt verschiedentlich<br />
eine Summe von 2.000 Thalern. So<br />
schrieb Bülow am 24. August 1866 aus<br />
Luzern: „Meine 2.000 brauche ich jetzt<br />
nicht. Ums Himmels willen bewahren<br />
Sie diese Summe, benutzen Sie sie wie,<br />
wann immer bis <strong>–</strong> <strong>der</strong> Teufel wie<strong>der</strong> los<br />
geht …“.<br />
Bülow hatte keine geringe Summe<br />
vorgestreckt, denn aus dem Jahr 1865<br />
gibt es eine Preisliste, wonach ein Konzertflügel<br />
von 8 Fuß Länge, „Mechanismus<br />
mit ununterbrochener Auslösung,<br />
Saitenhalter und Klangbalken“, 700<br />
Preußische Thaler kostete. Ein Stutzflügel<br />
kam auf 450 Thaler. Die Pianinos<br />
lagen zwischen 230 und 280 Thalern.<br />
Die Verpackung „in starker Holzkiste<br />
mit Schrauben“ berechnete das Unternehmen<br />
mit „8 resp. 7 Pr. Th.“.<br />
Die Qualität <strong>der</strong> Instrumente sprach<br />
sich indessen immer mehr herum,<br />
nicht zuletzt dank Bülow. Nichtsdestoweniger<br />
blieb <strong>Bechstein</strong> überaus großzügig.<br />
Anfang Mai 1864 floh Wagner<br />
aus Wien nach München zu seinem<br />
neuen Gönner, dem Bayernkönig Ludwig<br />
II. Und zu seinem Geburtstag kam<br />
aus Berlin ein <strong>Bechstein</strong>-Flügel. Am<br />
25. Mai bedankt sich Wagner artig:<br />
„Als ich vor drei Jahren zum ersten<br />
Male aus dem Exil nach Deutschland<br />
zurückkehrte und kurze Zeit bei<br />
meinem Freunde Liszt in Weimar verweilte,<br />
gerieth ich eines Tages zufällig<br />
über ein Instrument, das mich durch<br />
seinen krystalligen, wonnigen Ton <strong>der</strong><br />
Maaßen freute und fesselte, dass ich<br />
meinem theuren Hans von Bülow, <strong>der</strong><br />
mir bei einem traurigen Abschiede<br />
eine trostreiche Hoffnung erwecken<br />
wollte, den begeisterten Gedanken<br />
eingab, dafür Sorge tragen zu wollen,<br />
dass ein gleiches Instrument mich, wo<br />
ich weilen werde, erheitern solle.“<br />
Der „theure Freund“ Hans von Bülow<br />
konnte damals noch nicht ahnen, dass<br />
Cosima und Richard Wagner einan<strong>der</strong><br />
schon im November 1863 in Berlin<br />
getroffen und das „Bekenntnis, uns<br />
einzig gegenseitig anzugehören“<br />
ausgetauscht hatten. Am 10. April<br />
1865 wurde Isolde, das erste gemein-<br />
Begegnungen <strong>der</strong> <strong>Bechstein</strong>-Freunde: Richard Wagner im Gespräch mit Cosima von Bülow, spätere Wagner, Hans von Bülow und Franz Liszt, ca. 1869.<br />
same Kind von Cosima von Bülow und<br />
Richard Wagner, in München geboren.<br />
Am 10. Juni 1865 dirigierte Hans von<br />
Bülow in München die Uraufführung<br />
von Wagners „Tristan und Isolde“.<br />
Ende 1864 war Bülow, <strong>der</strong> ebenfalls<br />
nach München gegangen war, von<br />
<strong>Bechstein</strong> bedacht worden. Und zwar<br />
gleich mit zwei Flügeln, einem kleinen<br />
in Eiche und einem großen „wun<strong>der</strong>bar<br />
schönen“, den <strong>der</strong> Pianist kurz vor<br />
Weihnachten mit Erfolg im Konzert<br />
benutzte: „Ihr Flügel hat famos geklungen,<br />
hell, deutlich, voll. Alles ist sich<br />
darüber einig, dass man solche Pianos<br />
in München noch nicht gehört. Ich hoffe,<br />
dass auch die Augsburger [Musikzeitung]<br />
davon reden wird <strong>–</strong> Steinweg<br />
kann diesmal niemanden gegen Sie<br />
bestechen“. Noch bevor die Flügel eintrafen,<br />
schrieb Bülow an <strong>Bechstein</strong> ein<br />
aufschlussreiches Notabene: „Der König<br />
kommt anfangs nächsten Monats.<br />
Das erste, was Wagner und ich ihm zu<br />
oktroyieren vorhaben, ist natürlich ein<br />
‚<strong>Bechstein</strong>‘!“<br />
<strong>Bechstein</strong> dachte sich für Wagner später<br />
noch etwas Beson<strong>der</strong>es aus. 1867<br />
schickte er diesem, <strong>der</strong> nach etlichen<br />
Monaten erzwungenen Auslandsaufenthalts<br />
wie<strong>der</strong> nach München gezogen<br />
war, einen „Piano-Sekretär“, ein Klavier,<br />
das zugleich Schreibtisch war und<br />
damit ein zum Komponieren beson<strong>der</strong>s<br />
geeignetes Möbel. Den Piano-Sekretär<br />
musste er allerdings nicht verschenken.<br />
Bülow an <strong>Bechstein</strong>: „Das Wagnerklavier<br />
(wir sind erfreut, dass es fertig) ist<br />
eine offiziell Allerhöchste Bestellung<br />
zum 22. Mai, nur durch meine Frau<br />
vermittelt.“ Bülows Gattin Cosima<br />
hatte zwar Wagner inzwischen schon<br />
eine zweite Tochter geboren, fungierte<br />
aber offiziell als dessen „Sekretärin“.<br />
Bülow in einem weiteren Brief: „Ihr<br />
Piano-Sekretär <strong>–</strong> himmlisch <strong>–</strong> hat dem<br />
verehrten Meister große, große Freude<br />
bereitet! Haben Sie das Gegengeschenk<br />
seiner Büste empfangen? Ferner (hierüber<br />
bitte ich nur positive Auskunft)<br />
hat Ihnen das Hofsekretariat Ihr<br />
Kunstwerk honoriert? Wenn noch nicht,<br />
so schreiben Sie mir’s gleich <strong>–</strong> weil ich<br />
dann sofort mahnen werde <strong>–</strong> und mit<br />
Erfolg!“<br />
Während Bülow, wohin er auch kam,<br />
mit <strong>der</strong> größten Entschiedenheit für<br />
die Instrumente <strong>Bechstein</strong>s warb,<br />
hatte <strong>der</strong> Klavierfabrikant an dem<br />
hochnervösen, zunehmend unter<br />
Kopfschmerzen leidenden Pianisten<br />
keinen leicht zu nehmenden Freund.<br />
Dass er bereit war, Bülow in sein Haus<br />
aufzunehmen, wann immer <strong>der</strong> in<br />
Berlin Station machte, wurde geradezu<br />
selbstverständlich. Häufig musste sich<br />
<strong>der</strong> Pianist bei <strong>Bechstein</strong> von völliger<br />
Erschöpfung erholen, wo er fürsorglich<br />
abgeschirmt wurde gegen jede, auch<br />
die freundschaftlichste Zudringlichkeit.<br />
War Bülow auf Reisen, so versorgte<br />
<strong>Bechstein</strong> ihn nicht nur mit seinen<br />
Konzertflügeln, son<strong>der</strong>n auch mit<br />
Zeitungen, Zigaretten und gelegentlich<br />
sogenannten “Judenwitzen”. Denn<br />
Bülow pflegte einen leicht snobistischen<br />
Antisemitismus, <strong>der</strong> von seinen<br />
jüdischen Freunden wie dem Cellisten<br />
Heinrich Grünfeld o<strong>der</strong> dem Pianisten<br />
Moritz Moszkowski mit Fassung ertragen,<br />
gelegentlich auch mit scharfsinnigen<br />
Aperçus beantwortet wurde.<br />
In <strong>der</strong> Freundschaft zwischen dem Klavierfabrikanten<br />
und „seinem“ Pianisten<br />
fehlt jedes Moment von Berechnung.<br />
<strong>Bechstein</strong> war, so erfolgreich er als<br />
Unternehmer mit den Jahren auch wurde,<br />
weiterhin von seinem Klangideal<br />
getrieben; und er blieb ein Mensch, <strong>der</strong><br />
Begegnungen am <strong>Bechstein</strong><br />
14