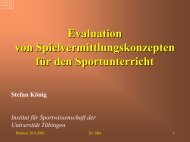Vorlesung Technikoptimierung - Volleyball-Training.de
Vorlesung Technikoptimierung - Volleyball-Training.de
Vorlesung Technikoptimierung - Volleyball-Training.de
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bewegung und <strong>Training</strong>: 10. <strong>Vorlesung</strong>seinheitReferent: Prof. Dr. Klaus RothWie optimiert man Sporttechniken?Theoretische Grundlagen und Metho<strong>de</strong>n1 EinleitungDas Ziel <strong>de</strong>r Vermittlung einer großen Fertigkeitsvielfalt, vor allem im Schulsport,darf nicht als Begründung o<strong>de</strong>r Rechtfertigung für ein „Hasten“ von Bewegungsformzu Bewegungsform missverstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Nach <strong>de</strong>n ersten erfolgreichenVersuchen sind die Ausführungen in <strong>de</strong>r Regel noch sehr störanfällig und durchUngenauigkeiten, beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n Festlegungen <strong>de</strong>r wesentlichen Programmparametergekennzeichnet. Das Üben <strong>de</strong>r neu erworbenen Grundtechniken solltedaher nicht frühzeitig und abrupt abgebrochen wer<strong>de</strong>n. Der methodische Akzentverlagert sich zunehmend auf eine systematische Fertigkeitsoptimierung.In <strong>de</strong>r 9. <strong>Vorlesung</strong>seinheit ist ausführlich auf <strong>de</strong>n Neuerwerb von Sporttechnikeneingegangen wor<strong>de</strong>n. Es wur<strong>de</strong> gezeigt, dass das <strong>Training</strong> mit <strong>de</strong>m zielgerichtetenEinsatz von Vereinfachungsstrategien beginnt. Bewährte Prinzipien sind diehorizontale und vertikale Zerlegung <strong>de</strong>r zu erwerben<strong>de</strong>n Bewegungsform, die Unterstützung<strong>de</strong>r unaustauschbaren Strukturelemente (z.B. Rhythmus-/Orientierungshilfen)sowie die Modifikation <strong>de</strong>r verän<strong>de</strong>rbaren Ausführungsbestandteile(z.B. Slow-Motion-Üben, Üben mit geringerem Krafteinsatz). Die Rücknahme <strong>de</strong>rErleichterungen geschieht im Rahmen <strong>de</strong>r allseits bekannten methodischen Ü-bungsreihen (MÜR), die in serieller, funktionaler o<strong>de</strong>r programmierter Form zu gestaltensind (Roth, 1998).Die 10. <strong>Vorlesung</strong> thematisiert die Automatisierung und Stabilisierung/Variationvon Sporttechniken. Diese Phasen schließen sich an das Neulernen und an einenzumeist eher kurzen Abschnitt <strong>de</strong>s Überlernens an. Methodisch gibt es zum Überlernennur wenig zu sagen. Im Mittelpunkt steht die Wie<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Grobformbeherrschten Techniken.Die Abbildung 1 vermittelt einen groben Überblick über das grundlegen<strong>de</strong> methodischeVorgehen in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Lernphasen. Mit ihr wird die Ziel-/Inhaltssystematikaus <strong>de</strong>r 9. <strong>Vorlesung</strong>seinheit auf die Metho<strong>de</strong>nebene übertragen.1. Neulernen = Technikvereinfachungen2. Überlernen = Technikwie<strong>de</strong>rholungen3. Automatisierung = Weglenken von Aufmerksamkeit4. Stabilisierung/Variation = Hinlenken von Aufmerksamkeit
Wie<strong>de</strong>rholungenHinlenken vonAufmerksamkeitAbb. 1: Systematik <strong>de</strong>s Techniktrainings – Metho<strong>de</strong>nebene (Rot h, 1997)Es wird erkennbar, dass die Prozesse <strong>de</strong>r Automatisierung (vertikales Kontinuum)einerseits und <strong>de</strong>r Stabilisierung/Variation (horizontales Kontinuum) an<strong>de</strong>rerseitsin einem engen wechselseitigen Zusammenhang stehen und sich in sinnvollerWeise ergänzen. Das Automatisierungstraining ist auf eine allmähliche Freisetzung<strong>de</strong>r zunächst bewegungsgebun<strong>de</strong>nen Aufmerksamkeitsanteile gerichtet. ImStabilisierungs-/Variationstraining geht es um die Nutzung <strong>de</strong>r freigewor<strong>de</strong>nenKapazitäten, also um ihren bedingungsgerechten, aufgabenbezogenen Einsatz.Methodisch betrachtet basieren die bei<strong>de</strong>n Bereiche <strong>de</strong>r <strong>Technikoptimierung</strong> damitauf einer gera<strong>de</strong>zu umgekehrten Logik: <strong>de</strong>m Weglenken o<strong>de</strong>r Hinlenken von Aufmerksamkeit.An<strong>de</strong>rs ausgedrückt: mit ein und <strong>de</strong>rselben Übung kann niemalsgleichzeitig die Automatisierung und die Stabilisierung/Variation trainiert wer<strong>de</strong>n.Im Folgen<strong>de</strong>n wird näher auf die in Abbildung 1 dargestellten Kontinua „AufmerksameKontrolle ↔ Automatisierte Kontrolle“ und „Stabilisierung ↔ Variabilität“eingegangen. Welcher genaue Zielpunkt auf <strong>de</strong>m zuletzt genannten horizontalenKontinuum angesteuert wird, hängt dabei vom jeweiligen Aufgaben-/Fertigkeitstypbzw. von <strong>de</strong>r Sportart ab.
2 „Aufmerksame Kontrolle « Automatisierte Kontrolle“Beim Automatisierungstraining steht die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Informationsverarbeitungim Vor<strong>de</strong>rgrund, die anfänglich durch eine große subjektiv empfun<strong>de</strong>ne Anstrengungund Konzentration charakterisiert ist. Die Steuerung <strong>de</strong>r Bewegung o-<strong>de</strong>r einzelner Teile soll von höheren Regulationsinstanzen (Hirnrin<strong>de</strong>) auf tiefereEbenen verlagert wer<strong>de</strong>n, die nicht mehr einer direkten Kontrolle <strong>de</strong>s Bewusstseinsunterliegen (vgl. z. B. Weineck, 1994, S. 95). Hierdurch erfolgt eine Entlastung<strong>de</strong>r Großhirnrin<strong>de</strong> und es wer<strong>de</strong>n – so stellt man sich dies in <strong>de</strong>n so genanntenRessourcentheorien vor (vgl. Moray, 1967; Kahnemann, 1973) – Kapazitätenfrei, die an<strong>de</strong>rweitig genutzt wer<strong>de</strong>n können.Aus dieser prinzipiellen Zielrichtung <strong>de</strong>s Automatisierungstrainings ergibt sich fastzwangsläufig die folgen<strong>de</strong> methodische Grundregel:• Im Automatisierungstraining sind Übungen einzusetzen, bei <strong>de</strong>nen die Aufmerksamkeitvon <strong>de</strong>n Bewegungsausführungen weggelenkt bzw. weggenommenwird!Die dahinter stehen<strong>de</strong> Grundi<strong>de</strong>e ist klar. Wenn man Aufmerksamkeit weglenkt,dann übt man gezielt die Ausführung ohne Aufmerksamkeit, also die automatisierteForm <strong>de</strong>r Bewegung. Die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Automatisierungstrainings beschränkensich <strong>de</strong>mnach keineswegs – obwohl dies in <strong>de</strong>r Sportliteratur vielfach behauptetwird – auf ein starres Wie<strong>de</strong>rholen o<strong>de</strong>r monotones Üben. Vielmehr steht dieVorgabe von so genannten Doppel- o<strong>de</strong>r Mehrfachaufgaben im Vor<strong>de</strong>rgrund. Beiihnen wer<strong>de</strong>n parallel zur Kriteriumsbewegung weitere (kognitive o<strong>de</strong>r motorische)Anfor<strong>de</strong>rungen einbezogen. Diese Zusatzbeanspruchungen können dabei, wie imIntegrierten Kontrolltraining von Strang (1991), sportartunspezifisch sein, z.B. von„400 in Dreierschritten rückwärts zählen“, o<strong>de</strong>r aber sportartspezifischen Charaktertragen, in<strong>de</strong>m während <strong>de</strong>r Ausführungen disziplintypische (bewegungsbezogene)Wahrnehmungsaufgaben o<strong>de</strong>r taktische Entscheidungsanfor<strong>de</strong>rungen zubewältigen sind.Aus praktischer Sicht stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt im LernverlaufZusatzaufgaben gestellt wer<strong>de</strong>n können. „Kann man damit direkt nach <strong>de</strong>r erstengelungenen Programmausführung beginnen?“ o<strong>de</strong>r: „Sollte zunächst die Techniknoch weiter überlernt (wie<strong>de</strong>rholt) wer<strong>de</strong>n?“ Eine allgemein verbindliche Antwortlässt sich hierauf natürlich nicht geben. Die Studien von Szymanski (1997) mitBewegungsformen aus <strong>de</strong>m Tischtennis, Badminton und <strong>Volleyball</strong> weisen jedochauf zweierlei hin. Erstens scheint es sinnvoll zu sein, möglichst rasch nach <strong>de</strong>mTechnikerwerb mit <strong>de</strong>m zielgerichteten Automatisierungstraining zu beginnen.Zweitens sollte man auch bei <strong>de</strong>n Zusatzaufgaben mo<strong>de</strong>rat und schrittweise vorgehen.Die Abbildung 2 illustriert exemplarisch die Ergebnisse <strong>de</strong>s Badmintonexperiments.Wie bei allen an<strong>de</strong>ren Untersuchungen erreichten jene Lerngruppendie größten Leistungsfortschritte, in <strong>de</strong>ren Übungen von Anfang an mo<strong>de</strong>rate perzeptivebzw. taktische Zusatzanfor<strong>de</strong>rungen enthalten waren. Die Gruppen, die
weiter rein motorisch übten o<strong>de</strong>r gleich mehrere (zwei) Zusatzaufgaben zu bewältigenhatten, schnitten signifikant schlechter ab.1,210,80,60,40,20I Keine II Eine III Eine IV ZweiAbb. 2: Badmintonexperiment von Szymanski (1997)Anzumerken ist, dass <strong>de</strong>r Grad <strong>de</strong>r Bewegungsautomatisierung häufig kaum o<strong>de</strong>rgar nicht am äußeren Fertigkeitsbild ablesbar ist. Der Leistungsfortschritt zeigtsich in <strong>de</strong>r Regel erst bei <strong>de</strong>r Lösung <strong>de</strong>r angesprochenen Doppel- o<strong>de</strong>r Mehrfachaufgaben.Konkret dokumentiert er sich in einer zunehmen<strong>de</strong>n Interferenzfreiheit,d.h. darin, dass die technischen Ausführungen mehr o<strong>de</strong>r weniger problemlosmit gleichzeitigen Zusatztätigkeiten verknüpft wer<strong>de</strong>n können.3 Stabilisierung « VariabilitätDas Stabilisierungs-/Variationstraining baut auf <strong>de</strong>n verfügbaren Aufmerksamkeitsressourcenauf. Beim Stabilisierungstraining wird die Aufmerksamkeit für gezielteVerbesserungen <strong>de</strong>r Ergebniskonstanz benötigt, bei <strong>de</strong>r Variationsschulunggeht es um präzise Modifikationen <strong>de</strong>r Grundmuster. Das Stabilisierungstrainingist vor allem in <strong>de</strong>n geschlossenen Sportdisziplinen (z.B. Gerätturnen, Leichtathletik,Schwimmen, Wasserspringen) wichtig, das Variationstraining dominiert in <strong>de</strong>noffenen, situativen Sportarten und in <strong>de</strong>n Sportspielen. Es ist allerdings daraufhinzuweisen, dass – an<strong>de</strong>rs als bei <strong>de</strong>n Inhalten – auf <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>nebene keineein<strong>de</strong>utige Abgrenzung möglich ist. Das Ziel „Stabilisierung“ setzt immer auch Variationstrainingund das Ziel „Variation“ immer auch Stabilisierungstraining voraus.StabilisierungstrainingDie in <strong>de</strong>n geschlossenen Disziplinen gewünschte Konstanz im Leistungsverhalten(Ergebniskonstanz) wird nicht einfach dadurch erreicht, dass die erlernten motorischenProgramme mit stets i<strong>de</strong>ntischen Parameterfestlegungen wie<strong>de</strong>rholt
wer<strong>de</strong>n. Neben einem hohen Maß an Präzision und Stabilität (vor allem <strong>de</strong>r Programminvarianten)ist auch ein gewisses Maß an Variabilität (vor allem <strong>de</strong>r Programmparameter)notwendig, vorrangig um die aktuellen Bewegungsausführungen:• anzupassen, z.B. an die Beschaffenheit <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>nbelages, an die Elastizität<strong>de</strong>r Geräte, an die Beleuchtungsverhältnisse, an Wetterbedingungen(Wind, Temperatur, Wellen usw.);• abzuschirmen, z.B. gegenüber körpereigenen Empfindungen (Ermüdung,Schmerz), gegenüber psychischen Beanspruchungen (Zuschauergeräusche,vorausgegangene Misserfolge), gegenüber plötzlichen Störgrößen;• zu kombinieren, z.B. mit Gesten und Gebär<strong>de</strong>n, die auf eine Steigerung <strong>de</strong>skünstlerischen Ausdrucks im Bewegungsvollzug zielen.Hierbei han<strong>de</strong>lt es sich zumin<strong>de</strong>st teilweise um (antizipierbare) Vorgänge, die bewegungsbegleitendbewusste Entscheidungen und damit freie kognitive Kapazitätenvoraussetzen.• Im Stabilisierungstraining sind Übungen heranzuziehen, bei <strong>de</strong>nen die (freigewor<strong>de</strong>ne)Aufmerksamkeit zielgerichtet auf Knotenpunkte bzw. Detailfunktionen<strong>de</strong>r Bewegung hingelenkt wird!Angestrebt wird eine weitere Präzisierung <strong>de</strong>r Bewegungsvorstellung sowie dieAbschirmung <strong>de</strong>r Technikrealisierung gegenüber Stör- und Stressreizen. Man unterschei<strong>de</strong>tzwischen bewegungsungebun<strong>de</strong>nen und bewegungsgebun<strong>de</strong>nen Metho<strong>de</strong>n.Die bewegungsungebun<strong>de</strong>nen Verfahren sind primär auf das Bewusstmachen<strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns gerichtet. Der Turner z.B. versucht, in seiner (gedanklichen)Vorstellung wichtige Bestandteile eines Elements richtig auszuführen, ersagt sich vor, „was er zu tun hat“. Er bewertet sich nach <strong>de</strong>n Bewegungstätigkeitenselbst (lautsprachlich o<strong>de</strong>r schriftlich) und ver<strong>de</strong>utlicht sich, wie sich die Bewegung„angefühlt“ hat. Insgesamt wer<strong>de</strong>n für diesen Bereich heute vielfältige psychologischeMaßnahmen vorgeschlagen. Empfohlen wer<strong>de</strong>n u.a. das Verbalisierungs-,Sensibilisierungs- und Mentale <strong>Training</strong> bis hin zum Autogenen <strong>Training</strong>und <strong>de</strong>r Autosuggestion. Für einen ausführlichen, aktuellen Überblick kann auf Balow(1993) verwiesen wer<strong>de</strong>n.Ausführungsbezogene Metho<strong>de</strong>n sind z.B. Kontrastübungen, Übungen unter verän<strong>de</strong>rtenWahrnehmungsbedingungen, physisches und psychisches Stresstrainingsowie Wettkampftraining. Die Abbildung 3 gibt einen Überblick über die bewegungsgebun<strong>de</strong>nenLehrmetho<strong>de</strong>n. Das Lenken <strong>de</strong>r Aufmerksamkeit auf wesentlicheTechnik<strong>de</strong>tails und das bei geschlossenen Fertigkeiten damit verbun<strong>de</strong>neInteresse einer Erhöhung <strong>de</strong>r Leistungskonstanz kann durch Verän<strong>de</strong>rungen<strong>de</strong>r Bewegungsrealisierungen an sich und/o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Ausführungssituationen erreichtwer<strong>de</strong>n.
Üben in verschie<strong>de</strong>nen Kombinationen:Schaffen von Kontrasten, vonunvorhersehbaren ReihenfolgenÜben von Teilbewegungen: nur <strong>de</strong>n Anlauf,nur das WasserfassenÜben unter psychischen Belastungen: unterStress, unter WettkampfbedingungenÜben unter physischen Belastungen: unterErmüdung, mit Gewichtswestenunverän<strong>de</strong>rte TechnikÜben unternormalenBedingungenunverän<strong>de</strong>rte Ausführungssituation verän<strong>de</strong>rteÜben in verän<strong>de</strong>rtenUmweltbedingungen: Wind, Gelän<strong>de</strong>,Wasser, Straßenbelag, SchneeÜben mit Zusatzgeräten: Flossen,SchwimmbretterÜben unter verän<strong>de</strong>rtenGerätebedingungen: mit kleineren,größeren, leichteren, schwereren, an<strong>de</strong>rsgeformten Geräten o<strong>de</strong>r ohne Geräteverän<strong>de</strong>rte TechnikÜben mit verän<strong>de</strong>rten Bewegungsparametern:an<strong>de</strong>reKräfte, Geschwindigkeiten,Richtungen, KörperteileBewusstes Ausführenfehlerhafter BewegungenAbb. 3: „Metho<strong>de</strong>nkreuz“ für das StabilisierungstrainingIm Feld I geht es vorrangig um das <strong>Training</strong> <strong>de</strong>r Kombinierbarkeit und <strong>de</strong>r Abschirmung<strong>de</strong>r Techniken. Das Einbeziehen von psychischen o<strong>de</strong>r physischen Zusatzanfor<strong>de</strong>rungenerfolgt dabei mit an<strong>de</strong>rer Zielsetzung als beim Automatisierungstraining.Geschult wird nicht das Weglenken <strong>de</strong>r Aufmerksamkeit, son<strong>de</strong>rndas Gegenteil, d.h., das störresistente Halten <strong>de</strong>r Konzentration bei <strong>de</strong>n Knotenpunkten<strong>de</strong>r Bewegungsausführungen. In II und III wird eine höhere Anpassungsfähigkeit<strong>de</strong>r Fertigkeiten angestrebt. Hier können die Umweltbedingungen wettkampftypisch(Gelän<strong>de</strong>, Bo<strong>de</strong>nbelag, Wind usw.) o<strong>de</strong>r wettkampfuntypisch (Flossen,schwerere, an<strong>de</strong>rs geformte Geräte usw.) variiert wer<strong>de</strong>n und/o<strong>de</strong>r die Technikenwer<strong>de</strong>n alleine, ohne unmittelbaren Situationsbezug, z.B. hinsichtlich ihrerParameterisierungen, systematisch verän<strong>de</strong>rt.VariationstrainingZielstellungen und InhalteIm Technikvariationstraining sollen die Sportler lernen, die von ihnen beherrschtenBewegungsmuster (motorischen Programme) präzise und situationsangepasst zuverän<strong>de</strong>rn (Zielstellung). Was kann – im Detail betrachtet – bei <strong>de</strong>r Ausführungvon offenen Techniken modifiziert wer<strong>de</strong>n? Was ist also in gewissen Grenzen variabelgestaltbar, d.h. nicht festgelegt, und gehört nicht unaustauschbar zur „Bewegungan sich“?Folgt man <strong>de</strong>n Informationsverarbeitungstheorien (8. <strong>Vorlesung</strong>seinheit), dannsind zwei zentrale Inhalte <strong>de</strong>s Variationstrainings voneinan<strong>de</strong>r zu unterschei<strong>de</strong>n(vgl. Abbildung 4):1. die Hilfsfunktionsphasen können strukturell variiert wer<strong>de</strong>n!
2. die Gesamttechnik o<strong>de</strong>r einzelne Phasen können mit unterschiedlichenBewegungsparametern ausgeführt wer<strong>de</strong>n!Abb. 4: Inhalte <strong>de</strong>s TechnikvariationstrainingsStrukturelle Variationen in <strong>de</strong>n (vorbereiten<strong>de</strong>n) HilfsfunktionsphasenFür das Technikvariationstraining ist die Unterscheidung zwischen Haupt- undHilfsfunktionsphasen sehr wichtig. Wenn man z.B. einen Sprungwurf variierenmöchte, dann muss trotz <strong>de</strong>r vielfältigen Verän<strong>de</strong>rungsmöglichkeiten stets währen<strong>de</strong>ines Sprungs geworfen wer<strong>de</strong>n. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: Die grundsätzlicheAblaufstruktur <strong>de</strong>r Hauptphase darf nicht verän<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r gar weggelassen wer<strong>de</strong>n.Sie <strong>de</strong>finiert die Technik, ohne ein Werfen im Sprung wird „irgend etwas“, aberkein Handball-Sprungwurf ausgeführt.Prinzipiell an<strong>de</strong>rs ist das bei <strong>de</strong>n Hilfsfunktionsphasen. Ihre Strukturen sind verän<strong>de</strong>rbar,sie können zum Teil auch vollständig ersetzt wer<strong>de</strong>n. Der Sprungwurfbleibt ein Sprungwurf unabhängig von <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r Ballannahme, von <strong>de</strong>r Anlaufrichtung,von <strong>de</strong>r Schrittzahl, von <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>s Absprungs (links, rechts, beidbeinig),von <strong>de</strong>r Wurfposition (RL/RR, RM, RA/LA, nach Gegenstoß) usw. Die Hauptphasenaller bekannten offenen Sporttechniken können in diesem Sinne bewusst undvielseitig mit verschie<strong>de</strong>nen Hilfsfunktionsphasen gekoppelt wer<strong>de</strong>n. Es ist dabeiklar und kaum geson<strong>de</strong>rt erwähnenswert, dass die Regeln „Variabilitätsgrenzen“ziehen. Natürlich muss im Sprungwurfbeispiel die Schrittzahl (ohne Prellen) zwischennull und drei bleiben, und das Schwungbein beim Sprung darf nicht „gegenspieler-gefähr<strong>de</strong>nd“angezogen wer<strong>de</strong>n.
suchungen mit Sportlern aus verschie<strong>de</strong>nen Disziplinen zeigen, dass das Optimum<strong>de</strong>r Variabilität keineswegs mit ihrem Maximum gleichzusetzen ist. Bewegungsvariationenentwickeln sich besser, wenn sie übersichtlich geordnet und für<strong>de</strong>n Sportler gedanklich nachvollziehbar trainiert wer<strong>de</strong>n:1. Vereinfachungsprinzip:Es wer<strong>de</strong>n nur einzelne o<strong>de</strong>r wenige, d.h. nicht alle (möglichen) Merkmalevariiert. Die Übungen konzentrieren sich z.B. beim Sprungwurf nur auf Verän<strong>de</strong>rungen<strong>de</strong>r Schrittzahl o<strong>de</strong>r auf die Art <strong>de</strong>s Absprungs, auf Variationen<strong>de</strong>r Gesamtgeschwindigkeit o<strong>de</strong>r auf einen Dynamikwechsel zwischen <strong>de</strong>rHaupt- und <strong>de</strong>n Hilfsphasen.2. Vereinfachungsprinzip:Es wer<strong>de</strong>n zwar mehrere Variationsquellen gleichzeitig trainiert, aber <strong>de</strong>rUmfang (die Ausprägung) <strong>de</strong>r Variabilität wird verkleinert. Bei diesem Vorgehenwer<strong>de</strong>n nicht die gesamten Variabilitäts-Spielräume ausgeschöpft. Eswird z.B. nur zwischen zwei und drei Anlaufschritten gewechselt, die gefor<strong>de</strong>rtenVerän<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>n Bewegungsparametern wer<strong>de</strong>n mehr o<strong>de</strong>rweniger stark eingeschränkt (Oberkörperhaltung: „nur“ Wechsel zwischen„zur Wurfarm- und zur Wurfarmgegenseite“; Wurfrichtung: „nur“ Wechselzwischen „links flach und rechts hoch“; Bewegungsgeschwindigkeit: „nur“Wechsel zwischen „schnell und mittelschnell“).Auf <strong>de</strong>r Grundlage dieser bei<strong>de</strong>n Vereinfachungsprinzipien bil<strong>de</strong>n sich jeweils differenzierteTeilerfahrungen/-regeln aus (vgl. Schematheorie; 8. <strong>Vorlesung</strong>seinheit).Sie können aufgeschaltet, und mit zunehmen<strong>de</strong>r Übungsdauer schrittweisemiteinan<strong>de</strong>r verknüpft wer<strong>de</strong>n. Noch später sollte – wie in allen an<strong>de</strong>ren Inhaltsbereichen<strong>de</strong>s <strong>Training</strong>s – zum Teil auch mit höheren (hier: Variabilitäts-)Anfor<strong>de</strong>rungentrainiert wer<strong>de</strong>n als sie im Wettkampf selbst vorkommen.4 Literaturdokumentation(Ann-Kristin Ehling und Carmen Petermann)Roth, K. (Hrsg.). Techniktraining im Spitzensport. Alltagstheorien erfolgreicherSportler (Kapitel 3, S 65-99). Köln: StraußDas Buch „Techniktraining im Spitzensport – Alltagstheorien erfolgreicher Trainer“ist im Jahr 1996 erschienen. Die Veröffentlichung geht auf ein Projekt aus <strong>de</strong>nJahren 1994 und 1995 zurück, das vom Bun<strong>de</strong>sinstitut für Sportwissenschaft inKöln geför<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Der Titel weist bereits auf <strong>de</strong>n Inhalt hin: Die Möglichkeiten,Leistungssteigerungen auf konditioneller Ebene im Spitzensport zu erzielen, sindweitgehend ausgereizt. Verbesserungsmöglichkeiten liegen vielmehr im Bereich<strong>de</strong>r Technik. Der Schwerpunkt zielt auf Qualität statt auf Quantität. Denn heutzu-
tage sind im Spitzensport Umfangs- und Intensitätssteigerungen kaum mehr möglich.Das Projekt wur<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r FU Berlin begonnen. Der Arbeitsgruppe gehörten nebenKlaus Roth die Wissenschaftlichen Mitarbeiter Ernst-Joachim Hossner, StefanKünzell, Thomas Pauer, Markus Raab, Daniela Schipke, Birgit Szymanski undRainer Wollny an. Das Forschungsvorhaben wur<strong>de</strong> am Institut für Sport undSportwissenschaft <strong>de</strong>r Universität Hei<strong>de</strong>lberg fortgeführt und been<strong>de</strong>t, unter zusätzlicherBeteiligung von Daniel Memmert.Das Charakteristische <strong>de</strong>s Projekts ist die gewählte methodische Vorgehensweise.Üblicherweise wer<strong>de</strong>n sportbezogene Projekte vor <strong>de</strong>m Hintergrund wissenschaftlicherTheorien bearbeitet. Hier jedoch wird <strong>de</strong>r Weg über das Alltagswissen<strong>de</strong>r Praxis eingeschlagen. „Aus <strong>de</strong>r Praxis für die Praxis“ – so lautet die grundlegen<strong>de</strong>I<strong>de</strong>e. Ausgangspunkt waren umfangreiche fokussierte Interviews (Leitfa<strong>de</strong>ninterviews),die mit erfolgreichen Bun<strong>de</strong>strainern aus verschie<strong>de</strong>nen Sportartengeführt wur<strong>de</strong>n. Diese Interviews wur<strong>de</strong>n komplett verschriftet (Transkription)und anschließend ausgewertet. Die Auswertung verlief über drei Schritte:• Erstellung von Protokollen über das Interview und Zusammenfassung <strong>de</strong>rwichtigsten Aussagen je<strong>de</strong>s Interviewten in Form eines individuellen Trainerportraits.• Erstellung einer kategorienspezifischen Auswertung über alle Trainerinterviewshinweg. Nach<strong>de</strong>m die Alltagstheorien <strong>de</strong>r einzelnen Trainer betrachtetwur<strong>de</strong>n, wird versucht, die relevanten Aussagen trainerübergreifend zu ordnenund systematisch zu vergleichen. Dies geschieht auf <strong>de</strong>r Basis einesKategoriensystems. Es wur<strong>de</strong> aus einer systematischen Literaturrecherchein <strong>de</strong>n sportspezifischen Datenbanken SPOLIT (Stand 9/1993) undSPORTDISKUS (Stand 12/1993) sowie auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r Befragungsergebnisseselbst abgeleitet. Folgen<strong>de</strong> Kategorien kamen zur Anwendung:<strong>Training</strong>sinhalte/-metho<strong>de</strong>n, Psychologisches <strong>Training</strong>, Komplextraining, Informationsgestaltung,Technikleitbild, <strong>Training</strong>splanung und Trainerwissen.Zu je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kategorien wur<strong>de</strong>n die zentralen Traineraussagen systematischzusammengefasst. Beson<strong>de</strong>rs beeindruckend sind die durchwegangeführten Zitate <strong>de</strong>r Trainer, die die theoretischen Überlegungenunterstreichen und einleuchtend illustrieren.• Verdichtung <strong>de</strong>r Auffassungen und Meinungen <strong>de</strong>r Trainer zu zehn Prinzipien<strong>de</strong>s Techniktrainings im Spitzensport (Prinzip <strong>de</strong>r Komplexität, Funktionalität,Individualisierung, Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit, Einsicht,Qualität, Kreativität und Originalität, Kongruenz, perzeptiven Führung, optimalenAufmerksamkeitszuwendung). Diese Prinzipien wur<strong>de</strong>n im Rahmeneiner zweiten Befragung auf ihre Akzeptanz hin evaluiert. Es wur<strong>de</strong> einstandardisierter Fragebogen konstruiert und mehr als 150 an<strong>de</strong>ren Trainernvorgelegt. Im Ergebnis erwiesen sich die Prinzipien fast durchgängig alsmehrheitsfähig. In weiteren empirischen Untersuchungen wer<strong>de</strong>n ihre
Grundaussagen <strong>de</strong>rzeit experimentell und quasiexperimentell auf <strong>de</strong>n Prüfstandgestellt.Das Buch von Klaus Roth und seinen Mitarbeitern kann als Versuch betrachtetwer<strong>de</strong>n, eine Brücke über die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, um<strong>de</strong>n Transfer sportwissenschaftlicher Erkenntnisse in <strong>de</strong>n Alltag <strong>de</strong>s Sports zu ermöglichen.Dabei kommt es darauf an, miteinan<strong>de</strong>r statt übereinan<strong>de</strong>r zu sprechen,was hier mit <strong>de</strong>n Trainerinterviews überzeugend umgesetzt wor<strong>de</strong>n ist.5 LiteraturBALOW, B.: Theoretische und empirische Untersuchungen zur zielgerichteten Herausbildung undVervollkommnung von Bewegungsvorstellungen im Grundlagentraining <strong>de</strong>r Leichtathletik.(Unveröffentlichte Dissertation), Rostock 1993.BREDEMEIER, H. / SPÄTE, D. / SCHUBERT, R. / ROTH, K.: Handball-Handbuch 2: Grundlagentrainingfür Kin<strong>de</strong>r und Jugendliche. Münster 1990.BRUCKMANN, K. / BRÖCKER, H. / BRUCKMANN, M.: Gerätturnen Jungen. Sport – Sekundarstufe II.Düsseldorf 1981.HEUER, H. / PRINZ, W.: Initiierung und Steuerung von Handlungen und Bewegungen. In: M. AME-LANG (Red.): Bericht <strong>de</strong>s 35. Kongresses <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Bd.2., Hei<strong>de</strong>lberg 1987, 289–299.KAHNEMANN, D.: Attention and effort. Englewood Cliff, 1973.MAGILL, R. A.: Motor learning. Dubuque 1981 2 .MEINEL, K. / SCHNABEL, G.: Bewegungslehre. Berlin (DDR) 1987 8 .MORAY, N.: Where is capacity limited? A survey and a mo<strong>de</strong>l. In: Acta Psychologica 27 (1967),84–92.ROCKMANN-RÜGER, U.: Laufen lernt man nur durch Laufen! In: Sportpsychologie 5 (1991) 1, 17–22.ROTH, K.: Einführung in das Schwerpunktthema „Techniktraining“ und „Erst das Leichte, danndas Schwere – stufenweise richtig lehren!“ – Zum Neulernen von Bewegungstechniken.In: Sportpsychologie 5 (1991) 1, 2–3 und 5–10.SCHMIDT, R. A.: Motor control and learning: A behavioral emphasis. Champaign 1988 2 .SCHMOLINSKY, G.: Leichtathletik. Berlin (DDR) 1980.STRANG, H.: Das Integrierte Kontrolltraining im Hochleistungssegeln. In: Sportpsychologie 5(1991) 4, 21–25.SZYMANSKI, B.: Die Situation ist die Frage – die Bewegung ist die Antwort! In: Sportpsychologie 5(1991) 1, 23–28.WEINECK, J.: Optimales <strong>Training</strong>. Erlangen 1994 8 .