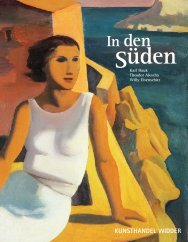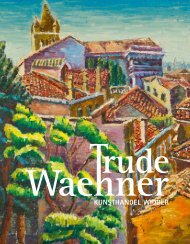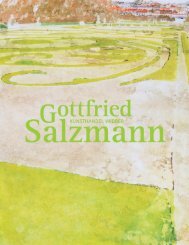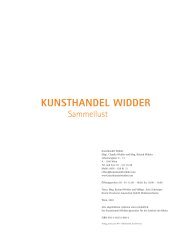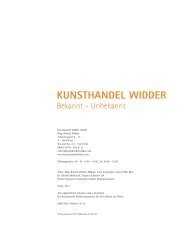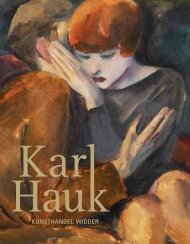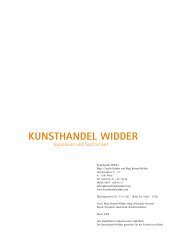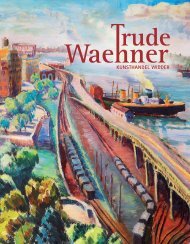Willy Eisenschitz - Kunsthandel Widder
Willy Eisenschitz - Kunsthandel Widder
Willy Eisenschitz - Kunsthandel Widder
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Franz Lerch<br />
Wien 1895 – 1977 New York<br />
Die Macht der Musik, 1973, Öl auf Leinwand, 101 x 86,5 cm,<br />
signiert F. Lerch, rückseitig Ausstellungsetikett, Datierung & Bildtitel<br />
Den Kennern des „Hagenbunds“ ist Franz Lerch wohlbekannt.<br />
In der Zwischenkriegszeit als Vertreter einer neusachlichen Bildauffassung<br />
positioniert, schließt er im New Yorker Exil an diese<br />
Tradition an, wobei es zu einer Abkehr von der naturgetreuen<br />
Wiedergabe kommt. Er wendet sich zu einer dem abstrakten Expressionismus<br />
zugewandten Seite, deren Farbigkeit der Pop Art<br />
nahe steht. Dabei steht Lerchs „Macht der Musik“ dem Werk von<br />
Jenés „Friedenstaube“ nahe und erinnert in seinem zurückgedrängten<br />
Räumlichkeit auch stark an die Arbeiten der Kärntner<br />
Künstlerin Kiki Kogelnik. In seiner reduzierten Formensprache<br />
präsentiert er uns ein Stück poetischer Gedankenmalerei in<br />
moderner Weltsicht.<br />
Franz Lerch studierte von 1919 bis 1927 an der Wiener Akademie<br />
und gehörte zu den profiliertesten Hagenbundmitgliedern. In dieser<br />
Zeit erhielt er den Österreichischen Staatspreis. Vor der Verfolgung<br />
des Naziregimes schützte ihn und seine Frau dies jedoch nicht, weswegen<br />
er in die USA emigrierte. In New York stellte er in zahlreichen<br />
Galerien aus, ein Brotberuf blieb dennoch unentbehrlich. 1975, zwei<br />
Jahre vor seinem Tod, entsannen sich die Österreichische Galerie<br />
und das Historische Museum dieses bedeutenden Künstlers und<br />
riefen mit einer Retrospektive die Erinnerung an ihn wieder wach.<br />
Nur wer fliegt, kann sich über Grenzen erheben. Den Vögeln ist<br />
diese Fähigkeit zu eigen. Auch der Taube, die als Symbol des<br />
Friedens gilt. Gründe zum Appell an die Völkerverständigung<br />
gibt es in der Entstehungszeit der Arbeit genug. Sie veranlassen<br />
wohl Jené zu vorliegendem Gemälde. Der Taube schreibt Jené<br />
eine Kugel ein, die an die Dualität der chinesischen Philosophie<br />
ebenso erinnert wie an die bipolare Teilung der Welt. Die Botschaft<br />
dabei ist, die Gegensätze zu überwinden. Wie die Taube<br />
im Flug, so wir Menschen in unserem Denken und Handeln. Die<br />
Startrampe dazu ist für Jené die Malerei.<br />
Edgar Jené<br />
Saarbrücken 1904 – 1984 La Chapelle, St. André<br />
Friedenstaube, 1952, Öl auf Leinwand, 60 x 73 cm, signiert & datiert Jené 52<br />
Edgar Jené studierte von 1922 bis 1924 an der Akademie in<br />
München danach in Paris. Dort kam er in Kontakt mit der surrealistischen<br />
Bewegung um André Breton. Er reiste nach Italien, in<br />
die Schweiz und übersiedelte 1935 als „entarteter Künstler“ nach<br />
Österreich, wo er bis 1950 lebte. Im Wien der Nachkriegszeit war<br />
Jené Gründer einer surrealistische Bewegung, die für die Phantastischen<br />
Realisten zur Ausgangsbasis ihrer Kunst wurde. In<br />
seinem Atelier erhielten sie authentische Berichte über die Malerei<br />
der Surrealisten und erfuhren entscheidende Anregungen auch<br />
wenn ihre Wege danach in andere Richtungen gingen. Jené zog<br />
1950 wieder nach Frankreich, wo er 1984 verstarb.<br />
68 69