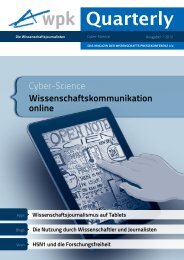PDF zum Download - WPK
PDF zum Download - WPK
PDF zum Download - WPK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 <strong>WPK</strong>-QuarterlyII/2013Auf den Geldgeber kommt es an!Wissenschaftsjournalismus, der von Dritten unterstützt wird,verliert nicht automatisch die Fähigkeit zur Kritik. Eine ReplikVon Beat GloggerIn der Kritik stehen wir, seit wir dieWissen-Seiten für 20 Minuten produzieren,also seit vier Jahren. Man gewöhntsich daran, aber man wundertsich auch. Vorgeworfen wird uns, in einemfinanziellen Abhängigkeitsverhältniskönne man keinen unabhängigenWissenschaftsjournalismus betreiben.Die Gewöhnung an diesen Vorwurf trittnatürlich durch dessen fortwährendeWiederholung ein. Interessanter ist dieVerwunderung: Sie rührt daher, dassunsere Kritiker immer nur prinzipielleBedenken vorzubringen haben – obschonich sie eins übers andere Malauffordere, konkrete Fälle zu nennen,wo meine Redaktion befangen gewesensei, wo wir zu wenig kritisch berichtethaben, zu wissenschaftsnah.Gefunden wurde ein solches Beispielbis jetzt nicht.Natürlich kann es nicht das journalistischeZiel sein, in einem Gratisblatt,das frühmorgens in überfüllten S-Bahnengelesen wird, die prinzipielle Systemkritikan der Wissenschaft zu üben.Wir verstehen unsere Aufgabe primärim Erklären. Denn, wenn das Publikumnicht weiß, was Nanotechnologie ist,kann ich es schwer mit Kritik an derselben<strong>zum</strong> Lesen animieren.Aber wenn wir kritisch sein wollen,dann sind wir es. Dies belegte ichkürzlich auf der „ScienceComm13“,der jährlichen in der Schweiz stattfindendenKonferenz der Wissenschaftskommunikatorenund -journalisten.Präsentiert habe ich eine Analyse derBerichterstattung von Sonntagszeitung,NZZ, Tagesanzeiger und 20 Minutenzur Premiere eines humanoidenRoboters der Universität Zürich. Diemeisten kritischen Fragen, die meistenQuellen, die höchste Quellentransparenzund die meisten Beispiele liefertendie Sonntagszeitung und wir in 20 Minuten.Gefolgt vom Tagesanzeiger. DieNZZ begnügte sich mit einer Ein-Quellen-Geschichteohne jeden kritischenAnsatz. Während das Zürcher Traditionsblattvon Weltruf sich also gerne zurWächterin über den Qualitätsjournalismusaufschwingt, kann ich <strong>zum</strong>indestfür unseren Wissensteil mit Fug undRecht behaupten: Wir liefern Qualität.Trotzdem reißt die Kritik nicht ab.«Man beißt doch nicht die Hand, die einenfüttert», hielt mir eine Kollegin vomRadio einmal vor. Dem stimme ich zu –im Prinzip. Doch meine Maxime lautetanders: «Man läßt sich nicht von einerHand füttern, in die man gerne beißenmöchte.» Will heißen: Nicht von jederQuelle nehme ich Geld für Journalismus.Ein Ministerium, eine Hochschule,eine Firma? Ausgeschlossen.Und nun bestätigt die Risikoabschätzungvon Markus Lehmkuhlmich erst recht in meiner Haltung. StiftungsfinanzierterWissenschaftsjournalismusist von allen Modellen derFremdfinanzierung das am wenigstenproblematische. Das werden meinekritischen Kollegen zähneknirschendzur Kenntnis nehmen (müssen). Ohnehinschulden sie mir noch die Antwortauf eine Frage, die ich ihnen ebenfallsan der ScienceComm13 gestellt habe:Wenn Wissen in 20 Minuten tatsächlichzu wenig kritisch ist, WEIL dieSeiten fremdfinanziert sind und/oderWEIL die verantwortliche Agentur auchKommunikationsaufgaben übernimmt,warum ist dann der Wissenschaftsjournalismusder so genannten unabhängigenRedaktionen nicht kritischer?Was ich vor Lehmkuhls Artikel nichtgewusst habe: dass Österreich ein Medientransparenzgesetzhat , das die mitöffentlichem Geld finanzierten Organisationenzwingt, den Betrag zu nennen,den sie für Medienkooperationenaufbringen. Was wohl so ein Gesetzin der Schweiz auslösen würde? Manerführe vielleicht, warum der Tagesanzeiger,der sich unabhängig nennt, dasPatronat für eine Wissenschaftsausstellungübernimmt, dazu eine mehrseitigeBerichterstattung liefert undverhindert, dass die veranstaltende Unianderen Medien Hintergrundinformationenzu der Ausstellung liefert. Oderinteressieren diese „kleinen Abhängigkeiten“die Branche etwa nicht?Und warum schreit niemand, wennein Redakteur einer ebenfalls unabhängigenZeitung in der Jury desSchweizer Buchpreises sitzt, gleichzeitigdas Porträt über den Gewinnerschreibt, die Präsentation des Buchesmoderiert – und seine Zeitung die Veranstaltungals Medienpartner unterstütztund bewirbt? Na gut, das ist Kulturjournalismus.Aber muss der nichtauch unabhängig sein?Wo ich mit Lehmkuhl nicht ganzeinverstanden bin, ist sein Fazit, dassVerleger zwei Risiken gegeneinanderabwägen müssen. Das Risiko, keinAngebot im Wissenschaftsbereich <strong>zum</strong>achen, mit dem Risiko, Geld von Externenanzunehmen. Es gibt noch einedritte Möglichkeit: Die Verlage finanziereneine Wissensseite selbst, weildie Leserschaft sie will. Denn Wissensteht bei Publikumsbefragungen immerganz oben auf der Prioritätenliste.In der Sonntagszeitung hat das BuchWissen am zweitmeisten Lesende. Beider NZZ am Sonntag steht Wissen aufRang drei. Trotzdem publiziert <strong>zum</strong>Beispiel das Blatt meiner Heimatstadtlieber drei Seiten Kultur – unter anderemmit Berichten zu Opernpremierenin Bayreuth – als einmal wöchentlichWissenschaft.Doch vielleicht ist das ganz einfachdie Schuld der Wissenschaftsjournalistenselbst, wie Irène Dietschi, dieehemalige Präsidentin des SchweizerKlubs für Wissenschaftsjournalismusin dessen letztem Bulletin zurDiskussion stellte. Was machen wirJournalisten falsch, dass Verleger undChefredaktoren Wissenschaft nur alsSpecial Interest und nicht als Pflichtstoffsehen?}Beat Gloggerist Inhaber derAgentur scitecmedia,welchedie DoppelseiteWissen in20 Minutenproduziert.