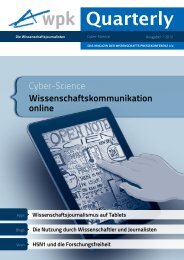16 <strong>WPK</strong>-QuarterlyII/2013Schokolade macht schlankMurks aus der Feder von Kollegen oder von Wissenschaftlern ist nicht selten.Soll man das korrigieren oder ignorieren? Ein StandpunktVon Alexander MäderDas sei ein schwarzer Tag für denWissenschaftsjournalismus gewesen,schrieb der Statistiker Gerd Antes ineiner Rundmail. Der Fall liegt schonanderthalb Jahre zurück, doch er eignetsich so gut wie andere, um zu fragen,ob der Journalismus nicht manchmalstill halten sollte. Ende März 2012gab die University of California in SanDiego eine Pressemitteilung mit derÜberschrift „Regular Chocolate Eatersare Thinner“ heraus, die in Deutschlandhohe Wellen schlug. Nicht alle,aber doch viele Medien brachten dieNachricht mit einer Überschrift der Art„Schokolade macht schlank“ heraus.Das Netzwerk für Evidenzbasierte Medizinkritisierte das später in einer eigenenPressemitteilung: Journalistenhätten die Bürgerinnen und Bürger –unabsichtlich oder bewusst – in die Irregeführt.Die Studie ist im Journal „JAMAInternal Medicine“ (Band 172, Seiten519 – 521) erschienen und geht aufeine ordentliche Befragung zurück.Die Medizinerin Beatrice Golomb untersuchteigentlich die Wirkung vonStatinen, doch sie hatte in ihren Fragebögenzu den Lebensgewohnheitender rund 1000 Teilnehmer auch nachdem wöchentlichen Schokoladenkonsumgefragt. So war es möglich, denstatistischen Zusammenhang mit demBody Mass Index zu berechnen. Erist leicht negativ, das heißt: Wenn derBody Mass Index steigt, dann sinkttendenziell der Schokoladenkonsum.Der Einwand der Statistiker und Medizinerist aus Büchern und Journalisten-Fortbildungenbekannt: EineKorrelation reicht nicht aus, um einenkausalen Zusammenhang zu begründen– also in diesem Fall die Aussage,dass die Schokolade den Body MassIndex beeinflusst. Es könnte schließlichgenauso gut umgekehrt sein: Werdünn ist, isst häufiger Schokolade,gerade weil sie oder er glaubt, es sichleisten zu können. Der statistischeZusammenhang ist mit beiden Erklärungsansätzenvereinbar und belegtdaher keinen von ihnen. Die kausaleThese, dass Schokolade schlank mache,ist spekulativ.Journalisten haben die frisch veröffentlichteStudie nicht nach ihrerwissenschaftlichen Qualität für dieBerichterstattung ausgewählt, sondernweil sie eine Frage betrifft, dieviele umtreibt: Wie viel Schokoladeist gut für mich? Eine solche Auswahlist grundsätzlich berechtigt, weil sichJournalismus nicht an dem orientierensollte, was wissenschaftlich relevantist, sondern an dem, was aus der Wissenschaftfür sein Publikum relevantist. Doch in diesem Fall hätte man <strong>zum</strong>Ergebnis kommen müssen, dass dieStudie die Frage, wie viel Schokoladegut für einen ist, nicht beantwortet.Studien:Fehlinterpretationhochwillkommen?Nun kann man einwenden, dassBeatrice Golomb und ihre Hochschulewenig unternommen haben, um Journalistendarauf hinzuweisen, dass diekausale These spekulativ ist. Im Gegenteil:In einem Youtube-Video, dasdie Pressemitteilung ergänzt, sitzt BeatriceGolomb in einem Pralinengeschäftund erläutert dort die angeblich positivenWirkungen der Schokolade aufden Stoffwechsel. Man darf wohl unterstellen,dass es ihr ganz recht war, wiedie Studie von deutschen Journalistenaufgenommen worden ist. Ein Teil desProblems liegt also im Wissenschaftsbetrieb.Doch das hilft dem Journalismusnicht weiter, denn er muss aufpassen,dass er nicht in die Irre geleitet wird.Im Normalfall sollte es so laufen: Derkritische Journalist erkennt die Ein-
II/2013<strong>WPK</strong>-Quarterly 17schränkungen der Studie und legt siezur Seite. Sie oder er überlegt vielleichtnoch, ob sich ein Beitrag <strong>zum</strong> Hypeder Pressearbeit lohnen würde. Aberdazu müsste es eine Universität in derNähe sein oder eine bekannte Autorin.Und dann schlägt die Studie doch sohohe Wellen, dass das Thema wiederaufkommt: Sollte sie oder er die Studiedoch noch aufgreifen, um sie richtig einzuordnen– und dabei die Berichte derKollegen zu relativieren oder zu korrigieren?Dann wären die Medienberichteder Anlass und nicht mehr die Studie.Ist das in Ordnung?Widerwille regt sich, denn dafür binich jedenfalls nicht Journalist geworden.Was gibt man als Berufsstand fürein Bild ab, wenn man sich mit den Berichtender Kollegen befasst statt mitdem echten Leben? Man vergeudetRessourcen für letztlich uninteressanteErgebnisse und bestätigt womöglichden Verdacht des Publikums, dassviele Journalisten unkritisch sind. Esmag zwar schwer zu ertragen sein, denkausalen Schluss „Schokolade machtschlank“ unkommentiert stehen zu lassen– und er war so oft zu hören undzu lesen, dass man befürchten musste,dass er hängen bleibt. Doch es wirdschon niemand so dumm gewesensein, nach Lektüre einer entsprechendenMeldung eine Schokoladendiätzu beginnen. Die Meldung hatte einenSchön-wär’s!-Klang und dürfte dasPublikum kaum über den Augenblickhinaus beschäftigt haben. Und selbstwenn: Wer sich tatsächlich ernsthaftgefragt hat, ob Schokolade schlankmacht, würde richtige Einordnungen imInternet rasch finden.Die Tücken derThemenwahlManche Journalisten werden sichhingegen über die Gelegenheit gefreuthaben, die Aussagekraft von Korrelationsstudienzu erläutern, denn einen gutenAnlass dazu hat man nicht oft. DasNetzwerk für Evidenzbasierte Medizinkritisiert zwar, dass immer wieder Korrelationsstudienfür kausale Schlüssemissbraucht würden, doch nur seltenwerden sie so stark verbreitet wie imFall der Schokoladenstudie. Die Themenauswahlder tagesaktuellen Medienunterscheidet sich in der Regel so deutlich,dass Studien eher selten übereinstimmendvon mehreren Medien ausgewähltwerden. Doch das mindert denWiderwillen nicht wirklich. Man steht voreinem Dilemma. Mein Publikum hat ausanderen Quellen von der Studie gehört,steht ihr möglicherweise skeptisch gegenüberund erwartet nun von mir eineEinordnung. Sich dem zu verweigern,wirkt so, als hätte man zu diesem Themanichts zu sagen. Deshalb fügt mansich womöglich zähneknirschend. Inanderen Ressorts mag das gang undgäbe sein. Aber das macht es für denWissenschaftsjournalismus nicht erstrebenswert.Denn Übereinstimmungin der Themenwahl ist nicht viel wert,wenn es keine gute Wahl ist.Die Alternative wäre mehr Mut <strong>zum</strong>Profil: Wofür steht mein Medium? Willich wissenschaftliche Erkenntnisse alsService aufbereiten, will ich beeindruckendeGeschichten erzählen oder willich aufklären und vor falschen Schlüssenwarnen? Nicht jedes Medium mussalle Aufgaben erfüllen, und deshalbmuss sich auch nicht jeder Journalistunter Druck fühlen, die Schokoladenstudieeinzuordnen. Für den einen sindforschungspolitische Entscheidungenwichtig, weil es um Geld geht, für anderestehen Expertisen zu politischenFragen im Vordergrund. Wieder anderesetzen auf gehobene Unterhaltung undzeigen die überraschenden Phänomeneder Tierwelt oder der Quantenweltauf. Und im großen Feld der Medizingibt es diejenigen, die den besten ärztlichenRat zusammentragen, und diejenigen,die sich mehr für die Grundlagenforschungund neue Medikamenteinteressieren, und diejenigen, die Fehlentwicklungenim Gesundheitssystemherausarbeiten. Die Relativierung derSchokoladenstudie ist nur für Medieninteressant, in denen regelmäßig Ernährungstippsgegeben werden oderwissenschaftstheoretische Reflexionbetrieben wird, denn nur bei ihnendürfte das Publikum eine Einordnungerwarten.Aber in der Regel erwarten Chefredakteurevon ihren Wissenschaftsressortsdas volle Programm. Und wenneine Meldung wie die über die Schokoladenstudieüberall auftaucht, dann giltdas als Beleg dafür, dass sie wichtig ist.Dann folgt die Frage: Warum haben wirnichts dazu gemacht? Doch diese Fragesollten Wissenschaftsjournalistenlernen, selbstbewusst zu beantworten.Hier könnte sich zeigen, wie ernst esein Medium mit dem oft geäußertenWunsch nach eigenen Geschichtenmeint: Traut es sich, gegen den journalistischenMainstream zu entscheidenund auf ein anderes Thema als dieSchokoladenstudie zu setzen?Orientierung durch dasScience Media Center?Das Science Media Center Deutschland(SMC), das die <strong>WPK</strong> mit Partnernaus Wirtschaft und Wissenschaft plant,könnte dabei helfen. Denn diese Einrichtungsoll Journalisten auch vor irreführenderBerichterstattung schützen.Bei der Schokoladenstudie könnte dasCenter <strong>zum</strong> Beispiel Experten bitten, dieAussagekraft der Studie einzuschätzen,und den Journalisten damit nahelegen,die Studie lieber zu ignorieren. Dochauch das SMC wird sich entscheidenmüssen, wie es seine Kapazitäten einteilt.Wäre seine Hilfe nicht wichtiger beiStudien, die schwieriger einzuschätzensind als die Korrelation zwischen BodyMass Index und Schokoladenkonsum?Bisher ist das SMC nur darauf festgelegtworden, seine Themen nach journalistischenGesichtspunkten auszuwählen.Es hat daher noch den Spielraum, dieZiele genauer zu bestimmen. }Alexander Mäderleitet das Wissenschaftsressortder StuttgarterZeitung.