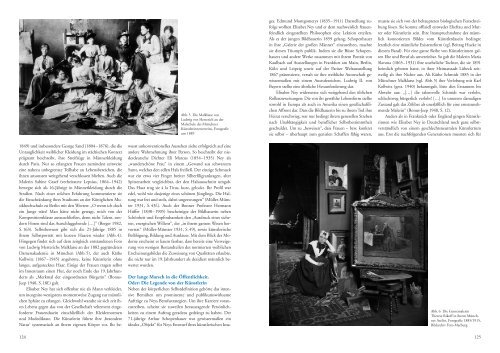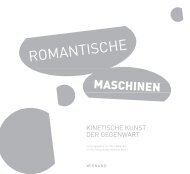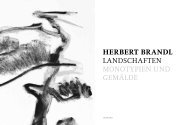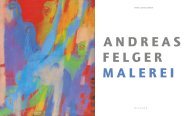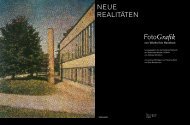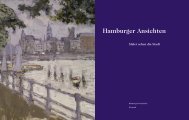Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag
Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag
Elisabet Ney konstruiert ihr Künstlerimage in ... - Wienand Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 110-185 14.01.2008 15:09 Uhr Seite 124<br />
1849) und <strong>in</strong>sbesondere George Sand (1804–1876), die die<br />
Untauglichkeit weiblicher Kleidung im städtischen Kontext<br />
prägnant beschreibt, <strong>ihr</strong>e Streifzüge <strong>in</strong> Männerkleidung<br />
durch Paris. Nur so erlangten Frauen zum<strong>in</strong>dest zeitweise<br />
e<strong>in</strong>e nahezu unbegrenzte Teilhabe an Lebensbereichen, die<br />
ihnen ansonsten weitgehend verschlossen blieben. Auch die<br />
Maler<strong>in</strong> Sab<strong>in</strong>e Graef (verheiratete Lepsius, 1864–1942)<br />
bewegte sich als 16-Jährige <strong>in</strong> Männerkleidung durch die<br />
Straßen. Nach e<strong>in</strong>er solchen Erfahrung kommentierte sie<br />
die E<strong>in</strong>schränkung <strong>ihr</strong>es Studiums an der Königlichen Musikhochschule<br />
zu Berl<strong>in</strong> mit den Worten: „O wenn ich doch<br />
e<strong>in</strong> Junge wäre! Man hätte nicht gewagt, mich von der<br />
Kompositionsklasse auszuschließen, denn nicht Talent, sondern<br />
Hosen s<strong>in</strong>d das Ausschlaggebende […]“ (Berger 1982,<br />
S. 163). Selbstbewusst gibt sich die 21-Jährige 1885 <strong>in</strong><br />
<strong>ihr</strong>em Selbstporträt mit kurzen Haaren wieder (Abb. 4).<br />
H<strong>in</strong>gegen f<strong>in</strong>det sich auf dem zeitgleich entstandenen Foto<br />
von Ludwig Merterichs Malklasse an der 1882 gegründeten<br />
Damenakademie <strong>in</strong> München (Abb. 5), der auch Käthe<br />
Kollwitz (1867–1945) angehörte, ke<strong>in</strong>e Künstler<strong>in</strong> ohne<br />
langes, aufgestecktes Haar. E<strong>in</strong>ige der Frauen tragen selbst<br />
im Innenraum e<strong>in</strong>en Hut, der noch Ende des 19. Jahrhunderts<br />
als „Merkmal der e<strong>in</strong>geordneten Bürger<strong>in</strong>“ (Bonus-<br />
Jeep 1948, S. 18f.) galt.<br />
<strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong> hat sich offenbar nie als Mann verkleidet,<br />
um <strong>in</strong>cognito wenigstens momentweise Zugang zur männlichen<br />
Sphäre zu erlangen. Gleichwohl wandte sie sich zeit <strong>ihr</strong>es<br />
Lebens gegen das von der Gesellschaft vehement e<strong>in</strong>geforderte<br />
Frauendase<strong>in</strong> e<strong>in</strong>schließlich der Kleidernormen<br />
und Modediktate. Die Künstler<strong>in</strong> führte <strong>ihr</strong>e ‚besondere<br />
Natur’ systematisch an <strong>ihr</strong>em eigenen Körper vor. Ihr be-<br />
124<br />
Abb. 5 Die Malklasse von<br />
Ludwig von Herterich an der<br />
Malschule des Münchner<br />
Künstler<strong>in</strong>nenvere<strong>in</strong>s, Fotografie<br />
um 1889<br />
wusst unkonventionelles Aussehen zielte erfolgreich auf e<strong>in</strong>e<br />
andere Wahrnehmung <strong>ihr</strong>er Person. So beschreibt der niederdeutsche<br />
Dichter Eli Marcus (1854–1935) <strong>Ney</strong> als<br />
„wunderschöne Frau“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „Gewand aus schwarzem<br />
Samt, welches den edlen Hals freiließ. Der e<strong>in</strong>zige Schmuck<br />
war e<strong>in</strong> etwa vier F<strong>in</strong>ger breiter Silberfiligrankragen, alter<br />
Spitzenarbeit vergleichbar, der den Halsausschnitt umgab.<br />
Das Haar trug sie à la Titus, kurz, gelockt. Ihr Profil war<br />
edel, wohl wie dasjenige e<strong>in</strong>es schönen Jüngl<strong>in</strong>gs. Die Haltung<br />
war frei und stolz, dabei ungezwungen“ (Müller-Münster<br />
1931, S. 43f.). Auch der Bonner Professor Hermann<br />
Hüffer (1830–1905) besche<strong>in</strong>igte der Bildhauer<strong>in</strong> neben<br />
Schönheit und Empf<strong>in</strong>dsamkeit den „Ausdruck e<strong>in</strong>es sicheren,<br />
energischen Willens“, der „<strong>in</strong> <strong>ihr</strong>em ganzen Wesen hervortrat“<br />
(Müller-Münster 1931, S. 49), sowie künstlerische<br />
Befähigung, Bildung und Ausdauer. Mit dem Blick der Moderne<br />
ersche<strong>in</strong>t es kaum fassbar, dass bereits e<strong>in</strong>e Verweigerung<br />
von wenigen Bestandteilen des normierten weiblichen<br />
Ersche<strong>in</strong>ungsbildes die Zuweisung von Qualitäten erlaubte,<br />
die nicht nur im 19. Jahrhundert als dezidiert männlich bewertet<br />
wurden.<br />
Der lange Marsch <strong>in</strong> die Öffentlichkeit.<br />
Oder: Die Legende von der Künstler<strong>in</strong><br />
Neben der körperlichen Selbstdef<strong>in</strong>ition gehörte das <strong>in</strong>tensive<br />
Bemühen um prom<strong>in</strong>ente und publikumswirksame<br />
Aufträge zu <strong>Ney</strong>s Berufsstrategien. Um <strong>ihr</strong>e Karriere voranzutreiben,<br />
sche<strong>in</strong>t sie zuweilen herausragende Persönlichkeiten<br />
zu e<strong>in</strong>em Auftrag geradezu gedrängt zu haben. Der<br />
71-jährige Arthur Schopenhauer war gewissermaßen e<strong>in</strong><br />
ideales „Objekt“ für <strong>Ney</strong>s Entwurf <strong>ihr</strong>es künstlerischen Ima-<br />
ges. Edmund Montgomerys (1835–1911) Darstellung zufolge<br />
wollten <strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong> und er dem nachweislich frauenfe<strong>in</strong>dlich<br />
e<strong>in</strong>gestellten Philosophen e<strong>in</strong>e Lektion erteilen.<br />
Als es der jungen Bildhauer<strong>in</strong> 1859 gelang, Schopenhauer<br />
<strong>in</strong> <strong>ihr</strong>e „Galerie der großen Männer“ e<strong>in</strong>zureihen, machte<br />
sie diesen Triumph publik. Indem sie die Büste Schopenhauers<br />
und andere Werke zusammen mit <strong>ihr</strong>em Porträt von<br />
Kaulbach auf Ausstellungen <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong>, Berl<strong>in</strong>,<br />
Köln und Leipzig sowie auf der Pariser Weltausstellung<br />
1867 präsentierte, versah sie <strong>ihr</strong>e weibliche Autorschaft gewissermaßen<br />
mit e<strong>in</strong>em Ausrufezeichen. Ludwig II. von<br />
Bayern stellte e<strong>in</strong>e ähnliche Herausforderung dar.<br />
<strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong> widersetzte sich weitgehend den üblichen<br />
Rollenzuweisungen: Die von <strong>ihr</strong> gewählte Lebensform stellte<br />
sowohl <strong>in</strong> Europa als auch <strong>in</strong> Amerika e<strong>in</strong>en gesellschaftlichen<br />
Affront dar. Dass die Bildhauer<strong>in</strong> bis zu <strong>ihr</strong>em Tod <strong>ihr</strong>e<br />
Heirat verschwieg, war nur bed<strong>in</strong>gt <strong>ihr</strong>em generellen Streben<br />
nach Unabhängigkeit und beruflicher Selbstbestimmtheit<br />
geschuldet. Um zu „beweisen“, dass Frauen – bzw. konkret<br />
sie selbst – überhaupt zum genialen Schaffen fähig waren,<br />
musste sie sich von der behaupteten biologischen Festschreibung<br />
lösen. Sie konnte offiziell entweder Ehefrau und Mutter<br />
oder Künstler<strong>in</strong> se<strong>in</strong>. Ihre Inanspruchnahme des männlich<br />
konnotierten Bildes vom Künstlerdase<strong>in</strong> bed<strong>in</strong>gte<br />
letztlich e<strong>in</strong>e männliche Existenzform (vgl. Beitrag Hucke <strong>in</strong><br />
diesem Band). Für e<strong>in</strong>e ganze Reihe von Künstler<strong>in</strong>nen galten<br />
Ehe und Beruf als unvere<strong>in</strong>bar. So gab die Maler<strong>in</strong> Maria<br />
Slavona (1865–1931) <strong>ihr</strong>e uneheliche Tochter, die sie 1891<br />
heimlich geboren hatte, <strong>in</strong> <strong>ihr</strong>er Heimatstadt Lübeck zeitweilig<br />
als <strong>ihr</strong>e Nichte aus. Als Käthe Schmidt 1885 <strong>in</strong> der<br />
Münchner Malklasse (vgl. Abb. 5) <strong>ihr</strong>e Verlobung mit Karl<br />
Kollwitz (gest. 1940) bekanntgab, löste dies Erstaunen bis<br />
Abwehr aus: „[…] die talentvolle Schmidt war verlobt,<br />
schlechtweg bürgerlich verlobt! […] In unserem damaligen<br />
Zustand galt das Zölibat als unerläßlich für e<strong>in</strong>e ernstzunehmende<br />
Maler<strong>in</strong>“ (Bonus-Jeep 1948, S. 12).<br />
Anders als <strong>in</strong> Frankreich oder England g<strong>in</strong>gen Künstler<strong>in</strong>nen<br />
wie <strong>Elisabet</strong> <strong>Ney</strong> <strong>in</strong> Deutschland noch ganz selbstverständlich<br />
von e<strong>in</strong>em geschlechtsneutralen Künstlertum<br />
aus. Erst die nachfolgenden Generationen mussten sich für<br />
Abb. 6 Die Genremaler<strong>in</strong><br />
Therese Rikoff <strong>in</strong> <strong>ihr</strong>em Münchner<br />
Atelier, Fotografie 1885/1915,<br />
Bildarchiv Foto Marburg<br />
125