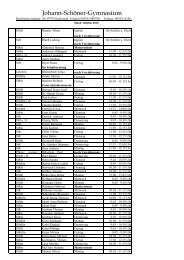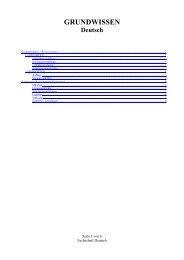GRUNDWISSEN Deutsch
GRUNDWISSEN Deutsch
GRUNDWISSEN Deutsch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Jahrgangsstufe 9...................................................................................................................................................... 2<br />
Literatur / literarische Gattungen ........................................................................................................................ 2<br />
1. Erzählende Literatur........................................................................................................................................ 2<br />
Die Kurzgeschichte ......................................................................................................................................... 2<br />
Die Novelle ..................................................................................................................................................... 2<br />
Die Parabel...................................................................................................................................................... 3<br />
2. Gedichte .......................................................................................................................................................... 3<br />
3. Drama / Theater (vgl. DB, S. 365/366). ......................................................................................................... 4<br />
Schreibformen / Aufsatzarten : ........................................................................................................................... 5<br />
1. Erweiterte Inhaltsangabe eines literarischen Textes.................................................................................... 5<br />
2. Erweiterte Inhaltsangabe eines Sachtextes.................................................................................................. 6<br />
3. Lineare Erörterung ...................................................................................................................................... 8<br />
Seite 1 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
Literatur / literarische Gattungen<br />
1. Erzählende Literatur<br />
(vgl. auch <strong>Deutsch</strong>buch 9, S.359-363)<br />
Die Kurzgeschichte<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Jahrgangsstufe 9<br />
Die Kurzgeschichte ist eine knappe, moderne Erzählung, die sich ab Mitte des 20. Jhdts.<br />
als Erzählform durchsetzt. Sie zeigt eine Momentaufnahme, einen krisenhaften Ausschnitt<br />
oder eine wichtige Episode aus dem Alltagsleben einer oder mehrerer Menschen.<br />
Kurzgeschichten haben meist folgende Merkmale:<br />
� geringer Umfang<br />
� Ausschnitt aus einem alltäglichen Geschehen, der für die dargestellten Figuren von<br />
besonderer Bedeutung ist<br />
� unmittelbarer Einstieg in das Geschehen, der schlagartig eine Situation aufreißt<br />
� zielstrebiger Handlungsverlauf hin zu einem Höhe- oder Wendepunkt<br />
� offener Schluss, der viele Deutungsmöglichkeiten zulässt<br />
� meist Alltagssprache mit einfachem Satzbau und umgangssprachlichen<br />
Elementen in der direkten Rede (passend zur alltäglichen Thematik der<br />
Kurzgeschichte)<br />
Die Novelle<br />
Die Novelle (von ital. novella = Neuigkeit) gehört zu den Kleinformen des Erzählens im<br />
Gegensatz zum Roman. Die Novelle, die im 19. Jhdt. ihre Blütezeit hatte, ist eine relativ<br />
kurze, in straffer Form erzählte, dramatische Begebenheit.<br />
Novellen haben meistfolgende Merkmale:<br />
� Sie erzählen von einer tatsächlichen oder möglichen Einzelbegebenheit (im<br />
Gegensatz zum Märchen).<br />
� Im Zentrum der Handlung steht ein Konflikt.<br />
� Sie weisen eine strenge Bauform auf, die dem Drama verwandt ist: knappe<br />
Exposition, zeitraffende, zielgerichtete Hinführung zum Höhe- bzw.<br />
Wendepunkt, Verzögerung, Lösung/Katastrophe.<br />
� Oft wird ein Gegenstand zum Bedeutungsträger (Dingsymbol, Leitmotiv).<br />
� Sie haben eine geschlossene Form (im Gegensatz zur offenen Form der<br />
Kurzgeschichte).<br />
Seite 2 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
Die Parabel<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Die Parabel (griech. parabole = Gleichnis) ist eine (meist kurze) lehrhafte<br />
Erzählung, die eine allgemeine Wahrheit oder Lebensweisheit durch ein Beispiel<br />
aus einem anderen Bereich verdeutlicht. Eine Parabel besteht aus einer Bildebene<br />
(das, was erzählt wird), die auf eine so genannte Sachebene (das, was gemeint ist)<br />
verweist.<br />
2. Gedichte<br />
(vgl. DB, S. 364-365 und Rhetorische Figuren S.207/8)<br />
2.1 Merkmale von Gedichten (vgl. auch Jgst. 5 bis 8)<br />
Folgende weitere Merkmale kennzeichnen die Lyrik:<br />
� Metrum (Versmaß):<br />
je nachdem, wie betonte und unbetonte Silben wechseln, unterscheidet man<br />
verschiedene Metren, z. B.<br />
Jambus („Am grauen Strand, am grauen Meer"),<br />
Trochäus („Meine Glocken läuten”)<br />
und Daktylus („Gotische Fenster und maurisch verziertes Portal").<br />
� Rhythmus:<br />
Betonungen, Sprechpausen und Sprechtempo geben beim Vortrag den<br />
Rhythmus eines Gedichts wieder.<br />
� Lyrisches Ich:<br />
Zu jedem Gedicht gehört eine Sprecherin oder ein Sprecher, der nicht mit der<br />
Autorin oder dem Autor gleichzusetzen ist. Oft stellt sich dieser Sprecher als<br />
ein Ich vor, das seine Gefühle, Beobachtungen und Gedanken so mitteilt, dass<br />
die Leserinnen und Leser sie mitempfinden können.<br />
� Sprache des Gedichts:<br />
Die Sprache von Gedichten ist oft durch Vergleiche und Bilder (Metaphern)<br />
geprägt. Sie sind besonders dazu geeignet, Gefühle und Stimmungen<br />
auszudrücken oder eine bestimmte Atmosphäre entstehen zu lassen.<br />
So werden zur Darstellung von Liebe, Freude, Angst oder Einsamkeit z. B. oft<br />
Bilder aus dem Bereich der Natur verwendet.<br />
(Mehr Informationen zu sprachlichen Gestaltungsmitteln auf den S.341/342).<br />
Seite 3 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
2.2. Politische Lyrik (vgl. DB, S.198)<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Gedichte, die politische und gesellschaftliche Zustände beschreiben, anklagen oder bewerten<br />
– meist mit dem Wunsch nach Veränderung–, bezeichnet man als politische Lyrik.<br />
Politische Lyrik gibt es in der deutschen Lyrik schon seit dem Mittelalter. Wir finden sie vor<br />
allem in politisch unruhigen Epochen, in Umbruchs- oder Kriegszeiten. Da aber kaum Zeiten<br />
der Ruhe oder Entspannung in der Geschichte zu finden sind, ist politische Dichtung fast<br />
immer gegenwärtig, z. B.:<br />
� im Umfeld der Französischen Revolution (1789 bis 1792),<br />
� während der Zeit des Vormärz (1815 bis 1848),<br />
� während des Nationalsozialismus (1933 bis 1945), hier vor allem als Exilliteratur,<br />
� im Zusammenhang mit dem DDR-Regime (1949 bis 1989) sowie<br />
� im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung (1990).<br />
Merkmale von politischer Lyrik sind:<br />
das Thematisieren, Aufzeigen und Anklagen aktueller politischer und sozialer Zustände, meist<br />
Missstände, z. B. indem diese kritisch oder ironisch kommentiert werden,<br />
der enge Bezug des Gedichts zu den jeweiligen geschichtlichen Ereignissen,<br />
der Wille, auf die politischen oder sozialen Zustände Einfluss zu nehmen, sei es, um sie zu<br />
verändern oder auch um sie zu bestätigen.<br />
3. Drama / Theater (vgl. DB, S. 365/366).<br />
Dramentexte sind in Dialogform verfasst und bilden damit die Gespräche der<br />
auftretenden Figuren ab.<br />
Für das Verstehen eines Dramas sind folgende Aspekte wichtig:<br />
� Exposition: Eingangsszene eines Stückes. In ihr werden die Haupt p ersonen,<br />
der Ort, die Zeit und häufig auch die Vorgeschichte der Handlung vorgestellt.<br />
� Konflikt: Auseinandersetzung oder Streit, der den Kern der Handlung auf der<br />
Bühne bildet. Akt: auch Aufzug genannt, Hauptabschnitt eines Dramas,<br />
geschlossene Handlungseinheit, die meist aus mehreren Szenen besteht.<br />
� Szene: Kurzer abgeschlossener Teil eines Theaterstücks. Eine Szene endet,<br />
wenn Schauspieler auf- oder abtreten oder wenn das Licht ausgeht.<br />
� Rolle: Gestalt oder Figur, die ein Schauspieler auf der Bühne verkörpert.<br />
� Dialog: Gespräch zwischen den Personen auf der Bühne. Ein Selbstgespräch<br />
auf der Bühne nennt man Monolog.<br />
� Regieanweisung: Anweisung an Re g isseure und Schauspieler, wie eine<br />
bestimmte Szene gespielt werden soll. Regieanweisungen helfen außerdem dem<br />
Leser, sich die Personen und das Geschehen vorzustellen.<br />
Seite 4 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Schreibformen / Aufsatzarten :<br />
1. Erweiterte Inhaltsangabe eines literarischen Textes<br />
1.1 Zusammenfassung des Inhalts<br />
1.2 Charakteristik der Hauptperson(en)<br />
1.3 Erläuterung der Intention<br />
Die erweiterte Inhaltsangabe eines literarischen Textes informiert kurz und sachlich über<br />
den Inhalt des Textes und bearbeitet zusätzlich eine weiterführende Aufgabe zum Text.<br />
Aufbau:<br />
� Die Einleitung macht Angaben über den Autor, den Titel, die Textart, ggf. das<br />
Erscheinungsdatum und benennt die Kernaussage des Textes.<br />
� Im Hauptteil werden die wichtigsten Ereignisse der Handlung mit eigenen Worten<br />
in chronologischer Reihenfolge zusammengefasst. Dabei wird der Leser über die<br />
Gründe der Handlung und der Ereignisse informiert.<br />
� Im dritten Teil wird eine weiterführende Aufgabe bearbeitet, z. B.: ausführlichere<br />
Behandlung eines Untersuchungsaspekts, Erörterung einer zentralen Textaussage etc.<br />
Interpretierende Aussagen im dritten Teil müssen anhand des Textes belegt werden,<br />
entweder als wörtliche Zitate mit Anführungszeichen oder als indirekte Zitate (mit<br />
eigenen Worten wiedergegebene Textstellen). Alle Textbelege werden mit<br />
Zeilenangaben angeführt.<br />
Die erweiterte Inhaltsangabe wird als zusammenhängender Text verfasst. Einzelne<br />
Aussagen oder Feststellungen 11 werden durch sinnvolle Überleitungen miteinander<br />
verbunden. Inhaltlich neue Gliederungspunkte werden durch Absätze kenntlich<br />
gemacht.<br />
Stil und Sprache<br />
Die Zeitform in ist das Präsens (bei Vorzeitigkeit C Perfekt). In der Zusammenfassung<br />
erscheint keine wörtliche Rede. Sind Äußerungen von Figuren besonders wichtig,<br />
werden sie in der indirekten Rede wiedergegeben oder in einem Aussagesatz zusammengefasst.<br />
Seite 5 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
2. Erweiterte Inhaltsangabe eines Sachtextes<br />
2.1 Zusammenfassung des Inhalts<br />
2.2 Erläuterung der Textsorte<br />
2.3 Aufzeigen auffälliger sprachlicher Mittel und Erklärung ihrer Funktion<br />
Die erweiterte Inhaltsangabe eines Sachtextes informiert kurz und sachlich<br />
über den Inhalt und den Gedankengang des Textes und bearbeitet eine<br />
weiterführende Aufgabe zum Text.<br />
Aufbau:<br />
� Die Einleitung macht Angaben über den Autor, den Titel, die Textsorte, ggf. die Quelle<br />
und benennt das Thema des Textes.<br />
� Im Hauptteil werden der Inhalt und der Gedankengang des Textes in eigenen Worten<br />
zusammengefasst.<br />
� Im dritten Teil wird eine weiterführende Aufgabe bearbeitet, z. B.: ausführlichere<br />
Behandlung eines Untersuchungsaspekts, Erörterung einer zentralen Textaussage etc.<br />
Interpretierende Aussagen im dritten Teil müssen anhand des Textes belegt werden,<br />
entweder als wörtliche Zitate mit Anführungszeichen oder als indirekte Zitate (mit eigenen<br />
Worten wiedergegebene Textstellen). Alle Textbelege werden mit Zeilenangaben angeführt.<br />
Die erweiterte Inhaltsangabe wird als zusammenhängender Text verfasst. Einzelne<br />
Aussagen oder Feststellungen werden durch sinnvolle Überleitungen miteinander<br />
verbunden. Inhaltlich neue Gliederungspunkte werden durch Absätze kenntlich<br />
gemacht.<br />
Stil und Sprache<br />
Die Zeitform ist das Präsens (bei Vorzeitigkeit Perfekt). In der Zusammenfassung erscheint<br />
keine wörtliche Rede. Unverzichtbare Äußerungen werden als indirekte Rede oder in einem<br />
Aussagesatz wiedergegeben.<br />
Seite 6 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
Rhetorische Figuren<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Rhetorische Figur Definition Beispiel<br />
Alliteration, die Wiederholung der<br />
Anfangsbuchstaben bei<br />
Wörtern<br />
dunkle Dinge<br />
Anapher, die Wiederholung eines Er schaut nicht die<br />
oder mehrerer Wörter an Felsenriffe/<br />
Satz- oder Versanfängen Er schaut nur hinauf ...<br />
Anrede, die 'Willst du ...<br />
Antithese, die Gegenüberstellung<br />
gegensätzlicher Begriffe<br />
heiß und kalt<br />
Chiasmus, der symmetrische Überkreuz- Ich schlafe am Tag,<br />
stellung von gedanklichen<br />
oder syntaktischen<br />
Elementen<br />
in der Nacht wache ich.<br />
Ellipse, die grammatisch unvollständiger je früher der Abschied,<br />
Satz, Auslassung eines Satzgliedes/Wortes,<br />
das leicht<br />
ergänzbar ist<br />
desto kürzer die Qual.<br />
Euphemismus, der Beschönigung „sanft entschlafen" für sterben<br />
Exklamation, die Ausruf als Affektausdruck „Oh!"; „Ach!"<br />
Hyperbel, die starke Übertreibung ein Meer von Tränen<br />
Inversion, die Umkehrung der geläufigen Der Schultern warmer<br />
Wortstellung im Satz Schnee wird werden kalter Sand.<br />
Metapher, die bildhafte Bedeutungsübertragung<br />
Mauer des Schweigens<br />
Neologismus, der Wortneuschöpfung Berufsjugendlicher<br />
Parallelismus, der Wiederholung gleicher Das Schiffchen fliegt,<br />
syntaktischer Fügungen der Webstuhl kracht.<br />
Personifikation, die Vermenschlichung Vater Staat;<br />
Mutter Natur<br />
rhetorische Frage, die Scheinfrage, Wer ist schon perfekt?<br />
die nur eine Antwort<br />
zulässt<br />
Seite 7 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>
3. Lineare Erörterung<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong><br />
<strong>Deutsch</strong><br />
Die steigernde (lineare) Erörterung (Einleitung und Überleitung vgl. Jgst 8)<br />
� Im Hauptteil wird zur Themafrage eine These aufgestellt und die Argumente steigernd<br />
angeordnet, d. h.: das weniger wichtige Argument zuerst, das wichtigste am Schluss.<br />
Durch die Steigerung der Argumente wird das Interesse des Lesers wach gehalten und der<br />
eigenen Position Nachdruck verliehen. Gegenargumente werden nur am Rande eingebracht,<br />
um mögliche Bedenken gleich auszuräumen.<br />
Am Ende des Hauptteils fasst man das Ergebnis der Erörterung als Fazit<br />
zusammen. Bei der steigernden Erörterung muss dieses Ergebnis der These<br />
vom Anfang des Hauptteils entsprechen und sich aus dem gedanklichen<br />
Aufbau ergeben. Hierbei kann man wichtige Argumente des Hauptteils zwar<br />
wieder aufgreifen, sollte sie aber nicht wörtlich wiederholen.<br />
� Der Schluss soll das Thema abrunden, indem die dargelegten Gedanken in einen<br />
größeren zeitlichen oder thematischen Zusammenhang eingeordnet werden.<br />
Auch der Schluss muss sich auf das Thema beziehen, darf aber keine neuen<br />
Argumente beinhalten. Einleitung und Schluss sollten sich vom Umfang her<br />
ungefähr entsprechen. Zur Gestaltung des Schlusses gibt es z. B. folgende<br />
Möglichkeiten: ein persönlicher Wunsch oder eine Forderung, ein Ausblick auf<br />
künftige Entwicklungen oder ein weiterführender Gedanke, ein Hinweis auf ein<br />
verwandtes Thema, das Aufgreifen des Einleitungsgedankens, sodass Einleitung<br />
und Schluss einen Rahmen bilden, die eigene Stellungnahme zum Thema.<br />
Mindestanforderung für die Gliederung:<br />
Entweder drei Überpunkte mit je zwei Unterpunkten oder zwei Überpunkte mit je drei<br />
Unterpunkten.<br />
Zu beachten ist die numerisch angelegte und im Nominalstil verfasste Gliederung!<br />
Seite 8 von 8<br />
Fachschaft <strong>Deutsch</strong>