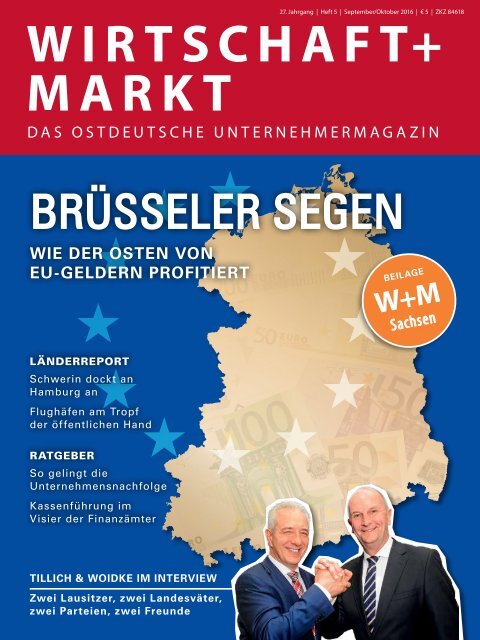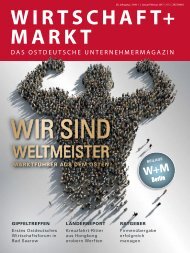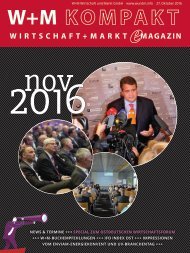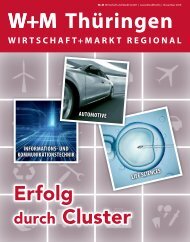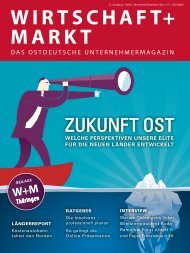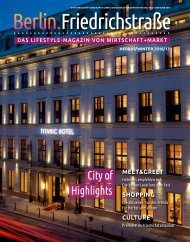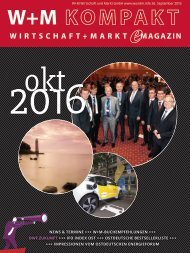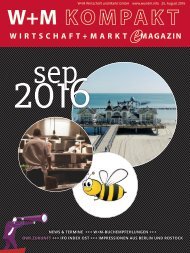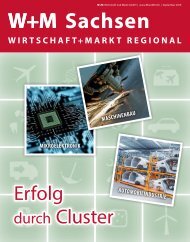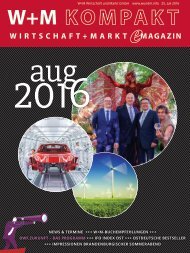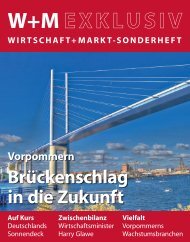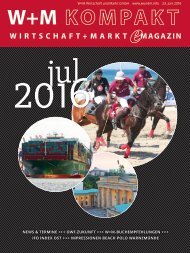WIRTSCHAFT+MARKT 5/2016
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
27. Jahrgang | Heft 5 | September/Oktober <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
BRÜSSELER SEGEN<br />
WIE DER OSTEN VON<br />
EU-GELDERN PROFITIERT<br />
BEILAGE<br />
Sachsen<br />
LÄNDERREPORT<br />
Schwerin dockt an<br />
Hamburg an<br />
Flughäfen am Tropf<br />
der öffentlichen Hand<br />
RATGEBER<br />
So gelingt die<br />
Unternehmensnachfolge<br />
Kassenführung im<br />
Visier der Finanzämter<br />
TILLICH & WOIDKE IM INTERVIEW<br />
Zwei Lausitzer, zwei Landesväter,<br />
zwei Parteien, zwei Freunde
Für Sie vor Ort in Mitteldeutschland:<br />
in Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle,<br />
Leipzig und Magdeburg.<br />
Der Kolibri. Mit 40 bis 50<br />
Flügelschlägen pro Sekunde<br />
kann er auf der Stelle fiegen<br />
und präzise manövrieren.<br />
Präzise Balance.<br />
Professionelle Leistung auf<br />
höchstem Niveau.<br />
Mit einer Qualität, die genau den Erwartungen unserer Kunden<br />
entspricht, will die Landesbank Baden-Württemberg zum Maßstab<br />
für gutes Banking werden. Deshalb betreiben wir Bankgeschäfte<br />
ver trauenswürdig und professionell. Fundiert und<br />
fokussiert. Sorgfältig und respektvoll. Als ein Unternehmen der<br />
LBBW-Gruppe pfegen wir langfristige Kundenbeziehungen in<br />
der Region und beraten Kunden transparent und ehrlich.<br />
www.sachsenbank.de<br />
Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe
EDITORIAL | 3<br />
Tue Gutes und<br />
rede darüber<br />
JETZT<br />
20. -21 . OKTOBER <strong>2016</strong><br />
ANMELDEN!<br />
owf<strong>2016</strong>.de<br />
Karsten Hintzmann<br />
Chefredakteur<br />
KH@WundM.info<br />
Foto: Privat, Titelfoto: Ralf Succo<br />
Das geeinte Europa geht aktuell<br />
durch eine tiefe Krise. Großbritannien<br />
hat vor wenigen Wochen<br />
den Austritt aus der Europäischen Union<br />
erklärt. Auch in weiteren Staaten laufen<br />
Debatten darüber, wie viel Sinn es<br />
noch macht, in der EU zu verbleiben und<br />
an der europäischen Idee festzuhalten.<br />
Es sind gefährliche Diskussionen, die<br />
da geführt werden. Denn wo kämen<br />
wir hin, wenn sich weitere Staaten von<br />
der EU abwenden? Das heute noch<br />
weitgehend geeinte Europa würde in<br />
jene Kleinstaaterei zurückfallen, die<br />
speziell in der ersten Hälfte des letzten<br />
Jahrhunderts so fatale Folgen hatte.<br />
Die negativen Auswirkungen auf die<br />
Wirtschaft können in ihrer ganzen Tragweite<br />
aktuell noch gar nicht überblickt<br />
werden, wenn man den so mühsam<br />
geschaffenen gemeinsamen europäischen<br />
Markt aufgeben würde.<br />
Insofern bleibt zu hoffen, dass sich<br />
die politisch Verantwortlichen in den<br />
EU-Mitgliedstaaten darauf besinnen,<br />
wie elementar wichtig das Gebilde EU<br />
auch für die nationalen Volkswirtschaften<br />
ist. Allerdings ist auch Brüssel gefordert,<br />
einige Gänge nach oben zu<br />
schalten. In mehrfacher Hinsicht. Für<br />
den Außenstehenden wirken die Europäische<br />
Kommission, das Europaparlament<br />
und der Europäische Rat wie<br />
drei schwer navigierbare und überdimensionierte<br />
Tanker, die in ihren Aktivitäten<br />
nur mühsam vorankommen.<br />
Ehe alltagsrelevante Entscheidungen<br />
getroffen werden, vergehen oft viele<br />
Monate, mitunter sogar Jahre.<br />
Das momentan größte Problem ist jedoch<br />
die Außendarstellung speziell der<br />
EU-Kommission. Sicher, es ist allgemein<br />
bekannt, dass es diverse EU-Fördertöpfe<br />
gibt. Aber damit hat es sich<br />
dann auch schon. Es gelingt der EU bis<br />
heute weder Herz noch Hirn der Menschen<br />
in Europa zu erreichen. Dass wir<br />
in Europa eine mehr als 70 Jahre andauernde<br />
Friedensperiode erleben, ist<br />
keine Selbstverständlichkeit, sondern<br />
geht ganz maßgeblich auf die gesamteuropäische<br />
Kooperation zurück. Auch<br />
die Tatsache, dass sich die Bürger in<br />
Europa weitgehend grenzenlos bewegen<br />
können und Waren ohne Zollbarrieren<br />
exportiert werden, ist ein Verdienst<br />
der EU. Die unvergleichlich positive<br />
Entwicklung, die Europa in den<br />
zurückliegenden Jahrzehnten genommen<br />
hat, ist das Ergebnis harter Arbeit<br />
und kluger Entscheidungen, die auch<br />
in Brüssel getroffen wurden. Tue Gutes<br />
und rede darüber – die Europäische<br />
Kommission ist dringend gefordert,<br />
ihre Politik wesentlich besser als<br />
bislang zu verkaufen.<br />
Die neuen Bundesländer haben in den<br />
zurückliegenden 25 Jahren erheblich<br />
von der Förderung aus Brüssel profitiert.<br />
Viele Milliarden Euro sind in regionale<br />
Entwicklungsprojekte und essenzielle<br />
Infrastrukturmaßnahmen geflossen.<br />
Lesen Sie dazu mehr in unserer<br />
Titelgeschichte ab Seite 30. In der laufenden<br />
Förderperiode stehen erneut<br />
große Budgets für Ostdeutschland zur<br />
Verfügung. Auch deshalb wäre es absolut<br />
gerechtfertigt, der EU und dem<br />
europäischen Gedanken zwischen<br />
Wismar und Görlitz eine größere Wertschätzung<br />
als bisher zu schenken.<br />
<br />
W+M<br />
WIRTSCHAFT<br />
WACHSTUM<br />
ZUKUNFT<br />
EINLADUNG<br />
zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum<br />
20.–21. Oktober <strong>2016</strong><br />
A-ROSA FORUM, BAD SAAROW<br />
www.WundM.info<br />
www.owf<strong>2016</strong>.de
4 | W+M INHALT<br />
W+M TITELTHEMA<br />
Brüsseler Segen – wie der Osten<br />
von EU-Geldern profitiert.................30<br />
W+M AKTUELL<br />
Köpfe......................................................................... 6<br />
Nachrichten............................................................... 8<br />
W+M SCHWERPUNKT SACHSEN<br />
Report: Stolz auf „Made in Saxony“........................12<br />
Cluster: Sachsens Stärke heißt Branchenvielfalt.....13<br />
Im Doppelinterview: Die Ministerpräsidenten<br />
Sachsens und Brandenburgs<br />
Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke......................16<br />
EnviaM-Chef Tim Hartmann über<br />
technische Innovationen für die Energiewende ....... 22<br />
30<br />
Titelthema Brüsseler Segen<br />
Finanzspritzen für den Mittelstand<br />
W+M LÄNDERREPORTS<br />
Mecklenburg-Vorpommern:<br />
Schwerin dockt an Hamburg an.............................. 24<br />
Ostdeutschland: Flughäfen am Tropf<br />
der öffentlichen Hand.............................................. 26<br />
Sachsen-Anhalt: Warum Bitterfeld<br />
zur AfD-Hochburg wurde...........................................28<br />
W+M TITELTHEMA BRÜSSELER SEGEN<br />
Report: Aufbauhelfer für Ostdeutschland............... 30<br />
Interview mit dem Berliner EU-Parlamentarier<br />
Joachim Zeller......................................................... 34<br />
Aktuelle Förderprogramme:<br />
Brüsseler Finanzspritzen für den Mittelstand............36<br />
Grenzregionen wachsen zusammen....................... 38<br />
Analyse: Wie der BREXIT<br />
auf Ostdeutschland wirkt........................................ 40<br />
16<br />
Exklusives Doppelinterview<br />
Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke<br />
Impressum<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong><br />
Das ostdeutsche Unternehmermagazin<br />
Ausgabe: 5/<strong>2016</strong><br />
Redaktionsschluss: 12.08.<strong>2016</strong><br />
Verlag: W+M Wirtschaft und Markt GmbH<br />
Zimmerstraße 56, 10117 Berlin<br />
Tel.: 030 479071-27<br />
Fax: 030 479071-22<br />
www.WundM.info<br />
Herausgeber/Geschäftsführer:<br />
Frank Nehring, Tel.: 030 479071-11<br />
FN@WundM.info<br />
Chefredakteur: Karsten Hintzmann<br />
Tel.: 030 479071-21, KH@WundM.info<br />
Redaktion: Janine Pirk-Schenker, Tel.: 030 479071-21,<br />
JP@WundM.info, Adrian M. Darr, Tel.: 030 479071-24,<br />
AD@WundM.info<br />
Autoren: Katrin Kleeberg, Harald Lachmann,<br />
Rudolf Miethig, Tomas Morgenstern, Matthias Salm,<br />
Thomas Schwandt<br />
Abo- und Anzeigenverwaltung: Kornelia Brocke,<br />
Tel.: 030 479071-27, KB@WundM.info<br />
Marketing/Vertrieb: Kerstin Will, Tel.: 030 479071-24<br />
KW@WundM.info<br />
Erscheinungsweise, Einzelverkaufs- und<br />
Abonnementpreis:<br />
Die Zeitschrift <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> erscheint<br />
zweimonatlich. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft<br />
der Unternehmerverbände Ostdeutschlands<br />
und Berlin sowie die Mitglieder des Vereins Brandenburgischer<br />
Ingenieure und Wirtschaftler (VBIW)<br />
erhalten diese Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.<br />
Einzelpreis: 5 €, Jahresabonnement (inkl. aller<br />
Ausgaben von W+M Regional, W+M Exklusiv, W+M<br />
Berlin.Friedrichstraße und dem Online-Magazin W+M<br />
Kompakt) 60 € inkl. MwSt. und Versand (im Inland).<br />
Layout & Design: Möller Medienagentur GmbH,<br />
www.moeller-mediengruppe.de<br />
Druck: Möller Druck und Verlag GmbH,<br />
ISSN 0863-5323<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Kopien nur<br />
mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen<br />
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und<br />
Fotos übernehmen wir keine Haftung.<br />
Fotos: W+M (oben), Ralf Succo (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
W+M INHALT | 5<br />
W+M POLITIK<br />
Pro und Contra: Braucht Ostdeutschland<br />
noch mehr Windräder?.............................................41<br />
Ostdeutsches Wirtschaftsforum:<br />
Bad Saarow lädt zum „Davos des Ostens“............ 42<br />
W+M RATGEBER<br />
Management: So gelingt<br />
die Unternehmensnachfolge................................... 46<br />
12<br />
Länderschwerpunkt<br />
Sachsens innovative Autobauer<br />
Finanzen: Förderprogramme für<br />
Erneuerbare Energien............................................. 48<br />
Insolvenz: Die Krise als Chance nutzen.................. 50<br />
Steuern: Kassenführung<br />
im Visier der Finanzbehörden.................................. 52<br />
Recht: Interessante Urteile für Unternehmer......... 53<br />
Büro: Vollautomaten für höchsten Kaffeegenuss... 54<br />
Literatur: Die ostdeutsche Bestsellerliste<br />
für Wirtschaftsliteratur............................................ 56<br />
Länderreport Ostdeutschland<br />
Flughäfen am Tropf der öffentlichen Hand<br />
26<br />
W+M NETZWERK<br />
Warnemünde:<br />
Business am Rande der Hanse Sail........................ 57<br />
Potsdam I: Sommernachtstraum am Tiefen See .....58<br />
Potsdam II: Brandenburger WirtschaftsForum<br />
zu Gast im Möbelhaus............................................ 59<br />
VBIW: Aktuelles aus dem Verein............................ 60<br />
Neues aus den Unternehmerverbänden................. 62<br />
W+M PORTRÄTS<br />
Nora Heer: Start-up-Dirigentin................................ 64<br />
Ralf Hillenberg: Preußischer Lautsprecher............. 65<br />
W+M DIE LETZTE SEITE<br />
Ausblick und Personenregister............................... 66<br />
Fotos: IAV (oben), Deutsche Post AG (Mitte)<br />
54<br />
Ratgeber Büro<br />
Höchster Kaffeegenuss fürs Office<br />
W+M WEITERE BEITRÄGE<br />
Editorial...................................................................... 3<br />
Impressum................................................................ 4<br />
Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt die Regionalausgabe<br />
W+M Sachsen sowie das Programm des Ostdeutschen<br />
Wirtschaftsforums OWF<strong>2016</strong> bei. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
6 | W+M AKTUELL<br />
K<br />
Ö<br />
2<br />
4<br />
P<br />
F<br />
1<br />
E 1 Tita von Hardenberg (48)<br />
TV-Unternehmerin aus Berlin<br />
Jüngst wurde die Berliner TV-Journalistin<br />
und Inhaberin des Medienunternehmens<br />
Kobalt als „Berliner Unternehmerin<br />
<strong>2016</strong>/2017“ von der Berliner Senatsverwaltung<br />
für Wirtschaft, Technologie und<br />
Forschung ausgezeichnet. Bevor Tita von<br />
Hardenberg ihr Unternehmen gründete,<br />
war sie Redaktionsleiterin der TV-Sparte<br />
des TIP-Stadtmagazins und verantwortete<br />
und moderierte die ORB-Sendung „TIP<br />
TV“. 1997 handelte sie mit ihrem Partner<br />
Stefan Mathieu einen eigenen Vertrag mit<br />
dem ORB aus, gründete Kobalt und produzierte<br />
fortan in eigener Verantwortung.<br />
Nach Höhen und Tiefen steht das Unternehmen<br />
heute wirtschaftlich kerngesund<br />
da, hat sich als Talentschmiede für große<br />
Fernsehkarrieren erwiesen und expandiert<br />
mit Kulturprogrammen und Dokumentationen<br />
seit vielen Jahren. „Kobalt<br />
vollzieht mit einem großen Team Festangestellter<br />
die Transformation ins digitale<br />
TV-Zeitalter und wird auch für weitere<br />
Jahrzehnte die Berliner Medienszene<br />
entscheidend mitprägen“, ist sich Tita<br />
von Hardenberg sicher.<br />
2<br />
Juliane Nowakowski (34)<br />
Hundeexpertin aus dem Havelland<br />
Die examinierte Juristin hatte nach dem<br />
Studium keine rechte Lust auf Gerichtssäle<br />
mehr. So sattelte sie um und baute sich<br />
3<br />
eine Hundeschule auf – besser gesagt:<br />
eine Hundehalterschule, wie es die zertifizierte<br />
Hundeerzieherin und Hundeverhaltensberaterin<br />
aus dem brandenburgischen<br />
Deetz bei Groß Kreutz nennt. Denn<br />
wenn ein Hund aus dem Ruder laufe, liege<br />
es oft eher an Herrchen oder Frauchen,<br />
lautet ihre Erfahrung. So bietet sie<br />
auch Anti-Jagd-Kurse, Rückrufkurse und<br />
Gruppenspaziergänge an. Einen Schwerpunkt<br />
hat die junge Frau, die dem Unternehmerinnen-Netzwerk<br />
Brandenburg<br />
angehört, bei Hütehunderassen. Hierzu<br />
hält sie selbst Schafe, mit denen Besitzer<br />
etwa von Border Collie, Schafpudel<br />
oder Strobel bei ihr testen können, ob diese<br />
noch ihre überkommenen Hirtenhund-<br />
Gene in sich tragen.<br />
3 Kristian Kirpal (43)<br />
Kammerpräsident aus Wermsdorf<br />
Der Familienunternehmer, der seit 2007<br />
gemeinsam mit Vater Kurt die Geschäfte<br />
der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau<br />
& Co. KG im nordsächsischen<br />
Wermsdorf führt, hatte sich Ende Juni<br />
bei der Vollversammlung der IHK Leipzig<br />
in geheimer Wahl gegen eine Mitbewerberin<br />
durchgesetzt. Er folgt Wolfgang<br />
Topf, der dieses Amt seit dem Jahr<br />
2000 innehatte. Zur IHK Leipzig gehören<br />
67.000 Mitgliedsbetriebe aus der<br />
Stadt und dem Landkreis Leipzig sowie<br />
dem Landkreis Nordsachsen. Kirpals<br />
Firma KET, die gut 40 Mitarbeiter beschäftigt,<br />
wurde bereits mit einem bundesweiten<br />
Innovationspreis der mittelständischen<br />
Wirtschaft ausgezeichnet.<br />
Einen Tätigkeitsschwerpunkt hat sie in<br />
der objektbezogenen dreidimen sionalen<br />
CAD-Planung individueller Aufträge.<br />
Zu ihren Kunden gehören auch Großkonzerne<br />
wie BMW, Porsche oder die<br />
Deutsche Bahn.<br />
4 Walter Riester (72)<br />
Renten-Erfinder aus Berlin<br />
Der frühere Bundesarbeitsminister ist<br />
nun endgültig Ostdeutscher geworden.<br />
Seit dem Frühjahr hat er seinen Lebensmittelpunkt<br />
in Berlin-Wuhlheide. Als gelernter<br />
Fliesenlegermeister verlegte er die<br />
Wand- und Bodenplatten in seiner neuen<br />
Wohnung übrigens selbst. Riester enga-<br />
Fotos: KircherPhoto (1), Harald Lachmann (2, 4), IHK Leipzig (3)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
W+M AKTUELL | 7<br />
IN MEMORIAM<br />
Thomas Wagner (38)<br />
5<br />
giert sich nach wie vor aktiv für die Entwicklung<br />
des Sozialstaats in Zeiten der<br />
Globalisierung sowie die Entwicklung<br />
sozialer Sicherungssysteme in Entwicklungs-<br />
und Schwellenländern. Zugleich<br />
mahnt er aber zu mehr Augenmaß in dieser<br />
Frage. Wer versuche, unsere westlichen<br />
Sozial- und Arbeitsstandards zu globalen<br />
Leitlinien zu erheben und sie der<br />
dritten Welt überzustülpen – um deren<br />
Einhaltung dann als pauschalen Maßstab<br />
für Exportwaren aus diesen Ländern zu<br />
verlangen – könne damit nur scheitern,<br />
sagt er. Hierfür sei die Welt kulturell zu<br />
verschieden.<br />
5 Dr. Alexandra Treutler (42)<br />
Fertigbad-Expertin aus Ahrensfelde<br />
Lange Zeit war der gebürtige Dessauer<br />
der Shootingstar der deutschen Internetszene,<br />
ein Überflieger der Branche. Sein<br />
Betriebswirtschaftsstudium brach er nach<br />
dem Vordiplom ab und bastelte lieber an<br />
seiner ersten Internetseite, einer Tauschbörse<br />
für Studenten. Ende 2002 ging sein<br />
erstes Versicherungsportal online, 2004<br />
ab-in-den-urlaub.de – mit monatlich drei<br />
Millionen Besuchern bis heute Deutschlands<br />
größtes Reiseportal. Zu seinen Werbeträgern<br />
gehören Michael Ballack und<br />
Rainer Calmund. Auch erfolgreiche Seiten<br />
wie geld.de, auto.de oder travel24.<br />
de brachte Wagner auf den Weg. Sein<br />
Portal fluege.de kaufte später sogar den<br />
ostdeutschen Ski-Hersteller „Germina“.<br />
Zuletzt beschäftigte er in seinem Leipziger<br />
Firmenimperium Unister über 2.000<br />
Menschen, betrieb 60 Webseiten, hielt<br />
die Rechte an hunderten weiteren. Dabei<br />
blieb er stets bescheiden, lebte mit seiner<br />
Partnerin in einer Leipziger Mietwohnung,<br />
überwies sich selbst nur 50.000 Euro im<br />
Jahr. Dennoch soll er illegale Versicherungsgeschäfte<br />
getätigt und damit Steuern<br />
in Millionenhöhe hinterzogen haben.<br />
Nach kurzer Untersuchungshaft kam er<br />
jedoch wieder frei, wartete nun auf eine<br />
Verhandlung. Am 14. Juli ist Thomas<br />
Wagner mit einer Privatmaschine über<br />
den slowenischen Bergen abgestürzt.<br />
Revitalisierung<br />
Sie kennen uns als Neubauspezialisten!<br />
Wussten Sie schon von unserer Revitalisierungskompetenz?<br />
Fotos: Harald Lachmann (5), Unister (rechts)<br />
Zart, zierlich, bewusst feminin – wer die<br />
junge Chefin der brandenburgischen Niederlassung<br />
von Schwörer Haus in Ahrensfelde<br />
erlebt, mag sie sich nur schwer<br />
in eine raue Bau- und Männerwelt hineindenken.<br />
Dennoch führt sie sehr erfolgreich<br />
die Außenstelle des schwäbischen<br />
Familienunternehmens – in ihr werden<br />
auf einem früheren Sportplatzgelände<br />
Bäder für Hotels und Wohnheime komplett<br />
vorgefertigt, so dass sie dann nur<br />
noch per Kran in die Gebäude eingesetzt<br />
werden – mit ebenso weiblich-sanfter<br />
wie energisch-konsequenter Hand. Und<br />
nebenher erlangte die studierte Betriebswirtin<br />
über ein Programm, das auf berufstätige<br />
Manager zugeschnitten ist,<br />
auch noch ihren Doctor of Business Administration<br />
an der niederländischen<br />
TIAS School for Business and Society.<br />
GOLDBECK Nordost GmbH<br />
Bauen im Bestand Nordost<br />
Hauptstraße 103<br />
04416 Markkleeberg<br />
Tel. 0341 35602-500<br />
www.goldbeck.de<br />
1977 2015<br />
konzipieren • bauen • betreuen<br />
ANZEIGE<br />
GOLDBECK
8 | W+M AKTUELL<br />
NACHRICHTEN<br />
ERFOLGREICHE BILANZ<br />
Potsdam. Am 30. Juni 1991 versandte die<br />
Bürgschaftsbank Brandenburg ihre ersten<br />
15 Bürgschaftsurkunden und ermöglichte<br />
damit der ersten Brandenburger Gründergeneration<br />
die Finanzierung ihrer Selbstständigkeit.<br />
Seitdem wurden mehr als<br />
8.000 Bürgschaften an Brandenburger Unternehmer<br />
und Existenzgründer vergeben,<br />
die etwa 31.000 neue Arbeitsplätze schufen<br />
und halfen, mehr als 126.000 Arbeitsplätze<br />
zu sichern. Die Bürgschaften dienten<br />
der Finanzierung von Investitionen in Höhe<br />
von über 4,2 Milliarden Euro, getätigt von<br />
mittelständischen Unternehmen aller Branchen<br />
und Größen. Ob Fanartikelversand,<br />
Bäcker, Tischler, Chocolatier, Softwareoder<br />
Bauunternehmer – Bürgschaften für<br />
inzwischen insgesamt zwei Milliarden Euro<br />
Kredite unterstützen seit 1991 den Brandenburger<br />
Mittelstand. Anlässlich des Jubiläums<br />
erklärt Ministerpräsident Dietmar<br />
Woidke: „Die Bürgschaftsbank ist seit nunmehr<br />
25 Jahren Partner und wichtige Stütze<br />
des Brandenburger Mittelstands. Mit<br />
Hilfe der Bürgschaften konnten viele der<br />
heute angesehenen Brandenburger Unternehmen<br />
investieren und erfolgversprechende<br />
Ideen umsetzen.“<br />
FIRMEN SUCHEN NACHFOLGER<br />
Harry Glawe, Rolf Kammann, Dr. Stefan Fassbinder, Klaus Olbricht und Dr. Wolfgang Blank (v. l.)<br />
beißen kraftvoll in Witeno-Äpfel.<br />
FEST AUF DEM SONNENDECK<br />
Greifswald. Der Einladung zum gemeinsamen<br />
Sommerfest des Technologiezentrums<br />
Vorpommern (TZV), des BioTechnikums<br />
Greifswald und der Wirtschaftsfördergesellschaft<br />
Vorpommern (WFG)<br />
folgten mehr als 250 Unternehmer der<br />
Region. Nach der Begrüßung durch TZVund<br />
BioTechnikum-Geschäftsführer Dr.<br />
Wolfgang Blank und Rolf Kammann, Geschäftsführer<br />
der WFG, betonte Mecklenburg-Vorpommerns<br />
Wirtschaftsminister<br />
Harry Glawe, dass eine Zusammenarbeit<br />
von Technologiezentren, regionalen Unternehmen,<br />
Hochschulen und außeruniversitären<br />
Forschungseinrichtungen nötig<br />
sei, um Forschung, Entwicklung und<br />
Innovation wirtschaftlich voranzubringen.<br />
Auch der Präsident der IHK Magdeburg<br />
Klaus Olbricht und Dr. Stefan Fassbinder,<br />
Oberbürgermeister der Stadt Greifswald,<br />
würdigten die Arbeit der Veranstalter für<br />
den Wirtschaftsstandort Vorpommern.<br />
Dr. Wolfgang Blank stellte außerdem die<br />
neue Gesellschaft „Witeno“ nach Verschmelzung<br />
der Technologiezentrum-Fördergesellschaft<br />
mbH und des BioTechnikums<br />
vor. Unternehmer, Investoren, Existenzgründer,<br />
Geschäftsfreunde und Netzwerkpartner<br />
nutzten – wie auch bereits<br />
im Vorjahr – das Sommerfest, um sich in<br />
entspannter Atmosphäre auszutauschen<br />
und Netzwerke zu knüpfen.<br />
Leipzig. Weil sich die Firmenchefs oft zu<br />
wenig oder aber zu spät Gedanken um die<br />
Nachfolge machen, wie man bei den IHK<br />
kritisiert, scheitert gegenwärtig allein in<br />
Sachsen bei 5.300 meist kleinen Unternehmen<br />
die Stabübergabe: Es fehlt jemand,<br />
der aus der zweiten Reihe nach vorn treten<br />
könnte. Damit liegt der Freistaat bundesweit<br />
an achter Stelle und in Ostdeutschland<br />
sogar im negativen Sinne an der Spitze. In<br />
Thüringen stehen 2.800 Übergaben an, in<br />
Sachsen-Anhalt 2.700, in ganz Deutschland<br />
sind es 135.300. Vor allem im ostdeutschen<br />
Handwerk sieht es laut Prof. Dr. Alexander<br />
Lahmann von der Handelshochschule Leipzig<br />
(HHL) sehr trübe in dieser Frage aus.<br />
Denn wie eine HHL-Studie ergab, seien<br />
hier oft keine Unternehmerfamilien im traditionellen<br />
Sinne vorhanden – es fehle also<br />
die nächste Generation, die ganz selbstverständlich<br />
ans Ruder dränge. Zudem hätten<br />
die nun ausscheidenden Firmenchefs, die<br />
ab 1990 die Betriebe aufbauten oder sie<br />
in die Marktwirtschaft führten, „meist bis<br />
zum Schluss gerackert“. Nun könnten sie<br />
nicht mehr, haben aber „die Zeit, jemanden<br />
einzuarbeiten, ungenutzt verstreichen<br />
lassen“, beobachtet auch Hartmut Bunsen,<br />
Vorsitzender des Unternehmerverbandes<br />
Sachsen. Denn drei bis fünf Jahre brauche<br />
es schon, um einen Nachfolger aufzubauen.<br />
Und dann sei nicht einmal sicher,<br />
dass der Neue auch zur Firma passe.<br />
SUBSTANZVERZEHR STOPPEN<br />
Berlin. Die LINKE hat angekündigt, im<br />
Bundestag und in den Landtagen dafür zu<br />
streiten, dass Investitionen in die öffentliche<br />
Infrastruktur der Kommunen und Länder<br />
massiv angehoben werden. Zwischen<br />
1992 und 2013 hätten sich diese Investitionen<br />
nahezu halbiert. Dadurch sei ein erheblicher<br />
Substanzverzehr an der baulichen,<br />
sozialen und Verkehrsinfrastruktur<br />
zu beklagen. Nach Berechnungen der Linken<br />
beläuft sich die Investitionslücke bundesweit<br />
auf mehr als 46 Milliarden Euro.<br />
Angesichts bröckelnder Schulen, Straßen<br />
und Krankenhäuser sei es trotz Schuldenbremse<br />
nötig und möglich, zu investieren.<br />
Die Linken setzen dabei jedoch nicht auf<br />
öffentlich-private Partnerschaften, sondern<br />
auf rein öffentliche Partnerschaften. Udo<br />
Wolf, LINKE-Fraktionschef in Berlin: „Wir<br />
wollen, dass die Kredite von öffentlichen<br />
Unternehmen aufgenommen werden. Die<br />
niedrigen Zinsen sollten genutzt werden,<br />
um endlich die öffentliche Infrastruktur zu<br />
sanieren, erneuern oder auszubauen. Doppelter<br />
Effekt: Mit so finanzierten Investitionsprogrammen<br />
können Beschäftigungsund<br />
Qualifizierungsmaßnahmen verbunden<br />
und ein Beitrag zur Bekämpfung von<br />
Arbeitslosigkeit sowie zur Integration von<br />
Geflüchteten geleistet werden.“<br />
Foto: G. Kulke<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
W+M AKTUELL | 9<br />
INVESTOREN ALS JOBMOTOR<br />
Dresden. Laut aktuellen Zahlen von Germany<br />
Trade & Invest, der Standortmarketinggesellschaft<br />
des Bundes, ist die mitteldeutsche<br />
Dreiländerregion bei ausländischen<br />
Unternehmern beliebter denn je. So<br />
entstanden allein 2015 durch Direktinvestitionen<br />
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und<br />
Thüringen fast 4.800 neue Jobs. Auch im<br />
Dresdener Wirtschaftsministerium bestätigt<br />
man eine gegenüber den Vorjahren<br />
„stark angestiegene“ Zahl erfolgreicher<br />
Projekte ausländischer Anleger. Wurden<br />
So kann eine Wohnung bei Wunderflats aussehen.<br />
2014 in ganz Sachsen noch zwölf Projekte<br />
mit einem Gesamtvolumen von 93,8 Millionen<br />
Euro auf den Weg gebracht, flossen<br />
2015 bereits 355,8 Millionen Euro in insgesamt<br />
23 Maßnahmen. Auch in Sachsen-Anhalt<br />
verdoppelte sich diese Zahl von 18 auf<br />
35 Projekte. In beiden Ländern wie auch in<br />
Thüringen führten vor allem US-amerikanische<br />
Investoren die Interessentenliste an,<br />
gefolgt von Unternehmen aus Asien, Österreich<br />
und der Schweiz. Als bevorzugte<br />
Branchen kristallisierten sich hierbei die Bereiche<br />
Maschinenbau, elektrische Ausrüstungen<br />
und Automotive heraus.<br />
BERLIN CAPITAL CLUB UNTERSTÜTZT START-UPS<br />
CLEVERE LÖSUNG<br />
Bautzen. Die BME Dr. Golbs & Partner<br />
GmbH aus Bautzen hat einen innovativen<br />
Langzeitspeicher entwickelt,<br />
der für den individuellen Wohnbereich<br />
eine autarke Versorgung mit Wärme<br />
und Kühlung sichern sollte. Basis der<br />
Versorgung ist die Nutzung von Solarenergiesystemen.<br />
Die Freude war<br />
groß, als bereits in den Vorversuchen<br />
Ergebnisse erzielt wurden, die weit<br />
über denen des Wettbewerbs lagen.<br />
Wie aber findet man die richtigen Partner<br />
und eine geeignete Finanzierung?<br />
Die Lösung war so einfach wie bemerkenswert:<br />
über die exzellenten<br />
Netzwerke der Unternehmerverbände.<br />
Durch die direkte Ansprache des<br />
Präsidenten des Unternehmerverbandes<br />
Schwerin Rolf Paukstat wurden<br />
Partner in Mecklenburg-Vorpommern<br />
gefunden, welche die Produktion<br />
übernehmen und so die Entwicklung<br />
vollenden werden. Unternehmer<br />
Dr. Andreas Golbs ist zufrieden: “Wir<br />
‚verkaufen‘ die Idee in der Frühphase<br />
an private Investoren und behalten<br />
trotzdem die Kontrolle. Wir nutzen eigene<br />
Substanz in Kombination mit<br />
Fördermitteln des Landes und Bundes.<br />
Wir verwerten bereits in der Entwicklungsphase<br />
international.“<br />
Fotos: Wunderflats (oben), BME (unten)<br />
Berlin. Die Hauptstadt ist für innovative<br />
Firmengründungen eine der wichtigsten<br />
Städte in Europa. Viele heute erfolgreiche<br />
Geschäftsmodelle haben dort ihren<br />
Ursprung, und der Berlin Capital Club<br />
will auf diese jungen Unternehmen zugehen.<br />
Das neue Veranstaltungsformat<br />
„Start Ups im Berlin Capital Club“ initiiert<br />
von den Advisory-Board-Mitgliedern<br />
Prof. Dr. Peter Fissenewert, Klaus-Jürgen<br />
Meier und Dr. Axel Stirl bietet Mitgliedern<br />
und Gästen unmittelbar die Möglichkeit,<br />
die handelnden Akteure und Gründer<br />
kennenzulernen und sich in unterschiedlicher<br />
Größenordnung zu beteiligen. Für<br />
die Start-ups ist dies eine ideale Plattform,<br />
sich zu präsentieren. Bei der jüngsten<br />
Veranstaltung Ende Mai waren die<br />
Unternehmen BJOOLI und Wunderflats<br />
im Club zu Gast.<br />
Bjooli.com ist der erste geprüfte Marktplatz<br />
für Oldtimerteile und Zubehör. Ziel ist der<br />
Aufbau des weltweit größten Marktplatzes<br />
für Fahrer und Fans klassischer Automobile.<br />
Dafür investiert BJOOLI derzeit in den<br />
Aufbau der führenden Fahrzeug- und Teiledatenbank<br />
für den Klassik-Markt.<br />
Wunderflats.com vermietet möblierte Wohnungen<br />
ab einem Monat Aufenthalts dauer.<br />
Kunden wie Microsoft oder Rolls-Royce<br />
nutzen Wunderflats bereits heute für Berufseinsteiger,<br />
Manager und Freiberufler.<br />
Im Rahmen der jetzigen Finanzierungsrunde<br />
nimmt das Start-up eine Million Euro Kapital<br />
auf, um im nächsten Jahr Marktführer in<br />
den fünf größten Städten Deutschlands zu<br />
werden. Der nächste Start-up-Abend findet<br />
am 15. September <strong>2016</strong> mit der VR Business<br />
Plattform Berlin/Brandenburg statt.<br />
<br />
www.berlincapitalclub.de<br />
Das Modell des innovativen Langzeitspeichers<br />
für eine autarke Versorgung<br />
mit Wärme und für die Kühlung eines<br />
Wohnbereichs.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
10 | W+M AKTUELL<br />
NACHRICHTEN<br />
ifo Geschäftsklima Ostdeutschland im Juli <strong>2016</strong><br />
TROTZ BREXIT-VOTUM BLEIBT INDUSTRIE OPTIMISTISCH<br />
Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft*<br />
der ostdeutschen Bundesländer ist im Juli gesunken. Maßgeblich<br />
waren die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage,<br />
die auf hohem Niveau spürbar zurückgenommen wurden.<br />
Die Geschäftserwartungen waren hingegen geringfügig optimistischer<br />
als im Juni.<br />
Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirtschaft<br />
Ostdeutschlands ist im Juli ebenfalls gesunken. Besonders deutlich<br />
trübten sich die Beschäftigungserwartungen im ostdeutschen<br />
Einzelhandel ein. Auch die Bauunternehmen rechnen in<br />
den kommenden drei Monaten saisonbereinigt mit weniger Beschäftigung.<br />
Dagegen wollen die ostdeutschen Industrieunternehmen<br />
und Großhändler ihre Beschäftigung per Saldo ausweiten.<br />
Das Brexit-Votum scheint der ostdeutschen Industrie die Stimmung<br />
vorerst nicht zu vermiesen. Zwar gehen die hiesigen Befragungsteilnehmer<br />
für die kommenden Monate von weniger Impulsen<br />
aus dem Auslandsgeschäft aus, jedoch korrigierten sie ihre<br />
Geschäftserwartungen insgesamt ein wenig nach oben. Auch die<br />
aktuelle Geschäftslage wurde etwas besser eingeschätzt als im<br />
Juni. Dagegen berichteten die ostdeutschen Bauunternehmer sowie<br />
die Groß- und Einzelhändler im Juli von deutlich weniger guten<br />
Geschäften als im Vormonat.<br />
Michael Weber und Prof. Joachim Ragnitz<br />
ifo Geschäftsklima<br />
VORMONAT 10,6 JULI 8,9<br />
ifo Beschäftigungsbarometer<br />
VORMONAT - 0,6 JULI - 2,1<br />
Verarbeitendes Gewerbe<br />
VORMONAT 12,6 JULI 14,1<br />
Bauhauptgewerbe<br />
VORMONAT 4,8 JULI 1,7<br />
Groß- und Einzelhandel<br />
VORMONAT 10,4 JULI 3,4<br />
* Unter gewerblicher Wirtschaft wird die Aggregation aus Verarbeitendem Gewerbe, Bauhauptgewerbe sowie Groß- und Einzelhandel verstanden.<br />
ZUKUNFTSFÄHIGE WÄRMEVERSORGUNG<br />
Eberswalde. In den letzten zwölf Monaten<br />
untersuchte der regionale Energiedienstleister<br />
EWE Möglichkeiten für eine<br />
zukunftsfähige Wärmeversorgung in der<br />
Eberswalder Innenstadt. Ende Juni stellte<br />
das Unternehmen den Abschlussbericht<br />
vor. „Unser Vorhaben hat Erkenntnisse<br />
Freuen sich über den erkenntnisreichen Projektabschluss: Dr. Ulrich Müller, Gerd Hampel,<br />
Dr. Lutz Giese, Dr. Oliver Ruch, Severine Wolff, Daniel Acksel und Prof. Dr. Jörn Mallok (v. l.).<br />
für ein ganzheitliches Wärmekonzept<br />
und insgesamt eine energetische Optimierung<br />
in vier unterschiedlichen Stadtquartieren<br />
geliefert“, so Dr. Ulrich Müller,<br />
Leiter der EWE-Geschäftsregion Brandenburg/Rügen.<br />
Im Kern habe die Untersuchung<br />
ergeben, dass es am sinnvollsten<br />
sei, Bestehendes Schritt für Schritt<br />
zu verbessern und nah an den Bedürfnissen<br />
der Menschen in ihrem Umfeld<br />
zu entwickeln. Betrachtet werden sollte<br />
der Sanierungs- und Investitionsbedarf<br />
genauso wie die Struktur- und Bevölkerungsentwicklung<br />
sowie die Entwicklung<br />
der Technologien. Ein gemeinsamer Arbeitsplan<br />
führe zum nachhaltigen Erfolg.<br />
Projektpartner waren die Stadt Eberswalde,<br />
das Büro für Kommunalberatung<br />
und Projektsteuerung, die Hochschule<br />
für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde,<br />
die Technische Hochschule Wildau<br />
sowie die Brandenburgische Technische<br />
Universität Cottbus-Senftenberg. Eingebunden<br />
ist das Vorhaben in das Forschungsprojekt<br />
„Wärme neu gedacht!“<br />
des Deutschen GeoForschungsZentrums<br />
GFZ, gefördert vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung im Programm<br />
Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation.<br />
Foto: EWE/Auras<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
ADVERTORIAL | 11<br />
Foto: Porta<br />
„Porta – Möbel und mehr“ heißt es<br />
deutschlandweit seit mehr als 50 Jahren.<br />
1965 im ostwestfälischen Porta Westfalica<br />
gegründet, gehört das familiengeführte<br />
Einrichtungsunternehmen heute zu<br />
den Top Sieben der Branche. Ob das neue<br />
Sofa, der geräumige Kleiderschrank oder<br />
die individuelle Traumküche, bei Porta wird<br />
jeder fündig, der sich neu einrichten will.<br />
Große Glasfronten sind stilprägend für alle Porta-Einrichtungshäuser<br />
und kommen 2017 auch beim Berliner Neubau zum Einsatz.<br />
Das Erlebniseinrichtungshaus<br />
Porta Möbel: Für jeden Stil die passende<br />
Einrichtung / 2017 Neueröffnung in Berlin-Mahlsdorf<br />
Von der Grundausstattung bis hin zur individuellen<br />
Dekoration gibt es in allen 22 Einrichtungshäusern<br />
tolle Möbel und trendige<br />
Wohnaccessoires. In unterschiedlichen Abteilungen<br />
zeigt Porta von elegant bis extravagant<br />
verschiedene Einrichtungsstile und<br />
themenbezogene Wohnwelten. So finden<br />
junge, zeitgeistorientierte Möbelliebhaber<br />
bei Quartier stylische Wohntrends und innovative<br />
Einrichtungsideen sofort zum Mitnehmen.<br />
Im House of Design warten außerdem<br />
exklusive Markenmöbel bekannter<br />
Hersteller. Als Erlebniseinrichtungshaus<br />
stehen bei Porta neben Möbeln vor allem<br />
die Punkte Service und Familienfreundlichkeit<br />
im Fokus. Die fachmännische Lieferung<br />
und Montage gehört ebenso zum Service-Einmaleins<br />
wie die vom Profi geplante<br />
Küche. Im hauseigenen Toscana-Restaurant<br />
serviert das Porta-Team außerdem<br />
frisch zubereitete Gerichte für jeden Geschmack.<br />
Und auch die kleinen Besucher<br />
kommen nicht zu kurz, wartet im Portalino-Kinderclub<br />
doch ein großer Abenteuerspielplatz,<br />
der entdeckt werden will.<br />
Zukünftig lädt Porta auch in Berlin zum Möbelshopping<br />
ein. Im Frühjahr 2017 soll in<br />
Mahlsdorf an der B1/B5 das 23. Einrichtungshaus<br />
– erstmals mit separater Küchenwelt<br />
– eröffnen. Auf mehr als 39.000<br />
Quadratmetern Fläche gibt es dann von<br />
A bis Z alles, was es braucht, um das eigene<br />
Zuhause individuell zu gestalten. Um<br />
die aufkommende logistische Kapazität zu<br />
bewerkstelligen, wird in Trebbin außerdem<br />
ein neues Zentrallager gebaut. An beiden<br />
Standorten sucht das Familienunternehmen<br />
daher aktuell mehr als 400 neue<br />
Fach- und Führungskräfte sowie Quereinsteiger<br />
in allen Bereichen. Mit der Neueröffnung<br />
in Berlin macht Porta den nächsten<br />
Schritt und will mithilfe zahlreicher<br />
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
die eigene Erfolgsgeschichte fortsetzen.<br />
WOHNIDEEN<br />
FÜR DIE GANZE<br />
FAMILIE<br />
14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 · direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · www.porta.de
TLÄNDERSCHWERPUNK<br />
12 | W+M SCHWERPUNKT<br />
Stolz auf<br />
„Made in Saxony“<br />
SACHSEN<br />
Blick in die moderne<br />
Produktion der Heckert GmbH.<br />
Sachsen nimmt heute einen Spitzenplatz in der ostdeutschen<br />
Wirtschaft ein. Das Bruttoinlandsprodukt verzeichnete im<br />
vergangenen Jahrzehnt einen Anstieg um 14 Prozent. Besonders<br />
stolz ist man im selbsternannten Land der Tüftler und Ingenieure auf<br />
den eigenen Fachkräftenachwuchs. Von Karsten Hintzmann<br />
Sachsens Wirtschaftsminister Martin<br />
Dulig (SPD) wirkt alles andere als<br />
unzufrieden, wenn er über den Wirtschaftsstandort<br />
Sachsen spricht: „Auf<br />
der Habenseite stehen die gewachsene<br />
Industriestruktur und die Industrietradition.<br />
Sachsen ist ein Industrieland. Wir sind<br />
Automobilland und Maschinen- und Anlagenbauland.<br />
Wir sind Mikroelektronikland.<br />
Es gibt ‚Made in Saxony‘ und viele ebenfalls<br />
erfolgreiche Branchen und zukunftsweisende<br />
Cluster. Wir haben eine Struktur,<br />
um die uns andere Länder beneiden.“<br />
Weitere Wachstumskerne haben sich –<br />
neben den von Dulig namentlich erwähnten<br />
Branchen – speziell in den Bereichen<br />
Umwelt- und Energietechnik, Life Sciences,<br />
Logistik, Luft- und Raumfahrt sowie<br />
Bahntechnik herausgebildet.<br />
Mit fünf Fahrzeug- beziehungsweise<br />
Motorenwerken<br />
von BMW, Porsche<br />
und Volkswagen sowie<br />
rund 750 Zulieferern,<br />
Ausrüstern und<br />
Dienstleistern der<br />
Branche gehört das<br />
„Autoland Sachsen“<br />
zu den deutschen Spitzenstandorten.<br />
Die Automobilindustrie<br />
mit ihren<br />
rund 80.000 Beschäftigten ist Sachsens<br />
umsatzstärkste Branche. Sie trägt fast<br />
ein Viertel zum Industrieumsatz und über<br />
ein Drittel zum Auslandsumsatz bei. Allerdings<br />
blicken die sächsischen Mittelständler<br />
derzeit besorgt nach Wolfsburg,<br />
denn der dort ausgelöste Abgasskandal<br />
könnte auch bis auf die sächsischen Zulieferer<br />
durchschlagen.<br />
Mit über 2.800 Unternehmen, mehr als<br />
38.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz<br />
von über 6,6 Milliarden Euro gehört<br />
„Silicon Saxony“ zu den vier großen<br />
Mikroelektronik-Standorten in Europa.<br />
Sachsen gilt als die Wiege des deutschen<br />
Maschinenbaus, lange Jahre angetrieben<br />
von den Erfordernissen des heimischen<br />
Bergbaus. Seit rund 200 Jahren<br />
kommen weltweit gefragte<br />
Maschinenbau-Erzeugnisse<br />
wie Textil-, Werkzeug-<br />
und Druckmaschinen<br />
aus Sachsen.<br />
Die Branche mit rund<br />
45.000 Mitarbeitern<br />
in nahezu 1.000 Firmen<br />
trägt rund zwölf<br />
Sachsens Wirtschaftsminister<br />
Martin Dulig.<br />
Prozent zum Industrieumsatz und 15 Prozent<br />
zum Auslandsumsatz Sachsens bei.<br />
Mit etwa 11.900 Beschäftigten in über 680<br />
Unternehmen ist die Umwelt- und Energietechnik<br />
in Sachsen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.<br />
Sie erzielt einen Umsatz von<br />
rund 2,7 Milliarden Euro. Auf Basis der Tradition<br />
Sachsens als Bergbauregion verfügen<br />
die hiesigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen<br />
bei der Sanierung<br />
von Bergbaufolgeschäden, in der Altlastenbeseitigung<br />
oder bei der Erneuerung<br />
von Abwassersystemen über herausragendes<br />
Expertenwissen.<br />
Der wirtschaftliche Aufschwung in Sachsen<br />
wird maßgeblich vom hervorragenden<br />
Fachkräftereservoir getragen. 95 Prozent<br />
der Sachsen verfügen über die Hochschulreife<br />
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung<br />
(EU-Durchschnitt: 77 Prozent). Die<br />
Hochschuldichte liegt mit sechs Universitäten,<br />
14 Fachhochschulen und sieben<br />
Berufsakademien deutlich über dem Bundesdurchschnitt.<br />
Dazu kommen 18 Einrichtungen<br />
der Fraunhofer-Gesellschaft, sechs<br />
Max-Planck-Institute, sechs Leibnitz-Institute,<br />
drei Helmholtz-Einrichtungen und 22<br />
Industrieforschungszentren.<br />
Die Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut:<br />
Europas modernstes Luftfrachtdrehkreuz<br />
befindet sich in Leipzig. Da sich in<br />
Sachsen etliche wichtige Europastraßen<br />
und Autobahnen kreuzen, gilt das Land<br />
als Logistikdrehkreuz zwischen Ost- und<br />
Westeuropa. Über die Elbe wird grenzübergreifender<br />
Handel von der Tschechischen<br />
Republik bis zum Hafen Hamburg<br />
abgewickelt.<br />
W+M<br />
Fotos: Heckert GmbH (oben), W+M (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
SACHSEN | 13<br />
Reinstraum bei Infineon in Dresden – eines der Flaggschiffe<br />
des erfolgreichen Mikroelektronik-Clusters Silicon Saxony.<br />
Foto: Infineon<br />
Sachsens Stärke heißt<br />
Branchenvielfalt<br />
Nicht nur traditionelle Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau<br />
oder die Automobilindustrie sind wieder stark vertreten. Auch auf<br />
den Gebieten Mikroelektronik/Informations- und Kommunikationstechnik<br />
(IKT) und Umwelttechnologie zeigt Sachsens Wirtschaft<br />
Innovationskraft. Sechs leistungsstarke Cluster etablierten sich<br />
inzwischen im Freistaat. Von Katrin Kleeberg und Harald Lachmann<br />
Von der Forschung zur Marktreife:<br />
Was andernorts als ein steiniger<br />
Weg gilt, gerät in Sachsen leicht<br />
zur Rennstrecke. Denn ein besonderes<br />
Plus des Freistaates liegt in dessen überdurchschnittlicher<br />
Innovationskraft. Dies<br />
unterstrich schon wiederholt auch der<br />
„Regional Innovation Scoreboard“ der EU<br />
– der wichtigste Gradmesser der Union in<br />
der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik.<br />
Demnach gilt Sachsen als<br />
einer der europäischen Innovationsführer.<br />
Das Land punktet mit dem Bildungsstand<br />
der Arbeitskräfte, der Höhe der<br />
Investitionen in Forschung und Entwicklung,<br />
der Anzahl an Patenten, dem Vernetzungsgrad<br />
von Forschung und Wirtschaft<br />
sowie der Anzahl der Beschäftigten<br />
in Forschung und Entwicklung.<br />
Zugleich verfügen fast 90 Prozent der<br />
Erwerbstätigen über einen beruflichen<br />
Bildungsabschluss – ein Spitzenwert in<br />
Deutschland. All das sind Voraussetzungen<br />
für leistungsfähige Cluster und Branchenverbünde,<br />
die die sächsische Wirtschaft<br />
heute maßgeblich prägen.<br />
Mikroelektronik:<br />
Europas größter Chipcluster<br />
Von Dresden aus, wo die 290 Unternehmen<br />
und Forschungseinrichtungen<br />
des Verbundes Silicon Saxony e. V. ihren<br />
Sitz haben, agiert heute nicht nur Europas<br />
größter Cluster der Halbleiterbranche.<br />
Auch weltweit rangiert die Region<br />
auf Platz fünf. Allein in und um Dresden<br />
arbeiten 40.000 Menschen in der Mikroelektronik.<br />
Die hiesige Produktion<br />
von integrierten Schaltkreisen trägt fast<br />
fünf Prozent zum weltweiten Chipmarkt<br />
bei. Neben Großproduzenten mit hohen<br />
Stückzahlen haben sich viele mittelständische<br />
Unternehmen in der Mikroelektronik<br />
und Informationstechnik angesiedelt.<br />
Auf sie entfällt bereits über die Hälfte der<br />
Arbeitsplätze in diesem Metier.<br />
Sachsenweit tummeln sich sogar über<br />
2.200 Unternehmen mit gut 58.000 Mitarbeitern<br />
in allen Fertigungsstufen der IKT-<br />
Wertschöpfungskette: Sie entwickeln, fertigen<br />
und vermarkten integrierte Schaltkreise,<br />
produzieren Material und Equipment,<br />
entwickeln Software oder sind auf<br />
Systeme spezialisiert, die auf integrierten<br />
Schaltungen fußen. Gemeinsam setzen<br />
sie jährlich gut acht Milliarden Euro um.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
14 | W+M SCHWERPUNKT<br />
passive Bauelemente oder Sensoren.<br />
Und die Herstellung derartiger Chips ist<br />
auch auf den bisherigen Anlagen möglich.<br />
Eine zentrale Rolle spielen hierbei<br />
auch Faktoren wie Kundenorientierung<br />
und Kundennähe – eine Stärke gerade der<br />
sächsischen Firmen.<br />
Die AWEBA Werkzeugbau GmbH in Aue gehört zu den größten und modernsten<br />
Werkzeugbaubetrieben in Europa.<br />
Dennoch bestimmen aber natürlich die<br />
Großen der Branche die Schlagzeilen.<br />
Neben Infineon, das in der Elbmetropole<br />
einen seiner weltweit leistungsfähigsten<br />
Fertigungsstandorte betreibt, gehört<br />
hierzu auch der US-amerikanische Halbleiterhersteller<br />
GLOBALFOUNDRIES. Er<br />
beschäftigt rund 3.600 hochqualifizierte<br />
Spezialisten. Die Fab 1 (Fabrikationsstätte)<br />
zählt zu den produktivsten und modernsten<br />
Waferfabriken weltweit. Mit einer<br />
Reinraumfläche von 52.000 Quadratmetern<br />
ist sie das größte und modernste<br />
Halbleiterwerk in Europa. Bislang investierte<br />
GLOBALFOUNDRIES gut neun Milliarden<br />
Dollar in Dresden.<br />
Solche Gigantomanie hat stets ihre Kehrseite,<br />
gerade in der Mikroelektronik. So<br />
wurde die Branche in den letzten Jahren<br />
weltweit von einer permanenten Miniaturisierung<br />
und Leistungssteigerung getrieben,<br />
was zu einem sehr hohen Innovationstempo<br />
gerade bei den Prozesstechnologien<br />
führte – und auch immense Investitionen<br />
nach sich zog. Vor allem stark<br />
staatlich subventionierte Player in Asien<br />
trieben diesen Wettlauf voran – zu Lasten<br />
auch sächsischer Produktionskapazitäten,<br />
die preislich hier teils nicht mithalten<br />
konnten.<br />
Doch inzwischen wirkt auch ein Gegentrend,<br />
der der ostdeutschen Mikroelektronik<br />
wieder in die Hände spielt: Immer<br />
stärker nachgefragt werden kundenorientierte<br />
Lösungen für spezifische Anwenderbranchen.<br />
Hierzu gehört gerade die<br />
Automobilindustrie, wo weniger Miniaturisierung<br />
und Leistungssteigerung von<br />
Mikrochips im Mittelpunkt stehen als ergänzende<br />
Funktionalitäten, etwa durch<br />
Motorenprüfstand im VW-Motorenwerk<br />
Chemnitz.<br />
Als ein Beispiel hierfür kann die X-FAB in<br />
Dresden gelten, eine Foundry, die analog-digitale<br />
integrierte Schaltkreise fertigt.<br />
Zudem werden Kunden und Partner<br />
bei der Entwicklung innovativer Mikroelektronik<br />
unterstützt. Gemeinsam mit<br />
weiteren Firmen und der Technischen<br />
Universität Dresden arbeitete X-FAB<br />
etwa an intelligenten Steuerungen für<br />
energieeffiziente E-Motoren und LED.<br />
Maschinenbau:<br />
Alte Stärke erfolgreich wiederbelebt<br />
Der Maschinen- und Anlagenbau in Sachsen<br />
ist seit seinen Anfangsjahren einer<br />
der Innovationstreiber im Freistaat –<br />
auch wenn das 1703, als Johann Esche<br />
im sächsischen Limbach die erste deutsche<br />
Fabrik für Spezialmaschinen der<br />
Strumpf- und Wäscheindustrie gründete,<br />
wohl noch ganz anders hieß. Fakt aber<br />
ist: Der erste maschinelle Tuchwebstuhl<br />
der Welt, die erste Farbdruckschnellpresse<br />
Deutschlands und die Nähwirktechnik<br />
haben ihren Ursprung in Sachsen.<br />
Es folgten im 20. Jahrhundert komplexe<br />
Bearbeitungszentren, hoch effektive<br />
Maschinen und Anlagen für nahezu alle<br />
Bereiche der Wirtschaft. Innovative Lösungen<br />
anbieten zu können – darin liegt<br />
das Erfolgsrezept des sächsischen Maschinen-<br />
und Anlagenbaus.<br />
Um diesen Wettbewerbsvorteil zu halten<br />
und weiter auszubauen, wurde bereits<br />
Ende 2003 die Verbundinitiative Maschinenbau<br />
Sachsen VEMAS ins Leben gerufen.<br />
Mit dem Ziel, „die Leistungs- und<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen<br />
des sächsischen Maschinen- und Anlagenbaus<br />
nachhaltig zu stabilisieren und<br />
konsequent weiter zu stärken“, gegründet<br />
und basisfinanziert vom Sächsischen<br />
Wirtschaftsministerium, hat sich diese<br />
Verbundinitiative immer weiter entwickelt.<br />
Seit Januar 2014 wird sie als Innovationsverbund<br />
Maschinenbau Sachsen<br />
unter der Projektträgerschaft des Fraun-<br />
Fotos: Harald Lachmann<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
SACHSEN | 15<br />
Der erste in Leipzig montierte BMW.<br />
Seit März 2005 wird in dem sächsischen<br />
Werk in Serie produziert.<br />
hofer IWU als „VEMASinnovativ“ weitergeführt.<br />
Im Mittelpunkt stehen jetzt „die<br />
Unterstützung des Technologietransfers<br />
und die Organisation von Netzwerkkooperationen<br />
für Produkt- und Prozessinnovationen<br />
und zur Markterschließung<br />
über Branchengrenzen hinweg sowie die<br />
Erschließung von Synergien und Systemkompetenzen“.<br />
Das Kernziel – die Stärkung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen<br />
Maschinenbauer – ist geblieben.<br />
Auch wenn die Zentralen der Konzerne<br />
oder Firmengruppen, zu denen die sächsischen<br />
Maschinenbauer heute zu einem<br />
Großteil gehören, ihren Stammsitz nicht<br />
in Sachsen haben – das Know-how der<br />
Maschinenbauer ist hier geblieben, wie<br />
auch so manch großer Name: Heckert,<br />
Barmag, NEMA, Niles und VEM. Sie alle<br />
sind heute wie vor Jahrzehnten weltweit<br />
geschätzte Marken.<br />
Heute gehört das Autoland Sachsen<br />
mit derzeit vier Werken von Volkswagen,<br />
BMW und Porsche wieder zu den<br />
deutschen Spitzenstandorten. Fast jeder<br />
zehnte in Deutschland gebaute Pkw<br />
kommt von hier. Volkswagen beschäftigt<br />
in Sachsen an gleich drei Standorten rund<br />
10.000 Mitarbeiter. In Zwickau entstehen<br />
Golf und Passat. Drei von vier Porsche-<br />
Autos sind inzwischen made in Saxony.<br />
Kürzlich rollte die erste viertürige Sportlimousine<br />
der zweiten Generation des<br />
Panamera in Leipzig vom Band. Sie wird<br />
nunmehr komplett in Sachsen gebaut.<br />
Auch rund 750 Zulieferer, Ausrüster und<br />
Dienstleister mit über 81.000 Beschäftigten<br />
tragen täglich zu dieser Entwicklung<br />
bei. Die Automobilbranche<br />
steuert damit mehr als ein<br />
Viertel zum Gesamtumsatz und<br />
mehr als ein Drittel zum Auslandsumsatz<br />
der sächsischen Industrie<br />
bei. Zudem steht Sachsen<br />
auch bei der zweiten automobilen<br />
Revolution auf der „Pole Position“.<br />
Ob moderne Hybrid- und<br />
Elektromobilitätslösungen, autonomes<br />
Fahren, Leichtbau, ressourceneffiziente<br />
Produktionstechnologien<br />
oder neue Verkehrskonzepte – überall<br />
arbeiten Industrie und Forschung hierfür<br />
Hand in Hand und treiben Lösungen<br />
für eine nachhaltige Mobilität voran. An<br />
der Westsächsischen Hochschule Zwickau<br />
arbeitet zudem ein in der deutschen<br />
Hochschullandschaft einzigartiges Zentrum<br />
für Kfz-Elektronik.<br />
Nicht zufällig startete BMW 2013 die Serienproduktion<br />
für die beiden ersten Elektromodelle<br />
im Leipziger Werk: den stadttauglichen<br />
BMW i3 und den Sportwagen<br />
BMW i8. Auch deshalb gehört Sachsen<br />
heute zu den vier bundesweiten Schaufenster-Regionen<br />
in Sachen Elektromobilität.<br />
W+M<br />
Fotos: Harald Lachmann<br />
Automobilindustrie:<br />
Zweite automobile Revolution<br />
Für Harald Krüger, Vorstandschef der<br />
BMW AG, ist Leipzig ein „wichtiger<br />
Standort in unserem globalen Produktionsnetzwerk“.<br />
Für die Stadt und die Region<br />
Leipzig sprächen „eine optimale Infrastruktur<br />
sowie sehr gut ausgebildete<br />
und hoch motivierte Mitarbeiter“. Diese<br />
führen denn das Erbe der sächsischen Ingenieure<br />
fort, die einst die Linkslenkung<br />
und den Frontantrieb in Serie auf das internationale<br />
Parkett gebracht hatten.<br />
Blick in die Montagehalle des Leipziger Porschewerkes, wo Panamera und Cayenne montiert werden.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
16 | W+M SCHWERPUNKT<br />
Zwei Landesväter, viele Parallelen:<br />
Sie sind pragmatisch, wirtschaftsfreundlich, stammen<br />
aus der Lausitz und lieben Schokolade<br />
W+M-Interview mit den Ministerpräsidenten<br />
Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU)<br />
Stanislaw Tillich und Dr. Dietmar Woidke<br />
haben so einiges gemeinsam – sie sind<br />
in ihren Ländern jeweils der dritte Ministerpräsident<br />
seit der deutschen Wiedervereinigung.<br />
Dietmar Woidke regiert in<br />
Brandenburg, Stanislaw Tillich in Sachsen.<br />
Beide sind sie gebürtige Lausitzer<br />
– Tillich stammt aus dem Oberlausitzer<br />
Ort Neudörfel, Woidke aus Naundorf<br />
in der Niederlausitz. Obwohl sie unterschiedlichen<br />
Parteien angehören, Woidke<br />
führt die Brandenburger SPD, Tillich<br />
ist Landeschef der sächsischen CDU,<br />
verbindet sie seit Jahren eine Männerfreundschaft.<br />
Dennoch kommt es selten<br />
vor, dass sie sich gemeinsam zum<br />
Interview stellen. Für das Magazin<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> machten sie<br />
eine Ausnahme. Am Rande einer Bundesratssitzung<br />
in Berlin diskutierten Stanislaw<br />
Tillich und Dietmar Woidke über<br />
den Stand der brandenburgisch-sächsischen<br />
Beziehungen, die Zukunft der<br />
Braunkohle und ihre Erwartungen an den<br />
Mittelstand.<br />
W+M: Seit wann kennen Sie sich eigentlich?<br />
Dietmar Woidke: Wir beide kennen uns<br />
schon eine ganze Weile. Es muss 2004<br />
gewesen sein, da waren wir zur gleichen<br />
Zeit Umweltminister unserer<br />
Länder.<br />
W+M: Sie machen keinen Hehl daraus,<br />
dass Sie sich über Parteigrenzen hinweg<br />
schätzen. Worauf basiert diese Wertschätzung?<br />
Dietmar Woidke: Was man nach der<br />
Geburt nicht mehr korrigieren kann: Wir<br />
sind beide Lausitzer. Wir sind beide unkomplizierte<br />
Typen. Wir haben ähnliche<br />
Erfahrungen gesammelt, zu DDR-Zeiten<br />
und vor allem in den 1990er Jahren. In<br />
einem Punkt stimmen wir völlig überein:<br />
Die Grundlage der weiteren Entwicklung<br />
der Länder ist eine aktive Industriepolitik.<br />
Da haben wir beide wenig Hang zur<br />
Esoterik. Wir wissen, wie sich Deindustrialisierung<br />
anfühlt.<br />
Stanislaw Tillich:<br />
Stimmt. Wir waren<br />
damals sogar auch<br />
Landwirtschaftsminister.<br />
Stanislaw Tillich: Das ist ein typischer<br />
Woidke gewesen, das mit der Esoterik.<br />
Ich sage es so: Wir machen kein Gewese<br />
drumherum. Sondern sind schnurgerade<br />
heraus. Wenn wir beide uns einig sind,<br />
wissen wir, dass wir gemeinsam bessere<br />
Chancen haben. Gemeinsam ist uns auch<br />
die Liebe zur eigenen Scholle. Um es auf<br />
den Punkt zu bringen: Pragmatisch, wirtschaftsfreundlich,<br />
dem Land zuerst verpflichtet<br />
und danach der Partei – und wir<br />
beide lieben Schokolade.<br />
W+M: Klappt die bilaterale Zusammenarbeit<br />
zwischen Sachsen und<br />
Brandenburg auch so reibungslos,<br />
wie der direkte Kontakt zwischen<br />
den Ministerpräsidenten? Wo sehen<br />
Sie die größten Reserven?<br />
Verstehen sich bestens:<br />
Stanislaw Tillich (l.) und<br />
Dietmar Woidke.<br />
Foto: Ralf Succo<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
SACHSEN | 17<br />
Fotos: Ralf Succo<br />
Gruppenbild im Bundesrat: W+M-Herausgeber Frank Nehring, die<br />
Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und Dietmar Woidke sowie<br />
W+M-Chefredakteur Karsten Hintzmann (v. l.).<br />
Stanislaw Tillich: Reserven gibt es immer.<br />
Wir müssen unseren Unternehmen<br />
nicht sagen, was sie tun sollten, das wissen<br />
sie selbst. Aber wir müssen die Voraussetzungen<br />
für wirtschaftliches Engagement<br />
schaffen. So versuchen wir<br />
etwa Druck zu machen, gerade bei den<br />
Infrastrukturprojekten, die an der sächsisch-brandenburgischen<br />
Landesgrenze<br />
liegen – im Raum zwischen Torgau und<br />
Herzberg oder auch in Schwarzheide und<br />
Schwarze Pumpe. Wir haben in Sachsen<br />
eine etwas üppigere Ausstattung<br />
bei den Hochschulen. Da gibt es sicher<br />
noch Potenziale, die wir für die Kooperation<br />
nutzen können. Und wir haben das<br />
System der Berufsakademien, das wichtig<br />
für die Fachkräfteversorgung ist. Der<br />
BASF in Schwarzheide fällt es zum Beispiel<br />
zunehmend schwer, Fachkräfte für<br />
den Standort zu bekommen. Das ist ein<br />
Punkt, um den wir uns gemeinsam kümmern<br />
müssen. Eine Frage steht dabei im<br />
Mittelpunkt: Wie schaffen wir es, diese<br />
Grenzregion so attraktiv zu machen, dass<br />
dort Fachkräfte hingehen?<br />
W+M: Wenn es um die wirtschaftliche<br />
Entwicklung und um Ansiedlungen von<br />
Investoren geht, sind Sie vermutlich Konkurrenten.<br />
Kam es schon vor, dass Sie<br />
sich potenzielle Investoren abgeworben<br />
haben?<br />
Dietmar Woidke: An so etwas kann<br />
ich mich nicht erinnern. Entscheidend<br />
ist für die Menschen in den branden-<br />
burgisch-sächsi-<br />
schen Grenzregionen,<br />
dass vor allem<br />
die Investitionen<br />
in der Region<br />
erfolgen.<br />
Stanislaw Tillich:<br />
Einer meiner Vorgänger<br />
hat mal gesagt:<br />
„Windräder<br />
sind Gelddruckmaschinen.“<br />
Daraufhin<br />
hat sich der<br />
Investor entschieden,<br />
in Lauchhammer<br />
zu bauen und<br />
nicht in Sachsen.<br />
Insofern hatte damals eine politische Äußerung<br />
dazu beigetragen, dass Brandenburg<br />
eine zusätzliche Investition bekam.<br />
W+M: Ein nach wie vor wichtiger Wirtschaftszweig<br />
ist der Braunkohleabbau<br />
und die nachfolgende Braunkohleverstromung.<br />
Wie lange hat Braunkohle in ihren<br />
Ländern noch eine Zukunft?<br />
Stanislaw Tillich: Ich bin davon überzeugt,<br />
dass wir mit der Braunkohle noch<br />
bis weit in die 2040er Jahre arbeiten werden.<br />
Weil wir sie als Brückentechnologie<br />
und zur stabilen Energieversorgung<br />
brauchen. Gerade auch, wenn ab 2022<br />
keine Kernenergie mehr in Deutschland<br />
produziert wird.<br />
Dietmar Woidke: Das betrifft die deutsche<br />
Industrie und Deutschland insgesamt.<br />
Es ist wichtig, die Energiedebatte<br />
ehrlich zu führen. Und das heißt, dass<br />
wir auf konventionelle Energieträger, also<br />
die Kohle, erst dann verzichten können,<br />
wenn wir die heute noch unzuverlässigen<br />
Erneuerbaren Energien zu zuverlässigen<br />
Energieträgern gemacht haben. Da<br />
stecken wir aktuell noch in den Kinderschuhen.<br />
W+M: Brandenburg plant als Reaktion<br />
auf den Bevölkerungsrückgang in den<br />
ländlichen und Randregionen eine Verwaltungsreform,<br />
die aktuell nicht unumstritten<br />
ist. Wie ist Sachsen auf den demografischen<br />
Wandel vorbereitet, stehen<br />
Sie auch vor einer Straffung der Verwaltung,<br />
Herr Tillich?<br />
Stanislaw Tillich: Wir haben unsere Verwaltung<br />
bereits in den letzten Jahren gestrafft.<br />
Noch vor rund zehn Jahren hatten<br />
wir 22 Landkreise und sieben kreisfreie<br />
Städte, heute sind es zehn Landkreise<br />
und drei. Die Reduzierung war 2008<br />
mit einer Verwaltungs- und Funktionalreform<br />
verbunden. Solche Vorhaben stoßen<br />
nicht immer auf Gegenliebe. Oft sind es<br />
Befindlichkeiten, die zur Gegenwehr führen.<br />
Meine Meinung zu solch einem politischen<br />
Vorhaben: Wenn du einmal gestartet<br />
bist, musst du durch und es immer wieder<br />
im Dialog erklären. Und am Ende des<br />
Tages zahlt es sich auch für die Bürger aus.<br />
W+M: Sowohl in Sachsen als auch in<br />
Brandenburg gab es in den zurückliegenden<br />
Monaten fremdenfeindliche Aktionen,<br />
über die auch in den internationalen<br />
Medien berichtet wurde. Befürchten Sie,<br />
dass dies negative Auswirkungen auf die<br />
Attraktivität der Standorte Sachsen und<br />
Brandenburg haben wird?<br />
ZUR PERSON<br />
Stanislaw Tillich wurde am 10. April 1959<br />
in Neudörfel bei Kamenz geboren. An<br />
der Technischen Universität Dresden<br />
studierte er Konstruktion und Getriebetechnik.<br />
Bereits zu DDR-Zeiten trat er<br />
der CDU bei. Seine politische Karriere im<br />
geeinten Deutschland startete Tillich in<br />
Brüssel – bis 1994 arbeitete er als Beobachter<br />
im Europaparlament, danach bis<br />
1999 als Abgeordneter. Ab 1999 bekleidete<br />
er in Sachsen verschiedene Ministerposten.<br />
Seit 2008 ist Stanislaw Tillich<br />
sächsischer Ministerpräsident. Er ist verheiratet<br />
und Vater zweier Kinder.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
18 | W+M SCHWERPUNKT SACHSEN<br />
Stanislaw Tillich: Dass es diese Ereignisse<br />
gegeben hat, ist das eine. Und dass<br />
es durch die Berichterstattung dazu führt,<br />
dass sich das eine oder andere Unternehmen<br />
überlegt, welche Konsequenzen das<br />
für eine zukünftige Investition hat, gehört<br />
leider dazu. Meine Antwort ist deutlich:<br />
Wenn das ein entscheidender Faktor wäre,<br />
eine Investition nicht zu tätigen, dann hätte<br />
man den Rechtsextremisten Genüge getan.<br />
Denn dann hätten sie es geschafft zu<br />
verhindern, was uns Demokraten am Herzen<br />
liegt: Dass Menschen und Investoren<br />
zu uns kommen – aus aller Welt. Wir tun<br />
alles dafür, dass sich die Rechtsextremen<br />
nicht durchsetzen können.<br />
Dietmar Woidke: Es schadet Deutschland<br />
immens, wenn Leute mit einem Galgen<br />
in der Hand durch Dresden marschieren.<br />
Und es schadet Ostdeutschland im<br />
Besonderen. Wir haben im letzten Jahr<br />
das „Bündnis für Brandenburg“ gegründet.<br />
Um einer immer stärker international<br />
agierenden Wirtschaft Flagge zu zeigen<br />
und zu sagen: Ihr Rechtspopulisten<br />
seid nicht die Mitte der Gesellschaft! Dieser<br />
Platz ist besetzt. Jede ausländische<br />
Fachkraft, die wir aufgrund solcher Bilder<br />
nicht mehr nach Deutschland bekommen,<br />
ist ein Verlust für unser Land. Daher<br />
bekämpfen wir Rechtsextremismus<br />
in Brandenburg seit Ende der 90er Jahre<br />
besonders intensiv und erfolgreich – sowohl<br />
mit der Zivilgesellschaft als auch mit<br />
den Mitteln des Rechtsstaates.<br />
W+M: Das wirtschaftliche Rückgrat in<br />
Brandenburg und Sachsen bildet der Mittelstand.<br />
Was erwarten Sie eigentlich von<br />
einem mittelständischen Unternehmer?<br />
Stanislaw Tillich: Ich wünsche mir von<br />
denjenigen, die mittlerweile das Potenzial<br />
haben, größer zu werden und zu wachsen,<br />
dass sie auch die Courage dazu haben.<br />
Sie können es, sie müssen nur den<br />
Mut zum nächsten Schritt haben. Oft sind<br />
ostdeutsche Unternehmer noch zu bescheiden<br />
bei dem, was sie drauf haben.<br />
ZUR PERSON<br />
Dietmar Woidke wurde am 22. Oktober<br />
1961 in Naundorf bei Forst geboren. Er<br />
studierte Landwirtschaft und Tierproduktion<br />
an der Berliner Humboldt-Universität.<br />
In der Wendezeit arbeitete Woidke<br />
als wissenschaftlicher Assistent am Berliner<br />
Institut für Ernährungsphysiologie.<br />
1993 trat er in die SPD ein und gehört<br />
seit 1994 dem Brandenburger Landtag<br />
an. Er fungierte bereits als Landwirtschafts-<br />
und als Innenminister. Seit dem<br />
28. August 2013 ist Dietmar Woidke Ministerpräsident<br />
in Brandenburg. Er ist<br />
verheiratet und Vater einer Tochter.<br />
Dietmar Woidke: Eine wichtige Erwartung,<br />
die ich an die Unternehmer habe,<br />
wurde in jüngster Zeit erfüllt: Dass sich<br />
die Unternehmen selbst darum kümmern,<br />
künftige Fachkräfte zu suchen und<br />
auszubilden. Sie nehmen möglichst frühzeitig<br />
mit den Schulen Kontakt auf und<br />
knüpfen die Verbindung Schule–Wirtschaft.<br />
Hier sind wir noch nicht am Ende<br />
des Wegs, aber ich bin froh, dass unsere<br />
Wirtschaft die Fachkräftesicherung inzwischen<br />
als Hauptthema erkannt hat.<br />
W+M: Als Landesväter sind Sie nicht nur<br />
gefordert, die aktuellen Regierungsgeschäfte<br />
zu führen. Sie müssen auch den<br />
Blick nach vorn richten und wichtige Weichenstellungen<br />
für die Zukunft vorantreiben.<br />
Wo sehen Sie Ihr Land – wirtschaftlich<br />
betrachtet – im Jahr 2030?<br />
Stanislaw Tillich: Wir wollen, dass in allen<br />
Landesteilen die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
die gleichen sind. Ich folge<br />
nicht den Wirtschaftsforschern, die sagen,<br />
dass wir in Zukunft bestimmte entleerte<br />
Räume haben werden. Der Bürger<br />
selbst wird entscheiden, wo er zu wohnen<br />
gedenkt. 80 Prozent der Unternehmen<br />
und 60 Prozent der Arbeitsplätze befinden<br />
sich im ländlichen Raum, außerhalb<br />
von Dresden, Chemnitz und Leipzig.<br />
Wir müssen die Voraussetzungen schaffen,<br />
damit dies so bleibt. 2030 wird Sachsen<br />
nicht nur Hotspot in der Mikroelektronik<br />
sein, Sachsen wird ein industrielles<br />
Herz Deutschlands sein und hoffentlich<br />
aufgeschlossen haben zu Bayern und<br />
Baden-Württemberg.<br />
Dietmar Woidke: Wir sind auf dem<br />
Weg, ein Hochtechnologieland zu werden<br />
– speziell im Bereich der Luft- und<br />
Raumfahrt. Dabei sind wir gut beraten,<br />
der Fachkräftesituation unvermindert<br />
große Aufmerksamkeit zu schenken.<br />
Wir werden 2030 noch nicht das wirtschaftlich<br />
führende Bundesland sein,<br />
aber ein Bundesland mit einer starken<br />
Wirtschaft und einer dann noch deutlich<br />
niedrigeren Arbeitslosigkeit. Um das zu<br />
erreichen, werden wir unsere industriellen<br />
Kerne weiter stärken und wirtschaftlichen<br />
Aufschwung in allen Landesteilen<br />
sicherstellen.<br />
W+M: Wer wird im Ländervergleich dann<br />
die Nase vorn haben – Brandenburg oder<br />
Sachsen?<br />
Stanislaw Tillich: Brandenburg ist heute,<br />
was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
rein nach dem Steueraufkommen<br />
betrifft, erfolgreicher als Sachsen. Beide<br />
Länder haben aber ein strukturelles Defizit.<br />
Der Brandenburger Norden ist schwächer<br />
als das Berliner Umland. Und unsere<br />
drei großen Städte Dresden, Leipzig<br />
und Chemnitz sind stärker als der Raum<br />
um sie herum. Für mich ist entscheidend,<br />
dass wir diese strukturellen Unterschiede<br />
beseitigen. Also, wenn Dresden so<br />
attraktiv ist, dass es den gleichen Wohlstand<br />
bis nach Zittau, Görlitz und Weißwasser<br />
trägt, dann bin ich zufrieden.<br />
Dietmar Woidke: Ostdeutschland befindet<br />
sich immer noch in einem wirtschaftlichen<br />
Aufholprozess. Wir sind auf einem<br />
guten Weg, aber es gibt viele Risiken.<br />
Deshalb müssen wir weiter hart arbeiten<br />
und vor allem ehrgeizig bleiben. Selbstzufriedenheit<br />
wäre fehl am Platz.<br />
Interview: Karsten Hintzmann<br />
und Frank Nehring<br />
Foto: Ralf Succo<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
Bewegt sitzen -<br />
mehr<br />
bewegen!<br />
www.büro-bewegung.de<br />
Die Aktion für mehr Bewegtsitzen im Büro<br />
Büro-Bewegung ist eine Aktion des:<br />
dimba<br />
Deutsches Institut<br />
für moderne Büroarbeit
20 | ADVERTORIAL<br />
IT-Trends für den Mittelstand<br />
Ohne IT-Systeme geht auch bei Mittelständlern nichts mehr. Deshalb stellt sich die<br />
kritische Frage: Was dürfen Datensicherheit und Verfügbarkeit der IT-Systeme kosten?<br />
Oder besser: Wie teuer wird es, wenn die IT (über mehrere Stunden) ausfällt?<br />
Oft entsprechen das Niveau von Risikovorsorge- und Sicherheitsmaßnahmen nicht<br />
mehr der gestiegenen Bedeutung der IT-Systeme. Die ACS Solutions und die<br />
envia TEL haben für unterschiedliche Branchen differenzierte Antworten.<br />
Wenn ein IT-System<br />
unternehmenskritisch ist<br />
Torsten Albrecht nennt ein einfaches Beispiel:<br />
Ein Maschinenbauunternehmen<br />
nutzt für die Steuerung und Verwaltung<br />
seiner Materiallager ein modernes ERP-<br />
System. Gelieferte Bauteile haben keinen<br />
festen Platz mehr im Lager, sondern werden<br />
vom ERP-System möglichst effizient,<br />
das heißt „chaotisch“ abgelegt. Wenn<br />
das ERP-System ausfällt, steht die Fertigung<br />
mangels Material sehr schnell still.<br />
Das kostet pro Schicht etwa 40.000 Euro.<br />
Die Verfügbarkeit des ERP-Systems hat<br />
also eine unternehmenskritische Bedeutung<br />
und erfordert eine angemessene<br />
Absicherung.<br />
Eines der Modernsten: das Datacenter von envia TEL in Taucha bei Leipzig.<br />
Das ERP-System wird jetzt im Hochsicherheits-Rechenzentrum<br />
der envia TEL<br />
betrieben und von ACS betreut. Hier<br />
sind alle Systeme auf Ausfallsicherheit<br />
und Hochverfügbarkeit optimiert. So ist<br />
die ERP-Software auf zehn virtualisierte<br />
Server verteilt, sodass ein Hardwareausfall<br />
keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit<br />
hat. Die schnelle Datenverbindung zum<br />
Maschinenbauunternehmen ist abhörsicher<br />
verschlüsselt und über zwei verschiedene<br />
Gebäudezugänge redundant<br />
ausgelegt.<br />
Der eigene IT-Technikraum<br />
kann problematisch werden<br />
„Viele Mittelständler halten eine IT-Infrastruktur<br />
im eigenen Haus immer<br />
noch für die beste Lösung. Das hält einer<br />
kritischen Überprüfung in aller Regel<br />
nicht stand“, so der ACS-Vertriebsleiter.<br />
Er nennt die physische Absicherung<br />
der Systeme, wie USV-Anlagen und<br />
Brandschutz, bis hin zu ausgefeilten Redundanzkonzepten.<br />
„Zusätzlich kommen<br />
Kosten für die IT-Security und für ausreichend<br />
qualifizierte IT-Mitarbeiter hinzu.<br />
Das wird durch die gestiegene Komplexität<br />
für die meisten Mittelständler<br />
recht teuer“, fasst Torsten Albrecht zusammen.<br />
ACS Solutions stellt für Geschäftskunden<br />
hoch standardisierte, flexible und effiziente<br />
IT-Lösungen bereit und arbeitet hier<br />
eng mit envia TEL zusammen. Der Telekommunikationsdienstleister<br />
betreibt in<br />
Taucha bei Leipzig einen der modernsten<br />
Datacenter-Standorte in Deutschland.<br />
Das Rechenzentrum unterliegt deutschen<br />
Datenschutzbestimmungen und<br />
ist nach dem international anerkannten<br />
IT-Sicherheitsstandard ISO/IEC 27001<br />
zertifiziert. Alle relevanten Infrastrukturkomponenten<br />
sind mehrfach ausgelegt<br />
und auch bei der physischen Sicherheit<br />
auf dem neuesten Stand der Technik. Als<br />
Datacenter-Anbieter kann envia TEL die<br />
Anlagen sehr wirtschaftlich betreiben<br />
und die Kosten auf eine Vielzahl von Anwendern<br />
verteilen.<br />
Sicherheit und Verfügbarkeit<br />
von Datenverbindungen<br />
Wenn ein Mitarbeiter von zu Hause aus<br />
auf die Daten im Unternehmen zugreifen<br />
will oder mehrere Standorte miteinander<br />
vernetzt werden sollen, spielt die<br />
Sicherheit und Verfügbarkeit der Datenverbindung<br />
eine entscheidende Rolle.<br />
Für einen IT-Dienstleister wie ACS sei<br />
es kein Problem, dafür ein sogenanntes<br />
virtuelles privates Netzwerk (VPN) einzurichten.<br />
Ein VPN verschlüsselt den kompletten<br />
Datenverkehr und sorgt, wie in<br />
einem geschützten Datentunnel, für eine<br />
abhör- und manipulationssichere Verbindung.<br />
„Bei den Datenverbindungen ver-<br />
Foto: envia TEL<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
ADVERTORIAL | 21<br />
Foto: ACS Solutions GmbH<br />
trauen wir trotzdem lieber auf den Service<br />
von envia TEL“, erläutert Torsten Albrecht.<br />
Große Provider wie envia TEL<br />
nutzen für den Transport von sensiblen<br />
Sprach- und Datenpaketen das Verfahren<br />
„Multiprotocol Label Switching“<br />
(MPLS). Das bringt aus Sicht von ACS<br />
den Vorteil, dass auch komplexe Anforderungen<br />
wie die verschlüsselte Verbindung<br />
zwischen mehreren Standorten zuverlässig<br />
und gut administriert werden<br />
können. Verfügt ein Unternehmen über<br />
zwei voneinander unabhängige Datenverbindungen,<br />
sorgt MPLS automatisch für<br />
deren Koordination.<br />
Beispiele für Engagement<br />
und Flexibilität<br />
Torsten Albrecht nennt die stärkere Vernetzung<br />
als wichtigen IT-Trend, der alle<br />
Mittelständler trifft. Was aktuell bei Industrie<br />
4.0 umgesetzt werde, fordere jeden<br />
Zulieferer heraus und gelte auch für<br />
Branchen wie Handel, Finanzdienstleistungen,<br />
Versicherungen, Dienstleistungen,<br />
Logistik und nicht zuletzt auch für<br />
die öffentliche Verwaltung. „Dabei geht<br />
es immer um sichere und schnelle Datenverbindungen<br />
und eine sichere Datenablage<br />
in einem möglichst ISO-zertifizierten<br />
Rechenzentrum. Hier arbeiten wir nach<br />
Möglichkeit mit envia TEL zusammen“,<br />
hebt der ACS-Vertriebsleiter hervor. Er<br />
sieht die Flexibilität, das Kosten-/Nutzenverhältnis<br />
und die Zuverlässigkeit vieler<br />
Provider als eher kritisch.<br />
Als Beispiel nennt er ein Projekt<br />
zur Datenanbindung<br />
einer Niederlassung in<br />
Norwegen. Die Verbindung<br />
kam wegen<br />
nicht erkennbarer<br />
Probleme zunächst<br />
nicht zustande. Da<br />
die Strecke über<br />
mehrere Leitungsanbieter<br />
gekoppelt werden<br />
musste, konnte der<br />
Fehler aus der Ferne nicht<br />
lokalisiert werden. „Erst durch das Engagement<br />
von envia TEL wurde das Problem<br />
gelöst. Ein Mitarbeiter ist mit seinen<br />
Messinstrumenten nach Norwegen<br />
gefahren und hat dort einen falsch konfigurierten<br />
Router gefunden“, berichtet<br />
der ACS-Vertriebsleiter. Er betont auch<br />
die Bereitschaft, möglichst flexible und<br />
bei Bedarf auch unkonventionelle Wege<br />
zu gehen. Wenn Leitungsverbindungen<br />
zu teuer sind, nutze envia TEL auch Richtfunkstrecken.<br />
„Eine solche Flexibilität ist<br />
nur durch engagierte Mitarbeiter<br />
möglich. Das schätzen<br />
wir an envia TEL“, fasst<br />
der ACS-Vertriebsleiter<br />
seine Bewertung<br />
zusammen.<br />
Torsten Albrecht<br />
ist Vertriebsleiter der<br />
ACS Solutions GmbH.<br />
Sicher und flexibel vernetzt<br />
Im Zeitalter der Digitalisierung stoßen Unternehmensnetzwerke<br />
immer öfter an Ihre Leistungsgrenze. Mit unserer<br />
zukunftssicheren Standortvernetzung und dem Datacenter<br />
Leipzig können Sie Ihr Netzwerk zuverlässig, sicher und<br />
kostengünstig betreiben.<br />
Home Office<br />
envia TEL Datacenter<br />
Partner/Lieferant<br />
Industrie 4.0<br />
Um für Ihr Unternehmen die passende Lösung<br />
zu finden, beraten wir Sie gern.<br />
Haben Sie Interesse?<br />
www.enviaTEL.de, www.datacenter-leipzig.de<br />
info@enviaTEL.de<br />
0800 0101600 (kostenfrei)<br />
Kundenstandort<br />
Router<br />
Sendemast<br />
Unterwegs
22 | W+M SCHWERPUNKT<br />
„Ohne technische Innovationen<br />
wird die Energiewende nicht gelingen.“<br />
Der enviaM-Vorstandsvorsitzende Tim Hartmann im W+M-Interview<br />
Die Diskussionen um die Energiewende sind festgefahren:<br />
Befürworter und Gegner konventionell erzeugter und Erneuerbarer<br />
Energien stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber,<br />
immer wieder flammen – wie jüngst in Brandenburg und<br />
Sachsen – hitzige Debatten über die weitere Notwendigkeit<br />
der Braunkohleverstromung auf. Gleichzeitig versucht der<br />
Gesetzgeber, den Ausbau der Erneuerbaren Energien<br />
wirtschaftlicher zu machen. Ausschreibung und<br />
Mengenbegrenzung heißen die Schlagworte.<br />
Davon offenbar unbeeindruckt arbeitet der<br />
ostdeutsche Energiedienstleister enviaM an<br />
der weiteren Schärfung seines Profils – und<br />
greift einen Megatrend auf: die Digitalisierung.<br />
Warum, das erklärt der Vorstandsvorsitzende<br />
von enviaM Tim Hartmann im Interview mit<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong>.<br />
W+M: Herr Hartmann, ein weiteres Jahr<br />
voller – sagen wir einmal – nicht ganz<br />
optimaler Rahmenbedingungen liegt<br />
hinter der deutschen Energiewirtschaft.<br />
Wie ist enviaM als Gruppe<br />
durch 2015 gekommen?<br />
Tim Hartmann: Wir haben erneut<br />
ein gutes Ergebnis erzielt.<br />
Insgesamt beliefen sich die<br />
Umsatzerlöse der enviaM-<br />
Gruppe in 2015 auf 4,99 Milliarden<br />
Euro gegenüber 4,79<br />
Milliarden Euro in 2014.<br />
Unser Strom- und Gasabsatz<br />
ist gestiegen, letzterer<br />
sogar um rund 30 Prozent.<br />
Wir konnten konstante<br />
Kundenzahlen im Stromund<br />
gestiegene Kundenzahlen<br />
im Gasbereich verzeichnen. Vor<br />
dem Hintergrund, dass insbesondere<br />
im Gassektor derzeit ein hoher Verdrängungswettbewerb<br />
herrscht, freuen<br />
uns die Zuwächse hier ganz besonders.<br />
All das ist ein guter Boden für weitere Investitionen.<br />
Diese wuchsen in der Gruppe<br />
in 2015 auf 185,3 Millionen Euro – ein<br />
Plus von knapp 30 Millionen Euro im Vergleich<br />
zum Vorjahr. Die Gelder flossen<br />
insbesondere in den Netzbereich und in<br />
die Stromerzeugung aus Erneuerbaren<br />
Energien. Die Zahl unserer Mitarbeiter<br />
stieg durch die erhöhte Investitionstätigkeit<br />
leicht auf 3.471. Unsere<br />
Ausbildungsquote bewegte sich mit<br />
9,3 Prozent erneut deutlich über dem<br />
Branchendurchschnitt.<br />
W+M: Ein Schlüssel zum Erfolg der Unternehmensgruppe<br />
ist das Unternehmensleitbild<br />
„ökologisch – partnerschaftlich<br />
– innovativ“.<br />
Was genau verbirgt<br />
sich dahinter?<br />
Tim Hartmann,<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
des Energiedienstleisters<br />
enviaM.<br />
Foto: W+M<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
SACHSEN | 23<br />
Foto: W+M<br />
Tim Hartmann: Es sind die Leitwerte,<br />
an denen wir unser gesamtes unternehmerisches<br />
Handeln ausrichten: „Ökologisch“<br />
definiert unseren Beitrag zum<br />
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Allein<br />
in 2015 haben wir rund 50 Millionen<br />
Euro in eigene Projekte im Bereich der<br />
regenerativen Energien investiert. „Partnerschaftlich“<br />
beschreibt die Kultur des<br />
Umgangs mit unseren Mitarbeitern, Kunden,<br />
Anteilseignern und anderen Akteuren,<br />
denn die Energiewende kann keiner<br />
allein stemmen. Und „innovativ“ untermauert<br />
unsere Bereitschaft, uns den<br />
technologischen Herausforderungen der<br />
Energiewirtschaft der Zukunft zu stellen.<br />
W+M: Stapeln Sie hier nicht etwas tief –<br />
denn beispielsweise beim Thema Digitalisierung<br />
gehören Sie ja zu den Vorreitern<br />
Ihrer Branche?<br />
Tim Hartmann: Für uns ist das als Marktführer<br />
in Ostdeutschland eine Selbstverständlichkeit.<br />
Denn eines ist sicher: Die<br />
Energiewende wird ohne technische Innovationen<br />
nicht funktionieren. Und woher,<br />
wenn nicht aus der Branche, die am<br />
meisten von der Energiewende betroffen<br />
ist und sie umsetzen muss, sollen<br />
die Innovationen denn sonst kommen?<br />
Die Digitalisierung wird eine Vielzahl von<br />
Veränderungen und Projekten nach sich<br />
ziehen.<br />
W+M: Können Sie uns schon Beispiele<br />
nennen?<br />
Tim Hartmann: In aller Munde ist ja die<br />
ab 2017 geplante flächendeckende Einführung<br />
der sogenannten intelligenten<br />
Stromzähler, mit dem der Kunde in die<br />
Lage versetzt werden soll, seinen Energieverbrauch<br />
nicht nur besser nachvollziehen<br />
zu können, sondern auch gezielt<br />
zu beeinflussen. Hier kooperieren wir eng<br />
mit Hochschulen, Instituten und Behörden,<br />
um die entsprechenden technischen<br />
Voraussetzungen zu schaffen. Selbstverständlich<br />
arbeiten wir dabei auch mit anderen<br />
Energieversorgern zusammen. So<br />
haben wir eine Anwendergemeinschaft<br />
mit Stadtwerken gegründet, um uns gegenseitig<br />
bei der Vorbereitung auf das<br />
neue Zählerzeitalter zu unterstützen.<br />
W+M-Herausgeber Frank Nehring und W+M-Autorin Katrin Kleeberg sprachen mit<br />
Tim Hartmann (v. l.).<br />
Auch im Gasbereich ist die Digitalisierung<br />
nicht mehr wegzudenken. Hier sind<br />
wir etwa dank moderner Datentechnik in<br />
der Lage, den Brennwert des eingespeisten<br />
Erd- und Biogases im Netzgebiet für<br />
unsere Kunden rechnerisch zu ermitteln.<br />
Bisher war dafür die Beimischung<br />
von Flüssiggas notwendig. Diese kann<br />
künftig eingespart werden. Wie im Netz<br />
schreitet die Digitalisierung auch im Vertrieb<br />
voran. Jeder zweite Neukunde im<br />
Privatkundenbereich kommt inzwischen<br />
online zu uns.<br />
W+M: Das heißt, die Digitalisierung verändert<br />
das Gesicht der enviaM?<br />
Tim Hartmann: Ich gebe Ihnen insofern<br />
recht, als dass die Digitalisierung in alle<br />
Unternehmensbereiche eingreift und Abläufe<br />
und Aufgaben im Unternehmen völlig<br />
neu definiert. So schaffen wir gerade<br />
an all unseren Standorten so genannte<br />
„Teamflächen“. Hier sind sechs und<br />
mehr Mitarbeiter tätig, die sich gegenseitig<br />
ergänzen und gemeinsam an Lösungen<br />
arbeiten. Das heißt: Im Unternehmen<br />
entwickelt sich ein völlig neues, ein<br />
projekt- und lösungsbezogenes Denken,<br />
vergleichbar vielleicht mit der interdisziplinären<br />
Forschung an Universitäten.<br />
Was sich aber nicht ändert ist: Wir verstehen<br />
uns als Energiedienstleister im besten<br />
Wortsinn – nämlich als Dienstleister<br />
für alle Fragen rund um das Thema Energie.<br />
W+M: Wohin wird diese Entwicklung die<br />
enviaM-Gruppe führen?<br />
Tim Hartmann: Das kann ich Ihnen so<br />
nicht beantworten. Mit der Digitalisierung<br />
betreten wir alle Neuland. Wir müssen<br />
unsere Mitarbeiter, Kunden und Anteilseigner<br />
auf dem Weg in die digitale<br />
Welt mitnehmen. Und die gesetzgeberischen<br />
Rahmenbedingungen müssen entsprechend<br />
geschaffen werden. Wenn es<br />
uns gelingt, dass unser Unternehmen bei<br />
dieser Reise in die Zukunft weiterhin wirtschaftlich<br />
erfolgreich bleibt, weil unsere<br />
Kunden zufrieden sind und unsere Mitarbeiter<br />
bei uns ein gutes Auskommen haben,<br />
dann haben wir viel erreicht.<br />
Interview: Katrin Kleeberg<br />
und Frank Nehring<br />
ENVIAM-ENERGIEKONVENT:<br />
„DIGITALISIERUNG DER<br />
ENERGIEWIRTSCHAFT“<br />
Am 24. Oktober <strong>2016</strong> lädt enviaM erneut<br />
zum „Energiekonvent“ in den<br />
Leipziger Kubus ein. Im Mittelpunkt<br />
des Abends steht die Digitalisierung<br />
der Energiewirtschaft aus Kundensicht.<br />
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft<br />
werden darüber diskutieren, welche<br />
Möglichkeiten und Mehrwerte die<br />
Digitalisierung den Energieverbrauchern<br />
bietet und was dies für die Beziehung<br />
zu ihrem Energieversorger bedeutet.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
24 | W+M LÄNDERREPORT<br />
In der Zulieferfirma FlammAerotec im Industriepark Schwerin werden<br />
Bauteile für die Airbus-Produktion in Norddeutschland gefertigt.<br />
Schwerin dockt<br />
an Hamburg an<br />
Die deutschen Küstenländer rücken enger zusammen. Im Zentrum<br />
der Annäherung steht Hamburg, das wirtschaftliche Schwergewicht<br />
des Nordens. Der gleichnamigen Metropolregion wollen sich jetzt<br />
auch Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin und<br />
der Altkreis Parchim anschließen. Von Thomas Schwandt<br />
Die Metropolregion Hamburg wird an<br />
ihrer Ostflanke gestärkt. Wenn alle<br />
parlamentarischen Hürden auf kommunaler<br />
und Länderebene bis Ende dieses<br />
Jahres genommen sind, werden ab<br />
1. Januar 2017 die mecklenburgisch-vorpommersche<br />
Landeshauptstadt Schwerin<br />
und das rudimentäre Landkreisgebiet<br />
Parchim offiziell zum Kooperationsverbund<br />
dazugehören. Im Mai dieses Jahres hat der<br />
Lenkungsausschuss der Metropolregion<br />
grünes Licht gegeben für die Ost-Erweiterung.<br />
Bereits zu Beginn dieses Jahrzehnts hatten<br />
sich das Land Mecklenburg-Vorpommern<br />
und die damaligen Landkreise Ludwigslust<br />
und Nordwestmecklenburg zu einem<br />
Beitritt entschlossen, der dann 2012<br />
auf Basis eines novellierten Staatsvertrages<br />
zwischen den Nordländern vollzogen<br />
wurde. Mit den jetzt avisierten Kandidaten<br />
gewinnt das östliche Bundesland in der<br />
Metropolregion Hamburg an Gewicht. Zugleich<br />
wird ein geografisches Vehikel beseitigt.<br />
Denn seit der Kreisgebietsreform<br />
2011 in Mecklenburg-Vorpommern bilden<br />
die Altlandkreise Ludwigslust und Parchim<br />
eine vereinigte Gebietskörperschaft unter<br />
adäquatem Doppelnamen. „Mit dem Hinzukommen<br />
von Parchim wird die Sache<br />
für uns nun gänzlich rund“, frohlockte Rolf<br />
Christiansen, Landrat von Ludwigslust-<br />
Parchim, nach dem Erweiterungsvotum<br />
im Lenkungsausschuss. Ludwigslust hat<br />
sich in den zurückliegenden Jahren in einigen<br />
großen Projekten der Metropolregion<br />
engagiert, zuletzt federführend beim Thema<br />
„Demografie und Daseinsvorsorge“.<br />
Die Landeshauptstadt Schwerin intensivierte<br />
vor zwei Jahren die bereits länger<br />
bestehende Zusammenarbeit mit der Metropolregion,<br />
vor allem bei der Vermarktung<br />
von Industrie- und Gewerbeflächen.<br />
Mit der angestrebten Mitgliedschaft könne<br />
die Landeshauptstadt „ihre bundesweite<br />
und internationale Wahrnehmung als starker<br />
und lebenswerter Standort ausbauen“,<br />
kommentierte Oberbürgermeisterin Angelika<br />
Gramkow den nächsten Schritt. Wirtschaftliche<br />
Aspekte führte auch Landrat<br />
Christiansen an: „Die Marke ,Hamburg‘<br />
ist für das regionsübergreifende und internatio<br />
nale Marketing ein Magnet, um Investoren<br />
und Fachkräfte anzuwerben.“<br />
Die Landespolitik im westlichen Teil Norddeutschlands<br />
hatte bereits Anfang der<br />
1990er-Jahre mit einem regionalen Entwicklungskonzept<br />
die länderübergreifende<br />
Kooperation vorangetrieben. Die Strahlkraft<br />
des hanseatischen Wirtschaftszentrums<br />
soll genutzt werden, um für die benachbarte<br />
Region zwischen Nord- und<br />
Ostsee neue Wachstumspotenziale zu<br />
generieren. Ohne einem Nordstaat das<br />
Wort zu reden, finden die Landesregierungen<br />
in Hamburg, Hannover, Schwerin<br />
und Kiel immer häufiger zu einer gemeinsamen<br />
Sprache. Wissend, in den harten<br />
Verteilungskämpfen mit dem Bund ist nur<br />
so ein spürbares Gegengewicht zu den Begehrlichkeiten<br />
der südlichen Bundesländer<br />
herzustellen. Exemplarisch dafür steht der<br />
Foto: Thomas Schwandt<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
MECKLENBURG-VORPOMMERN | 25<br />
METROPOLREGION HAMBURG<br />
Die Metropolregion Hamburg umfasst<br />
zurzeit 17 Landkreise und zwei kreisfreie<br />
Städte in den Bundesländern Niedersachsen,<br />
Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Schleswig-Holstein und der Freien und<br />
Hansestadt Hamburg. Fünf Millionen<br />
Menschen leben in dem Einzugsbereich.<br />
Wenn das aktuelle Beitrittsverfahren<br />
für die Landeshauptstadt Schwerin<br />
und den Altkreis Parchim bis Ende <strong>2016</strong><br />
erfolgreich abschlossen wird, steigt die<br />
Einwohnerzahl auf 5,2 Millionen und die<br />
Metropolregion Hamburg umfasst dann<br />
28.500 Quadratkilometer, was der Fläche<br />
von Belgien entspricht.<br />
Bundesverkehrswegeplan 2030. Für die<br />
maritime Wirtschaft im Norden besitzen<br />
zum Beispiel die Vertiefung der Elbe zum<br />
Hamburger Hafen hin sowie der Schiffszufahrten<br />
zu den Häfen Rostock und Wismar<br />
oberste Priorität. Derartige millionenschwere<br />
Infrastrukturprojekte sind in Berlin<br />
nur in konzertiertem Auftreten der Küstenländer<br />
zu erstreiten.<br />
der Metropolregion Hamburg auf dem gemeinsamen<br />
Webportal GEFIS präsentiert.<br />
Sucht ein Interessent nach einem Standort<br />
nahe Hamburg, werden ihm zum Beispiel<br />
auch Flächen in Westmecklenburg<br />
offeriert.<br />
Für Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister<br />
Harry Glawe sind die Ansiedlungserfolge<br />
ein Beleg für die gezielte<br />
Wirtschaftsförderung. „Unser Land bietet<br />
eine moderne Infrastruktur und attraktive<br />
Fördermöglichkeiten.“ Darauf hinzuweisen,<br />
dazu trage auch die Zusammenarbeit<br />
in der Metropolregion Hamburg bei. Die<br />
Plattform sei gut geeignet, in der Hansestadt<br />
Kontakte zu international agierenden<br />
Unternehmen zu knüpfen und über diese<br />
den Standort Mecklenburg-Vorpommern<br />
„im Ausland besser bekannt zu machen“.<br />
Glawe betont aber auch gern, dass das<br />
nordöstliche Bundesland trotzdem „verstärkt<br />
selbst Flagge zeigen muss“. Unter<br />
dem mächtigen Schirm von Hamburg könne<br />
„man auch schnell übersehen werden“.<br />
Er plädiert für eine Balance zwischen gemeinsamen<br />
und eigenen Interessen.<br />
Ordnungs- und wirtschaftspolitisch zielt die<br />
Metropolregion Hamburg darauf ab, die Rahmenbedingungen<br />
für Wachstum zu verbessern.<br />
So existieren in Norddeutschland bereits<br />
gemeinsame Statistik- und Eichämter<br />
sowie Cluster in den Bereichen maritime Industrie,<br />
Life Sciences und Ernährungswirtschaft.<br />
Doch auch die Herausforderungen<br />
eines globalisierten Marktes bedingen ein<br />
Zusammenrücken. In der norddeutschesten<br />
aller Branchen, der maritimen Industrie,<br />
vollzieht sich unter extremem internationalen<br />
Konkurrenzdruck seit Jahren ein<br />
tiefer Strukturwandel. Infolge der Insolvenz<br />
der P+S-Werften (Stralsund/Wolgast) übernahm<br />
beispielweise im Mai 2013 die Bremer<br />
Lürssen-Werft die Peene-Werft in Wolgast.<br />
Das vergrößerte Potenzial erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Das treibt auch den asiatischen<br />
Investor Genting Hong Kong (HK) um,<br />
der in diesem Jahr die drei Werften in Wismar,<br />
Warnemünde und Stralsund gekauft<br />
hat und daraus die Schiffbaugruppe „MV<br />
Werften“ schmiedet. Diese kooperiert eng<br />
mit der Lloyd-Werft Bremerhaven, die seit<br />
Jahresbeginn <strong>2016</strong> ebenfalls zu 100 Prozent<br />
von Genting HK erworben wurde. W+M<br />
Quelle Schaubild: Metropolregion Hamburg<br />
Innerhalb der Metropolregion wirkt das<br />
wirtschaftliche Schwergewicht Hamburg<br />
auch tief hinein nach Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Ausschlaggebend dafür ist die<br />
sehr gute verkehrstechnische Anbindung<br />
Westmecklenburgs an die Elbe-Metropole.<br />
Entlang der Ost-West-Autobahnen 24<br />
und 20 sind prosperierende Gewerbegebiete<br />
entstanden, in denen Unternehmen<br />
aus der Ernährungsindustrie, der Automotive-<br />
und Luftfahrtbranche sowie Medizintechnik<br />
investiert und Produktionsstätten<br />
errichtet haben. Darunter Konzerne wie<br />
Dr. Oetker und Nestlé sowie mittelständische<br />
Firmen wie FlammAerotec (Luftfahrtindustrie)<br />
und Euroimmun (Medizintechnik).<br />
Die günstige Lage an der Achse<br />
Berlin–Hamburg hat die Investitionsentscheidungen<br />
maßgeblich beeinflusst. In<br />
jüngster Zeit entdeckten vermehrt Hamburger<br />
Unternehmen die Nähe Westmecklenburgs<br />
und expandierten nach<br />
dort. Die FVH Folienveredlung Hamburg<br />
GmbH & Co. KG legte erst kürzlich den<br />
Grundstein für eine neue Betriebsstätte<br />
im Industriepark Schwerin. Zur Akquise<br />
von Investoren werden Gewerbeflächen in<br />
N O R D S E E<br />
Cuxhaven<br />
Landkreis<br />
Cuxhaven<br />
Heide<br />
Kreis<br />
Dithmarschen<br />
SCHLESWIG-<br />
HOLSTEIN<br />
Neumünster<br />
Itzehoe Bad Segeberg<br />
Kreis<br />
Kreis<br />
Steinburg<br />
Segeberg<br />
Lübeck<br />
Bad<br />
Kreis<br />
Oldesloe<br />
Pinneberg<br />
Kreis<br />
Pinneberg<br />
Stormarn Ratzeburg<br />
Stade<br />
Kreis<br />
Herzogtum<br />
Landkreis HAMBURG<br />
Lauenburg<br />
Stade<br />
Landkreis<br />
Rotenburg (Wümme)<br />
Rotenburg<br />
(Wümme)<br />
Bad<br />
Fallingbostel<br />
Winsen<br />
Landkreis<br />
Harburg<br />
Landkreis<br />
Heidekreis<br />
Lüneburg<br />
Landkreis<br />
Lüneburg<br />
Uelzen<br />
NIEDERSACHSEN<br />
Lüchow<br />
O S T S E E<br />
Wismar<br />
Ab 2017 sollen Schwerin und das Gebiet Parchim zur Metropolregion Hamburg gehören,<br />
in welcher dann 5,2 Millionen Menschen leben.<br />
Eutin<br />
Landkreis<br />
Uelzen<br />
Kreis<br />
Ostholstein<br />
Landkreis<br />
Nordwestmecklenburg<br />
Alt-Landkreis<br />
Ludwigslust<br />
Landkreis<br />
Lüchow-Dannenberg<br />
Schwerin<br />
MECKLENBURG-<br />
VORPOMMERN<br />
Parchim<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
26 | W+M LÄNDERREPORT<br />
Eine DHL-Frachtmaschine vom Typ A300-B4-200 überquert am<br />
Frachtzentrum des Flughafens Leipzig-Halle eine Rollbrücke.<br />
Flughäfen am Tropf<br />
der öffentlichen Hand<br />
Lange galten Regionalflughäfen in Deutschland als Symbol<br />
für Modernität, oft hielten Politiker auf Landes-, Kreis- und<br />
kommunaler Ebene sie für unverzichtbare Standortfaktoren in der<br />
Konkurrenz um Investoren und neue Arbeitsplätze. Erwartungen,<br />
die meist zum teuren Flop wurden – auch in Ostdeutschland, wo<br />
eine entsprechende Infrastruktur nach 1990 aufgebaut werden<br />
musste. Von Tomas Morgenstern<br />
Am Flughafen Rostock-Laage<br />
herrschte am 25. Juni Aufbruchstimmung<br />
beim Sommerfest mit<br />
5.000 Besuchern. Erst wenige Tage zuvor<br />
war der erste reguläre Jumbo-Jet mit<br />
mehr als 520 Urlaubern an Bord gelandet.<br />
Der Airport in Ostsee-Nähe, zugleich Fliegerhorst<br />
des Jagdgeschwaders 73 der<br />
Bundesluftwaffe, hat seit Januar 2015<br />
einen Deal mit der Reederei Costa Crociere<br />
(Italien). Die bringt in der Saison<br />
ihre Kreuzfahrtreisenden über Laage direkt<br />
zu den Luxuslinern im Rostocker Hafen.<br />
„Seamless Travel“ (Nahtlos Reisen)<br />
heißt das Konzept, für das inzwischen<br />
auch Pullmantur Cruises (Spanien) und<br />
MSC Cruises (Schweiz) gewonnen wurden.<br />
Nach schwachen Jahren sind 2015<br />
in Laage gut 190.000 Passagiere abgefertigt<br />
worden, darunter erstmals 18.000<br />
Kreuzfahrtreisende. Airport-Chef Rainer<br />
Schwartz hofft, <strong>2016</strong> 70.000 Hochsee-<br />
Touristen am Airport begrüßen zu können.<br />
In diesem Sommer geht es vielleicht auch<br />
am Ferienflughafen Heringsdorf auf Usedom<br />
wieder aufwärts. 2015 war die Passagierzahl<br />
um ein Drittel auf 27.500 gesunken.<br />
Erst im Juni sorgte die Nachricht,<br />
dass die EU-Kommission die zwischen<br />
2004 und 2014 gewährten Betriebszuschüsse<br />
und darüber hinaus auch die für<br />
die Jahre 2015 bis 2018 noch zu gewährenden<br />
Investitionsbeihilfen genehmigt<br />
hat, für Erleichterung. Allein im Jahr <strong>2016</strong><br />
überweist der Landkreis als Flughafengesellschafter<br />
bis zu 350.000 Euro.<br />
Die Situation der ostdeutschen Flughäfen<br />
ist höchst unterschiedlich – die größeren<br />
können mit wachsenden Passagierzahlen<br />
rechnen, die kleineren suchen nach<br />
der rettenden Nische. Gemeinsam ist den<br />
meisten, dass sie keine Gewinne erwirtschaften,<br />
sondern dauerhaft auf Zuschüsse<br />
von Bund, Ländern, Landkreisen und<br />
sogar Kommunen angewiesen sind.<br />
Einen der Gründe dafür sieht der Frankfurter<br />
Flughafenexperte Dieter Faulenbach<br />
da Costa in der zu großen Flughafendichte.<br />
Auch fehle es, wie er W+M sagte, an<br />
einer sinnvollen Arbeitsteilung unter den<br />
Flughäfen. Vom Bund erwartet er, dass<br />
sein längst überfälliges neues Flughafen-<br />
Foto: Deutsche Post AG<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
OSTDEUTSCHLAND | 27<br />
konzept den Ländern die Möglichkeit biete,<br />
den Wildwuchs auf diesem Gebiet zu<br />
beseitigen. Faulenbach da Costa schwebt<br />
vor, dass sich Bundesländer zusammentun<br />
– beispielsweise Berlin und Brandenburg<br />
mit Sachsen und Sachsen-Anhalt oder<br />
Mecklenburg-Vorpommern mit Niedersachsen<br />
und Hamburg – und sich auf der<br />
Basis von Staatsverträgen auf einige wenige<br />
wirtschaftlich leistungsstarke und zukunftsfähige<br />
Flughafenstandorte verständigen.<br />
So bestünde die Chance, den nach<br />
2030 erwarteten Anstieg des jährlichen<br />
Passagieraufkommens in Deutschland auf<br />
mehr als 300 Millionen zu bewältigen.<br />
Düsseldorf. Allein in Tegel wurden 2015<br />
rund 21,01 Millionen Passagiere abgefertigt.<br />
Der einstige DDR-Zentralflughafen<br />
Schönefeld legte um fast 17 Prozent auf<br />
8,29 Millionen zu.<br />
Auch der Flughafen der sächsischen Hauptstadt<br />
in Dresden-Klotzsche, seit 2008 Dresden<br />
International, wird von der Mitteldeutschen<br />
Flughafen AG betrieben. Die Passagierzahl<br />
lag 2015 bei 1,72 Millionen. Am<br />
Flughafen produzieren die traditionsreichen<br />
Elbe Flugzeugwerke Bauteile für Airbus Industries.<br />
Seit Mai 2013 ist Dresden Reparaturstützpunkt<br />
für den Airbus A380.<br />
In die Entwicklung des Flughafens Magdeburg-Cochstedt<br />
haben das Land Sachsen-Anhalt<br />
und der Salzlandkreis über die<br />
Jahre 30 Millionen Euro Steuergeld investiert.<br />
Er liegt an einem Gewerbepark und<br />
darf rund um die Uhr betrieben werden.<br />
Weil er dennoch nicht aus der Verlustzone<br />
kam, wurde der Platz 2010 für nur eine<br />
Million Euro an einen dänischen Investor<br />
verkauft. Im Januar musste er Insolvenz<br />
anmelden und fährt pro Monat 250.000<br />
Euro Verluste ein.<br />
Foto: Flughafen Dresden GmbH/Michael Weimer<br />
Insgesamt 40 Standorte in<br />
Deutschland haben die zuständigen<br />
Landesluftfahrtbehörden<br />
als Verkehrsflughäfen klassifiziert,<br />
elf davon in den neuen<br />
Ländern. Neben den Berliner<br />
Flughäfen Tegel und Schönefeld<br />
zählen dazu zum Beispiel<br />
Leipzig-Halle, Dresden International,<br />
Erfurt-Weimar, Magdeburg-Cochstedt,<br />
Rostock-Laage<br />
und Schwerin-Parchim. Ergänzt<br />
werden sie durch ein Netz kleinerer<br />
Verkehrs- und Sonderlandeplätze.<br />
Die beiden Berliner Flughäfen<br />
sehen sich unabhängig von<br />
der Fertigstellung des seit November<br />
2011 überfälligen neuen Hauptstadtflughafens<br />
BER im Luftverkehr gemeinsam<br />
in einer anderen Liga – etwa<br />
mit Frankfurt am Main, München und<br />
PASSAGIERAUFKOMMEN AN<br />
DEUTSCHEN FLUGHÄFEN 2015<br />
Die Zahl der Passagiere auf deutschen<br />
Flughäfen ist 2015 um 7,5 Millionen<br />
gestiegen. Insgesamt starteten oder<br />
landeten im vergangenen Jahr 193,9<br />
Millionen Fluggäste auf deutschen Flughäfen.<br />
Im Auslandsverkehr erhöhten<br />
sich die Passagierzahlen gegenüber<br />
2014 um 7,1 Millionen (plus 4,4 Prozent)<br />
auf 170,8 Millionen. Im Inlandsverkehr<br />
stieg die Anzahl der Fluggäste hingegen<br />
lediglich um 400.000 (plus 1,5 Prozent)<br />
auf 23,1 Millionen.<br />
Blick auf die Abflugebene des Terminals des Flughafens Dresden<br />
International.<br />
Dank der Ansiedlung des Frachtzentrums<br />
der Posttochter DHL im Jahr 2008<br />
am Standort Schkeuditz ist der Flughafen<br />
Leipzig-Halle zum zweitgrößten Luftdrehkreuz<br />
Deutschlands aufgestiegen.<br />
Der Freistaat Sachsen ließ sich das 71<br />
Millionen Euro kosten, weitere 350 Millionen<br />
Euro machte er für die neue Startund<br />
Landebahn Süd locker. Der Flughafen<br />
gehört der Mitteldeutschen Flughafen<br />
AG und damit den Ländern Sachsen<br />
und Sachsen-Anhalt sowie einigen Städten<br />
und Kreisen. 65 Frachtmaschinen werden<br />
dort jede Nacht abgefertigt, im vergangenen<br />
Jahr wurden erstmals mehr als<br />
988.000 Tonnen umgeschlagen. Die Fluggastzahlen<br />
indes stagnieren, 2015 lagen<br />
sie bei 2,32 Millionen. Mit einem Verlust<br />
von 49,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr<br />
2014 fuhr Halle-Leipzig das negativste Ergebnis<br />
aller deutschen Flughäfen ein.<br />
Der Freistaat Thüringen als<br />
Hauptgesellschafter betreibt<br />
im Erfurter Ortsteil Bindersleben<br />
den Flughafen Erfurt-Weimar.<br />
Seit 1980 war hier fast nur<br />
noch die Interflug in die Feriengebiete<br />
im sozialistischen Ausland<br />
abgehoben. Nach dem Rekordjahr<br />
2004, als in Erfurt mehr<br />
als eine halbe Million Fluggäste<br />
abgefertigt wurden, erreichte<br />
das Passagieraufkommen 2015<br />
nur noch 230.436.<br />
In einer im Juli 2015 von der<br />
Deutschen Bank Research vorgelegten<br />
Studie heißt es dazu:<br />
„Mit wenigen Ausnahmen waren<br />
die Jahresergebnisse der<br />
Flughäfen in den letzten rund zehn Jahren<br />
negativ. So konnte 2013 keiner der Regionalflughäfen<br />
ein positives Ergebnis erzielen.<br />
In der Regel lag der Fehlbetrag pro<br />
Flughafen im ein- bis zweistelligen Millionenbereich.“<br />
Mit Regionalflughäfen lasse sich kein lohnendes<br />
Geschäft machen, räumte ausgerechnet<br />
Rostocks Oberbürgermeister Roland<br />
Methling (parteilos) im Juni ein. Doch<br />
komme das millionenschwere Engagement<br />
Rostocks als Flughafengesellschafterin<br />
seit Anfang der 1990er Jahre nicht<br />
nur den hier lebenden Menschen zugute.<br />
„Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag<br />
für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts<br />
und schaffen die Basis, neue<br />
Zielgruppen im Tourismusbereich anzusprechen.“<br />
W+M<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
28 | W+M LÄNDERREPORT<br />
Im Chemiepark Bitterfeld sind in den letzten Jahren 11.000<br />
Arbeitsplätze entstanden. Bitterfeld selbst hat 15.500 Einwohner.<br />
Warum Bitterfeld<br />
zur AfD-Hochburg wurde<br />
Für Bitterfeld und Wolfen stehen heute weder grassierende Deindustrialisierung<br />
und extreme Arbeitslosigkeit noch städtebaulicher Verfall<br />
oder Umweltnotstand. Die Menschen sind aufgrund der hohen<br />
Industriedichte zu DDR-Zeiten überdurchschnittlich gebildet, und<br />
inzwischen wandelte sich ein gewaltiger Tagebau zu einem idyllischen<br />
See direkt am Innenstadtrand. Dennoch gilt die Region seit der<br />
jüngsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Hochburg der rechtspopulistischen<br />
Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD). Eine<br />
Ursachensuche. Von Harald Lachmann<br />
Schulschließungen stoppen, TTIP verhindern,<br />
Kita-Gebühren abschaffen,<br />
rot-grüne Bildungsexperimente aufhalten<br />
oder auch: Frühsexualisierung in Kita<br />
und Schule beenden. Auf der Webseite von<br />
Daniel Roi fehlt es nicht an politischen Themen.<br />
Doch Begriffe wie Flüchtlinge oder<br />
Asylmissbrauch finden sich nicht. Dabei<br />
steht auch der 29-jährige Bachelor of Engineering,<br />
der einige Zeit im Dessauer Landwirtschaftsamt<br />
arbeitete, für das ausländerfeindliche<br />
Profil der AfD im Südosten<br />
Sachsen-Anhalts. Denn für sie hatte er zur<br />
Landtagswahl im März kandidiert und mit<br />
31 Prozent der Erststimmen das Direktmandat<br />
im Wahlkreis Wolfen geholt.<br />
Ähnlich der 50-jährige Volker Olenicak<br />
aus Friedersdorf, ein Unternehmer, der in<br />
und um Bitterfeld mehrere Telefonshops<br />
betreibt. Er holte für die AfD mit 33,4 Prozent<br />
das Direktmandat in Bitterfeld und<br />
gehört inzwischen im Landtag sogar jener<br />
parlamentarischen Kommission an,<br />
die die Geheimdienste kontrollieren soll.<br />
Beide, Roi wie Olenicak, stehen damit nun<br />
bundesweit am Pranger für ein Phänomen,<br />
das in den großen Medien der Republik –<br />
von SPIEGEL ONLINE bis Tagesschau – als<br />
die „Schande von Bitterfeld“ gebrandmarkt<br />
wurde. Denn nirgendwo machten mehr<br />
Menschen bei der AfD ihr Kreuzchen. Dabei<br />
gewann die rechte Protestpartei im Süden<br />
Sachsen-Anhalts sogar 15 Direktmandate.<br />
Auch in Zeitz, Merseburg, Querfurt<br />
oder Staßfurt schnitt sie vergleichbar ab.<br />
Woran liegt das? Schnelle, seriöse Antworten<br />
fallen schwer. Es vor allem auf<br />
Foto: Harald Lachmann<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
SACHSEN-ANHALT | 29<br />
Fotos: AfD (oben), Harald Lachmann (unten)<br />
Der AfD-Landtagsabgeordnete<br />
Daniel Roi ist Chef der<br />
Stadtrats- und Kreisratsfraktion<br />
seiner Partei.<br />
die ausländerfeindliche<br />
Rhetorik zurückzuführen,<br />
wäre zu kurz<br />
gegriffen – selbst wenn<br />
die AfD vor der Wahl mit<br />
markigen Sprüchen wie diesem<br />
warb: „Grenzen sichern. Asylchaos stoppen.“<br />
Und 400 Migranten auf 15.500 Bitterfelder,<br />
zudem dezentral untergebracht,<br />
sind kein Grund zur Panik. Sicher finden<br />
sich auf den Facebook-Seiten etwa von<br />
Olenicak bösartige Angriffe auf die Kanzlerin<br />
oder Links auf rechte Portale wie das<br />
der „Reichsbürger“. Doch dafür hat man<br />
ihn und die ganze AfD kaum gewählt. Immerhin<br />
holte sie mit 24,3 Prozent fast so<br />
viele Stimmen wie LINKE (16,3) und die<br />
bisherige Magdeburger Regierungspartei<br />
SPD (10,6) zusammen.<br />
Es ist also mehr faul in der Region, zumal<br />
auch eine geringe Wahlbeteiligung diesmal<br />
nicht als Begründung dienen kann.<br />
Denn anders als bei früheren Wahlen,<br />
wo Parteien am rechten oder linken Rand<br />
eben davon profitierten, gingen diesmal<br />
wesentlich mehr Menschen zur Wahl –<br />
und zwar eben weil sie die AfD ankreuzen<br />
wollten. Sie hatte also mit ihrem Auftauchen<br />
auf der politischen Bühne sogar<br />
zusätzliche Wähler mobilisiert – offenbar<br />
Menschen, die den etablierten Kräften<br />
schon länger nicht mehr trauten.<br />
Dennoch bleibt es rätselhaft, warum ausgerechnet<br />
der Raum Bitterfeld-Wolfen<br />
derartigen AfD-Zulauf hatte. Denn jene<br />
Region bildet längst wieder eines der industriellen<br />
Schwergewichte in Sachsen-<br />
Anhalt, so mit dem prosperierenden Chemiepark,<br />
der Metallverarbeitung oder<br />
der sich wieder erholenden Solarzellenherstellung.<br />
Allein im Chemiecluster arbeiten<br />
11.000 Menschen. So liegt auch<br />
die Arbeitslosigkeit in Bitterfeld mit etwa<br />
neun Prozent teils deutlich unter der in der<br />
Altmark, im Kreis Mansfeld-Südharz, im<br />
Salzlandkreis oder den Städten Halle und<br />
Dessau-Roßlau. Auch die Lebensqualität<br />
in Bitterfeld<br />
– einst maßlos übertrieben<br />
als „dreckigste<br />
Stadt Europas“ gegeißelt<br />
– kann sich<br />
sehen lassen. Der<br />
Ortskern ist schmuck<br />
restauriert und arrondiert<br />
nun sogar einen<br />
riesigen See mit Badestränden,<br />
Marinas und Ausflugsoasen.<br />
Und die Hochschule<br />
im zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehörenden<br />
Köthen – nur 35 Kilometer westwärts<br />
gelegen – bildet ein weithin ausstrahlendes<br />
geistiges Zentrum. So holte<br />
hier auch die LINKE das Direktmandat.<br />
Mithin ist es eher eine Verquickung mehrerer<br />
Umstände, dass Bitterfeld-Wolfen<br />
heute als AfD-Hochburg gilt, selbst wenn<br />
mehr als doppelt sie viele Menschen sie<br />
eben nicht wählten. Fraglos haben CDU<br />
und SPD, die seit zehn Jahren als Magdeburger<br />
Regierungsdoppel agieren und dabei<br />
etliche Wählerwünsche offen ließen,<br />
eine Aktie daran. Selbst die LINKE gehört<br />
in Sachsen-Anhalt längst zum Establishment.<br />
So hatte es Olenicak denn auch<br />
leicht, als er genau damit Wahlkampf betrieb<br />
und zugleich eine „Diktatur à la Merkel“<br />
geißelte. „Der Unmut der Bürger ist<br />
allgegenwärtig“, konstatierte er. Die Menschen<br />
seien unzufrieden „mit Berlin und mit<br />
Magdeburg“, spürten Stillstand, fühlten sich<br />
vor allem nicht mehr erhört.<br />
Und im Raum Bitterfeld-Wolfen<br />
mit seiner<br />
weit überdurchschnittlich<br />
gebildeten<br />
Einwohnerschaft wird<br />
darüber eben nicht nur<br />
auf Stammtischniveau<br />
gemotzt.<br />
Als wenn sie all den<br />
Vorurteilen gegenüber<br />
den etablierten Parteien<br />
persönlich die<br />
Krone aufsetzen wollten,<br />
versagten Landrat<br />
Uwe Scholze (CDU)<br />
und Oberbürgermeisterin<br />
Dagmar Zoschke<br />
(LINKE) dann auch noch in einer entscheidenden<br />
Situation: Beim Empfang einer<br />
Schar – möglicherweise nicht ganz unvoreingenommener<br />
– Medienvertreter, die<br />
nach der Wahl nach Bitterfeld gekommen<br />
war, um nach Ursachen für das starke AfD-<br />
Ergebnis zu suchen. Statt sich zunächst<br />
einmal hinter die Stadt und das demokratische<br />
Votum zu stellen, stimmten sie mit<br />
in die Wählerschelte ein.<br />
Negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort<br />
Bitterfeld-Wolfen gibt es<br />
bislang offenbar noch nicht. Kein potenzieller<br />
Investor ist abgesprungen und auch aus<br />
den Wirtschaftskammern gibt es diesbezüglich<br />
keine nervösen Signale.<br />
Eher entsteht in den etablierten Kreisen<br />
der Region derzeit eine Abwartehaltung:<br />
Man hofft, dass sich die AfD wie einst die<br />
rechtsextreme DVU (sie war 1998 auch in<br />
Sachsen-Anhalt mit 12,9 Prozent auf ihr<br />
bis dato bestes Resultat gekommen) von<br />
selbst zerlegt. Dafür spricht einiges. Weder<br />
Roi noch Olenicak haben vier Monate<br />
nach ihrer Wahl eines der avisierten Bürgerbüros<br />
in Bitterfeld beziehungsweise<br />
Wolfen eröffnet. Dabei traten gerade sie<br />
mit dem Versprechen von mehr Transparenz<br />
und Bürgernähe an. „Bisher waren<br />
es eben nur Parolen“, sinniert der Ingenieur<br />
Dr. Joachim Gülland, der heute für die<br />
LINKE als Ortsbürgermeister in Bitterfeld<br />
agiert: „Nun müssen sie selbst mitarbeiten<br />
und sich beweisen.“ W+M<br />
An der Goitzsche, einem früheren Braunkohletagebau direkt<br />
im Stadtgebiet von Bitterfeld, entstand eines der attraktivsten<br />
Wassersportreviere Mitteldeutschlands.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
30 | W+M TITEL<br />
Aufbauhelfer<br />
für Ostdeutschland<br />
Großbritannien hat den Brexit<br />
gewählt: Das Leave-Votum der<br />
Briten beflügelt auch hierzulande<br />
EU-Skeptiker. Doch gerade<br />
in Ostdeutschland haben<br />
EU-Gelder wesentlich zum<br />
notwendigen Strukturwandel<br />
nach 1990 beigetragen. Und<br />
auch aktuell profitiert die<br />
ostdeutsche Wirtschaft von den<br />
Brüsseler Fördertöpfen.<br />
Von Matthias Salm<br />
Wirtschaftsleistung in der EU, und Regionen<br />
wie Ostdeutschland gelten dann<br />
nicht mehr als strukturschwach, mutmaßte<br />
etwa Thüringens Wirtschaftsminister<br />
Wolfgang Tiefensee (SPD) über<br />
mögliche Folgen für die EU-Förderung.<br />
Wohl wissend, dass man den Beitrag der<br />
EU zum Aufholprozess der ostdeutschen<br />
Wirtschaft seit 1991 nicht geringschätzen<br />
darf. Er tritt allerdings oft angesichts<br />
der auch jetzt wieder anhebenden Klage<br />
über die Regulierungswut der Brüsseler<br />
Bürokraten in den Hintergrund.<br />
Erneuerbare Energien: Die EU fördert in der aktuellen<br />
Förderperiode auch Maßnahmen zum Klimaschutz.<br />
Welche Folgen der britische Austritt<br />
für die heimische Wirtschaft<br />
zeitigen könnte, darüber<br />
herrscht bei Experten derzeit weitgehend<br />
Rätselraten. Für Thüringens Exporteure<br />
etwa bildet das Vereinigte Königreich den<br />
viertwichtigsten Auslandsmarkt mit einem<br />
Handelsvolumen von mehr als 1,6<br />
Milliarden Euro. „Gegenwärtig unterhalten<br />
290 Thüringer Betriebe stabile Geschäftsbeziehungen<br />
mit Großbritannien“,<br />
weiß Gerald Grusser, Hauptgeschäftsführer<br />
der IHK Erfurt. Im benachbarten<br />
Sachsen rangiert Großbritannien nach<br />
China und den USA auf dem dritten Platz<br />
der Ausfuhrziele. Allein zwischen 2011<br />
und 2015 stieg der Wert der ausgeführten<br />
Waren aus dem Freistaat auf die Insel<br />
um 63 Prozent.<br />
Aber nicht nur die ostdeutschen Exporteure<br />
bangen angesichts der herrschenden<br />
Ungewissheit. Ohne die britische<br />
Wirtschaftskraft sinkt das Niveau der<br />
Im Gegensatz zum lauten Knall, mit dem<br />
die Briten das gemeinsame europäische<br />
Haus verlassen wollen, schlüpfte Ostdeutschland<br />
1990 im Zuge der Deutschen<br />
Einheit beinahe geräuschlos unter<br />
das Dach der EU. Seither flossen rund<br />
43 Milliarden Euro an Strukturfondsmittel<br />
aus dem Europäischen Fonds für Regionale<br />
Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen<br />
Sozialfonds (ESF) in die neuen<br />
Bundesländer. Dazu addieren sich noch<br />
die Mittel aus dem Europäischen Fonds<br />
für die ländliche Entwicklung (ELER) und<br />
dessen Vorgängerprogramme.<br />
Zehn Milliarden Euro für<br />
den Nordosten<br />
Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern:<br />
Deutschlands Nordosten erhielt rund 4,5<br />
Milliarden Euro aus dem EFRE, rund zwei<br />
Milliarden Euro aus dem ESF sowie aus<br />
dem ELER und seinen Vorläufern weitere<br />
rund 3,4 Milliarden Euro. Aufgestockt<br />
wurden die insgesamt zehn Milliarden<br />
Foto: EC/Alain Schroeder<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
BRÜSSELER SEGEN | 31<br />
Von den Förderprogrammen der EU-Kommission hat Ostdeutschland seit 1990 erheblich profitiert.<br />
Euro von der EU durch die Kofinanzierungsmittel<br />
von Bund, Land und Kommunen<br />
in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Euro.<br />
Gewerbegebiete zu erschließen sowie<br />
die wirtschaftsnahe und touristische Infrastruktur<br />
auszubauen.<br />
Fotos: W+M (oben), ILB/Sabine Engels (unten)<br />
Finanzmittel, die dem wirtschaftlichen<br />
Aufholprozess zwischen Ostsee und Müritz<br />
zugutekamen: Der Indikator Bruttoinlandsprodukt<br />
pro Kopf des Landes, bezogen<br />
auf den Durchschnitt der EU, lag 2001<br />
noch bei 72,3 Prozent (bezogen auf die EU-<br />
25), 2014 bereits bei 84 Prozent (bezogen<br />
auf die EU-28). „Hierzu haben die EU-Mittel<br />
maßgeblich beigetragen“, sagt Staatssekretär<br />
Dr. Christian Frenzel, Chef der<br />
Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Und der Küstenstaat plant auch aktuell<br />
mit der europäischen Strukturförderung.<br />
Aus dem EFRE erhält das Land in der Förderperiode<br />
von 2014 bis 2020 rund 968<br />
Millionen Euro. Das Geld setzt Schwerin<br />
zum Beispiel ein, um Forschung, Entwicklung<br />
und Innovation voranzutreiben,<br />
Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender<br />
der Brandenburger Förderbank ILB.<br />
„Ein großer Teil der von<br />
der ILB bisher insgesamt<br />
zugesagten Fördermittel<br />
in Höhe von knapp<br />
36 Milliarden Euro<br />
stammt aus EU-Töpfen.“<br />
Neue Förderprogramme<br />
in Brandenburg<br />
Im benachbarten Brandenburg investierten<br />
in der zurückliegenden Förderperiode<br />
rund 2.000 Unternehmen mit EFRE-<br />
Mitteln unter anderem in Forschungsund<br />
Entwicklungsvorhaben. Um die Bedeutung<br />
der EU-Mittel gerade für den<br />
Mittelstand des Landes weiß daher Tillmann<br />
Stenger, Vorstandsvorsitzender der<br />
Investitionsbank des Landes Brandenburg<br />
(ILB). Die ILB ist seit fast 25 Jahren einer<br />
der wichtigsten Ansprechpartner für europäische<br />
Förderung in Brandenburg.<br />
Aktuell verwaltet die ILB neben den Programmen<br />
aus dem EFRE erstmals auch<br />
alle ESF- sowie ausgewählte ELER-Förderprogramme.<br />
„Allein im Bereich der in<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
32 | W+M TITEL<br />
einem Flächenland so wichtigen Regionalentwicklung<br />
und Sozialförderung ermöglicht<br />
uns das bis Ende 2020 die Vergabe<br />
von über 1,2 Milliarden Euro europäischer<br />
Fördermittel für die weitere Entwicklung<br />
in Brandenburg”, erklärt Stenger.<br />
So startete die ILB im Juli das Förderprogramm<br />
„Brandenburg Kredit Innovativ“ mit<br />
Haftungsfreistellung.<br />
Damit partizipieren<br />
innovative Unternehmer<br />
in der Mark an einer<br />
EU-weiten Investitionsoffensive.<br />
ILB-<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Stenger: „Wir<br />
freuen uns, dass es<br />
der ILB gelungen<br />
ist, aus dem Europäischen<br />
Fonds für strategische<br />
Investitionen, dem so genannten<br />
Juncker-Plan, erstmals zusätzliche Mittel<br />
für das Land Brandenburg zu gewinnen.“<br />
Beim neuen „Brandenburg Kredit Innovativ“<br />
stellt die ILB die Hausbank zu 70 Prozent<br />
des Kreditanteils von ihrem Risiko frei.<br />
Die Haftungsfreistellung kann durch die Kooperation<br />
zwischen der ILB und der Bürgschaftsbank<br />
Brandenburg für kleine und<br />
„Die Forschung in<br />
Sachsen profitiert<br />
erheblich davon, dass<br />
große Summen aus<br />
den EU-Strukturfonds<br />
fließen.“<br />
Dr. Eva-Maria Stange, Sächsische<br />
Staatsministerin für Wissenschaft<br />
und Kunst.<br />
mittelständische Unternehmen (KMU) sogar<br />
auf bis zu 80 Prozent erhöht werden.<br />
Auf großes Interesse stoßen auch die in<br />
diesem Frühjahr neu aufgelegten Fonds<br />
für innovative Start-ups: In den ersten vier<br />
Monaten wurden bereits vier Millionen<br />
Euro Risikokapital oder Nachrangdarlehen<br />
ausgereicht. Für den „Frühphasen- und<br />
Wachstumsfonds“<br />
sowie den „Brandenburg-Kredit<br />
Mezzanine“<br />
stehen bis zum<br />
Jahr 2023 102,5 Millionen<br />
Euro zur Verfügung.<br />
Die Fondsmittel<br />
werden zu<br />
80 Prozent aus dem<br />
EFRE und zu 20 Prozent<br />
von der ILB bereitgestellt.<br />
Ostdeutsche Forschung<br />
baut auf die EU<br />
Auch die Forschungslandschaft in Ostdeutschland<br />
ist eng mit der EU verwoben.<br />
So zum Beispiel der Wissenschaftsstandort<br />
Sachsen. In der Förderperiode<br />
2007 bis 2013 standen dem Dresdener<br />
Wissenschaftsministerium für die anwendungsorientierte<br />
Forschungsförderung<br />
und die Forschungsinfrastruktur 467<br />
Millionen Euro zur Verfügung, nun sind<br />
es bis 2020 immerhin noch 175 Millionen.<br />
Hochschulbauten wurden mit EU-<br />
Mitteln in Höhe von 315 Millionen Euro<br />
unterstützt, in der aktuellen Förderperiode<br />
bis 2020 sind es 162,5 Millionen<br />
Euro. Und für die Förderung von Nachwuchswissenschaftlern<br />
konnte Sachsen<br />
von 2007 bis 2013 aus dem Europäischen<br />
Sozialfonds 178 Millionen Euro einsetzen,<br />
von 2014 bis 2020 118 Millionen Euro.<br />
Dies ermöglicht Forschungsergebnisse,<br />
die auch dem sächsischen Mittelstand<br />
zugutekommen. So haben sich jüngst die<br />
renommierten Universitäten in Freiberg,<br />
Dresden und Chemnitz zur Forschungsallianz<br />
Leichtbau zusammengeschlossen.<br />
Sie soll das Profil Sachsens im Bereich<br />
Fahrzeug- und Maschinenbau schärfen.<br />
„Das sächsische Know-how“, ist sich Peter<br />
Nothnagel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung<br />
Sachsen GmbH, sicher,<br />
„verschafft den ansässigen Unternehmen<br />
– von der Elektromobilität über die Luftfahrtzulieferindustrie<br />
bis hin zum Fahrzeugbau<br />
– entscheidende Wettbewerbsvorteile.“<br />
Im Rahmen des EFRE sichert<br />
Sachsen dem Forschungsverbund bis<br />
2020 über zwei Millionen Euro zu. 400.000<br />
Euro davon stammen vom Freistaat.<br />
EU-Fördermittel für sächsische Leichtbauallianz: Prof. Hubert Jäger (TU Dresden), Dr. Jürgen<br />
Tröltzsch (TU Chemnitz), Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange und Prof. Rudolf Kawalla (TU<br />
Bergakademie Freiberg) (v. l.).<br />
„Sachsen hat in den letzten Jahren in vielen<br />
Wissenschaftsbereichen internationale<br />
Sichtbarkeit erreicht“, verkündet denn<br />
auch die Wissenschaftsministerin des<br />
Landes Dr. Eva-Maria Stange nicht ohne<br />
Stolz. Wie stark Sachsens Forscher in der<br />
EU heute vernetzt sind, belegt das Beispiel<br />
des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen<br />
und Umformtechnik IWU<br />
in Chemnitz, übrigens einst das erste Forschungsinstitut<br />
der Fraunhofer-Gesellschaft<br />
in Ostdeutschland. „Projekte mit<br />
internationalen und europäischen Partnern<br />
sind wichtig für die weltweite Vernetzung<br />
und Kennzeichen wissenschaftlich<br />
exzellenter Forschung“, erklärt Katja<br />
Haferburg, EU-Netzwerk-Managerin<br />
beim Fraunhofer IWU.<br />
Auf EU-Ebene kooperiert das Fraunhofer<br />
IWU mit Partnern aus Wissenschaft, For-<br />
Fotos: Götz Schleser (oben), Detlev Müller/TU Bergakademie Freiberg (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
BRÜSSELER SEGEN | 33<br />
Fotos: Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern (links), EC/Thomas Haley (rechts)<br />
schung und Industrie und beteiligt sich<br />
aktiv an europäischen Technologieplattformen,<br />
ebenso an der Beratung der EU-<br />
Kommission. So prägte das Fraunhofer<br />
Staatssekretär Dr. Christian Frenzel,<br />
Chef der Staatskanzlei<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
„Jeder Euro aus dem<br />
Strukturfonds erbringt<br />
langfristig eine Rendite<br />
von etwa 1,85 Euro.“<br />
IWU etwa entscheidend die Forschung<br />
beim EU-Projekt iMAIN. Seit September<br />
2012 arbeiteten Umformtechniker,<br />
Industrieanwender, Informatiker und Ingenieure<br />
aus vier europäischen Ländern<br />
unter Koordination des Fraunhofer IWU<br />
zusammen, um die Instandhaltung von<br />
Industriemaschinen zu verbessern. Das<br />
im Projekt iMAIN entwickelte intelligente<br />
Instandhaltungssystem überwacht und<br />
analysiert komplexe Maschinensysteme<br />
wie beispielsweise Mehrstufenpressen<br />
in der Automobilfertigung mithilfe von realen<br />
und virtuellen Sensoren fortlaufend<br />
in ihrer Funktion sowie in ihrem Energieverbrauch.<br />
Dadurch können Fehler früher<br />
erkannt und bereinigt werden. Die Chemnitzer<br />
avancierten nicht zuletzt durch das<br />
EU-Projekt zum Kompetenzführer in diesem<br />
Zukunftsfeld der Produktion. W+M<br />
Seit 1990 flossen rund 43 Milliarden Euro von der EU in die neuen Länder.<br />
Wir sind die Gestalter<br />
der Energiezukunft.<br />
Dezentral, erneuerbar, vernetzt, effizient: So wünschen sich unsere<br />
Kunden aus Industrie, Gewerbe und Kommunen ihre Energie. Wir<br />
setzen diese Wünsche in die Tat um und gestalten bereits heute<br />
die Zukunft der Energie – dabei greifen Infrastruktur, Technik und<br />
Dienstleistungen ineinander. Energieeffizienz ist für uns der Schlüssel,<br />
um wirtschaftlich zu handeln und Ressourcen zu schonen.<br />
Aktiv in allen Bereichen, die für eine nachhaltige Energiezukunft<br />
relevant sind: Das ist ENGIE.<br />
Energien optimal einsetzen.<br />
engie-deutschland.de
34 | W+M TITEL<br />
„Mir ist es wichtig, dass Berlin<br />
in Brüssel nicht zu kurz kommt“<br />
W+M-Interview mit dem Berliner Europaabgeordneten Joachim Zeller<br />
Seit 2009 vertritt der Berliner CDU-Politiker<br />
Joachim Zeller die Bundeshauptstadt<br />
im Europäischen Parlament. Der 64 Jahre<br />
alte, studierte Slawist gehört der Fraktion<br />
der Europäischen Volkspartei (EVP) an und<br />
ist Mitglied in vier Parlamentsausschüssen,<br />
unter anderem in dem für die Förderpolitik<br />
der EU wichtigen Regionalausschuss.<br />
Darüber hinaus ist er Mitglied in<br />
der EU-Russland-Delegation, die sich um<br />
die europäisch-russischen Beziehungen<br />
kümmert. Zeller gehört zu einem kleinen<br />
Kreis von Parlamentariern, die Erfahrungen<br />
sowohl auf der internationalen Bühne<br />
als auch im kommunalpolitischen Bereich<br />
vorweisen können. Zwischen 1996<br />
und 2006 war Zeller Bezirksbürgermeister<br />
von Berlin-Mitte.<br />
W+M: Herr Zeller, wie stark profitiert Berlin<br />
von Brüssel?<br />
Am Rande einer Ausschusssitzung im EU-<br />
Parlament: Joachim Zeller und W+M-<br />
Chefredakteur Karsten Hintzmann (r.).<br />
Joachim Zeller: Nach der deutschen Wiedervereinigung<br />
hatte Berlin erhebliche Lasten<br />
zu tragen. Daher war es für die Stadt<br />
von enormer Wichtigkeit, dass sie von<br />
den Hilfen im Rahmen der Kohäsions- und<br />
Strukturpolitik der Europäischen Union profitieren<br />
konnte. In der Förderperiode von<br />
2007 bis 2013 erhielt Berlin aus den Töpfen<br />
des Regional- und des Sozialfonds 1,2 Milliarden<br />
Euro. In der aktuellen Förderperiode<br />
werden es 850 Millionen Euro sein. Darüber<br />
hinaus bekommt Berlin als Stadt der<br />
Wissenschaft erhebliche Mittel aus dem<br />
EU-Forschungsprogramm. Ohne diese Unterstützung<br />
wäre beispielsweise unser Berliner<br />
Forschungsjuwel, der Wissenschaftsstandort<br />
Adlershof, undenkbar gewesen.<br />
W+M: Gab es konkrete und für Berlin wirtschaftlich<br />
relevante Projekte, die Sie seit<br />
2009 persönlich vorangebracht haben?<br />
Joachim Zeller: Hier müssen wir zunächst<br />
klarstellen, wofür das EU-Parlament<br />
zuständig ist. Es schafft die gesetzlichen<br />
Grundlagen für die jeweiligen Förderperioden.<br />
Wenn die Fördermittel dann<br />
bewilligt wurden, sind die einzelnen Länder<br />
für die Verwendung der Fördermittel<br />
selbst verantwortlich. Mir ist es natürlich<br />
wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
so zu gestalten, dass Berlin nicht<br />
zu kurz kommt. Das ist mir durchaus gelungen.<br />
Wir haben es beispielsweise in<br />
den letzten Jahren geschafft, das Thema<br />
Stadtentwicklung viel stärker als zuvor<br />
in die europäischen Förderkriterien einzubinden.<br />
Zudem achte ich darauf, dass<br />
bei der EU-Gesetzgebung möglichst keine<br />
Regelungen getroffen werden, die der<br />
Berliner Wirtschaft anschließend das Leben<br />
schwer machen. Um ein Beispiel zu<br />
nennen: Bei der Erarbeitung der Datenschutzgrundverordnung<br />
musste sichergestellt<br />
werden, dass auch die Start-ups<br />
und die vielen Internetunternehmen damit<br />
zurechtkommen.<br />
Besonderes Augenmerk richte ich auch<br />
auf rechtliche Erleichterungen bei der Zusammenarbeit<br />
der Grenzregionen. Für die<br />
Haushaltsentlastung der Kommission für<br />
das Jahr 2015 bin ich Parlamentsberichterstatter.<br />
Und seit zwei Jahren setze ich<br />
mich verstärkt für eine Neuausrichtung der<br />
Entwicklungszusammenarbeit ein, die sich<br />
ZUR PERSON<br />
Joachim Zeller wurde am 1. Juli 1952 in<br />
Oppeln (polnisch: Opole) in Oberschlesien<br />
geboren. Nach dem Abitur studierte<br />
er an der Berliner Humboldt-Universität<br />
Slawistik. Anschließend blieb er<br />
der renommierten Forschungsstätte<br />
treu und arbeitete bis 1992 als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter in der Universitätsbibliothek.<br />
1990 trat er der CDU bei<br />
und wirkte fortan fast zwei Jahrzehnte<br />
als Kommunalpolitiker – als Bezirksbürgermeister<br />
sowie Stadtrat in Berlin-Mitte.<br />
Von 2003 bis 2005 war Zeller Landesvorsitzender<br />
der Berliner CDU. Seit<br />
2009 ist er Mitglied des Europäischen<br />
Parlaments.<br />
Joachim Zeller ist verwitwet und Vater<br />
von vier Kindern.<br />
effektiver als bisher der Ursachenbekämpfung<br />
von Flucht und Migration vieler Menschen<br />
widmen und eine faire Teilnahme<br />
der Entwicklungsländer an der Weltwirtschaft<br />
zum Ziel haben sollte.<br />
W+M: Brüssel ist ein Marktplatz der Regionen<br />
und ein Sammelpunkt der internationalen<br />
Lobbyisten. Tut der Berliner Senat<br />
aus Ihrer Sicht genug, um vor Ort für den<br />
Standort Berlin zu werben?<br />
Joachim Zeller: Das hat sich gebessert.<br />
Ich möchte ausdrücklich die Arbeit des Berliner<br />
Büros hervorheben. Die Mitarbeiter<br />
sind sehr gut vernetzt und führen viele interessante<br />
Veranstaltungen durch. Wenn ich<br />
allerdings vergleiche, wie andere Länder in<br />
Brüssel die Trommel rühren, hat Berlin noch<br />
Luft nach oben. Gegenüber anderen Regionen<br />
haben wir einen klaren Vorteil: Der<br />
Nimbus von Berlin wirkt hier unverändert<br />
als Türöffner. Es wird aber sehr genau registriert,<br />
wie eine Landesregierung präsent ist<br />
und ob sie auch mit ihrem Spitzenpersonal<br />
vor Ort die Interessen des Landes vertritt.<br />
Foto: W+M<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
BRÜSSELER SEGEN | 35<br />
W+M: Sie haben aufgrund Ihrer Biografie,<br />
Ihrer beruflichen Herkunft und als Mitglied<br />
im entsprechenden EU-Ausschuss einen<br />
besonderen Draht zu Russland. Wie bewerten<br />
Sie die aktuelle EU-Politik gegenüber<br />
Russland?<br />
Joachim Zeller: Die Annexion der Krim<br />
und die Einmischung Russlands im Osten<br />
der Ukraine waren ein Bruch des Völkerrechts.<br />
Das konnte nicht ohne Reaktion<br />
bleiben. Dass wir aber vom Präsidenten<br />
des EU-Parlaments seit zwei Jahren keine<br />
Genehmigung für offizielle Kontakte zum<br />
russischen Parlament erhalten, halte ich<br />
für falsch. Wir müssen mit den russischen<br />
Kollegen reden. Denn wo geredet wird,<br />
wird nicht geschossen.<br />
Foto: W+M<br />
W+M: Glauben Sie, dass der „Brexit“ zu<br />
einem Dominoeffekt innerhalb der EU führen<br />
wird?<br />
Joachim Zeller: Das sehe ich nicht. Wir<br />
haben eine eindeutige Stimmung im Parlament:<br />
Alle sind nach dem „Brexit“ erschrocken<br />
und auch die größten Schreihälse<br />
von Rechtsaußen sind abgetaucht.<br />
Was man hat, das weiß man. Was kommt,<br />
könnte aufs Glatteis führen. Jetzt müssen<br />
wir dringend die Diskussion darüber führen,<br />
worauf wir uns in Europa in den kommenden<br />
Jahren konzentrieren sollten.<br />
W+M: Wenn Sie die Chance hätten, was<br />
würden Sie persönlich tun, um die Arbeit<br />
des EU-Parlaments zu effektivieren?<br />
Joachim Zeller: Unsere Regeln sind<br />
schon sehr ausgefeilt. Allerdings sehe<br />
Seit 2009 für Berlin im<br />
Europaparlament: Joachim Zeller.<br />
ich, dass es Kollegen im Parlament gibt,<br />
die zu kommissionsgläubig sind. Das Parlament<br />
ist sich in Teilen nicht seiner gestiegenen<br />
Bedeutung bewusst, die es seit<br />
dem Lissabon-Vertrag zweifellos hat. Wir<br />
könnten durchaus öfter selbstbewusst auf<br />
den Tisch hauen und die EU-Kommissare<br />
härter anpacken.<br />
W+M: Gibt es ein konkretes Vorhaben,<br />
das Sie bis zum Ende der Legislaturperiode<br />
dringend realisieren möchten?<br />
Joachim Zeller: Mir ist vor allem wichtig,<br />
dass in Brüssel in den nächsten Jahren die<br />
richtigen Entscheidungen hinsichtlich der<br />
Kohäsions- und Strukturpolitik getroffen<br />
werden. Kohäsionspolitik heißt konkret,<br />
Politik für den inneren Zusammenhalt zu<br />
betreiben. Da es immer noch erhebliche<br />
regionale Unterschiede gibt, brauchen wir<br />
auch über 2020 hinaus eine Fortsetzung<br />
dieser Politik. In diesen Zusammenhang<br />
werde ich auch das Thema Stadt im Fokus<br />
behalten. Immerhin leben 70 Prozent<br />
der Europäer in Städten. Viele dieser Städte<br />
brauchen Unterstützung aus Brüssel.<br />
Berlin gehört dazu.<br />
Interview: Karsten Hintzmann<br />
Ihre erste Adresse<br />
für alle Services rund<br />
um den RMB<br />
Bank of China Berlin Branch<br />
Leipziger Platz 8 · 10117 Berlin<br />
Tel. 030 4050 8740<br />
berlin@bocffm.com · www.bankofchina.com/de
36 | W+M TITEL<br />
Brüsseler Finanzspritzen<br />
für den Mittelstand<br />
In der aktuellen Förderperiode 2014–2020 stehen Ostdeutschland<br />
weniger EU-Mittel als zuvor zur Verfügung. Es gilt daher die<br />
Konzentration der Mittel: Die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen<br />
und mittelständischen Unternehmen (KMU), Innovationen und der<br />
Klimaschutz stehen im Fokus der EU-Förderung. Von Matthias Salm<br />
Wie ostdeutsche Unternehmen<br />
vom Brüsseler Geldsegen profitieren<br />
können, zeigt folgende<br />
Übersicht über wichtige, aus EU-Fonds<br />
gespeiste Förderprogramme für mittelständische<br />
Unternehmen in den einzelnen<br />
Bundesländern:<br />
Berlin<br />
Für Gründer:<br />
Mikrokredite aus dem KMU-Fonds<br />
Gefördert werden Investitionen bei<br />
Existenzgründungen und -festigungen,<br />
Neuansiedlungen, Betriebsübernahmen,<br />
Erweiterungen sowie die Vorfinanzierung<br />
konkreter Aufträge mit Mikrokrediten bis<br />
zu 25.000 Euro.<br />
Für KMU:<br />
Berlin Kredit<br />
Das Förderprogramm Berlin Kredit dient<br />
der langfristigen Unterstützung von Investitionen<br />
und Betriebsmitteln kleiner<br />
und mittlerer Unternehmen mit Darlehen<br />
bis zu zehn Millionen Euro.<br />
Für Innovative:<br />
Berlin Innovativ<br />
Hier gibt es Darlehen zwischen 100.000<br />
und zwei Millionen Euro für Investitionen,<br />
Betriebsmittel sowie Forschungs- und Innovationsvorhaben.<br />
Die Mittel stammen<br />
zum Teil aus dem Europäischen Fonds<br />
für strategische Investitionen.<br />
WEITERE INFOS ZU DEN<br />
FÖRDERPROGRAMMEN:<br />
Investitionsbank Berlin<br />
Kundenberatung Wirtschaftsförderung<br />
Bundesallee 210, 10719 Berlin<br />
Tel.: 030 2125-4747<br />
www.ibb.de<br />
Brandenburg<br />
Für Gründer:<br />
Gründung innovativ<br />
Gründung innovativ unterstützt innovative<br />
Existenzgründer in bestimmten<br />
Clustern mit Zuschüssen bei Investitionen,<br />
Personalausgaben sowie technischen<br />
Beratungs- und Entwicklungsleistungen.<br />
Für KMU: Eigenkapitalfinanzierung –<br />
Wachstumsfinanzierung<br />
Hier soll die Wettbewerbsfähigkeit von<br />
KMU durch die Übernahme offener Beteiligungen<br />
und beteiligungsähnlicher Investitionen<br />
verbessert werden. Förderthemen<br />
sind zum Beispiel die Produktentwicklung<br />
oder das Unternehmenswachstum.<br />
WEITERE INFOS ZU DEN<br />
FÖRDERPROGRAMMEN:<br />
Investitionsbank des<br />
Landes Brandenburg<br />
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam<br />
Infotelefon<br />
Wirtschaft & Infrastruktur<br />
Tel.: 0331 660-2211<br />
www.ilb.de<br />
Für Innovative:<br />
Brandenburg-Kredit Innovativ<br />
Den Brandenburg-Kredit Innovativ können<br />
KMU sowie Unternehmen mit weniger<br />
als 500 Beschäftigten in Anspruch<br />
nehmen, sofern sie eines von zwölf Innovationskriterien<br />
erfüllen. Es stehen Darlehen<br />
von 100.000 bis drei Millionen Euro<br />
bereit.<br />
Foto: European Union/Etienne Ansotte<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
BRÜSSELER SEGEN | 37<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Für Gewerbebetriebe:<br />
GRW-Förderung<br />
Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
(GRW) zielt auf Investitionsvorhaben,<br />
durch die die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Wirtschaft gestärkt wird. Die Förderung<br />
wird als sachkapitalbezogener Zuschuss<br />
gewährt.<br />
WEITERE INFOS ZUM<br />
FÖRDERPROGRAMM:<br />
Landesförderinstitut<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Werkstraße 213, 19061 Schwerin<br />
Erstberatung<br />
Tel.: 0385 6363-1282<br />
www.lfi-mv.de<br />
Für Weiterbildung:<br />
Bildungsschecks für Unternehmen<br />
Mecklenburg-Vorpommern gewährt mit Hilfe<br />
des Europäischen Sozialfonds Bildungsschecks<br />
für die Teilnahme von Beschäftigten<br />
an der beruflichen Weiterbildung. Gefördert<br />
werden bis zu 50 Prozent der förderfähigen<br />
Kosten, maximal 500 Euro.<br />
WEITERE INFOS ZUM<br />
FÖRDERPROGRAMM:<br />
GSA – Gesellschaft für Struktur- und<br />
Arbeitsmarktentwicklung mbH<br />
Schulstraße 1-3, 19055 Schwerin<br />
Tel.: 0385 55775-0<br />
www.gsa-schwerin.de<br />
Für Innovative: Förderung von Forschung,<br />
Entwicklung und Innovation<br />
Gefördert mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen<br />
werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben<br />
ebenso wie Durchführbarkeitsstudien<br />
oder die Anmeldung<br />
von Schutzrechten von KMU wie auch<br />
von Forschungseinrichtungen.<br />
WEITERE INFOS ZUM<br />
FÖRDERPROGRAMM:<br />
TBI Technologie-Beratungs-Institut GmbH<br />
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin<br />
Tel.: 0385 3993-165<br />
www.tbi-mv.de<br />
Sachsen<br />
Für Innovative:<br />
Technologieförderung<br />
Die Technologieförderung setzt auf drei<br />
Instrumente: Die Projektförderung zielt<br />
auf die Entwicklung neuer Produkte und<br />
Verfahren. Die Technologietransferförderung<br />
unterstützt KMU beim Erwerb von<br />
Lizenzen oder Patentrechten, die Innovationsprämie<br />
fördert die Zusammenarbeit<br />
von KMU mit Forschungseinrichtungen.<br />
Für Exporteure:<br />
Messen, Außenwirtschaft<br />
Sachsen fördert aus EFRE-Mitteln die<br />
Teilnahme von KMU an Auslandsmessen<br />
ebenso wie an Produktpräsentationen<br />
und Symposien zur Erschließung<br />
ausländischer Märkte.<br />
Für Energiesparer:<br />
Zukunftsfähige Energieversorgung<br />
KMU erhalten nicht rückzahlbare Zuschüsse<br />
für Maßnahmen zur Energieeffizienz,<br />
den Einsatz erneuerbarer Energieträger<br />
oder Investitionen in die Energiespeicherung<br />
oder intelligente Energienetze.<br />
WEITERE INFOS ZU DEN<br />
FÖRDERPROGRAMMEN:<br />
Sächsische Aufbaubank<br />
Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden<br />
Servicecenter<br />
Tel.: 0351 4910-4910<br />
Servicehotline Energie und Klima<br />
Tel.: 0351 4910-4648<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Für Gründer und KMU:<br />
Sachsen-Anhalt IMPULS<br />
Sachsen-Anhalt IMPULS unterstützt bei<br />
der Finanzierung von betrieblichen Investitionen,<br />
Betriebsmitteln oder Investitionen<br />
in Entwicklung und Innovation.<br />
Für Innovative:<br />
Sachsen-Anhalt Idee<br />
Das Programm fördert mit Darlehen die<br />
Phase nach der Produktentwicklung, also<br />
Investitionen in die Markteinführung eines<br />
Produkts, eines Verfahrens oder einer<br />
Dienstleistung.<br />
Für Wachstumsunternehmen:<br />
Sachsen-Anhalt Mut<br />
Darlehen zwischen 25.000 und 500.000<br />
Euro zur Vorfinanzierung neuer Aufträge.<br />
WEITERE INFOS ZU DEN<br />
FÖRDERPROGRAMMEN:<br />
Investitionsbank Sachsen-Anhalt<br />
Domplatz 12, 39104 Magdeburg<br />
Servicehotline:<br />
Tel.: 0800 5600757<br />
www.ib-sachsen-anhalt.de<br />
Thüringen<br />
Für Energiesparer:<br />
GREEN invest<br />
Thüringen fördert die Beratung zu Energieeffizienzmaßnahmen<br />
und anschließende<br />
Investitionen über einen Zuschuss bis zu<br />
80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.<br />
Für KMU:<br />
Thüringen-Invest<br />
Gefördert werden Investitionsvorhaben<br />
über einen Zuschuss, der mit einem zinsverbilligten<br />
Darlehen kombiniert werden<br />
kann. Zuschussförderung: bis zu 20 Prozent<br />
der zuschussfähigen Kosten, maximal<br />
50.000 Euro; Förderdarlehen: projektbezogene<br />
Finanzierung bis zu 200.000 Euro.<br />
Für Wachstumsunternehmen:<br />
Thüringen-Dynamik<br />
Thüringen-Dynamik ist ein Förderprogramm<br />
zur Wachstumsfinanzierung. Es<br />
ermöglicht Darlehen bis zu 500.000 Euro<br />
pro Antragsteller und Kalenderjahr.<br />
WEITERE INFOS ZU DEN<br />
FÖRDERPROGRAMMEN:<br />
Thüringer Aufbaubank<br />
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt<br />
Tel: 0361 7447-0<br />
www.aufbaubank.de<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
38 | W+M TITEL<br />
Das Elbsandsteingebirge wird mit EU-Unterstützung<br />
als gemeinsame Tourismusregion vermarktet.<br />
Grenzregionen<br />
wachsen zusammen<br />
2004 traten Polen und Tschechien im Zuge der Osterweiterung<br />
der Europäischen Union bei. Seither fördert Brüssel das<br />
Zusammenwachsen der Grenzregionen als gemeinsame<br />
Wirtschaftsräume. Chancen zur Kooperation bestehen vor allem<br />
im Tourismus und in der Bildung.<br />
Von Matthias Salm<br />
Die Natur macht nicht an Grenzen<br />
halt – das gilt auch für das Elbsandsteingebirge.<br />
Die faszinierenden<br />
Felsenwelten im südlichen Sachsen erstrecken<br />
sich beiderseits der Grenze, hier<br />
als Sächsische, im benachbarten Tschechien<br />
als Böhmische Schweiz. Eine Region<br />
wie geschaffen für grenzüberschreitenden<br />
Tourismus.<br />
Die Touristiker auf beiden Seiten haben<br />
dies schon frühzeitig erkannt. Seit 2005<br />
kooperiert der Tourismusverband Sächsische<br />
Schweiz (TVSSW) mit seinem<br />
böhmischen Pendant, der Gemeinnützigen<br />
Gesellschaft Böhmische Schweiz<br />
(GGBS), um das Elbsandsteingebirge als<br />
touristische Destination zu vermarkten.<br />
Das Ziel: das Elbsandsteingebirge als<br />
grenzüberschreitendes Vorbild für die<br />
gelungene Integration von Tourismus-,<br />
Natur- und Umweltschutzzielen. Dafür<br />
setzen die Partner auch finanzielle Mittel<br />
aus Brüssel ein. Der Vorsitzende der<br />
GGBS Zbyněk Linhart formuliert es so:<br />
„Ohne die partnerschaftliche, grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit wären wir<br />
längst nicht da, wo wir heute stehen. Insbesondere<br />
die Fördermittel der Europäischen<br />
Union haben uns in den vergangenen<br />
Jahren erlaubt, gemeinsam große<br />
Schritte zu tun.“<br />
Und Tino Richter, Geschäftsführer des<br />
Tourismusverbands Sächsische Schweiz,<br />
ergänzt: „Die EU-Förderung hilft uns dabei,<br />
gemeinsame Aktivitäten umzusetzen.“<br />
Mittlerweile haben die Tourismusverbände<br />
einen einheitlichen Markenauftritt<br />
für das Urlaubsgebiet entwickelt.<br />
Seit zwei Jahren verbindet zudem<br />
die Nationalparkbahn Sächsisch-Böhmische<br />
Schweiz wieder beide Regionen auf<br />
einst traditionsreicher Strecke. Auch die<br />
Foto: Z. Patzelt<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
DÄNEMARK<br />
BRÜSSELER SEGEN | 39<br />
Foto: Lars Neumann<br />
regionale Tourismusbörse dient der Vermarktung<br />
beider Reiseziele.<br />
Jüngstes Beispiel für die Zusammenarbeit:<br />
Den 116. Deutschen Wandertag,<br />
gerne auch als das größte Wanderfest<br />
der Welt bezeichnet, begingen beide<br />
Seiten im Juni dieses Jahres als sächsisch-böhmisches<br />
Projekt. „Solche Ereignisse<br />
sind bei uns mittlerweile selbstverständlich<br />
grenzüberschreitend“, weiß<br />
Tino Richter. „Gerade die Wandertouren<br />
auf tschechischer Seite wurden von den<br />
Gästen sehr gut angenommen.“<br />
Die sächsisch-tschechischen Beziehungen<br />
beschränken sich jedoch nicht allein<br />
auf den Tourismus. Chancen eröffnen<br />
auch Projekte von sächsischen und<br />
tschechischen Forschungseinrichtungen<br />
im Rahmen des EU-Programms „Horizon<br />
2020“. Noch, räumt Sachsens Wissenschaftsministerin<br />
Dr. Eva-Maria Stange<br />
ein, richten sächsische Hochschulen<br />
und Forschungsinstitute ihren Blick eher<br />
Richtung Westeuropa – das Potenzial der<br />
Vernetzung mit grenznahen Forschungseinrichtungen<br />
in Polen und Tschechien<br />
soll deshalb mit EU-Unterstützung künftig<br />
besser genutzt werden.<br />
Darüber hinaus stehen für grenzübergreifende<br />
Projekte mit Tschechien bis 2020 in<br />
den Bereichen Hochwasser-, Brand- und<br />
Katastrophenschutz, innere Sicherheit,<br />
Schutz des gemeinsamen Natur- und<br />
Kulturerbes, Tourismus, Bildung und interkultureller<br />
Dialog insgesamt 186 Millionen<br />
Euro zur Verfügung. Diese Mittel<br />
stammen aus dem Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) und aus<br />
nationalen Fördertöpfen der beiden Nachbarländer.<br />
Auch in den sächsisch-polnischen Grenzraum<br />
fließen Gelder aus der EU. Das Kooperationsprogramm<br />
INTERREG Polen –<br />
Sachsen 2014–2020 wird auf der deutschen<br />
Seite in den Landkreisen Görlitz<br />
und Bautzen sowie auf der polnischen<br />
Seite in der Unterregion Jelenia Góra der<br />
Woiwodschaft Niederschlesien und Landkreis<br />
Żarski der Woiwodschaft Lebuser<br />
Land umgesetzt. Bis 2020 stehen 70 Millionen<br />
Euro aus dem EFRE zur Verfügung.<br />
BELGIEN<br />
So plant etwa die Sächsische Bildungsagentur<br />
mit vier polnischen Landratsämtern<br />
in ihrem Projekt „Regional Manage-<br />
Schleswig-<br />
sund<br />
KIEL<br />
Stral-<br />
Rostock<br />
Greifswald<br />
Holstein<br />
ment“, die Berufsperspektiven junger Lübeck Mecklenburg-<br />
Wismar<br />
Leute in der Grenzregion Wilhelms- Bremerzu<br />
verbessern.<br />
HAMBURG<br />
Vorpommern<br />
haven<br />
haven<br />
SCHWERIN<br />
Neubrandenburg<br />
Zum Projekt zählen grenzübergreifende<br />
Emden<br />
Groningen<br />
BREMEN Lüneburg<br />
Bildungsmaßnahmen in den Bereichen<br />
Oldenburg<br />
Kultur- und Tourismus-Management.<br />
Niedersachsen<br />
Auch den Ausbau und die Modernisierung<br />
der Straßeninfrastruktur Enschede im Grenz-HANNOVER<br />
Wolfsburg Sachsen- POTSDAM<br />
BERLIN<br />
Celle<br />
Branden-<br />
Stendal<br />
burg<br />
NIEDERLANDE<br />
gebiet fördert die EU in drei Vorhaben Osnabrück mit Hildesheim Braun-<br />
Arnheim<br />
schweig<br />
Anhalt<br />
einem Gesamtfördervolumen von knapp<br />
Brandenburg<br />
Münster<br />
Bielefeld Salzgitter MAGDE-<br />
Detmold<br />
BURG<br />
Cottbus<br />
zehn Millionen Euro.<br />
A'dam<br />
Den Haag<br />
Duisburg<br />
Nordsee<br />
Essen<br />
Polen steht auch im Fokus des Programms<br />
Ruhr<br />
DÜSSELDORF<br />
Kassel<br />
INTERREG V A, Nordrhein-<br />
das die Zusammenarbeit<br />
Köln<br />
Westfalen<br />
der Woiwodschaft Westpommern Siegen in Polen<br />
mit den Landkreisen Barnim, Uckermark<br />
Bonn<br />
Marburg<br />
Gießen<br />
und Märkisch-Oderland in Brandenburg sowie<br />
den Rheinland-<br />
Landkreisen Vorpommern-Greifs-<br />
Koblenz Hessen<br />
WIES- Frankfurt<br />
BADEN<br />
wald, Vorpommern-Rügen Pfalz und Mecklenburgische<br />
LUX. Seenplatte in Mecklenburg-Vor-<br />
Darmstadt<br />
MAINZ<br />
Trier<br />
pommern begleitet. Insgesamt Mannheim stehen für<br />
Saarland Lu'hafen<br />
Heidelberg<br />
das Programm in der EU-Förderperiode bis<br />
SAABRÜCKEN Kaiserslautern<br />
2020 134 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln<br />
Karlsruhe<br />
bereit.<br />
Maas<br />
Mosel<br />
FRANKREICH<br />
Dortmund<br />
Lahn<br />
Baden<br />
Tübingen<br />
In Mecklenburg-Vorpommern Straßburg weitet sich<br />
der Blick der Internationalisierung<br />
Württemberg<br />
allerdings<br />
über das EU-Nachbarland Polen hinaus.<br />
Schließlich betreibt<br />
Freiburg<br />
das Land rund<br />
30 Prozent seines Außenhandels mit den<br />
Basel Konstanz<br />
Ländern im Ostseeraum. Dieser bildet die<br />
Zürich<br />
Grundlage für SCHWEIZ<br />
wichtige Branchen des Landes<br />
wie etwa die Hafenwirtschaft und die<br />
Logistikbranche. Gleichzeitig lebt die erfolgreiche<br />
Tourismuswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns<br />
wesentlich von der<br />
Ostseeküste. Vor allem aus Schweden<br />
(rund 71.100 Ankünfte) und Dänemark<br />
(59.800 Ankünfte) reisten 2015 die meisten<br />
ausländischen Gäste an. Künftig, so<br />
die Ziele der Landesregierung<br />
Mecklenburg-Vorpommern,<br />
soll eine grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
der Ostseeanrainer<br />
helfen, die Marke<br />
„Ostseeurlaub“<br />
international bekannter<br />
zu machen.<br />
Die Wirtschaftspolitik<br />
des Landes setzt auch<br />
in anderen Bereichen stark<br />
Ems<br />
Lippe<br />
Flensburg<br />
Göttingen<br />
Fulda<br />
Würzburg<br />
STUTTGART<br />
Ulm<br />
Friedrichshafen<br />
Fulda<br />
Aller<br />
Werra<br />
Thüringen<br />
Bamberg<br />
Fürth<br />
Augsburg<br />
Halle<br />
Nordhausen<br />
ERFURT Weimar<br />
Eisenach<br />
Gera<br />
Main<br />
Suhl<br />
Coburg<br />
Erlangen<br />
Nürnberg<br />
Bayern<br />
Ingolstadt<br />
Lech<br />
Hof<br />
Bayreuth<br />
MÜNCHEN<br />
Elbe<br />
Saale<br />
Innsbruck<br />
Dessau<br />
Plauen<br />
Leipzig<br />
Regensburg<br />
Landshut<br />
Sachsen<br />
DRESDEN<br />
Chemnitz<br />
Zwickau<br />
Donau<br />
Isar<br />
Salzburg<br />
auf die EU-Programme für die Ostsee-<br />
Staaten. Dies sind im Einzelnen das Ostseeraumprogramm<br />
mit einem Gesamtbudget<br />
von circa 350 Millionen Euro, davon<br />
rund 280 Millionen Euro EFRE-Mittel<br />
sowie auf das EU-Programm für den<br />
Südlichen Ostseeraum mit einem Budget<br />
von rund 103 Millionen Euro, davon<br />
etwa 83 Millio nen Euro<br />
EFRE-Mittel. Schwerpunkte<br />
der Programme<br />
sind die Themen<br />
Verkehr und Erneuerbare<br />
Energien.<br />
<br />
W+M<br />
Inn<br />
Tino Richter, Geschäftsführer<br />
Tourismusverband<br />
Sächsische Schweiz.<br />
Ostsee<br />
POLEN<br />
TSCHECHIEN<br />
Passau<br />
Spree<br />
Frankfurt<br />
Prag<br />
Deutschland grenzt im Nordosten auf einer<br />
Garmisch-<br />
Partenk.<br />
Länge von 442 Kilometern an Polen und 811<br />
Kilometer im Osten an Tschechien.<br />
Moldau<br />
Görlitz<br />
Küstrin<br />
Neisse<br />
Oder<br />
Elbe<br />
ÖSTERREICH<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
40 | W+M TITEL BRÜSSELER SEGEN<br />
RAGNITZ ANALYSIERT<br />
Wie der BREXIT<br />
auf Ostdeutschland<br />
wirkt<br />
Mit der deutschen Vereinigung<br />
wurde Ostdeutschland nicht<br />
nur Teil des nunmehr größeren<br />
Deutschlands, sondern gleichzeitig<br />
auch Teil der Europäischen Union. Damit<br />
stand von Anfang an der große Europäische<br />
Binnenmarkt auch den Unternehmen<br />
aus dem Osten Deutschlands offen<br />
– was viele Betriebe auch offensiv genutzt<br />
haben: Die EU-Länder in ihrer Gesamtheit<br />
sind heute für alle ostdeutschen<br />
Länder der bedeutsamste Exportmarkt.<br />
Nicht zu unterschätzen ist zudem das<br />
Engagement europäischer Investoren<br />
in Ostdeutschland, die über die Errichtung<br />
neuer Produktionsstätten maßgeblich<br />
zur Stabilisierung der ostdeutschen<br />
Wirtschaft beigetragen haben.<br />
Darüber hinaus hat Ostdeutschland von<br />
Anfang an von der Förderung der EU profitieren<br />
können – sei es über die finanzielle<br />
Beteiligung an Infrastrukturprojekten,<br />
die Kofinanzierung der einzelbetrieblichen<br />
Förderung in Ostdeutschland<br />
oder auch die zahlreichen arbeitsmarktpolitischen<br />
Programme. Darüber hinaus<br />
flossen in erheblichem Umfang natürlich<br />
auch Mittel über die Fachprogramme<br />
der EU nach Ostdeutschland,<br />
insbesondere im<br />
landwirtschaftlichen<br />
Bereich.<br />
Bis heute ist Ostdeutschland<br />
flächendeckend<br />
Zielgebiet<br />
der regionalen<br />
Strukturförderung<br />
der EU – zwar<br />
nicht mehr als bevorzugtes<br />
Fördergebiet, da<br />
das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner<br />
(als relevantes Kriterium für die Festlegung<br />
der förderwürdigen Regionen) hier<br />
längst den Grenzwert von 75 Prozent des<br />
EU-Durchschnitts übersteigt, aber immerhin<br />
noch als Nutznießer einer „Übergangsförderung“,<br />
die all jenen Regionen<br />
zugutekommt, deren Wirtschaftskraft<br />
weniger als 90 Prozent des EU-Durchschnitts<br />
beträgt. Dies wird auch bis zum<br />
Jahr 2020 so bleiben – danach allerdings<br />
muss damit gerechnet werden, dass der<br />
größte Teil der ostdeutschen Länder keine<br />
EU-Strukturfondsförderung mehr erhält.<br />
Schon heute nämlich weisen fast<br />
alle ostdeutschen Regionen ein BIP je<br />
Einwohner von annähernd 90 Prozent<br />
des EU-Durchschnitts auf; nur Mecklenburg-Vorpommern<br />
liegt mit 84 Prozent<br />
noch darunter. Die Regionen Dresden<br />
und Leipzig sind sogar deutlich stärker<br />
– mit 95 beziehungsweise 103 Prozent<br />
des EU-Durchschnitts. Gegenüber dem<br />
Stand zu Anfang der 2000er-Jahre ist die<br />
relative Wirtschaftskraft in den ostdeutschen<br />
Fördergebieten dabei deutlich stärker<br />
gestiegen als in den westdeutschen<br />
Nicht-Förderregionen – was man<br />
durchaus als ein Zeichen für<br />
den Erfolg der EU-Strukturfondsförderung<br />
ansehen<br />
kann. Und dieser<br />
Erfolg zeigt dann<br />
Professor<br />
Dr. Joachim Ragnitz<br />
ist Stellvertretender Leiter<br />
des ifo-Instituts Dresden.<br />
eben auch, dass in Zukunft auf Förderung<br />
leichter verzichtet werden kann als<br />
es in der Vergangenheit der Fall gewesen<br />
ist. Insoweit dürfte es auch für die Landespolitik<br />
in Ostdeutschland verkraftbar<br />
sein, wenn EU-Fördermittel nicht mehr<br />
zur Kofinanzierung landeseigener Förderprogramme<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Das zu erwartende Ausscheiden Großbritanniens<br />
aus der Europäischen Union<br />
lässt auch Ostdeutschland nicht unberührt.<br />
Negativ könnte sich dies auswirken,<br />
weil das Vereinigte Königreich für<br />
alle Länder ein bedeutsamer Handelspartner<br />
ist und sich die Marktchancen<br />
ostdeutscher Anbieter dort wenn auch<br />
nicht direkt (über etwaige Beschränkungen<br />
des freien Warenverkehrs), so<br />
aber doch indirekt (über eine Abschwächung<br />
der konjunkturellen Entwicklung<br />
in Großbritannien selber beziehungsweise<br />
über induzierte Wechselkurseffekte)<br />
verschlechtern könnten. Dem stehen<br />
aber auch mögliche positive Auswirkungen<br />
gegenüber, so wenn britische Unternehmen<br />
nunmehr ihre Investitionsengagements<br />
auf dem Kontinent ausweiten,<br />
um weiterhin innerhalb der Europäischen<br />
Union präsent zu sein – hiervon könnte<br />
dann auch Ostdeutschland profitieren.<br />
Derzeit ist es aber noch zu früh, hier genauere<br />
Vorhersagen zu treffen. Problematisch<br />
würde es allerdings sein, wenn<br />
der BREXIT auch andere Länder zu einem<br />
Austritt aus der EU veranlassen würde –<br />
dann wäre die wirtschaftliche (und politische)<br />
Integration Europas insgesamt gefährdet,<br />
von der doch auch Ostdeutschland<br />
in der Vergangenheit so gut hat profitieren<br />
können.<br />
W+M<br />
Fotos: bluedesign/fotolia.com (oben), ifo Dresden (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
POLITIK | 41<br />
Brauchen wir in Ostdeutschland aktuell<br />
noch mehr Windräder?<br />
Hermann Albers,<br />
Präsident des Bundesverbandes WindEnergie e. V.<br />
Saskia Ludwig (CDU),<br />
Mitglied des Landtags Brandenburg<br />
Fotos: Bundesverband WindEnergie e. V. (links), Laurence Chaperon (rechts)<br />
„Ja” „Nein”<br />
Der Netzbetreiber 50Hertz<br />
Nur ein Teil der bis heute produzierten<br />
Windkraftenergie<br />
sieht Ostdeutschland als Steckdose<br />
Europas. Das ist richtig und<br />
wird genutzt! Für den Rest<br />
bedeutet zugleich, dass hier die Kasse steht, in<br />
bezahlen wir trotzdem. Die Argumente, warum<br />
die einbezahlt wird. Diese Chance muss der Osten<br />
nutzen! Mitten im Strukturwandel der ostdeutgen<br />
besser heute als morgen beendet werden<br />
der Windkraftausbau unter aktuellen Bedingunschen<br />
Wirtschaft gelang es, eine starke Windindustrie<br />
aufzubauen. Die Branche sorgt für sichere Be-<br />
für Mensch und Tier in zahlreichen Studien be-<br />
müsste, sind allen bekannt. Die negativen Folgen<br />
schäftigung, gute Steuereinnahmen und besticht legt. Und trotzdem waren gerade viele Städter für<br />
mit einem enormen Exporterfolg. Die Aufgeschlossenheit<br />
der ostdeutschen Akteure für eine Zusam-<br />
es für sie keine praktischen Berührungspunkte<br />
diese Argumente bisher wenig zugänglich, weil<br />
menarbeit mit den neuen Playern im Energiesektor gab. In schönen Altbauwohnungen lebend, von<br />
legte dafür die Grundlage. Tatkraft und ostdeutscher deren Balkone aus bis zum Horizont keine solche<br />
Pragmatismus zeigen sich auch bei der Erschließung Industrieanlage zu sehen war, machte das Urteilen<br />
von Effizienzpotenzialen im Netz oder der Strategieplattform<br />
für Power-to-Gas. Richtig ist: Fast 37 nehmend kommt es zu einer Bewusstseinsände-<br />
über die Folgen dieser für Andere leicht. Doch zu-<br />
Prozent der deutschen Windkraftanlagen stehen im rung. Exemplarisch die 180-Grad-Wende im Meinungsbild<br />
einer befreundeten Familie. Er Richter,<br />
Osten. Dank der Gewerbesteueraufteilung bleiben<br />
70 Prozent der Steuern bei der Standortgemeinde. sie Lehrerin. Nach dem kreditfinanzierten Kauf eines<br />
ehemaligen Bauernhauses in der Uckermark,<br />
Perspektivisch kann die Erneuerung des Maschinenparks<br />
bei insgesamt gleichbleibender Anlagenzahl<br />
hohe Effizienzgewinne erschließen. Die ambigerecht<br />
saniert hatten, wurden ihnen drei graue<br />
welches sie liebevoll für viel Geld denkmalschutztionierten<br />
Klimaschutzziele erfordern es, die Sektoren<br />
Mobilität und Wärme für Erneuerbare Energien ländlichen Idyll wurde ein Albtraum. Die surrenden<br />
Anlagen in unmittelbare Nähe gesetzt. Aus dem<br />
zu öffnen. Die Sektorenkopplung wird einen neuen Industrieanlagen sorgen für eine Dauerbeschallung<br />
Innovationsschub auslösen, starke Beschäftigungsimpulse<br />
setzen und neue Wertschöpfungschan-<br />
ist für die Familie unerträglich. „Früher habe ich<br />
und der Licht-Schatten-Wechsel der Rotorblätter<br />
cen generieren. Die preiswerte Windenergie an<br />
an meinem Rucksack den gelben Button ,Atomkraft?<br />
Nein Danke‘ getragen. Heute klebt der Sticker<br />
Land wird der Motor dieser Entwicklung bleiben.<br />
Indem die neuen Bundesländer ihre Chancen nutzen,<br />
werden sie wirtschaftlich aufschließen und<br />
ehemalige Grüne. Die Frage, ob wir in Ostdeutsch-<br />
,Windkraft? Nein Danke‘ an meiner Tasche“, so der<br />
in einigen Bereichen sogar die Schrittgeschwindigkeit<br />
bestimmen.<br />
man ihm besser nicht mehr<br />
land aktuell noch mehr Windräder brauchen, sollte<br />
stellen.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
42 | W+M POLITIK<br />
Davos des Ostens<br />
Im Oktober <strong>2016</strong> findet in Bad Saarow das erste Ostdeutsche<br />
Wirtschaftsforum statt. Dort werden namhafte Politiker,<br />
Unternehmer und Wissenschaftler über die Chancen und<br />
Perspektiven der Region zwischen Rügen und dem Erzgebirge reden<br />
und Ideen für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland entwickeln.<br />
Von Karsten Hintzmann<br />
Im vergangenen Jahr standen landauf<br />
landab Jubiläumsfeiern zum 25-jährigen<br />
Bestehen der neuen Bundesländer<br />
und dem Einzug der sozialen Marktwirtschaft<br />
im Osten auf der Tagesordnung.<br />
Man blickte zurück auf Jahre des<br />
schmerzhaften Strukturwandels, bilanzierte<br />
die Fortschritte, die es seither gegeben<br />
hat und kam meist zu dem Schluss, dass<br />
man durchaus stolz auf das Erreichte sein<br />
könne. Auch wenn der wirtschaftliche Aufholprozess<br />
freilich längst noch nicht abgeschlossen<br />
ist.<br />
Exklusives Hotel am Scharmützelsee:<br />
A-ROSA-Resort Bad Saarow.<br />
Vor dem Hintergrund der vielfältigen<br />
Feierlichkeiten und inhaltlichen<br />
Standortbestimmungen kristallisierte<br />
sich für die Redaktion des Magazins<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> heraus, dass auf<br />
den Blick zurück nunmehr auch der Blick<br />
nach vorn folgen muss. Selbstverständlich<br />
wird unser Magazin auch in Zukunft<br />
erfolgreiche Entwicklungen von regionalen<br />
Wirtschaftszentren, Unternehmen,<br />
Branchen und Clustern aufgreifen und<br />
analysieren. Aber wir sehen uns als einziges<br />
auf die neuen Bundesländer fokussiertes<br />
Wirtschafts- und Unternehmermagazin<br />
im deutschsprachigen Raum<br />
auch aufgefordert, einen Diskussionsprozess<br />
anzuschieben, der über die Vergangenheit<br />
und die Tagesaktualität weit<br />
hinaus geht und sich mit wirklichen Zukunftsthemen<br />
befasst. Wir wollen aktiv<br />
daran mitarbeiten, dass für Ostdeutschland<br />
echte Visionen – im positiven Sinne,<br />
versteht sich – entwickelt werden. Dafür<br />
haben wir das Ostdeutsche Wirtschaftsforum<br />
(OWF) in Bad Saarow aus der Taufe<br />
gehoben. Wir sind davon überzeugt,<br />
dass es hohe Zeit ist für ein „Davos des<br />
Ostens“ – so lautete der interne Arbeitstitel<br />
für das OWF. Denn es gibt so viele<br />
Fragen, die auf Antworten warten: Wird<br />
der Angleichungsprozess an die alten<br />
Länder je gelingen? Wird Ostdeutschland<br />
auf Dauer nur eine verlängerte Werkbank<br />
sein? Wie viel Potenzial steckt im eher<br />
kleinteiligen ostdeutschen Mittelstand<br />
– wird er auf Dauer nur Nischen besetzen<br />
oder ist er Schmelztiegel für künftige<br />
Großkonzerne? Kann der Osten im Wettbewerb<br />
um qualifizierte Fachkräfte angesichts<br />
niedrigerer Produktivität und geringerer<br />
Einkommen überhaupt mithalten?<br />
Wird sich der ostdeutsche Zusammenhalt<br />
perspektivisch auflösen oder weiter<br />
verstärken?<br />
Über all diese Fragen werden wir auf<br />
dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum<br />
debattieren – über Parteigrenzen hinweg<br />
und ohne Rücksichtnahme auf<br />
Wahlzyklen.<br />
Im A-ROSA Forum findet das OWF statt.<br />
Foto: A-ROSA (oben), W+M (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
POLITIK | 43<br />
Wir wollen über<br />
Zukunft sprechen.<br />
W+M-Herausgeber Frank Nehring erläutert die Idee des<br />
Ostdeutschen Wirtschaftsforums<br />
Programm zum<br />
Ostdeutschen<br />
Wirtschaftsforum (OWF)<br />
OWF.ZUKUNFT. Was hat es mit dem<br />
Ostdeutschen Wirtschaftsforum auf<br />
sich?<br />
Die sehr gute Entwicklung des Mittelstandes<br />
in Ostdeutschland in den vergangenen<br />
25 Jahren erfüllt zu Recht mit<br />
Stolz. Der Blick zurück ist wichtig, der<br />
Blick nach vorn aber wichtiger. Wir haben<br />
viele Themen für die Zukunft zu meistern,<br />
die Herausforderungen sind hoch,<br />
aber wir reden zu wenig darüber.<br />
Deshalb wollen wir mit dem OWF.ZU-<br />
KUNFT ein exklusives Veranstaltungsformat<br />
schaffen – das Ostdeutsche Wirtschaftsforum.<br />
Ist das OWF.ZUKUNFT ein Kongress?<br />
Ja und nein. Ja, er findet vom 20. bis<br />
21. Oktober <strong>2016</strong> in Bad Saarow<br />
statt. Und nein, mit<br />
dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum<br />
wollen<br />
wir nicht nur die Themen<br />
„Wirtschaft.<br />
Wachstum.Zukunft“<br />
einmalig in einem ausgewählten<br />
Kreis diskutieren.<br />
Wir wollen einen<br />
Thinktank gründen, der<br />
sich den Zukunftsthemen<br />
der ostdeutschen Wirtschaft<br />
annimmt und beim OWF2017, ein Jahr<br />
später, Ergebnisse vorlegen kann. Das<br />
Gründungsteam des Thinktanks hat sich<br />
bereits formiert.<br />
Wer organisiert das OWF.ZUKUNFT?<br />
Die Initiative „Wirtschaft.Wachstum.Zukunft“,<br />
die vom Magazin<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> und den ersten<br />
Thinktank-Partnern, wie dem ifo Institut<br />
Dresden, GTAI – Germany Trade and Invest,<br />
der Organisations- und Personalberatung<br />
Egon Zehnder sowie der Interessengemeinschaft<br />
der ostdeutschen Unternehmerverbände,<br />
begründet wurde.<br />
Die W+M Wirtschaft und Markt GmbH<br />
ist verantwortlich für die Veranstaltungsorganisation.<br />
Wer trifft sich beim OWF.ZUKUNFT?<br />
Alle die, die ein Interesse an einer wachstumsorientierten<br />
Entwicklung der Wirtschaft<br />
in den neuen Bundesländern haben.<br />
Das sind verantwortliche Vertreter<br />
und Institutionen des Bundes und der<br />
Länder, Unternehmer und Führungskräfte<br />
in- und ausländischer Unternehmen,<br />
internationaler Beteiligungsgesellschaften,<br />
Finanz- und Wirtschaftsforschungsinstitute,<br />
Universitäten, Botschafter und<br />
Diplomaten sowie Vertreter nationaler,<br />
internationaler und regionaler Wirtschaftsförderungsgesellschaften<br />
und Wirtschaftsverbände.<br />
Initiator des Ostdeutschen<br />
Wirtschaftsforums:<br />
Frank Nehring.<br />
Was ist das Ziel des<br />
OWF.ZUKUNFT?<br />
Am 20. und 21. Oktober<br />
<strong>2016</strong> wollen wir in Bad<br />
Saarow das Thema „Wirtschaft.Wachstum.Zukunft“<br />
auf<br />
die Agenda von Politik, Wirtschaft und<br />
Wissenschaft bringen. Wir werden die<br />
Perspektiven der stark mittelständisch geprägten<br />
Unternehmen in den neuen Bundesländern<br />
diskutieren und Handlungsfelder<br />
definieren. Den hochkarätigen Referenten<br />
und Teilnehmern eröffnen sich damit<br />
neue Möglichkeiten einer intensiven<br />
und zielorientierten Vernetzung.<br />
Es soll ein Thinktank entstehen, der die<br />
Zukunft branchen- und länderübergreifend<br />
thematisiert, und in der Folge ein<br />
jährliches Forum für den Austausch von<br />
Ideen in exklusivem Ambiente.<br />
Do, 20. Oktober <strong>2016</strong><br />
14:00 Anreise, Check-in<br />
15:00 Begrüßung<br />
16:00 Eröffnungsvortrag<br />
Sigmar Gabriel,<br />
Vizekanzler und Bundes minister<br />
für Wirtschaft und Energie<br />
Wirtschaft.Wachstum.Zukunft<br />
sowie weitere Keynotes<br />
Podiumsdiskussion<br />
19:30 Galadinner<br />
Fr, 21. Oktober <strong>2016</strong><br />
9:00 Begrüßung<br />
Impulsvorträge und Diskussionen<br />
Wachstum und Innovation<br />
Kaffeepause<br />
Impulsvorträge und Diskussionen<br />
Unternehmertum und Leadership<br />
Mittagessen<br />
Impulsvorträge und Diskussionen<br />
Wachstumsfelder und Investoren<br />
Kaffeepause<br />
Die große Podiumsdiskussion<br />
Die MPs der neuen Bundesländer<br />
Keynote<br />
17:30 Schlusswort<br />
18:00 Get-together zum Ausklang<br />
Sa, 22. Oktober <strong>2016</strong> (optional)<br />
Timeout<br />
Zeit für private Verabredungen<br />
Zeit für Entspannung im A-ROSA SPA<br />
Zeit für eine Runde Golf<br />
Zeit für …<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
44 | W+M POLITIK<br />
Referenten und Gesprächspartner<br />
Ihre Themen<br />
Sigmar Gabriel<br />
Vizekanzler und Bundesminister<br />
für Wirtschaft und Energie<br />
Wie wir mehr Wirtschaftswachs tum<br />
in Ostdeutschland erreichen.<br />
Prof. Dr. Johanna Wanka<br />
Bundesministerin<br />
für Bildung und Forschung<br />
Wie wir den Mittelstand stärker an<br />
Forschung und Entwicklung teilhaben<br />
lassen.<br />
Iris Gleicke<br />
Parlamentarische Staatssekretärin und<br />
Bundes beauftrage für die neuen Bundes länder,<br />
für Mittelstand und Tourismus beim<br />
Bundesministerium für Wirt schaft und Energie<br />
Was sind künftige Handlungsfelder<br />
für die Zukunft der kleinteiligen<br />
Wirtschaft im Osten?<br />
Dr. Reiner Haseloff<br />
Ministerpräsident<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Michael Müller<br />
Regierender<br />
Bürgermeister<br />
Berlin<br />
Erwin Sellering<br />
Ministerpräsident<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Wie wirkt die Forschungsexzellenz<br />
als<br />
Wirtschaftsfaktor in<br />
Sachsen-Anhalt?<br />
Dr. Dietmar Woidke<br />
Ministerpräsident<br />
Brandenburg<br />
Warum wir in naher Zukunft<br />
sowohl auf Braunkohle<br />
als auch Erneuerbare<br />
Energie setzen.<br />
Start-up-Hauptstadt<br />
und Digital Hub – welche<br />
Perspektiven hat Berlin<br />
als Wirtschaftsstandort?<br />
Christian Pegel<br />
Minister für Energie,<br />
Infrastruktur und<br />
Landesentwicklung<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Warum MV ein Land zum<br />
Leben ist und was andere<br />
davon lernen können.<br />
Wie Mecklenburg-<br />
Vorpommern die Zukunft<br />
meistern wird.<br />
Prof. Dr.<br />
Joachim Ragnitz<br />
Stellvertretender Leiter ifo<br />
Institut Niederlassung Dresden<br />
Was wir der ostdeutschen<br />
Wirtschaft vorm Hintergrund<br />
des demografischen Wandels<br />
in den nächsten 25 Jahren<br />
zutrauen – und was nicht.<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
POLITIK | 45<br />
Prof. Dr.<br />
Christoph Meinel<br />
Wissenschaftlicher<br />
Institutsdirektor und CEO<br />
sowie Inhaber Lehrstuhl<br />
„Internet-Technologien<br />
und Systeme“<br />
Hasso-Plattner-Institut<br />
Wohin führt uns die Di gitalisierung<br />
in naher Zukunft?<br />
Prof. Dr.<br />
Jörg K. Ritter<br />
Partner<br />
Egon Zehnder<br />
International GmbH<br />
Unternehmertum und<br />
Leadership – was wir der<br />
neuen Unternehmer <br />
gene ration im Osten raten.<br />
Dr. Andreas Golbs<br />
Unternehmer und Sprecher<br />
der Geschäftsführer der<br />
IG der Ostdeutschen<br />
Unternehmerverbände<br />
und Berlin<br />
Warum innovative<br />
Unternehmer so dringend<br />
gebraucht werden.<br />
Dr. Frank Golletz<br />
Technischer Geschäftsführer<br />
50Hertz Transmission GmbH<br />
Wo wir Wachstumspotenziale<br />
in einer sich<br />
wandelnden Energielandschaft<br />
sehen.<br />
Alexander Winter<br />
Geschäftsführender<br />
Gesellschafter<br />
Arcona/A-ROSA<br />
Guo Guangchang<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Fosun Group<br />
Warum Deutschland ein<br />
interessanter<br />
Investitions standort ist.<br />
Frank Nehring<br />
Herausgeber<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong><br />
Warum wir ein Davos<br />
des Ostens brauchen.<br />
Holger Werner<br />
Bereichsvorstand<br />
Mittelstandsbank<br />
Region Ost<br />
Commerzbank AG<br />
Wie wir als Bank die<br />
Partnerschaft mit dem<br />
Mittelstand neu denken.<br />
Heinrich von<br />
Nathusius<br />
Geschäftsführer<br />
MIFA-Bike GmbH<br />
Wie man mit neuen<br />
Ideen in die Jahre<br />
gekommene Produkte<br />
wieder fit macht.<br />
Dr. Frank Höpner<br />
Mitglied der<br />
Geschäftsleitung<br />
ENGIE Deutschland<br />
Dr. Benno Bunse<br />
Erster Geschäftsführer<br />
Germany Trade and Invest -<br />
Gesellschaft für Außenwirt schaft<br />
und Standortmarketing mbH<br />
Wie sich ostdeutsche Mittelständler<br />
als Weltmeister auf<br />
internationalen (Nischen-)<br />
Märkten durchsetzen.<br />
Hartmut Bunsen<br />
Unternehmer und Präsident<br />
der IG der Ostdeutschen<br />
Unternehmerverbände und<br />
Berlin<br />
Warum der Osten eine<br />
Stimme braucht.<br />
Stefan Teuchert<br />
Regionalleiter Ost<br />
BMW Group<br />
Hallo Zukunft!<br />
Wie wir uns dem Thema<br />
Wachstum stellen.<br />
Dr. Ralph Beckmann<br />
Abteilungsleiter<br />
Nachfolgeberatung<br />
Commerzbank AG<br />
Weshalb die Nachfolgeregelung<br />
auch in ostdeutschen<br />
Unternehmen eine<br />
der wichtigsten Zukunftsfragen<br />
ist.<br />
Dr. Jens-Uwe Meyer<br />
Innovationsexperte und<br />
Buchautor<br />
Wie eine gelungene<br />
Unternehmens nachfolge<br />
motiviert.<br />
Andrea Joras<br />
Geschäftsführerin<br />
Berlin Partner für<br />
Wirtschaft und<br />
Technologie GmbH<br />
Wie wir unsere<br />
Strategie an<br />
den Megatrends<br />
ausrichten.<br />
Nora Heer<br />
Gründerin und<br />
Geschäftsführerin<br />
Loopline Systems<br />
Internet GmbH<br />
Wie ostdeutsche<br />
Unter nehmer mit der<br />
Digitalisierung gewinnen<br />
können.<br />
Moderation<br />
Rommy Arndt<br />
Moderatorin n-tv<br />
Innovationsstandort<br />
Berlin – Innovationshauptstadt<br />
für Deutschland.<br />
Wieso der „War of<br />
Talents“ unser Denken<br />
verändern muss.<br />
Änderungen vorbehalten!<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
46 | W+M RATGEBER<br />
Projekt Unternehmensnachfolge<br />
Die Übergabe der Geschicke der<br />
eigenen Firma in die Hände eines<br />
fähigen Nachfolgers zu meistern<br />
ist heute – besonders in den<br />
neuen Bundesländern – für viele<br />
Unternehmer eine unerwartet<br />
große Herausforderung. In dieser<br />
und den folgenden Ausgaben<br />
möchte ich Ihnen einen Überblick<br />
über den grundsätzlichen Ablauf<br />
des „Projekts Unternehmensnachfolge“<br />
geben, welcher<br />
neben der Phase des konkreten<br />
Unternehmensverkaufs sowohl<br />
die Vorbereitung als auch die Zeit<br />
nach der Unterschrift beleuchtet.<br />
<br />
Von Holger Wassermann<br />
Im mittelständisch geprägten Deutschland<br />
ist es seit jeher eine etwa alle 25<br />
bis 35 Jahre wiederkehrende Aufgabe<br />
für den Unternehmer, die Fortführung des<br />
Betriebs der nächsten Generation zu überlassen.<br />
Noch findet<br />
sich in rund der Hälfte<br />
der Fälle der Nachfolger<br />
in den Reihen<br />
der Familie, circa ein<br />
Sechstel der Unternehmen<br />
wird von Mitarbeitern<br />
übernommen. Für den Rest muss ein<br />
externer Käufer gefunden werden – sei es<br />
ein einzelner Nachfolger, ein Nachfolgerteam<br />
oder ein anderes Unternehmen.<br />
„Rechtzeitig? Es ist<br />
immer zu spät und<br />
niemals zu früh. Aber:<br />
Besser spät als nie.“<br />
Problematisch ist dabei, dass sich die<br />
Nachfolge für immer weniger Menschen<br />
als eine interessante Option darstellt. Bei<br />
dem aktuell positiven Arbeitsmarktklima<br />
ist es einfacher, ein gutes Einkommen<br />
als Angestellter zu erzielen, und in Zeiten<br />
der Work-Life-Balance ist die typische<br />
80-Stunden-Woche eines Unternehmers<br />
auch nicht mehr wirklich erstrebenswert.<br />
Hinzu kommt der demografische<br />
Wandel, der ohnehin zu einer<br />
Verknappung der Personen<br />
in der relevanten<br />
Altersgruppe zwischen<br />
30 und 40 führt.<br />
Durch das geringe<br />
Lohnniveau der letzten<br />
Jahre fehlt es zudem<br />
übernahmewilligen Gründern häufig<br />
an dem notwendigen Eigenkapital.<br />
Viele Punkte, die eine Tätigkeit in einem<br />
Start-up oder einem angesehenen<br />
Großunternehmen attraktiver erscheinen<br />
lassen.<br />
Phasen der Unternehmensübergabe<br />
Grundsätzlich kann ein Nachfolgeprojekt<br />
in drei Hauptphasen unterschieden werden:<br />
die Vorbereitung, die Durchführung<br />
und die Zeit nach der Übergabe. In der<br />
Vorbereitungsphase werden die Grundlagen<br />
für eine erfolgreiche Nachfolge und<br />
die Erzielung eines möglichst hohen Kaufpreises<br />
gelegt. In der Durchführungsphase<br />
wird der Nachfolger gesucht und (hoffentlich)<br />
gefunden, es wird verhandelt und<br />
der Vertrag geschlossen. Die Zeit nach<br />
der Übergabe kann für den Unternehmer<br />
durch eine Begleitung des Nachfolgers<br />
oder neue Aufgaben gekennzeichnet sein,<br />
während für den Nachfolger nun das Unternehmer-Sein<br />
beginnt. Dieser Beitrag<br />
fokussiert sich auf die erste der drei Phasen<br />
der Unternehmensübergabe.<br />
Die Vorbereitungsphase<br />
Eine langfristige Vorbereitung beginnt etwa<br />
zehn Jahre vor der Nachfolge. Einerseits<br />
ist bei familieninternen Schenkungen eine<br />
Zehn-Jahres-Frist zu beachten, andererseits<br />
gewährt diese Zeitspanne genug Spielraum<br />
für die anstehenden Maßnahmen.<br />
Foto: Ogerepus/fotolia.com<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
MANAGEMENT | 47<br />
Foto: Intagus<br />
Zur langfristigen Vorbereitung zählt die<br />
Erstellung eines Plans, wie sich der Unternehmer<br />
„sein Leben danach“ und die<br />
Nachfolge idealerweise vorstellt. Auf Basis<br />
dieses Plans können nun Projekte angegangen<br />
werden, die einerseits dazu beitragen,<br />
dass die Wahrscheinlichkeit erhöht<br />
wird, einen geeigneten Nachfolger zu finden,<br />
andererseits können Maßnahmen zur<br />
Steigerung des späteren Kaufpreises eingeleitet<br />
werden. Besonders positiv dabei<br />
ist, dass Unternehmen bereits während<br />
dieser Phase von den Maßnahmen profitieren<br />
– vergleichbar mit dem eigenen<br />
Heim, das ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge<br />
ist, in dem man aber schon<br />
vorher lebt.<br />
Ein Unternehmer soll nicht IN sondern AN<br />
seinem Unternehmen arbeiten – dieses<br />
Wortspiel umschreibt nahezu perfekt die<br />
Aufgabe dieser Phase. Je weniger ein Unternehmen<br />
ohne seinen Chef auskommen<br />
kann, umso unverkäuflicher ist es. Daher<br />
gilt es, Verantwortung, Wissen und Kontakte<br />
auf Mitarbeiter zu übertragen.<br />
Professor Dr. Holger Wassermann ist<br />
Wissenschaftlicher Leiter des KCE<br />
KompetenzCentrum für Entrepreneurship<br />
& Mittelstand der FOM-Hochschule und<br />
Geschäftsführer der Intagus GmbH.<br />
Etwa fünf Jahre vor der Unternehmensübergabe<br />
beginnt die mittelfristige Vorbereitung<br />
und gewissermaßen der Referenzzeitraum,<br />
denn die potenziellen<br />
Nachfolger werden sich natürlich das Unternehmen,<br />
das sie eventuell erwerben<br />
wollen und für das sie sich hoch verschulden<br />
werden, auf Herz und Nieren prüfen.<br />
Eine Analyse des Geschäftsverlaufs der<br />
vergangenen drei bis fünf Jahre ist dabei<br />
absolut üblich. Daher sollten spätestens<br />
ab diesem Zeitpunkt einerseits aussagefähige<br />
Unterlagen bereitstehen, die<br />
zu einem späteren Zeitpunkt nicht einfach<br />
nachträglich erzeugt werden können, andererseits<br />
sollte ab jetzt verstärkt darauf<br />
geachtet werden, Negativmerkmale<br />
wie Liquiditäts- oder Umsatz engpässe zu<br />
vermeiden.<br />
Diese Phase dient somit in entscheidendem<br />
Maße der Vorbereitung der sogenannten<br />
Due Diligence, also der genauen<br />
Prüfung der Unternehmung durch<br />
den Nachfolger. Je besser diese Phase<br />
mit Blick auf die Nachfolge durchgeführt<br />
wird, umso höher wird der spätere Kaufpreis<br />
ausfallen können.<br />
Das letzte Jahr vor dem Beginn der Durchführungsphase<br />
dient dazu, dem Nachfolger<br />
ein „aufgeräumtes Haus“ zu präsentieren.<br />
Wichtige Projekte sollten nach Möglichkeit<br />
abgeschlossen werden, weit in die<br />
Zukunft reichende neue Vorhaben sollten<br />
nun nicht mehr begonnen werden. Nun<br />
kann auch die Kommunikation der geplanten<br />
Nachfolge innerhalb eines Zeithorizonts<br />
von zwei bis drei Jahren gegenüber<br />
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten<br />
beginnen. Das beugt Fragen wie „Wie<br />
geht es wohl weiter?“ hinter vorgehaltener<br />
Hand vor und gibt den Geschäftspartnern<br />
die Sicherheit, dass der Fortbestand<br />
der Unternehmung nicht dem Zufall überlassen<br />
wird.<br />
Wichtig ist in dieser Phase besonders die<br />
Konsequenz. Viele Unternehmer finden<br />
hier immer wieder Ausreden, warum es<br />
jetzt doch noch nicht passe. W+M<br />
Unternehmensübergabe:<br />
Woran sollte man denken?<br />
Bei der Vorbereitung der Nachfolge<br />
sind viele verschiedene Dinge zu beachten,<br />
angefangen bei persönlichen<br />
bis hin zu betriebswirtschaftlichen und<br />
rechtlichen Aspekten. Hier soll auf einige<br />
besonders wichtige Fragen hingewiesen<br />
werden, die im Vorfeld geklärt<br />
werden sollten.<br />
Persönlich<br />
Was mache ich danach? Welche neuen<br />
Ziele oder neuen Aufgaben habe ich?<br />
Was ist mir wichtig? Kenne ich einen<br />
darauf spezialisierten Coach, der mir<br />
dabei helfen kann?<br />
Finanziell<br />
Wovon werde ich leben? Welche Ausgaben<br />
und Einnahmen werde ich haben?<br />
Benötige ich einen bestimmten<br />
Kaufpreis?<br />
Betriebswirtschaftlich<br />
Soll ein Familienmitglied oder ein Mitarbeiter<br />
Nachfolger werden? Wie muss<br />
er noch vorbereitet werden (persönlich,<br />
fachlich, finanziell)? Soll ein Externer<br />
die Firma kaufen? Wie will ich den passenden<br />
Nachfolger finden? Welchen<br />
Wert hat meine Firma heute? Was<br />
kann ich noch tun, um besser verkaufen<br />
zu können? Wie gestalten wir die<br />
Übergangsphase? Kenne ich einen darauf<br />
spezialisierten Berater, der mir dabei<br />
helfen kann?<br />
Rechtlich<br />
Bei Nachfolgen sollten Sie stets einen<br />
fachkundigen Notar oder Rechtsanwalt<br />
einbeziehen, deshalb: Kenne ich einen<br />
Notar oder Rechtsanwalt, der mir dabei<br />
helfen kann?<br />
Steuerrechtlich<br />
Bei Nachfolgen sollten Sie stets ein<br />
fachkundigen Steuerberater einbeziehen,<br />
deshalb: Kenne ich einen Steuerberater,<br />
der mir dabei helfen kann?<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
48 | W+M RATGEBER<br />
Wärme aus<br />
Erneuerbaren Energien<br />
Die Energiewende im Unternehmen: Mit dem Einsatz Erneuerbarer<br />
Energien wie Photovoltaik, Biomasse oder Windkraft können<br />
Unternehmen ihre Energiekosten senken und sich von den<br />
Energiemärkten unabhängiger machen. Die KfW fördert solche<br />
Investitionen mit langfristigen und zinsgünstigen Krediten und<br />
Tilgungszuschüssen aus Mitteln des Bundesministeriums für<br />
Wirtschaft und Energie (BMWi). Von Matthias Salm<br />
Gerade bei der Prozesswärme bleiben<br />
in den Unternehmen bisher<br />
viele Einsparpotenziale ungenutzt.<br />
Denn laut Deutscher Energie-Agentur<br />
(dena) stellt die Prozesswärme, etwa zum<br />
Betrieb von Brennöfen und Trocknungsanlagen,<br />
einen Anteil von 57 Prozent am industriellen<br />
Gesamtendenergieverbrauch.<br />
Diese Wärme kann vermehrt auch<br />
aus Erneuerbaren Energien gewonnen<br />
werden.<br />
Die finanziellen Rahmenbedingungen für<br />
solche Investitionsvorhaben sind zudem gegenwärtig<br />
besonders günstig. Das BMWi<br />
unterstützt insbesondere den Umbau der<br />
innerbetrieblichen Wärmeerzeugung auf Erneuerbare<br />
Energien im Rahmen seines aktuellen<br />
Marktanreizprogramms. Zu diesen<br />
Anreizen zählen sowohl höhere Tilgungszuschüsse<br />
für kleine und mittelständische<br />
Unternehmen (KMU) bei einem Förderdarlehen<br />
als auch eine erweiterte Antragsberechtigung<br />
für größere Unternehmen.<br />
Als wesentliche Triebkraft für den Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energien zur Stromund<br />
Wärmeerzeugung fungieren die Förderdarlehen<br />
der KfW. Im Jahr 2013 wurden<br />
42,3 Prozent und im Jahr darauf 33,5<br />
Prozent aller in Deutschland getätigten Investitionen<br />
in diesem Bereich durch KfW-<br />
Programme mitfinanziert.<br />
Die KfW-Förderprogramme sind als Kombination<br />
aus zinsverbilligten Darlehen und<br />
Tilgungszuschüssen konzipiert. Bei einer<br />
im Unternehmen installierten Solarkollektoranlage<br />
etwa, die der Warmwasserbereitung,<br />
der Raumheizung oder der solaren<br />
Kälteerzeugung dienen, beträgt der<br />
Tilgungszuschuss bis zu 30 Prozent. Wird<br />
die Solaranlage zur Gewinnung von Prozesswärme<br />
eingesetzt, kann der Zuschuss<br />
sogar auf bis zu 50 Prozent aufgestockt<br />
werden. Bei Investitionen in große Biomasseanlagen<br />
oder Wärmepumpen gewährt<br />
die KfW Tilgungszuschüsse von<br />
bis zu 50.000 Euro je Einzelanlage beziehungsweise<br />
maximal 30 Prozent der<br />
förderfähigen Kosten.<br />
Im Wesentlichen bieten sich für Investitionen<br />
in die Einführung Erneuerbarer<br />
Energien im Unternehmen folgende Förderprodukte<br />
an:<br />
KfW-Programm Erneuerbare<br />
Energien Premium<br />
Das Programm zielt auf den Einsatz Erneuerbarer<br />
Energien im Wärmemarkt.<br />
Mögliche Investitionsmaßnahmen:<br />
Solarkollektoranlagen, Biomasseanlagen<br />
zur Verbrennung fester Biomasse für die<br />
Foto: BSW-Solar/Upmann<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
FINANZEN | 49<br />
Foto: KfW Bankengruppe/Heinrich Völkel, OSTKREUZ<br />
thermische Nutzung, Wärmenetze, Anlagen<br />
der Tiefengeothermie, Biosgasleitungen<br />
für unaufbereitetes Biogas sowie große<br />
Wärmespeicher und Wärmepumpen.<br />
Höchstbetrag:<br />
In der Regel reicht die KfW Darlehensbeträge<br />
von maximal zehn Millionen Euro<br />
pro Vorhaben aus.<br />
Konditionen:<br />
Bei Laufzeiten der Darlehen bis zu zwanzig<br />
Jahren können Zinsbindungen bis zu<br />
zehn Jahre vereinbart werden. Als besonders<br />
attraktiv für Unternehmen erweisen<br />
sich die Tilgungszuschüsse. Bei der größenabhängigen<br />
Förderung von Solarkollektoranlagen<br />
liegt ihre Höhe zwischen<br />
30 und 50 Prozent.<br />
Bei Biomasseanlagen sind maximal<br />
50.000 Euro je Einzelanlage als Tilgungszuschuss<br />
denkbar. Zusätzlich sieht das<br />
Programm noch weitere Boni, etwa für<br />
niedrige Staubemissionen, vor. Durch Addition<br />
von Grundförderung und Boni erhöht<br />
sich der Tilgungszuschuss im Idealfall<br />
auf bis zu 100.000 Euro. Bei Wärmenetzen<br />
beläuft sich der Zuschuss zur<br />
Tilgung auf 60 Euro je neu errichtetem<br />
Meter, höchstens jedoch auf eine Million<br />
Euro.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.kfw.de/271.<br />
KfW-Programm Erneuerbare<br />
Energien Standard<br />
Das Programm finanziert Vorhaben zur<br />
Nutzung Erneuerbarer Energien zur<br />
Stromerzeugung.<br />
Mögliche Investitionsmaßnahmen:<br />
Windkraft-, Photovoltaik- und Biogasanlagen<br />
zur Stromerzeugung sowie Batteriespeicher.<br />
Ebenso förderfähig ist die<br />
Strom- und Wärmeerzeugung in Kraft-<br />
Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen).<br />
Höchstbetrag:<br />
Maximal werden Darlehen bis zu 50 Millionen<br />
Euro vergeben.<br />
Konditionen:<br />
Es sind Zinsbindungen und Kreditlaufzeiten<br />
bis zu 20 Jahren möglich.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.kfw.de/270.<br />
Anträge auf eine Förderung aus der KfW-<br />
Programmfamilie Erneuerbare Energien<br />
sind vor Beginn des Vorhabens bei der<br />
Hausbank zu stellen, die diese an die KfW<br />
weiterreicht. <br />
W+M<br />
„Die Fördertöpfe sind gut gefüllt“<br />
Interview mit Mario Hattemer, Prokurist<br />
Gewerbliche Umweltschutzfinanzierung bei der KfW<br />
W+M: Herr Hattemer, 2015 förderte die<br />
KfW mit den KfW-Programmen Erneuerbare<br />
Energien Standard und Premium die<br />
Nutzung Erneuerbarer Energien mit 4,4<br />
Milliarden Euro. Wie können kleine und<br />
mittlere Unternehmen von dieser Förderung<br />
profitieren?<br />
Mario Hattemer: Der weitaus größte<br />
Teil dieser Förderung fließt in die Verstromung<br />
von Energie aus Windkraft und<br />
Photovoltaik. Hingegen ist das Potenzial<br />
Erneuerbarer Energien zur Deckung des<br />
Wärmebedarfs im Unternehmen vielfach<br />
noch nicht ausreichend ausgeschöpft.<br />
W+M: Für welche Unternehmen kommen<br />
solche Investitionen in Frage?<br />
Mario Hattemer: In zahlreichen Fertigungsbereichen<br />
in Industrie und Gewerbe<br />
wird Prozesswärme benötigt, beispielsweise<br />
in Lackierstationen in der Automobilindustrie.<br />
Aber mit Erneuerbaren Energien<br />
lassen sich auch Produktionshallen, Personal-<br />
oder Wirtschaftsgebäude beheizen.<br />
Anlagen zur Verfeuerung von fester Biomasse<br />
können beispielsweise in der holzverarbeitenden<br />
Industrie, in Schreinereien<br />
oder Sägewerken eingesetzt werden.<br />
W+M: Weshalb werden Erneuerbare<br />
Energien dann noch nicht ausreichend<br />
genutzt?<br />
Mario Hattemer.<br />
Mario Hattemer: Investitionen in Prozesswärmeanlagen<br />
oder betriebliche<br />
Wärmenetze sind zum Teil kostenintensiv,<br />
vor allem aber auch technologisch anspruchsvoll.<br />
Nicht zuletzt wegen dieser<br />
Hürden hat das Bundeswirtschaftsministerium<br />
die Förderbedingungen im Rahmen<br />
des Marktanreizprogramms weiter<br />
verbessert.<br />
W+M: Es lohnt sich also, gerade jetzt in<br />
Erneuerbare Energien zu investieren?<br />
Mario Hattemer: Die Fördertöpfe sind<br />
gut gefüllt. Zusätzlich zum niedrigen Zinsniveau<br />
und den langen Laufzeiten sind die<br />
aus Mitteln des BMWi finanzierten Tilgungszuschüsse<br />
besonders lohnenswert.<br />
<br />
<br />
Interview: Matthias Salm<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
50 | W+M RATGEBER INSOLVENZ<br />
Die Krise als<br />
Chance nutzen<br />
Die Insolvenz ist häufig mit einer persönlichen Krise verbunden.<br />
Der Ausgang eines Insolvenzverfahrens ist auch davon abhängig,<br />
ob und wie die persönliche Krise überwunden werden kann.<br />
Krisen mental gut zu überstehen, seien<br />
sie persönlicher, medizinischer,<br />
psychischer oder wirtschaftlicher<br />
Natur, ist nicht ganz einfach. Wer erfolgreich<br />
ist oder werden will, muss in der<br />
Lage sein, mit – teilweise auch schweren<br />
– Rückschlägen gekonnt umzugehen. Bei<br />
höheren Positionen in Wirtschaft und Politik<br />
wird ein professioneller Umgang mit<br />
schweren Niederlagen geradezu erwartet.<br />
So gehört es bei einem Spitzenpolitiker<br />
dazu, Wahlniederlagen wegzustecken und<br />
danach siegessicher wieder anzutreten.<br />
Der Vorstand eines größeren Unternehmens<br />
muss auch schwerste Zeiten überstehen.<br />
Glanzvolle Namen wie Volkswagen,<br />
Deutsche Bank, ThyssenKrupp und<br />
Lufthansa sind gute Beispiele. Erfolgreiche<br />
Menschen haben eins gemeinsam:<br />
Sie haben ein klares Ziel,<br />
verarbeiten eine Vielzahl<br />
von Rückschlägen,<br />
lassen sich<br />
nicht unterkriegen<br />
Dr. Florian Stapper,<br />
Fachanwalt für<br />
Insolvenz- und<br />
Steuerrecht und Inhaber<br />
von STAPPER Insolvenzund<br />
Zwangsverwaltung.<br />
und sind robust. Die psychische Widerstandskraft,<br />
oft auch als Resilienz bezeichnet,<br />
ist zum Teil genetisch veranlagt.<br />
Man kann sie aber auch lernen. Wer<br />
in welcher Krise auch immer steckt, sollte<br />
auf Folgendes achten:<br />
Persönliche Entwicklungen verlaufen<br />
in der Regel wellenartig<br />
Es gibt meist nur kurze Phasen, in denen<br />
man „ganz oben“ oder auch „ganz<br />
unten“ ist. Wer gerade „ganz unten“ ist,<br />
muss wissen, dass es jetzt nur noch aufwärts<br />
gehen kann. Je länger man „ganz<br />
unten“ ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass der Beginn des Aufstiegs<br />
unmittelbar bevorsteht. Allein diese<br />
Einstellung hilft oft weiter.<br />
Geteiltes Leid ist halbes Leid<br />
Wer ein Problem hat, sollte das nicht<br />
„in sich hineinfressen“, sondern<br />
Vertraute hinzuziehen. Häufig<br />
kommt dabei auch Hilfe von<br />
Personen, mit denen man<br />
gar nicht gerechnet hat.<br />
Wer keine solchen Bezugspersonen<br />
hat, kann<br />
nach dem Grundsatz leben:<br />
„Wenn mir keiner<br />
hilft, helfe ich mir selbst“.<br />
Das motiviert gelegentlich<br />
ganz besonders.<br />
Die Krise als Chance nutzen<br />
Krisen sind eine stetige Herausforderung.<br />
Sie können genutzt werden, um nach der<br />
Krise besser dazustehen als zuvor. Wer<br />
in einer persönlichen Krise steckt, etwa<br />
aufgrund einer Ehescheidung, nimmt sich<br />
beispielsweise vor, dass der nächste Lebenspartner<br />
besser zu einem passt. Wer<br />
ein medizinisches Problem hat, wird das<br />
nutzen, um gesünder zu leben und mehr<br />
Sport zu treiben. Wer wirtschaftlich einen<br />
„Durchhänger“ hat, kann daran arbeiten,<br />
sein Unternehmen neu aufzustellen.<br />
Ärgern ist Zeitverschwendung<br />
Wer in der Krise steckt, ist häufig von<br />
anderen schlecht behandelt worden.<br />
Es nützt in dieser Situation nichts, sich<br />
über die Vergangenheit oder unzuverlässige<br />
und unlautere Mitmenschen<br />
zu ärgern und darauf auch noch Energie<br />
zu verschwenden. Es geht einem<br />
nicht besser, wenn es anderen schlecht<br />
geht! Insofern sollte man seine gesamte<br />
Energie nur in sich selbst investieren<br />
und sich selbst wieder nach vorne<br />
bringen.<br />
Belohnung nicht vergessen<br />
Wer die Krise überstanden hat, belohnt<br />
sich selbst mit irgendetwas, was einem<br />
wichtig und wertvoll ist und feiert das<br />
Ende der Krise. Denn: Die nächste Krise<br />
steht schon vor der Tür und wartet auf<br />
eine gekonnte Lösung.<br />
Nur wer aufgibt, verliert<br />
Insofern wird nicht aufgegeben.<br />
W+M<br />
Foto: STAPPER (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
001_Titel_0315 1 23.04.2015 14:44:45<br />
Titel_WuM_0615.indd 1<br />
21.10.15 11:32 Uhr<br />
001_Titelentwürfe_WuM_0316 1 22.04.<strong>2016</strong> 09:00:36<br />
Titel_WuM_0415.indd 1<br />
18.06.15 13:16 Uhr<br />
Titelentwuerfe_WuM_0416.indd 1 15.06.16 13:51<br />
Titel_WuM_0515.indd 1 18.08.15 22:27<br />
W+M<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> 1-2/2015<br />
26. Jahrgang | Heft 3 | Mai/Juni 2015 | 5 | ZKZ 84618<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> 1-2/2015<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
26. Jahrgang | Heft 4 | Juli/August 2015 | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> 1-2/2015<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
26. Jahrgang 26. Jahrgang | Heft 5 | September/Oktober Heft 4 | Juli/August 2015 | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
BRANDENBURG<br />
ENERGIE<br />
ELEKTRISIERT<br />
MECKLENBURG-VORPOMMERN<br />
IM INTERVIEW<br />
Ministerpräsident<br />
Dietmar Woidke<br />
SACHSEN<br />
STUDIE<br />
IM INTERVIEW<br />
Ministerpräsident<br />
Erwin Sellering<br />
UNTERNEHMEN<br />
ORWO – eine<br />
Tradition lebt auf<br />
RATGEBER<br />
Tagungen und<br />
Geschäftsreisen<br />
Mittelstand im<br />
digitalen Wandel<br />
UMFRAGE<br />
Welches Auto<br />
passt zu Ihnen?<br />
Kraftakt<br />
Firmenübergabe<br />
EXKLUSIVE INTERVIEWS<br />
Bundeswirtschaftsminister<br />
Sigmar Gabriel<br />
Ministerpräsident<br />
Stanislaw Tillich<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> 1-2/2015<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
26. Jahrgang 26. | Jahrgang Heft 6 | November/Dezember | Heft 4 | Juli/August 2015 | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> 1-2/2015<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
27. Jahrgang 26. Jahrgang | Heft | Heft 1 | Januar/Februar 4 | Juli/August <strong>2016</strong> 2015 | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
27. Jahrgang | Heft 2 | März/April <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
DIE<br />
WIRTSCHAFT<br />
GRÜNT<br />
THÜRINGEN<br />
BERLIN<br />
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT<br />
EIN GESCHÄFT<br />
FÜR VIELE<br />
BRANCHEN<br />
OSTPRODUKTE<br />
DIE UNHEIMLICHE<br />
RENAISSANCE<br />
Motorenwerk Kölleda:<br />
Herz einer Region<br />
W+M<br />
mit<br />
Sachsen-Anhalt<br />
IM INTERVIEW<br />
WindNODE:<br />
Energie aus dem Norden<br />
Ministerpräsident<br />
Bodo Ramelow<br />
REPORT<br />
Rivalität auf<br />
der Ostsee<br />
RATGEBER<br />
Betriebliche<br />
Altersvorsorge<br />
IM INTERVIEW<br />
Berlins Regierender<br />
Michael Müller<br />
REPORT<br />
Eberswalder<br />
Metall-Gen<br />
RATGEBER<br />
Gutschein<br />
statt Geld<br />
Bilanz vor der Wahl:<br />
Reiner Haseloff<br />
Davos in Bad Saarow:<br />
Ostdeutsches Wirtschaftsforum<br />
Management:<br />
Der Honecker-Effekt<br />
Travel:<br />
Tipps für Geschäftsreisen<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
27. Jahrgang | Heft 3 | Mai/Juni <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />
Beilage<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
FERIEN DAHEIM<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
TOURISMUS<br />
Wie der neue Trend<br />
den Osten stärkt<br />
LÄNDERREPORTS<br />
100 Jahre Leuna<br />
Profisport im Osten<br />
RATGEBER<br />
Investieren im Iran<br />
Gesundes Arbeiten im Büro<br />
Mutig in der Insolvenz<br />
LIFESTYLE<br />
Edle Uhren-Neuheiten<br />
Logieren in Schlosshotels<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
27. Jahrgang | Heft 4 | Juli/August <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
WIRTSCHAFT+<br />
MARKT<br />
27. Jahrgang | Heft 5 | September/Oktober <strong>2016</strong> | 5 | ZKZ 84618<br />
DAS OSTDEUTSCHE UNTERNEHMERMAGAZIN<br />
BRÜSSELER SEGEN<br />
WIE DER OSTEN VON<br />
EU-GELDERN PROFITIERT<br />
LÄNDERREPORT<br />
Schwerin dockt an<br />
Hamburg an<br />
Flughäfen am Tropf<br />
der öffentlichen Hand<br />
RATGEBER<br />
So gelingt die<br />
Unternehmensnachfolge<br />
Kassenführung im<br />
Visier der Finanzämter<br />
BEILAGE<br />
Sachsen<br />
BEIL AGE<br />
INTERVIEWS<br />
Christian Pegel, Erwin Sellering und Gerold Jürgens,<br />
Tillmann Stenger, Peter-Michael Diestel, Reinhard Pätz<br />
Brandenburg<br />
TILLICH & WOIDKE IM INTERVIEW<br />
Zwei Lausitzer, zwei Landesväter,<br />
zwei Parteien, zwei Freunde<br />
Sichern Sie sich Ihr Abo! www.WundM.info
52 | W+M RATGEBER STEUERN<br />
Im Visier der<br />
Finanzverwaltung<br />
Unternehmen in bargeldintensiven Branchen rücken durch<br />
verschärfte Aufzeichnungspflichten für digitale Kassendaten ab 2017<br />
weiter in den Fokus der Betriebsprüfung.<br />
Diese gelten nicht erst ab dem 1. Januar<br />
2017, die entsprechenden<br />
Schreiben des Bundesfinanzministeriums<br />
(BMF) datieren bereits vom 1. Januar<br />
2002 beziehungsweise 26. November<br />
2010, der sogenannten letzten „Kassenrichtlinie“<br />
des BMF. Die dort getroffenen<br />
Aussagen werden durch die neuen,<br />
sogenannten „Grundsätze zur ordnungsmäßigen<br />
Führung und Aufbewahrung von<br />
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen<br />
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“<br />
(GoBD) zusätzlich bekräftigt. Die<br />
erste Kassenrichtlinie geht zurück auf<br />
das Jahr 1996. Danach sollte bei elektronischen<br />
Registrierkassensystemen die<br />
Aufbewahrung der Kassenstreifen (und<br />
damit die Einhaltung der Einzelaufzeichnungspflicht<br />
insgesamt) verzichtbar sein,<br />
wenn der Steuerpflichtige die folgenden<br />
Belege verwahrt: vollständige Tagessummen-Bons<br />
(Z-Bons), die von der Kasse gegebenenfalls<br />
erstellten Aufrechnungen sowie<br />
die zur Kasse gehörenden Organisationsunterlagen.<br />
Von Sebastian Wisch<br />
der Streit mit dem Betriebsprüfer bereits<br />
ab dem Jahr 2011 vorprogrammiert.<br />
Ab Januar 2017 soll nach Vorstellung des<br />
BMF uneingeschränkt der Grundsatz der<br />
Einzelaufzeichnungspflicht durchgesetzt<br />
werden. Dies bedeutet, dass ab dem<br />
nächsten Jahr nur noch Kassensysteme<br />
mit einem angeschlossenen Datenbankoder<br />
Archivsystem benutzt werden dürfen.<br />
Wer diesen technischen Standard nicht erfüllt,<br />
läuft Gefahr, dass seine Buchführung<br />
in der Außenprüfung verworfen wird und<br />
Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden,<br />
was gegebenenfalls erhebliche Steuernachforderungen<br />
nach sich ziehen kann.<br />
Es gilt, das eigene Kassensystem umgehend<br />
zu analysieren, Schwachpunkte aufzudecken<br />
und einen Maßnahmenkatalog<br />
zu entwickeln, um Mängel in Systemen<br />
zu beseitigen. Daran anknüpfend ist von<br />
Bedeutung, die von der Finanzverwaltung<br />
geforderte Verfahrensdokumentation rund<br />
um die Abwicklung und Aufzeichnung der<br />
Bargeschäfte im Unternehmen zu erstellen.<br />
Diese sollten Sie zusammen mit den digitalen<br />
Kassendaten gemäß dem gesetzlichen<br />
Aufbewahrungszeitraum von zehn Jahren<br />
auf zuverlässigen Datenspeichersystemen<br />
zur Verfügung zu haben, so dass die Möglichkeit<br />
besteht, die Daten im Rahmen einer<br />
steuerlichen Außenprüfung kurzfristig<br />
lesbar und auswertbar zu machen.<br />
Der Bundesfinanzhof hat in einer Entscheidung<br />
vom 16. Dezember 2014 unternehmerfreundlich<br />
den Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht<br />
hervorgehoben, allerdings<br />
entgegen der Vorstellung der Finanzverwaltung<br />
eine bestimmte Form der<br />
Kassenführung nicht vorgeschrieben.<br />
Aus unternehmerisch-kaufmännischer Sicht<br />
wäre es sicherlich ratsam, sich in Bezug auf<br />
das Kassensystem moderner elektronischer<br />
Medien zu bedienen, welche zwei Fliegen<br />
mit einer Klappe schlagen. Zum einen sollten<br />
die strengen Aufzeichnungspflichten der<br />
Finanzverwaltung erfüllt werden und zum<br />
anderen die verwendeten Medien einen wesentlichen<br />
Beitrag zum Informationssystem<br />
des Unternehmens in Bezug auf Bargeldvorgänge<br />
bieten können.<br />
Die Übergangsfrist zur Anwendung dieser<br />
Regelungen läuft am 31. Dezember dieses<br />
Jahres endgültig aus. Sie galt dabei nur für<br />
solche Unternehmen, deren Kassensystem<br />
nicht mechanisch oder in Bezug auf<br />
die Software aufgerüstet werden konnten.<br />
Alle anderen Systeme unterliegen<br />
bereits seit den Jahren 2001 beziehungsweise<br />
2010 den verschärften Vorschriften<br />
des BMF. Allerdings ist dies in vielen Branchen<br />
bisher völlig unbekannt und fand bis<br />
dato zu wenig Berücksichtigung. In Unternehmen,<br />
die eine technisch mögliche<br />
Softwareanpassung sowie Speichererweiterungen<br />
nicht durchgeführt haben, ist<br />
Sebastian Wisch ist Steuerberater und<br />
Geschäftsführer der AUDITA Dr. Feske Zauft<br />
& Wisch GmbH Wirtschaftsprüfungs- und<br />
Steuerberatungsgesellschaft in Berlin<br />
Der einzelne Geschäftsvorfall an der Kasse<br />
lässt sich aus Sicht des Verfassers als<br />
wertvoller Datensatz für die gesamte Unternehmenssteuerung<br />
nutzen. Bei konkreter<br />
Analyse der einzelnen verkauften Artikel<br />
kann dies fundamental zur Sortimentssteuerung<br />
verwendet werden, ebenso verknüpft<br />
mit gleichzeitigen Verbrauchsmeldungen an<br />
Lager und gekoppelt an automatisches Bestellwesen<br />
sowie ABC-Analysen und Deckungsbeitragskalkulationen<br />
sollte man diese<br />
Informationsquelle insgesamt nicht unterschätzen.<br />
Die Ordnungsmäßigkeit für die<br />
Finanzverwaltung erscheint dann nur noch<br />
wie ein Nebenprodukt.<br />
W+M<br />
Foto: Audita (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
RATGEBER RECHT | 53<br />
Foto: AllebaziB/fotolia.com, Quelle: www.kostenlose-urteile.de<br />
Urteile für<br />
Unternehmer<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> hat wichtige Urteile<br />
für Sie zusammengestellt<br />
Mindestlohn<br />
Arbeitgeber dürfen Sonderzahlungen<br />
auf Mindestlohn anrechnen<br />
Bisher gewährte Sonderzahlungen wie<br />
Urlaubs- und Weihnachtsgeld können in<br />
bestimmten Fällen vom Arbeitgeber auf<br />
den gesetzlichen Mindestlohn angerechnet<br />
werden, um die gesetzliche Lohnuntergrenze<br />
von 8,50 Euro pro Stunde zu<br />
erreichen. Das entschied das Bundesarbeitsgericht<br />
(BAG).<br />
Der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen<br />
Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete<br />
Arbeitsstunde. Er erfüllt den Anspruch<br />
durch die als Gegenleistung für<br />
Arbeit erbrachten Entgeltzahlungen, soweit<br />
diese dem Arbeitnehmer endgültig<br />
verbleiben. Die Erfüllungswirkung fehlt<br />
nur solchen Zahlungen, die der Arbeitgeber<br />
ohne Rücksicht auf tatsächliche Arbeitsleistung<br />
des Arbeitnehmers erbringt<br />
oder die auf einer besonderen gesetzlichen<br />
Zweckbestimmung beruhen.<br />
Im vorliegenden Fall wurde dem Kläger<br />
das Urlaubs- und Weihnachtsgeld in<br />
zwölf Teilen monatlich neben dem Gehalt<br />
ausgezahlt. Der Kläger wollte erreichen,<br />
dass sein Monatsgehalt und die Jahressonderzahlungen<br />
ebenso wie die vertraglich<br />
zugesagten Zuschläge für Mehr-,<br />
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf<br />
Basis des gesetzlichen Mindestlohns in<br />
Höhe von 8,50 Euro brutto pro Stunde<br />
gezahlt werden. Das BAG entschied nun,<br />
dass der Kläger aufgrund des Mindestlohngesetzes<br />
keinen Anspruch auf erhöhtes<br />
Monatsgehalt, erhöhte Jahressonderzahlungen<br />
sowie erhöhte Lohnzuschläge<br />
hat. Der gesetzliche Mindestlohn tritt als<br />
eigenständiger Anspruch neben die bisherigen<br />
Anspruchsgrundlagen, verändert<br />
diese aber nicht. Der nach den tatsächlich<br />
geleisteten Arbeitsstunden bemessene<br />
Mindestlohnanspruch des Klägers<br />
sei erfüllt worden, denn auch den vorbehaltlos<br />
und unwiderruflich in jedem Kalendermonat<br />
geleisteten Jahressonderzahlungen<br />
kommt Erfüllungswirkung zu.<br />
BAG, 5 AZR 135/16<br />
Datenschutz<br />
Kein Schadensersatz bei Videoüberwachung<br />
nach Sabotage<br />
Ein Arbeitgeber, der Produktionsräume<br />
zwei Monate lang per Video überwachen<br />
lässt, ohne die Mitarbeiter hierüber zu informieren,<br />
weil es zuvor zu Sabotageakten<br />
bei der Produktion gekommen war,<br />
schuldet den Mitarbeitern nicht zwangsläufig<br />
Schadensersatz wegen einer Persönlichkeitsverletzung.<br />
Dies geht aus einer Entscheidung des<br />
Landesarbeitsgerichts (LAG) Sachsen-Anhalt<br />
hervor. Nach dem Datenschutzgesetz<br />
ist die Installation einer Videoanlage zwar<br />
verboten, gleichwohl besteht in dieser Situation<br />
für den Arbeitgeber ein nachvollziehbarer<br />
Anlass, diese Maßnahme zu ergreifen.<br />
Das Gericht wies die Schadensersatzklage<br />
des Mitarbeiters ab. Die Überwachung<br />
hat sich auf einen relativ kurzen<br />
Zeitraum des Arbeitsverhältnisses (zwei<br />
Monate) bezogen. Weiter beschränkte<br />
sich die Videoüberwachung auf den Produktionsbereich.<br />
Eine Beobachtung des<br />
Klägers in Bereichen, in denen seine Privatsphäre<br />
hätte tangiert sein können, zum<br />
Beispiel Umkleideräume oder Pausenräume,<br />
hat nicht stattgefunden. Die Beobachtung<br />
hat sich auch nicht gezielt gegen den<br />
Kläger gerichtet, sondern erstreckte sich<br />
auf den gesamten Produktionsbereich des<br />
Unternehmens. Der Mitarbeiter stand mithin<br />
nicht im Fokus der Beobachtung.<br />
LAG Sachsen-Anhalt, 6 Sa 301/14<br />
AGB<br />
Klausel zur Haftungsbeschränkung<br />
muss verständlich sein<br />
Das Amtsgericht (AG) München hat entschieden,<br />
dass eine Haftungsbeschränkung<br />
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
(AGB) auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit<br />
dann unwirksam ist, wenn die Klausel<br />
unverständlich ist.<br />
Der Kläger des zugrunde liegenden Streitfalls<br />
ist Mitglied in einem Verein zur Wahrnehmung<br />
und Förderung der Interessen<br />
des Kraftfahrzeugwesens. Der Mitgliedsvertrag<br />
beinhaltet die Verpflichtung zur<br />
Pannen- und Unfallhilfe, um die Fahrbereitschaft<br />
des Fahrzeugs herzustellen. In<br />
den allgemeinen Vertragsbedingungen<br />
des Vereins findet sich eine Klausel, die die<br />
Haftung des Vereins auf grob fahrlässiges<br />
oder vorsätzliches Verhalten beschränkt.<br />
Beim Versuch, das Auto des Klägers durch<br />
einen Pannenhelfer zu öffnen, ging die<br />
Windschutzscheibe zu Bruch. Der Kläger<br />
lies diese austauschen und verlangte<br />
den Schaden vom Verein ersetzt. Dieser<br />
berief sich auf seine vertraglichen Haftungsbeschränkungen<br />
und verweigerte<br />
die Zahlung. Die Klausel der Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen, die die Haftung<br />
des Vereins auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches<br />
Verhalten beschränkt, ist nach<br />
Auffassung des Gerichts aber unwirksam.<br />
Denn es sei laut Gericht für einen<br />
typischen Verbraucher nicht hinreichend<br />
verständlich, was die Haftungsbeschränkung<br />
umfasst, weil der Begriff „wesentliche<br />
Hauptpflichten” zu vage ist und weder<br />
durch eine abstrakte Erklärung noch durch<br />
Regelbeispiele näher erläutert werde.<br />
AG München, 274 C 24303/15<br />
W+M<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
54 | W+M RATGEBER<br />
Latte Macchiato<br />
im Büro<br />
Wer heute seinen Gästen nur noch den klassischen Filterkaffee<br />
anbieten kann, ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Moderne<br />
Kaffeevollautomaten bieten bei einfacher Bedienung verschiedene<br />
Kaffeespezialitäten. Zwölf Kaffeevollautomaten für circa 15<br />
Mitarbeiter im Vergleich.<br />
Promesso,<br />
Jacobs Douwe Egberts<br />
Carimali BlueDot,<br />
Coffema<br />
1200 S,<br />
WMF<br />
Coffee Soul,<br />
Schaerer<br />
Kaffeevollautomaten haben den Kaffeegenuss<br />
sichtlich verändert. Moderne<br />
Maschinen bieten statt des<br />
typischen Filterkaffees heute mehrere<br />
unterschiedliche Kaffeespezialitäten an.<br />
Dazu lassen sie sich leicht bedienen und<br />
auch immer einfacher pflegen. Alle Automaten<br />
im W+M-Vergleich verfügen<br />
über automatische Reinigungsprogramme,<br />
die Kaffeestärke ist bei allen einstellbar<br />
und alle Geräte verfügen zudem über<br />
einen Heißwasserbezug für Tee. Die Anzahl<br />
der möglichen Getränke schwankt<br />
jedoch bei den verschiedenen Herstellern<br />
mitunter beträchtlich. Dies liegt daran,<br />
dass jeder Hersteller anders zählt:<br />
„Kaffee groß“ und „Kaffee klein“ werden<br />
einmal als ein Getränk gezählt und<br />
mal als zwei. Oder verfügbare Getränke<br />
werden mal mit der einstellbaren Kaffeestärke<br />
multipliziert und mal nicht.<br />
Bis auf die Promesso von Jacobs Douwe<br />
Egberts, die über ein eigenes Kaffee-Pak-<br />
System verfügt, verwenden alle Maschinen<br />
im Vergleich ganze Bohnen. DeLonghi<br />
und Severin werben dabei mit ihren<br />
extra leisen Kegelmahlwerken und auch<br />
Franke weißt auf seine zwei geräuscharmen<br />
Präzisionskaffeemühlen mit Keramikscheiben<br />
hin. Das ist immer dann von besonderer<br />
Bedeutung, wenn die Kaffeemaschine<br />
in unmittelbarer Arbeitsplatznähe<br />
steht. Während die A200 von Franke optional<br />
auch mit Kapseln genutzt werden<br />
kann, bieten die Automaten von DeLonghi,<br />
JURA und Krups die Möglichkeit, auch Kaf-<br />
Cafina XT5,<br />
Melitta<br />
Hersteller Coffema DeLonghi Franke Coffee<br />
Systems<br />
Jacobs Douwe<br />
Egberts<br />
JURA<br />
Kaffee Partner<br />
Modell Carimali BlueDot Autentica Plus A200 Promesso WE8 Crema Duo<br />
Tassen pro Tag¹ 80 k. A. 80 40-150 30 60<br />
Kaffeespezialitäten² 18 k. A. 36 8 12 12<br />
Wassertank 4 l 1,3 l 4 l 2,2 l 3 l 5 l<br />
Preis ab 4.800 € ab 699 € ab 5.593 € ab 2.749 € ab 1.695 € ab 19 Cent pro Tasse<br />
Maße (H x B x T) in mm 585 x 368 x 550 325 x 195 x 473 604 x 340 x 560 480 x 450 x 430 419 x 295 x 444 570 x 346 x 518<br />
Web www.coffema.de www.delonghi.com www.franke.com www.promesso.de www.juragastroworld.de www.kaffee-partner.de<br />
¹ Anzahl der empfohlenen Tassenbezüge pro Tag ² Anzahl der möglichen unterschiedlichen Kaffeespezialitäten<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
BÜRO | 55<br />
A200, Franke Coffee Systems<br />
Saeco Incanto Deluxe HD 8921/01, Philips<br />
Autentica Plus, DeLonghi<br />
feepulver zu verwenden. Für alle, die es<br />
gern süß mögen, besitzen die Modelle<br />
von Franke, Melitta, Philips, Schaerer<br />
und WMF zusätzlich einen Behälter<br />
für Schoko-, Vanille- oder Toppingpulver.<br />
Die Severin KV 8090 ist mit 18<br />
Zentimetern die schmalste der vorgestellten<br />
Maschinen.<br />
Crema Duo, Kaffee Partner<br />
Für die Coffee Soul hebt Schaerer ein<br />
besonderes Feature hervor: Um alle relevanten<br />
Daten rund um Maschinenzustand,<br />
Bevorratung, Getränkestatistik,<br />
Extraktionszeiten und Anderes auswerten<br />
zu können, lässt sich die Coffee Soul<br />
mit der Schaerer-eigenen Telemetrie-Lösung<br />
M2M Coffee Link ausstatten. Sie<br />
liefert in Echtzeit Informationen und unterstützt<br />
den Betreiber, Angebote anzupassen,<br />
rechtzeitig aufzufüllen oder Service-<br />
beziehungsweise Wartungsprozesse<br />
anzustoßen. Die Crema Duo von<br />
Kaffee Partner wurde mit dem Red-Dot-<br />
Design-Award für das „Beste Produktdesign<br />
<strong>2016</strong>“ ausgezeichnet. Den Award<br />
„Best of the Best <strong>2016</strong>“ erhielt dagegen<br />
die Promesso von Jacobs Douwe<br />
Egberts.<br />
W+M<br />
KV 8090, Severin<br />
WE8, JURA<br />
EA 9010, Krups<br />
Krups Melitta Philips Schaerer Severin WMF<br />
EA 9010 Cafina XT5 Saeco Incanto Deluxe HD 8921/01 Coffee Soul KV 8090 1200 S<br />
k. A. 150 k. A. 180 k. A. bis 100<br />
17 128 6 mehr als 200 5 10<br />
1,7 l 20 l 1,8 l kein Tank, nur Festwasseranschluss 1,1 l 4 l<br />
ab 1.599,99 € ab 6.470 € ab 799,99 € ab 9.750 € ab 549 € ab 3.685 €<br />
585 x 400 x 575 715 x 300 x 580 330 x 215 x 429 716 x 330 x 595 395 x 180 x 315 682 x 324 x 553<br />
www.krups.de www.melitta-professional.de www.philips.de www.schaerer.com www.severin.de www.wmf-kaffeemaschinen.de<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
56 | W+M RATGEBER LITERATUR<br />
Wirtschaftsliteratur<br />
Die ostdeutsche<br />
Bestsellerliste<br />
1<br />
2<br />
6<br />
7<br />
5<br />
8<br />
4<br />
9<br />
3<br />
10<br />
Die ostdeutsche Bestsellerliste für<br />
Wirtschaftsliteratur wird exklusiv von<br />
W+M aus den Verkaufszahlen großer<br />
Buchhandlungen in Brandenburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,<br />
Sachsen-Anhalt und Thüringen erstellt.<br />
Beteiligt haben sich:<br />
• Hugendubel Cottbus,<br />
Mauerstraße 8, 03046 Cottbus<br />
• Hugendubel Erfurt,<br />
Anger 62, 99084 Erfurt<br />
• Hugendubel Greifswald,<br />
Markt 20–21, 17489 Greifswald<br />
• Hugendubel Leipzig,<br />
Petersstraße 12–14, 04109 Leipzig<br />
• Hugendubel Potsdam,<br />
Stern-Center 1, 14480 Potsdam<br />
• Hugendubel Schwerin,<br />
Marienplatz 3, 19053 Schwerin<br />
• Ulrich-von-Hutten-Buchhandlung,<br />
Logenstraße 8, 15230 Frankfurt/Oder<br />
Die Teilnahme steht weiteren Buchhandlungen<br />
jederzeit offen. Schreiben Sie bei<br />
Interesse eine E-Mail an JP@WundM.info.<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
NETZWERK GESELLSCHAFT | 57<br />
UV-Rostock-Geschäftsführerin Manuela Balan (M.) mit den Referenten des Forums.<br />
16. Hanse Sail Business Forum<br />
Wirtschaftsfaktor Bundeswehr<br />
Die Bundeswehr ist ein wichtiger<br />
Wirtschaftsfaktor in der Region“<br />
war Fazit des 16. Hanse Sail<br />
Business Forums vom Unternehmerverband<br />
Rostock-Mittleres Mecklenburg, der<br />
Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern,<br />
der Industrie- und Handelskammer<br />
zu Rostock und dem enterprise<br />
europe network. Etwa 200 Teilnehmer aus<br />
Wirtschaft und Politik folgten am 11. August<br />
der Einladung des Initiativkreises der<br />
Wirtschaft. IHK-Hauptgeschäftsführer und<br />
Moderator der Veranstaltung Jens Rademacher<br />
betonte: „Pro Jahr beenden 600<br />
bis 800 Menschen in hiesigen Dienststellen<br />
der Bundeswehr ihren militärischen<br />
Dienst. Unser Bestreben muss sein, das<br />
Potenzial dieser hervorragend ausgebildeten<br />
Personen für die Wirtschaft<br />
zu nutzen.“ Auch im Rahmen der Vorträge<br />
der Referenten wurde deutlich,<br />
dass die in Mecklenburg-Vorpommern<br />
angesiedelten Bundeswehrstandorte<br />
generell einen nicht zu<br />
unterschätzenden Wirtschaftsfaktor<br />
darstellen.<br />
W+M<br />
Sylvia Sapich, Angelika Kleinfeldt und<br />
Doris Kleinfeldt (v. l.) im Gespräch.<br />
Gute Stimmung im Publikum.<br />
Fotos: Angelika Heim<br />
Vertreter des Marinekommandos Rostock<br />
nutzen die Gelegenheit zum Kontakt mit<br />
Unternehmern.<br />
Etwa 200 Teilnehmer folgten der Einladung zum 16. Hanse Sail Business Forum.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
58 | W+M NETZWERK<br />
Rund 3.000 Gäste waren der Einladung<br />
zum Brandenburger Sommerabend gefolgt.<br />
Effektvoll umrahmte Gastgeber: Thomas Kralinski, Dietmar Woidke und Miloš Stefanović (v. l.).<br />
Brandenburgischer Sommerabend <strong>2016</strong><br />
Sommernachtstraum<br />
am Tiefen See<br />
Ein farbenfroher Hingucker: die Beelitzer<br />
Spargelkönigin Sarah Wladasch.<br />
Einen Sommernachtstraum erlebten<br />
rund 3.000 Gäste beim traditionellen<br />
Brandenburgischen Sommerabend<br />
im Potsdamer Erlebnisquartier Schiffbauergasse<br />
am Ufer des Tiefen Sees. Die Gastgeber<br />
Brandenburgs Ministerpräsident Dr.<br />
Dietmar Woidke, der Bevollmächtigte beim<br />
Bund und Staatssekretär Thomas Kralinski<br />
sowie der Präsident des WirtschaftsForum<br />
Brandenburg Dr. Miloš Stefanović begrüßten<br />
die Gäste aus Politik, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft der Metropolregion Berlin-<br />
Brandenburg, darunter Bandenburgs Landtagspräsidentin<br />
Britta Stark und zahlreiche<br />
Abgeordnete, Botschafter und Gesandte<br />
mehrerer Staaten sowie Bürger, die sich in<br />
Ehrenämtern engagieren. Der Ministerpräsident<br />
nahm die Begrüßung zu dem festlichen<br />
Abend zum Anlass, die märkischen Teilnehmer<br />
an den Olympischen Spielen in Rio zu<br />
verabschieden. Dabei waren unter anderen<br />
die Kanuten Sebastian Brendel und Franziska<br />
Weber, Judoka Mareen Kräh sowie Christian<br />
Zille kens (Moderner Fünfkampf). W+M<br />
Brandenburgs Ministerpräsident<br />
Dietmar Woidke (l.) ehrte Jibran Khalil<br />
für sein Engagement für Flüchtlinge.<br />
Ein prachtvolles<br />
Feuerwerk<br />
krönte den<br />
Sommerabend<br />
in Potsdam.<br />
Die Konditorei-<br />
Azubis Alyssa<br />
Laack (l.) und<br />
Jenny Wolf<br />
zauberten<br />
vor Ort süße<br />
Köstlichkeiten.<br />
Fotos: CHL Photodesign Christian Lietzmann<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
GESELLSCHAFT | 59<br />
Das PORTA-Möbelhaus in Potsdam.<br />
Dr. Miloš Stefanović (r.), Präsident des WirtschaftsForums, mit seinen Gästen Kurt Jox,<br />
Frank Matthus und Christian Görke (v.l.).<br />
WirtschaftsForum Brandenburg<br />
Im Spannungsbogen von Politik,<br />
Wirtschaft und Kunst<br />
PORTA-Chef Kurt Jox beeindruckte die<br />
Zuhörer mit Klartext.<br />
Fotos: G. Reiche/WirtschaftsForum Brandenburg<br />
Die Organisatoren des Wirtschafts-<br />
Forums Brandenburg hatten sich<br />
mal wieder einen interessanten<br />
Themenmix ausgesucht und gleich noch<br />
den klassischen Veranstaltungsort im Dorint-Hotel<br />
mit dem PORTA-Möbelhaus in<br />
Potsdam getauscht.<br />
Der Brandenburger Finanzminister Christian<br />
Görke (Die LINKE) schaffte es in 20<br />
Minuten, die aktuelle Finanzlage des Landes<br />
anschaulich darzustellen und gleichzeitig<br />
noch auf Themen wie beispielsweise<br />
den Brexit einzugehen. Hausherr Kurt<br />
Jox, Geschäftsführer der PORTA Möbel<br />
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, ermunterte<br />
nicht nur zum verstärkten Küchenkauf,<br />
sondern erläuterte auch den<br />
komplizierten Möbelmarkt und die Rolle<br />
von PORTA. Außergewöhnlich in dieser<br />
Runde: der Künstlerische Leiter der<br />
Kammeroper Schloss Rheinsberg Frank<br />
Matthus, welcher für den Kulturstandort<br />
im Norden Brandenburgs warb. W+M<br />
Das PORTA-Restaurant<br />
überraschte mit leckeren Speisen.<br />
Der breite Themenmix des Abends<br />
bot eine Fülle an Diskussionsstoff.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
60 | W+M NETZWERK<br />
Wiederauferstehung einer<br />
Traditionsmarke<br />
Wird ab 2017 in China produziert: Borgward BX7.<br />
Wieviel Borgward aus der Ära der Isabella ist noch im neuen<br />
Borgward drin? Geht es nur um den prestigeträchtigen Markennamen<br />
oder steckt solides Know-how aus dem ehemaligen Bremer Werk<br />
oder aus Deutschland dahinter? Von Rudolf Miethig (VBIW)<br />
Stuttgart. 1954 tauchte die schlanke,<br />
elegante Borgward Isabella auf den Straßen<br />
auf. Ihre aus Amerika übernommene<br />
Pontonform war hier ein Novum. Borgward<br />
war Ende der 1950er-Jahre Deutschlands<br />
fünftgrößter Autohersteller. Doch 1961<br />
war Schluss, dem Ingenieur und Alleinunternehmer<br />
Carl Friedrich Wilhelm Borgward<br />
war das Geld ausgegangen. Offenbar<br />
war es die beispiellose Modellvielfalt, die<br />
Borgward in den Konkurs getrieben hatte.<br />
Auf dem Genfer Autosalon taucht 2015<br />
wieder eine Firma mit dem Namen Borgward<br />
auf. Sie will ab 2017 einen SUV in<br />
China produzieren. Den Fehler des Großvaters<br />
wolle der Enkel und Präsident der<br />
neuen Gesellschaft nicht mehr machen.<br />
Statt vieler, zum Teil schwer verkäuflicher<br />
Modelle wird er die Produktion mit<br />
einem SUV starten, dem BX7. Der war<br />
zwar in Genf noch nicht ausgestellt, dafür<br />
zeigte Borgward zunächst einen Veteranen,<br />
das Isabella-Coupé. Der BX7 feierte<br />
dann auf der IAA in Frankfurt am Main<br />
Premiere.<br />
Die Borgward Isabella wurde<br />
von 1954 bis 1961 produziert.<br />
Im Arbeitskreis Verkehrswesen des VBIW<br />
fragte man sich, wieviel Borgward der<br />
fünfziger Jahre – abgesehen vom Markennamen<br />
– noch im neuen Borgward steckt,<br />
also zum Beispiel welche kon struktiven<br />
oder Design-Merkmale überlebt haben.<br />
Der Markenname gehört jetzt der Firma<br />
Foton bei Peking. Foton ist auch der Mehrheits-<br />
oder Alleineigner der BORGWARD<br />
Group AG in Stuttgart. Die Technik des<br />
BX7 soll aber deutsch sein, versichert<br />
der Borgward-Enkel Christian Borgward.<br />
Design und Entwicklung stammen aus<br />
deutschen Ingenieurbüros. Und dann gibt<br />
es über Christian Borgward die personelle<br />
Verbindung zum ehemaligen Unternehmen.<br />
Er ist zwar nicht Ingenieur, wie es<br />
der Großvater war, aber hoffentlich<br />
ein guter Unternehmer, jedenfalls<br />
sei er jetzt Autobauer,<br />
arbeitet er doch seit zehn Jahren<br />
leidenschaftlich an der Wiederbelebung<br />
der Firma. Andere Parallelen zum<br />
alten Unternehmen wirken eher bemüht,<br />
wie der Hinweis von Chefdesigner Benjamin<br />
Nawka auf die markante Schulterlinie<br />
des BX7, wie sie von der Isabella bekannt<br />
sei. Für die Mitglieder des Arbeitskreises<br />
sieht der neue Borgward aus wie<br />
viele andere SUV – durchaus gelungen, er<br />
gewann ja auch die renommierte Designauszeichnung<br />
Red-Dot-Award, aber er erinnert<br />
nicht direkt an die Autos von Borgward.<br />
Muss aber auch nicht sein.<br />
Am Ende scheint es nicht unmöglich, dass<br />
die Wiederbelebung der Marke Borgward<br />
gelingt, zumal China ein wachsender Absatzmarkt<br />
ist, auf dem deutsches Engineering<br />
hoch geschätzt wird. In Deutschland<br />
will Borgward ein Montagewerk auf Basis<br />
importierter Komponenten errichten. W+M<br />
Fotos: Creative Commons/Spielvogel (oben), Creative Commons/Lothar Spurzem (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
VBIW | 61<br />
VBIW-Sonderpreise für „Jugend forscht“<br />
Wildau/Brandenburg/Schwarzheide.<br />
Am Wettbewerb „Jugend forscht“, der<br />
im Frühjahr endete, wirkten auch wieder<br />
VBIW-Juroren mit. Zudem spendete der<br />
Verein – wie in den Vorjahren auch – eigene<br />
Sonderpreise.<br />
Auf dem Regionalwettbewerb Brandenburg<br />
Ost erhielt der 18-jährige Patrick Langer den<br />
VBIW-Sonderpreis. Er entwickelte ein Gerät,<br />
das über Elektroden auf der Haut Signale<br />
abgreifen, filtern und an einen Computer<br />
übertragen kann. Kleinste Muskelanspannungen<br />
können so in feinmotorische Bewegungen<br />
einer Prothese gewandelt werden.<br />
Auf dem Regionalwettbewerb Brandenburg<br />
West erhielten Tilman Tschirner, Jeromé<br />
Gonschorek und Lisa Gründer einen<br />
VBIW-Sonderpreis. Sie schufen einen „Digitalen<br />
Polychromator“, ganz ohne bewegte<br />
Teile, der beliebige Farbwerte erzeugen<br />
kann, ein seit Langem von der optischen<br />
Industrie verfolgtes Entwicklungsziel.<br />
Der Erhöhung der Verkehrssicherheit haben<br />
sich zwei Azubis von der Heidelberger<br />
Druckmaschinen AG in Brandenburg an<br />
der Havel verschrieben. Bastian Nischan<br />
und Maximilian Gudat griffen das Problem<br />
der Blendung durch Scheinwerfer<br />
auf. Sie schlugen vor, dass bei Stillstand<br />
eines Fahrzeugs automatisch nach fünf<br />
Sekunden das Standlicht und bei Weiterfahrt<br />
das Abblendlicht eingeschaltet wird.<br />
Dieses Projekt wurde zum Landeswettbewerb<br />
mit dem VBIW-Sonderpreis ausgezeichnet,<br />
da es einen weiteren Denkanstoß<br />
zur Lösung der Blendproblematik<br />
liefert.<br />
<br />
Jutta Scheer (VBIW)<br />
Patrick Langer aus Seelow nutzt<br />
bioelektrische Zellpotenziale zur Steuerung<br />
von Maschinen.<br />
Ein Schotte hat’s erfunden<br />
Fotos: BASF/Rasche (oben), Stirling Technologie Institut Potsdam (unten)<br />
Mikro-BHKW von Gimsa: Braun der warme<br />
Teil, blau der kalte Teil eines Stirlingmotors<br />
und rechts der Wand der Pelletkessel.<br />
Potsdam. 1816 erfand der schottische<br />
Pfarrer Robert Stirling den Heißluftmotor.<br />
Anders als der Verbrennungsmotor, wo<br />
Explosionen im Inneren unter Kompression<br />
ablaufen, arbeitet der Heißluftmotor<br />
mit einer äußeren Wärmequelle.<br />
Erhitzte Luft strömt<br />
von einem warmen in einen<br />
kalten Zylinder und wird danach<br />
wieder zurückgeschoben,<br />
wobei über einen Kurbeltrieb<br />
mechanische Energie erzeugt<br />
wird.<br />
Seit Jahren forscht VBIW-Mitglied<br />
Dr.-Ing. Andreas Gimsa<br />
mit dem Stirling Technologie<br />
Institut Potsdam, einer gemeinnützigen<br />
GmbH, an effizienten<br />
und umweltfreundlichen<br />
Methoden zur Heizung von Gebäuden.<br />
Dabei fügt er herkömmliche<br />
Heiztechnik mit dem Stirling-Motor<br />
in einem kleinen Block-Heizkraftwerk<br />
(Mikro-BHKW) zusammen. Dieses kann<br />
dezentral in Einfamilienhäusern eingesetzt<br />
werden.<br />
Eine Gruppe von VBIW-Mitgliedern erlebte<br />
kürzlich ein Mikro-BHKW in Betrieb.<br />
Als dessen äußere Wärmequelle dient ein<br />
Holzpellets-Kessel. Dieser speist Wärme<br />
direkt in ein Heizsystem ein, zusätzlich<br />
wird aber auch die Abwärme des Stirlingmotors<br />
zur Heizung genutzt. Dieser Motor<br />
treibt überdies einen Generator an, um<br />
Strom zu erzeugen. Gimsa will noch in<br />
diesem Jahr einige Mikro-BHKW in den<br />
Praxistest überführen, um 2017 mit dem<br />
Bau einer Kleinserie beginnen zu können.<br />
Dr. Norbert Mertzsch und<br />
Rudolf Miethig (beide VBIW)<br />
VBIW – Verein Brandenburgischer<br />
Ingenieure und Wirtschaftler e. V.<br />
Landesgeschäftsstelle:<br />
Fürstenwalder Str. 46,<br />
15234 Frankfurt (Oder)<br />
Tel.: 0335 8692151<br />
E-Mail: buero.vbiw@t-online.de<br />
Internet: www.vbiw-ev.de<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
62 | W+M NETZWERK<br />
UV Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin<br />
AUF DER SUCHE NACH FACHKRÄFTEN<br />
Unternehmer und Wissenschaftler<br />
diskutierten beim 3. Unternehmerfrühstück<br />
des Jahres über den Fachkräftemangel.<br />
Großer Dreesch. Am 12. Juli <strong>2016</strong> fand<br />
das 3. Unternehmerfrühstück des Jahres<br />
der Verbandsregion Schwerin großen<br />
Zuspruch. Mehr als 30 Unternehmer<br />
und Wissenschaftler fanden sich ein,<br />
um Fragen zum vielfach bereits spürbaren<br />
Fachkräftemangel zu diskutieren. Dabei<br />
gingen die Referenten auf Themen<br />
wie Arbeitgeberattraktivität, die Rolle der<br />
Aus- und Weiterbildung bei der Mitarbeitersuche<br />
und auch -bindung sowie auf<br />
die bislang wenig beachtete, aber zahlenmäßig<br />
gar nicht so unerhebliche Gruppe<br />
der Studienabbrecher ein. Diese Gruppe<br />
junger Leute für eine berufliche Ausbildung<br />
zu gewinnen, kann sich durchaus<br />
lohnen. Hierbei ist seit rund einem Jahr<br />
das JOBSTARTERerplus-Projekt "ask for<br />
change" der Hochschule Wismar und der<br />
RegioVision GmbH Schwerin aktiv im Einsatz.<br />
Die Projektmitarbeiter berichteten<br />
beim diesjährigen Unternehmerfrühstück<br />
von ihren Erfahrungen. Viele Unternehmer<br />
zeigen bereits großes Interesse an<br />
diesen potenziellen Auszubildenden und<br />
Fachkräften mit Entwicklungspotenzial.<br />
UV Brandenburg-Berlin<br />
BILDUNGSANGEBOTE NACH MASS<br />
Potsdam. Der Unternehmerverband<br />
Brandenburg-Berlin (UVBB) und die Verwaltungsakademie<br />
(VWA) in Potsdam<br />
wollen die Zusammenarbeit weiter ausbauen.<br />
Auf der Mitgliederversammlung<br />
des Bildungsträgers verwies Dr. Joachim<br />
Feske, 1. Vizepräsident des UVBB,<br />
auf den zunehmenden Fachkräftemangel<br />
und den Bedarf an berufsbegleitenden<br />
Angeboten zur Qualifizierung der<br />
Mitarbeiter. Die VWA ist langjähriges<br />
Mitglied des Unternehmerverbands. In<br />
Zukunft sollen vermehrt Seminare und<br />
Workshops für Mitglieder des UVBB<br />
durchgeführt werden. Ein erstes Seminar<br />
fand bereits zum Thema „Innovative<br />
Geschäftsmodelle marktnah testen“<br />
statt. Das nächste ist für Mitte November<br />
Prof. Dieter Wagner, Sven Heise, Torsten Bork, Stefan Frerichs und Waldemar Stengel (v. l.)<br />
bei der Podiumsdiskussion.<br />
geplant. Ziel ist es, Unternehmer und Mitarbeiter<br />
beim Thema Betriebswirtschaftliches<br />
Know-how gezielt auf den neuesten<br />
Stand zu bringen. Vorschläge und Anregungen<br />
aus dem Kreis der Mitglieder<br />
des UVBB sind stets willkommen.<br />
GELEGENHEIT ZUR STANDORTBESTIMMUNG<br />
Bad Saarow. Der Unternehmerverband<br />
Brandenburg-Berlin (UVBB) nutzte die<br />
Mitgliederversammlung am 1. Juli für die<br />
Standortbestimmung und zum Abstecken<br />
der Ziele. Als Schwerpunkte sieht UVBB-<br />
Präsident Dr. Burkhardt Greiff die Fachkräftesicherung,<br />
den Ausbau der Internet-Infrastruktur,<br />
die Steuerpolitik sowie die Strompreisentwicklung.<br />
Gastreferent auf der<br />
Mitgliederversammlung war Dr. Steffen<br />
Kammradt, Sprecher der Geschäftsführung<br />
der ZukunftsAgentur Brandenburg, welcher<br />
sich zu aktuellen Wirtschaftsfragen wie beispielsweise<br />
dem Strukturwandel in der Lausitz<br />
äußerte. Die Mitgliederversammlung<br />
nahm den Jahresabschluss 2015 an und<br />
entlastete das Präsidium. Der Haushaltsplan<br />
<strong>2016</strong> wurde bestätigt und in einer Nachwahl<br />
der Potsdamer Rechtsanwalt Wolfgang<br />
Matzke in das Präsidium aufgenommen.<br />
Er tritt die Nachfolge von Ingrid Andres an.<br />
Fotos: Reinhard Klawitter (oben), Bolko Bouché (unten)<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
UNTERNEHMERVERBÄNDE | 63<br />
Foto: Claudia Koslowski<br />
UV Sachsen<br />
SCHUTZ VOR CYBER-KRIMINALITÄT<br />
Lars Schaller, Heiko Waber, Michael Sauermann, Andreas Kessler und Jürgen Voigt beim<br />
Unternehmerabend (v. l.).<br />
Leipzig. Der 6. Leipziger Unternehmerabend<br />
von KPMG, UV Sachsen und dem<br />
Verein „DIE FAMILIENUNTERNEHMER –<br />
ASU“ Mitte Juni rückte das Thema „Von<br />
Erpressung, Sabotage und Diebstahl –<br />
wie professionelle Machenschaften von<br />
Cyber-Kriminellen auch mittelständische<br />
Unternehmen bedrohen“ in den Blickpunkt.<br />
Die Veranstaltung in der Alten Essigmanufactur<br />
Leipzig stieß auf große Resonanz.<br />
Cyberattacken gehören für Unternehmen<br />
auf der ganzen Welt mittlerweile<br />
zum Alltag. Dass dies nicht nur multinationale<br />
Konzerne in Übersee betrifft, zeigt<br />
die neueste E-Crime-Studie. Fast 90 Prozent<br />
der befragten Unternehmen schätzen<br />
das momentane Risiko als sehr hoch<br />
ein, mehr als 40 Prozent sind oder waren<br />
schon von e-Crime betroffen – trotz steigender<br />
Investitionen in IT-Sicherheit: Die<br />
Hacker werden nicht müde, nach immer<br />
neuen Einfallstoren in Unternehmen und<br />
Organisationen zu suchen, um diese für<br />
ihre Zwecke auszunutzen. In Deutschland<br />
war es Unternehmen bislang möglich, Cyberattacken<br />
und Hackerangriffe – zumindest<br />
vor der breiten Öffentlichkeit – für<br />
sich zu behalten. Das wird künftig durch<br />
das IT-Sicherheitsgesetz und der damit<br />
einhergehenden Informationspflicht für<br />
Unternehmen nicht mehr so ohne weiteres<br />
möglich sein. Michael Sauermann von<br />
der Abteilung Forensic der KPMG gab einen<br />
spannenden Einblick in seine Arbeit<br />
und zeigte anschauliche Praxisbeispiele<br />
auf. Die stark zunehmenden Hackerangriffe<br />
wecken bei mittelständischen Unternehmen<br />
zudem immer mehr das Bedürfnis<br />
nach einem geeigneten Versicherungsschutz.<br />
Somit gab ein Kurzreferat<br />
von Heiko Waber aus der Geschäftsleitung<br />
des Haftpflichtverbandes der deutschen<br />
Industrie (HDI) Einblick in mögliche<br />
Policen.<br />
GESCHÄFTSSTELLEN<br />
Unternehmerverband Berlin e. V.<br />
Präsident: Armin Pempe<br />
Hauptgeschäftsstelle<br />
Hauptgeschäftsführer: N. N.<br />
Frankfurter Allee 202, 10365 Berlin<br />
Tel.: +49 30 9818500<br />
Fax: +49 30 9827239<br />
E-Mail: mail@uv-berlin.de<br />
Internet: www.uv-berlin.de<br />
Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e. V.<br />
Präsident: Dr. Burkhardt Greiff<br />
Geschäftsführer: Steffen Heller<br />
Hauptgeschäftsstelle<br />
Jägerstraße 18, 14467 Potsdam<br />
Tel.: +49 331 810306<br />
Fax: +49 331 8170835<br />
E-Mail: potsdam@uv-bb.de<br />
Internet: www.uv-bb.de<br />
Geschäftsstelle Berlin<br />
Charlottenstraße 80, 10117 Berlin<br />
Tel.: +49 30 2045990<br />
Fax: +49 30 20959999<br />
E-Mail: berlin@uv-bb.de<br />
Geschäftsstelle Cottbus<br />
Schillerstraße 71, 03046 Cottbus<br />
Tel.: +49 355 22658<br />
Fax: +49 355 22659<br />
E-Mail: cottbus@uv-bb.de<br />
Unternehmerverband Norddeutschland<br />
Mecklenburg-Schwerin e. V.<br />
Präsident: Rolf Paukstat<br />
Hauptgeschäftsstelle<br />
Hauptgeschäftsführerin: Pamela Buggenhagen<br />
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin<br />
Tel.: +49 385 569333<br />
Fax: +49 385 568501<br />
E-Mail: mecklenburg@uv-mv.de<br />
Internet: mecklenburg.uv-mv.de<br />
Unternehmerverband Rostock-Mittleres<br />
Mecklenburg e. V.<br />
Präsident: Frank Haacker<br />
Hauptgeschäftsstelle<br />
Geschäftsführerin: Manuela Balan<br />
Wilhelm-Külz-Platz 4<br />
18055 Rostock<br />
Tel.: +49 381 242580<br />
Fax: +49 381 2425818<br />
E-Mail: info@rostock.uv-mv.de<br />
Internet: www.uv-mv.de<br />
Unternehmerverband Sachsen e. V.<br />
Präsident: Hartmut Bunsen<br />
Geschäftsführer: Lars Schaller<br />
Hauptgeschäftsstelle<br />
Bergweg 7, 04356 Leipzig<br />
Tel.: +49 341 52625844<br />
Fax: +49 341 52625833<br />
E-Mail: info@uv-sachsen.org<br />
Internet: www.uv-sachsen.de<br />
Geschäftsstelle Chemnitz<br />
Marianne-Brandt-Str. 4, 09112 Chemnitz<br />
Tel.: +49 371 49512912<br />
Fax: +49 371 49512916<br />
E-Mail: chemnitz@uv-sachsen.org<br />
Geschäftsstelle Dresden<br />
Semperstraße 2b, 01069 Dresden<br />
Tel.: +49 351 8996467<br />
Fax: +49 351 8996749<br />
E-Mail: dresden@uv-sachsen.org<br />
Unternehmerverband Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Präsident: Jürgen Sperlich<br />
Geschäftsführer: Dr. Andreas Golbs<br />
Geschäftsstelle Halle/Saale<br />
Berliner Straße 130, 06258 Schkopau<br />
Tel.: +49 345 78230924<br />
Fax: +49 345 7823467<br />
Unternehmerverband Thüringen e. V.<br />
Präsident: Jens Wenzke<br />
c/o IHK Erfurt - Abteilung Standortpolitik<br />
Arnstädter Str. 34, 99096 Erfurt<br />
Tel.: +49 361 4930811<br />
Fax: +49 361 4930826<br />
E-Mail: info@uv-thueringen.de<br />
Internet: www.uv-thueringen.de<br />
Unternehmerverband Vorpommern e. V.<br />
Präsident: Gerold Jürgens<br />
Geschäftsführer: N. N.<br />
Geschäftsstelle<br />
Am Koppelberg 10, 17489 Greifswald<br />
Tel.: +49 3834 835823<br />
Fax: +49 3834 835825<br />
E-Mail: uv-vorpommern@t-online.de<br />
Internet: vorpommern.uv-mv.de<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
64 | W+M PORTRÄTS<br />
Nora Heer<br />
Start-up-Dirigentin<br />
VISIONÄRE<br />
Nora Heer entspricht dem modernen<br />
Unternehmertyp der neuen<br />
New Economy. Sie beobachtet genau,<br />
spricht schnell, hält zum Nachdenken<br />
inne und erweckt den Eindruck, dass sie<br />
stets gut zuhört, aber schnell<br />
denkt und auch so handelt.<br />
Wer nach dem Studium<br />
gleich in die Unternehmensentwicklung<br />
eines großen<br />
Unternehmens wie Holtzbrinck wechselt,<br />
strategische Aufgaben zu erfüllen hat und<br />
international unterwegs ist, dem stehen<br />
viele Türen offen.<br />
STECKBRIEF<br />
Nora Heer, geboren 1979 in Köln, studierte<br />
Medienwirtschaft in Heidenheim<br />
und ist seit 2004 in Berlin. Neben dem<br />
Abschluss als Diplommedienwirtschaftlerin<br />
verfügt sie über mehrere Zusatzausbildungen.<br />
Nach gut drei Jahren<br />
beim Holtzbrinck-Verlag startete sie ihre<br />
Karriere bei der Meltwater Group. Bei<br />
Project A, einem Venture-Capital-Unternehmen,<br />
nutzte sie ihre Erfahrungen,<br />
um ein Instrument für kontinuierliches<br />
Performance Management zu entwickeln.<br />
Diese Idee bildete den Grundstein<br />
für die Ausgründung im Jahr 2014. Nora<br />
Heer ist Mitgründerin und Geschäftsführerin<br />
von Loopline Systems.<br />
„Ich möchte nie<br />
aufhören, Start-up<br />
zu sein.“<br />
So auch Nora Heer, die bald merkt, dass sie<br />
lieber selbst gestalten will, als in einer großen<br />
Organisation zu planen und zu funktionieren.<br />
Der Zufall und private Gründe sind es,<br />
die sie 2004 nach Berlin führen und wo sie<br />
für ein skandinavisches Unternehmen einen<br />
Standort mit aufbauen soll. Eine interessante<br />
Aufgabe, die schon unternehmerische Freiheiten<br />
und Herausforderungen<br />
abverlangte. Eine Quasi-Unternehmensgründung<br />
im Angestelltenverhältnis.<br />
Hier fand sie das, was sie eigentlich<br />
suchte<br />
und reizte. Aktiv<br />
sein in schnell<br />
wachsenden Unternehmen,<br />
die Organisationsentwicklung<br />
gestalten, neue Leute einstellen,<br />
den Aufbau der dahinter liegenden<br />
Strukturen bis hin zur Managemententwicklung<br />
installieren.<br />
Sie begleitete das Unternehmen sieben<br />
Jahre, die Mitarbeiterzahl stieg von vier<br />
auf 940. Dass sie damals über 1.700 Vorstellungsgespräche<br />
führen musste, hat ihr<br />
Erfahrungen eingebracht, die heute, wo<br />
die Unternehmen oft krampfhaft nach guten<br />
Leuten suchen, von unschätzbarem<br />
Wert sind. Heers Metier ist die Start-up-<br />
Szene. So kommt sie 2012 zu Project A,<br />
einem Inkubator und Venture-Capital-Unternehmen,<br />
das junge Unternehmen finanziell,<br />
aber auch organisatorisch begleitet.<br />
Hier beriet sie Start-ups von der Personalseite<br />
her – vom Recruiting bis zum Coaching<br />
von Führungskräften. Auf der Suche<br />
nach einem passenden Personal-System,<br />
das der Denke von jungen digitalen Unternehmern<br />
entspricht, war nichts Fertiges<br />
am Markt zu finden. So entstand ein eigenes<br />
Produkt, das den modernen Anforderungen<br />
an Performance Management und<br />
Führung entspricht. Ursprünglich gedacht<br />
für das 100-köpfige Team von Project A<br />
und seine Ventures entwarf sie loopline,<br />
ein cloud-basiertes Software-Instrument,<br />
das Ziele mit individuellen Beobachtungen<br />
zum Potenzial und der Zufriedenheit von<br />
Mitarbeitern verknüpft.<br />
Dieses Produkt war auch für andere Unternehmen<br />
von Interesse und so entstand<br />
schnell die Idee, daraus ein Unternehmen<br />
zu machen. Dass Heer hier ein eigenes<br />
Start-up-Unternehmen übernahm, war<br />
nicht von Anfang an klar, heute ist sie<br />
froh darüber.<br />
Sie stammt zwar aus einer Unternehmerfamilie,<br />
aber sie meint, dass es vielmehr<br />
die Vorbilder waren, die sie so geprägt<br />
hätten. Immer hatte sie gute Vorgesetzte,<br />
die notwendigen Freiraum gaben.<br />
Sie spricht von Anpacker-Mentalität<br />
und meint damit die Unternehmerfähigkeit,<br />
Möglichkeiten zu sehen und sich<br />
selbst in die Verantwortung zu nehmen.<br />
Die Kombination von visionärem Denken<br />
und prozessorientiertem Handeln machen<br />
den Unternehmer als Gestalter aus.<br />
Die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ist<br />
Heer wichtiger als Status. Ihre Aufgabe<br />
beschreibt sie als eine Art Dirigent und<br />
meint damit, Vision und Strategie für das<br />
Unternehmen vordenken und Mitarbeiter<br />
mitnehmen. Auf die Frage, wann das Unternehmen<br />
denn kein Start-up mehr sein<br />
wird, sagt sie: „Ich möchte nie aufhören,<br />
Start-up zu sein, es hat nichts mit Größe<br />
zu tun, sondern ist eher eine Einstellung.“<br />
<br />
Frank Nehring<br />
Foto: Hoffotografen<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
MACHER<br />
W+M PORTRÄTS | 65<br />
Ralf Hillenberg<br />
Preußischer Lautsprecher<br />
Foto: W+M<br />
Ralf Hillenberg hört man oft schon von<br />
weitem. Etwa wenn er mit Freunden<br />
oder Kollegen zusammensteht, eine<br />
Zigarette raucht und die Pause mit einem<br />
Witz auflockert, der durchaus etwas derber<br />
sein darf. Dann spricht er dröhnend<br />
laut und mit „Berliner Schnauze“. Eine<br />
Gabe, die ihm in die Wiege gelegt wurde,<br />
schließlich war der Großvater einst Bierkutscher<br />
und der Vater U-Bahn-Chauffeur.<br />
Hillenberg ist sicher ein Lautsprecher –<br />
aber keinesfalls ein banaler Sprücheklopfer.<br />
Er, der sich selbst als „absoluten Preußen“<br />
bezeichnet, hält es im beruflichen<br />
Alltag mit dem Motto: „Nicht reden, handeln!“<br />
Seit dem Sprung in die Selbstständigkeit<br />
vor nunmehr 22 Jahren hat er drei<br />
Firmen gegründet, sie in schweren Zeiten<br />
über Wasser gehalten und mittlerweile zu<br />
profitablen Unternehmen entwickelt. Es<br />
war ein Weg mit Biegungen, steilen Anstiegen,<br />
riskanten Gratwanderungen und<br />
einem schmerzhaften Absturz.<br />
Als das ehemals volkseigene Unternehmen<br />
Ingenieurhochbau Berlin, für das<br />
Hillenberg fast 20 Jahre gearbeitet hatte,<br />
1994 massiv in Schieflage geriet, kündigte<br />
der Pankower kurzentschlossen. „Ich<br />
brachte es nicht übers Herz, dass ich als<br />
Abteilungsleiter plötzlich<br />
langjährige Kollegen in die<br />
Arbeitslosigkeit schicken<br />
sollte.“ Er gründete seine<br />
erste eigene Firma, die<br />
auf Baubetreuung<br />
spezialisierte<br />
IPBB<br />
GmbH. Es folgte<br />
ein Unternehmen,<br />
das als Generalübernehmer fungiert, sowie<br />
die Spinola Objektgesellschaft, die<br />
sich um Grundstücksentwicklungen kümmert.<br />
Nicht ohne Stolz zählt Hillenberg<br />
vier Punkte auf, die eine Vorstellung von<br />
dem vermitteln, was seine inzwischen 37<br />
Mitarbeiter in zwei Jahrzehnten geschaffen<br />
haben: „Wir stehen für 16.843 sanierte<br />
und neu gebaute Wohnungen. Der Gesamtumsatz<br />
belief sich auf rund 560 Millionen<br />
Euro. Durch unsere energetischen<br />
Sanierungskonzepte konnte der Kohlendioxid-Ausstoß<br />
um 310.000 Tonnen reduziert<br />
werden. Darüber hinaus wurden<br />
durch unsere Wärmedämmung 135 Millionen<br />
Kubikmeter Gas eingespart.“<br />
2010 war das für ihn wohl schwierigste<br />
Jahr. Dem Sozialdemokraten Hillenberg,<br />
von 1990 bis 2011 insgesamt 18<br />
Jahre Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus,<br />
wurde vorgeworfen, Aufträge<br />
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft<br />
HOWOGE ohne Ausschreibung<br />
erhalten zu haben. Dass damit seine politische<br />
Laufbahn abrupt endete, war für<br />
Hillenberg emotional schmerzhaft. Noch<br />
dramatischer waren die Auswirkungen<br />
auf seine Firmen: „Man behandelte uns<br />
plötzlich wie Aussätzige, wir bekamen<br />
über Monate keine Aufträge.“ Zwei Jahre<br />
lang führte Hillenberg seine Unternehmen,<br />
ohne sich auch nur einen Euro Ge-<br />
„Es gibt wichtigere<br />
Dinge als die<br />
Politik.“<br />
halt zu überweisen. „Wir standen damals<br />
auf der Kippe.“ Aber Hillenberg hielt durch<br />
und sein Team zusammen. Und nebenbei<br />
gewann er eine ihn prägende Erkenntnis:<br />
„Es gibt wichtigere Dinge als die Politik.<br />
Seitdem genieße ich noch<br />
mehr die Freiheit, mich als<br />
Unternehmer zu verwirklichen.“<br />
Auch auf neuen Feldern<br />
– seit 2010 arbeitet er<br />
als Energieberater in Russland, der Ukraine<br />
und Kasachstan.<br />
Einst sah Hillenbergs Lebensplanung vor,<br />
mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Jetzt ist<br />
er 60. „Ich denke gar nicht daran, mich<br />
aufs Altenteil zurückzuziehen. Die Arbeit<br />
ist mein Hobby und am wichtigsten ist mir,<br />
dass meine Mitarbeiter zufrieden sind und<br />
gern bei uns arbeiten. Das soll mindestens<br />
noch zehn Jahre so bleiben.“<br />
Karsten Hintzmann<br />
STECKBRIEF<br />
Ralf Hillenberg wurde am 3. August<br />
1956 in Berlin geboren. Nach Abitur<br />
und Armeedienst erlernte er den Beruf<br />
des Zimmermanns. Von 1978 bis 1984<br />
absolvierte er ein Fernstudium an der<br />
Technischen Universität Dresden, das<br />
er als Diplom-Ingenieur abschloss. Bis<br />
1994 arbeitete Hillenberg als angestellter<br />
Bauleiter. Anschließend machte er<br />
sich selbstständig und gründete insgesamt<br />
drei Unternehmen. Er ist seit 1989<br />
Mitglied der SPD und war von 1991 bis<br />
2011 (mit Unterbrechungen) Mitglied<br />
des Berliner Abgeordnetenhauses.<br />
Er ist geschieden und Vater von zwei<br />
Söhnen.<br />
www.WundM.info <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
66 | W+M DIE LETZTE SEITE<br />
Ausblick auf die nächste Ausgabe<br />
Zukunft Ost<br />
Wie werden sich die neuen Länder<br />
in den kommenden 25 Jahren<br />
entwickeln? Wird der seit<br />
1990 andauernde Aufholprozess gegenüber<br />
dem Altbundesgebiet hinsichtlich<br />
der Wirtschaftskraft und der Lebensverhältnisse<br />
irgendwann gelingen? Gibt es<br />
eine Chance, dass sich der aktuell kleinteilige<br />
Mittelstand mausert und daraus sogar<br />
Konzernstrukturen erwachsen? Mit all<br />
diesen Fragen befasst sich das von<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> initiierte<br />
erste Ostdeutsche Wirtschaftsforum,<br />
das am 20. und 21. Oktober<br />
in Bad Saarow stattfindet.<br />
Viele namhafte Akteure<br />
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft<br />
haben ihre Teilnahme zugesagt. Im<br />
Vorfeld des Kongresses, der den etwas<br />
unbescheidenen Arbeitstitel „Davos des<br />
Ostens“ trägt, stellen zahlreiche Referenten<br />
ihre Kerngedanken zur „Zukunft Ost“<br />
komprimiert im Magazin vor.<br />
In unserer Serie über die Entwicklung des<br />
Wirtschaftsstandortes Ostdeutschland berichten<br />
wir in dieser Ausgabe über Thüringen.<br />
Dort haben vor allem die Bereiche Automotive,<br />
Life Sciences, Informations- und<br />
Kommunikationstechnik (IKT) sowie die optische<br />
Industrie an Dynamik gewonnen. Ministerpräsident<br />
Bodo Ramelow stellt sich<br />
den Fragen von <strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong><br />
und spricht über interessante Ansiedlungsvorhaben,<br />
die Integration von Flüchtlingen<br />
in den Arbeitsmarkt und seine Gedanken<br />
zum Thema Länderfusionen.<br />
Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt<br />
aktuelle Nachrichten aus den neuen Bundesländern<br />
sowie einen informativen Ratgeberteil.<br />
Die nächste Ausgabe von<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong><br />
erscheint am<br />
17. Oktober <strong>2016</strong>.<br />
PERSONENREGISTER<br />
Acksel, Daniel 10<br />
Albers, Hermann 41<br />
Ancelotti, Carlo 56<br />
Andres, Ingrid 62<br />
Arndt, Rommy 45<br />
Balan, Manuela 57<br />
Ballack, Michael 7<br />
Baumeister, Roy 56<br />
Beckmann, Ralph 45<br />
Blank, Wolfgang 8<br />
Borgward, Christian 60<br />
Bork, Torsten 62<br />
Brendel, Sebastian 58<br />
Bunse, Benno 45<br />
Bunsen, Hartmut 8, 45<br />
Calmund, Rainer 7<br />
Christiansen, Rolf 24<br />
Dulig, Martin 11<br />
Fassbinder, Stefan 8<br />
Faulenbach da Costa, Dieter 26/27<br />
Ferris, Timothy 56<br />
Feske, Joachim 62<br />
Fissenewert, Peter 9<br />
Frenzel, Christian 31/33<br />
Frerichs, Stefan 62<br />
Friedrich, Marc 56<br />
Gabriel, Sigmar 43/44<br />
Giese, Lutz 10<br />
Gimsa, Andreas 61<br />
Glawe, Harry 8, 25<br />
Gleicke, Iris 44<br />
Golbs, Andreas 9, 45<br />
Golletz, Frank 45<br />
Gonschorek, Jeromé 61<br />
Görke, Christian 59<br />
Gramkow, Angelika 24<br />
Greiff, Burkhardt 62<br />
Gründer, Lisa 61<br />
Grusser, Gerald 30<br />
Gudat, Maximilian 61<br />
Gülland, Joachim 29<br />
Guo, Guangchang 45<br />
Haferburg, Katja 32<br />
Hahne, Peter 56<br />
Hampel, Gerd 10<br />
Hartmann, Tim 22/23<br />
Haseloff, Reiner 44<br />
Hattemer, Mario 49<br />
Heer, Nora 45, 64<br />
Heise, Sven 62<br />
Herrmann, Ulrike 56<br />
Hillenberg, Ralf 65<br />
Höpner, Frank 45<br />
Jäger, Hubert 32<br />
Joras, Andrea 45<br />
Jox, Kurt 59<br />
Kahnemann, Daniel 56<br />
Kammann, Rolf 8<br />
Kammradt, Steffen 62<br />
Kawalla, Rudolf 32<br />
Kessler, Andreas 63<br />
Khalil, Jibran 58<br />
Kirpal, Kristian 6<br />
Kirpal, Kurt 6<br />
Kleindfeldt, Angelika 57<br />
Kleindfeldt, Doris 57<br />
Kräh, Mareen 58<br />
Kralinski, Thomas 58<br />
Krüger, Harald 15<br />
Laack, Alyssa 58<br />
Lahmann, Alexander 8<br />
Langer, Patrick 61<br />
Linhart, Zbyněk 38<br />
Ludwig, Saskia 41<br />
Mallok, Jörn 10<br />
Mathieu, Stefan 6<br />
Matthus, Frank 59<br />
Matzke, Wolfgang 62<br />
Meier, Klaus-Jürgen 9<br />
Meinel, Christoph 45<br />
Merkel, Angela 29<br />
Mertzsch, Norbert 61<br />
Methling, Roland 27<br />
Meyer, Jens-Uwe 45<br />
Müller, Michael 44<br />
Müller, Ulrich 10<br />
Nawka, Benjamin 60<br />
Nischan, Bastian 61<br />
Nothnagel, Peter 32<br />
Nowakowski, Juliane 6<br />
Olbricht, Klaus 8<br />
Olenicak, Volker 28/29<br />
Paukstat, Rolf 9<br />
Pegel, Christian 44<br />
Piketty, Thomas 56<br />
Rademacher, Jens 57<br />
Ragnitz, Joachim 10, 40, 44<br />
Ramelow, Bodo 66<br />
Richter, Tino 38/39<br />
Riester, Walter 6<br />
Ritter, Jörg K. 45<br />
Roi, Daniel 28/29<br />
Ruch, Oliver 10<br />
Sapich, Sylvia 57<br />
Sauermann, Michael 63<br />
Schaller, Lars 63<br />
Scheer, Jutta 61<br />
Scholze, Uwe 29<br />
Schwartz, Rainer 26<br />
Sellering, Erwin 44<br />
Stange, Eva-Maria 32, 39<br />
Stapper, Florian 50<br />
Stefanović, Miloš 58, 59<br />
Stengel, Waldemar 62<br />
Stenger, Tillmann 31/32<br />
Stirl, Axel 9<br />
Teuchert, Stefan 45<br />
Tiefensee, Wolfgang 30<br />
Tierney, John 56<br />
Tillich, Stanislaw 16-18<br />
Topf, Wolfgang 6<br />
Treutler, Alexandra 7<br />
Tröltzsch, Jürgen 32<br />
Tschirner, Tilman 61<br />
Vance, Ashlee 56<br />
Voigt, Jürgen 63<br />
von Hardenberg, Tita 6<br />
von Nathusius, Heinrich 45<br />
Waber, Heiko 63<br />
Wagner, Dieter 62<br />
Wagner, Thomas 7<br />
Wanka, Johanna 44<br />
Wassermann, Holger 46/47<br />
Weber, Franziska 58<br />
Weber, Michael 10<br />
Weik, Matthias 56<br />
Werner, Holger 45<br />
Winter, Alexander 45<br />
Wisch, Sebastian 52<br />
Wladasch, Sarah 58<br />
Woidke, Dietmar 8, 16-18, 44, 58<br />
Wolf, Jenny 58<br />
Wolf, Udo 8<br />
Wolff, Severine 10<br />
Zeller, Joachim 34/35<br />
Zillekens, Christian 58<br />
Zoschke, Dagmar 29<br />
<strong>WIRTSCHAFT+MARKT</strong> | 5/<strong>2016</strong>
„Wir sorgen für<br />
gute Geschäfte“<br />
Werte Kolleginnen und Kollegen,<br />
als Unternehmernetzwerk haben wir<br />
es uns zur ersten Aufgabe gemacht,<br />
bei unseren Mitgliedern für<br />
gute Geschäfte zu sorgen -<br />
national wie international.<br />
Unsere Haltung dabei ist die des<br />
nachhaltigen Wirtschaftens und<br />
der Fairness.<br />
Es gilt:<br />
Ihr Erfolg ist unser Erfolg.<br />
Als Unternehmer und Unternehmerin<br />
wenden Sie sich direkt an uns:<br />
vorstand@bwa-deutschland.de<br />
Herzlich,<br />
Ihr BWA-Vorstand.<br />
Wirtschaft-das-sind-wir-alle
REINSCLASSEN<br />
Alles Wichtige<br />
mach’ ich selbst!<br />
Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht.<br />
Buchhaltung, Aufträge, Rechnungen oder Lohn und Gehalt: Mit Lexware haben Sie mit einem Klick alle<br />
Geschäftszahlen selbst im Blick – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Egal, ob Sie das erste Mal mit<br />
Buchhaltung zu tun haben oder Vollprofi sind. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de