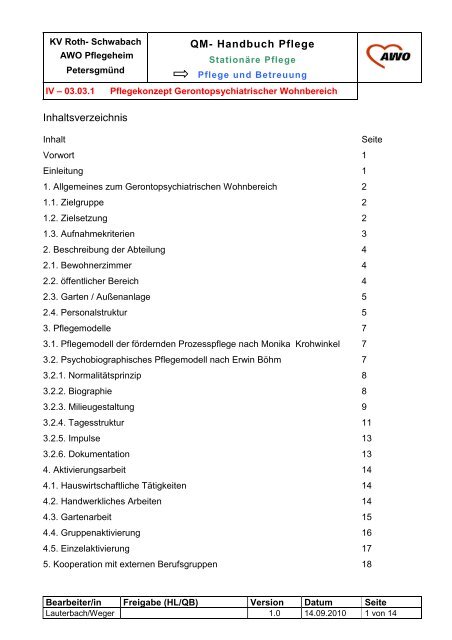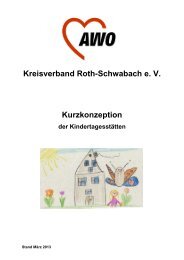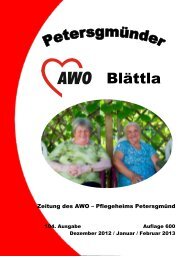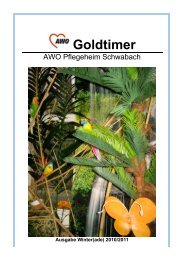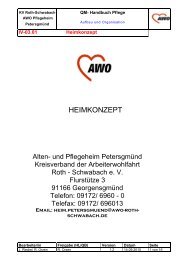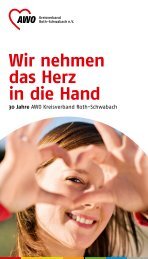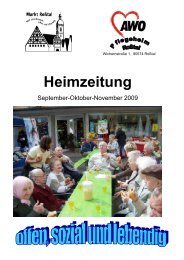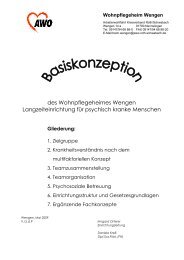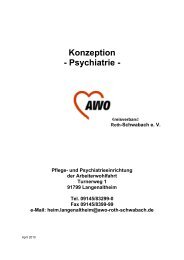QM- Handbuch Pflege - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
QM- Handbuch Pflege - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
QM- Handbuch Pflege - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhalt Seite<br />
Vorwort 1<br />
Einleitung 1<br />
1. Allgemeines zum Gerontopsychiatrischen Wohnbereich 2<br />
1.1. Zielgruppe 2<br />
1.2. Zielsetzung 2<br />
1.3. Aufnahmekriterien 3<br />
2. Beschreibung der Abteilung 4<br />
2.1. Bewohnerzimmer 4<br />
2.2. öffentlicher Bereich 4<br />
2.3. Garten / Außenanlage 5<br />
2.4. Personalstruktur 5<br />
3. <strong>Pflege</strong>modelle 7<br />
3.1. <strong>Pflege</strong>modell der fördernden Prozesspflege nach Monika Krohwinkel 7<br />
3.2. Psychobiographisches <strong>Pflege</strong>modell nach Erwin Böhm 7<br />
3.2.1. Normalitätsprinzip 8<br />
3.2.2. Biographie 8<br />
3.2.3. Milieugestaltung 9<br />
3.2.4. Tagesstruktur 11<br />
3.2.5. Impulse 13<br />
3.2.6. Dokumentation 13<br />
4. Aktivierungsarbeit 14<br />
4.1. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 14<br />
4.2. Handwerkliches Arbeiten 14<br />
4.3. Gartenarbeit 15<br />
4.4. Gruppenaktivierung 16<br />
4.5. Einzelaktivierung 17<br />
5. Kooperation mit externen Berufsgruppen 18<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 1 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
6. Zusammenarbeit mit Berufsgruppen im Haus 19<br />
7. Ehrenamtliche Mitarbeiter 20<br />
8. Angehörigenarbeit 21<br />
Schlusswort 22<br />
Literaturverzeichnis 23<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 2 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
Konzept des Gerontopsychiatrischen Wohnbereiches unter<br />
Einbeziehung des Psychobiographischen <strong>Pflege</strong>modell nach<br />
E. Böhm<br />
Vorwort<br />
Im <strong>Pflege</strong>heim Petersgmünd befinden sich drei Wohnbereiche. Im Laufe der Zeit stellte sich<br />
heraus, dass es nötig ist im beschützenden Wohnbereich ein eigenes Konzept zu erarbeiten,<br />
da sich hier die Arbeitsweise in einigen Punkten von der <strong>Pflege</strong> der anderen Wohnbereiche<br />
unterschied. Dieses Konzept wurde im März 2005 erstellt und bisher eingesetzt. Im Jahre<br />
2007 gab es im beschützenden Wohnbereich eine Änderung bzw. Erweiterung des<br />
bisherigen <strong>Pflege</strong>modells. Das Modell nach Monika Krohwinkel wurde durch das<br />
Psychobiographische <strong>Pflege</strong>modell nach Erwin Böhm ergänzt und Mitarbeiter geschult.<br />
Daher ist es notwendig, dass Konzept zu überarbeiten und die neuen Schwerpunkte mit<br />
einfließen zu lassen.<br />
Einleitung<br />
Die Lebenserwartung in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und wird die<br />
kommenden Jahre weiter ansteigen. Dadurch haben sich Krankheitsverläufe entwickelt, die<br />
es in diesem Ausmaß und vor allem in der Häufigkeit so nicht gegeben hat.<br />
In Deutschland leben derzeit etwa eine Million Menschen, die an mittelschwerer und<br />
schwerer Demenz erkrankt sind, Tendenz weiter steigend.<br />
Weitere häufige Erkrankungen jenseits des 50. Lebensjahres sind Depressionen, paranoide<br />
Störungen sowie Schizophrene Erkrankungen einhergehend mit Wahnideen. Zwar sind diese<br />
mit unter banal, aber alltagsnah und beziehen sich auf Beeinträchtigungen oder<br />
Bedrohungen in der unmittelbaren Lebensumgebung des Betroffenen.<br />
1. Allgemeines zum Gerontopsychiatrischen Wohnbereich<br />
1.1. Zielgruppe<br />
Aufgrund der Zunahme der beschriebenen Krankheitsbilder ist die Betreuung dieser<br />
Personengruppe im <strong>Pflege</strong>heim Petersgmünd deutlich in den Vordergrund gerückt. Unser<br />
Angebot auf dem Gerontopsychiatrischen Wohnbereich richtet sich an ältere Menschen ab<br />
dem 60. Lebensjahr mit allen Formen einer Demenz und psychiatrischen Erkrankungen, die<br />
aus gesundheitlichen Gründen nicht im häuslichen Umfeld leben oder betreut werden<br />
können.<br />
Schwerpunkt in der Versorgung ist die Betreuung von Menschen die an herausforderndem<br />
Verhalten, wie Weglauftendenzen, aggressiven Durchbrüchen, wahnhaften Erleben,<br />
nächtlicher Verwirrtheit etc. leiden.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 3 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
1.2 Zielsetzung<br />
Der beschützende Wohnbereich befindet sich im Erdgeschoß und ist ein geschlossener<br />
gerontopsychiatrischer Bereich mit therapeutisch-reaktivierendem Charakter. Hier können 20<br />
Bewohner aufgenommen werden. Durch eine akute psychiatrische Erkrankung ist eine<br />
Anpassung an die Umwelt nur noch schwer möglich. Deshalb muss sich die Umwelt an den<br />
Erkrankten anpassen, dabei wollen wir eine Balance zwischen aktivierenden/stimulierenden<br />
und schützenden Elementen anstreben.<br />
Ziele aus unserem <strong>Pflege</strong>leitbild sind, den uns anvertrauten Menschen, die eigene Identität<br />
und ihre Selbstbestimmtheit zu erhalten und ihnen die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung<br />
zu geben. Dies bedeutet für uns den Menschen als ein einheitliches Ganzes unter<br />
Berücksichtigung von Körper, Geist und Seele sowie seinem sozialen Umfeld zu sehen.<br />
Um dieser Ganzheitlichkeit gerecht zu werden, planen wir die <strong>Pflege</strong> nach dem <strong>Pflege</strong>modell<br />
nach Monika Krohwinkel. Die Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung erhalten und<br />
fördern wir nach dem Psychobiographischen <strong>Pflege</strong>modell von Erwin Böhm.<br />
1.3 Aufnahmekriterien<br />
Aufgenommen werden hauptsächlich mittel- bis hochgradig desorientierte und verwirrte<br />
betagte Menschen mit Weglauftendenz und / oder Selbst- bzw. Fremdgefährdung. Für die<br />
Aufnahme ist ein aktueller richterlicher Beschluss notwendig.<br />
Nicht aufgenommen werden insbesondere Personen mit extrem sozial unverträglichen<br />
Verhaltensweisen z. B. extreme Gewalttätigkeit. Menschen mit Zerstörungssymptomatik,<br />
Suchtproblematik vor allem Alkohol- und Drogenabhängigkeit, extremes Sexualverhalten<br />
sowie jüngere, psychisch erkrankte Menschen können ebenfalls nicht aufgenommen werden,<br />
da hierbei aus therapeutischen Gründen verschiedene Zielsetzungen aufeinander stoßen.<br />
2. Beschreibung der Abteilung<br />
2.1. Bewohnerzimmer<br />
Alle Bewohnerzimmer sind als Zweibettzimmer ausgelegt. Die Möbel sind aus hellem<br />
Buchenholz gefertigt, so können die Zimmer in Ergänzung mit eigenen Möbeln, Bildern und<br />
persönlichen Gegenständen sehr wohnlich nach den Wünschen der einzelnen Bewohner<br />
eingerichtet werden.<br />
Die Standardeinrichtung eines Zimmers besteht aus einem <strong>Pflege</strong>bett, Nachtschrank,<br />
Sideboard und Kleiderschrank. Telefon- und Fernsehanschluss sowie Zimmernotruf sind<br />
selbstverständlich integriert. In der Regel teilen sich je zwei Doppelzimmer eine Nasszelle mit<br />
zwei Waschbecken, Toilette und Dusche. Ausnahmen sind die jeweiligen Eckzimmer sowie<br />
Zimmer 0.28 und 0.29. Diese verfügen über eine eigene Nasszelle.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 4 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
2.2 Öffentlicher Bereich<br />
Der öffentliche Bereich gliedert sich in Stationsgang, Küche und Wohnzimmer. Auf dem<br />
Gang befinden sich Sitzmöglichkeiten, mehrere Tische sowie Einrichtungsgegenstände aus<br />
den vierziger Jahren.<br />
In der Küche stehen drei Tische an denen insgesamt 12 Personen Platz finden. Weitere<br />
Tischgruppen befinden sich im Wohnzimmer und im hinteren Bereich des Flures.<br />
Im Wohnzimmer stehen ein Sofa und mehrere Sessel sowie ein Fernseher. Alle öffentlichen<br />
Zimmer sind zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Bewohner zugänglich.<br />
Im Wohnbereich sind außerdem verschiedene Funktionsräume wie Fäkalienraum,<br />
Stationszimmer, Teeküche und Stationsbad mit Badewanne integriert.<br />
2.3 Garten / Außenanlage<br />
Eine Besonderheit dieses Wohnbereiches ist der angegliederte Garten, der von den<br />
Bewohnern durch den direkten Zugang nach außen jederzeit genutzt werden kann. Der<br />
Garten verfügt über einen Rundweg, eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Pergola sowie<br />
einen Therapieweg mit verschiedenartigen Bodenbelägen. Die Glasüberdachung direkt am<br />
Gartenzugang bietet die Möglichkeit auch bei schlechtem Wetter draußen zu sitzen.<br />
Im Garten befindet sich außerdem ein Hochbeet mit saisonaler Bepflanzung sowie eine<br />
Kräuterecke mit mehreren Kräutern und Gewürzen.<br />
Zudem steht ein gemauerter Grill für Grillabende zur Verfügung.<br />
2.4 Personalstruktur<br />
Das Personal setzt sich aus folgenden Berufsgruppen zusammen:<br />
- Altenpflegerinnen<br />
- Krankenschwestern<br />
- Krankenpfleger<br />
- <strong>Pflege</strong>helfer<br />
- Betreuungsassistent<br />
- Auszubildende<br />
Die Wohnbereichsleitung hat zusätzlich die Qualifikation zur Gerontofachkraft. Eine weitere<br />
Fachkraft macht zudem die Gerontopsychiatrische Weiterbildung.<br />
Den Grundkurs <strong>Pflege</strong>modell nach Erwin Böhm haben 80 % des Personals absolviert.<br />
Eine Sozialpädagogin mit Böhm-Grundkurs unterstützt das <strong>Pflege</strong>team.<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal ist verpflichtet sich ständig fort- und weiterzubilden, so dass jederzeit<br />
eine <strong>Pflege</strong> und Betreuung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
gewährleistet ist.<br />
Die <strong>Pflege</strong>person ist angehalten sich selbst und ihre Arbeit fortwährend zu reflektieren, nicht<br />
zu somatisieren und den Menschen so sein lassen wie er ist, ihn in dem was er braucht zu<br />
unterstützen. Das <strong>Pflege</strong>personal muss in der Lage sein zu Aktivieren und Reaktivieren und<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 5 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
den Klienten in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Es ist unbedingt erforderlich,<br />
dass sich jeder Mitarbeiter als Teil des Teams versteht und sich nach seinen Fähigkeiten<br />
entsprechend einbringt.<br />
Durch monatliche Teamgespräche wird der Prozess gefördert und unterstützt, Probleme<br />
können dadurch konstruktiv besprochen werden.<br />
3. <strong>Pflege</strong>modelle<br />
3.1 <strong>Pflege</strong>modell der fördernden Prozesspflege nach Monika Krohwinkel<br />
Die Schlüsselkonzepte des Modells sind der Mensch, die Umgebung, Gesundheit und<br />
Krankheit sowie die <strong>Pflege</strong>. Die <strong>Pflege</strong> wird vom <strong>Pflege</strong>team individuell für den Bewohner<br />
geplant. Die <strong>Pflege</strong>planung erfolgt nach den Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des<br />
Lebens, den so genannten AEDL`s (13 Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des<br />
Lebens).<br />
Trotz der Unterteilung der einzelnen AEDL´s ist immer die Ganzheit des zu <strong>Pflege</strong>nden zu<br />
beachten. Alle Bereiche der AEDL´s gehören zu einem Menschen und beeinflussen sich<br />
wechselseitig. Ressourcen und Hilfebedürftigkeit in einem Bereich haben unmittelbare<br />
Auswirkungen auf andere Bereiche.<br />
Die <strong>Pflege</strong>organisation gliedert sich in drei Bezugspflegebereiche der je eine<br />
Bezugspflegefachkraft zugeordnet ist. Diese erstellt eine ausführliche <strong>Pflege</strong>planung, ist<br />
verantwortlich für die Erhebung der Informationen, der Evaluation und der Umsetzung<br />
sämtlicher Expertenstandards. Zudem steht die Bezugspflegefachkraft im engen Kontakt mit<br />
den Angehörigen bzw. Betreuern und den behandelten Ärzten.<br />
3.2 Psychobiographisches <strong>Pflege</strong>modell nach Erwin Böhm<br />
Die Anwendung des Psychobiographischen <strong>Pflege</strong>modells lässt grundsätzlich eine<br />
Reaktivierung d. h. eine deutliche Verbesserung des psychischen Zustandes des dementen<br />
Menschen zu, indem sie die Demenz nicht als organische, sondern als psychobiographisch<br />
interpretierbares Problem sieht. Der Demenzkranke Mensch bleibt in seinem Gefühl, also<br />
seiner Thymopsyche erreichbar. Durch Schlüsselreize die aus der individuellen und<br />
kollektiven Biographie ersichtlich sind, kann die Lebensenergie wieder entfacht werden.<br />
Eine systemische Anwendung des Modells führt mindestens zu folgenden Verbesserungen<br />
für Bewohner und Personal:<br />
- eine Reaktivierung bei Klienten im Destruktionstrieb und Rückzug<br />
- eine Symptomlinderung ohne Einsatz von Psychopharmaka<br />
- eine Erhöhung des Selbstwertgefühls beim alten Menschen<br />
- eine Verbesserung der <strong>Pflege</strong>qualität durch "seelische <strong>Pflege</strong>"<br />
- eine deutliche Erhöhung der Arbeitszufriedenheit<br />
- eine Senkung der Krankenstände<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 6 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
3.2.1 Normalitätsprinzip<br />
Daheim ist ein Gefühl!<br />
Und weil das so ist, und wir uns Zu Hause am wohlsten fühlen, wollen wir auch für unsere<br />
Bewohner das individuelle Daheim-Gefühl schaffen. Das ist die Basis unserer Betreuung und<br />
wird erreicht durch das sog. Normalitätsprinzip. Prof. Erwin Böhm spricht vom<br />
Normalitätsprinzip und meint damit, dass wir uns immer wieder fragen müssen, was in der<br />
Kindheit, Jugend oder im frühen Erwachsenenalter der heutigen alten Menschen "normal"<br />
oder "üblich" war. Gemeint sind moralische Wertvorstellungen ebenso wie ganz banale<br />
Alltagsgewohnheiten, die das Leben einstmals bestimmten. Man muss bedenken: Der alte<br />
Mensch lebt zunehmend in der Normalität von Gestern. Und was gestern vielleicht "normal"<br />
war, kann heute zum Teil sehr befremdlich wirken.<br />
3.2.2 Biographie (Lebensgeschichte)<br />
Um zu erfahren um welche "Normalität" es sich beim Bewohner handelt, erstellen wir eine<br />
Gefühlsbiographie. Diese beinhaltet nicht nur markante Eckdaten, wie Geburts- und<br />
Heiratsdaten, sondern vor allem Storys, Lebensschicksale und Folklore die den einzelnen<br />
prägten und ihn als Menschen ausmachen. Prägungen können sowohl positiv als auch<br />
negativ sein. Außerdem ist zu bedenken, aus welchem Milieu der Bewohner stammt und<br />
welche regionalen Gegebenheiten wichtig waren. Die Biographie gibt zudem Auskunft über<br />
Schlüsselreize, Emotionen und Copings des Betagten.<br />
Man spricht hier von der Böhm´schen Formel: Prägung + Schlüsselreiz + Emotion =<br />
Coping<br />
3.2.3 Milieugestaltung<br />
Demente Menschen leben im Altzeitgedächtnis und ein alt vertrautes Milieu gibt dem<br />
Bewohner Sicherheit und unterstützt das "Daheim-Gefühl". Das heißt die Umgebung wird<br />
dem Dementen angepasst und nicht umgekehrt. Hierbei wird die individuelle Biographie, der<br />
Zeitgeist, Herkunft und die Brauchtümer (Religion) berücksichtigt.<br />
3.2.3.1 öffentlicher Bereich<br />
Der Flur wird durch verschiedene Farbgebungen und Wandgestaltungen in mehrere<br />
Bereiche unterteilt. Es gibt sowohl Ruhezonen mit Sesseln und Sofas, als auch Gegenstände<br />
mit Aufforderungscharakter zum Beispiel eine Garderobe mit Hüten, Jacken, Schirmen und<br />
Spazierstöcke. Die Farben sind hell und einladend, und mit verschiedenen Mustern aus den<br />
vierziger und fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts versehen. Die Eingangstür ist<br />
mit Fachwerk verkleidet und ist somit nicht mehr als Tür zu erkennen, was die<br />
Weglauftendenz erheblich reduziert. Neben der Fachwerkwand hängen zwei Briefkästen, in<br />
die das Personal die Privatpost der Bewohner einwirft und später mit ihnen gemeinsam leert.<br />
Die Zimmertüren sind unter Berücksichtigung der emotionalen Erreichbarkeit und der<br />
Interaktionsstufe mit Bildern gekennzeichnet. Das bedeutet, Bewohner erkennen sich<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 7 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
entweder auf den Bildern selbst, oder haben eine starken Bezug zu dem, was auf den<br />
Bildern zu erkennen ist. Namen sind groß und bei Bedarf auch in Alter Schrift geschrieben.<br />
Das Ess- und Wohnzimmer sind ebenfalls im Stil der vierziger und fünfziger Jahre des<br />
Neunzehntenjahrhunderts eingerichtet. Das Esszimmer ist zugleich Küche in der gekocht,<br />
gearbeitet und gegessen wird. Die Alltagsgegenstände, wie Handtuchhalter und Kaffeemühle<br />
laden zum aktiven Tun ein und erinnern an die gute alte Zeit, wecken Emotionen und rufen<br />
Erinnerungen wach. Im Esszimmer finden 12 Bewohner an drei Tischen platz. Einer dieser<br />
Tische ist ein Spültisch bei dem, nach Bedarf, die Spülvorrichtung ausgezogen und gespült<br />
werden kann. Im Küchenbüffet steht verschiedenes Geschirr zur Benutzung bereit. Auf dem<br />
alten Ofen kann mit Hilfe einer Induktionskochplatte gekocht werden.<br />
Im Wohnzimmer fördern ein altes Sofa und zwei Sessel das gemütliche beisammen sein. Ein<br />
Wohnzimmerbüffet und ein alter Regulator, der zur vollen Stunde schlägt, erinnern an die<br />
gute Stube von früher. Um die heimelige Atmosphäre noch zu unterstreichen, hängen alte<br />
Bilder an den Wänden und am Boden liegt sich ein Teppich. Wer möchte, kann hier seinen<br />
Abend gemeinsam mit anderen Bewohnern vor dem Fernseher verbringen.<br />
Die Toilettentüren sind mit Herz gekennzeichnet, da dies ein bekanntes Symbol von früher<br />
ist, und auch Bewohner welche nicht mehr lesen können, dieses Zeichen erkennen. Die<br />
Toilette hat eine schwarze Klobrille, um besser im weißen Bad sichtbar zu sein.<br />
3.2.3.2 Bewohnerzimmer<br />
Damit sich die Bewohner schon vom ersten Tag an bei uns wohl fühlen, ist es sehr wichtig,<br />
dass sie auch in ihrem privaten Bereich vertraute und lieb gewonnene Gegenstände wieder<br />
finden. Es ist daher nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht, das Zimmer nach<br />
den Bedürfnissen des Bewohners zu gestalten. So kann ein vertrautes Bild und der<br />
Ruhesessel von zu Hause Geborgenheit vermitteln und die Eingewöhnung im neuen<br />
Zuhause deutlich erleichtern.<br />
Die Angehörigen werden im Vorfeld mit einbezogen. Ziel ist es jedoch, den Bewohner in<br />
seinem häuslichen Umfeld zu Hause noch vor dem Einzug kennen zu lernen. Deshalb bieten<br />
wir vorab Hausbesuche an, um uns dem zukünftigen Bewohner vorzustellen und etwas über<br />
seine Lebensgewohnheiten zu erfahren. Diese Informationen können später in der<br />
Milieugestaltung passend umgesetzt werden.<br />
3.2.4. Tagesstruktur<br />
Ein strukturierter Tagesablauf ist notwendig um den Bewohnern, die oft das Gefühl für Zeit<br />
und Raum verlieren Sicherheit und feste Anhaltspunkte zu geben. Außer den vorgegebenen<br />
Zeiten für gemeinsames Essen und Rahmenprogramm des Sozialdienstes richtet sich der<br />
Tagesablauf nach der Normalität des einzelnen Bewohners. Am Vormittag werden<br />
gemeinsam hauswirtschaftliche Tätigkeiten erledigt. Es werden hier Bewohner mit<br />
einbezogen bei denen diese "normalen" und sinnvollen Beschäftigungen Alltag waren. Die<br />
Biographie des Bewohners gibt über die individuelle Alltagsnormalität Auskunft und das<br />
Erledigen von bekannten Aufgaben trägt zur Erhöhung der Ich-Wichtigkeit bei.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 8 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
Wichtig ist es bei der Tagesstruktur auf Kontinuität zu achten, damit sich die Abläufe im<br />
Tertiärgedächtnis der Klienten verankern können.<br />
Um der Individualität gerecht zu werden richtet sich der Tagesablauf nach dem Bewohner<br />
und nicht umgekehrt. Aufsteh- und Schlafenszeiten können von ihm selbst gewählt werden.<br />
Nach dem Aufstehen und der Grundpflege wird der Morgen gemeinschaftlich in der Küche<br />
begonnen. Zusammen Kaffee kochen und Frühstücken stärkt das Gemeinschaftsgefühl und<br />
gibt zeitliche Orientierung. Nach dem Frühstück wird das Geschirr gespült und abgetrocknet.<br />
Insgesamt bietet die Küche vielerlei Möglichkeiten der Impulssetzung. Sowohl<br />
hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Zeitungslesen und andere Gruppenaktivitäten finden am<br />
Vormittag hier statt. Dreimal wöchentlich wird zusätzlich ein Teil des Mittagessens z.B.<br />
Nachtisch, Suppe oder Kartoffeln zubereitet.<br />
Vor dem Essen werden, mit einigen Bewohnern zusammen, die Tische gedeckt, um dann<br />
gemeinsam in familiärer Atmosphäre die Mahlzeiten einzunehmen. Unterstützt wird dies vor<br />
allem durch gleich bleibende Tischgruppen, die sich nach Interaktionsstufen und<br />
Herkunftsmilieu zusammensetzen. Damit die Bewohner die Möglichkeit haben sich nach<br />
ihren Bedürfnissen zu bedienen und die Menge selbst zu bestimmen stehen verschiedene<br />
Schüsseln auf dem Tisch. <strong>Pflege</strong>kräfte begleiten die Mahlzeiten nicht als Zuschauer sondern<br />
als Teil der Gruppe, indem sie sich zu den Bewohnern setzen und mit ihnen essen.<br />
Nach dem Mittagessen ist bis 14.00 Uhr Mittagsruhe. Hier wird den Bewohnern angeboten<br />
sich etwas hinzulegen oder in bequemen Sitzmöglichkeiten auszuruhen.<br />
Am Nachmittag findet ausgedehntes Kaffeetrinken statt, das vielerlei gestaltet werden kann,<br />
z.B. Kaffeemahlen mit der Mühle und frisches Aufbrühen des Kaffees oder benutzen von<br />
Sonntagsgeschirr. Der Schwerpunkt hier ist die Kommunikation zwischen <strong>Pflege</strong>personal und<br />
Bewohner sowie die Förderung des Kontaktes der Bewohner untereinander. Anschließend ist<br />
Raum für gezielte Aktivitäten und Einzelbeschäftigungen.<br />
Das Abendessen gestaltet sich ähnlich wie das Frühstück. Es wird hierbei der<br />
Tagesausklang in den Mittelpunkt gestellt, da viele demenzkranke alte Menschen in den<br />
Abendstunden vermehrt Unruhe zeigen und instabil werden. Die Abendpflege im Anschluss<br />
ist deshalb individuell gestaltet und richtet sich nach den Bedürfnissen und der Biographie<br />
jedes Einzelnen, z.B. Gebet, Wärmflasche oder ein Glas warme Milch tragen zur<br />
Geborgenheit bei und erleichtern das Ein- und Durchschlafen.<br />
3.2.5. Impulse<br />
Neben der Tagesstruktur werden, für den Bewohner wichtige, Impulse gesetzt. Da jeder<br />
prägungsbedingt andere Ressourcen mitbringt, ist es wichtig diese zu kennen und unter<br />
Umständen zu Reaktivieren. Impulse werden aus der Biographie ermittelt und in den<br />
Tagesablauf integriert. (Impuls: Etwas in Bewegung bringen) Ziel ist es ein Wiederaufleben<br />
und eine Steigerung des Selbstwertgefühls zu erreichen. Denn "Vor den Beinen muss die<br />
Seele bewegt werden" (Böhm 2009, 24) das geht nur, indem man für eine Tätigkeit<br />
zunächst einen Anreiz/Motiv schafft.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 9 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
3.2.6. Dokumentation<br />
Die tägliche, ausführliche Böhm-Dokumentation ist notwendig um den emotionalen Zustand<br />
des Bewohners zu erfassen und Probleme zu erkennen. Im Berichtsblatt wird erfasst was er<br />
tut, wie er es macht, wie er dabei aussieht (Gestik, Mimik, Sprache, Blickkontakt) und wie es<br />
ihm dabei geht (wirkt/scheint).<br />
An der wöchentlichen Böhm-Visite nehmen mindestens vier Mitarbeiter teil. Hierbei wird nach<br />
dem Böhm´schen Regelkreis vorgegangen.<br />
4. Aktivierungsarbeit<br />
Nicht unterfordern, nicht überfordern, aber belasten, ist Grundsatz der Aktivierungsarbeit<br />
nach Böhm um eine gezielte Aktivierung und Reaktivierung zu erreichen. Wichtig ist dabei,<br />
dass die Biographie und Ressourcen des Einzelnen berücksichtigen werden.<br />
4.1 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten<br />
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten sind unter anderem Kochen, Backen, Spülen, Abtrocknen,<br />
Bügeln und Blumenpflege usw.<br />
Ziele:<br />
- Erhaltung von Fähigkeiten und Fertigkeiten<br />
- Schaffung von Erfolgserlebnissen<br />
- Gleichzeitige Förderung der manuellen Feinmotorik<br />
Mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten können sich auch schwer verwirrte Bewohner<br />
identifizieren. Altvertrautes Können und Wissen wird reaktiviert und führen zu sichtbaren<br />
Erfolgserlebnissen.<br />
4.2. Handwerkliches Arbeiten<br />
Unter handwerkliches Arbeiten fallen alle Aktivierungen die biographisch mit dem erlerntem<br />
Beruf, hausfraulichen Tätigkeiten oder Hobbys zu tun haben wie z. B. Stopfen, Nähen,<br />
Häkeln, Stricken, Schuhe putzen, Gehweg kehren, Bilder aufhängen, kaputte Gegenstände<br />
reparieren, kleine Holzarbeiten usw.<br />
Ziele:<br />
- Erhaltung manueller Geschicklichkeit<br />
- Freude am sinnvollen Tun<br />
4.3. Gartenarbeit<br />
Da demente Menschen oft zeitlich desorientiert sind, bietet der Garten, eine gute Möglichkeit<br />
die Jahreszeiten aktiv zu erfahren und mitzuerleben wie sich die Natur jahreszeitlich<br />
entsprechend verändert. Deshalb steht den Bewohnern der Garten das ganze Jahr zur<br />
Verfügung.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 10 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
Frühjahr: - Hochbeet und Kräutergarten wird bepflanzt<br />
- Sträucher werden geschnitten und in Form gebracht<br />
Sommer: - Ernte je nach Reife der verschiedenen Bepflanzungen, z.B.<br />
Erdbeeren, Kohlrabi, Salat, Tomaten usw.<br />
Herbst: - Laubkehren und beseitigen der Blätter aus den Beeten<br />
- Ernten von Nüssen und den letzten Früchten<br />
Winter: - Schnee räumen<br />
Die Gartenarbeit wird vom <strong>Pflege</strong>personal angeleitet, z.B. Blumengießen, Bepflanzen und<br />
Ernten. Der Bewohner hat jedoch jederzeit die Möglichkeit aus eigener Motivation heraus<br />
sich an den Früchten und Kräutern zu bedienen, das Beet zu harken, die Wege zu kehren<br />
oder sich auch nur als Beobachter im Garten aufzuhalten und genießen.<br />
4.4. Gruppenaktivierung<br />
Ziele:<br />
- Förderung des Gefühls der Zugehörigkeit und Eingebundenheit<br />
- Förderung sozialer Kontakte<br />
Die Gruppenaktivierung findet meist an den Nachmittagen statt und richtet sich nach den<br />
Jahreszeiten, orientiert sich aber auch am gesamten Wochenplan im Haus. Der Bewohner<br />
soll hierbei die Möglichkeit haben mit anderen Bewohnern in Kontakt zu treten und<br />
Angehörige können leicht mit einbezogen werden. Das Altzeitgedächtnis wird aktiviert,<br />
Lebensfreude wird vermittelt und erhalten.<br />
Gruppenaktivitäten können sein:<br />
- singen (Einsatz von Musik aus den 20 er bis 50 er Jahren)<br />
- tanzen<br />
- Zeitung (vor)-lesen<br />
- Geburtstage feiern<br />
- Geschichten vorlesen<br />
- Gesellschaftsspiele, Sprichwörter raten<br />
- Gymnastik<br />
- Fernsehabende<br />
- Grillabende<br />
- Gesprächskreis<br />
- Kaffeerunde<br />
- Zehn-Minuten-Aktivierung<br />
- Ausflüge<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 11 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
4.5. Einzelaktivierung<br />
Ziele:<br />
- eine individuelle Impulssetzung ermöglichen<br />
- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zur <strong>Pflege</strong>kraft<br />
- gezieltes Eingehen auf Emotionen und besondere Bedürfnisse des einzelnen<br />
Bewohners, die durch eine Gruppenaktivität unter- bzw. überfordert sind.<br />
Einzelaktivitäten können sein:<br />
- Basale Stimulation<br />
- Besuch von Therapiepuppen<br />
- Einkaufsfahrten<br />
- Biographiegespräch, Erinnerungsarbeit<br />
- Entlastungsgespräch<br />
- Konfliktgespräch<br />
- Bewegungsübungen<br />
- Spaziergänge<br />
- Kontakte zu Angehörigen unterstützen durch z.B. Briefe schreiben, Telefonate<br />
5. Kooperation mit externen Berufsgruppen<br />
Die <strong>Pflege</strong> arbeitet eng mit folgenden Berufsgruppen zusammen:<br />
- Hausärzte: Der Bewohner hat grundsätzlich die Möglichkeit sich seinen Hausarzt frei<br />
zu wählen. Viele Ärzte kommen jedoch nicht zur Visite ins Haus und mit<br />
zunehmendem Krankheitsverlauf ist es oftmals schwierig zu den einzelnen Ärzten zu<br />
gelangen und die lange Wartezeit zu überbrücken. Aus diesem Grund arbeiten wir<br />
vorwiegend mit ortsansässigen Ärzten zusammen, die regelmäßig zur Visite in den<br />
Wohnbereich kommen, damit Probleme und Veränderungen zeitnah besprochen<br />
werden können.<br />
- Fachärzte: Gelegentlich werden bei spezifischen Problemen zusätzlich Fachärzte<br />
hinzugezogen. Neurologenvisite erfolgt zweimal monatlich. Hier werden Probleme<br />
besprochen, aber im Wesentlichen auch die Dosierung der Psychopharmaka überprüft<br />
und kontinuierlich reduziert. Der Neurologe ist über die Grundzüge des<br />
Psychobiographischen <strong>Pflege</strong>modells informiert und unterstützt die <strong>Pflege</strong>kräfte darin.<br />
- Augen-, HNO- und Zahnärzte sowie Urologen machen auf Anfrage Hausbesuche.<br />
Bei Bedarf einer Behandlung durch einen weiteren Facharzt werden für die<br />
Bewohner Termine in der Praxis bzw. Klinik vereinbart, und die <strong>Pflege</strong>kräfte<br />
koordinieren den Transport und begleiten sie wenn nötig<br />
- Weitere externe Berufsgruppen mit denen jede <strong>Pflege</strong>kraft zusammen arbeitet sind<br />
Seelsorger, Sanitätshäuser, Krankengymnasten, Apotheken, Vormundschaftsgericht,<br />
Gesundheitsamt, MDK, Krankenhäuser und Bezirkskliniken.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 12 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
6. Zusammenarbeit mit Berufsgruppen im Haus<br />
Jeder Mitarbeiter im Haus, der in diesem Wohnbereich mit den Bewohnern in Kontakt tritt<br />
sollte das <strong>Pflege</strong>modell kennen und mit ihm umgehen können! Das bedeutet<br />
beispielsweise, dass sich zu den Mahlzeiten gemeinsam zum Essen gesetzt wird. Dies<br />
betrifft jeden Mitarbeiter der sich zu dem Zeitpunkt auf der Station aufhält, also auch<br />
Raumpflege und Betreuungsassistenten. Mitarbeiter der Wäscherei verteilen regelmäßig<br />
die frisch gewaschene Bewohnerkleidung und sind angehalten dies mit den Bewohnern<br />
gemeinsam zu tun. Aufgaben der Raumpflege wie etwa Blumengießen sollen mit einem<br />
oder mehrerer Bewohner erledigt werden. Das Gemeinschaftsgefühl wird dadurch<br />
gefördert, die Raumpflege wird als Teil des Teams wahrgenommen und die<br />
Alltagsnormalität wird somit optimal unterstützt.<br />
Der Wohnbereich arbeitet zudem noch mit den anderen Wohnbereichen, der Küche, der<br />
Wäscherei, der Verwaltung, dem technischen Dienst und dem Sozialdienst zusammen.<br />
Heimleitung und <strong>Pflege</strong>dienstleitung unterstützen die Umsetzung des<br />
Psychobiographischen <strong>Pflege</strong>modells im Wohnbereich und arbeiten eng mit den<br />
<strong>Pflege</strong>kräften zusammen. Um die Zusammenarbeit zu optimieren finden täglich<br />
Besprechungen statt, in denen das Tagesgeschehen zusammengefasst, Abläufe<br />
koordiniert und Veranstaltungen geplant werden.<br />
7. Ehrenamtliche Mitarbeiter<br />
Das Haus verfügt über einige ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich je nach persönlicher<br />
Ressource in die Einrichtung einbringen. So finden beispielsweise Singgruppen,<br />
Spaziergänge oder auch Gesprächsrunden statt, die von den ehrenamtlichen Mitarbeitern<br />
durchgeführt werden. Für die Organisation und Logistik ist der Sozialdienst verantwortlich<br />
und wird hierbei von den <strong>Pflege</strong>kräften unterstützt.<br />
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden zu allen Festen und Ausflügen eingeladen. Meist<br />
unterstützen sie dann die angestellten Mitarbeiter bei der Betreuung der Bewohner.<br />
8. Angehörigenarbeit<br />
Wenn der Ehepartner, die Mutter oder der Vater an Demenz erkrankt, beginnt für die<br />
betroffenen Angehörigen eine schwierige Zeit. Sie müssen zusehen, wie Menschen die<br />
sie lieben oder für sie Respektspersonen waren, sich auf eine Weise verändern, die alles<br />
Vorhergehende in Frage stellt. Oft fühlen sie sich in dieser Situation allein gelassen, bzw.<br />
wissen nicht, wo sie Hilfe erfahren können. Das <strong>Pflege</strong>personal des Wohnbereiches steht<br />
daher schon vor dem eigentlichen Einzug den Angehörigen beratend zur Seite und gibt<br />
Hilfestellung wo sie benötigt wird. Darüber hinaus hält die Bezugspflegefachkraft des<br />
jeweiligen Bewohners stets engen Kontakt zu dessen Angehörigen.<br />
Wir wissen, dass Angehörige für uns wichtige Partner sind, denn sie sind diejenigen, die<br />
unsere Bewohner seit Jahren kennen und uns Auskunft über die Biographie geben<br />
können, sofern wir von den Bewohnern selber nicht ausreichend erfahren. Unser<br />
Wohnbereich steht für Angehörige immer offen und sie sind zu jeder Zeit willkommen. Wir<br />
ermuntern sie, sich bei uns einzubringen und am Leben im Wohnbereich teilzunehmen.<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 13 von 14
KV <strong>Roth</strong>- <strong>Schwabach</strong><br />
<strong>AWO</strong> <strong>Pflege</strong>heim<br />
Petersgmünd<br />
<strong>QM</strong>- <strong>Handbuch</strong> <strong>Pflege</strong><br />
Stationäre <strong>Pflege</strong><br />
<strong>Pflege</strong> und Betreuung<br />
IV – 03.03.1 <strong>Pflege</strong>konzept Gerontopsychiatrischer Wohnbereich<br />
Das <strong>Pflege</strong>personal hat stets ein offenes Ohr für Probleme, Wünsche und Anregungen<br />
seitens der Angehörigen und bespricht mit ihnen die Umsetzung in den<br />
<strong>Pflege</strong>planungsprozess.<br />
Wir wissen auch, dass es für Angehörige von demenzkranken Personen manchmal<br />
notwendig ist, Abstand von der Situation zu bekommen. Daher wird es vom<br />
<strong>Pflege</strong>personal akzeptiert, wenn Angehörige eventuell eine Zeitlang nicht zu Besuch<br />
kommen und wird auch nicht in Frage gestellt. Damit es dennoch möglich ist mit anderen<br />
Angehörigen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und die Bewohner vielleicht von<br />
einer anderen Seite zu erleben finden regelmäßig Feste und Feiern im Haus statt zu<br />
denen Angehörige eingeladen und ausdrücklich erwünscht sind.<br />
Um sich näher über unseren Wohnbereich und das <strong>Pflege</strong>konzept zu informieren stehen<br />
den Angehörigen mehrere Möglichkeiten offen. Der Wohnbereich verfügt über einen<br />
Flyer, sowie über eine Kurzinformation in der die wesentlichen Inhalte des Konzeptes<br />
einfach beschrieben sind. Zudem bietet der Wohnbereich alle drei Monate eine<br />
Angehörigensprechstunde an.<br />
Schlusswort<br />
<strong>Pflege</strong> ist ein Prozess und somit keine starre Einheit sondern bedarf einer stetigen<br />
Weiterentwicklung. Alle Mitarbeiter des Wohnbereiches tragen dazu bei, die Qualität und die<br />
Entwicklung voran zu treiben und dabei die Würde und Selbstständigkeit des Einzelnen zu<br />
berücksichtigen. Daher kann dieses Konzept nur als Richtschnur verstanden werden und<br />
unterliegt einer regelmäßigen Kontrolle. Bei Bedarf wird dieses Konzept nach neuesten<br />
wissenschaftlichen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen überarbeitet.<br />
Petersgmünd, September 2010<br />
Bearbeiter/in Freigabe (HL/QB) Version Datum Seite<br />
Lauterbach/Weger 1.0 14.09.2010 14 von 14