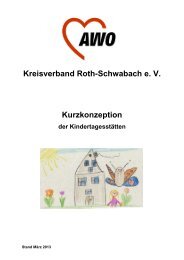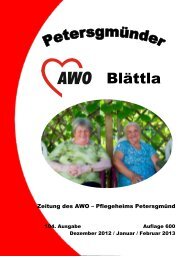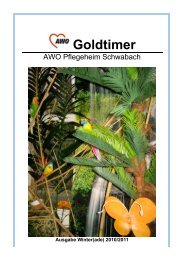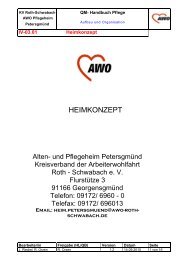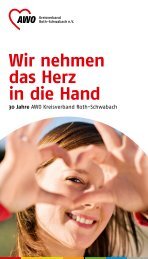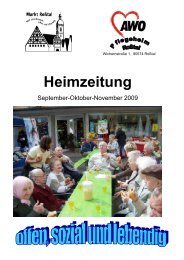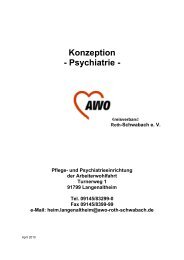Wohnpflegeheim Wengen - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
Wohnpflegeheim Wengen - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
Wohnpflegeheim Wengen - AWO Kreisverband Roth-Schwabach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
des <strong>Wohnpflegeheim</strong>es <strong>Wengen</strong><br />
Langzeiteinrichtung für psychisch kranke Menschen<br />
Gliederung:<br />
1. Zielgruppe<br />
2. Krankheitsverständnis nach dem<br />
multifaktoriellen Konzept<br />
3. Teamzusammenstellung<br />
4. Teamorganisation<br />
5. Psychosoziale Betreuung<br />
6. Einrichtungsstruktur und Gesetzesgrundlagen<br />
7. Ergänzende Fachkonzepte<br />
<strong>Wengen</strong>, Mai 2009<br />
V.i.S.d.P Irmgard Orterer<br />
Einrichtungsleitung<br />
<strong>Wohnpflegeheim</strong> <strong>Wengen</strong><br />
Arbeiterwohlfahrt <strong>Kreisverband</strong> <strong>Roth</strong>/<strong>Schwabach</strong><br />
<strong>Wengen</strong> 14 a 91790 Nennslingen<br />
Tel. 09147/94 68 88-0 FAX 09147/94 68 88-20<br />
E-Mail:heim.wengen@awo-roth-schwabach.de<br />
Daniela Kreß<br />
Dipl.Soz.Päd. (FH)
1. Zielgruppe<br />
Um die Zielgruppe für unsere Einrichtung zu definieren, stellen wir an dieser<br />
Stelle eine Definition für psychische / geistige Gesundheit voran:<br />
„Die geistige Gesundheit setzt beim Individuum die Gewohnheit voraus,<br />
harmonische Beziehungen mit anderen zu knüpfen und teilzunehmen an oder<br />
beizutragen zu den Veränderungen des sozialen oder physischen Milieus. Sie<br />
schließt in gleicher Weise auch die harmonische und ausgeglichene Lösung<br />
der Konflikte in Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen eigenen<br />
Triebtendenzen mit ein. Sie erwartete außerdem vom Individuum, den<br />
Charakter in der Art zu entwickeln, daß es seine Persönlichkeit entfaltet, indem<br />
es sich seinen Trieben öffnet, die Konflikte auslösen können, und ihnen ein<br />
harmonisches Ausdrucksfeld in der vollständigen Realisierung seiner<br />
Möglichkeiten schafft.“<br />
( Battegay, Benedetti, Rauchfleisch 1977, S.19)<br />
Diese Definition zeigt klar auf, welche Defizite im Zusammenhang mit einer<br />
psychischen Erkrankung stehen, was aus dem zweiten Bayerischen<br />
Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter<br />
(1990) hervorgeht. Hier wird die Zielgruppe wie folgt definiert:<br />
„Zu dieser Gruppe (der psychisch Kranken) [sic] zählen Kranke mit Psychosen,<br />
Neurosen und anderen nichtpsychotischen psychischen Störungen, zerebrale<br />
Anfallskranke nur insofern, als ihre psychischen Symptome betroffen sind.“<br />
(ebd. S.17)<br />
Die epidemiologischen Ergebnisse der Forschung zeigen auf, dass rund 25%<br />
der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens einmal an einer psychischen Störung<br />
erkranken (vgl. zweiter Bayerischer Landesplan, 1990 S.17/18).<br />
Aus diesen Ausführungen geht deutlich hervor, dass das Klientel unserer<br />
Einrichtung mit weit reichenden Problematiken und Störungen zu uns kommt,<br />
ein Ausschlussverfahren ist aufgrund der vielen Anfragen nicht möglich.
Dennoch versuchen wir, durch das Anbieten von Probewohnen dem Klienten<br />
und uns die Möglichkeit zu bieten, erste Eindrücke zu sammeln und ein<br />
Agieren auf einer gemeinsamen Basis zu initiieren bzw. frühzeitig<br />
Unstimmigkeiten zu erkennen.<br />
Unsere Einrichtung möchte chronisch psychisch Kranken eine Heimat bieten<br />
und ihnen ein möglichst selbständiges und individuelles Leben, bis hin zur<br />
Eingliederung in die Gesellschaft, ermöglichen. Aus dem Bayerischen<br />
Landesplan von 1990 geht hervor, dass gerade dieses Klientel eine<br />
Problemgruppe darstellt, die Bayernweit rund 90.000 Menschen umfasst<br />
(vgl.ebd. S.18).<br />
Bei diesem Klientel handelt es sich um Menschen, die in ihrem sozialen Umfeld<br />
in besonderer Weise „sensibel“ sind und schwere Einschränkungen in den<br />
sozialen Fähigkeiten aufzeigen.<br />
Die Heimkosten können über Eingliederungshilfen oder Hilfe zur Pflege<br />
beantragt werden.<br />
2. Krankheitsverständnis nach dem multifaktoriellen Konzept<br />
2.1. Das multifaktorielle Konzept<br />
Das multifaktorielle Konzept macht deutlich, dass psychische Erkrankungen<br />
sich aus bio- psycho-sozialen Elementen zusammensetzen, welche sich<br />
gegenseitig bedingen und auf einer genetischen Disposition beruhen. Diese<br />
genetische Disposition liegt hier in einer erblich bedingten Vulnerabilität (=<br />
prämorbide Verletzlichkeit) welche zur Folge hat, dass eine Person seelisch<br />
schneller und leichter verletzbar ist, als Menschen ohne diese Veranlagung. Im<br />
Zusammenspiel mit psychischen und sozialen Faktoren kann es dann zu einer<br />
Auslenkung im biologischen Haushalt kommen, was dann eine akute<br />
Psychose nach sich ziehen kann.<br />
Die Elemente und Komponenten dieses Konzeptes beziehen sich nicht<br />
ausschließlich auf ihre auslösenden Momente, sondern verdeutlichen welche
Bereiche des Lebens von der psychischen Krankheit betroffen bzw.<br />
eingeschränkt sind.<br />
2.2. Krankheitsverständnis<br />
Basis für die Behandlung in unserer Institution ist ein Krankheitsverständnis,<br />
welches sich mit allen Konsequenzen am multifaktoriellen Konzept orientiert.<br />
Das heißt, dass wir versuchen durch einen mutliprofessionellen Background<br />
die Arbeit mit den Klienten ganzheitlich zu gestalten, an deren Ressourcen<br />
anzusetzen und für jeden Einzelfall durch das Erstellen eines individuellen<br />
Hilfeplanes den Bedürfnissen und Förderzielen gerecht zu werden.<br />
In der Versorgung von psychisch Kranken bedarf es im Rahmen der<br />
ganzheitlichen aktivierenden Pflege vor allem einer intensiven<br />
therapeutischen Betreuung.<br />
Pflege und Therapie bilden dabei eine Einheit.<br />
Fähigkeiten der Klienten gilt es nicht nur zu erhalten, sondern auch<br />
auszubauen, zu stabilisieren und zu fördern.<br />
Ebenso muss eine größt möglichste gesellschaftliche Akzeptanz angestrebt<br />
werden, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen gesichert und eine<br />
medizinische Grundversorgung gewährleistet werden.<br />
3. Teamzusammensetzung<br />
3.1. Das multiprofessionelle Team als Notwendigkeit<br />
Da die Arbeit mit dem Klientel in unserer Einrichtung auf dem multifaktoriellen<br />
Konzept basiert, wird deutlich, dass dieses Krankheitsverständnis ein<br />
mutliprofessionelles Team zur Umsetzung einer qualitativ hochwertigen und an<br />
den individuellen Ressourcen und Bedürfnissen orientierten Betreuung und<br />
Pflege bedarf.<br />
Eine professionsübergreifende Zusammenarbeit (auch mit Professionen<br />
außerhalb der Einrichtung) ermöglicht „ die umfassende Wahrnehmung der<br />
Klienten mit ihren Ressourcen und Beeinträchtigungen. Das Team stellt somit<br />
die fachliche Qualität der rehabilitativen Arbeit in allen Bereichen sicher.“
(Nernheim in: Claaßen, Cordshagen, Heimer, Schulze Steinmann (2003), S.<br />
146)<br />
Teambesprechungen sichern die professionsübergreifende Diskussion,<br />
Durchführung und Weiterentwicklung. Die therapeutische Arbeit findet im<br />
Rahmen des Bezugspersonensystems statt; Supervision und<br />
Fortbildungsangebote sichern die Qualität der Arbeit.<br />
3.2. Berufsbilder<br />
• Pflegebereich<br />
Im Bereich Pflege arbeiten Fach- und Hilfskräfte:<br />
- die Pflegefachkräfte sind Kranken- und Altenpfleger, zum Teil mit<br />
gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung;<br />
- die Pflegehilfskräfte sind Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer,<br />
Arzthelferin, Auszubildende in der Altenpflege; Zivildienstleistende und<br />
junge Frauen im freiwilligen sozialen Jahr<br />
• Behindertenbereich<br />
Im Betreuungsbereich arbeiten:<br />
- Dipl. Sozial.Päd. (FH)<br />
- Krankenpfleger<br />
- Heilerziehungspfleger<br />
- Heilerziehungspflegehelfer<br />
- Auszubildende zum Heilerziehungspfleger/in<br />
- Zivildienstleistende<br />
- Vorpraktikanten und FSJler/innen<br />
• Hauswirtschaft<br />
Der Bereich Hauswirtschaft umfasst Küche, Wäscherei und Hausreinigung.<br />
Hier arbeiten:<br />
- Meisterin der städt. Hauswirtschaft mit Ausbildereignung<br />
- Hauswirtschafterin<br />
- Schneiderin
- Auszubildende der städt. Hauswirtschaft<br />
- Auszubildende zur Hauswirtschaft technischen Helferin<br />
- Angelernte Hilfskräfte<br />
• Verwaltung<br />
Der Bereich Verwaltung wird von zwei Mitarbeiterinnen getragen.<br />
- Verwaltungsangestellte<br />
Neben der Einrichtungsleitung gibt es für jeden Bereich eine Leitungsperson.<br />
Die Bereichsleitungen und die Einrichtungsleitung agieren als Team und<br />
sichern ihren Austausch in regelmäßigen Leitungsteambesprechungen.<br />
4. Teamorganisation<br />
4.1. Organigramm<br />
Siehe Anhang<br />
4.2. Multiprofessionelle Zusammenarbeit mit externen Berufsgruppen<br />
Neben den in der Einrichtung vertretenen Berufsgruppen ist es von<br />
wesentlicher Bedeutung sich mit externen Berufsgruppen zu vernetzen, da nur<br />
so eine qualitativ hochwertige und an den Bedürfnissen der Klienten<br />
orientierte Betreuungs- und Pflegeleistung gesichert werden kann.<br />
Neben der medizinischen Versorgung durch die Vernetzung mit<br />
Allgemeinärzten und Neurologen, basiert eine enge Zusammenarbeit mit den<br />
Berufsbetreuern, in Einzelfällen mit der Bewährungshilfe, Ämtern und<br />
Behörden, dem Kreiskrankenhaus Weißenburg und dem Bezirkskrankenhaus in<br />
Ansbach.<br />
Auch die Vernetzung zu anderen Einrichtungen und die Initiierung einer<br />
Angehörigengruppe tragen für den Anspruch der Ganzheitlichkeit unserer<br />
Arbeit bei.
5. Psycho-soziale Betreuung<br />
5.1. Basis der psycho-sozialen Betreuung: Empowerment als Grundhaltung<br />
Da unsere Einrichtung eine ganzheitliche Haltung im Umgang mit den<br />
Klienten vertritt und darauf abzielt, den Klienten als Individuum mit eigenen<br />
Interessen und Bedürfnissen auch innerhalb einer stationären<br />
Versorgungsmaßnahme wahrzunehmen, muss sich unsere Arbeit am<br />
Empowerment - Ansatz orientieren.<br />
In der sozialen Arbeit wird dieser Ansatz wie folgt definiert:<br />
„Empowerment meint den Prozess, innerhalb dessen Menschen sich ermutigt<br />
fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen<br />
Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert<br />
selbsterarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen. Empowerment bezieht sich<br />
auf einen Prozess, in dem die Kooperation von gleichen und ähnlichen<br />
Problemen betroffener Personen durch Zusammenarbeit zu synergetischen<br />
Effekten führt. Aus Sicht professioneller und institutionalisierter Hilfen bedeutet<br />
die Empowerment- Perspektive die aktive Förderung solcher solidarischen<br />
Formen der Selbstorganisation.“<br />
( Keupp 1996, in Galuske, 1999 S.230)<br />
Wörtlich bedeutet „Empowerment“ Bemächtigung und bezeichnet den<br />
Prozess der Entwicklung „in die Dimension der Zeit, in deren Verlauf Menschen<br />
die Kraft gewinnen, der sie bedürfen, um ein nach eigenen Maßstäben<br />
buchstabiertes `besseres´ Leben zu leben“<br />
( Herriger, 1997, S.11).<br />
Für die Arbeit im therapeutischen Milieu, aber auch für eine aktivierende<br />
Pflege heißt das, dass die Selbstbestimmung der Klienten immer geachtet und<br />
respektiert werden muss. Es gilt das Klientel zur Selbstbestimmung anzuleiten<br />
und Ziele und Vorgehen immer mit den Klienten abzusprechen und an diese<br />
anzugleichen.
Nur mit dem Empowerment - Ansatz als Basis für unsere Arbeit kann die<br />
Eigenständigkeit der Klienten erhalten und gefördert werden, zudem kann so<br />
Abhängigkeitsbeziehungen und Hospitalismuserscheinungen<br />
entgegengewirkt werden.<br />
In der Praxis fordert der Ansatz von allen Mitarbeitern ein Ausloten des realen<br />
Hilfebedarfs des Klienten. Bietet der Mitarbeiter eine zu intensive Betreuung<br />
besteht die Gefahr, dass er das Verhalten des Klienten hinsichtlich dessen<br />
Passivität bzw. den Folgen der erlernten Hilflosigkeit (des Hospitalismus)<br />
verstärkt. Deshalb muss ein Ausloten erfolgen um nur soviel Unterstützung zu<br />
leisten, dass Unterstützung auch eine wirkliche Hilfe ist und nicht<br />
problematische Verhaltensweisen verstärkt.<br />
Sämtliche Angebote richten sich nach dem Bezugspersonensystem. Somit<br />
hat jeder Klient einen festen Ansprechpartner, was Sicherheit und Vertrauen<br />
vermittelt und gerade für unsere Zielgruppe von großer Bedeutung ist.<br />
Der Bezugsmitarbeiter „ist im Gegensatz zum anonymen Schichtmodell auch<br />
nach Dienstende und am nächsten Tag wieder zuständig. Die Nähe kann<br />
Beziehungen entstehen lassen, das Aushandeln von Nähe und Distanz lernen<br />
helfen und dabei unterstützen, Konflikte auszutragen“. (Nernheim in: Claaßen,<br />
Cordshagen, Heimler, Schulze Steinmann (2003)S. 147)<br />
Gerade das betreute Klientel ist biographisch sehr in Beziehungsabbrüchen<br />
erfahren und hat durch das Bezugspersonensystem einen Partner zur Seite,<br />
auf den es sich verlassen kann.<br />
5.2. Module im Behindertenbereich<br />
Die einzelnen Module des Behindertenbereichs orientieren sich an den HEB-<br />
Bögen. Sie gliedern sich in die Bereiche _ Beschützender Wohnbereich,<br />
_ Offener Wohnbereich und _ Offener Wohnbereich (Fördergruppe).<br />
5.3. Module im Pflegebereich<br />
Die Module des Pflegebereiches gliedern sich in _ Beschützender<br />
Wohnbereich und _ Offener Wohnbereich. Sie orientieren sich an der<br />
Pflegeplanung.
5.4. Module im Bereich Organisation/ Administration<br />
Dieser Bereich gliedert sich ebenfalls in Behinderten- und Pflegebereich. Aber<br />
auch der Ambulante Bereich findet hier seinen Platz.<br />
5.5. Module im Ambulanten Bereich<br />
Das Betreute Wohnen besteht aus 2 unterschiedlichen Finanzierungsformen:<br />
dem Betreutes Wohnen nach Hilfebedarfsgruppen und dem Betreuten<br />
Wohnen über das Persönliche Budget.<br />
Auch die Externe Arbeitstherapie wird hier angeboten.<br />
6. Einrichtungsstruktur und Gesetzesgrundlagen<br />
Unsere Einrichtung ist ein <strong>Wohnpflegeheim</strong> und gliedert sich innerhalb der<br />
Einrichtungsstruktur in einen Behinderten- und einen Pflegebereich. Wir bieten<br />
sowohl im Behinderten-, als auch im Pflegebereich einen Beschützenden und<br />
einen Offenen Wohnbereich an. Der Behindertenbereich wird durch eine<br />
Fördergruppe ergänzt.<br />
Das Betreute Wohnen im Ambulanten Bereich ergänzt die stationären<br />
Angebote.<br />
Unsere Einrichtung will mit dieser Struktur den Klienten eine „Heimat auf Zeit“<br />
und gleichzeitig auch ein „Sprungbrett“ nach Draußen sein.<br />
Die wesentlichen Gesetzesgrundlagen stellen folgende Gesetzestexte dar:<br />
_ SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen<br />
_ SGB XII, Sozialhilfe (insbesondere §§53ff, 58, 75f)<br />
_ Eingliederungshilfe – Verordnung nach § 60 SGB XII<br />
_ Bayerischer Rahmenvertrag zu § 79 Abs. 1 SGB XII<br />
_ Rahmenleistungsvereinbarung in der aktuell geltenden Fassung<br />
_ SGB XI, Soziale Pflegeversicherung
Darstellung der Leistungsmodule als Übersicht<br />
_ Wohnen im Behindertenbereich<br />
_ Wohnen im Pflegebereich<br />
_ Ambulanter Bereich
7. Ergänzende Fachkonzepte<br />
_ Pflegebereich<br />
Konzeption Pflegebereich – Wohnbereiche 2 und 4<br />
_ Behindertenbereich<br />
Konzeption Behindertenbereich – Wohnbereiche 1, 3, und 5<br />
_ Ambulanter Bereich<br />
- Betreutes Wohnen<br />
- Externe Arbeitstherapie<br />
_ Bereichsübergreifende Angebote<br />
- Einrichtungsbeschreibung<br />
- Konzeption Tiere als Co- Therapeuten<br />
- Konzeption Malgruppe<br />
- Konzeption Singgruppe<br />
- Konzeption: Gewinnung, Begleitung und Koordination von<br />
Ehrenamtlichen<br />
- Konzeption Tagesstruktur<br />
- Konzeption Gesundheitsförderung<br />
- Konzeption Krisenbett<br />
- Konzeption Hauswirtschaftliche Versorgung
Literaturverzeichnis:<br />
Battegay, R./ Benedetti, G./ Rauchfleisch, U. (1977), Grundlagen und<br />
Methoden der Sozialpsychiatrie. Göttingen/ Zürich: Verlag für med.<br />
Psychologie im: Verlag Vadenhoeck & Ruprecht.<br />
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1990),<br />
Zweiter Bayerischer Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und<br />
psychisch Behinderter. München: MZ- Druck.<br />
Brandhofer, P. (Hrsg.) ( 1991),Gesetzessammlung für die Altenpflege.( 3.<br />
Erweiterte Auflage).Augsburg: MaroDruck.<br />
Finzen, A./ Schädel- Deininger, H. (1979), „Unter elenden<br />
menschenunwürdigen Umständen“. Die Psychiatrie- Enquête. Wunstdorf:<br />
Psychiatrie- Verlag.<br />
Nernheim, K., Rein in die Zukunft! Raus aus dem Heim! In:<br />
Claaßen,J./ Cordshagen, H./ Heimler, J./ Schulze Steinmann, L. (Hrsg..) (2003),<br />
Die Zukunft sozialpsychiatrischer Heime. Bonn: Psychiatrie- Verlag.<br />
Galuske, M. (1999), Methoden der Sozialen Arbeit – Eine Einführung. (2.<br />
Auflage). Wernheim/ München: Juventa.<br />
Herriger, N. (1997), Empowerment in der Sozialen Arbeit- Eine Einführung.<br />
Stuttgart/ Berlin/ Köln: Kohlhammer.<br />
Rosemann, M. (1999), Zimmer mit Ausblick. Betreutes Wohnen bei psychischer<br />
Krankheit. Bonn: Psychiatrie- Verlag.<br />
Vollmer, R. (1996), Elftes Buch- Sozialgesetzbuch – SGBXI. ( 3. Auflage).<br />
Remagen: AOK- VERLAG GmbH.