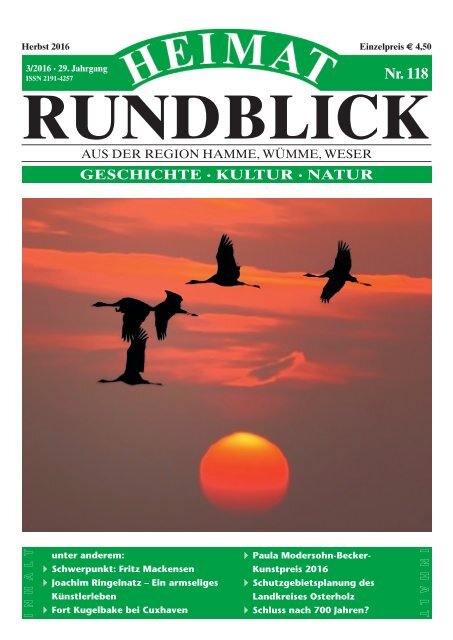Heimat-Rundblick 118 - Herbst 2016
Magazin für Geschichte - Kultur - Geschichte in der Region Hamme, Wuemme Weser
Magazin für Geschichte - Kultur - Geschichte in der Region Hamme, Wuemme Weser
- TAGS
- mackensen
- ringelnatz
- worpswede
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
Einzelpreis € 4,50<br />
3/<strong>2016</strong> · 29. Jahrgang<br />
ISSN 2191-4257 Nr. <strong>118</strong><br />
RUNDBLICK<br />
AUS DER REGION HAMME, WÜMME, WESER<br />
GESCHICHTE · KULTUR · NATUR<br />
I N H A L T<br />
unter anderem:<br />
Schwerpunkt: Fritz Mackensen<br />
Joachim Ringelnatz – Ein armseliges<br />
Künstlerleben<br />
Fort Kugelbake bei Cuxhaven<br />
Paula Modersohn-Becker-<br />
Kunstpreis <strong>2016</strong><br />
Schutzgebietsplanung des<br />
Landkreises Osterholz<br />
Schluss nach 700 Jahren?<br />
I N H A L T
Anzeigen<br />
Bestellcoupon<br />
Ja, ich möchte den HEIMAT-RUNDBLICK abonnieren.<br />
Zum Jahresvorzugspreis von € 18,– einschl. Versand.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Siebdruck<br />
Digitaldruck<br />
Außenwerbung<br />
Wilbri GmbH<br />
Gutenbergstraße 11<br />
28 865 Lilienthal<br />
Tel. 04298-2706 0<br />
www.wilbri.de<br />
Name / Vorname<br />
Straße / Hausnummer<br />
PLZ / Ort<br />
Bezahlung:<br />
Überweisung auf Kto. 1 410 007 528<br />
Kreissparkasse Lilienthal (BLZ 291 523 00)<br />
IBAN: DE27 2915 2300 1410 0075 28 · BIC: BRLADE21OHZ<br />
Abbuchung von meinem Konto Nr.<br />
Bank:<br />
IBAN:<br />
• Offsetdruck • Digitaldruck • Werbetechnik<br />
• Fensterbeschriftung<br />
• Fahrzeugbeschriftung<br />
• Schild-/ Lichtreklame<br />
• Teil-/ Vollfolierung<br />
• Großformatdruck<br />
• Glasdekorfolie<br />
• Banner<br />
• Roll-Up<br />
• Pylon<br />
• und vieles mehr...<br />
Mit freundlicher Genehmigung der Firma Carl Fiedler · www.glaserei-fiedler.de<br />
Redaktionssitzung<br />
Die nächste Redaktionssitzung findet statt am<br />
15. Oktober <strong>2016</strong>, 15.00 Uhr,<br />
im „Köksch un Qualm“,<br />
Stader Landstraße 46, 28719 Bremen<br />
Gewerbegebiet Moorhausen · Scheeren 12 · 28865 Lilienthal<br />
Lilienthal Tel.: 0 42 98 / 3 03 67 · Bremerhaven Tel.: 0471 / 4 60 53<br />
info@langenbruch.de · www.langenbruch.de<br />
Anmeldungen werden erbeten<br />
bis zum 10. Oktober <strong>2016</strong> unter<br />
Tel. 04298 / 46 99 09 oder info@druckerpresse.de
Aus dem Inhalt<br />
Aktuelles<br />
Manfred Simmering<br />
Äpfel, Äpfel, Äpfel … Seite 6<br />
Johannes Kleine-Büning<br />
Schutzgebietsplanung des<br />
Landkreises Osterholz Seite 12 – 13<br />
Jürgen Langenbruch<br />
Redaktionssitzung Seite 20<br />
Wilhelm Berger<br />
Schluss nach 700 Jahren? Seite 22 – 25<br />
Harald Kühn<br />
Gedenkfeier am Schroeter-Grab Seite 26<br />
<strong>Heimat</strong>geschichte<br />
Rudolf Matzner<br />
Ein armseliges Künstlerleben Seite 4 – 6<br />
Rudolf Matzner<br />
Die Küstenfestung<br />
Fort Kugelbake bei Cuxhaven Seite 8 – 9<br />
Kultur<br />
Ursula Villwock<br />
Paula Modersohn-Becker-<br />
Kunstpreis <strong>2016</strong> Seite 10 – 11<br />
Dr. Helmut Stelljes<br />
„Goldene Medaille I. Classe“<br />
für Fritz Mackensen Seite 14 – 15<br />
Prof. Dr. Jürgen Teumer<br />
Fritz Mackensen: Einblicke in<br />
die Familienchronik Seite 16 – 19<br />
Katja Pourshirazi<br />
Fritz Mackensen – Der umstrittene<br />
Erfinder Worpswedes Seite 19 – 20<br />
Natur<br />
Maren Arndt<br />
Vogel des Glücks Seite 7<br />
NABU<br />
Am Brunnen vor dem Tore …<br />
Die Winterlinde ist<br />
Baum des Jahres <strong>2016</strong> Seite 21<br />
Serie<br />
Peter Richter<br />
‘n beten wat op Platt Seite 11<br />
Peter Richter<br />
Die plattdeutsche<br />
Beduinensklavin Seite 11<br />
Peter Richter<br />
Bauernregeln Seite 21<br />
Jan Brünjes<br />
Lach- und Torfgeschichten Seite 27<br />
Redaktionsschluss für die nächste<br />
Ausgabe: 15. November <strong>2016</strong><br />
Liebe Leserinnen<br />
und Leser,<br />
der Sommer zeigt sich in diesen<br />
Tagen Mitte September noch einmal<br />
von der besten Seite. Ich schreibe<br />
Ihnen diese Zeilen während der alljährlichen<br />
Leserreise, die uns diesmal<br />
nach Münster führt, einer Stadt, die<br />
für die deutsche Geschichte von<br />
besonderer Bedeutung ist. Vielleicht<br />
sind Sie unter den Mitreisenden und<br />
können Ihren Freunden von einer<br />
sonnigen und interessanten Fahrt<br />
berichten. Die Redaktion bemüht<br />
sich, den Leserinnen und Lesern Artikel<br />
zu bieten, die zum einen flüssig<br />
zu lesen sind, auf der anderen Seite<br />
aber auch wissenschaftliches Niveau<br />
und neue Erkenntnisse bieten. Das<br />
schließt nicht aus, dass auch Themen<br />
zur Sprache kommen, die mit<br />
etwas Polemik gespickt sind. So z. B.<br />
die Artikel aus Heft 117 zur Erhaltung<br />
bzw. Zerstörung des Teufelsmoores.<br />
Herr Kleine-Büning, Leiter<br />
des Planungs- und Naturschutzamtes<br />
des Landkreises OHZ nahm dies<br />
zum Anlass für eine Darstellung der<br />
Schutzgebietsplanung aus Sicht des<br />
Landkreises. Ich bin der Meinung,<br />
dass eine solche kontroverse Diskussion<br />
für die Lebendigkeit unserer<br />
Zeitschrift durchaus einen Gewinn<br />
bedeutet.<br />
Kontrovers ist auch die Sicht auf Fritz<br />
Mackensen, der als Initiator für das<br />
„Weltdorf“ Worpswede gilt. Unsere<br />
Autoren Dr. Katja Poushirazi, Dr. Helmut<br />
Stelljes und Prof. Dr. Jürgen Teumer<br />
haben sich intensiv mit ihm und<br />
seiner Familie beschäftigt und sind<br />
in Archiven und bei persönlichen<br />
Kontakten mit den Nachkommen<br />
der Familie fündig geworden und<br />
können die sozialen und persönlichen<br />
Hintergründe des umstrittenen<br />
Künstlers etwas aufhellen. Nicht zu<br />
verdecken ist, dass Fritz Mackensen<br />
sich engagiert für nationalsozialistische<br />
Kulturpolitik eingesetzt hat - im<br />
Gegensatz z. B. zu Heinrich Vogeler,<br />
Titelbild:<br />
Kraniche im Flug<br />
Foto: Maren Arndt<br />
der sich von der volkstümelnden,<br />
rückwärts gewandten Kunstrichtung<br />
abgewandt hat und versuchte, seine<br />
Kunst in den Dienst einer erhofften<br />
neuen Menschheitsentwicklung zu<br />
stellen. Dieses Heft ist also etwas<br />
„mackensenlastig“; auch in der folgenden<br />
Ausgabe werden noch weitere<br />
Ergänzungen folgen.<br />
Aber - es gibt nicht nur „Worpswede“.<br />
Sie lesen über Ringelnatz in<br />
Bremen, die Kugelbake in Cuxhaven,<br />
den „Vogel des Glücks“ und<br />
den Paula Modersohn-Becker-Preis,<br />
der am 6. November <strong>2016</strong> verliehen<br />
wird, die Geschichte eines Teufelsmoorer<br />
Hofes, zum 200. Todestag<br />
von Johann Hieronymus Schroeter,<br />
dazu etwas für die Freunde der plattdeutschen<br />
Sprache.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei<br />
der Lektüre!<br />
Ihr Jürgen Langenbruch<br />
Impressum<br />
Herausgeber und Verlag: Druckerpresse-Verlag UG<br />
(haftungsbeschränkt), Scheeren 12, 28865 Lilienthal,<br />
Tel. 04298/46 99 09, Fax 04298/3 04 67, E-Mail<br />
info@heimat-rundblick.de, Geschäftsführer: Jürgen<br />
Langenbruch M.A., HRB Amtsgericht Walsrode 202140.<br />
Redaktionsteam: Wilko Jäger (Schwanewede),<br />
Rupprecht Knoop (Lilienthal), Dr. Christian Lenz (Teufelsmoor),<br />
Peter Richter (Lilienthal), Manfred Simmering<br />
(Lilienthal), Dr. Helmut Stelljes (Worps wede).<br />
Für unverlangt zugesandte Manuskripte und Bilder wird<br />
keine Haftung übernommen. Kürzungen vorbehalten. Die<br />
veröffentlichten Beiträge werden von den Autoren selbst<br />
verantwortet und geben nicht unbedingt die Meinung<br />
der Redaktion wieder. Wir behalten uns das Recht vor,<br />
Beiträge und auch Anzeigen nicht zu veröffentlichen.<br />
Leserservice: Telefon 04298/46 99 09, Telefax 04298/3 04 67.<br />
Korrektur: Helmut Strümpler.<br />
Erscheinungsweise: vierteljährlich.<br />
Bezugspreis: Einzelheft 4,50 €, Abonnement 18,– € jährlich<br />
frei Haus. Bestellungen nimmt der Verlag entgegen;<br />
bitte Abbuchungsermächtigung beifügen. Kündigung<br />
drei Monate vor Ablauf des Jahresabonnements.<br />
Bankverbindungen: Für Abonnements: Kreissparkasse<br />
Lilienthal IBAN: DE27 2915 2300 1410 0075 28,<br />
BIC: BRLADE21OHZ.<br />
Für Spenden und Fördervereins-Beiträge: Kreissparkasse<br />
Lilienthal, IBAN: DE96 2915 2300 0000 1221 50,<br />
BIC: BRLADE21OHZ, Volksbank Osterholz eG, IBAN:<br />
DE66 2916 2394 0732 7374 00, BIC: GENODEF1OHZ.<br />
Druck: Langenbruch, Lilienthal.<br />
Erfüllungsort: Lilienthal, Gerichtsstand Osterholz-Scharmbeck.<br />
Der HEIMAT-RUNDBLICK ist erhältlich:<br />
Bremen: Böttcherstraße/Ecke Andenkenladen<br />
Worpswede: Buchhandlung Netzel, Aktiv-Markt, Philine-<br />
Vogeler-Haus (Tourismus-Info), Barkenhoff.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
3
Ein armseliges Künstlerleben<br />
Joachim Ringelnatz war auch in Bremen<br />
Als meine Frau und ich vor etlichen Jahren<br />
mit der Landsmannschaft der Sachsen<br />
an einer Studienreise nach Mitteldeutschland<br />
teilnahmen, fuhren wir auch durch das<br />
Städtchen Wurzen. Der Reiseleiter Wolfgang<br />
Günther ließ den Bus in einer unauffälligen<br />
Straße halten und wir standen vor<br />
dem Geburtshaus von Hans Gustav Bötticher,<br />
alias Joachim Ringelnatz. Kurze<br />
Erklärung zur Person; wer war er und was<br />
hat ihn bekannt gemacht? Und schon ging<br />
es weiter.<br />
Es war eine liebgewordene Tradition,<br />
dass man den Abend gemeinsam mit einem<br />
Programm ausklingen ließ. Noch vor dem<br />
Abendessen drückte mir Wolfgang Günther<br />
eine Loseblattsammlung mit Ringelnatz-<br />
Gedichten in die Hand mit der Bitte, beim<br />
geselligen Zusammensein daraus vorzulesen.<br />
Doch das war nicht alles, was mich an<br />
Ringelnatz erinnerte.<br />
Joachim Ringelnatz ist viel gereist, hat<br />
Tagebuch geführt und darin aufgeschrieben,<br />
dass er im Juli 1924 als Seemann auch<br />
in Bremen war. Dabei erwähnte er, dass er<br />
auch die Damen des ältesten Gewerbes der<br />
Welt in der Helenenstraße gegenüber dem<br />
Ziegenmarkt einen Besuch abgestattet<br />
habe. Doch bedeutender und nachhaltiger<br />
war wohl sein Aufenthalt im Bremer Ratskeller.<br />
Welch ein Kontrast! Und hier schrieb<br />
er, als hätte er im Weinkeller folgendes<br />
Gedicht zu Papier gebracht. Teils eine<br />
Lobeshymne auf Bremen, andererseits auch<br />
ringelnatztypische skurrile Satzgebilde.<br />
Hier gelt ich nix, und würde gern etwas gelten,<br />
denn diese Stadt ist echt, und echt ist selten.<br />
Reich ist die Stadt. Und schön ist ihre Haut.<br />
Sag einer mir: Welch Geist hat hier<br />
die St.Ansgarikirche aufgebaut ?<br />
Groß schien mir alles, was ich hier entdeckte.<br />
Ein Riesenhummer lag in einem Laden,<br />
wie der die Arme eisern von sich reckte,<br />
als wollte er durchs Glas in Frauenwaden,<br />
in Bremer Brüste plötzlich fassen<br />
Und wie wir’s von den Skorpionen lesen -<br />
restweg im Koitus sein Leben lassen, -<br />
war er nicht schon länger rot und tot gewesen.<br />
Als ich herauskam aus dem Keller, wo<br />
schon Heine saß, da sagte ich „Oho“<br />
denn auf mich sah Paul Wegener aus Stein,<br />
und er war groß und ich natürlich klein.<br />
Brustwarzen hatte er an beiden Knien,<br />
vielleicht wars auch der Roland von Berlin.<br />
Und als ich, wie um eine spanische Wand<br />
mich schlängelnd, eine seltsam leere<br />
doch wohlgepflegte Villengasse fand<br />
und darin viel verlorene Ehre.<br />
Stand dort ein Dacharbeiter,<br />
den fragte ich so ganz nebenbei:<br />
ob er wohl ein Senator sei?<br />
da ging er lächelnd weiter.<br />
Porträt Joachim Ringelnatz, vor 1925<br />
Quelle: Wikipedia gemeinfrei<br />
Der in dem Gedicht erwähnte Paul<br />
Wegener war zu der Zeit ein bekannter<br />
Schauspieler, der mit Joachim Ringelnatz<br />
gut befreundet war.<br />
Joachim Ringelnatz, wie er sich ab 1919<br />
nannte, wurde am 7. August 1883 als jüngstes<br />
von drei Geschwistern in Wurzen bei<br />
Leipzig geboren. Er verstarb am 17.<br />
November 1934 in Berlin. Sein Vater entstammte<br />
einer thüringischen Gelehrtenfamilie.<br />
Die Mutter war die Tochter eines<br />
Sägewerksbesitzers. Der Vater hatte in jeder<br />
Hinsicht auf den Sohn mehr Einfluss als die<br />
Mutter. Mit der Mutter hatte Joachim Ringelnatz<br />
mehr Probleme. Als Siebenundzwanzigjähriger<br />
schrieb er an seine Verlobte<br />
AIma: „Mutterliebe fehlt uns beiden“.<br />
Hänseleien in<br />
der Schulzeit<br />
Die Schulzeit war für den seltsam aussehenden<br />
Jungen recht schwer. Von den Mitschülern<br />
wurde er wegen seiner mädchenhaften<br />
Frisur, seiner ungewöhnlich langen<br />
Vogelnase, seinem vordrängenden Kinn<br />
und seiner kleinen Statur gehänselt. Der<br />
Junge flüchtete sich in Trotz und Rüpeleien.<br />
Als Quintaner leistete sich Ringelnatz<br />
einen Streich zu viel: Während der Pause<br />
verließ er das Schulgebäude des König-<br />
Albert-Gymnasiums, ging zu einem neben<br />
der Schule gelegenen Zoo und ließ sich<br />
von einer Samoanerin auf den Unterarm<br />
eine Tätowierung stechen. Gegenüber seinem<br />
Lehrer gab er mit diesem Vorfall noch<br />
an. Die Reaktion war der Verweis vom<br />
Gymnasium. Es folgten Jahre auf einer privaten<br />
Realschule, aber auch diese Zeit war<br />
nicht besonders erfolgreich. Mit der im<br />
Abgangszeugnis bescheinigten Obersekundareife<br />
des zweimaligen Sitzenbleibers<br />
vermerkte ein Lehrer, der Absolvent sei<br />
„ein Schulrüpel ersten Ranges“.<br />
Schon 1886 zog die Familie von Wurzen<br />
nach Leipzig, wo der Vater der Künstlerund<br />
Gelehrtenszene angehörte. Hier verschrieb<br />
er sich ganz der Schriftstellerei.<br />
Joachim Ringenatz hatte sich in den<br />
Kopf gesetzt, unbedingt Seemann zu werden<br />
und so heuerte er als Schiffsjunge auf<br />
einem Segelschiff an. Doch das dauerte<br />
nur sechs Monate, von April 1901 bis September<br />
gleichen Jahres, dann hatte er vorerst<br />
genug von der so geliebten Seefahrt.<br />
Er wurde wegen seiner sächsischen Aussprache<br />
gehänselt und selbst der Kapitän<br />
nannte ihn „Nasenkönig“. In Britisch-Honduras<br />
riss er aus, verirrte sich im Urwald<br />
und wurde glücklicherweise wieder gefunden.<br />
Auf der Rückreise nach Hamburg<br />
wurde er noch mehr schikaniert. Nach dieser<br />
Enttäuschung war er zunächst arbeitslos<br />
und hatte kaum das Nötigste zum<br />
Leben. Als Aushilfe bei einer Schlangenschau<br />
auf dem Hamburger Dom - das ist<br />
ein großes Volksfest - half er Riesenschlangen<br />
zu tragen. Dieses war nur eine<br />
der über dreißig Beschäftigungen, die<br />
Joachim Ringelnatz ausübte, und wieder<br />
bestimmte sein Wunsch, Seemann zu werden,<br />
seinen weiteren Lebensweg. Seine<br />
Erfahrung auf dem Segelschiff konnte ihn<br />
nicht davon abhalten, als Leichtmatrose<br />
auf einem Motorschiff anzuheuern und die<br />
Weltmeere zu bereisen.<br />
Doch das war auch nicht von Dauer,<br />
Phasen von Arbeitslosigkeit und ohne<br />
Unterkunft bestimmten sein Leben.<br />
Bevor Ringelnatz in einem Seemannsheim<br />
untergeordnete Arbeiten verrichten<br />
konnte, lebte er von Essensspenden, die er<br />
dankbar annahm. Nun geriet er in einen<br />
Freundeskreis und hier lernte und schätzte<br />
er die ausschweifenden Trinkgewohnheiten.<br />
Des Feierns überdrüssig, heuerte er<br />
erneut auf Schiffen an, bis ihm 1903 die<br />
Ausübung des Matrosenberufes wegen<br />
mangelnder Sehschärfe seiner Augen<br />
untersagt wurde. Dennoch absolvierte er<br />
die Qulifikationsfahrt für den Militärdienst<br />
bei der Marine und diente 1904 als Einjährig-Freiwilliger<br />
bei der Kaiserlichen<br />
Marine in Kiel. Auch diese Zeit war relativ<br />
kurz und so begann erneut ein unstetes<br />
Leben. Zu einem geregelten Alltag war<br />
Ringelnatz auch nicht bereit.<br />
Ein Jahr danach, 1905, bemühte er sich<br />
um einen Studienplatz an der Universität<br />
Leipzig. Sein Interesse galt dem Studienfach<br />
Handelswissenschaften, doch bevor<br />
er sich einschreiben lassen konnte, verweigerte<br />
der Vater dem Sohn die finanzielle<br />
4 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Geburtshaus von Joachim Ringelnatz in Wurzen © Wikipedia CC-By-Sa 3.0 Joeb 07/Wikimedia Commons<br />
durchaus gefährlicher Einsatz. Unter großer<br />
Anstrengung schaffte Joachim Ringelnatz<br />
den Aufstieg zum Reserveoffizier, 1917 war<br />
er als Leutnant zur See Kommandant eines<br />
Minensuchbootes in Seeheim bei Cuxhaven.<br />
In seiner Freizeit interessierte er sich für<br />
das Leben von Schlangen und Eidechsen in<br />
einem Terrarium. Es gibt Hinweise, dass sein<br />
Nachname auf die Ringelnatter hinweist,<br />
weil sie sich zu Lande und im Wasser wohlfühlt.<br />
Der Vorname Joachim wird mit Ringelnatz’<br />
lebenslanger Gläubigkeit in Verbindung<br />
gebracht. Der Name bedeutet „Gott<br />
richtet auf“.<br />
Ringelnatz erlebte in den Nachkriegsjahren<br />
erneut entbehrungsreiche Jahre voller<br />
Kälte und Hunger.<br />
1920 heiratet er die fünfzehn Jahre jüngere<br />
Lehrerin Leonharda Pieper, die ihm<br />
eine unentbehrliche Hilfe bei all seinen<br />
schriftstellerischen Tätigkeiten war. Die<br />
beiden wohnten als Schwarzmieter in<br />
einer Münchener Wohnung, bis sie dann<br />
nach Berlin umzogen.<br />
Wie wenig sich die Lebensverhältnisse<br />
gebessert hatten, zeigt das folgende<br />
Gedicht:<br />
Unterstützung. Es ist doch erstaunlich,<br />
dass der Vater, der doch hätte wissen können,<br />
dass sein Sohn meistens am Rande<br />
des Existenzminimums lebte, kaum bereit<br />
war, ihm zu helfen. Joachim hatte zu<br />
schreiben und zu malen begonnen und<br />
dabei hatte der Vater vermittelt, dass er in<br />
AUERBACHS DEUTSCHEM KINDERKALEN-<br />
DER seine Werke veröffentlichen konnte.<br />
Doch das war keine ständige Unterhaltssicherung.<br />
Darüber hinaus entstanden seine<br />
ersten Ölbilder.<br />
Zur gleichen Zeit versuchte Joachim Ringelnatz<br />
als Lehrling in einer Hamburger<br />
Dachpappenfabrik eine Anstellung zu finden<br />
und danach als kaufmännischer Angestellter<br />
in Leipzig und Frankfurt/M. zu<br />
arbeiten. Und wieder war es die geregelte<br />
Arbeitszeit, die ihm nicht behagte. Jetzt<br />
begann er als fahrender Sänger und als<br />
Gelegenheitsarbeiter sein Geld zu verdienen.<br />
Vor Hunger entkräftet, vegetierte er in<br />
einer Bodenkammer und er schlief in einer<br />
Holzkiste. In Amsterdam hielt der deutsche<br />
Pfarrer ihn für einen Betrüger, zeigte ihn an<br />
und er wurde für kurze Zeit ins Gefängnis<br />
gesteckt.<br />
Danach nahm Ringelnatz eine Stellung<br />
als Buchhalter in einem Münchener Reisebüro<br />
an. Er gab bei der Einstellung an, fünf<br />
Fremdsprachen zu beherrschen, doch das<br />
konnte nicht gut gehen.<br />
Ab 1909 begann seine Laufbahn als<br />
Kabarettist mit Auftritten in der Münchener<br />
Künstlerkneipe SIMPLIZISSIMUS,<br />
jedoch sein Engagement wurde schlecht<br />
bezahlt und somit war auch das schnell<br />
wieder vorbei. Nun veröffentlichte er<br />
Gedichte und den autobiografischen Essay<br />
VIELLIEBER FREUND und das Märchen<br />
DER EHRLICHE SEEMANN.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
Bildungslücken sollten<br />
geschlossen werden<br />
Joachim Ringelnatz spürte, dass in gehobener<br />
Gesellschaft seine Bildung Lücken<br />
hatte und so ließ er sich privat von Baron<br />
Thilo von Seebach in Literaturgeschichte<br />
und anderen Fächern unterrichten. Doch<br />
seine Einkommensverhältnisse verbesserten<br />
sich durch die folgenden Aufträge keineswegs.<br />
So bemühte er sich zum Beispiel,<br />
als verkleidete Wahrsagerin in einem Bordell<br />
den Prostituierten die Zukunft vorauszusagen.<br />
Im Jahre 1912 fand er eine Anstellung als<br />
Privatbibliothekar bei einem Grafen und<br />
danach arbeitete er mit der gleichen Aufgabe<br />
bei dem Freiherrn von Münchhausen<br />
in Hannover und schließlich war Ringelnatz<br />
Fremdenführer auf der Burg Lauenstein.<br />
Danach absolvierte er einen Kursus als<br />
Schaufensterdekorateur. Er dekorierte<br />
jedoch nur ein Schaufenster, doch sein<br />
Können reichte nicht für eine weitere<br />
Beschäftigung.<br />
Es erschien seine Gedichtsammlung DIE<br />
SCHNUPFTABAKDOSE, die einige seiner<br />
bekanntesten Verse enthält. Für ein weiteres<br />
Werk bekam er ein einmaliges Honorar<br />
von 200 Mark. Weder als Schriftsteller<br />
noch als Schauspieler verdiente er ein<br />
zufriedenstellendes Honorar, ganz im<br />
Gegenteil, Hunger und Armut begleiteten<br />
sein Leben.<br />
Mit Kriegsbeginn 1914 hoffte er als Freiwilliger<br />
bei der Marine eine gesicherte<br />
Zukunft in Aussicht zu haben. Gerne hätte<br />
er an Schlachten teilgenommen, doch er<br />
wurde einem Minenlegeschiff zugeteilt, ein<br />
Angstgebet in Wohnungsnot<br />
Ach, lieber Gott, dass sie nicht<br />
Uns aus der Wohnung jagen.<br />
Was soll ich ihr denn noch sagen -<br />
Meiner Frau - in ihr verheultes Gesicht?<br />
Ich ringe meine Hände<br />
Weil ich keinen Ausweg fände,<br />
Wenns eines Tages so wirklich wär;<br />
Bett, Kleider, Bücher, mein Sekretär, -<br />
Dass das auf der Straße stände.<br />
Sollt ichs versetzen, verkaufen?<br />
Ist all doch nötiges Gerät<br />
Wir würden, einmal, die Not versaufen,<br />
und dann; wer weiß, was ich tät.<br />
Ich hänge so an dem Bilde,<br />
das noch von meiner Großmama stammt,<br />
Gott, gieße doch etwas Milde<br />
Über das steinerne Wohnungsamt.<br />
Wie meine Frau die Nacht durchweint,<br />
das barmt durch all meine Träume.<br />
Gott, lass uns die lieben zwei Räume<br />
Mit der Sonne, die vormittags hinein scheint.<br />
Ab <strong>Herbst</strong> 1920 hatte Joachim Ringelnatz<br />
erste erfolgreiche Aufträge im Berliner<br />
Kabarett SCHALL UND RAUCH. Danach<br />
verbrachte er mehrere Monate im Jahr auf<br />
Bühnen im gesamten deutschsprachigen<br />
Raum. Er trat stets im Matrosenanzug auf<br />
und war nun gut beschäftigt. 1927<br />
erschienen seine beiden erfolgreichsten<br />
Gedichtsammlungen, Kuddeldaddeldu<br />
und Turngedichte. Für drei Wochen reiste<br />
er nach Paris und 1928 führte ihn sein Weg<br />
nach London, von wo er enttäuscht<br />
zurückkam.<br />
5
Obwohl Ringelnatz fast jedes Jahr<br />
Bücher veröffentlichte, so mussten er und<br />
seine Frau stets sparsam leben und dennoch<br />
blieben sie nie sorgenfrei.<br />
1933 erteiIten die Nationalsozialisten<br />
die ersten Auftrittsverbote in Hamburg<br />
und München und es begann die Zeit der<br />
Bücherverbrennung. Auch Ringelnatz<br />
hatte darunter zu leiden und wieder lebten<br />
sie auf der untersten Stufe des Wohlstands.<br />
An einer beginnenden Tuberkulose<br />
erkrankt, konnte er noch seinen 50.<br />
Geburtstag feiern, auf dem seine Freunde<br />
Asta Nielsen, Paul Wegener und sein Verleger<br />
Ernst Rowohlt Reden hielten. Sie waren<br />
lange Jahre miteinander befreundet.<br />
Am 17. November 1934 verstarb Joachim<br />
Ringelnatz in seiner Berliner Wohnung<br />
Am Sachsenplatz. Beerdigt wurde er<br />
auf dem Waldfriedhof in Berlin. Nur neun<br />
Personen begleiteten seinen Sarg und zum<br />
Abschied wurde das Lied LA PALOMA<br />
gespielt.<br />
Mehrere Straßen in Berliner Bezirken<br />
wurden nach Ringelnatz benannt.<br />
Zum 125. Geburtstag des Dichters am<br />
7. 8. 2008 gab die Deutsche Bundespost<br />
eine Sonderbriefmarke heraus. Die Vorstellung<br />
der Erstlingsausgabe fand durch das<br />
Bundesfinanzministerium im Joachim-Ringelnatz-Museum<br />
in Cuxhaven statt. Die<br />
Betreuung des Nachlasses übernahm 2002<br />
die Ringelnatz-Gesellschaft in Cuxhaven.<br />
Schon zuvor von 1986-1991 wurde von<br />
der Stadt Cuxhaven im zweijährigen Turnus<br />
der mit 10000 DM dotierte Joachim-<br />
Ringelnatz-Preis für Lyrik vergeben. Seit<br />
1948 gibt es in seiner Geburtsstadt Wurzen<br />
eine Ringelnatz-Ausstellung im Stadt-<br />
Museum.<br />
Ringelnatz-Museum in Cuxhaven:<br />
Südersteinstraße 44<br />
Eintrittspreis Euro 4,–<br />
Telefon 0472/1394411<br />
Öffnungszeiten:<br />
Dienstags bis sonntags 10.00 – 13.00 Uhr<br />
und 14.00 – 17.00 Uhr<br />
Abschließen möchte ich mit einem Kindergebet<br />
von Joachim Ringelnatz.<br />
Kindergebet<br />
Lieber Gott, recht gute Nacht.<br />
Ich hab noch schnell Pipi gemacht,<br />
damit ich von Dir träume.<br />
Ich stelle mir den Himmel vor<br />
Wie hinterm Brandenburger Tor<br />
Die Lindenbäume.<br />
Nimm meine Worte freundlich hin,<br />
weil ich schon sehr erwachsen bin.<br />
Rudolf Matzner<br />
Quellen:<br />
Bremen. Literarischer Spaziergang, Insel<br />
Taschenbuch<br />
Eigenes Zeitungsarchiv<br />
Hinweis der Redaktion:<br />
Im Jahre 2004 fand eine Leserreise des<br />
<strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> nach Cuxhaven mit<br />
Besuch des Ringelnatz-Museums statt<br />
(siehe auch <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> Nr. 71,<br />
Winter 2004).<br />
Äpfel, Äpfel, Äpfel …<br />
Wo aus Früchten herrliche Säfte entstehen<br />
In Überhamm, einem Ortsteil von<br />
Worpswede, liegt ein kleiner Betrieb, der es<br />
in sich hat. Hier werden Äpfel und auch<br />
andere Früchte zu herrlichem Saft<br />
gepresst.<br />
Wenn man Alke Zimmermann zusieht,<br />
wie sie in ihrem Betrieb herumwirbelt,<br />
kann man sich nicht vorstellen, dass sie vier<br />
Kindern das Leben geschenkt hat.<br />
Ihr Mann ist IT-Mensch und muss sich<br />
seiner Arbeit widmen. Aber ihr Sohn<br />
Johannes, der Schornsteinfeger gelernt<br />
hat, unterstützt sie sehr. Auch ihm geht die<br />
Arbeit leicht von der Hand. Und natürlich<br />
sind auch noch andere fleißige Helfer<br />
dabei.<br />
Man kann von morgens 7.00 Uhr bis<br />
abends 20.00 Uhr sein Obst pressen lassen.<br />
Dabei werden z. B. die Äpfel in einer<br />
Packpresse gepresst und der erhitzte Saft<br />
bei 80 °C in Literflaschen abgefüllt. Die<br />
Früchtereste, der sogenannte Trester, findet<br />
Abnehmer. Bauern und Jäger nehmen<br />
ihn gern. Aber auch ein Schafhalter ist<br />
dabei. Der Kunde kann die Wartezeit überbrücken,<br />
indem er sich am Wagen<br />
draußen im Garten eine Bratwurst mit<br />
Pommes oder einen Kaffee gönnt. Täglich<br />
kann man auch Eier, Kartoffeln, Kuchen<br />
und Honig kaufen.<br />
In jedem Jahr am 3. Oktober ist „Tag der<br />
offenen Tür“. Es wird dann Kaffee geröstet,<br />
man kann Forellen probieren. Aber es gibt<br />
auch frisch gebackenen Butterkuchen aus<br />
dem Lehmbackofen.<br />
Auch Spezialitäten<br />
im Angebot<br />
Alke, die im Jahr ca. 120.000 Flaschen<br />
befüllt und bewegt, hat auch Spezialsäfte<br />
im Angebot: Rote Bete, Holunder, Limette,<br />
alles mit Apfel. Aber der Clou ist ihr Aroniasaft<br />
mit Apfel. Die Aroniabeeren bezieht<br />
sie vom Bio-Betrieb von Oesen.<br />
Der 25 ha große Hof ist übrigens seit<br />
1610 im Familienbesitz.<br />
Text: Manfred Simmering<br />
Fotos: Helmut Stelljes<br />
6 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
„Vogel des Glücks“<br />
So nennen die Chinesen den Kranich<br />
Pünktlich zum <strong>Herbst</strong>anfang beginnt ein<br />
ganz besonderes Spektakel im Teufelsmoor.<br />
Die Kraniche (Grus grus) kommen.<br />
Anfangs sind es nur wenige versprengte<br />
Trupps, aber spätestens wenn die Maisfelder<br />
abgeerntet sind, fliegen sie zu tausenden<br />
ein. Tagsüber findet man sie auf den<br />
Feldern, abends fliegen sie ins Günnemoor<br />
oder ins Huvenhoopsmoor in die renaturierten<br />
flachen Moorgewässer. Dort verbringen<br />
sie die Nächte im Wasser stehend,<br />
geschützt vor Füchsen und anderen Räubern.<br />
Das Naturschauspiel wiederholt sich<br />
in jedem Jahr im <strong>Herbst</strong> und verliert nichts<br />
von seiner Faszination. Allein schon die<br />
Geräuschkulisse der unzähligen Vögel ist<br />
atemberaubend.<br />
Beeindruckendes<br />
Schauspiel<br />
Der Einflug der Kraniche in ihre Nachtquartiere<br />
ist ein beeindruckendes Schauspiel.<br />
Mit lauten Trompetenrufen fliegen<br />
die Vögel kurz vor Sonnenuntergang zu<br />
ihren Schlafplätzen, um bei Tagesanbruch,<br />
noch bevor die Sonne sich blicken lässt,<br />
wieder mit der gleichen Lautstärke auf die<br />
Maisfelder zu fliegen. Es ist wichtig, dass<br />
sie sich für den langen Flug in ihre Winterquartiere<br />
stärken und Fettreserven bilden<br />
können. Mögen die Maisfelder auch ein<br />
Fluch sein für die Artenvielfalt in der<br />
Region, den Kranichen nützen sie.<br />
Kraniche sind am besten aus dem Auto<br />
zu beobachten. Sie sind gegenüber dem<br />
Links der Jungvogel, rechts der Altvogel<br />
Foto: Maren Arndt<br />
Menschen sehr scheu. Die Fluchtdistanz<br />
liegt bei ca. 300 Metern. Die Jungvögel<br />
kann man an ihrem braunen Kopf gut von<br />
den grauen Elterntieren unterscheiden.<br />
Unter günstigen Umständen haben Kraniche<br />
eine Lebenserwartung von 20 Jahren.<br />
Ein Kranichpaar bleibt ein Leben lang<br />
zusammen. Manchmal entdeckt man<br />
einen beringten Kranich. Die Beringung<br />
besteht aus einem Farbencode, den man<br />
auf den Webseiten des Kranichinformationszentrums<br />
nachlesen kann. Dort kann<br />
man auch beringte Kraniche melden, die<br />
man gesehen hat und bekommt Auskunft<br />
über den Vogel, wo er beringt wurde, in<br />
welchem Land, in welcher Region und wo<br />
er bereits schon gesehen und gemeldet<br />
wurde.<br />
Wie von Zauberhand<br />
verschwunden<br />
Foto: Maren Arndt<br />
Spätestens nach den ersten frostigen<br />
Nächten und wenn Wind und Thermik<br />
günstig sind, machen sich die Vögel auf<br />
den Weiterflug ins wärmere Südfrankreich,<br />
nach Spanien oder manche auch nach<br />
Nordafrika. Wie von Zauberhand können<br />
sie von einem auf den anderen Tag verschwunden<br />
sein. Manch vereinzelte Paare<br />
bleiben den Winter über hier. Einige Brutpaare<br />
gibt es mittlerweile auch an<br />
geschützten Plätzen im Teufelsmoor.<br />
Im Frühling ziehen die Vögel schnell und<br />
ohne langen Halt in Richtung Norden, wo<br />
die allermeisten Kraniche brüten. Wer<br />
zuerst dort ankommt, dem stehen die<br />
besten Brutplätze zur Verfügung.<br />
Freuen wir uns über die fliegenden<br />
Nomaden.<br />
Kranichbeobachtungstürme gibt es im<br />
Huvenhoopsmoor. Im Günnemoor kann<br />
man den Einflug der Kraniche gut in Verlüssmoor<br />
beobachten, in der Nähe vom<br />
Hofladen Lütjen.<br />
Maren Arndt<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
7
Die Küstenfestung Fort Kugelbake bei Cuxhaven<br />
Unauffällig hinterm Deich<br />
In unmittelbarer Nähe des Wahrzeichens<br />
der Stadt Cuxhaven, der Kugelbake,<br />
befindet sich hinterm Seedeich die Festungsanlage<br />
gleichen Namens. Hier am<br />
nördlichsten Zipfel von Niedersachsen hat<br />
die rd. 1140 Kilometer fließende Elbe eine<br />
Breite von 16 Kilometern und sie zählt zu<br />
den wichtigsten Wasserstraßen Europas.<br />
Das auf einer Landzunge von Elbe und<br />
Nordsee umspülte Gebiet bot den geeigneten<br />
Raum, um für einen militärischen<br />
Küstenschutz zu sorgen. Schon um 1820<br />
hatte Napoleons Oberkommandierender<br />
der französischen Armee in Deutschland,<br />
Marschall Davout, an dieser Stelle eine<br />
Zugang zum Fort Kugelbake<br />
Küstenfestung geplant. Zuvor hatte Friedrich<br />
der Große in seinem Testament mit<br />
Sorge darauf hingewiesen, dass seine Mittel<br />
keine Zersplitterung seiner Kräfte durch<br />
den Aufbau einer Flotte ermöglichten. In<br />
den folgenden Zeiten stand Deutschland<br />
als Landmacht den Seemächten Dänemark<br />
und England oft hilflos gegenüber. Das<br />
änderte sich, als die Deutsche Nationalversammlung<br />
1848 über eine Verfassung für<br />
ganz Deutschland debattierte und als Zeichen<br />
der Einheit die Schaffung einer<br />
Kriegsflotte in den Vordergrund stellte. Das<br />
war in der Zeit, als der dänische König<br />
Friedrich VII. sich bemühte, die Herzogtümer<br />
Holstein und Lauenburg, trotz<br />
Zugehörigkeit zum Deutschen Bund, stärker<br />
in sein Reich einzubinden. Die durch<br />
Admiral Rudolf Brommy (1804-1860) in<br />
Eile aufgestellte erste Kriegsflotte war im<br />
Seegefecht gegen Dänemark nicht gerade<br />
erfolgreich, was wiederum die Planung<br />
einer Küstenfestung stark beeinflusste.<br />
Doch geht man zurück in die Zeit der<br />
Planungsphase, dann muss man auch<br />
daran erinnern, dass im Juni 1868 der<br />
General Helmuth Graf von Moltke (1800-<br />
1891) mit weiteren hochrangigen Militärangehörigen<br />
den geplanten Standort bei<br />
Cuxhaven besichtigt haben. Daraus ist<br />
abzulesen, dass das Interesse für eine<br />
Küstenbefestigung wachgehalten und die<br />
Heeresleitung als Entscheidungsträger sich<br />
für zuständig hielt. Erst der marinebegeisterte<br />
deutsche Kaiser Wilhelm II.<br />
(1859-1941) – er war nach Friedrich III.<br />
(1831-1888) und Wilhelm I. (1797-1888)<br />
der letzte Regent im „Dreikaiserjahr“ 1888<br />
Kasemattenzugang vom Innenhof<br />
– änderte die Zuständigkeit von der<br />
Heeresleitung an die Marineführung. Das<br />
war der Anlass, dass für die bevorstehende<br />
Aufgabe ein Kommandant für Cuxhaven<br />
eingesetzt wurde.<br />
Am 28. Mai 1870 wurde der Grundstein<br />
für das Fort Kugelbake gelegt und 9 Jahre<br />
später konnte die Fertigstellung gemeldet<br />
werden, doch gebaut wurde an der Festungsanlage<br />
bis zum 2. Weltkrieg ständig.<br />
Die Grundform ist auf dem 6 Hektar<br />
großen Areal allerdings unverändert<br />
geblieben. Die Außenmaße dieser militärischen<br />
Einrichtung betragen im Fünfeck<br />
unregelmäßige Längen von 1, 10, 55, 57,<br />
86 und 94 Metern. Ein 12 Meter breiter<br />
und 2,50 Meter tiefer Graben umschließt<br />
das Fort.<br />
Die im Laufe der Jahre hoch gewachsenen<br />
Büsche und Bäume versperren heute<br />
den Blick auf die ehemalige Küstenbatterie.<br />
Sie liegt unauffällig hinterm Deich und<br />
ist von den vielen Spaziergängern kaum<br />
wahrzunehmen. Nur wenige mit<br />
geschichtlichem Interesse nehmen an<br />
einer Führung durch diese ehemals<br />
bedeutsame Anlage teil.<br />
Gelangt man in den großen, etwas tiefer<br />
liegenden Innenhof, erahnt man die<br />
ehemals militärstrategische Bedeutung<br />
dieser Befestigungsanlage. Zur Seeseite<br />
befinden sich die Geschützwälle und darunter<br />
die Kasematten, die bis zu 400 Soldaten<br />
Unterkunft bieten konnten. Zur Stabilisierung<br />
der Deckenschichten wurden in<br />
passender Länge geschnittene Eisenbahnschienen<br />
von insgesamt 500 Quadratmetern<br />
eingepasst. Achtzehn Millionen Ziegelsteine<br />
wurden im Fort Kugelbake ver-<br />
8 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Eine der ehemaligen Geschützstellungen (kein Original, Leihgabe)<br />
baut und 1800 Arbeiter waren hier<br />
beschäftigt. Diese Küstenbefestigung<br />
wurde nicht von Truppenteilen, wie Pionieren<br />
oder dergleichen, sondern durch<br />
ansässige Privatfirmen errichtet. Natürlich<br />
brachte das gutes Geld in die Gemeindekassen<br />
und außerdem Arbeitsplätze für die<br />
Bevölkerung. Darüber hinaus wurde auch<br />
das benötigte Baumaterial durch die Privatwirtschaft<br />
besorgt. Für nicht befugte<br />
Zivilisten war das gesamte Areal als Sperrgebiet<br />
erklärt worden.<br />
Die Kasemattengänge stehen heute<br />
zum Teil unter Wasser, sodass stabile Bretter<br />
für einen trockenen Weg sorgen. Ein<br />
großes Problem war von Beginn an der<br />
Kampf gegen die Feuchtigkeit und gegen<br />
das von oben eindringende Regenwasser.<br />
Abgesehen von den oberen Dokumentationsräumen<br />
sind die unteren Gänge mit<br />
den architektonisch üblichen Tonnen- und<br />
Kreuzgewölben gebaut. Die vorhandene<br />
Waffenkammer, Küche und Schlafräume<br />
bieten noch ein anschauliches Bild vom<br />
damaligen Festungsleben. Die ersten Soldaten<br />
wurden noch bei den Einwohnern<br />
der Umgebung untergebracht, weil die<br />
Ehemalige Küchenkessel (Original)<br />
Kasematten<br />
Unterkünfte noch nicht bezugsfertig<br />
waren. Doch genau wie auf Segelschiffen<br />
wurde in den Kasematten zum Teil in Hängematten<br />
geschlafen.<br />
Eine Besonderheit im Fort Kugelbake<br />
waren die Hebebühnen, auf denen die<br />
Geschütze aus dem unteren Bereich über<br />
Rampen mit menschlicher Muskelkraft<br />
oder auch durch Pferde nach oben gehievt<br />
werden konnten. Auf gleiche Art konnte<br />
ein Scheinwerfer mit einem beachtlichen<br />
Durchmesser von 2 Metern aus dem unteren<br />
Schacht auf die Aufzugsplattform in<br />
Stellung gebracht werden. Dieses Feindsuchgerät<br />
mit der Bezeichnung G200 von<br />
der Firma Siemens und Schuckert war eine<br />
technische Meisterleistung. Gemessen an<br />
der jahrzehntelangen Aufbauarbeit hielten<br />
sich die kriegerischen Erfolge in Grenzen.<br />
Ab 1940 wurden für die anderweitig eingesetzten<br />
deutschen Soldaten russische<br />
Hilfswillige (Hiwis) und später auch Schüler<br />
ab dem Jahrgang 1926 als Marinehelfer,<br />
sogar Marinehelferinnen, im Fort Kugelbake<br />
eingesetzt.<br />
Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde die<br />
Festungsanlage durch die Siegermächte<br />
weitgehend entmilitarisiert. Die gegenwärtig<br />
dort zu sehenden Geschütze sind<br />
größtenteils Leihgaben. In den ersten<br />
Nachkriegsjahren wurden die Räumlichkeiten<br />
für die Unterbringung von Flüchtlingen<br />
genutzt, danach bemühte man sich<br />
in den 50er Jahren, die erste Jugendherberge<br />
in Cuxhaven hier einzurichten.<br />
Geschlafen wurde in den ehemaligen<br />
Stahlbetten der Festungssoldaten. Für<br />
kurze Zeit siedelten sich kleinere Firmen<br />
hier an, bis dann 1972 darüber diskutiert<br />
wurde, ob es nicht an der Zeit sei, die<br />
Anlage vollkommen abzutragen.<br />
Nach zwanzigjährigem Schlaf gelang es<br />
der Stadt Cuxhaven, Gelder aus dem EG-<br />
Strukturfond zu beschaffen, die durch<br />
eigene und Landesmittel mit einer<br />
Gesamtsumme von 6,5 Mio. DM aufgestockt<br />
wurde, die dazu dienten, das Fort<br />
Kugelbake notdürftig zu erhalten.<br />
Für kulturelle und auch für private Veranstaltungen<br />
steht in der ehemaligen Festungsanlage<br />
sowohl im Innenhof als auch<br />
in den früheren Unterkunftsräumen ein<br />
gastronomischer Bereich zur Verfügung.<br />
Diese Führung an einem Tag im September<br />
2011 war sehr interessant. Der<br />
Festungsführer Herr Warncken wusste<br />
außerordentlich viel zu berichten, seine<br />
Informationen wurden dankbar aufgenommen<br />
und ich habe viel gelernt. Es war<br />
ein Blick in eine unbekannte Vergangenheit,<br />
die auch zur deutschen Geschichte<br />
gehört.<br />
Führungen im Fort Kugelbake:<br />
Mo. – Fr. 14.30 Uhr<br />
Di., Do., Sa., So. 10.30 Uhr<br />
Eintrittpreis: € 4,–<br />
Voranmeldung bei Gruppen empfehlenswert<br />
unter Telefon-Nr. 04721 / 40 44 44.<br />
Text und Bilder: Rudolf Matzner<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
9
Paula Modersohn-Becker – Kunstpreis <strong>2016</strong><br />
Verleihung seit 2010 im zweijährigen Turnus<br />
Der Kunstpreis hat für den Landkreis<br />
Osterholz Tradition. Nach vielen Jahren<br />
eines Kunstpreises, für dessen Vergabe sich<br />
nur im Landkreis Osterholz lebende Künstler(innen)<br />
bewerben konnten, wurde im<br />
Jahre 2010 der „neue“ Paula Modersohn-<br />
Becker-Kunstpreis ins Leben gerufen. Der<br />
Preis richtet sich nun an Künstler(innen)<br />
mit biografischen Bezügen zum Gebiet der<br />
Metropolregion Bremen-Oldenburg. Seit<br />
2010 wird der Preis im zweijährigen Turnus<br />
verliehen. Der neue PMB-Kunstpreis<br />
besteht aus drei Einzelkategorien.<br />
Der Paula Modersohn-Becker-Kunstpreis<br />
ist inzwischen ein fester Bestandteil der<br />
internationalen Kunstwelt und wird dieses<br />
Jahr zum 4. Mal vergeben.<br />
Der PMB-Kunstpreis ist ein wichtiges Signal<br />
an die junge Kunstszene Worpswedes<br />
und der Metropolregion. Denn auch die<br />
alten Worpsweder waren zu ihrer Zeit junge<br />
Künstler mit kontroversen Ansichten.<br />
Die Ausschreibung zur Bewerbung<br />
erreicht inzwischen immer weitere Kreise,<br />
was beweist, dass Künstler aus der ganzen<br />
Welt einen Bezug zur Nord/West-Metropolregion<br />
haben und diesen Preis sehr<br />
schätzen. So sind diesmal neben Deutschland<br />
die Länder Österreich und Frankreich<br />
mit Künstlern vertreten. Es haben sich wieder<br />
über 160 Künstler beworben und die<br />
Auswahl für die Jury wird immer schwieriger,<br />
da die Qualität der Einreichungen<br />
begeistert. Der „PMB-Kunstpreis“ aus drei<br />
Einzelpreisen: Hauptpreis, Nachwuchspreis<br />
(gestiftet von Karl-Heinz Marg), Sonderpreis<br />
für Künstler mit biografischen<br />
Bezügen zur Metropole Nordwest.<br />
Die vertretenen Medien der ausgewählten<br />
Künstler/Innen zeugen auch dieses Mal<br />
von einer großen Bandbreite künstlerischen<br />
Schaffens. Selten wurden die Fragen an<br />
unsere Zeit auf so experimentelle Weise<br />
gestellt. Auch machen sich Künstler zunehmend<br />
selbst zu Objekten ihrer Forschungsarbeit,<br />
wie beispielsweise der Franzose Virgile<br />
Novarina, der seit fast 20 Jahren seinen<br />
Schlaf erforscht, dazu in der Öffentlichkeit<br />
sein Bett aufstellt und während das Schlafes<br />
kleine Textskizzen entstehen, die irgendwo<br />
aus dem Unterbewusstsein kommen. Oder<br />
Max Schaffer, dem auf wundersame Weise<br />
Objekte begegnen, die sich mit ihm und<br />
seinem Leben unmittelbar zu verknüpfen<br />
scheinen, und aus denen er konzeptuelle<br />
Kunstwerke entwickelt, die örtlich bezogen<br />
sind. Aber auch Malerei und Zeichnungen<br />
bleiben aktuell wie bei Anna Bart und Ralf<br />
Ziervogel. Vertreten ist auch die Videokunst,<br />
die immer neue Wege einschlägt. So<br />
zu sehen bei Julian Öffler und Annika Kahrs.<br />
Und die Verwendung gefundener Objekte,<br />
die bei Waldemar Grazewicz zu humorvollen<br />
Kunstwerken verwandelt werden und<br />
bei Kornelia Hoffmann Eingang in kom-<br />
Anna Bart “Wand”, Öl auf Papier, 247 x 396 cm, 2012<br />
Annika Kahrs, „Playing to the Birds”, Videostill<br />
Waldemar Grazewicz, „749,-“, Mischtechnik auf<br />
Pappe / 67x70 cm, 2015<br />
Virgile Novarina, „Marie-Sol Parant”<br />
Irena Eden und Stijn Lernout, „o.T.“, Acryl und<br />
Bleistift auf HDF, 70 x 48 x 30 cm, 2014<br />
10 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
plexe Collagen finden. Gesellschaftlich relevante<br />
Fragen mit aktuellem Zeitbezug greift<br />
diesmal das Wiener Künstlerduo Irena Eden<br />
& Stijn Lernout auf und bringt so auch<br />
einen politischen Diskurs in den insgesamt<br />
wieder sehr spannenden Ausstellungsparcours.<br />
Dabei steht nicht nur die Betrachtung<br />
unserer heutigen Gesellschaft im<br />
Fokus der Werke, auch Rückbezüge auf Vergangenes<br />
öffnen den Blick für Zeitgenössisches.<br />
Die diesjährige regionale Jury, bestehend<br />
aus Dr. Dorothee Hansen (Kunsthalle Bremen),<br />
Ele Hermel (Galerie Mitte, Bremen)<br />
und Dr. Inken Steen (Kulturredakteurin<br />
NWR) hat folgende Künstler nominiert:<br />
Anna Bart, Irena Eden & Stijn Lernout,<br />
Waldemar Grazewicz, Kornelia Hoffmann,<br />
Annika Kahrs, Virgile Novarina, Julian<br />
Öffler, Max Schaffer, Ralf Ziervogel<br />
Eine hochkarätige überregionale Jury,<br />
bestehend aus Kathrin Becker (N.B.K. Leiterin<br />
Videoforum, Berlin), Roland Nachtigäller<br />
(Marta Herford) und Marion Scharmann<br />
(Kuratorin, Köln), wird innerhalb der Ausstellung<br />
den/die Hauptpreisträger/in<br />
bestimmen. Die Preisträger/innen werden<br />
im Rahmen der Eröffnung bekanntgegeben.<br />
Preisverleihung und<br />
Ausstellungseröffnung:<br />
Sonntag, 6. November <strong>2016</strong>, 11.30 Uhr<br />
Begleitveranstaltungen:<br />
Führung und Kaffeetrinken für Senioren:<br />
Freitag, 11. November <strong>2016</strong>, 14.30 Uhr<br />
(12,50 €, Anmeldung erforderlich)<br />
Artdating: »Kunstfreunde finden«<br />
Ein Speeddating der etwas anderen Art<br />
Samstag, 19. November <strong>2016</strong>, 18.00 Uhr<br />
(10 €, inkl. Getränke und Häppchen, Anmeldung<br />
erforderlich). Nähere Infos unter<br />
www.worpswede-museen.de/aktuelles<br />
Matinée kulinarisch:<br />
Sonntag, 4. Dezember <strong>2016</strong>, 12.00 Uhr<br />
Kuratorenführung, dazu kann ein Mittagessen<br />
im Kaffee Worpswede gebucht werden.<br />
(Gesamtpreis 30 €, Anmeldung erforderlich)<br />
Finissage mit Kuratorenführung:<br />
Sonntag, 8. Januar <strong>2016</strong>, 15.00 Uhr<br />
Was schläft….?<br />
Virgile Novarina im Gespräch mit der Kuratorin<br />
Susanne Hinrichs<br />
Seit 10 Jahren arbeiten der Künstler und die<br />
Kuratorin immer wieder in verschiedenen<br />
Zusammenhängen an gemeinsamen Projekten.<br />
Novarinas Schlafforschung und künstle-<br />
rische Auseinandersetzung mit dem Schlaf<br />
ist so vielseitig, dass die Aspekte seiner Kunst<br />
zahlreiche Belange der Gesellschaft berühren.<br />
Hinrichs und Novarina geben Einblicke<br />
in das Werk des Künstlers und ihre<br />
gemeinsame Arbeit. Im Anschluss an das<br />
Gespräch sehen Sie die deutsche Uraufführung<br />
von Novarinas neuestem Film „Virgile<br />
schläft, 6 Skizzen zu einem Film“, 22',<br />
Jean Seban, 2013 (Best Short Documentary<br />
at the Southampton International Film Festival)<br />
Ort: Große Kunstschau Worpswede,<br />
Lindenallee 5, Worpswede<br />
Tel. 04792 13 02<br />
Dienstag bis Sonntag 11 bis 16 Uhr.<br />
Darüber hinaus gibt es eine Ausstellung<br />
mit Werken des Sonderpreisträgers in der<br />
Galerie Altes Rathaus in Worpswede.<br />
Eröffnung: 4. Dezember <strong>2016</strong>, 15 Uhr.<br />
Dauer der Ausstellung bis 8. Januar 2017<br />
Ort: Galerie Altes Rathaus,<br />
Bergstr. 1, Worpswede.<br />
www.galerie-altes-rathaus-worpswede.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Dienstag bis Freitag 14 bis 17 Uhr<br />
Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr<br />
Ursula Villwock<br />
www.pmb-kunstpreis.de<br />
‘n beten wat<br />
op Platt<br />
Sprichwörter und Redensarten<br />
unserer engeren <strong>Heimat</strong><br />
Wer sick för`n Pannkoken backen lett,<br />
de ward dor ok för upfreten.<br />
Wo de Steen liggt, dor bewasst he.<br />
Sebenteihn Handwark un achtteihn<br />
Unglück.<br />
Von Sporen un Woren kummt dat<br />
Hebben von her.<br />
Dor is keen Hund so slecht,<br />
he will jümmer eenen hebben,<br />
de noch slechter is.<br />
Den eenen sien Uhl<br />
is den annern sien Nachtigall.<br />
Verbeten Hunnen hebbt<br />
selten een heelet Fell.<br />
„All weer togliek“, sä de Bur,<br />
„do föhr he eenspännig.“<br />
„Kremm di (mach dich gerade)“, sä de<br />
Buersfro to de annere, „wi sünd glieks<br />
in Osterholt.“<br />
(aus: „<strong>Heimat</strong>bote“, Osterholz, Jg. 1926)<br />
Peter Richter<br />
Die plattdeutsche<br />
Beduinensklavin<br />
Der 1733 in Lüdingworth im Lande<br />
Hadeln geborene bekannte Forschungsreisende<br />
Carsten Niebuhr<br />
war auf einer Reise ins Innere von<br />
Afrika einst Gast im Nomadenzelt. Als<br />
eine Sklavin einen Auftrag nicht zur<br />
Zufriedenheit des Scheichs erledigt<br />
hatte, entfernte sich dieser mit einigen<br />
kräftigen Schimpfworten gegen<br />
die Schuldige. Kaum hatte der<br />
Häuptling den Zeltvorhang hinter<br />
sich fallen lassen, als die arabische<br />
Sklavin sich aufrichtete und im<br />
schönsten Plattdeutsch hinter ihm<br />
herrief: „Du ole Bullerballer!“ Niebuhr,<br />
der arabische Kleidung trug,<br />
verfiel sofort in seine heimische<br />
Mundart und fragte das Mädchen in<br />
höchster Verwunderung: „Min beste<br />
Deern, wo büst du her?“<br />
Die Reihe, sich zu wundern, war<br />
nun an der Sklavin: „Ut Lüdingworth<br />
in Lanne Hadeln!“ - Es stellte sich heraus,<br />
dass Niebuhr mitten in der<br />
Wüste Afrikas eine Landsfrau, dazu<br />
noch aus seinem kleinen <strong>Heimat</strong>dorfe,<br />
getroffen hatte.<br />
Die Wirkung war, wie man sich<br />
ausmalen kann, für beide Teile verblüffend.<br />
Der Bericht des Mädchens<br />
gab Aufklärung über ihre seltsame<br />
Lage: Sie hatte einen Bruder in<br />
Surinam wohnen, der sie auf seine<br />
Kosten nach drüben kommen lassen<br />
wollte. Das Mädchen schiffte sich in<br />
Hamburg ein, geriet aber auf der<br />
Reise in die Hände tunesischer Korsaren,<br />
die dem Mädchen alle Habe<br />
stahlen und es zuletzt an der afrikanischen<br />
Küste als Sklavin verkauften.<br />
Niebuhr pflegte das merkwürdige<br />
Zusammentreffen im Beduinenzelte<br />
oft zu erzählen. Jedesmal setzte er<br />
hinzu, dass ihn nichts so überwältigt,<br />
wie der unvermutete Klang heimatlichen<br />
Plattdeutsches mitten in Afrika,<br />
und nichts habe jemals seine Seele so<br />
ergriffen wie das poltrige Schimpfwort:<br />
„Du ole Bullerballer!“<br />
(gefunden in „<strong>Heimat</strong>bote“,<br />
Osterholz, Jg. 1926)<br />
Peter Richter<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
11
Schutzgebietsplanung des Landkreises Osterholz<br />
Interessenausgleich auf hohem Niveau für eine nachhaltige Entwicklung<br />
Wer sich zu Fuß oder per Rad in die Hammeniederung<br />
und die nordwestlich davon<br />
gelegenen Hammehochmoore begibt, erlebt<br />
eine überaus interessante Moorkulturlandschaft<br />
mit einem vergleichsweise hohen<br />
Anteil noch naturnaher Bereiche. Auf den<br />
ersten Blick eine landschaftliche Idylle!<br />
Bei näherer Betrachtung drängen sich aber<br />
bald Fragen auf: Wo gibt es denn hier eigentlich<br />
noch das sagenumwobene Moor mit den<br />
für Hochmoore charakteristischen großräumigen<br />
baumfreien Bereichen, mit schwingenden<br />
Torfmoosrasen, Sonnentau und weiß<br />
fruchtendem Wollgras? Wo sind die früher<br />
großen Kiebitzschwärme geblieben? Warum<br />
findet man kaum noch die einst so prägenden<br />
blütenreichen Sumpfdotterblumenwiesen?<br />
Und der naturkundliche Interessierte<br />
wird sich fragen, warum Sumpfläusekraut,<br />
Fischotter, Sumpfohreule, Uferschnepfe,<br />
Grüne Mosaikjungfer und Enzianbläuling so<br />
extrem selten geworden sind. Oder erinnert<br />
sich jemand noch an das inzwischen ausgestorbene<br />
Birkwild, den Kampfläufer oder die<br />
Trauerseeschwalbe, die hier einst heimisch<br />
waren? Und das Landschaftsbild: Konnte<br />
man in der oberen Hammeniederung nicht<br />
noch vor wenigen Jahren überall die offene<br />
Weite der Landschaft genießen, wo der Blick<br />
heute vielerorts nach wenigen Metern an der<br />
hochgewachsenen Maiskultur endet? Und im<br />
Übrigen: Wie wirkt sich eigentlich der Maisanbau<br />
auf Moorböden auf das Klima aus und<br />
der Einsatz von Gülle auf den Wasserhaushalt?<br />
Kommen scheue Tierarten noch klar mit<br />
der intensiven Erholungsnutzung an Land,<br />
auf dem Wasser und in der Luft?<br />
Es ist nicht zu übersehen: Wir haben es mit<br />
einem sehr empfindlichen und gefährdeten<br />
Landschaftsraum zu tun, der einen Umgang<br />
erfordert, der wirtschaftlich, sozial und ökologisch<br />
nachhaltig ist und damit auch auf kommende<br />
Generationen Rücksicht nimmt. Ein<br />
solcher Umgang stellt nicht weniger als eine<br />
gesamtgesellschaftliche Herausforderung<br />
dar. Der Landkreis Osterholz stellt sich dieser<br />
Aufgabe auf vielfältige Weise.<br />
In diesem Kontext steht auch die aktuelle<br />
Absicht des Landkreises, im Bereich Hammeniederung<br />
/ Teufelsmoor zwei Naturschutzgebiete<br />
(NSG) und drei Landschaftsschutzgebiete<br />
(LSG) auszuweisen (s. Abb.<br />
rechts).<br />
Die geplanten Schutzgebiete sollen in<br />
Form einer sog. „Sammelverordnung“, die<br />
vom Kreistag zu beschließen ist, ausgewiesen<br />
werden. Das Gebiet der Sammelverordnung<br />
ist 97 qkm groß. Dies entspricht 9.700 ha.<br />
Ca. 50 % der Gebietskulisse nehmen die<br />
geplanten Naturschutzgebiete und 50 % die<br />
Landschaftsschutzgebiete ein.<br />
Das geplante Naturschutzgebiet Hammeniederung<br />
entspricht weitestgehend dem<br />
Gebiet des gesamtstaatlich repräsentativen<br />
Naturschutzgroßprojektes, das der Landkreis<br />
seit 1995 in der unteren Hammeniederung<br />
nach einem Förderprogramm des Bundesumweltministeriums<br />
durchführt (sog. „GR-<br />
Projekt“). Über das Projekt wurde im <strong>Heimat</strong>rundblick<br />
Nr. 111 04/2014, S. 18 – 20 umfassend<br />
berichtet. Im Projektgebiet sind signifikante<br />
Erfolge des Naturschutzes zu verzeichnen,<br />
die durch neue Wege und Aussichtsmöglichkeiten<br />
für Erholungssuchende erlebbar<br />
gemacht wurden. Mit der Annahme von<br />
über 14 Mio. € Fördermitteln des Bundes<br />
und des Landes Niedersachsen übernahm der<br />
Landkreis Osterholz auch die Pflicht, das Projektgebiet<br />
als Naturschutzgebiet auszuweisen.<br />
Darüber hinaus ist der Landkreis verpflichtet,<br />
die von der Europäischen Union festgelegten<br />
Natura 2000 - Gebiete als Naturschutz-<br />
oder Landschaftschutzgebiete auszuweisen.<br />
73 % des Gebietes der Sammelverordnung<br />
sind Natura 2000 – Gebiete. Das<br />
sog. ökologische Netz Natura 2000 ist der<br />
zentrale Beitrag der Europäischen Union zum<br />
Schutz der weltweiten biologischen Vielfalt,<br />
der auf der Umweltkonferenz in Rio de<br />
Janeiro 1992 international vereinbart wurde.<br />
Das ökologische Netz setzt sich aus den<br />
sog. EU-Vogelschutzgebieten und EU-<br />
Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten)<br />
zusammen.<br />
Die Sammelverordnung bezweckt auch im<br />
eigenen Interesse des Landkreises den Schutz<br />
von ökologischen und landschaftlichen Qualitäten,<br />
die nicht über Natura 2000 abgedeckt<br />
sind. Dabei geht es insbesondere um<br />
den Erhalt des außergewöhnlich schönen<br />
12 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Landschaftsbildes, das heimische und auswertige<br />
Erholungssuchende anzieht und eine<br />
wichtige Grundlage für den Tourismus in der<br />
Region darstellt.<br />
Die Sammelverordnung enthält für die<br />
Naturschutzgebiete vergleichsweise strenge,<br />
für die Landschaftsschutzgebiete milde und<br />
im Falle des Landschaftsschutzgebiets „Teufelsmoor“<br />
sehr milde Nutzungsregelungen.<br />
Die Regelungen bestehen aus einer Kombination<br />
von Verboten, Ausnahmen von diesen<br />
Verboten, Zustimmungsvorbehalten und<br />
Freistellungen.<br />
Das Regelwerk ist unter Berücksichtigung<br />
zahlreicher Gespräche mit Betroffenen so<br />
abgefasst, dass ein intensiver Ausgleich unterschiedlichster<br />
Nutzungsinteressen bewirkt<br />
wird.<br />
Wohnlagen und Hofgrundstücke sind aus<br />
dem Geltungsbereich der Schutzgebiete<br />
gänzlich ausgeklammert. Somit gelten hier<br />
keine einschränkenden Regelungen der entsprechenden<br />
Verordnungen. Im Übrigen ist<br />
durch zahlreiche Freistellungen sichergestellt,<br />
dass das dörfliche Leben weitergeht.<br />
Besonders intensiv abgewogen sind die<br />
Regelungen für die landwirtschaftliche Nutzung.<br />
Denn schließlich leben die landwirtschaftlichen<br />
Familienbetriebe von ihren<br />
Flächen. Und der Landkreis Osterholz hat aus<br />
gesamtgesellschaftlichen Gründen ein hohes<br />
Interesse am Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft<br />
- übrigens auch aus Naturschutzgründen:<br />
Ohne Landwirtschaft keine Wiesen,<br />
ohne Wiesen weder Wiesenblumen noch<br />
Wiesenvögel.<br />
In den Landschaftsschutzgebieten „Hammeniederung“<br />
und „Teufelsmoor“ soll die<br />
ordnungsgemäße Landwirtschaft weiterhin<br />
weitestgehend möglich bleiben.<br />
In den geplanten Naturschutzgebieten<br />
„Hammeniederung“ und „Teufelsmoor“ sollen<br />
zukünftig dagegen strengere Regelungen<br />
gelten. Diese stehen noch nicht abschließend<br />
fest. Ihre vollständige Ausgestaltung soll erst<br />
in einem weiteren Verfahren (2. Tranche) in<br />
enger Abstimmung mit den betroffenen<br />
Landwirten erfolgen. Dabei ist Folgendes zu<br />
berücksichtigen: Große Teile der geplanten<br />
Naturschutzgebiete wurden von der öffentlichen<br />
Hand für Naturschutzzwecke erworben.<br />
Auf verbliebenen privaten Grünlandflächen<br />
werden durch Auflagen bedingte Erschwernisse<br />
vom Land finanziell ausgeglichen.<br />
Ein besonderes Thema ist die Umwandlung<br />
von Grünland in Acker, die meistens das<br />
Ziel verfolgt, Mais als wertvolle Futter- bzw.<br />
Energiepflanze anzubauen. Die Sammelverordnung<br />
verpflichtet die Landwirte, die eigenen<br />
Fachregeln der ordnungsgemäßen Landwirtschaft<br />
einzuhalten. Damit soll für die<br />
Zukunft die Umwandlung von Grünland auf<br />
Moorböden, grundwassernahen Böden und<br />
in Überschwemmungsgebieten verbindlich<br />
unterbleiben.<br />
Und auch das ist wichtig für die Landwirtschaft:<br />
Die Sammelverordnung enthält keine<br />
Regelungen zur Vernässung der Gebiete. Sie<br />
ändert weder die Steuerung der Ritterhuder<br />
Um die geplante Sammelverordnung<br />
ranken sich derzeit viele Gerüchte. Auch<br />
der Artikel im <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> 3/<strong>2016</strong><br />
zur Sammelverordnung von Agnes Lenz<br />
bedarf einiger Richtigstellungen:<br />
• Nicht der Landkreis hat Vogelschutzund<br />
FFH-Gebiete an die Europäische<br />
Union gemeldet, sondern das Land<br />
Niedersachsen bzw. die Bundesrepublik<br />
Deutschland.<br />
• Die Natura 2000 – Gebiete in der Hammeniederung<br />
müssen als Natur- oder<br />
Landschaftschutzgebiete ausgewiesen<br />
werden. Der Landkreis hat insoweit<br />
keine Spielräume.<br />
• Der Landkreis hat sich bezüglich der<br />
Sicherung der Natura 2000 – Gebiete<br />
eben nicht für die „schärfste Form entschieden“.<br />
Dies wäre die vollständige<br />
Ausweisung als Naturschutzgebiet<br />
gewesen. Die Sammelverordnung<br />
sieht dagegen einen Mix aus Naturund<br />
Landschaftsschutzgebieten vor.<br />
• Der Landkreis weist keine Biotope aus.<br />
Seit 1990 werden im Bundesnaturschutzgesetz<br />
bzw. im entsprechenden<br />
Niedersächsischen Landesgesetz<br />
bestimmte gefährdete Biotope<br />
benannt, die kraft Gesetzes unter<br />
Schutz stehen. Der Landkreis hat die<br />
gesetzliche Pflicht, diese zu erfassen<br />
und in das Naturschutzverzeichnis einzutragen.<br />
• Mit der Feststellung der gesetzlich<br />
geschützten Biotope findet ausdrücklich<br />
nicht „de facto eine Enteignung“<br />
statt. Die bisherige Nutzung, die zum<br />
Entstehen des Biotops geführt hat, darf<br />
i.d.R. fortgeführt werden. Der Biotop<br />
darf aber nicht zerstört oder sonst<br />
erheblich beeinträchtigt werden.<br />
Soweit es sich um privates Grünland<br />
handelt, zahlt das Land für Erschwernisse<br />
der Bewirtschaftung Ausgleich.<br />
• Die Sammelverordnung berücksichtigt<br />
eben nicht „ausschließlich die Erhaltung<br />
und Förderung der Vogel- und<br />
Pflanzenwelt“. Die Sammelverordnung<br />
berücksichtigt auch andere<br />
Naturschutzaspekte, wie die für den<br />
Tourismus wichtige Erhaltung des<br />
Landschaftsbildes. Sie berücksichtigt<br />
aber insbesondere umfänglich die<br />
Belange unterschiedlicher Nutzungen<br />
im Gebiet.<br />
• Der Vergleich der Sammelverordnung<br />
mit der „Planwirtschaft“, die Unterstellung<br />
einer „willkürlichen Lenkung der<br />
Bevölkerung“, die Befürchtung einer<br />
„Mangelwirtschaft“, die Aussagen,<br />
dass das betreffende Gebiet „von der<br />
kulturellen Weiterentwicklung bewusst<br />
abgeschnitten wird“ und weitere<br />
Unterstellungen gegenüber dem<br />
Landkreis entbehren jeglicher Grundlage<br />
und werden von der Kreisverwaltung<br />
ausdrücklich zurückgewiesen.<br />
Schleuse noch die Entwässerung des Waakhauser<br />
und Niederender Polders. Die in den<br />
Gebieten überall erforderliche Gewässerunterhaltung<br />
bleibt erlaubt. Allerdings soll sie<br />
zukünftig ökologisch verträglicher erfolgen.<br />
Diesbezüglich enthält die Sammelverordnung<br />
einige Vorgaben, die sich aber weitestgehend<br />
auf die beiden geplanten Naturschutzgebiete<br />
beschränken.<br />
Heimische und auswärtige Erholungssuchende<br />
sind nach wie vor in den Schutzgebieten<br />
willkommen. Soweit die Gebiete zum<br />
europäischen Vogelschutzgebiet gehören<br />
sind sie allerdings an das ausgewiesene naturverträgliche<br />
Freizeitwegenetz gebunden.<br />
Dieses umfasst eine Gesamtlänge von 115<br />
km. Hinzu kommen noch 15 km Straßen<br />
begleitende Radwege. Zusammen ein Wegenetz<br />
von 130 km! Auch die Schifffahrt und<br />
der Bootssport sollen unter besserer Beachtung<br />
der Pflanzen- und Tierwelt und unter<br />
Berücksichtigung des Tourismus neu geregelt<br />
werden. Dasselbe gilt eingeschränkt auch für<br />
die Luftfahrt und den Flugsport. Die Sammelverordnung<br />
setzt damit bereits vor 10 Jahren<br />
ausgehandelte und politisch beratene kompromissorientierte<br />
Konzepte um.<br />
Die Sammelverordnung zielt auch darauf<br />
ab, den klimaschädlichen Torfabbau zu<br />
unterbinden - und das auch außerhalb der<br />
Natura 2000 – Kulisse. Dies ist ein ganz herausragender<br />
Grund für das geplante Landschaftsschutzgebiet<br />
„Teufelsmoor“. Denn<br />
hier lagern nach wie vor beachtliche Torfbestände.<br />
Ohne das Landschaftsschutzgebiet<br />
„Teufelsmoor“ würden Torfabbauanträge<br />
kaum abzulehnen sein. Das Landschaftsschutzgebiet<br />
„Teufelsmoor“ sichert damit<br />
auch die schönen Wohnlagen der Ortschaft<br />
Teufelsmoor!<br />
Einschränkungen der Fischerei beschränken<br />
sich weitestgehend auf das Naturschutzgebiet<br />
„Hammeniederung“. Aber auch hier<br />
wird die Fischerei keinesfalls verboten. Der<br />
Verordnungsentwurf sieht u.a. Fischereizonen<br />
von insgesamt 17 km Länge, davon 12<br />
km ohne zeitliche Befristung vor. Einschränkungen<br />
der Jagd beziehen sich vor allem auf<br />
die geplanten Naturschutzgebiete. Der<br />
Schwerpunkt liegt auf dem Naturschutzgebiet<br />
„Hammeniederung“ und hier vornehmlich<br />
auf den öffentlichen Flächen. Alle Regelungen<br />
sind so abgestimmt, dass die Jagd ihre<br />
wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen<br />
kann.<br />
Die Sammelverordnung liegt derzeit als<br />
Entwurf vor. Das Beteiligungsverfahren, das<br />
u.a. eine öffentliche Auslegung umfasste, ist<br />
abgeschlossen. Aktuell wertet die Kreisverwaltung<br />
die eingegangenen Stellungnahmen<br />
aus und überarbeitet den Verordnungsentwurf.<br />
Der überarbeitete Entwurf soll im Oktober<br />
dieses Jahres dem Kreistag zur abschließenden<br />
Entscheidung und Beschlussfassung<br />
vorgelegt werden.<br />
Johannes Kleine-Büning<br />
Leiter des Planungs- und Naturschutzamtes<br />
des Landkreises Osterholz<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
13
„Goldene Medaille I. Classe“ für Fritz Mackensen<br />
Reaktionen zu der legendären Auszeichnung 1895 in München Teil 2<br />
Der Dichter Rainer Maria Rilke zitiert<br />
1903 in der „Monographie Worpswede“<br />
einen Kritiker, der über die „Münchener<br />
Jahres-Ausstellung von Künstlern aller<br />
Nationen“ im Glaspalast 1895 kommentierte:<br />
„Für den, der irgend weiß, wie ein<br />
Künstler zu solchen Ehren sonst nur durch<br />
langjähriges Streben und gute Verbindungen<br />
kommen kann, ist das eine so fabelhafte<br />
Sache, daß er sie nicht glauben<br />
würde, hätte er sie nicht selbst erlebt. Niemals<br />
ist eine Wahrheit so unwahrscheinlich<br />
gewesen“. Hier richtet sich „eine so fabelhafte<br />
Sache“ insbesondere auf die Auszeichnung<br />
des damals noch völlig unbekannten<br />
„Fritz Mackensen in Worpswede“.<br />
Ihm wurde 1895 für das Gemälde „Gottesdienst<br />
im Freien“ im Glaspalast „Die<br />
Goldene Medaille I. Classe“ verliehen.<br />
Mit dem oben genannten Zitat des Kritikers<br />
endet der Artikel „150 Jahre Fritz<br />
Mackensen“ im <strong>Heimat</strong> <strong>Rundblick</strong>, Frühjahr<br />
<strong>2016</strong> Nr. 116, Seite 24 – 26.<br />
Anhand von vorhandenen Briefen und<br />
Dokumenten soll im Folgenden untersucht<br />
werden, welche Reaktionen durch den<br />
legendären Erfolg von Mackensen 1895<br />
ausgelöst wurden.<br />
Die Korrespondenz zwischen Fritz<br />
Mackensen und seiner Mutter geschah<br />
stets in einer wechselseitigen Herzlichkeit<br />
und mit Fürsorge. (Paula Becker nannte<br />
Mackensen in ihrem Tagebuch 1897:<br />
„zärtlich weich zu seiner Mutter“; Worpsweder<br />
Almanach, Seite 66).<br />
Fritz Mackensen, Büste seiner Mutter, um 1898,<br />
Bronze, Kulturstiftung Landkreis Osterholz, © VG<br />
Bild-Kunst, Bonn <strong>2016</strong><br />
Die Mutter schrieb am 7.4.1895 aus<br />
Hannover an ihren ältesten Sohn: „Mein<br />
lieber Fritz! … Auch für die Kunst wünsche<br />
ich Dir viel Glück und besten Erfolg. ...<br />
Heute habe ich sehr viel an Dich denken<br />
müssen, ist doch heute Eure Ausstellungseröffnung“<br />
(die Ausstellung der „Künstlervereinigung<br />
Worpswede“ in der Kunsthalle<br />
Bremen ist hier gemeint).<br />
Als im Sommer 1895 die Ausstellung in<br />
München begann, teilte Mackensens Bru-<br />
der ihm am 9. Juli 1895 mit: „Mein lieber<br />
Fritz! Soeben erhalten wir von Mutter die<br />
Nachricht Deines so überaus großen Erfolges.<br />
Und nun gratuliere ich Dir von<br />
ganzem Herzen dazu. Wie sehr habe ich<br />
mich gefreut …“. (Der Vater, der Bäckermeister<br />
Julius Ludwig Ernst Mackensen,<br />
war bereits 1871 in Greene gestorben. Die<br />
Mutter musste die vier Söhne versorgen).<br />
Am 19.8.1895 fragt die Mutter ihren Sohn<br />
Fritz: „… Hast Du denn die ‚Brücke im<br />
Moor‘ verkauft? … Recht freue ich mich,<br />
daß Deine Bilder in München so gut<br />
gefragt sind ….“. In zahlreichen Briefen<br />
nimmt Mackensens Mutter immer wieder<br />
regen Anteil an den künstlerischen Erfolgen<br />
ihres Sohnes Fritz.<br />
Die breite Anerkennung des Worpsweder<br />
Künstlers Fritz Mackensen für seine<br />
legendäre Auszeichnung in München<br />
bekräftigt ein Brief aus Hamburg vom<br />
9.7.95 (Absender nicht lesbar): „Selten<br />
habe ich eine Neuigkeit aus der Zeitung<br />
mit größerer Freude begrüßt, wie heute,<br />
als ich las, daß Ihnen in München die Goldene<br />
Medaille zuteil geworden ist. Ich<br />
weiß, wie ernst ihr Streben, wie all Ihr Sinnen<br />
nur der lauteren, höchsten Kunst gilt.<br />
Darum rufe ich Ihnen aus innerstem Herzen<br />
meinen herzlichen Glückwunsch zu.<br />
Möge Ihnen die verdiente Anerkennung<br />
und Auszeichnung ein Ansporn zu immer<br />
neuem Streben sein und bleiben“.<br />
Aus Konstantinopel erhält Fritz Mackensen<br />
einen anerkennenden Brief vom 10.<br />
Oktober 1895 von seinem Onkel Ernst<br />
(Friedrich Ernst Anton Mackensen,<br />
Geheimrat, Dipl. Ing., Erbauer der Bagdad-<br />
Bahn, geb. 1840 in Gandersheim, gest.<br />
1909 in Konstantinopel, Bruder des Vaters<br />
von Fritz): Mein lieber Fritz! .. Über Deinen<br />
glänzenden Erfolg freue ich mich herzlich.<br />
Mehrere Bekannte, welche Dein Bild „Predigt“<br />
in München gesehen haben, sind<br />
voll des Lobes, und ich muß sagen, daß ich<br />
den Wunsch habe, es selbst bald einmal<br />
sehen zu können. Ich nehme an, daß Du<br />
das Bild in der nächstjährigen Ausstellung<br />
in Berlin ausstellen wirst … Deine weiteren<br />
Arbeiten werden Dir im Gefolge der Anerkennung,<br />
welche Du in so reichem Maße<br />
gefunden hast, schon leichter werden“.<br />
Welch großer, großer<br />
Künstler müssen Sie sein!<br />
Ausstellungshalle des „Glaspalast München“, um 1895 (Innenansicht), Fotografie; Sammlung Hanfstaengl<br />
, München<br />
Ein Schreiben vom 26. Oktober 1895<br />
erhält Mackensen aus Hannover (Absender<br />
lässt sich nicht entziffern): „Ich las eine Kritik<br />
über Sie und so eine glänzende, daß ich<br />
kaum meinen Augen traue. Welch großer,<br />
großer Künstler müssen Sie sein!“<br />
14 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Der „Glaspalast München“ um 1895, Fotografie; Sammlung Hanfstaengl, München<br />
Nach Erfolg meldeten<br />
sich die Presse …<br />
Nach dem großen Erfolg in München<br />
meldeten sich zunehmend Verlage und<br />
Zeitungsredaktionen bei dem Worpsweder<br />
Künstler Mackensen.<br />
„Die Redaktion der Illustrierten Zeitung<br />
in Leipzig“ bittet am 1. Juli 1895 um das<br />
„Holzschnittrecht“: „Wir hegen den<br />
Wunsch Ihr jetzt in München im Glaspalast<br />
ausgestelltes Gemälde „Der Säugling“<br />
unsern Lesern in Holzschnittreproduction<br />
vorzuführen und erlauben uns die Anfrage<br />
an Sie zu richten, ob und unter welchen<br />
Bedingungen Sie uns das Buchreproductionsrecht<br />
daran im Sinne des beiliegenden<br />
Reverses abzutreten bereit wären“.<br />
Am 15. Juli 1895 teilt J.J. Weber von der<br />
„Redaction der Illustrierten Zeitung in<br />
Leipzig“ Mackensen mit, dass sie das<br />
„Gottesdienst“ betitelte Gemälde den<br />
Lesern als Reproduktion vorzuführen beabsichtigen,<br />
„wenn an diesem das Buchreproductionsrecht<br />
noch frei und eine Photographie<br />
vorhanden ist“.<br />
… und Verlage<br />
Ein Schreiben aus Dornach vom 30.<br />
Oktober 1895 („Photographischer Kunstverlag<br />
AD. Braun & Cie“) richtete sich an<br />
Mackensen in Worpswede: „Empfangen<br />
Sie unsern verbindlichsten Dank für die<br />
ehrenvolle Auszeichnung, die Sie uns<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
durch den Antrag Ihrer Bilder ‚Gottesdienst‘<br />
und ‚Der Säugling‘ durch unsern<br />
Verlag veröffentlichen zu lassen, entgegenbringen“.<br />
Auch Kontakte zu Museen<br />
entstanden<br />
In der Zwischenzeit waren auch Kontakte<br />
zu Museen in Leipzig, Berlin und<br />
Mackensens Werk „Moorbrücke“ erzielte auf der<br />
„Münchener Jahres-Ausstellung“ den Betrag von<br />
600,- Mark<br />
Dresden entstanden, und es wurden Ausstellungen<br />
geplant. In Leipzig äußerte Max<br />
Klinger sich anerkennend über Werke von<br />
Fritz Mackensen. Aus Bremen schrieb<br />
Gustav Vinnen - (mit dem Maler Carl Vinnen<br />
verwandt) - am 23. Oktober 1895:<br />
„Freue mich sehr, Ihr berühmtes Worpswede<br />
jetzt in der stimmungsvollsten Jahreszeit<br />
kennen zu lernen. Es wird ein würdiger<br />
Schlußakkord unserer Sommerzeit<br />
sein“. Außerdem bekräftigt der Bremer<br />
Rechtsanwalt Dr. R. Voigt in dem Brief vom<br />
24. Oktober 1895 an Mackensen: „Nachdem<br />
mir so allmählich klar geworden (ist),<br />
daß Sie mittlerweile ein berühmter Maler<br />
geworden sind, habe ich einige Gewissensbisse<br />
bekommen über unsern neulich<br />
verabredeten Plan, unsere kleinen Schwägerinnen<br />
durch Sie malen zu lassen. Ich<br />
denke mir, bei Ihren Erfolgen (können<br />
Sie) Ihre Zeit sehr nutzbringend anwenden“.<br />
Fritz Mackensen sandte seiner Mutter<br />
am 18.10.1895 die seinerzeit sehr einflussreiche<br />
Kunstzeitschrift „Die Kunst für Alle“.<br />
Diese bekannte Publikation erschien ab<br />
1885 im Münchener Bruckmann Verlag<br />
und wurde von dem Maler und Kunstschriftsteller<br />
Friedrich Precht herausgegeben.<br />
Der Worpsweder Künstler Fritz Overbeck<br />
veröffentlichte am 15. Oktober 1895<br />
in dem Heft 2, Seite 20 bis 24 den Artikel<br />
„Ein Brief aus Worpswede“. Aufgrund der<br />
Münchener Ausstellung im Glaspalast<br />
hatte ein „Redakteur“ den Wunsch an<br />
Overbeck gerichtet, „etwas von Worpswede<br />
zu hören“.<br />
Der Artikel „Ein Brief aus Worpswede“<br />
war mit Abbildungen von Worpsweder<br />
Künstlern illustriert. Dazu zählten auch<br />
Werke von Mackensen. Seine Mutter kommentierte<br />
am 18.10.95: „Mein lieber lieber<br />
Fritz! Gestern Morgen erhielten wir<br />
(die Zeitschrift) … es machte mir ungeheuren<br />
Spaß, Mittags Wilhelm (Bruder von<br />
Fritz), den Aufsatz vorzulesen. Weißt Du,<br />
mein lieber bester Fritz, daß in dem Heft<br />
Dein „Säugling“ das Beste von allem ist,<br />
das ist nach meinem Gefühl ganz wunderbar.<br />
Dein ‚Gottesdienst‘ ist doch längst<br />
nicht so klar und schön“.<br />
Die legendäre Auszeichnung 1895 in<br />
München für Fritz Mackensen hat unzählige<br />
Reaktionen und Erklärungen ausgelöst.<br />
Mit Hilfe von verfügbarem Quellenmaterial<br />
aus diesem Jahr konnten einzelne<br />
Facetten beschrieben werden. Die<br />
Darstellung ist möglicherweise eine Anregung<br />
zu weiteren Untersuchungen und<br />
Betrachtungen.<br />
Dr. Helmut Stelljes<br />
Quellenmaterial:<br />
Archiv der Barkenhoff-Stiftung Worpswede<br />
15
Fritz Mackensen: Einblicke in die Familienchronik<br />
Teil 1<br />
Anlass für diesen Beitrag<br />
Der in diesem Jahr begangene 150.<br />
Geburtstag des Gründungsvaters der<br />
Malerkolonie Worpswede, Fritz Mackensen,<br />
böte sicher genügend Anlass, seiner<br />
zu gedenken. Indes, es herrscht ziemliche<br />
Zurückhaltung, nicht zuletzt im Künstlerort<br />
selbst, dessen spezielle Geschichte nun<br />
einmal mit Mackensen in besonderer<br />
Weise zu tun hat. Lediglich im Museum am<br />
Modersohn-Haus in Worpswede und im<br />
Overbeck-Museum in Bremen-Vegesack<br />
kann man sich einen breiteren Einblick in<br />
sein Werk verschaffen, zum Teil mit Bildern,<br />
die bisher kaum oder gar nicht<br />
öffentlich gezeigt worden sind. In den Einführungsvorträgen<br />
bei den Ausstellungseröffnungen<br />
wurde durch Katja Pourshirazi<br />
und Bernd Küster in Vegesack sowie Friederike<br />
Schmidt-Möbus in Worpswede<br />
natürlich in erster Linie sein künstlerisches<br />
Werk kritisch gewürdigt. Andererseits blieb<br />
aber auch seine politische Verankerung,<br />
vor allem seine Nähe zum Nationalsozialismus,<br />
in den Betrachtungen nicht ausgespart.<br />
Und auch bei einer Podiumsdiskussion<br />
Anfang September im Worpsweder<br />
Rathaus wurden nicht nur kunstkritische<br />
Reflexionen angestellt. Immerhin kam es<br />
hier zu einer vergleichsweise differenzierten<br />
Betrachtung seines Lebens und Wirkens.<br />
Aber dennoch: Fritz Mackensen<br />
macht es uns allen offensichtlich schwer,<br />
mit seiner Vita zurechtzukommen.<br />
Aber anders als an den erwähnten Orten<br />
und auch anders als in den in dieser Zeitschrift<br />
veröffentlichten Beiträgen von Helmut<br />
Stelljes (<strong>2016</strong>) sollen im Folgenden<br />
ausnahmsweise weder sein künstlerisches<br />
Werk noch seine Vita im Vordergrund stehen.<br />
In den Mittelpunkt gerückt werden<br />
sollen vielmehr die Familie, vor allem die<br />
drei Brüder sowie deren Werdegang und<br />
Wirken. Meine Absicht ist damit nicht, Fritz<br />
Mackensen etwa völlig aus dem Blick nehmen<br />
zu wollen, um seine Handlungen<br />
oder Verfehlungen kleiner zu schreiben,<br />
gar zu entschuldigen. Nein, mein Beitrag<br />
soll vielmehr den Blick auf ihn erweitern<br />
helfen, indem ich sein soziales Umfeld<br />
betrachte.<br />
Der Auslöser<br />
Auslöser für diesen speziellen Ansatz in<br />
der Darstellung ist im Grunde genommen<br />
eine Nebensächlichkeit. Bei der Beschäftigung<br />
mit dem Künstler musste ich nämlich<br />
feststellen, dass in der einschlägigen Literatur<br />
wiederholt ärgerliche Verwechslungen<br />
seiner Brüder auftreten. Im Mittelpunkt<br />
dieses irritierenden „Wechselspiels“<br />
stehen ausschließlich die beiden jüngeren<br />
Brüder von Fritz, nämlich Wilhelm und<br />
Albert. Otto, der jüngste, bleibt in dieser<br />
Hinsicht (bislang) noch unbehelligt.<br />
Dabei hatte eigentlich alles einmal korrekt<br />
begonnen, heißt es doch in der Monographie<br />
von Ulrike Hamm/Bernd Küster<br />
(1990, S. 25): „Albert wurde Kaufmann in<br />
Bremen, Wilhelm Architekt und Hofbaurat<br />
in Hannover ...“. Leider kommt es dann<br />
aber im selben Werk auf Seite 74 erstmals<br />
zu der oben kritisierten Verwechslung. Bei<br />
der Beschreibung von Fritz Mackensens<br />
Wohnhaus am Weyerberg in Worpswede,<br />
dem sogenannten Haus Susenbarg, heißt<br />
es dann falsch: „Das Haus wurde nach Entwürfen<br />
des Bruders und Architekten Albert<br />
Mackensen gebaut.“ Dass dieser Fehler Folgen<br />
zeitigte, wird denjenigen Lesern deutlich,<br />
die zu dem außerordentlich lesenswerten<br />
Buch von Gudrun Scabell (2012) greifen<br />
und dort im Text über die Villa Mackensen<br />
denselben (falschen) Hinweis finden,<br />
dass „die Entwürfe … von Albert Mackensen,<br />
dem Architekten und Bruder Fritz<br />
Mackensens“ (S. 80) stammten. Und ein<br />
aktuelles (und hoffentlich auf Dauer letztes)<br />
Beispiel ist in dem Buch zu finden, das<br />
Sigrun und Bernhard Dieter Kaufmann<br />
<strong>2016</strong> aus Anlass der von ihnen im Museum<br />
am Modersohn-Haus in Worpswede initiierten<br />
und so sehenswerten Ausstellung von<br />
Kunstwerken Fritz Mackensens herausgegeben<br />
haben. Darin schreibt die eingangs<br />
erwähnte Kunsthistorikerin Friederike<br />
Schmidt-Möbus über die wiederum<br />
miteinander vertauschten Söhne (S. 9):<br />
„Sohn Wilhelm wurde erfolgreicher Kaufmann<br />
in Bremen, Albert wurde Architekt<br />
und Baurat in Hannover ...“.<br />
Ich will es damit bewenden lassen und<br />
mich im Weiteren der höchst interessanten<br />
Familienchronik der Mackensen-Familie<br />
zuwenden – und dabei ausführlich über<br />
die Söhne Albert, Wilhelm und Otto und<br />
ihre wahren beruflichen Funktionen und<br />
Leistungen berichten. Die dabei gesammelten<br />
Daten und Informationen sind vielleicht<br />
zugleich dazu geeignet, aus den vielfältigen<br />
Familienbeziehungen ein neues<br />
und differenzierteres Bild von und über<br />
Fritz Mackensen zu gewinnen.<br />
Die meisten Ausgangsdaten konnte ich<br />
einem genealogischen Forschungsbericht<br />
von Hans Bülow (1989) entnehmen.<br />
(Inzwischen weiß ich allerdings, dass eine<br />
ganze Reihe von Angaben darin unzutreffend<br />
sind.) Einige Informationen zum<br />
Abgleich bzw. als Ergänzungen fand ich<br />
verstreut in den entsprechenden Wikipedia-Seiten<br />
bzw. in weiteren Einträgen im<br />
Internet. Wichtige Hilfestellungen leisteten<br />
auch der <strong>Heimat</strong>verein in Greene in der<br />
Person seines 1. Vorsitzenden Jürgen Sander<br />
sowie viele andere hilfsbereite Menschen,<br />
z.B. in Orts-, Stadt-, Staats- und Kirchenarchiven,<br />
bei Handelskammern und<br />
in Unternehmensarchiven. Ihnen sei an<br />
dieser Stelle ebenso herzlich gedankt wie<br />
den mehr als zwei Dutzend ungenannt<br />
bleibenden Personen aus der Nachkommenschaft<br />
der Mackensens, die in ihren<br />
Erinnerungen, Datensammlungen und<br />
Fotoalben auf Spurensuche gegangen<br />
waren und mir sehr behilflich zur Seite<br />
standen.<br />
Der Vater,<br />
seine Geschwister<br />
und die Mutter<br />
Meine Einblicknahme in die Familienchronik<br />
möchte ich mit den Eltern beginnen.<br />
Der Vater Ludwig Mackensen (* 1836<br />
in Gandersheim; † 1871 in Greene) war<br />
Bäckermeister in der gepachteten Gemeindebäckerei<br />
in Greene, einer Gemeinde im<br />
südlichen Niedersachsen, die heute zur<br />
Stadt Einbeck gehört. Ludwig Mackensen<br />
setzte mit seiner Tätigkeit eine gewisse<br />
Familientradition fort, denn auch sein<br />
Vater war Bäckermeister, allerdings im<br />
nahen Gandersheim. Überhaupt dominierten<br />
in der Linie des Vaters, d.h. seiner<br />
Vorfahren, handwerkliche Berufe. So werden<br />
seit dem späten 17. Jahrhundert, vorwiegend<br />
in Gandersheim, neben den<br />
Bäckermeistern u.a. auch Ratszimmer-,<br />
Nagelschmiede- und Schuhmachermeister<br />
als Vorfahren mit dem Namen<br />
Mackensen genannt. Diese Tradition wird<br />
aber erstmals in der Familie des Vaters<br />
nicht mehr durchgängig aufrechterhalten.<br />
Während die Schwester Georgine noch<br />
einen Sattlermeister und die Schwester<br />
Antonie einen Bäckermeister heirateten,<br />
verließen die beiden Brüder diese Familientradition,<br />
indem sie sich technischen<br />
Berufen zuwandten, und zwar über eine<br />
akademische Ausbildung.<br />
Der eine Bruder, nämlich Ernst Mackensen<br />
(* 1840 in Gandersheim; † 1909 in<br />
Konstantinopel-Pera), brachte es als Dipl.<br />
Ing., versehen mit der Ehrendoktorwürde<br />
der TH Dresden, zum preußischen Titel<br />
eines Geheimen Baurats. Besondere Auszeichnungen,<br />
d.h. mehrere Orden des<br />
Osmanischen Reiches, erwarb er sich aber<br />
im Zusammenhang mit Eisenbahnprojekten<br />
in der heutigen Türkei. Als Leiter der<br />
Anatolischen Eisenbahngesellschaft, vor<br />
allem aber bei der Planung und beim Bau<br />
der berühmten Bagdadbahn, einer ingenieurtechnischen<br />
Meisterleistung, die ab<br />
16 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
1903 realisiert wurde, spielte er eine wichtige<br />
Rolle.<br />
Der zweite Bruder, nämlich Wilhelm (*<br />
1847 in Gandersheim; † ? in Braunschweig),<br />
wurde ebenfalls Dipl. Ing. und<br />
mit dem Titel Geheimrat ausgestattet.<br />
Auch sein Tätigkeitsschwerpunkt hatte mit<br />
der Bahn zu tun, dem damals noch<br />
zukunftsträchtigen Unternehmen. In der<br />
Bremer Region z.B. zeichnete er verantwortlich<br />
für den Bau der sogenannten<br />
Dreyerbrücke, einer Eisenbahnbrücke, die<br />
die Weser zwischen Bremen-Hemelingen<br />
und Dreye, einem Ortsteil der Gemeinde<br />
Weyhe überspannt. Sie entstand 1873 als<br />
Teil der Hamburg-Venloer Bahn in der<br />
Zuständigkeit der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft,<br />
für die zu jener Zeit<br />
auch der eben erwähnte Bruder Ernst tätig<br />
war. Der Gedanke, dass der ältere Bruder<br />
dem jüngeren den Zugang zum Unternehmen<br />
erleichterte, dürfte nicht ganz abwegig<br />
sein. Wir werden an anderen Stellen<br />
noch auf weitere Unterstützungsleistungen<br />
innerhalb der Familie Mackensen<br />
stoßen, sicher ein gutes Prinzip des familiären<br />
Zusammenhalts.<br />
Die mit der Vatergeneration in der Familie<br />
aufbrechende veränderte berufliche<br />
Orientierung ist insofern erwähnenswert,<br />
weil sie sich ja, wie darzustellen sein wird,<br />
in der Generation der Söhne, angefangen<br />
bei Fritz Mackensen, durchgängig in nichthandwerkliche<br />
Richtungen entwickelt und<br />
verfestigt. Es spricht viel dafür, dass sie sich<br />
aus den neuen Möglichkeiten sowie Ausbildungsgängen<br />
in der sogenannten Gründerzeit,<br />
einem Zeitalter zunehmender<br />
Industrialisierung und des technischen<br />
Fortschritts erklären lässt.<br />
Unerwähnt blieb bisher die Ehefrau des<br />
Bäckermeisters bzw. die Mutter der hier im<br />
Mittelpunkt stehenden vier Jungen. Ludwig<br />
Mackensen hatte 1865 die Lehrerstochter<br />
Luise Meyer aus Bodenwerder an<br />
der Weser geheiratet. Sie war dort 1839<br />
geboren worden. Ihre Mutter war 37-jährig<br />
kurz nach der Geburt der Tochter im<br />
Wochenbett verstorben. Ob der Vater<br />
erneut eine Ehe eingegangen war, konnte<br />
nicht ermittelt werden. Indes, es ist wohl<br />
davon auszugehen, zumal er zeitweise seinen<br />
Enkel Fritz bei sich aufnahm (s.u.).<br />
Luise Mackensen soll nach allem, was zu<br />
erfahren ist, eine recht harte, strenge,<br />
streit- und herrschsüchtige Frau gewesen<br />
sein, gefürchtet zumindest von allen Enkeln<br />
und Schwiegertöchtern. Fritz Mackensen<br />
soll zu ihr trotz allem ein inniges Verhältnis<br />
gehabt haben. Er nahm sie des Öfteren für<br />
längere Zeit bei sich in seiner Wohnung,<br />
zunächst in der Alten Schule und später in<br />
seinem Hause in Worpswede auf. Dabei fertigte<br />
er eine Reihe von Zeichnungen,<br />
Gemälden und Plastiken von ihr an. Im<br />
Jahre 1919 starb sie in Hannover, wo zu<br />
dieser Zeit der drittälteste Sohn Wilhelm<br />
wohnte. Sie wurde dort auf dem Stadtfriedhof<br />
Engesohde beigesetzt.<br />
Die Söhne<br />
und ihre Familien<br />
In der Ehe von Ludwig und Luise<br />
Mackensen, die durch den frühen und<br />
plötzlichen Tod des 35-jährigen Ehemannes<br />
bereits im Jahre 1871 endete, wurden<br />
die drei Söhne Fritz, Albert und Wilhelm<br />
geboren. Der vierte Sohn, nämlich Otto,<br />
stammt aus einer anderen, wenn man so<br />
will „nach-ehelichen“ Beziehung der Mutter.<br />
Dazu später mehr.<br />
Nun zu den ehelich geborenen Söhnen<br />
und ihren Familien mit den (so weit wie<br />
möglich ermittelten) Lebensdaten:<br />
(1) Heinrich Friedrich Karl (genannt<br />
Fritz) Mackensen (* 8.4.1866 in Greene; †<br />
12.5.1953 in Bremen); verheiratet mit seiner<br />
ehemaligen, fast 18 Jahre jüngeren<br />
Malschülerin Hertha, geb. Stahlschmidt (*<br />
13.3.1884 in Bonn; † 11.12.1949 in Bremen),<br />
Tochter eines Bonner Kaufmanns.<br />
Das Ehepaar Fritz und Hertha Mackensen (entnommen<br />
aus Hamm/Küster 1990, S. 14)<br />
Porträt der Tochter Alexandra, 1938 (Foto: Teumer,<br />
aufgenommen im Overbeck-Museum)<br />
Aus der Ehe stammt die (behinderte)<br />
Tochter Alexandra (* 7.1.1908 in<br />
Worpswede; † 21.3.1961 in Lüneburg),<br />
die über Jahre in Pflegeeinrichtungen<br />
lebte. Durch ihr Lebensschicksal, im Dritten<br />
Reich zwangssterilisiert und der Euthanasie<br />
ausgesetzt, mag man vielleicht<br />
ein wenig mehr Einsicht und Verständnis<br />
entwickeln in manche Handlungen des<br />
Vaters. Das bedeutet nicht, sein Tun zu verharmlosen.<br />
Es hilft aber möglicherweise<br />
dazu, sein Handeln aus den Zeitumständen<br />
und seiner persönlichen Lage heraus<br />
differenzierter als es gemeinhin geschieht<br />
zu bewerten.<br />
(2) Albert Konrad Johann Mackensen (*<br />
11.11.1867 in Greene; † 2.7.1936 in Düsseldorf);<br />
verheiratet mit der Tochter eines Bremer<br />
Silberwarenfabrikanten, Luise Charlotte<br />
Marie, geb. Wilkens (* 3.8.1880 in Hemelingen<br />
b. Bremen; † 4.10.1947 in Lehesterdeich<br />
b. Bremen).<br />
Dieser Ehe entstammen zwei Töchter,<br />
und zwar Gertrud Bertha Luise (*<br />
20.9.1902 in Düsseldorf; † 18.7.1997 in<br />
München) sowie Mirjam Frida Elisabeth (*<br />
14.1.1908 in Düsseldorf; † 30.9.1984 in<br />
München). Gertrud, verheiratet mit dem<br />
Kaufmann und Direktor der Focke-Wulf-<br />
Flugzeugwerke in Bremen Dr. Werner Naumann,<br />
betrieb nach dem altersbedingten<br />
Ausscheiden ihrer Mutter die von dieser<br />
auf dem Charlottenhof in Bremen-Horn<br />
aufgebaute stadtbekannte Baum- und<br />
Rosenschule weiter (s. Teil 2). Mirjam war<br />
in erster Ehe mit (dem frühverstorbenen)<br />
Otto Liederley, Generaldirektor der Rhein.<br />
Bahngesellschaft und komm. Oberbürgermeister<br />
in Düsseldorf, in zweiter Ehe mit<br />
dem Richter Dr. Ernst Freiherr v. Dörnberg<br />
verheiratet.<br />
Porträt der Tochter Alexandra, 1938 (Foto: Teumer,<br />
aufgenommen im Overbeck-Museum)<br />
(3) Wilhelm Adolf Albert Ernst Mackensen<br />
(* 21.8.1869 in Greene; † 8.3.1955 in<br />
Hannover);<br />
verheiratet mit Helene, geb. Justorff (*<br />
12.11.1868 in Hameln; † 14.10.1938 in<br />
Hannover), Tochter eines Buchbindermeisters<br />
aus Hameln.<br />
In dieser Ehe wurden vier Kinder gebo-<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
17
en, und zwar (der frühverstorbene) Hans-<br />
Heinrich (* 21.2.1903 in Hannover; †<br />
27.6.1903 in Hannover), Walter<br />
(11.11.1905 in Hannover; † ? in ?); Hertha<br />
(* 4.1.1907 in Hannover; † 2.1.1990 in<br />
Hannover) und Margarete (* 25.6.1908 in<br />
Hannover; † 20.4.1974 in Hannover). Walter<br />
wurde Reg.Baurat in Münster, und er<br />
war u.a. bei der Wiedereinweihung der (an<br />
den Lilienthaler Unternehmer Naber verkauften)<br />
Mackensen-Villa nach ihrer Renovierung<br />
1962 in Worpswede anwesend.<br />
Hertha war mit dem Stadtoberbaurat Karl-<br />
Ernst Rohmer, Margarete mit dem (in Russland<br />
vermissten) Dr. Ing. Hanskarl Voigt<br />
verheiratet.<br />
Das Leben der Mutter<br />
Nach dem plötzlichen Tod des Ehemannes<br />
und Vaters der drei Söhne stand die<br />
Witwe vor der Aufgabe, den Betrieb der<br />
Bäckerei aufrechtzuerhalten, um damit<br />
die Lebensgrundlage für sich und die Kinder<br />
zu sichern. Dies gelang zunächst mit<br />
Hilfe des in der Bäckerei tätigen Gesellen.<br />
Ob es sich dabei um Johann Georg Caspar<br />
Sürig (oder auch: Syrig) gehandelt hat,<br />
wird aus den mir zur Verfügung gestellten<br />
Unterlagen aus dem <strong>Heimat</strong>verein Greene<br />
e.V. nicht zweifelsfrei ersichtlich. Unbestritten<br />
aber ist, dass Luise Mackensen einen<br />
um fast sechs Jahre jüngeren Bäcker<br />
namens Sürig (* 2.2.1845 in Hildesheim,<br />
kath. Glaubens) am 14. Juli 1872 geheiratet<br />
hat. Allerdings endete diese Verbindung<br />
– Fritz Mackensen macht dafür die<br />
Trunksucht und Rohheit des Mannes verantwortlich<br />
(vgl. Hamm/Küster 1990, S.<br />
24) – nach sehr kurzer Dauer mit der Scheidung,<br />
die am 1. September 1874 vom<br />
Kreisgericht in Gandersheim ausgesprochen<br />
wurde. Der Bäckereibetrieb war<br />
bereits seit 1873, als Sürig die neue Familie<br />
plötzlich verlassen hatte, von der o.a.<br />
Schwägerin Antonie zusammen mit ihrem<br />
Mann, dem Bäckermeister Heinrich Christian<br />
Willgeroth, weitergeführt worden.<br />
Dass dieses Schicksal und Scheitern für die<br />
Mutter mit ihren drei Söhnen eine existentielle<br />
Bedrohung darstellte, liegt auf der<br />
Hand. Fritz war bereits 1871 nach dem<br />
Tode des Vaters vorübergehend zum<br />
Großvater nach Bodenwerder gegeben<br />
worden, Albert und Wilhelm waren mit der<br />
Mutter in das Haus eines Tierarztes in Greene<br />
umgezogen.<br />
Im Jahre 1877 entschloss sich die Mutter<br />
dazu, mit ihren drei Söhnen (nicht mit vier,<br />
wie mehrfach zu lesen ist, weil der vierte<br />
ja noch nicht geboren war!) in das 40 km<br />
entfernte Holzminden an der Weser zu ziehen.<br />
Die Begründung für diesen Umzug in<br />
die Kleinstadt liegt wohl ausschließlich<br />
darin, für die Söhne eine höhere Schulbildung<br />
zu ermöglichen. Doch in Holzminden<br />
trat ein Ereignis ein, was das Familiengefüge<br />
zweifellos noch einmal veränderte:<br />
Die drei Jungen, Fritz inzwischen 13 Jahre,<br />
Mutter Mackensen mit den vier Söhnen (Foto: privat)<br />
Albert 11 Jahre und Wilhelm 9 Jahre alt,<br />
bekamen 1879 einen weiteren Bruder,<br />
nämlich Otto. Er war unehelich, und seine<br />
genaue Herkunft zu erkunden, ist trotz der<br />
Recherchen in den Kirchenbüchern sowie<br />
im Stadtarchiv in Holzminden nur verdachtsweise<br />
gelungen, also nicht restlos<br />
abgesichert. Die entsprechenden Einträge<br />
fehlen nämlich, d.h. bei der Beurkundung<br />
der Geburt wurde kein Nachname des Kindes<br />
notiert, wohl aber die Tatsache, dass<br />
der Ehemann der Witwe Mackensen<br />
„bereits vor acht Jahren verstorben“ war.<br />
Dadurch war offenbar klar, dass das Kind<br />
den Mädchennamen der Mutter zu erhalten<br />
habe, also Otto Meyer. Und so blieb<br />
die Namensgebung, wahrscheinlich mit<br />
dem Zusatz: genannt Mackensen,<br />
zunächst auch über Jahre. (Über die<br />
Gründe, dass dieser vierte Sohn schließlich<br />
doch den Nachnamen Mackensen erhielt,<br />
wird in Teil 2 berichtet.)<br />
Interessant sind in diesem Zusammenhang<br />
aber noch zwei weitere Sachverhalte:<br />
Einerseits verwundert, dass in allen Dokumenten<br />
die Mutter als Witwe Mackensen,<br />
nicht aber als geschiedene Sürig bezeichnet<br />
wird, da doch wohl davon auszugehen ist,<br />
dass sie bei der zweiten Eheschließung den<br />
Namen Sürig angenommen hat. Erwähnenswert<br />
(und ziemlich überraschend) ist<br />
andererseits, dass bei Ottos Taufe eine Frau<br />
Dorette Syrig aus Hildesheim als Patin fungiert,<br />
also eine Verwandte des zweiten Ehemanns.<br />
War die Beziehung zur Familie also<br />
intakt geblieben, obwohl die Ehe so schnell<br />
geendet hatte?<br />
Luise wohnte, nunmehr mit ihren vier<br />
Söhnen, zunächst bis ins Jahr 1886 in Holzminden<br />
im Hause des jüdischen Kaufmanns<br />
Hirsch Stern, der ein Bekleidungsgeschäft<br />
besaß. Danach war sie noch in<br />
eine andere Unterkunft in der Stadt umgezogen.<br />
Den Lebensunterhalt für sich und<br />
die Kinder beschaffte sie sich, indem sie<br />
sich zu niederen Dienstleistungen verdingte<br />
und putzen, waschen und nähen<br />
ging. Zweifellos war dies ein sozialer<br />
Abstieg, und es wird berichtet, dass er<br />
besonders Fritz belastete (vgl.<br />
Hamm/Küster 1990, S. 25). In seinem<br />
1947 herausgebrachten Roman „Gerd<br />
Klindworth, Betas Sohn“, eine verschlüsselte<br />
Autobiografie, hat er dieses familiäre<br />
Problem noch in späten Jahren zu verarbeiten<br />
versucht. Ob dieses Schicksal für die<br />
Kinder vielleicht aber sogar ein Ansporn<br />
war, der in ihnen Kräfte für einen beispielhaften<br />
sozialen Aufstieg freisetzte, muss<br />
hier spekulativ bleiben. Auf jeden Fall aber<br />
wird auch die Mutter eine bewundernswerte<br />
Stärke oder auch Härte besessen<br />
haben. Hans Wohltmann, der als enger<br />
Freund Fritz Mackensens wohl viel Privates<br />
wusste, berichtete sogar recht drastisch<br />
davon, dass „aufopfernde Mutterliebe …<br />
die vier begabten Söhne 'hochgequält'“<br />
habe (1963, S. 23). Von Belang ist auch,<br />
dass es seitens der von mir danach befragten<br />
Nachkommenschaft mehrere Hinweise<br />
gibt, dass sich die beiden oben bereits<br />
erwähnten Onkel, nämlich Ernst und Wilhelm,<br />
sich der Familie und ihrer beengten<br />
finanziellen Lage angenommen haben.<br />
Beide waren kinderlos, Ernst zudem sehr<br />
wohlhabend.<br />
1889 verließ Luise, die weiterhin (oder<br />
wieder?) den Nachnamen Mackensen<br />
führte, Holzminden. Sie zog nach Hannover,<br />
wo sich einer der Söhne, nämlich Wilhelm,<br />
aufhielt. Er hatte, genauso wie<br />
Albert, seine Schulausbildung bereits<br />
beendet. Fritz, der Älteste, hatte zu dieser<br />
Zeit, wie bekannt, sein Studium an der<br />
Düsseldorfer sowie an der Münchner<br />
Kunstakademie gerade abgeschlossen und<br />
sich inzwischen mit einigen Malerfreunden<br />
zum Verbleib in dem am Rande des<br />
Teufelsmoores gelegenen Dorf Worpswede<br />
entschlossen. Deshalb hatte sich die<br />
Mutter hauptsächlich noch um den Jüngsten,<br />
nämlich den inzwischen 10-jährigen<br />
Otto und sein schulisches Fortkommen zu<br />
kümmern. Zwischenzeitlich hat sie sich<br />
aber wiederholt für längere Zeit bei ihrem<br />
ältesten Sohn Fritz in Worpswede aufgehalten,<br />
der sich ja vor dem Bau des eigenen<br />
Hauses für längere Zeit in der Alten<br />
Schule unterhalb des Friedhofs eingemietet<br />
hatte.<br />
Der vierte Sohn<br />
Ottos Lebensdaten und die seiner Familie<br />
sind die folgenden:<br />
(4) Luis Otto Theodor Meyer (später<br />
Mackensen, s. Teil 2) (* 14.5.1879 in Holzminden;<br />
† 10.2.1940 in Jena); verheiratet<br />
mit Hedwig Margarethe, geb. Sprung (*<br />
27.8.1883 in Halberstadt; † 14.1.1977 in<br />
München). Hedwigs Vater hatte den<br />
(heute seltenen) Beruf eines Gelbgießers,<br />
d.h. er goss und bearbeitete Messing und<br />
nahm die Funktion eines Werkmeisters<br />
wahr.<br />
18 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
In dieser Ehe wurden zwei Kinder geboren,<br />
und zwar Konrad (* ...1918 in Jena; †<br />
? in ?) sowie Dorothea (* 13.6.1919 in<br />
Jena; † 4.1.2010; in USA). Beide wurden<br />
Mediziner, Konrad Orthopäde in München,<br />
seine Schwester Zahnärztin in den<br />
USA.<br />
Prof. Dr. Jürgen Teumer<br />
Hinweis:<br />
Dieser Beitrag wird im nächsten Heft des <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong>s<br />
mit der ausführlichen Schilderung<br />
des persönlichen bzw. beruflichen<br />
Werdegangs von Otto, Wilhelm und Albert<br />
Mackensen fortgesetzt.. Auch die vielfältigen<br />
Auswirkungen auf das Leben und Wirken von<br />
Fritz Mackensen werden dargestellt.<br />
Literaturangaben<br />
- Bülow, Hans: Die Familien Mackensen aus<br />
Niedersachsen. Forschungsbericht. Neue<br />
Folge, Bd. 7. Hannover 1989<br />
- Hamm, Ulrike und Küster, Bernd: Fritz<br />
Mackensen 1866-1953. Lilienthal 1990<br />
- Mackensen, Fritz: Gerd Klindworth, Betas<br />
Sohn. Schloss Bleckede a. d. Elbe 1947<br />
- Scabell, Gudrun: Worpsweder Künstlerhäuser.<br />
Leben am Weyerberg. Bremen 2012<br />
- Schmidt-Möbus, Friederike: „Es brennt<br />
solch ein Feuer in ihm für seine Kunst“. Zum<br />
150. Geburtstag von Fritz Mackensen. In:<br />
Kaufmann, Sigrun und Kaufmann, Bernhard<br />
Dieter (Hrsg.): Fritz Mackensen und<br />
die Sammlung Bernhard Kaufmann.<br />
Worpswede <strong>2016</strong><br />
- Stelljes, Helmut: 150 Jahre Fritz Mackensen,<br />
Teil 1. In: <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> Nr. 116.<br />
Lilienthal Heft 1/<strong>2016</strong>, S. 24-26; Teil 2. In:<br />
<strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> Nr. <strong>118</strong>. Lilienthal Heft<br />
3/<strong>2016</strong>, S. …...<br />
- Wohltmann, Hans: Worpswede. Worpswede<br />
1963, 6. Aufl.<br />
Quellen<br />
- Mitteilungen und Unterlagen aus dem <strong>Heimat</strong>verein<br />
Greene e.V.<br />
- Unterlagen aus Kirchenbüchern, Orts-,<br />
Stadt- und Staatsarchiven sowie aus dem<br />
Archiv der Zeiss AG Jena<br />
- Wikipedia<br />
Fritz Mackensen<br />
Der umstrittene Erfinder Worpswedes<br />
Ohne ihn hätte es die Künstlerkolonie<br />
Worpswede nie gegeben: Fritz Mackensen,<br />
geboren 1866 in Greene im südlichen<br />
Niedersachsen, war der erste aus dem<br />
Kreis der später so genannten „Worpsweder<br />
Maler“, der in das Dorf am Weyerberg<br />
reiste und dort zu malen begann. Im Alter<br />
von nur 18 Jahren – er hatte sein Studium<br />
an der Düsseldorfer Kunstakademie<br />
gerade erst aufgenommen – folgte er der<br />
Einladung der Kaufmannstochter Mimi<br />
Stolte und verbrachte den Sommer in<br />
Worpswede. Erst auf seine begeisterten<br />
Schilderungen hin folgten ihm in den darauffolgenden<br />
Jahren seine Malerkollegen<br />
Otto Modersohn und Hans am Ende nach.<br />
Während heute meist von fünf Gründervätern<br />
der Künstlerkolonie gesprochen wird<br />
– neben den genannten zählen auch Fritz<br />
Overbeck und Heinrich Vogeler dazu -, war<br />
Fritz Mackensen gerade zu Anfang die treibende<br />
Kraft der Gruppe und der eigentliche<br />
„Erfinder“ Worpswedes als Künstlerort.<br />
Er galt als der vielversprechendste der<br />
Worpsweder Maler: Die Preise und Medaillen,<br />
mit denen er gerade in den Anfangsjahren<br />
überhäuft wurde, haben entscheidend<br />
zum Ruhm der Künstlerkolonie beigetragen.<br />
Fritz Mackensen: Die einsame Heimfahrt, 1903<br />
(Sammlung Dörnberg)<br />
Fritz Mackensen (Quelle: Worpsweder Archiv der<br />
Barkenhoff-Stiftung Worpswede)<br />
Sein Leben und Werk<br />
sind untrennbar mit<br />
Worpswede verknüpft<br />
Mackensen war nicht nur der erste, sondern<br />
in gewisser Weise auch der letzte<br />
unter den Worpsweder Malern: Da Overbeck<br />
bereits 1905 wegzog und Modersohn<br />
1908, Hans am Ende 1918 im Ersten<br />
Weltkrieg fiel und Vogeler 1931 in die<br />
Sowjetunion emigrierte, blieb allein<br />
Mackensen bis zu seinem Tod im Jahr 1953<br />
in Worpswede. Sein Leben und Werk sind<br />
über fast 70 Jahre hinweg untrennbar mit<br />
dem Ort verknüpft.<br />
Dennoch ist Fritz Mackensen in Worpswede<br />
heute kein eigenes Museum gewidmet,<br />
Ausstellungen und Publikationen über<br />
den Künstler sind rar, und eine differenzierte<br />
Erforschung seines Werkes steht noch<br />
aus. Diese Lücke in Forschung und öffentlicher<br />
Wahrnehmung erklärt sich vor allem<br />
durch seine Haltung im Nationalsozialismus,<br />
mit dem er nicht nur sympathisierte,<br />
sondern den er zum Teil offen unterstützte.<br />
Seine Rolle als Gründer der ‚Nordischen<br />
Kunsthochschule‘ in Bremen, in deren Satzung<br />
er schrieb, sie solle „mitwirken am<br />
Aufbau arteigener Kunst im Sinne Adolf Hitlers“,<br />
seine Einflussnahme als nationalsozialistischer<br />
Kulturfunktionär, als der er diffamierend<br />
gegen Kollegen wie Heinrich<br />
Vogeler vorging, und einige seiner Arbeiten<br />
aus den 1930er und 1940er Jahren, die im<br />
Auftrag von NS-Militärs oder der Reichskulturkammer<br />
entstanden, machten Mackensen<br />
rückblickend zur persona non grata.<br />
Unversöhnlich stehen sich bis heute<br />
zwei Sichtweisen gegenüber: Für die einen<br />
ist Fritz Mackensen der „Nazi-Maler“, dessen<br />
ideologische Verblendung sein gesamtes<br />
Werk diskreditiert und dessen Arbeiten<br />
deshalb heute am besten gar nicht mehr<br />
gezeigt werden sollten. Für die anderen ist<br />
er der Schöpfer einfühlsamer Bauern- und<br />
Landschaftsporträts, der erst im Alter von<br />
71 Jahren in die NSDAP eintrat und dessen<br />
umfangreiches künstlerisches Werk deshalb<br />
zumindest zum Teil losgelöst von den<br />
Zeitläufen der 1930er und 1940er Jahre<br />
betrachtet werden müsse.<br />
Fritz Mackensen: Landschaft im <strong>Herbst</strong>, o.J.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
19
In der Unvereinbarkeit dieser beiden<br />
Positionen, die beide einen Teil der Wahrheit<br />
auf ihrer Seite haben, wird die ganze<br />
Ambivalenz der Figur Fritz Mackensen<br />
deutlich. Für den geltungsbedürftigen<br />
sozialen Aufsteiger, der aus einfachen Verhältnissen<br />
kam und es bis zum bedeutenden<br />
Künstler, Kunstprofessor und sogar<br />
Hochschuldirektor brachte, waren Erfolg<br />
und Anerkennung von überragender<br />
Bedeutung. Umstandslos diente er sich<br />
dem Regime an, um Einfluss zu gewinnen.<br />
Seine konservative Einstellung und die<br />
Liebe zur norddeutschen Landschaft und<br />
<strong>Heimat</strong>kunst gingen allzu leicht in militanten<br />
Nationalismus über und schließlich im<br />
Nationalsozialismus auf. Zugleich suchte er<br />
seine geistig behinderte Tochter dem<br />
Zugriff der Euthanasie-Gesetze zu entziehen.<br />
In seinen Gemälden heroisiert er das<br />
entbehrungsreiche Leben der Bauern und<br />
vor allem der Bäuerinnen, die er in großformatigen<br />
Porträts zu madonnenhaften Müttern<br />
stilisiert, lange bevor der Nationalsozialismus<br />
die Verehrung der „deutschen<br />
Mutter“ zum Programm erhebt. In vielen<br />
Redaktionssitzung<br />
anderen, kleineren Studien, wie den Porträts<br />
seiner Tochter Alexandra oder einigen<br />
seiner unbekannteren Landschaftsdarstellungen,<br />
zeigt er sich von einer ganz anderen<br />
Seite: freier, experimentierfreudig, aufgeschlossen<br />
gegenüber zeitgenössischen<br />
Kunstströmungen wie impressionistischen<br />
und expressionistischen Tendenzen. Hier<br />
scheint der Künstler Mackensen auf einmal<br />
anderen Werten zu folgen als der Ideologe<br />
Mackensen sie vertritt.<br />
Durchsetzen tut sich diese experimentierfreudige<br />
Seite in Mackensens Werk<br />
nicht. Zu sehr steht seine nationalkonservative<br />
Haltung seiner künstlerischen Weiterentwicklung<br />
im Wege. Es bleibt ein<br />
umfangreiches Werk, das um einiges vielfältiger<br />
ist als viele ahnen, dem aber vielleicht<br />
gerade deshalb die zukunftsweisende Linie<br />
fehlt: Neben den bekannten großformatigen<br />
Ölgemälden, für die Fritz Mackensen<br />
zu Lebzeiten überragende Anerkennung<br />
erhielt und die heute leicht als „zu pathetisch“<br />
abgetan werden, existieren zahllose<br />
kleinere, unbekanntere Studien, die in<br />
Motivwahl und Malduktus jeweils so unterschiedlich<br />
sind, als seien hier verschiedene<br />
Maler am Werk gewesen.<br />
Unermüdlicher und<br />
vielseitiger Künstler<br />
Hinzu kommen unzählige sehr gekonnte<br />
Radierungen und Zeichnungen und sogar<br />
einige wenige, aber durchaus überzeugende<br />
Skulpturen. Fritz Mackensen zeigt<br />
sich als unermüdlicher und vielseitiger<br />
Künstler. Viele seiner Arbeiten befinden<br />
sich vermutlich noch in Privatbesitz und<br />
sind bis heute gar nicht wissenschaftlich<br />
erfasst. Ein aktuelles Werkverzeichnis existiert<br />
nicht, ein ihm gewidmetes Museum<br />
ist nicht in Planung.<br />
Immerhin: Das Overbeck-Museum in<br />
Bremen-Vegesack widmet dem umstrittenen<br />
Maler anlässlich seines 150. Geburtstages<br />
in diesem Jahr eine Ausstellung, die<br />
als kritische Würdigung und erste Annäherung<br />
an den Künstler verstanden werden<br />
will und noch bis zum 16. Oktober zu<br />
sehen ist.<br />
Dr. Katja Pourshirazi<br />
Am 16. Juli <strong>2016</strong> hatte die Redaktion des<br />
<strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong>s das Vergnügen, bei Herrn<br />
Dr. Zaft in Garlstedt in den Räumlichkeiten des<br />
ehemaligen Studios von Mike Leckebusch zu<br />
tagen. Dort wurden vielen Folgen von „Musikladen<br />
extra“ produziert. Mike Leckebusch,<br />
1937 in Leipzig geboren und 2000 in OHZ<br />
verstorben, konzipierte in den 60er-Jahren die<br />
legendäre Sendung „Beat-Club“. Viele Informationen<br />
dazu sind leicht im Internet zu finden.<br />
Siegfried Zaft, beruflich tätig im Bereich<br />
Flugsicherheit (www.adk6.com), ist seine<br />
fröhliche Begeisterung für das mit Technik voll<br />
gepropfte Studio anzumerken. Mit viel Enthusiasmus<br />
und mindestens genau soviel finanziellen<br />
Mittel hat er Haus und Studio auf Vordermann<br />
gebracht und nebenbei noch ein<br />
kleines Flugzeug in den Garten gestellt - Spass<br />
muss sein!<br />
Nach einer Führung mit vielen „Ahs“ und<br />
„Ohs“ begrüßte Jürgen Langenbruch die<br />
Anwesenden zur Redaktionssitzung. Alle<br />
gedachten des verstorbenen langjährigen<br />
Redakteurs und Freund des <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong>,<br />
Jürgen Lodemann, der uns viele Jahre<br />
mit viel Sachkenntnis begleitet hat.<br />
Zwischenzeitlich ist ein Werbeständer<br />
gestaltet worden, der für Veranstaltungen<br />
zwecks Werbung für den <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong><br />
zur Verfügung steht. Freundlicherweise hat<br />
der Förderverein die Finanzierung übernommen<br />
- dafür vielen Dank! Ein schon lange<br />
gärendes Thema ist das Findbuch - das digitale<br />
Suchwortarchiv. Vorgeschlagen wird eine<br />
Datenbanklösung z. B. Access von Microsoft,<br />
die als Grundlage für weitere Bearbeitung dienen<br />
kann. Weiteres beim nächsten Treffen.<br />
Weiter ging es mit dem Rückblick auf das<br />
aktuelle Heft und der Vorstellung der neuen<br />
Themen für die Ausgabe <strong>118</strong>. Die Leserreise<br />
nach Münster im September steht auf dem<br />
Plan (zwischenzeitlich erfolgreich bei bestem<br />
Wetter durchgeführt). Im nächsten Jahr wird<br />
der <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong> 30 Jahre jung, zu diesem<br />
Anlaß sollten frühzeitig Planungen für<br />
Veranstaltungen und Veröffentlichungen<br />
stattfinden.<br />
Das nächste Treffen findet am 15. Oktober<br />
<strong>2016</strong> im „Köksch und Qualm“, Stader Landstraße<br />
46 in Bremen.<br />
Nach lebhafter Plauderei und letztem<br />
Rundgang durch das einmalige Gebäude ging<br />
auch diese Redaktionssitzung zu Ende. Jürgen<br />
Langenbruch bedankte sich bei dem Gastgeber<br />
und seiner Frau für diesen schönen Abend<br />
und bei den Redaktionsmitgliedern für die<br />
gute Zusammenarbeit und die vielen Mühen,<br />
die Grundlagen unserer beliebten Publikation<br />
sind.<br />
Jürgen Langenbruch<br />
20 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Am Brunnen vor dem Tore …<br />
Die Winterlinde ist Baum des Jahres <strong>2016</strong><br />
Sie ist Muse für Dichter und Musiker,<br />
sozialer Treffpunkt, Apotheke und Nahrungsquelle<br />
für zahlreiche Tiere: die Winterlinde,<br />
botanisch Tilia cordata. Wegen<br />
ihrer Vielfältigkeit wurde sie zum Baum des<br />
Jahres <strong>2016</strong> gewählt.<br />
Gekürt wird der Baum des Jahres von der<br />
gleichnamigen Stiftung, in dessen Kuratorium<br />
auch der NABU vertreten ist. Stiftungspräsident<br />
Dr. Silvius Wodarz hofft, mit<br />
dem Baum des Jahres den Blick der Men-<br />
Sommer- und Winterlinde auch Kreuzungen<br />
aus Sommer- und Winterlinde<br />
gepflanzt.<br />
Kann 1000 Jahre<br />
alt werden<br />
Die Winterlinde, die bis zu 25 Meter<br />
hoch wird und ein Alter von 1000 Jahren<br />
erreichen kann, blüht etwas später als ihre<br />
„Schwester“, die Sommerlinde, die bereits<br />
wird deshalb vor allem im Innenbereich<br />
verwendet und auch Bildhauer und Holzschnitzer<br />
arbeiten gerne mit dem Lindenholz.<br />
Viele berühmte Meisterwerke in der<br />
Sakralkunst, zum Beispiel von Tilman Riemenschneider<br />
und Veit Stoß, wurden aus<br />
Lindenholz gefertigt.<br />
Seit Jahrhunderten dient die Winterlinde<br />
dem Menschen als Apotheke: Lindenblüten<br />
werden als Tee und Arzneimittel zum<br />
Beispiel bei Erkältungskrankheiten verwen-<br />
Winterlindenzweig kurz nach dem Laubaustrieb im Frühjahr Foto: Helge May<br />
Winterlindenstämme - Foto: Helge May<br />
schen auf Pflanzen schärfen zu können. Der<br />
Titel wird seit 1989 an einheimische Bäume<br />
vergeben. Ziel ist es, das Wissen über<br />
Bäume zu vertiefen und auf seltene oder<br />
bedrohte Baumarten hinzuweisen.<br />
Kaum ein Baum ist in deutschen Straßen<br />
und Parks so oft anzutreffen wie die Linde.<br />
Kein Wunder, ist sie doch nicht nur sehr<br />
schön anzuschauen, sondern auch relativ<br />
anspruchslos, was ihren Lebensraum<br />
betrifft. Dabei ist Linde aber nicht gleich<br />
Linde. Als Straßen- und Stadtbäume werden<br />
neben den beiden heimischen Arten<br />
1991 zum Baum des Jahres gekürt wurde.<br />
Zur Unterscheidung lohnt sich ein Blick auf<br />
die Blattunterseiten. Diese sind bei der<br />
Winterlinde kahl und mit einigen rotbraunen<br />
Härchenbüscheln versehen. Bei der<br />
Sommerlinde sind diese „Bärte“ dagegen<br />
weiß. Die Blüten der Winterlinde erscheinen<br />
erst ab Ende Juni – fast zwei Wochen<br />
später als die der Sommerlinde. Sie blüht<br />
damit am spätesten von allen heimischen<br />
Baumarten.<br />
Lindenholz ist meist weißlich bis gelblich<br />
und gehört zu den weichen Hölzern. Es<br />
det. Außerdem sind die Blüten wichtige<br />
Nahrungsquelle für Bienen. Entsprechend<br />
beliebt ist der süße Lindenblütenhonig.<br />
Der kulinarische Einfluss geht noch weiter.<br />
„Zur Linde“ sei der häufigste Gasthausname<br />
in Deutschland, bilanziert die Stiftung.<br />
Dorflinden, Gerichtslinden, Kirchlinden,<br />
Tanzlinden und Hoflinden ebenso wie<br />
Sagen und Ortsnamen zeugen von einer<br />
„jahrhundertelangen vielseitigen Bedeutung“.<br />
Text: NABU<br />
Bauernregeln<br />
Oktober – November – Dezember<br />
Oktober<br />
Am Sankt Gallustag (16.10.)<br />
den Nachsommer man erwarten mag.<br />
Bringt der Oktober viel Frost und Wind,<br />
sind Januar und Februar wohl gelind.<br />
November<br />
Ein heller, kalter, trockener November<br />
gibt Regen und milde Luft im Januar.<br />
Ist's um Martinitag nass,<br />
kommt spät erst Klee und Gras.<br />
Dezember<br />
Fließt Nikolaus noch der Birkensaft,<br />
dann kriegt der Winter keine Kraft.<br />
Haben's die unschuldigen Kindlein (28.12.) kalt,<br />
so weicht der Frost noch nicht so bald.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
21
Schluss nach 700 Jahren?<br />
Geschichte und Zukunftsaussichten eines Teufelsmoor-Hofes Teil 2<br />
Es ist ein Glücksfall, wenn Zeugnisse<br />
vorhanden sind, die es ermöglichen, in die<br />
Vergangenheit einer Familie einzutauchen.<br />
Bei der hier vorgelegten Untersuchung<br />
konnte zudem nicht nur auf schriftliche<br />
Überlieferungen zurückgegriffen werden;<br />
erst die detaillierten Schilderungen einer<br />
Zeitzeugin haben die Schriftstücke „zum<br />
Leben erweckt“ und für einen Außenstehenden<br />
begreifbar gemacht.<br />
Beschäftigt man sich mit der Entwicklung<br />
der Dorfschaft Teufelsmoor, so ist<br />
diese eng mit den 19 Höfen verknüpft, die<br />
sich als konstante und dominante Größe<br />
durch mehrere Jahrhunderte als prägend<br />
erwiesen haben. Die Höfe entlang des<br />
Querdamms, die heute die Große Reihe<br />
bilden, sind es, die von Anbeginn an, d. h.<br />
seit dem späten 13. oder frühen 14. Jahrhundert,<br />
den Charakter der Siedlung<br />
bestimmt, die wirtschaftliche Entwicklung<br />
gestaltet, die Landschaft geformt und das<br />
soziale Leben geprägt haben.<br />
Kann also anhand eines Hofes dargestellt<br />
werden, was das Besondere am Dorf<br />
ist, worin es sich von anderen Orten unterscheidet?<br />
Ist es vielleicht sogar eine der<br />
letzten Möglichkeiten, Traditionen im Ort<br />
aufzuspüren in einer Zeit, in der der Strukturwandel<br />
längst auch die althergebrachten<br />
Strukturen im Dorf erfasst, wo vieles<br />
Neue das Alte abgelöst und verdrängt hat?<br />
Der alte Hof Nr. 4 unter<br />
wechselnden Herrschaften<br />
Wenn auch die Menschen der damaligen<br />
Zeit das evtl. anders empfunden<br />
haben mögen, so kann man aus heutiger<br />
Sicht wohl doch sagen, dass die Zeit bis<br />
zum Dreißigjährigen Krieg unter der Herrschaft<br />
des Erzbischofs relativ gleichmäßig<br />
und ohne große Umwälzungen verlief.<br />
Durch die Reformation hatte sich das<br />
Bekenntnis gewandelt; der durch den<br />
Glaubensstreit ausgelöste große Krieg tangierte<br />
das abgeschiedene Dorf aber nur.<br />
Erst mit der Eroberung durch die Schweden<br />
und die Verleihung des Klosters Osterholz<br />
an Landgraf Friedrich von Hessen-<br />
Eschwege im Jahre 1647 änderten sich die<br />
Verhältnisse. Das Kloster wurde 1650 endgültig<br />
aufgelöst, die bis dahin dort zu entrichtenden<br />
Abgaben waren an Friedrich<br />
und ab 1655 an seine Witwe Eleonora<br />
Catharina zu begleichen.<br />
Die Schwedenzeit endete 1712; nach<br />
einem kurzen dänischen Intermezzo kam<br />
das Dorf mit den nach dem Dreißigjährigen<br />
Krieg geschaffenen Herzogtümern<br />
Bremen und Verden 1715 an das Kurfürstentum<br />
Hannover. In Osterholz war<br />
bereits 1692 ein staatliches Amt eingerichtet<br />
worden, an dem nun die Abgaben<br />
abzuliefern waren, daran änderte sich<br />
nach 1715 nichts.<br />
Seit 1714 war der Kurfürst Georg Ludwig<br />
in Personalunion als Georg I. englischer<br />
König. Unter seinem Sohn und<br />
Nachfolger Georg August (Georg II.) rückten<br />
die Moorgebiete stärker in das Blickfeld<br />
des Staates. Bevor dieser jedoch durch Jürgen<br />
Christian Findorff die ungenutzten<br />
Moore an Hamme, Wümme und Oste kultivieren<br />
ließ, sehen wir Findorff 1755 in<br />
amtlicher Mission im Dorf Teufelsmoor,<br />
um Vermessungen durchzuführen und<br />
seine Ergebnisse in mehreren Karten darzustellen.<br />
Ein Ausschnitt aus einer Karte in<br />
kleinerem Maßstab zeigt sehr schön, wie<br />
das Land, das zum Hof Nr. 4 gehörte,<br />
genutzt wurde und wie ähnlich dies auch<br />
bei den Nachbarhöfen gehandhabt<br />
wurde. (vgl. HRB Nr. 117, S. 25) Möglicherweise<br />
hat Findorff bei seiner Tätigkeit<br />
Ausschnitt Special Carte…Teufelsmoor von 1755. LArch. Stade Karten Neu Nr. 2982<br />
22 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
im Ort wichtige Erkenntnisse über die<br />
Landbewirtschaftung auf Moorböden<br />
gewonnen, die er bei seiner Tätigkeit im<br />
Rahmen der staatlichen Moorkolonisation<br />
sinnvoll umsetzen konnte. Hierbei hatte er<br />
es ab 1760 mit Georg III. zu tun, der seine<br />
Anweisungen vom fernen London aus gab,<br />
ohne dass er Hannover während seiner 60-<br />
jährigen Regierungszeit jemals besucht<br />
und Findorffs Werk in Augenschein<br />
genommen hat.<br />
Auch wie Findorff die Siedlungen angelegt<br />
hat, lässt gewisse Ähnlichkeiten erkennen.<br />
Wie bei Teufelsmoor handelt es sich<br />
um Reihensiedlungen entlang einer Leitlinie;<br />
die Flurstücke stellen parallel verlaufende<br />
Streifen dar, auf denen die Hofgebäude<br />
stehen.<br />
Ob Findorff Teufelsmoor später noch<br />
einmal besucht hat, ist nicht bekannt. Die<br />
Personalunion hatte noch bis 1837<br />
Bestand, Hannover – ab 1814 Königreich –<br />
existierte bis 1866.<br />
Anfang der Ablösungsurkunde vom 14. Dez. 1870<br />
Vom Meierhof zur<br />
Unabhängigkeit<br />
Bereits in den 1830er Jahren schuf der<br />
hannoversche Staat die Möglichkeit, dass<br />
sich die abhängigen Meier gegen Zahlung<br />
eines Betrages, der den 25-fachen Wert<br />
der Meierabgaben ausmachte, freikaufen<br />
konnten. Doch diese finanzielle Belastung<br />
war selbst für wirtschaftlich erfolgreiche<br />
Teufelsmoor-Höfe nicht ohne weiteres aufzubringen,<br />
so dass von dieser Möglichkeit<br />
zunächst kein Gebrauch gemacht wurde.<br />
Jedoch wurde schon bald ein erster<br />
Schritt vollzogen, indem man sich von<br />
Dienstpflichten freikaufte. Dies waren 18<br />
(ehem. Kloster-) Meierleute aus Teufelsmoor,<br />
Worpswede und Waakhausen, die<br />
Pflichten in den Klosterweiden bei Osterholz<br />
zu erfüllen hatten; darunter war Borchert<br />
Wellbrock. Im Ablösungs-Contract<br />
der Königlich-Großbritannisch-Hannoverschen<br />
Domainen-Cammer von 1831 heißt<br />
es u. a.: „Gegenstand der Ablösung sind<br />
nur diejenigen Spann- und Handdienste,<br />
Ausschnitt aus der Urkarte Blatt 10, hrsg. vom Katasteramt Osterholz-Scharmbeck<br />
Anfang des Meierbriefs für den Vollhöfner Gevert Wellbrock vom 1. März 1864<br />
welche die vorbenannten Meierleute nach<br />
dem Dienstregister der Rentey des Amts<br />
Osterholz der allergnädigsten Landesherrschafft<br />
in den s. g. Klosterweiden überall<br />
insbesondere behuf der Dämme, Gräben,<br />
Bäche und Teiche zu leisten haben.<br />
Königliche Domainen-Cammer verzichtet<br />
Namens der allergnädigsten Landesherrschaft<br />
vom 1. Januar 1837 an auf<br />
ewige Zeiten zu Gunsten der benannten<br />
Meierleute und deren Nachfolger auf jene<br />
Dienstleistungen in ihrem ganzen<br />
Umfange.“ 14 ) Jeder Meier hatte hierfür 31<br />
Tl. 6 ggr. zu entrichten. Das hat Borchert<br />
Wellbrock geleistet, mehr aber nicht.<br />
Es war sogar so, dass nach der Hofübernahme<br />
durch Gevert Wellbrock 1864 für<br />
ihn als Vollhöfner vom Königlich Hannoverschen<br />
Amt in Osterholz noch ein neuer<br />
Meierbrief ausgestellt wurde. In diesem<br />
werden außerdem noch die Aftermeierstellen<br />
aufgeführt, die von Hermann Heissenbüttel<br />
(Häusling), Johann Ficken (Häusling)<br />
sowie Hermann Grotheer (Häuerling)<br />
besetzt waren. Im Vergleich zu 1755 sind 2<br />
Namen gleich geblieben, aber eine Stelle<br />
ist weggefallen.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
23
Ausschnitt aus der Urkarte Blatt 13, hrsg. vom Katasteramt Osterholz-Scharmbeck. Die Stelle Nr. 50 liegt<br />
da, wo in der Karte die Ziffer 61 eingetragen ist.<br />
Die Flächen sind beim Vollhöfner<br />
geringfügig, bei den Aftermeiern deutlich<br />
geringer geworden.<br />
Erst 1870 konnte dann die notwendige<br />
Summe an Ablösungs-Kapital aufgebracht<br />
werden, so dass der Staat, vertreten durch<br />
die Königliche Finanz-Direction, vom 1.<br />
Nov. 1870 an auf seine Rechte am Hof verzichtete<br />
und dieser somit in das Eigentum<br />
des Vollhöfners Gevert Wellbrock überging.<br />
Aus dieser Zeit stammen auch die ersten<br />
Katasteramtskarten, die in Preußen bzw.<br />
im neu gegründeten 2. Deutschen Reich<br />
im Maßstab 1 : 2000 erstellt wurden.<br />
Die Ausschnitte zeigen die Hofstelle des<br />
Vollhofs Nr. 4 südlich der Teufelsmoorstraße<br />
sowie die Brinkköthnerstelle Nr. 50<br />
und die Anbauerstelle Nr. 51 nördlich der<br />
Straße, die gemeinsam auf Antrag von<br />
Gevert Wellbrock am 20. Feb. 1875 in die<br />
Höferolle der Gemeinde Teufelsmoor eingetragen<br />
worden sind.<br />
Einschneidende Änderungen<br />
im 20. Jahrhundert<br />
Gevert Wellbrock hatte spät geheiratet.<br />
Als er 1903 starb, war sein Sohn Johann<br />
noch zu jung, um den Hof zu übernehmen.<br />
Im Endeffekt für 21 Jahre wurde dieser<br />
verpachtet. Johann hatte zunächst<br />
Militärdienst zu leisten und wurde dann<br />
zum Kriegsdienst einberufen. Nach Rückkehr<br />
aus dem Weltkrieg wurde er Gemeindevorsteher<br />
der Gemeinde Teufelsmoor<br />
und blieb dies bis 1945.<br />
Von 1907 bis 1970 wurde ein damals<br />
neu gebautes Haus auf der gegenüber liegenden<br />
Straßenseite (Nr. 60) bewohnt,<br />
bevor 1970 der Umzug auf die alte Hofstelle<br />
in das neu erbaute Wohnhaus<br />
erfolgte.<br />
Im 2. Weltkrieg fiel der erbberechtigte<br />
Sohn Johann-Georg, so dass Tochter Wilhelmine<br />
– ab 1950 Lühr – den Hof erbte.<br />
Einflussnahme durch<br />
das GR-Gebiet<br />
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft<br />
brachte auch in Teufelsmoor einschneidende<br />
Änderungen mit sich.<br />
Mechanisierung ging einher mit Spezialisierung<br />
auf reine Rindviehhaltung, dem<br />
Abbau von Arbeitskräften bei Aufgabe<br />
unrentabler Betriebe und Expansion der<br />
verbliebenen.<br />
So gehört der Betrieb zu den wenigen<br />
verbliebenen, die die Landwirtschaft noch<br />
Teilräume des GR-Gebiets (Ausschnitt) aus dem<br />
Abschlussbericht zw. S. 7 und 8<br />
im Vollerwerb betreiben. Es wird heute<br />
aber kein Ackerbau mehr betrieben; die<br />
reinen Grünlandflächen werden gemäht<br />
bzw. weidewirtschaftlich genutzt. Der<br />
betriebswirtschaftliche Schwerpunkt liegt<br />
auf der Milcherzeugung. Die lange Zeit<br />
betriebene Schafhaltung ist in den 1960er<br />
Jahren aufgegeben worden.<br />
Die im Nieder- und Hochmoor gelegenen<br />
Flächen sind historisch überliefertes<br />
Eigenland, aber von minderer Ertragskraft.<br />
Eine charakteristische Bodenmesszahl lautet:<br />
Mo III a3-30. 15 ) Bedeutet: Moorboden<br />
der III. Qualitätsstufe im gemäßigten Klima<br />
bei recht hoher Bodenfeuchtigkeit und<br />
einem Grünland-Bodenwert an der Grenze<br />
von mittelgut zu gering.<br />
Für die Bewirtschaftung bedeutet dies,<br />
dass eine Bodenverbesserung durch<br />
erhöhte Nährstoffzufuhr erreicht werden<br />
kann oder dass den Naturgegebenheiten<br />
Rechnung getragen wird und die Wirtschaftsweise<br />
eher extensiv ausgerichtet ist.<br />
Für die zweite Alternative hat sich die<br />
Politik in Gestalt des Kreistages des Landkreis<br />
Osterholz entschieden, indem Bereiche<br />
der unteren Hammeniederung in der<br />
Größe von 2780 ha zu einem Naturschutzgroßprojekt<br />
von nationaler Bedeutung<br />
(GR-Gebiet) ausgewiesen worden<br />
sind. Zu den Maßnahmen, um eine standortgerechte<br />
Tier- und Pflanzenwelt zu<br />
sichern und zu fördern, gehören demzufolge<br />
Nutzungsauflagen für die Landwirtschaft,<br />
die die Extensivierung der Grünlandwirtschaft<br />
zum Ziel haben. 16 )<br />
Unumstritten war das Projekt nicht.<br />
Verlockend und seitens der Politik immer<br />
wieder hervorgehoben war der Umstand,<br />
dass zur Umsetzung der Ziele beträchtliche<br />
Mittel des Bundes und des Landes in den<br />
Landkreis fließen würden und dieser selbst<br />
nur 11% der 16 Mio. € teuren Maßnahmen<br />
aufbringen müsste. Demgegenüber<br />
äußerten die Landwirte – u. a. W. Lühr –<br />
die Sorge, dass die Existenz ihrer Höfe<br />
durch das GR-Gebiet gefährdet sei. 17 ) D.<br />
Krause-Behrens schreibt dazu in ihrem<br />
Kommentar: „Die Teufelsmoorer Bauern,<br />
die sich als Opfer fürs GR-Gebiet sehen,<br />
das man in Kauf nimmt, fühlen sich allein<br />
gelassen: von den Landwirten im Landkreis,<br />
von der Politik, von den Planern.“<br />
Reizthema<br />
Sammelverordnung<br />
Seitdem seit Anfang 2015 Pläne bekannt<br />
sind, dass der Landkreis Osterholz in einer<br />
Sammelverordnung großflächige Schutzgebiete<br />
ausweisen will, wird dieses Vorhaben<br />
in der Ortschaft und darüber hinaus<br />
höchst kontrovers diskutiert, wobei in der<br />
Tagespresse den Informationen seitens des<br />
Landkreises sowie den Stellungnahmen<br />
der Kritiker breiter Raum gewährt wird. Im<br />
Ort hat sich eine Schutzgemeinschaft<br />
gebildet, die seit Anfang Mai <strong>2016</strong> mit<br />
24 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Raumkategorien der Sammelverordnung (Ausschnitt)<br />
Kreuzen und Spruchbändern auf ihre<br />
Anliegen aufmerksam macht.<br />
Vergleicht man die Flächen, so fällt<br />
zunächst einmal auf, dass die insgesamt 5<br />
auszuweisenden Gebiete mit einer<br />
Gesamtgröße von 9700 ha 3 ½ mal so<br />
groß sind wie das GR-Gebiet. Dieses<br />
nimmt nur einen Teil innerhalb des<br />
Ganzen ein und ist in etwa deckungsgleich<br />
mit dem geplanten NSG Hammeniederung.<br />
Darüber hinaus sind ein weiteres<br />
NSG (Teufelsmoor), zwei größere LSG mit<br />
den vorgenannten Namen sowie ein kleines<br />
LSG (Beekniederung) vorgesehen.<br />
Für die Nutzflächen in Teufelsmoor<br />
bedeutsam ist, dass im Gegensatz zum GR-<br />
Gebiet auch die Flächen jenseits der Teufelsmoorstraße<br />
als Schutzgebiete ausgewiesen<br />
werden sollen. Ausgespart sollen<br />
die Hoflagen bleiben; dies ist auf der veröffentlichten<br />
Karte (s. HRB Nr. 117, S. 22)<br />
so nicht zu erkennen. Erst eine Darstellung<br />
in größerem Maßstab macht dies deutlich.<br />
Einerseits steht der Landkreis bei der Planung<br />
der Schutzgebiete unter Zugzwang.<br />
Mit dem Zuwendungsbescheid für das GR-<br />
Gebiet vom Nov. 1995 war die Verpflichtung<br />
verbunden, das Projektgebiet als<br />
NSG auszuweisen. Dies ist bislang nicht<br />
geschehen. Andererseits stellen das weitere<br />
NSG und die LSG kreiseigene Planungen<br />
dar, um bestehende Natura 2000-<br />
Gebiete abzurunden und zu sichern.<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
Gibt es eine Zukunft?<br />
Im Moment sind die Fronten verhärtet,<br />
wobei es nicht nur Forderungen nach<br />
weniger Naturschutz gibt, sondern auch<br />
etliche Stimmen, die dem Schutz der<br />
Natur noch mehr Vorrang einräumen und<br />
noch strengere Auflagen durchsetzen<br />
möchten. 18 ) Im Oktober <strong>2016</strong> soll nun die<br />
endgültige Entscheidung fallen.<br />
Es ist davon auszugehen, dass es bei den<br />
vorgesehenen Schutzgebieten bleibt. In<br />
einigen Details werden sich noch Änderungen<br />
ergeben; so hat die Stadt Osterholz-Scharmbeck<br />
gefordert, die „weißen“,<br />
nicht betroffenen Hoflagen innerhalb der<br />
Ortschaft auszuweiten. Inwieweit Ausnahmeregelungen<br />
mit Betroffenen vereinbart<br />
werden, wird vom Verhandlungsgeschick<br />
der Beteiligten abhängen.<br />
Für die Landwirte wird die Verordnung<br />
veränderte Rahmenbedingungen mit sich<br />
bringen. Sie sollten mit Augenmaß festgelegt<br />
werden, um deren Existenz nicht<br />
leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Eine<br />
Bestandsgarantie für die noch verbliebenen<br />
Höfe wird der Landkreis nicht aussprechen<br />
können. Dazu gibt es zu viele weitere<br />
Einflussgrößen, die nicht in der Macht der<br />
örtlichen Politik liegen. Einem Milch erzeugenden<br />
Betrieb macht es ohnehin der verfallene<br />
Milchpreis schwer, seine Kosten zu<br />
decken und Gewinne zu erwirtschaften.<br />
Gewinne, die auch nötig sind, um Investitionen<br />
zu tätigen für den Erhalt und die<br />
Anpassung des Betriebes an neue Erfordernisse.<br />
Um ihn zukunftsfähig zu machen,<br />
damit der Hof eines Tages vielleicht an<br />
einen der beiden Söhne übergeben werden<br />
kann. Doch dies ist – nicht nur bei diesem<br />
Betrieb – die weitere existenzielle<br />
Frage. War früher die Hofnachfolge innerhalb<br />
der Familie selbstverständlich, gilt<br />
dieses heute nicht mehr, und mancher der<br />
als Hoferben in Frage kommenden jungen<br />
Leute fasst in anderen Berufen Fuß und will<br />
sich nicht der Arbeit und den Risiken in der<br />
Landwirtschaft aussetzen.<br />
Was bedeutet dies für die Kulturlandschaft?<br />
Die Struktur des immer noch so<br />
ländlich erscheinenden Ortes Teufelsmoor<br />
hat sich längst gewandelt. Der Großteil der<br />
Bewohner geht Tätigkeiten außerhalb der<br />
Ortschaft nach, Infrastruktur und Freizeitangebote<br />
sind nur eingeschränkt vorhanden,<br />
die Lebensbedingungen dort nicht<br />
unbedingt für jeden attraktiv. Für etliche<br />
ehemalige Landwirte war bereits Schluss.<br />
Noch lebt der dörfliche Stadtteil – und<br />
wie! Die Bewohner kämpfen für ihren Ort,<br />
dessen Reiz auf der Natur und der aus<br />
einem Wechsel von offenem Grünland,<br />
einzelnen Gehölzgruppen, zahlreichen<br />
Gewässern und traditionellen bäuerlichen<br />
Gehöften bestehenden Kulturlandschaft<br />
basiert. Wer diese auch in der Zukunft erleben<br />
möchte, muss sich für deren Erhalt<br />
einsetzen!<br />
Wilhelm Berger<br />
Anmerkungen<br />
14) Anm. 1 – 13 s. HRB Nr. 117, S. 25. Ablösungs-Contract<br />
im Kreisarchiv Osterholz,<br />
Dep. 29 Bd. 107<br />
15) Bodenmesszahlen angegeben in der<br />
Inselkarte, einer Fortführung der Urkarte<br />
etwa Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie<br />
basieren auf Bodenschätzungen, die in<br />
Teufelsmoor 1935 flächendeckend<br />
durchgeführt worden sind.<br />
16) LK Osterholz, Naturschutzgroßprojekt<br />
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung<br />
„Hammeniederung“. Abschlussbericht;<br />
Osterholz-Scharmbeck 2012. Eine<br />
abschließende Bewertung findet sich<br />
auch im HRB: Johannes Kleine-Büning,<br />
Neue Wege des Naturschutzes in der<br />
Hammeniederung; in: HRB 4/2014, S.<br />
18 – 20.<br />
17) Daniela Krause-Behrens, GR-Gebiet:<br />
Landwirte im Teufelsmoor fordern Konzept<br />
für ihre Zukunft; in: Osterholzer<br />
Anzeiger vom 14. II. 1999<br />
18) als letzte noch vor Redaktionsschluss<br />
erschienenen Artikel seien genannt:<br />
Michael Schön, Naturschützer wollen<br />
fairen Ausgleich; in: OK vom 20. VIII. 16<br />
sowie ts, Die richtige Maßnahme; in:<br />
Osterholzer Anzeiger vom 24. VIII. 16.<br />
25
Gedenkfeier am Schroeter-Grab<br />
Auch Goethe und Kant würdigten Johann Hieronymus Schroeter<br />
Johann Hieronymus Schroeter war ein<br />
außerordentlich umsichtiger und<br />
geschätzter Oberamtmann und Justizrat in<br />
Lilienthal. Doch seine internationale Anerkennung<br />
und Würdigung erlangte er als<br />
leidenschaftlicher und erfolgreicher Astronom.<br />
Mit einer Feierstunde anlässlich seines<br />
200. Todestages am 29. August <strong>2016</strong><br />
wurde an das Wirken Schroeters erinnert.<br />
Schroeter-Grab bildete<br />
würdigen Rahmen<br />
Das neu vom <strong>Heimat</strong>verein gestaltete<br />
Schroeter-Grab neben dem Westeingang<br />
der Klosterkirche bildete einen würdigen<br />
Rahmen.<br />
Über das gezeigte große Interesse an<br />
der Gedenkfeier freute sich der Vorsitzende<br />
des <strong>Heimat</strong>vereins Lilienthal, Hilmar Kohlmann.<br />
Fröhlich und schwungvoll stimmen<br />
mehr als 40 Grundschüler der Schroeter-<br />
Schule ein Sommerlied an. „Ihr vertreibt<br />
bestimmt die Regenwolken mit Eurem<br />
schönen Lied“, hoffte Hilmar Kohlmann.<br />
Schroeter hat den<br />
Namen Lilienthals in<br />
die Welt getragen<br />
Schon wenige Minuten später, als Bürgermeister<br />
Willy Hollatz in seiner Ansprache<br />
die Bedeutung seines „Vorgängers“ für<br />
Lilienthal hervorhob, konnte die eindrucksvolle<br />
Gedenkfeier regenfrei fortgesetzt<br />
werden. „Schroeter hat den Namen<br />
Lilienthals mit seinen knapp 700 Einwohnern<br />
in die Welt getragen“, stellte Lilienthals<br />
Bürgermeister fest.<br />
Johann Hieronymus Schroeter trat seinen<br />
Dienst als Oberamtmann am 1. Mai<br />
1782 an.<br />
Der ehemalige Vorsitzende des <strong>Heimat</strong>vereins,<br />
Harald Kühn, beleuchtete in seinem<br />
Vortrag wichtige Stationen aus dem<br />
Leben Schroeters.<br />
Sonne, Mond, Planeten und Fixsterne<br />
faszinierten ihn gleichermaßen. Zur internationalen<br />
Bedeutung ist Schroeter vor<br />
allem durch die Herausgabe seines großen<br />
Mondwerkes, der „Selenotopographischen<br />
Fragmente“, gelangt. Mit diesem<br />
Standardwerk begann eine neue Epoche in<br />
der Mondforschung und brachten Schroeter<br />
den Ruf eines der bedeutendsten<br />
Mondforscher seiner Zeit. Ebenso fand das<br />
von ihm 1793 erbaute 27-füßige Teleskop,<br />
welches das größte „Fernrohr“ des<br />
europäischen Festlandes war, weltweites<br />
Aufsehen und Beachtung. Internationale<br />
Von links: Werner Pfingsten, Jens Erdmann, Kristian Tangermann, Hilmar Kohlmann, Willy Hollatz und<br />
Antke Bornemann. Am Mikrofon Harald Kühn.<br />
Wissenschaftler und Astronomen, wie Wilhelm<br />
Olbers, Karl Friedrich Gauß, Friedrich<br />
Wilhelm Bessel und Karl Ludwig Harding,<br />
waren oft längere Zeit in Lilienthal, um auf<br />
der berühmten Sternwarte zu beobachten<br />
und zu forschen.<br />
Schroeter-Grab<br />
Auch in Texten der Weltliteratur fanden<br />
die Erkenntnisse und Forschungsergebnisse<br />
Schroeters ihr Echo. So lobte der<br />
Königsberger Philosoph Immanuel Kant<br />
den „Lilienthaler Schroeter“ in seinen Werken.<br />
Johann Wolfgang von Goethe wiederum<br />
weist in seinem umfangreichen<br />
Briefwechsel mit Friedrich von Schiller „auf<br />
die bemerkenswerten astronomischen Forschungsergebnisse<br />
des Schroeters aus Lilienthal“<br />
hin.<br />
Grußbotschaften der<br />
direkten Nachfahren<br />
Besonders freuten sich die Besucher der<br />
Gedenkfeier über die von Harald Kühn verlesenen<br />
Grußbotschaften der direkten<br />
Nachfahren des großen Astronomen.<br />
Erfreut zeigten sich Dr. Heide Bittner aus<br />
Sanitz bei Rostock, Herbert F. Schroeter aus<br />
Birmingham, Alabama sowie Carol Page<br />
aus San Francisco, Kalifornien, über die<br />
große Anerkennung, die ihrem Vorfahren<br />
in Lilienthal bis heute entgegengebracht<br />
wird.<br />
Das von den Schülern der Schroeter-<br />
Schule stimmungsvoll vorgetragene<br />
„Weltraum-Lied“ begeisterte die Anwesenden.<br />
Text: Harald Kühn<br />
Fotos: Karl-Peter Geittner<br />
26 RUNDBLICK <strong>Herbst</strong>s <strong>2016</strong>
Lach- und Torfgeschichten<br />
„Jan von Moor“ un de Düwel<br />
Dat weer eenmol, so fangt de Määrken<br />
un Sagen jo meistendeels an. Dat weer<br />
eenmol so eenige hunnert Johr’n torüch,<br />
vor us Tied, in dat unwirtliche un gruselige<br />
Moorland, dat hüütdoog’s Düwelsmoor<br />
nöömt word. Dor weer bloot’s Woter,<br />
wubbeligen Dobben un smerigen Torfbodden,<br />
keen Padd, keen Wege un keen<br />
Groben, bloot de Beek un de Hamm<br />
schlängeln sick dor dör. Noch keen Menschenskind<br />
harr sick dor hentroot, es sei<br />
den, mit Gewalt, Mord- un Doodslag.<br />
Eenige, wie veel weet man nich, sind in dat<br />
garstige Moor umkomen un for jümmer<br />
vorswunnen. Bit de erste „Jan von Moor“<br />
mit sien Fro un dree Kinner von den Geestpuckel<br />
in’t Moor töög un sick up een<br />
högere Steer een lüttje armselige Koten<br />
henstell. Dat Daak ut Schelp un Stroh reck<br />
bit up’n Torf, de Spoor’n un Wan’n weern<br />
ut Eekensprickelholt, mit Torf upsett. Een<br />
Füersteer weer dorbin un’n Leeger ut<br />
Busch un Stroh. Dor husen se al tohoop<br />
bin, mit een Zeeg. Dat weer al düchtig<br />
wat, so harrn se een beten Zeegenmelk for<br />
de Kinner. Jan de steek Torf, mook Gröben<br />
open un een beten Land toschick for Bookweten<br />
un Gras for de Zeeg. So kööm he<br />
mit sien Fomilie, mehr slecht as recht, ober<br />
de Runnen.<br />
Schaurig schön ist es in Teufelsmoor<br />
An een Sommerobend, dat weer een hitten<br />
un dämpigen Dag ween, dor is Jan<br />
noch bie’n Torfpott togang, he will gliek<br />
Fieroben moken. Een gräsigt Donnerweer<br />
un swatte Grummelschurn mit gleunige<br />
Blitze bruust ober’t Moor, dadt is spökendüster.<br />
Jan is Angst in de Knoken föhrt.<br />
Jegen emm qalmt un stinkt dat. „So mutt<br />
dat wol in’ne Höll wesen“, denkt he bie<br />
sick un schuutert de kolen Gräsen ober sien<br />
Puckel.<br />
Jegen emm steiht de Düwel, de Leibhaftige<br />
in Person mit gleunige Ogen, den<br />
Peerfoot, ruuget Fell un sien langen Steert<br />
mit den Quest doran. An den Quest glimm<br />
noch so’n beten Höllenfüer. De Düwel will<br />
Jan in Angst un Bangen moken un bolkt<br />
emm an: „Wat wullt du hier, du elende<br />
Moormensch, dit hier dat is mien Land,<br />
RUNDBLICK <strong>Herbst</strong> <strong>2016</strong><br />
hier heff bloot ick wat to seggen un to<br />
doon. Se to dat du mit dien Wief un de Blagen<br />
ober de Hamm kummst!“ „Jan von<br />
Moor“ is vordattert, emm is gruselig un he<br />
hett Angst, ober he behaupt sick un steiht<br />
sien Mann: „Ick blief hier un mook Torf, ick<br />
kann mit mien Fro un de Kinnder narn’s<br />
woanners henn, dor jogdt se us uck oberall<br />
we“ Jen keek den Düwel vorgrellt an: „Ick<br />
blief hier, mook Land drög un eben, sei’e<br />
Bookweten un Hobern in, dormit wie al<br />
wat to Eten hebbt un leven köönt. Gröben,<br />
Wege un Dämme willt wie boen, dor<br />
kommt no veel mehr Menschen in’t Moor.<br />
Us Weiden un Felder ward grön, wie hebbt<br />
veel Gras un Korn, Keu’e un Beester, Swien<br />
un Höhner un een Gorden in den alles wassen<br />
deit, wat de leeve Herrgott us tokomen<br />
lett. Een groten Damm boot wie no us Karken,<br />
dormit wie an’n Sunndag god forhen<br />
kommt un den Herrgott löven köönt.“ De<br />
Düwel weer kort vor’n Platzen, dat Füer<br />
sprung emm ut de Ogen: „Du Wicht, du<br />
Erdskrüüpel, wat glöv’s du, wat du al<br />
kannst, du kannst gor nichts. Ick kann alles<br />
wat du die utdenken kannst, mark die dat<br />
„Jan von Moor“.“<br />
Jan hölt emm dat scharpe Torfmesser<br />
vor den smerigen Buuk um den Düwel sick<br />
von’n Liev to holen. „Ick glöv, du kannst<br />
nich alles“, meen he to emm. De Düwel<br />
harr’n groten Snuten. „Wetten, ick will mit<br />
die wetten, dat ick alles kann, wat du von<br />
mie wullt. Wenn ick dat nich kann, denn<br />
kann’s mit dien Blagen hierblieben.“ Jan<br />
keek emm plietsch in de gleunigen Ogen:<br />
„Dat is mol een Wort, dor go ick up in. Ick<br />
geef die hier een Stück knokendrögen Torf<br />
von unnen ut’n Pott, hart un drög! Dit<br />
Torfstück muss du woller natt moken.“<br />
De Düwel kunn sick vor Lachen utschütten:<br />
„Wenn’t wieter nix is, her mit dien<br />
Torfbülten.“ Een Torfpott weer full Woter,<br />
dor smeet he den Torf mit aller Gewalt rin.<br />
De Torfbülten duuk ünner un schööt woller<br />
ut’n Woter hoch, he swumm boben up.<br />
De Düwel pedd emm mit sien Peerhuf woller<br />
no unnen. Schwupp, swumm dat Torfstück<br />
woller boben up, dat Woter lööp<br />
andol. „Jan von Moor“ grien: „Drögen Torf<br />
kannst du nee woller natt moken, glöv mie<br />
dat.“<br />
De Düwel schaff dat uck nee, he kunn<br />
nich mehr an sick holen un sprung in’n<br />
Moor hen un her, dorbi spee he Füer un<br />
Flammen. In een grote Moorbussen, een<br />
Spalten un swartet Lock, is he mit veel<br />
Damp rinzischt, dat hett qualmt un stunken.<br />
Jan stünd mit zitterige Been an sien<br />
Torfpott, den Düwel harr he in de Schranken<br />
wiest, he kunn blieben. He sett sick up<br />
de holten Schuufkorr, hol deep Luft un vorpuust<br />
sick, dorbi dach he: „Ja, wat hest du<br />
Teufelsskulptur in Teufelsmoor<br />
woller for Dusel hart, Gott sei Dank!“ De<br />
Düwel weer in een Brass liek hendol in sien<br />
Höll suust, dor tööf Grotmudder, sien<br />
Oma, al up emm. Se kicher un laach oh’n<br />
Tähnen in’n Snuut: „Na mien Düwelskerl,<br />
de lüttje „Jan von Moor“ hett die wol ornlich<br />
kranzheistert un too’n Narr’n mokt,<br />
dat harr ick die furn’s seggen kunnt. Ober<br />
een betern Mann harr’n wie gornich finnen<br />
kunnt for dit gruselige Moor, loot<br />
emm un al sien Macker’s man in Ruh, de<br />
mokt dat all.“ De Düwel weer an’n Keuchen<br />
un Snuben: „Dat paast mie jo nee,<br />
ober wenn du dat meenst Oma, denn loot<br />
ick den Donnerslag gewähr’n. Un at een<br />
ewig Teeken schall dit Moor un dat este<br />
Dorp mienen Nomen dregen.“ Siet den<br />
Dag heet dat hier Düwelsmoor.<br />
Um eer’n Düwel in Ruh un to Besinnung<br />
to kriegen, harr Oma emm sien „Höllenelexier“<br />
mischt. „Höllenelexier“ is ut 3 Sluck<br />
Stroh-Rum, 3 Sluck „Ratzeputz“, Tabaso,<br />
twee Bullenklöten un word upfüllt mit<br />
Höhnerblood. Nich schüddeln, bloot<br />
umröhr’n, dat brennt goot un is „echt<br />
lecker!“ Dor schütt de Düwel nu allerhand<br />
von in sien Schlund un muss sick gräsig<br />
schuutern. He slöp uck bald in un snorch<br />
luut. Af de Tiet hett he „Jan von Moor“ un<br />
sien Lü’e in Free’r loten. Düwelsmoor un<br />
de Düwelsmoorer giff dat jümmer noch.<br />
Am besten nich argern un nich mit anleggen,<br />
de weet sick jümmer to helpen un<br />
holt tohoop – uck wenn se gegen den<br />
Düwel anmööt!<br />
Johann (Jan) Brünjes<br />
27