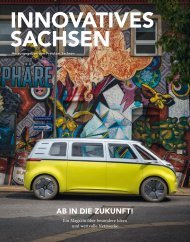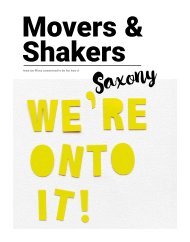Sachsen Macher
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Macher</strong><br />
brand eins Wissen im Auftrag des Freistaats<br />
<strong>Sachsen</strong>
<strong>Sachsen</strong> // <strong>Macher</strong><br />
Inhalt<br />
Da schau hin!<br />
Manchmal könnte man meinen, <strong>Sachsen</strong> habe nur noch<br />
Negatives zu bieten. Gestern Pannen, heute ein Skandal, morgen<br />
eine Hiobsbotschaft. Die schlechten Nachrichten formen sich seit<br />
Monaten zu einem diffusen, aber einprägsamen Bild. Es ist ziemlich<br />
düster – und falsch.<br />
Denn so wahr einzelne Schlagzeilen auch sind: Der unschöne<br />
Schein trügt. <strong>Sachsen</strong> ist mehr, als die jüngsten Botschaften suggerieren.<br />
Wir sind auf unseren Reisen nach Rochlitz, Chemnitz,<br />
Radebeul, Zittau, Dresden oder Schneeberg jedenfalls zahllosen<br />
neugierigen und aufgeschlossenen Menschen begegnet. Menschen<br />
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, hier geboren<br />
oder einfach heimisch, angestellt oder selbstständig, Student<br />
oder Unternehmer, Forscher oder Praktiker. Es sind Menschen mit<br />
Lust auf Zukunft, die ihre Träume wahr machen wollen, ihren Weg<br />
suchen und sich einlassen – auf neue Ideen und Projekte, auf Veränderungen<br />
und Rückschläge, auf Sackgassen und schwierige Zeiten.<br />
Wir haben diese Menschen nicht suchen müssen. Man trifft sie<br />
überall im Land. Auf jedem Hof und jeder Bühne, im Dorf und in<br />
der Stadt, in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Und ja, es gibt<br />
auch jene, die für Negativschlagzeilen sorgen. Wir wollten unseren<br />
Blick aber lieber von jener lauten Minderheit auf die Vertreter der<br />
leisen Mehrheit richten. Sie, diese Menschen, die sich jeden Tag<br />
neu aufmachen und engagieren, sind der Grund für unser Heft.<br />
Vielleicht können ihre Geschichten dazu beitragen, unser <strong>Sachsen</strong>-<br />
Bild zu korrigieren. Verdient hätten sie es.<br />
Noch mehr<br />
<strong>Macher</strong> in <strong>Sachsen</strong><br />
finden Sie auf:<br />
www.brandeinswissen.de<br />
4 Der globale Blick // Carsten Meyer hat fast eine Million<br />
Euro bekommen, um den Artenschutz global zu betrachten.<br />
6 Ich seh’ den Sternenhimmel // Mike Behnke wollte das<br />
Schneeberger Planetarium retten – und wurde zum Erfinder.<br />
8 Zurück in die Zukunft // Margitta Faßl ehrt Computer-<br />
Pionier Konrad Zuse – und gibt ihrer Stadt eine Perspektive.<br />
10 Unruh und Hemmung // Theodor Prenzel und Lutz<br />
Reichel haben der Uhrenindustrie eine Sensation beschert.<br />
18 Viel zu tun // Hussein Jinah hat einen Job, zehn Ehrenämter<br />
und ein großes Ziel: das weltoffene Dresden zu fördern.<br />
20 Läuft // Sebastian Wolter und Leif Greinus haben aus<br />
ihrem Freiheitsdrang einen florierenden Verlag gemacht.<br />
22 Hinter den Spiegeln // Kristina Musholt erforscht das<br />
Wesen des Menschen und ändert den Wissenschaftsbetrieb.<br />
24 Rappen in Zahlen // Johann Beurich rappt seine Songs<br />
auf Youtube und hat damit schon vielen das Abitur gerettet.<br />
Susanne Risch, Chefredakteurin<br />
susanne_risch@brandeinswissen.de<br />
12 Kraut und Rüben // Daniel Hausmann ist Visionär und<br />
Realist – und <strong>Sachsen</strong>s erster veganer Landwirt.<br />
26 Lernen, lachen, leben // Elf berühmte <strong>Sachsen</strong> aus<br />
vier Jahrhunderten erklären kurz, wie es so ist, das Leben.<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Freistaat <strong>Sachsen</strong> Chefredaktion: Susanne Risch Artdirection: Britta Max Chefin vom Dienst: Michaela Streimelweger<br />
Grafik: Deborah Tyllack Redaktion: Renate Hensel, Sibylle Kumm, Peter Lau, Kathrin Lilienthal, Uwe Rasche Text: Johannes Böhme,<br />
Anika Kreller, Brigitta Palass, Klaus Rathje, Andreas Wenderoth Foto: Michael Hudler, Oliver Helbig, Sigrid Reinichs, Anne Schönharting<br />
Illustration: Kia Sue Illustration Gesamtkoordination: Ketchum Pleon GmbH Konzept: brand eins Wissen © brand eins Wissen, Hamburg,<br />
2016 www.brandeinswissen.de<br />
14 Bewegend // Chayeon Lee ist erst 17, aber schon auf<br />
dem besten Weg, ein neuer Ballett-Star zu werden.<br />
16 Sonnige Zeiten // Christian von Olshausen beantwortet<br />
eine Zukunftsfrage: Wie speichert man erneuerbare Energien?<br />
28 Sauber gemacht! // Wolfgang Groß hat „fit“ in eine<br />
Erfolgsfirma mit mehr als 100 Marken verwandelt.<br />
30 Friede, Freude, Blinzes // Uwe und Lars Ariel<br />
Dziuballa betreiben <strong>Sachsen</strong>s einziges jüdisches Restaurant.<br />
2 3
Er sieht nicht aus wie der<br />
klassische Wissenschaftler,<br />
aber das heißt wenig:<br />
Carsten Meyer forscht am<br />
iDiv und hat sich gerade für<br />
ein Stipendium in<br />
Millionenhöhe qualifiziert.<br />
Der globale Blick<br />
<strong>Sachsen</strong> // leidenschaftlich<br />
Kann eine geschützte Art in Deutschland zehn nicht geschützte Arten in Südamerika<br />
vernichten? Der Biologe Carsten Meyer vom iDiv in Leipzig will genau das herausfinden.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: Michael Hudler<br />
Carsten Meyer ist Biologe und seit Kurzem Millionär – zumindest<br />
auf dem Papier. Denn jüngst erhielt der 32-Jährige, der am<br />
Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv)<br />
und an der Universität Leipzig tätig ist, ein Freigeist-Stipendium<br />
der VolkswagenStiftung. Budget: knapp eine Million Euro. Damit<br />
will der junge Wissenschaftler in den kommenden fünf Jahren die<br />
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen des<br />
weltweiten Artenschwundes untersuchen.<br />
Meyers Ansatz könnte eine große Lücke schließen. Rund<br />
400 000 Arten an Pflanzen und Landwirbeltieren sind derzeit weltweit<br />
wissenschaftlich erfasst. Doch Qualität und Quantität der über<br />
sie verfügbaren Daten sind höchst uneinheitlich, und so ist es fraglich,<br />
ob die tatsächliche Vielfalt der Flora und Fauna wie auch ihr<br />
Schwund realistisch abgebildet werden.<br />
Schon für seine Dissertation hatte Carsten Meyer Millionen an<br />
Datensätzen über die Verbreitung aller bekannten Arten von Säugetieren,<br />
Vögeln und Amphibien untersucht. Dabei stellte er fest,<br />
dass die relativ überschaubare Tier- und Pflanzenwelt in den Industrieländern<br />
fast vollständig erfasst, die Datenlage in den tropischen<br />
Zonen Südamerikas, Asiens und Afrikas dagegen ziemlich dünn<br />
ist. Gerade dort aber ist die Artenvielfalt am größten. Doch auch<br />
in Kanada, auf dem Balkan und in einigen ehemaligen Sowjetrepubliken<br />
klaffen Lücken. „Am allermeisten erstaunt haben uns<br />
die großen Defizite in relativ wohlhabenden Schwellenländern“,<br />
erzählt der Biologe.<br />
Meyer – T-Shirt, Jeans, Bart und leicht verstrubbelte Haare –<br />
hatte sich nur geringe Chancen seiner Bewerbung für das Stipendium<br />
ausgerechnet. Sein Doktor vater in Göttingen hatte ihn darauf<br />
aufmerksam gemacht. Doch bis dahin hatte Meyer kaum<br />
wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. „Und die sind nun mal<br />
die Währung in der akademischen Welt“, sagt er. Zudem kann<br />
man sich nur einmal um diese spezielle Studienförderung bewerben:<br />
Sie ist ausdrücklich für junge Wissenschaftler gedacht, die mit<br />
ihrer Arbeit gewohnte Wege verlassen, um einen neuen Blick auf<br />
Probleme zu werfen und nach innovativen Lösungen zu suchen.<br />
Ein anderer wichtiger Schritt ist dem Forscher bereits gelungen:<br />
„Ich wollte nach meiner Promotion in Göttingen unbedingt<br />
an das iDiv.“ Das Institut, eine gemeinsame Einrichtung der Universitäten<br />
Leipzig, Halle und Jena sowie des Helmholtz-Zentrums<br />
für Umweltforschung, zieht Experten aus aller Welt an und hat<br />
Leipzig ins Zentrum internationaler Spitzenforschung in Sachen<br />
Biodiversität gerückt – und es bringt auch Meyer voran: „Wenn ich<br />
bei einem wissenschaftlichen Problem nicht vorankomme, ist die<br />
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich ein paar Türen weiter jemanden<br />
finde, der mir helfen kann“, sagt er.<br />
Sein Ziel ist ehrgeizig. Der Biologe will all jene komplexen<br />
globalen Zusammenhänge erforschen, über die lokale wirtschaftliche<br />
und politische Entscheidungen die globale Artenvielfalt beeinflussen.<br />
„Der Verlust des natürlichen Lebensraums ist der wichtigste<br />
Grund für das Aussterben einer Art“, erklärt Meyer. Land- und<br />
Forstwirtschaft oder Straßen- und Bergbau können ursächlich dafür<br />
sein. Der Zusammenhang scheint auf den ersten Blick klar,<br />
doch global gesehen ist es komplizierter. „Angenommen, ein relativ<br />
artenarmes Land in Nordeuropa schränkt seine Forstwirtschaft<br />
gesetzlich stark ein, um Tiere und Pflanzen des Waldes besser zu<br />
schützen. Das Holz, das vor Ort gebraucht wird, wird künftig also<br />
importiert – und verursacht möglicherweise Kahlschläge in anderen,<br />
arten reicheren Ländern, deren Naturschutzstandards geringer<br />
sind. Ein deutlich höherer Artenschwund wäre die Folge; so könnte<br />
die lokal nützliche Gesetzesänderung global schädlich sein.“<br />
Für diesen globalen Blick müssen enorme Datenmengen verarbeitet<br />
werden – Big Data trifft Biologie. Das ermöglicht ganz<br />
neue Einsichten, birgt aber das Risiko des unbekannten Terrains.<br />
Doch damit kann Carsten Meyer leben. Schließlich gehe es der<br />
VolkswagenStiftung doch genau darum: dem freien Geist Raum zu<br />
schaffen, dass er sich ins Unbekannte entfalten möge.<br />
4<br />
5
<strong>Sachsen</strong> // Findig<br />
Ich seh’ den Sternenhimmel<br />
Das Planetarium von Schneeberg stand vor der Schließung – kein Geld für neue Technik. Hobbyastronom<br />
Mike Behnke entwickelte zur Rettung eine digitale Lösung, die Fachleute begeistert.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: sigrid reinichs<br />
Natürlich arbeitet<br />
Mike Behnke auch mit<br />
Klassikern wie diesem<br />
Zeiss-Teleskop. Seine<br />
Erfindung aber ist<br />
funk tionsfähig, viel<br />
günstiger als die<br />
herkömmlichen<br />
Systeme – und hat<br />
das Planetarium in<br />
Schneeberg gerettet.<br />
Jahrelang war ihm dieses Geräusch vertraut: das leise Klacken,<br />
wenn einer der 32 Projektoren unter der Kuppel des Zeiss-Planetariums<br />
in Schneeberg das nächste Dia vor das Objektiv schob – mit<br />
einer weiteren Ansicht der nächtlichen Gestirne. Es ist verstummt –<br />
für immer. Und Mike Behnke aus dem gut 30 Kilometer entfernten<br />
Gelenau ist darüber nicht traurig. Eines nach dem anderen hatten<br />
die alten Geräte den Dienst quittiert. Ersatz war kaum aufzutreiben,<br />
weil der Hersteller, der einstige Weltkonzern Kodak, längst deren<br />
Produktion eingestellt hatte. Und wirkten die Projektoren nicht<br />
ohnehin hoffnungslos altmodisch mit ihrer statischen Darstellung<br />
des Sternenhimmels in unserer bewegten, bildverliebten Welt?<br />
Zeitgemäßer Ersatz musste also her, und genau da begann das<br />
Problem. Projektionssysteme selbst für kleine und mittlere Planetarien<br />
wie das in Schneeberg kosten rund eine Viertelmillion Euro<br />
– zu viel für den „kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises“ als öffentlichem<br />
Träger. 2014 drohte die Schließung des Planetariums<br />
und der dazugehörenden mehr als 60 Jahre alten Sternwarte. Doch<br />
das kam für Mike Behnke nicht infrage.<br />
Ihn hatte der Blick zu den Sternen schon immer fasziniert. „Alles,<br />
was mit dem Universum, mit Raumfahrt, mit unserem Sonnensystem<br />
und fernen Galaxien zu tun hatte, begeisterte mich“, sagt er. Er<br />
war acht, als er sich nach einer Anleitung aus einem Handbuch für<br />
junge Astronomen sein erstes eigenes Teleskop bastelte. Doch die<br />
Astronomie blieb nur ein intensiv gepflegtes Hobby. Behnke wurde<br />
Kfz-Mechaniker und arbeitete später als Gerüstbauer. Erst 2006<br />
bot sich ihm die Gelegenheit, seine Leidenschaft zum Beruf zu<br />
machen. Der Landkreis suchte freie Mitarbeiter zur Betreuung des<br />
Planetariums. Da traf es sich gut, dass Behnke kurz zuvor einen<br />
Onlinehandel mit optischem Zubehör für Sterngucker und Naturfreunde<br />
gegründet hatte. Weil er den Internetauftritt möglichst professionell<br />
gestalten wollte, hatte er zudem eine Ausbildung zum Mediendesigner<br />
absolviert. Das sollte sich als sehr nützlich erweisen.<br />
Denn mit dem Hinscheiden der alten, analogen Diaprojektoren<br />
begriff Behnke, dass der künftige Blick in die Unendlichkeit digital<br />
sein würde. „Ich musste eine Lösung für eine Projektion auf gekrümmte<br />
Flächen und einen 360-Grad-Rundumblick finden. Anders<br />
geht es bei einer Planetariumskuppel nicht.“ Die Hardware – Computer<br />
und moderne HD-Beamer – war das geringste Problem. Aufwendiger<br />
gestaltete sich die Suche nach der passenden Software.<br />
Behnke wurde bei Flugsimulationsprogrammen fündig, aber das<br />
war nur der Anfang. Danach galt es, die zunächst sechs, heute nur<br />
noch vier Beamer so zu programmieren, dass keine Ruckler, Unschärfen<br />
und Nahtstellen bei der Projektion in der Kuppel auftreten.<br />
Ein halbes Jahr lang tüftelte Behnke bis tief in die Nacht an seinem<br />
System, er trug zunächst alle Kosten selbst. Dann führte er das<br />
Ergebnis den kommunalen Kulturverantwortlichen vor – und stieß<br />
auf Begeisterung. Auch weil seine Lösung mit rund 20 000 Euro<br />
nicht einmal ein Zehntel dessen kosten sollte, was für die Systeme<br />
etablierter Hersteller veranschlagt wird.<br />
In nur zwei Monaten und mit viel Eigenleistung wurde das<br />
Planetarium umgerüstet. Weil es inzwischen eine ganze Reihe von<br />
Animationen in Fulldome-Technik gibt, kann man in den nachtblauen<br />
Samtsesseln unter der Schneeberger Kuppel heute virtuell<br />
nicht nur durch die Weiten des Universums reisen, auf dem Mond<br />
landen oder die Ringe des Saturns kreuzen, sondern auch durch<br />
eine Blumenwiese fliegen oder mit Walen tauchen. Besonders die<br />
jungen Besucher sind fasziniert von den bewegten und bewegenden<br />
Bildern unseres wunderbaren blauen Planeten im All. Sie kommen<br />
oft mit ihren Eltern oder Großeltern wieder.<br />
Das freut Behnke besonders, schließlich wird die Astronomie<br />
als offizielles Lehrthema seiner Ansicht nach viel zu stiefmütterlich<br />
behandelt. Dabei hat sein System bereits Schule gemacht, im Wortsinn:<br />
Das Schulplanetarium in Chemnitz setzt seit einiger Zeit<br />
nämlich auch auf die Spezialtechnik aus dem Erzgebirge.<br />
6 7
<strong>Sachsen</strong> // Visionär<br />
Zurück in die Zukunft<br />
In der Vergangenheit war die Leiterin der Wohnungsgesellschaft<br />
Hoyerswerda vor allem mit Abriss<br />
beschäftigt. Jetzt baut Margitta Faßl neu auf: Museen,<br />
Gärten, Ideen – und Perspektiven für ihre Stadt.<br />
Über Jahrzehnte war Hoyerswerda ein höchst moderner Ort.<br />
Mit einem Museum will die Stadt nun an diese Zeit anschließen.<br />
Text: Peter Lau<br />
Foto: Anne Schönharting<br />
Städte leben von Visionären, die sie voranbringen, getrieben<br />
von Heimatliebe und einer Vision. Menschen wie Margitta Faßl.<br />
Die 65-Jährige könnte in den Ruhestand gehen, stattdessen arbeitet<br />
sie an einer neuen Perspektive für Hoyerswerda. Dazu beitragen<br />
soll das ZCOM (Zuse-Computer-Museum), ein Museum, das<br />
dem Erfinder, Unternehmer und weltbekannten Computerpionier<br />
Konrad Zuse gewidmet ist, der hier lebte und 1928 sein Abitur in<br />
der Stadt gemacht hat.<br />
Das Projekt ist ihre Idee, und für sie lag es nahe: „Es gab seit<br />
1995 eine Sammlung von Rechenmaschinen, die anlässlich eines<br />
Besuchs von Zuse in Hoyerswerda gestartet wurde“, erzählt Faßl.<br />
„Die Apparate waren am Rande der Stadt untergebracht, und viele<br />
Stücke befanden sich im Lager. Nun bringen wir die gesamte<br />
Sammlung auf 1300 Quadratmetern in der Neustadt unter, ganz<br />
zentral in den Ladenflächen eines Elfgeschossers.“<br />
Als Standort für ein Museum ist das ziemlich modern, aber<br />
Hoyerswerda war immer ein Ort, an dem die Zukunft stattfand:<br />
Hier entstand der erste Plattenbau der Welt, als die Stadt in den<br />
Fünfzigern zum Zentrum der „Energieregion“ der DDR ausgebaut<br />
wurde. Und hier wurde Konrad Zuse zur wohl wichtigsten Erfindung<br />
des 20. Jahrhunderts inspiriert, dem ersten funktionsfähigen<br />
Digitalrechner. Jahrzehnte später schrieb der Bauingenieur über die<br />
Atmosphäre, die seine Jugend prägte: „In Hoyerswerda gab es endlich<br />
auch eine technische, eine technisierte Umwelt. Nicht weit von<br />
der Stadt lagen modern eingerichtete Braunkohlegruben … Die<br />
großen Abraumförderbrücken gaben mir eine erste Vorstellung von<br />
einem automatisierten, technischen Zeitalter.“<br />
Margitta Faßl will auch nach vorn denken. Sie weiß aus ihrer Arbeit,<br />
wie nötig ihre Stadt eine Perspektive hat: Seit 1993 leitet die<br />
Diplom-Ingenieurin die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda, der<br />
eine Vielzahl von Häusern im Plattenbauviertel Neustadt gehört. In<br />
den vergangenen Jahren war sie in ihrer Position vor allem mit<br />
der Stadtschrumpfung beschäftigt – also mit Abriss. Das sei nicht<br />
immer einfach gewesen, sagt sie: „Ein Großteil der Älteren, vor<br />
allem die Bergbaurentner, hadern sehr mit dem Thema Rückbau.“<br />
Faßl kann das verstehen – beirren lässt sie sich davon nicht.<br />
Denn bei allem Sinn fürs Bewahren: Manchmal müssen die Relikte<br />
der Vergangenheit weg, um Platz für Neues zu schaffen. Auch das<br />
Museum soll mehr sein als ein Ort der Erinnerung. „Das ZCOM<br />
wird die alten Rechenmaschinen, die wir besitzen, in einem sinnvollen<br />
Rahmen zeigen, außerdem wollen wir damit einen besonderen<br />
Ort der Bildung schaffen.“ Langfristig hat die Ingenieurin aber<br />
noch eine andere Vision: Die Geschichte soll wieder aufleben –<br />
und im Idealfall Unternehmen aus der Computerbranche oder den<br />
neuen Medien an den traditionsreichen Ort ziehen.<br />
Margitta Faßl verfolgt derweil schon die nächste Idee. Sie hat<br />
einen Film über Gärten in der Stadt gesehen, die in Gebäuden angelegt<br />
werden, erzählt sie. An einigen dieser Projekte ist die Hochschule<br />
für Technik und Wirtschaft in Dresden beteiligt, zu der sie<br />
deshalb gerade Kontakt aufnehme. „Vielleicht ist es möglich, einen<br />
Plattenbau, der nicht mehr gebraucht wird, für so ein Projekt zu<br />
nutzen?“ Die Rente kann warten. Margitta Faßl hat noch zu tun.<br />
Und lächelt wie eine, die weiß: Die Zukunft kommt nicht einfach<br />
– sie wird gemacht.<br />
8 9
Unruh und<br />
Hemmung<br />
<strong>Sachsen</strong> // Präzise<br />
Es ist nicht einfach, ein Monopol zu knacken.<br />
Theodor Prenzel und Lutz Reichel haben mit<br />
dafür gesorgt, dass es der Uhrenmanufaktur<br />
Nomos Glashütte gelungen ist.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: Michael Hudler<br />
Sie lieben Uhren, Teamarbeit, Technik und<br />
Wettbewerb – und haben Nomos Glashütte<br />
zu einer Sensation verholfen:<br />
Konstruktionsleiter Lutz Reichel (links)<br />
und Laborleiter Theodor Prenzel.<br />
Es war die Sensation der Baselworld 2014, der bedeutendsten<br />
Uhrenmesse der Welt. Die Manufaktur Nomos Glashütte stellte ihr<br />
selbst entwickeltes Swing-System vor. Dieses Herz einer jeden<br />
mechanischen Uhr, auch Assortiment, Reglage oder Hemmung<br />
genannt, besteht aus Unruh, Spirale, Ankerrad und Anker sowie<br />
weiteren winzigen Teilen. Von ihrem komplizierten und zugleich<br />
perfekten Zusammenspiel hängt ab, wie genau, robust und langlebig<br />
ein Uhrwerk ist. Das Monopol auf diese entscheidende Baugruppe<br />
hatten jahrelang die Swatch-Töchter ETA und Nivarox in<br />
der Schweiz. Und deren Spezialisten hüteten ihre Geheimnisse gut.<br />
Seit dem Aufkommen der Quarzuhren in den Sieb zigerjahren gab<br />
es keine Grundlagenforschung in der Königs dis ziplin der Uhrmacherei<br />
mehr. Es existierte kaum Literatur, und es gab schon gar<br />
keine mathematischen Berechnungen für die Reglage. Wer mechanische<br />
Uhren bauen wollte, musste bei den Schweizern kaufen.<br />
Oder bei null anfangen.<br />
Die Uhrmacher aus <strong>Sachsen</strong> wählten den zweiten Weg und<br />
investierten sieben Jahre und elf Millionen Euro in ihre Unabhängigkeitserklärung.<br />
In einem gemeinsamen Projekt mit der Technischen<br />
Universität Dresden simulierten und berechneten sie mit<br />
dem Computer das feine Zusammenspiel all der kleinen Teile eines<br />
Assortiments und brachten es zur Serienreife. Das Fraunhofer-<br />
Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden unterstützte<br />
sie bei der Suche nach modernen Materialien. In entscheiden <br />
der Funktion dabei: Theodor Prenzel, 32, Leiter der Konstruktion<br />
bei Nomos Glashütte und stellvertretender Chef der Abteilung<br />
Forschung und Entwicklung, sowie Lutz Reichel, 31, Entwicklungsingenieur<br />
und Laborleiter der Manufaktur.<br />
Beide stammen aus Uhrmacherfamilien, und für beide war früh<br />
klar, dass sie diese Tradition fortsetzen wollten. Sie sind fasziniert<br />
von der perfekten Symphonie der winzigen, komplexen Mechanik.<br />
Prenzel hat in Jena Feinwerktechnik studiert. Seine Abschlussarbeit<br />
schrieb er bei Nomos – er wurde prompt übernommen. Auch für<br />
Lutz Reichel war klar, dass er sich in seinem Maschinenbaustudium<br />
an der TU Dresden mit der Konstruktion von Uhren beschäftigte.<br />
„Es war eine besondere Erfahrung, dass ich während eines<br />
Praxissemesters bei Nomos Uhren von Grund auf selbst montieren<br />
durfte“, erzählt er. „Das war für die spätere Konstruktions- und<br />
Berechnungsarbeit sehr hilfreich.“ Das Thema seiner Diplomarbeit:<br />
„Die dynamische Simulation des NOMOS-Swing-Systems.“<br />
Nach einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni<br />
wechselte Reichel 2011 in die Praxis nach Glashütte und betreute<br />
das Projekt auf Firmenseite weiter. Er hielt Kontakt zu den Forschungsinstituten<br />
und war verantwortlich für den Prototypenbau.<br />
Theodor Prenzel leitete die konstruktiven Arbeiten und verantwortete<br />
die komplette Zeichnungserstellung. Die Schnittstelle zwischen<br />
Konstruktion und Prototypenbau ist ein sensibler Punkt:<br />
„Nur wenn hier die Kommunikation klappt, können wir Probleme<br />
bereits in einer sehr frühen Phase erkennen“, erklärt Prenzel. Dank<br />
persönlicher Sympathie, flacher Hierarchien, der wöchentlichen<br />
Abstimmung von Ergebnissen und Zielen und der kurzen Wege im<br />
alten Bahnhof in Glashütte, in dem Nomos residiert, war das kein<br />
Problem. Oft half in dieser Phase neben all der Wissenschaft auch<br />
die praktische Erfahrung der Uhrmacher im Hause weiter. Der entscheidende<br />
Sprung vom Prototyp zur Serienfertigung gelang, 2014<br />
stellte die Manufaktur die ersten Handaufzugswerke mit „Swing“<br />
vor. Später wurde das System zum Herzstück des neuen Automatikwerks<br />
DUW 3001, das nach völlig neuen Konstruktionsprinzipien<br />
arbeitet, wie Prenzel erklärt.<br />
So ein Durchbruch wie die Entwicklung des Swing-Systems ist<br />
ein bisschen wie ein Olympiasieg. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn<br />
die theoretischen Berechnungen und Konstruktionen sich auch in<br />
der Praxis als funktional erweisen und schlicht besser sind als das,<br />
was die meisten anderen machen“, sagt Prenzel. Schön sei auch, in<br />
den Geschäften ‚sein‘ Uhrwerk im fertigen Produkt zu sehen. Am<br />
meisten aber freuen sich Prenzel und Reichel auf neue Projekte und<br />
Aufgaben – auf den nächsten Wettkampf. Genug Ideen dafür, das<br />
bekräftigen beide, haben sie.<br />
10 11
<strong>Sachsen</strong> - Machen<br />
Kraut und Rüben<br />
<strong>Sachsen</strong> // unbeirrbar<br />
Daniel Hausmann aus Rochlitz ist <strong>Sachsen</strong>s einziger Bauer, der nicht nur biologisch,<br />
sondern auch streng vegan wirtschaftet. Einfach ist das nicht. Aber er zeigt, dass es geht.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: sigrid reinichs<br />
Bio-veganer Anbau<br />
bedeutet geringe Erträge,<br />
harte körperliche Arbeit<br />
und eine aufwendige<br />
Vermarktung. Doch<br />
Daniel Hausmann bereut<br />
seine Entscheidung<br />
nicht: Zur klassischen<br />
Landwirtschaft wollte<br />
der 25-jährige Biobauer<br />
nicht zurück.<br />
Das mit den Mairübchen war so nicht geplant. Die Pflanzen, die<br />
eigentlich als zartes Gemüse geerntet werden sollten, wuchsen wie<br />
verrückt, entwickelten lange Pfahlwurzeln und waren kaum noch<br />
aus der Erde zu bekommen. Nun dürfen sie mit dem Klee, der sie<br />
langsam überwuchert, um Nährstoffe und Platz kämpfen. Auch sonst<br />
herrscht in Daniel Hausmanns Gemüsebeeten ein Tohuwabohu:<br />
schmale Reihen, ungeeignet für Maschinen. Und reichlich Grünzeug<br />
und Getier, das gemeinhin als Unkraut und Ungeziefer gilt.<br />
„Für mich ist das einfach Natur“, sagt Hausmann, 25 Jahre alt<br />
und <strong>Sachsen</strong>s erster und bisher einziger Landwirt, der nicht nur<br />
biologisch, sondern auch vegan wirtschaftet. Über massenweise<br />
Nacktschnecken im Gemüsebeet kann sich natürlich auch Hausmann<br />
nicht freuen. Doch er setzt lieber auf natürliche Feinde statt<br />
auf Chemie und auf abwechslungsreiche Fruchtfolgen, die dem<br />
Boden nicht einseitig Nährstoffe entziehen. Auch das scheinbare<br />
Durcheinander im Beet hat seinen Sinn, denn manche Pflanzenarten<br />
halten sich gegenseitig die Fressfeinde vom Stängel. Hausmanns<br />
Schlüsselerlebnis war ein Gang über ein konventionell bestelltes<br />
Gerstenfeld, das zur Landwirtschaft seiner Eltern gehörte. „Das einzige<br />
Getier dort waren zwei kränklich wirkende Nacktschnecken.<br />
In unserem Kartoffel- und Gemüsegarten dagegen gab es ein buntes<br />
Gewimmel von Spinnen, Käfern, Fliegen und anderen Insekten.<br />
Von da an wusste ich, welchen Weg ich einschlagen würde.“<br />
Als Hausmann 2012 den elterlichen 20-Hektar-Hof übernahm,<br />
weil sein Vater schwer erkrankt war und schließlich starb, stellte er<br />
sukzessive auf Bio um. Er schloss sich dem ökologischen Landbauverband<br />
Gäa an, setzte mit dem Bekenntnis zur veganen Ackerwirtschaft<br />
noch eins drauf: Er verzichtet nicht nur auf Gentechnik,<br />
Kunstdünger und Pestizide, sondern auch auf jedwede Haltung<br />
von Nutztieren und den Einsatz ihrer Hinterlassenschaften. Keine<br />
geringe Herausforderung, denn mit jeder geernteten Pflanze verschwinden<br />
auch Nährstoffe vom Acker.<br />
Im herkömmlichen Ökolandbau sorgen Mist aus dem Viehstall,<br />
aber auch Hornmehl und -späne sowie Federn und Borsten von<br />
Schlachttieren dafür, dass die Depots wieder aufgefüllt werden.<br />
Beim veganen Anbau müssen die Pflanzen selbst für Nachschub<br />
sorgen: entweder weil sie nicht geerntet, sondern in den Boden<br />
eingearbeitet werden – oder weil sie selbst Dünger produzieren.<br />
Hülsenfrüchtler etwa können mittels eines komplizierten Verfahrens<br />
Stickstoff aus der Luft im Boden binden. Auf dem Hausmann-<br />
Hof übernimmt Kleegras, frisch oder kompostiert, diese Aufgabe.<br />
Daniel Hausmann ist Idealist, aber kein Träumer. Er hat Ökolandbau<br />
und Vermarktung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung<br />
Eberswalde studiert und sich in seiner Bachelor-Arbeit<br />
mit unterschiedlichen Nutzungsverfahren von Pflanzen als Stickstofflieferanten<br />
beschäftigt. Als er auf dem Hof die Verantwortung<br />
übernahm, standen noch Kühe und Schweine in den Ställen, grasten<br />
Schafe auf der Wiese, scharrten Hühner auf dem Hof. Mit dem<br />
Wissen um die geplante Bioproduktion im Betrieb wuchsen jedoch<br />
auch Hausmanns Bedenken gegen das Töten und Essen von Tieren,<br />
gegen tierische Produkte insgesamt. Der Bauer wurde erst<br />
zum Vegetarier, dann zum Veganer. „Und mit meinem Betrieb<br />
wollte und will ich nur noch erzeugen, was ich selber esse.“<br />
Das sagt sich leicht, ist in der Praxis aber kompliziert. Ein<br />
funktionierendes Netzwerk an Gleichgesinnten in der Umgebung<br />
gibt es noch nicht, zertifiziertes Saatgut und Jungpflanzen sind<br />
schwer zu bekommen, der Aufbau eines Kundenstamms ist mühsam.<br />
Inzwischen baut Hausmann Getreide wie Dinkel, Hafer und<br />
Weizen an, auf einer Streuobstwiese wachsen Äpfel, Birnen, Pflaumen,<br />
Süß- und Sauerkirschen. Ein halber Hektar wird für Gemüse<br />
genutzt. Das ist nicht viel, macht aber viel Arbeit – von Hand.<br />
Obst und Gemüse vermarktet der junge Bauer deshalb ausschließlich<br />
direkt, teils im eigenen Hofladen, teils durch Lieferungen nach<br />
Leipzig und Chemnitz. Etwa 20 bis 25 bio-vegane Gemüsekisten<br />
in unterschiedlichen Größen bringt er jede Woche auf Online-Vorbestellung<br />
in Privathaushalte, auch ein Restaurant gehört mittlerweile<br />
zu seinen Kunden. Große Sprünge sind noch nicht drin, aber<br />
inzwischen kann der Jungbauer von seinem Hof leben.<br />
Kürzlich war Daniel Hausmann in Berlin. Dort hat er mit anderen<br />
Landwirten einen bio-veganen Anbauverband gegründet.<br />
13
Chayeon Lee, 17, ist<br />
eines von rund 200<br />
Talenten, die derzeit an<br />
Palucca studieren. Die<br />
Koreanerin kam mit<br />
15 nach Dresden – und<br />
will für immer bleiben.<br />
Ihr Traum ist eine<br />
Karriere beim<br />
Semper oper-Ballett.<br />
Bewegend<br />
<strong>Sachsen</strong> // anmutig<br />
Tanzen lernen kann man vielerorts. Aber nur in <strong>Sachsen</strong> gibt es dafür eine eigene Universität.<br />
Die Palucca Hochschule in Dresden bereitet schon junge Eleven auf eine Ballettkarriere vor.<br />
Text: Klaus Rathje<br />
Foto: michael Hudler<br />
Er könnte auch das Atelier eines Malers sein, dieser lichtdurchflutete<br />
Trainingsraum an der Palucca Hochschule für Tanz<br />
Dresden, kurz Palucca. Die sechs Studentinnen verziehen keine<br />
Miene bei ihren Übungen, während ein Piano den Takt vorgibt und<br />
der Dozent Anweisungen erteilt: das Bein höher. Die Drehung<br />
langsamer. Und jetzt bitte noch mal zusammen. Erst als die Übung<br />
vorbei ist, keuchen die jungen Damen, allesamt Teenager. Was wie<br />
ein Kinderspiel aussieht, ist Disziplin, Anstrengung, harte Arbeit.<br />
In mehrfacher Hinsicht ganz vorn bewegt sich Chayeon Lee,<br />
Bachelor-Studentin im zweiten Studienjahr. „Man kommt schon<br />
sehr ins Schwitzen“, sagt die 17-Jährige, die ihren Wohnsitz mit<br />
15 von Seoul nach Dresden verlegte. Sie wollte ihre Ausbildung unbedingt<br />
außerhalb ihrer Heimat machen. „Die Koreaner trennen<br />
beim Tanz strikt zwischen klassisch und zeitgenössisch“, erzählt<br />
die junge Frau. „Ich hätte mich also im Studium für eine Seite<br />
entscheiden müssen – und das wollte ich nicht.“<br />
An Palucca gefällt ihr die Mischung aus Tradition und Moderne.<br />
Und außerdem etwas, das auch an westlichen Tanzakademien nicht<br />
selbstverständlich ist, hier aber zum Konzept gehört: Improvisation.<br />
„In Korea gibt es das nicht als Fach. Ich kannte es gar nicht<br />
im professionellen Tanz. Und jetzt liebe ich es zu improvisieren.“<br />
Das hätte der namensgebenden Gründerin gefallen. Improvisation<br />
war ein Schwerpunkt der berühmten, 1993 im Alter von 91<br />
Jahren verstorbenen Ausdruckstänzerin Gret Palucca; nicht zuletzt<br />
deshalb gilt sie als eine der Begründerinnen des modernen Tanzes.<br />
1925 hatte sie in Dresden ihre eigene Schule eröffnet, sie unterrichtete<br />
zunächst in ihrer Wohnung. 1936 kam das Verbot durch die<br />
Nazis – freier Tanz war nicht mehr erwünscht. Nach Kriegsende<br />
konnte Palucca weitermachen, mit Gründung der DDR wurde ihre<br />
Schule verstaatlicht und zu einer veritablen Größe im Sozialismus.<br />
Heute ist Palucca die einzige eigenständige staatliche Tanz-<br />
Universität in Deutschland. Rund 200 Studenten aus der ganzen<br />
Welt lernen hier Tanz, Tanzpädagogik oder Choreografie. Auf jeden<br />
Platz im Bachelor-Studiengang Tanz kommen rund 20 Bewer<br />
ber. Selbst Zehnjährige trifft man auf dem Campus – Eltern können<br />
ihre Kinder bereits zur fünften Klasse bei Palucca einschulen,<br />
sofern sie gut Deutsch sprechen. Statt Sportunterricht steht dann<br />
Tanz auf dem Stundenplan, daneben wird nach dem normalen<br />
sächsischen Lehrplan unterrichtet. Und das Angebot gilt nicht nur<br />
für Einheimische: Der Schule ist ein Internat angeschlossen.<br />
Chayeon (gesprochen: Schajon), die als großes Talent gilt, hat<br />
nach zweieinhalb Jahren gerade ihre erste eigene Wohnung bezogen.<br />
Sie will tanzen, seit sie zwölf ist. Damals hat sie eine Aufführung<br />
des Stuttgarter Balletts mit einer koreanischen Tänzerin gesehen,<br />
erzählt sie – und war begeistert. „Ich konnte den starken<br />
Ausdruck ihres Tanzes wirklich spüren und verstehen. Das hat<br />
mich so berührt, dass ich weinen musste.“ Genau das wollte sie<br />
auch, denn sie hat damals den Unterschied gespürt: „Sich selbst zu<br />
Musik zu bewegen ist das eine. Aber andere Menschen durch Tanz<br />
zu bewegen, dazu gehört viel mehr.“<br />
Seit 2006 wird Palucca von Jason Beechey geleitet, einem renommierten<br />
Solisten und Choreografen. Der gebürtige Kanadier<br />
hat viele Projekte angestoßen und die Schule internationalisiert, etwa<br />
über den Aufbau eines Netzwerks mit Partnerschulen. „Wir suchen<br />
aktiv nach Talenten wie Chayeon, zum Beispiel mit Workshops in<br />
Spanien, Italien und auch Südkorea“, sagt er. Der Ruf der Palucca-<br />
Hochschule ist zwar ausgezeichnet und das Konzept, zu dem die<br />
Entwicklung und Implementierung neuer Lehrformen gehören, ein<br />
Alleinstellungsmerkmal. Doch allein in Deutschland buhlen rund<br />
ein Dutzend weiterer renommierter Tanzausbildungen um die<br />
Gunst der künftigen Bühnenstars. Eine bessere Werbung als einen<br />
neuen Publikumsliebling kann sich da kein Haus wünschen.<br />
Chayeon könnte bald einer sein. Die begeisterte Dresdnerin<br />
möchte nicht nach Seoul zurück, sondern nach ihrem Abschluss in<br />
zwei Jahren hier ihre Tanzkarriere fortsetzen. Ihr Traumjob mag für<br />
eine Palucca-Studentin nicht überraschen, für eine Koreanerin hingegen<br />
schon: „Ich möchte zum Semperoper-Ballett. Ich weiß, dass<br />
es schwer ist, aber ich hoffe, dass ich es schaffen werde.“<br />
14 15
<strong>Sachsen</strong> // Nachhaltig<br />
Sonnige Zeiten<br />
<strong>Sachsen</strong> - Machen<br />
Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, heißt<br />
es. Doch wie speichert man Wind, Sonne oder<br />
Wasserkraft? Sunfire hat eine Lösung gefunden.<br />
Text: Anika Kreller<br />
Foto: Oliver Helbig<br />
Christian von Olshausen schwenkt ein<br />
Fläschchen mit einer glasklaren Flüssigkeit.<br />
Unspektakulär auf den ersten Blick. Doch<br />
was wie Wasser aussieht, ist eine Sensation:<br />
ein Kraftstoff, der ohne einen Tropfen Erdöl<br />
entstanden ist.<br />
Produziert hat ihn das Dresdner Unternehmen<br />
Sunfire, das von Olshausen 2010 mit<br />
zwei Mitstreitern gegründet hat. Der Firma<br />
ist es gelungen, aus Wasser, Ökostrom<br />
und Kohlendioxid (CO 2<br />
) einen künstlichen<br />
Dieselkraftstoff herzustellen. Im April 2015<br />
kippte Bundesforschungsministerin Johanna<br />
Wanka die ersten fünf Liter aus der Testanlage<br />
in ihren Dienstwagen. Das war der<br />
medienwirksame Beweis: Es funktioniert.<br />
Sunfire hat damit Schlagzeilen gemacht.<br />
Denn das Unternehmen, für das inzwischen<br />
mehr als 90 Mitarbeiter arbeiten, kann<br />
nicht nur Erdöl ersetzen – das dafür benötigte<br />
CO 2<br />
zieht es außerdem aus der Luft,<br />
wo es ohnehin zu viel davon gibt. Bisher<br />
wird das komplizierte Verfahren allerdings<br />
kaum angewendet. „Es ist noch zu teuer“,<br />
sagt von Olshausen. Besonders betrübt<br />
klingt er aber nicht. Für ihn ist seine Vision<br />
nicht gescheitert – der hohe Preis bedeutet<br />
nur eine weitere Etappe bis zum großen Ziel:<br />
erneuerbare Energien immer und überall<br />
verfügbar zu machen.<br />
Einen Weg zu finden, Strom aus Sonnen-,<br />
Wasser- oder Windkraft in einer Form<br />
zu speichern, die jederzeit einsetzbar ist, gehört<br />
zu den großen Herausforderungen der<br />
Energiewende. In der Fachwelt werden die<br />
potenziellen Technolo gien dafür als Powerto-X<br />
bezeichnet. Doch egal ob Power-to-<br />
Liquid, Power-to-Gas oder Power-to-Heat:<br />
Noch befindet sich das gesamte Feld in der<br />
Entwicklung. Das ist nicht weiter schlimm,<br />
denn wirklich relevant werden die Technologien<br />
ohnehin erst dann, wenn erneuerbare<br />
Quellen einen höheren Anteil an der<br />
Strom erzeugung haben und es darum gehen<br />
wird, überschüssige Energie zu nutzen.<br />
Noch ist umstritten, welcher Weg am effizientesten<br />
ist – viel hängt von der weiteren<br />
technischen Entwicklung ab. Dass es um<br />
eine essenzielle Zukunftstechnologie geht,<br />
bestreitet allerdings niemand.<br />
„Mich hat es gereizt, an einer Sache konzeptionell<br />
beteiligt zu sein, an der welt weit<br />
gearbeitet wird“, sagt Christian von Olshausen.<br />
Der 36-jährige Wirtschaftsingenieur<br />
hat 2008 einen guten Job bei einem<br />
großen Unternehmen aufgegeben, um sich<br />
ihr zu widmen. Es war ein Schritt in eine<br />
ungewisse Zukunft, denn damals stand die<br />
Diskussion noch am Anfang.<br />
Ganz ins Blaue spazierten er und seine<br />
Mitgründer Carl Berninghausen und Nils<br />
Aldag allerdings nicht. Sie gaben eine Machbarkeitsstudie<br />
in Auftrag, um zu sehen, ob<br />
ihre Idee überhaupt funktionieren könnte –<br />
und ob sich ihre geplanten Produkte wirtschaftlich<br />
herstellen ließen. Danach war klar:<br />
Wir probieren es. Sie suchten Partner mit<br />
dem nötigen Know-how und übernahmen<br />
2011 die Dresdner Firma Staxera.<br />
Staxera war auf Brennstoffzellen-Stacks,<br />
also gekoppelte Brennstoffzellen, spezialisiert.<br />
Deren Weiterentwicklung bildet noch<br />
heute das Herz des Unternehmens. Die<br />
Sunfire-Zellen funktionieren jedoch, anders<br />
als konventionelle Zellen, in zwei Richtungen:<br />
Sie können nicht nur aus Wasserstoff<br />
Strom erzeugen, sondern auch umgekehrt<br />
– beides in einer einzigen Anlage.<br />
Energie für die chemische Industrie<br />
Reversible Elektrolyse heißt der Prozess. Daran<br />
forschen auch andere, doch keiner sei<br />
so weit wie Sunfire, sagt von Olshausen. Im<br />
vergangenen Herbst wurde an Boeing eine<br />
erste Anlage ausgeliefert, die aus überschüssiger<br />
Solarenergie Wasserstoff herstellt und<br />
speichert. Bei einem Stromengpass, etwa<br />
nachts oder wenn die Sonne nicht scheint,<br />
kann die Anlage aus dem Wasserstoff wieder<br />
Strom erzeugen.<br />
Von Olshausen sieht seine Technologie<br />
aber gar nicht vorrangig als Energiespeicher<br />
– er will den erzeugten Wasserstoff als Rohstoff<br />
in der chemischen Industrie nutzen.<br />
Denn in der Regel wird der aus Erdgas gewonnen,<br />
Sunfire dagegen braucht für seine<br />
Herstellung nur Wasserdampf, CO 2<br />
und<br />
Ökostrom. „Wir wollen helfen, dass erneuerbare<br />
Energien nicht nur im Stromsektor,<br />
sondern auch in der chemischen Industrie<br />
zum Einsatz kommen“, sagt er. „Dort werden<br />
mehr als drei Millionen Endprodukte<br />
hergestellt – die können wir nicht alle durch<br />
nachhaltige Alternativen auffangen. Aber<br />
wir können versuchen, fossiles Erdgas und<br />
Erdöl, das für viele dieser Produkte benötigt<br />
wird, durch nachhaltig erzeugte Rohstoffe<br />
zu ersetzen.“<br />
Allerdings wird auch mit der richtigen<br />
Technologie noch nicht automatisch Geld<br />
verdient. Trotz ihres Umsatzes im hohen<br />
einstelligen Millionenbereich arbeiten die<br />
Dresdner noch nicht kostendeckend, sagt<br />
von Olshausen. Sein erstes Ziel sei es deshalb,<br />
die Firma in den kommenden Jahren<br />
profitabel zu machen.<br />
Als Partner für die Weiterentwicklung<br />
wurden bereits gute Namen gewonnen:<br />
Bilfinger hat investiert, mit Audi steht man<br />
im Austausch, ein Brennstoffzellenheizgerät<br />
wird in Kooperation mit Vaillant angeboten.<br />
Der nächste Schritt wird sein, die Stückzahlen<br />
zu erhöhen, um die Produkte günstiger<br />
anbieten zu können. Außerdem arbeiten sie<br />
am Wirkungsgrad der Anlagen und an der<br />
Lebensdauer der Brennstoffzellen.<br />
Ob Sunfire bald im großen Stil nachhaltige<br />
Rohstoffe produzieren wird, ist allerdings<br />
nicht nur eine Frage der Technologie.<br />
Denn ein Problem können die Dresdner<br />
nicht allein lösen: Solange fossile Rohstoffe<br />
noch in großen Mengen verfügbar sind,<br />
werden sie immer billiger sein als nachhaltig<br />
hergestellte. „Am Ende ist es eine gesellschaftliche<br />
Entscheidung, einen Markt für<br />
erneuerbare Kraftstoffe und Chemikalien zu<br />
schaffen“, sagt von Olshausen.<br />
Wenn er heute einen Vortrag über Sunfire<br />
halte, gehe es deshalb nur in den ersten<br />
drei, vier Folien um das Unternehmen. Den<br />
Rest der Zeit spreche er über Rahmenbedingungen,<br />
die die Politik schaffen muss.<br />
Erdölfreier Kraftstoff wird derzeit genauso<br />
besteuert wie normaler Diesel – absurd!<br />
Und die chemische Industrie wird ohne<br />
eine Quotenregelung oder ähnliche Anreize<br />
auch nicht auf grünen Wasserstoff umsteigen.<br />
Kurz: Die Technologie ist da – jetzt<br />
braucht es den Willen, sie zu nutzen.<br />
Christian von Olshausen wollte an einer Sache beteiligt sein,<br />
an der weltweit gearbeitet wird. Jetzt mischt er mit seinem<br />
Unternehmen Sunfire mit und will Autofahren und die chemische<br />
Industrie nachhaltiger machen.<br />
16 17
<strong>Sachsen</strong> // Umtriebig<br />
Viel zu tun<br />
Der Sozialarbeiter Hussein Jinah kämpft in<br />
Dresden gegen Fremdenfeindlichkeit.<br />
Ehrenamtlich, unermüdlich – und sanft.<br />
Text: Andreas Wenderoth<br />
Foto: Michael Hudler<br />
Gegen 5.30 Uhr steht er meist auf, rührt sich einen löslichen<br />
Billigkaffee an und schaut auf n-tv, ob die Welt seit gestern noch<br />
schrecklicher geworden ist. Dann setzt er sich in die Straßenbahn<br />
und kauft am Hauptbahnhof ein Brötchen, das er erst im Büro essen<br />
wird. Hussein Jinah arbeitet jeden Tag acht Stunden als Sozialarbeiter<br />
im Sozialamt und einmal in der Woche im Personalrat der<br />
Stadtverwaltung. Aber er hat noch etwa zehn andere Jobs, für die<br />
er kein Geld bekommt. Weil sie gemacht werden müssen. Weil die<br />
Schwachen eine Stimme brauchen. Und weil er Debatten provozieren<br />
will. Darüber, ob Dresden eine weltoffene Stadt sein kann oder<br />
nur ein Symbol deutscher Fremdenfeindlichkeit.<br />
Als Treffpunkt hatte der 58-Jährige das „Maharadscha“ vorgeschlagen,<br />
das älteste indische Restaurant der Stadt. Dort sitzt er<br />
nun auf seinem Stammplatz in der blau getünchten Ecke vor einem<br />
prächtigen roten Wandteppich, schaut durch seine leicht getönte<br />
Brille, bestellt Linsen, extrascharf, und erzählt mit sanfter Stimme<br />
sein Leben. 1985 war er im Rahmen eines Austauschprogramms<br />
zwischen der DDR und Indien nach Dresden gekommen, zusammen<br />
mit einigen Landsleuten. Die meisten, mit denen er damals zu<br />
tun hat, wissen nicht, wo Indien liegt. Manche denken, er sei ein<br />
Indianer. Heute, sagt er, lebten etwa 1500 Inder in der Stadt.<br />
Jinah promoviert als Ingenieur der Elektrotechnik. Er schreibt<br />
mehr als 100 Bewerbungen und wird zu keinem einzigen Vorstellungsgespräch<br />
geladen. Mal heißt es, er sei überqualifiziert, dann ist<br />
von Umstrukturierungen die Rede. Irgendwann hat er die Nase voll<br />
und will zurück nach Indien, aber da hat er sich gerade in seine<br />
künftige Frau verliebt. Also bleibt er und sattelt um: Hussein Jinah<br />
wird Sozialarbeiter. Berufsbegleitend studiert er Sozialpädagogik<br />
an der TU. Und entdeckt für sich das Feld der Ehrenamtlichkeit.<br />
Heute ist er Vorstandsvorsitzender des Sächsischen Flüchtlingsrats,<br />
sitzt im Bundesmigrationsausschuss von Verdi und im<br />
Landesmigrationssauschuss, ist Vorsitzender des Integrationsund<br />
Ausländerbeirats der Stadt Dresden. Als Gemeindedolmetscher<br />
arbeitet er auch noch. Ist immer da, wenn ihn jemand<br />
braucht, der fremd ist. Weil er selbst Fremdheit erlebt hat. Argwöhnische<br />
Blicke schon zu DDR-Zeiten, aber nach der Wende eben<br />
noch mehr. Weil der neuen Freiheit, wie Jinah sagt, offenbar ein<br />
Missverständnis zugrunde liegt. Sie war doch nicht erkämpft worden,<br />
damit man anschließend Minderheiten drangsalieren konnte.<br />
An einem Juli-Abend wird er von einer Gruppe Skinheads auf<br />
der Straße provoziert: „Türken sind Schweine“, rufen sie, weil sie<br />
ihn für einen Türken halten. Einer knallt ihn gegen die Wand und<br />
schlägt zu. Keiner der Umstehenden hilft. Keiner greift zum Telefon.<br />
Das ist es, was Jinah bis heute traurig macht. Wenn Menschen<br />
wegschauen. Als er zur Wache geht, sagt ihm der Diensthabende:<br />
„Na ja, das könnte auch eine ausländerfeindliche Einbildung sein.“<br />
Und dass er ohne ärztliches Attest den Fall leider nicht aufnehmen<br />
könne. Wenn er aber am nächsten Tag wiederkommen wolle …<br />
Jinah fühlt sich gedemütigt. Es bleibt nicht das einzige Mal.<br />
Einmal wird er Zeuge, als Jugendliche in der Straßenbahn Ausländer<br />
als Schmarotzer bezeichnen. Er meldet sich zu Wort und sagt,<br />
dass er sehr wohl Steuern zahle und auch Sozialversicherungsbeiträge.<br />
„Halt’s Maul!“, sagt einer der Jugendlichen und zieht ein<br />
Messer. Da entschuldigt sich Jinah und sagt, er nehme alles zurück.<br />
Als am 20. Oktober 2014 rund 350 Menschen die Pegida-<br />
Montagsdemonstration ins Leben rufen, ist er der einzige Gegendemonstrant.<br />
Wenig später sind es schon Tausende. Bis heute ist<br />
er bei jeder Gegendemonstration dabei, hält Reden, zeigt sein<br />
Gesicht. Jinah sagt, er kämpfe bis zuletzt. Nicht für sich, sondern<br />
für künftige Generationen. Für ein Dresden, wie es sein könnte.<br />
Und wie es in vielen Stadtteilen auch ist. Dass die Leute das nicht<br />
verstehen: „Glück ist nicht materieller Wohlstand, sondern die<br />
innere Einstellung gegenüber Mitmenschen und Umwelt.“<br />
Er versucht, sich nicht zu ärgern, weil das Gift für den Körper<br />
sei. Stattdessen nimmt er die Dinge, wie sie sind, und meditiert<br />
gegen den Hass. In seiner Zeit als Streetworker bedachten ihn die<br />
ausländerfeindlichen Jugendlichen mit bösen Sprüchen, er blieb immer<br />
sanft und freundlich. Ließ ihre negative Kraft ins Leere gleiten.<br />
Aber wenn er mal frei hatte, haben sie sich nach ihm erkundigt, ob<br />
er krank sei – was, wenn man so will, schon ein gewisses Zeichen<br />
von Sympathie ist. „Tu etwas im Leben und halte dich fern von<br />
Aggressionen“, hat er ihnen beizubringen versucht. Und jetzt, viele<br />
Jahre später, sieht er sie manchmal mit Frau und Kind auf der Straße,<br />
und sie sagen immer noch „Alter“ zu ihm und fragen, was „abgeht“.<br />
„Viel zu tun“, antwortet er meistens.<br />
Ingenieur, Sozialarbeiter, Lokalpolitiker, Flüchtlingsberater,<br />
Dolmetscher, Demonstrant, ehrenamtlicher Helfer und seit mehr als<br />
30 Jahren Dresdner: Hussein Jinah.<br />
18 19
<strong>Sachsen</strong> // unangepasst<br />
Läuft<br />
<strong>Sachsen</strong> <strong>Sachsen</strong> - Machen // <strong>Macher</strong><br />
Ein eigener Verlag? Das<br />
geht. Mit Fleiß, Autoren<br />
wie Ahne, die schreiben<br />
und vorlesen können –<br />
und Gottes Hilfe.<br />
Text: Andreas Wenderoth<br />
Foto: Michael Hudler<br />
Ahne, 48, hat die DDR nicht geliebt.<br />
Aber sie ihn auch nicht. Zweimal hat er<br />
versucht, sein Abitur nachzumachen, beide<br />
Male ist er durchgefallen. Also wurde er<br />
Drucker und irgendwann arbeitslos. Bei<br />
einem kurzen Ausflug in die Lokalpolitik<br />
war er als Bezirksverordneter in Berlin-Lichtenberg<br />
als Sicherheitsbeauftragter<br />
unter anderem für Hausbesetzer<br />
zu ständig, was Ahne bis heute<br />
wahnsinnig komisch findet, weil er damals<br />
selbst einer war. Irgendwann jedenfalls<br />
nahm ihn sein Freund Falko Hennig mit in<br />
die Reformbühne Heim & Welt: weil er<br />
doch sowieso ab und zu mal was schreiben<br />
würde. Und es dort vortragen könne.<br />
Da ihm das gut gefiel, ist er dann jede<br />
Woche gekommen und brachte jedes Mal<br />
zwei neue Texte mit: „Die Atmosphäre war<br />
ein bisschen wie beim Punkrockkonzert:<br />
Wir gehen auf die Bühne und rotzen einfach<br />
was runter.“ Manchmal hatte er erst<br />
kurz vorher in der U-Bahn etwas auf seinen<br />
Block gekritzelt, und als er einmal gar nichts<br />
hatte, machte er einfach Liegestütze auf der<br />
Bühne. Im Grunde war ihm egal, wie die<br />
Leute reagierten. Als sie lachten, war es na<br />
türlich schön. Wie hätte er auch ahnen können,<br />
dass er in nicht allzu ferner Zukunft<br />
sein Geld mit Büchern verdienen würde?<br />
Sebastian Wolter und Leif Greinus hatten<br />
in Leipzig Buchhandel und Verlagswirtschaft<br />
studiert und wussten früh, dass sie<br />
keine Lust hatten, die programmatische<br />
Linie eines vorgesetzten Verlegers abzuarbeiten.<br />
Weil sie unabhängig bleiben wollten,<br />
beschlossen sie 2004, der uralten sächsischen<br />
Buchtradition zu folgen und selbst<br />
einen Verlag zu gründen, erzählt Greinus.<br />
Der Name – Voland & Quist – war<br />
ihnen auf der Autobahnfahrt nach Düsseldorf<br />
eingefallen: Voland, der mephistophelische<br />
Teufel aus Greinus’ Lieblingsroman,<br />
„Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow,<br />
steht dem friedensstiftenden Quinten<br />
Quist aus Harry Mulischs „Die Entdeckung<br />
des Himmels“ gegenüber. Beide<br />
zusammen sind eigentlich unschlagbar.<br />
Die Sache war nicht ohne Risiko:<br />
15 000 Euro hatten sie kurzerhand von<br />
Freunden und Verwandten geliehen. Greinus<br />
hatte einige Tage zuvor im Fern sehen<br />
eine Podiumsdiskussion gesehen, wo eine<br />
Branchenexpertin von zwei Millionen Euro<br />
sprach, die man brauchte, um einen Verlag<br />
anzuschieben. „Braucht man aber<br />
nicht“, sagt er. Dagegen unbedingt<br />
erforderlich: Leidenschaft,<br />
Fleiß und Ideen. Den meisten<br />
ihrer Bücher ist etwa eine CD<br />
beigelegt, was vor ihnen kein<br />
anderer Verlag machte. Aber sie verlegen<br />
ja auch Autoren, die gute Vorleser und<br />
Vortragende sind – und die soll man natürlich<br />
auch hören. Inzwischen prägen sie ein<br />
eigenes Genre: Spoken-Word-Lyrik, Live-<br />
Literatur. Außerdem haben sie sich auf<br />
fünfeinhalb Stellen vergrößert: 2014 lag die<br />
Bilanzsumme bei immerhin 390 000 Euro.<br />
„Natürlich müssen wir als unabhängiger<br />
Verlag kämpfen, aber wir sind jetzt alle<br />
über Mindestlohn“, sagt Leif Greinus und<br />
lacht, weil er seinen Idealismus nicht als<br />
Opfer begreift, sondern als Lebensqualität.<br />
Schließlich kann er seine Arbeitszeit mit<br />
Menschen verbringen, mit denen er auch<br />
privat gern zu tun hätte.<br />
86 Autoren sind es inzwischen, viele aus Osteuropa.<br />
Nicht wenige mit Lesebühnenoder<br />
Poetry-Slam-Tradition. Weil sie ein<br />
junges studentisches Publikum am ehesten<br />
ansprechen würden. Ahne zum Beispiel<br />
hatte damals gerade zwei Bücher mit Kurzgeschichten<br />
für Kiepenheuer & Witsch geschrieben.<br />
Die Idee zu seinem neuen Buch<br />
aber fand dort keinen Anklang. Dialoge in<br />
breitem Berlinerisch versprachen eine eher<br />
begrenzte Kundschaft. Greinus sah das anders<br />
und griff dankend zu. So kamen sie zu<br />
ihrem ersten Bestseller: 18 000-mal verkauften<br />
sich Ahnes „Zwiegespräche mit Gott“.<br />
Eigentlich, sagt Ahne, befände er sich<br />
sowieso ständig im inneren Dialog mit sich<br />
selbst. Warum den anderen also nicht Gott<br />
nennen, „der für viele ja eine große Rolle<br />
spielt“. Gott, sagt Ahne, fände es schon<br />
gut, wenn er ihn ernster nehmen, als Autorität<br />
betrachten würde. Aber für Ahne, der<br />
lieber weiß als glaubt, ist Gott eher ein<br />
Kumpel, mit dem er sich unterhalten kann.<br />
Zum Beispiel an diesem Abend in der<br />
„Jägerklause“ in Berlin-Friedrichshain. Ahne<br />
hat zur Lesebühne einen riesigen Bovist<br />
mitgebracht, den er im Wald gefunden hat<br />
und später verschenken wird. Jetzt sitzt er<br />
mit fünf anderen Autoren unter der holzgetäfelten<br />
Decke auf einem Kunstledersofa<br />
und wartet auf seinen Einsatz.<br />
Ahne in kariertem Hemd und Fred-<br />
Perry-Jacke. Mit den längsten Koteletten<br />
der Welt. Von der Wand starren Geweihe,<br />
als er erzählt, dass Gott nicht selbst kommen<br />
konnte und er deshalb beide Parts<br />
übernehmen müsse (was er schon ziemlich<br />
oft erzählt hat, aber das nimmt der Geschichte<br />
nicht ihren Witz). Und dann legt er<br />
los, mit einer Stimme, die einige seiner<br />
Freunde als „zu druckvoll“ kritisieren. Ahne<br />
sagt, er neige dazu, etwas forciert zu reden,<br />
wenn er sich nicht sicher ist, ob er das Publikum<br />
auch bekommt.<br />
Aber heute ist Heimspiel. Ahne also<br />
steht da und sagt: „Na, Gott.“ – „Na …“<br />
Und dann unterhalten sie sich. Über Gott<br />
und die Welt und … Aber das kann man ja<br />
in seinen Büchern nachlesen. Acht sind es<br />
inzwischen bei Voland & Quist.<br />
Andere hätten ihren Verlag<br />
vielleicht Greinus & Wolter<br />
genannt. Aber die würden auch<br />
alles andere anders machen als<br />
Leif Greinus (links) und<br />
Sebastian Wolter. Deshalb heißt<br />
ihr Verlag Voland & Quist<br />
und verlegt ziemlich<br />
ungewöhnliche Autoren.<br />
20 21
Hinter den Spiegeln<br />
<strong>Sachsen</strong> <strong>Sachsen</strong> // Neugierig - Machen<br />
Philosophie – ein Fach für abgehobene Denker im einsamen Studierstübchen?<br />
Nicht wenn es nach der Leipziger Professorin Kristina Musholt geht.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: Anne schönharting<br />
Was ist der Mensch, was eint und was<br />
unterscheidet ihn von anderen Arten?<br />
Kristina Musholt geht diesen Fragen als<br />
Professorin für Kognitive Anthropologie der<br />
Universität Leipzig auf den Grund.<br />
Es ist ein berühmtes Experiment der<br />
Verhaltens- und Kognitionsforschung: der<br />
Spiegeltest. Dazu wird der Proband unbemerkt<br />
markiert, etwa mit einem roten<br />
Punkt auf der Stirn. Beim Blick in einen<br />
Spiegel zeigt sich dann, ob Mensch oder<br />
Tier sich erkennt und versucht, den Punkt<br />
abzuwischen. Der Test gilt als Beweis für<br />
die Fähigkeit eines Individuums, sich seiner<br />
selbst bewusst zu sein. Kinder bestehen ihn<br />
mit etwa zwei Jahren, aber auch Schimpansen<br />
und Orang-Utans, Delfine oder Elstern<br />
merken, dass sie selbst es sind, die sich da<br />
aus dem Spiegel anblicken.<br />
Aber ist das schon Selbstbewusstsein?<br />
Braucht es neben der Existenz einer solchen<br />
Ichperspektive nicht auch das Wissen<br />
darum, dass es diese Perspektive gibt? Wie<br />
funktioniert Denken überhaupt, wie entwickelt<br />
es sich? Kristina Musholt hat sich<br />
schon als Schülerin für komplexe Fragen<br />
wie diese interessiert. Und die Suche nach<br />
klugen Antworten darauf ist heute ihr Beruf:<br />
Die 36-Jährige ist seit 2015 Professorin<br />
für Kognitive Anthropologie am Institut für<br />
Philosophie der Universität Leipzig.<br />
Wer in dem kleinen, dunklen Büro an<br />
der Leipziger Beethovenstraße eine zurückgezogene,<br />
in die eigene Gedankenwelt versponnene<br />
Wissenschaftlerin erwartet, wird<br />
allerdings enttäuscht. Kristina Musholt,<br />
schmal, ernsthaft und immer ein wenig<br />
atemlos, ist meist unterwegs, engagiert sich<br />
vielfältig – auch außerhalb ihrer Disziplin.<br />
Ihr besonderer Ansatz: Sie bezieht in ihre<br />
Forschungen die Entwicklungspsychologie<br />
ebenso ein wie die Neurowissenschaften.<br />
Aufbauend auf Erkenntnissen dieser empirischen<br />
Wissenschaften, will sie ein Stufenmodell<br />
der Entwicklung von Selbstbewusstsein<br />
und sozialer Kognition entwerfen.<br />
Das ist neu und ungewöhnlich.<br />
Zurzeit beschäftigt sich Musholt vor<br />
allem mit der Entwicklung von Erklärungsmodellen<br />
zu menschlichen Fähigkeiten der<br />
sozialen Kognition. „Das heißt, dass wir<br />
uns in andere hineinversetzen und unsere<br />
Blickwinkel vergleichen können“, erklärt<br />
sie. „Denn nur so ist unser Wissen um uns<br />
selbst möglich. Und erst wenn wir diese<br />
Zusammenhänge besser verstehen, können<br />
wir Fragen nach der Entwicklung spezifisch<br />
menschlicher Fähigkeiten oder nach den<br />
Unterschieden und Gemeinsamkeiten von<br />
menschlichen und tierischen Fähigkeiten<br />
beantworten.“<br />
Antworten auf die Kernfragen nach<br />
dem Wesen des Menschen sucht die Wissenschaftlerin<br />
schon lange – in ganz unterschiedlichen<br />
Disziplinen. Deshalb hat sie<br />
selbst nicht nur Philosophie, sondern auch<br />
Humanbiologie und Neurowissenschaften<br />
studiert und ist viel im Ausland gewesen,<br />
unter anderem am renommierten MIT in<br />
Boston und an der London School of Economics.<br />
Unser Verständnis menschlicher Fähigkeiten<br />
könne von einer interdisziplinären Perspektive<br />
nur profitieren, findet Musholt. Die<br />
Philosophie hinterfrage zwar alltägliche<br />
Phänomene, kreise dabei aber zu oft noch<br />
um sich selbst. Wenn es nach Musholt<br />
geht, wird sich das ändern: Raus mit der<br />
Disziplin aus dem Elfenbeinturm, die Wissenschaft<br />
gehört in die Gesellschaft.<br />
Daran arbeitet sie auch als Mitglied der<br />
Jungen Akademie, zu der Kristina Musholt<br />
2014 berufen wurde. Der Zusammenschluss<br />
von 50 hervorragenden jungen Wissenschaftlern<br />
unterschiedlichster Fächer ist ein<br />
Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie<br />
der Wissenschaften und der Deutschen<br />
Akademie der Naturforscher Leopoldina<br />
und wurde 2000 ins Leben gerufen. In<br />
dieser weltweit ersten Akademie des wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses beschäftigen<br />
sich die jungen Forscher in interdisziplinären<br />
Arbeitsgemeinschaften mit aktuellen<br />
Themen an der Schnittstelle von Wissenschaft<br />
und Gesellschaft.<br />
Musholts neuestes fachübergreifendes<br />
Projekt ist erst wenige Monate alt – in<br />
mehrfacher Hinsicht. Gemeinsam mit anderen<br />
Wissenschaftlern untersucht sie an<br />
einem 2016 neu gegründeten Zentrum der<br />
Uni Leipzig die frühkindliche Entwicklung.<br />
Und hat dabei eine kleine Probandin gleich<br />
im Haus. Seit 2015 ist Kristina Musholt<br />
auch Mutter einer Tochter.<br />
23
<strong>Sachsen</strong> // pfiffig<br />
Rappen in Zahlen<br />
Der Student Johann Beurich aus Radebeul<br />
bringt Schülern auf Youtube Mathe bei,<br />
indem er Formeln in Ohrwürmer verwandelt.<br />
Das gefällt auch vielen Lehrern.<br />
Text: Johannes Böhme<br />
Foto: Oliver Helbig<br />
Er hat ein gutes Gespür für Zahlen und für<br />
Musik. Also begann er, mathematische<br />
Formeln zu singen. Damit wurde Johann<br />
Beurich zum Internet-Star.<br />
Für einen Youtube-Star ist Johann Beurich<br />
Coolness erstaunlich egal: kurze Hose,<br />
graues T-Shirt, pragmatischer Kurzhaarschnitt.<br />
Beurich ist 22 Jahre alt, wohnt<br />
noch bei seinen Eltern, geht gern in die Kirche<br />
und besitzt einen IQ von 137 – den hat<br />
er beim Hochbegabtenclub Mensa messen<br />
lassen. Schon in der Pubertät trank er keinen<br />
Alkohol, heute bleibt es meistens bei<br />
einem Radler. Discos mag er nicht besonders,<br />
dafür aber Mathe. Sehr sogar. Und<br />
dann ist Johann Beurich, Mathematikstudent<br />
aus Radebeul bei Dresden, eben auch<br />
noch Rapper – und so etwas wie ein kleiner<br />
Internet-Star.<br />
Bekannt geworden ist er unter seinem<br />
Pseudonym DorFuchs (Der Fuchs, gesächselt)<br />
als Deutschlands größter (und mutmaßlich<br />
einziger) Mathe-Rapper. Er rappt über<br />
die pq-Formel, binomische Formeln, die<br />
Eulersche Zahl – alles große Hits, die meisten<br />
Hunderttausende Male angeklickt, alles<br />
mathematisch sauber, mit Herleitung der<br />
Regeln und der Formel als Refrain.<br />
Millionen haben seine Videos auf Youtube<br />
inzwischen gesehen. Mädchen fragen<br />
ihn in der Kommentarspalte, ob sie nicht<br />
mal etwas mit ihm trinken gehen können,<br />
weil sie ihn „so süß“ finden. Er saß bei Stefan<br />
Raab auf der „TV total-“Couch und wurde<br />
an seinem ersten Tag als Student an der<br />
TU Dresden von einem Kamerateam des<br />
ZDF begleitet. Das alles scheint ihn selbst<br />
immer noch zu überraschen – all diese Aufmerksamkeit<br />
wegen ein paar Mathe-Songs.<br />
„Wieso die Leute sich meine Videos angucken,<br />
kann ich eigentlich gar nicht so richtig<br />
beantworten“, sagt er. „Die meisten<br />
wollen wohl tatsächlich etwas lernen. Und<br />
einige finden es natürlich auch witzig.“<br />
In der sechsten Klasse, erzählt Beurich,<br />
sollte er in der Schule ein Selbstporträt malen<br />
– mit Dingen im Hintergrund, die er<br />
mochte. Er malte sich vor einem Hintergrund<br />
voller Zahlen. „Die Erfolgserlebnisse<br />
in Mathematik waren für mich fast wie eine<br />
Droge.“ Ihm fällt die Mathematik leicht,<br />
er hat einen einfachen, intuitiven Zugang<br />
zu ihr. In seinen Videos fällt sofort auf, dass<br />
da jemand eine unglaubliche Freude hat –<br />
am Lösen von Formeln, an der Eleganz der<br />
Herleitungen und an der Klarheit der Ergebnisse.<br />
Und weil er außerdem gern Musik<br />
macht (Beurich spielt Klavier, Gitarre,<br />
Schlagzeug, Bass und Akkordeon), verwandelte<br />
er als 16-Jähriger die pq-Formel zum<br />
Lösen quadratischer Gleichungen in einen<br />
Song. Als er fertig war, nahm er das Ganze<br />
mit der Kamera seiner Schwester auf, spielte<br />
Klavier dazu und stellte es bei Youtube<br />
ein – für seine kleine Gruppe von Abonnenten.<br />
„Das waren so wenige, viel passieren<br />
konnte da nicht.“<br />
In den folgenden Wochen stellte er verwundert<br />
fest, dass sein Video innerhalb eines<br />
Monats fast 2000-mal angeschaut worden<br />
war. Also machte er schnell noch eines.<br />
Diesmal über die binomischen Formeln –<br />
noch so eine Sache, an der kein deutscher<br />
Schüler im Mathe-Unterricht vorbeikommt.<br />
Und wieder waren da deutlich mehr Leute<br />
als sonst auf seinem Kanal. Das ist jetzt fünf<br />
Jahre her, und seitdem hat er nicht mehr<br />
aufgehört, Videos zu produzieren.<br />
Beurich hat zwischendurch das Abitur<br />
gemacht, sein Studium begonnen, seinen<br />
Bachelor absolviert, einen Master angefangen.<br />
Er hat sich eine teurere Kamera gekauft,<br />
professionelles Licht und einen Greenscreen.<br />
Aber seine Songs haben sich im Prinzip<br />
kaum verändert. Es geht um Formeln und<br />
ihre Herleitung, immer in Reimform, immer<br />
tadellos vorgerechnet.<br />
Zwar gab es bislang nie den großen<br />
Durchbruch, seine Videos sind nicht „viral<br />
gegangen“, sie haben sich also nicht explosionsartig<br />
verbreitet. Die Klickzahlen verliefen<br />
stattdessen wie eine klassische lineare<br />
Funktion mit positiver Steigung: kontinuierlich<br />
nach oben.<br />
Tatsächlich ist der Grund für Beurichs<br />
Erfolg so einfach wie offensichtlich: Seine<br />
Videos und Songs eignen sich einfach gut<br />
zum Lernen – gerade für Teenager mit kurzer<br />
Aufmerksamkeitsspanne und geringer<br />
Frustrationstoleranz. Diverse Untersuchungen<br />
zeigen, dass es Menschen sehr viel leichter<br />
fällt, Dinge zu behalten, wenn sie mit<br />
einer Melodie verbunden werden. Auch<br />
deshalb können wir die Texte unserer Lieblingslieder<br />
nach vielen Jahren noch auswendig.<br />
„Eine Lehrerin hat mal gesagt: Deine<br />
Clips sind wie ein Ohrwurmspickzettel“,<br />
erzählt Beurich.<br />
Er selbst schätzt, dass seine Songs bereits<br />
mehrere Tausend Mal von Pädagogen<br />
in deutschen Klassenzimmern vorgespielt<br />
wurden. Ab und zu schreiben ihm Lehrer,<br />
die kein Internet in der Schule haben oder<br />
bei denen Youtube auf dem Schulrechner<br />
gesperrt ist, ob sie sich das Video runterladen<br />
können. „Das erlaube ich dann natürlich.“<br />
Hinzu kommen all die positiven<br />
Kommentare auf seiner Youtube-Seite. Da<br />
steht dann zum Beispiel: „Du hast mir heute<br />
echt den Hintern gerettet“, „Da versteht<br />
man ja endlich, warum diese Regeln gelten“,<br />
oder auch einfach: „Alter, wie gut bist<br />
du eigentlich?!?!“<br />
Spott für seine Videos gibt es allerdings<br />
auch. Dann wird Johann Beurich in Kommentaren<br />
beispielsweise als „Opfer“ tituliert,<br />
man zieht über seinen Glauben her,<br />
oder irgendwer nennt die Videos einfach<br />
nur „Schrott“. Der Comedian Oliver Kalkofe<br />
hat sich mal in Kalkofes Mattscheibe<br />
über ihn lustig gemacht, ihn als „kleinen<br />
Streber“ bezeichnet und gemeint: „Das gibt<br />
Prügel auf dem Schulhof bis zum Abitur.“<br />
Beurich fand das nicht witzig, aber seine<br />
Freunde haben sich schlappgelacht über<br />
die Vorstellung, dass er auf dem Schulhof<br />
verprügelt würde. Wurde er natürlich nicht.<br />
Coolness ist eben auch auf dem Schulhof<br />
nicht alles.<br />
24 25
<strong>Sachsen</strong> // Weise<br />
Lernen, lachen, leben<br />
<strong>Sachsen</strong> sind bekanntlich eher <strong>Macher</strong> als Sprücheklopfer. Außer sie haben wirklich etwas zu<br />
sagen. Das war nie anders, wie diese Denker aus den vergangenen Jahrhunderten belegen.<br />
„Die Handlungen<br />
der<br />
Menschen<br />
leben fort<br />
in den<br />
Wirkungen.“<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz<br />
(1646–1716), geboren in Leipzig,<br />
Philosoph, Mathematiker, Diplomat<br />
und Historiker<br />
„Es ist des<br />
Lernens<br />
kein<br />
Ende.“<br />
Robert Schumann (1810–1856),<br />
geboren in Zwickau, Komponist,<br />
Musikkritiker und Dirigent<br />
„Die drei elementarsten Fragen<br />
des Menschen sind: Wer sind wir?<br />
Woher kommen wir? Wohin<br />
gehen wir? Sie zu beantworten ist<br />
Aufgabe der Wissenschaft.“<br />
Jesco von Puttkamer (1933–2012), geboren in Leipzig, Raumfahrtingenieur<br />
und Autor<br />
„Die Kunst ist die höchste<br />
Form von Hoffnung.“<br />
Gerhard Richter, geboren 1932 in Dresden, Maler, Bildhauer und Fotograf<br />
„Über sehr ernste Gegenstände sehr<br />
ernst sprechen wollen, führt zu<br />
Schweigen. Sehr ernste Gegenstände<br />
oder Weltzustände lassen sich nur<br />
mit Humor bereden.“<br />
Irmtraud Morgner (1933–1990), geboren in Chemnitz, Schriftstellerin<br />
„Wer neben den Wissenschaften<br />
noch andere<br />
Ergötzungen sucht, muss<br />
die wahren Süßigkeiten<br />
derselben noch nicht<br />
geschmeckt haben.“<br />
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), geboren in<br />
Kamenz, Dichter<br />
„Der Blick<br />
über die Welt<br />
hinaus ist der<br />
einzige, der die<br />
Welt versteht.“<br />
Richard Wagner (1813–1883), geboren in Leipzig,<br />
Komponist<br />
„,Wird’s besser? Wird’s schlimmer?‘, fragt man<br />
alljährlich. Seien wir ehrlich:<br />
Leben ist immer lebensgefährlich!“<br />
Erich Kästner (1899–1974), geboren in Dresden, Schriftsteller und Drehbuchautor<br />
„Die Idee ist noch nicht Seele<br />
und die Seele noch nicht Geist,<br />
aber der Geist ist nur innerhalb<br />
der Seele und die Seele nur innerhalb<br />
der Idee, und diese drei<br />
sind nur eins bei aller Verschiedenheit,<br />
und nur als in einem<br />
Einigen seiend, können sie verstanden<br />
werden vom Geiste.“<br />
Carl Gustav Carus (1789–1869), geboren in Leipzig, Arzt,<br />
Maler und Naturphilosoph<br />
„Die Furcht ist der<br />
schlechteste Ratgeber.“<br />
Karl Liebknecht (1871–1919), geboren in Leipzig, Politiker<br />
„Freiheit, auch in den Regungen des<br />
äußerlichen Lebens, ist der Boden, in<br />
welchem die höhere Bildung keimt.“<br />
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), geboren in<br />
Rammenau, Erzieher und Philosoph<br />
26 27
<strong>Sachsen</strong> // beständig<br />
Sauber gemacht!<br />
Früher kam aus der Oberlausitz nur „fit“, das Spülmittel der DDR. Heute werden<br />
in Zittau auch Sanso, Rei, Sunil, Gard und andere Westmarken produziert.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: Michael Hudler<br />
Es hatte geschneit an jenem Karfreitag<br />
1992. Zum Glück. Der frische Schnee verhüllte<br />
gnädig den maroden Außenbereich<br />
jenes Betriebsteils der Leuna-Werke, für den<br />
er sich interessierte. „Sonst wäre ich vielleicht<br />
gleich wieder umgekehrt“, sinniert<br />
Wolfgang Groß heute. So besichtigte er die<br />
Produktionsanlagen, in denen das Spülmittel<br />
fit hergestellt wurde – und erkannte auf<br />
den ersten Blick die hochintelligente, effiziente<br />
Fertigung. Das Spülmittel wurde in<br />
selbst produzierte Plastikflaschen abgefüllt,<br />
die aus nur einem Stück bestanden, und die<br />
Produktionsreste wurden sofort recycelt.<br />
Groß war schon viel herumgekommen,<br />
aber das sei die preiswerteste Herstellung<br />
gewesen, die er je gesehen habe. „Die Leute<br />
hatten aus dem allgegenwärtigen Mangel<br />
etwas ganz Wichtiges geschaffen.“ Damals<br />
wurde ihm augenblicklich klar, dass er gefunden<br />
hatte, wonach er schon lange suchte:<br />
sein Unternehmen.<br />
Wolfgang Groß, promovierter Chemiker,<br />
war bis dahin Manager bei Konzernen<br />
wie Procter & Gamble gewesen, hatte eine<br />
Forschungsabteilung geleitet und das Marketing<br />
verantwortet. Eine ordentliche Karriere<br />
für einen Enddreißiger, aber nicht das,<br />
was er sich wirklich wünschte. Ihn störten<br />
die Zwänge der Großorganisation, er träumte<br />
von Selbstständigkeit. Die Wiederver einigung<br />
verlieh seinem Traum Flügel. „Es<br />
war der Moment, in dem alles stimmte. Ich<br />
war alt genug für die nötige Erfahrung und<br />
jung genug für einen Neustart. Und es standen<br />
Tausende ehemalige DDR-Betriebe zum<br />
Verkauf.“ Groß sah sich viele an – fit passte.<br />
In der DDR kannte nahezu jeder Haushalt<br />
die viereckige Flasche. Mit fit wurden Teller<br />
und Töpfe gespült, Autos gewaschen und<br />
Blattläuse bekämpft. 1955 hatte der VEB<br />
Fettchemie Karl-Marx-Stadt das Spülmittel<br />
auf den Markt gebracht, 1967 entstand das<br />
Werk in Hirschfelde bei Zittau, wo bis heute<br />
produziert wird. Nach der Wende hatten<br />
sich viele Konzerne für die Markenrechte<br />
interessiert, die Fabrik mit 450 Arbeitern<br />
wollte keiner. Außer Groß. „Natürlich waren<br />
es zu viele Leute“, sagt er heute. „Aber<br />
den von der Treuhand geforderten Erhalt<br />
von 60 Arbeitsplätzen konnte ich garantieren.“<br />
Am 1.1.1993 gründete er die fit GmbH.<br />
Der Anfang war bitter. Viel Arbeit,<br />
wenig Schlaf, der neue Chef kampierte auf<br />
einer Luftmatratze im Verwaltungsge bäude,<br />
was sich nur graduell geändert hat: Heute<br />
bewohnt er eine Wohnung im Obergeschoss.<br />
Groß hat nicht nur eine Firma gekauft, er<br />
hat sie sich zu eigen gemacht. Stand auf der<br />
Leiter und rupfte die Bäumchen aus, die sich<br />
auf dem Dach der alten Hallen ausgebreitet<br />
hatten. Streifte wieder den Laborkittel über<br />
und entwickelte mit seinen Leuten Rezepturen<br />
für neue Produkte. Und erkannte, als das<br />
Geschäft im Osten langsam wieder anlief,<br />
dass er die alten Bundesländer brauchte –<br />
und Marken, die man dort kannte.<br />
Die ersten kaufte Wolfgang Groß im<br />
Jahr 2000 seinem alten Arbeitgeber ab: Rei,<br />
Rei in der Tube, Sanso. Später folgten Sunil<br />
und Kuschelweich von Unilever, inzwischen<br />
ist das Sortiment auf 100 Produkte gewachsen.<br />
Und das Werk gehört europaweit zu<br />
den modernsten der Branche.<br />
Ein Vierteljahrhundert ist es<br />
her, seit Wolfgang Groß in Zittau<br />
fand, wonach er lange suchte.<br />
Unter seiner Leitung hat das<br />
Unternehmen die Wende geschafft:<br />
Heute erwirtschaften<br />
mehr als 200 Mitarbeiter rund<br />
160 Millionen Euro Umsatz.<br />
28 29
<strong>Sachsen</strong> // verbindlich<br />
Friede, Freude, Blinzes<br />
Hätten sie keinen besseren Ort finden können als ausgerechnet Chemnitz? Eigentlich nicht,<br />
finden die Brüder Dziuballa, die Betreiber des einzigen jüdischen Restaurants in <strong>Sachsen</strong>.<br />
Sie hätten auch in ihren erlernten Berufen arbeiten können,<br />
als Maschinen- und Anlagenbauer oder als Broker. Lars Ariel (links)<br />
und Uwe Dziuballa haben sich stattdessen lieber der Kultur vermittlung<br />
verschrieben. Und weil das beim Essen in entspannter Atmosphäre<br />
besonders gut gelingt, betreiben sie das „Schalom“.<br />
Text: Brigitta palass<br />
Foto: Anne schönharting<br />
New York wäre vielleicht eine Alternative<br />
gewesen. Aber am Ende lief es doch<br />
auf Chemnitz hinaus – die Stadt, die 1965,<br />
als Uwe Dziuballa dort geboren wurde, noch<br />
nach Karl Marx benannt war. Dort lebte<br />
Dziuballas Mutter und wollte nach dem Tod<br />
ihres Mannes auch nicht mehr fort. Deshalb<br />
haben die Brüder Uwe und Lars Ariel hier<br />
ihr Lokal eröffnet. Das „Schalom“ ist das<br />
erste und bisher einzige öffentliche jüdische<br />
Restaurant in <strong>Sachsen</strong>.<br />
Großstadtflair verbreite es, schwärmte<br />
kürzlich ein Gastro-Kritiker. Viel Holz, klare<br />
Linien, warme Farben – das Schalom ist<br />
auf eine sehr moderne Art gemütlich. Und<br />
für seine gute Küche bekannt: Am Herd<br />
steht ein Profi, der nach strengen jüdischen<br />
Speisevorschriften koscher kocht. „Wir haben<br />
alte Rezepte durchstöbert“, erzählt Uwe<br />
Dziuballa. Das Ergebnis ist eine Speisekarte<br />
mit ost-, mitteleuropäischen und nahöstlichen<br />
Einflüssen. Blinzes gehören dazu –<br />
jiddische Pfannkuchen mit allerlei Füllungen<br />
–, die osteuropäische Rote-Bete-Suppe<br />
Borschtsch und natürlich auch der legendäre<br />
jüdische Küchenklassiker Gefilte Fisch.<br />
Knapp 40 Plätze hat das Restaurant, und<br />
über schlechte Auslastung können die Wirte<br />
nicht klagen. Amüsiert, aber auch etwas genervt<br />
beobachtet Dziuballa, wie verdruckst<br />
der anfängliche Umgang vieler Gäste mit jüdischer<br />
(Ess-)Kultur ist, wie bemüht sie sind,<br />
bloß nichts Falsches zu sagen oder zu tun.<br />
Darf man äußern, dass man Gefilte Fisch<br />
optisch und geschmacklich scheußlich findet?<br />
Darf man fragen, warum es neben der<br />
eleganten Bar ein Handwaschbecken gibt?<br />
Man darf, und man soll! Denn die Dziuballas<br />
sind eher zufällig Gastronomen geworden.<br />
Ihre eigentliche Mission ist, deutschjüdisches<br />
Leben wieder zu einem Teil der<br />
Alltagskultur werden zu lassen. Speis und<br />
Trank, haben sie festgestellt, eignen sich dabei<br />
ganz vorzüglich als Transportmedium.<br />
Uwe Dziuballa hat in der DDR Elektrotechnik<br />
studiert und nach der Wende außerdem<br />
bei der Deutschen Bank gelernt, Lars<br />
Ariel, der einige Jahre Jüngere, ist Maschinen-<br />
und Anlagenbauer. Für beide spielten<br />
jüdischer Glaube und Kultur in ihrer DDR-<br />
Jugend keine große Rolle.<br />
Wie selbstverständlich Judentum praktiziert<br />
und akzeptiert werden kann, erlebte<br />
Uwe Dziuballa erst, als er 1993 für ein knappes<br />
Jahr als Broker nach New York und Miami<br />
ging. „Den ungezwungenen Umgang<br />
der verschiedenen Ethnien untereinander<br />
fand ich sehr erfrischend“, sagt er. Es war<br />
der prägendste Eindruck, den er aus den<br />
USA mit zurücknahm. Inzwischen war auch<br />
die vormals winzige jüdische Gemeinde in<br />
Chemnitz durch den Zuzug von Immigranten<br />
aus der zerfallenden Sowjetunion rasant<br />
gewachsen. 1998 gründete Uwe Dziuballa<br />
mit sechs Freunden den Verein Schalom e. V.<br />
– als Kulturvermittler und als Hilfsorga <br />
ni sation für die Neuankömmlinge aus dem<br />
Osten. Das Restaurant ist das wichtigste<br />
Forum des Vereins – für Konzerte, Vorträge,<br />
Ausstellungen und Lesungen.<br />
Es wäre wohl verlogen, Dziuballa nur<br />
nach jüdischer Kochkunst und nicht nach<br />
Antisemitismus in der Stadt zu fragen. Auch<br />
Chemnitz hat eine Neonazi-Szene, und in<br />
der Tat haben die Dziuballas seit Bestehen<br />
des Schalom mehr als 40 000 Euro ausgegeben,<br />
um Schäden zu beheben – zerstochene<br />
Autoreifen, kaputte Scheiben, Schmierereien.<br />
Nach dem Umzug vor vier Jahren in<br />
eine belebtere Wohngegend sei es aber besser<br />
geworden, sagt Dziuballa. Früher seien<br />
Hooligans auf dem Weg zum Bahnhof fast<br />
automatisch am Schalom vorbeigekommen.<br />
Entmutigen lassen sich die Brüder von<br />
solchen Attacken nicht. Da trinkt Uwe Dziuballa<br />
lieber noch ein Glas „Freude“. Simcha<br />
– Freude – heißt das zertifizierte koschere<br />
Pils, das sie im nahen Hartmannsdorf brauen<br />
lassen. Es ist die einzige koschere Biermarke<br />
Deutschlands. Mit den importierten<br />
Lagerbieren aus Israel gab es öfter Lieferprobleme.<br />
Aber eine deutsche Gaststätte<br />
ohne Bier? Kaum auszudenken.<br />
30 31
<strong>Sachsen</strong> - Machen<br />
WIR ERFINDEN NICHT STÄNDIG<br />
DAS RAD NEU. ABER DAS LICHT.<br />
ERFINDERGEIST HAT IN SACHSEN TRADITION. Wir investieren<br />
in Innovationen. Zum Beispiel in die Entwicklung energieeffizienter<br />
organischer Leuchtdioden, die deutlich weniger Wärme entwickeln<br />
als klassische LEDs. Mit fast 40 Unternehmen und 20 Forschungseinrichtungen<br />
ist <strong>Sachsen</strong> heute das größte europäische Cluster der<br />
organischen Elektronik.<br />
32<br />
Mehr dazu unter www.so-geht-sächsisch.de