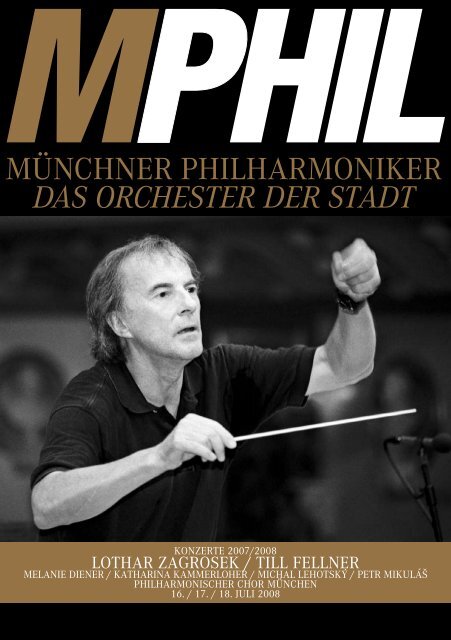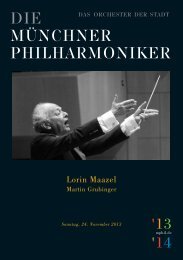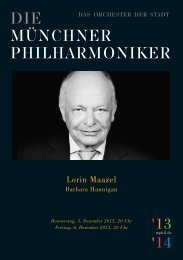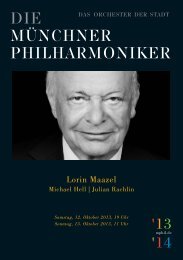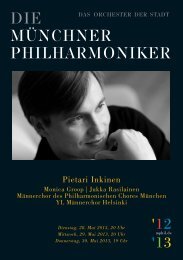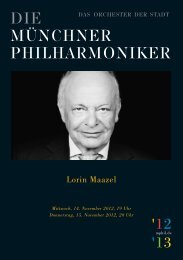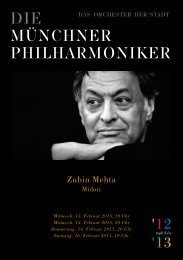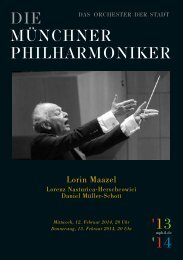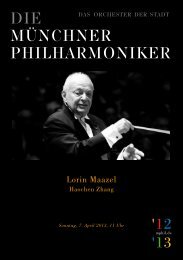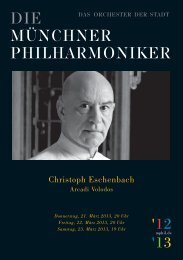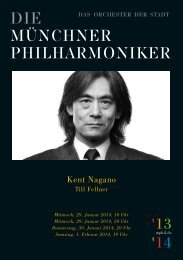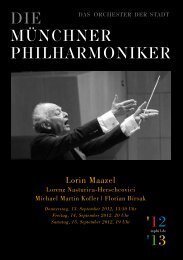Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker
Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker
Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
konzerte 2007/2008<br />
Lothar zagrosek / tiLL feLLner<br />
MeLanie Diener / katharina kaMMerLoher / MichaL Lehotsky´ / Petr MikuLásˇ<br />
PhiLharMonischer chor München<br />
16. / 17. / 18. JuLi 2008
MITTWOCH, 16. JULI 2008, 20 UHR<br />
8. ABONNEMENTKONZERT F<br />
DONNERSTAG, 17. JULI 2008, 20 UHR<br />
8. ABONNEMENTKONZERT B<br />
FREITAG, 18. JULI 2008, 20 UHR<br />
8. ABONNEMENTKONZERT C<br />
WOLFGANG AMADEUS MOZART<br />
KONZERT FÜR KLAVIER UND ORCHESTER B-DUR KV 456<br />
1. ALLEGRO VIVACE – 2. ANDANTE UN POCO SOSTENUTO – 3. ALLEGRO VIVACE<br />
LEOSˇ JANÁČEK<br />
„GLAGOLSKÁ MSˇE“ (GLAGOLITISCHE MESSE)<br />
FÜR SOLISTEN, CHOR UND ORCHESTER<br />
1. ÚVOD (EINLEITUNG) – 2. GOSPODI POMILUJ (KYRIE)<br />
3. SLAVA (GLORIA) – 4. VĚRUJU (CREDO)<br />
5. SVET (SANCTUS) – 6. AGNEČE BOZˇIJ (AGNUS DEI)<br />
7. VARHANY SOLO (ORGELSOLO) – 8. INTRADA (AUSKLANG)<br />
LOTHAR ZAGROSEK<br />
DIRIGENT<br />
TILL FELLNER<br />
KLAVIER<br />
MELANIE DIENER<br />
SOPRAN<br />
KATHARINA KAMMERLOHER<br />
MEZZOSOPRAN<br />
MICHAL LEHOTSKY´<br />
TENOR<br />
PETR MIKULÁSˇ<br />
BASS<br />
FRIEDEMANN WINKLHOFER<br />
ORGEL<br />
PHILHARMONISCHER CHOR MÜNCHEN<br />
EINSTUDIERUNG: ANDREAS HERRMANN<br />
KONZERTE 2007/2008<br />
110. SPIELZEIT SEIT DER GRÜNDUNG 1893<br />
GENERALMUSIKDIREKTOR CHRISTIAN THIELEMANN
2<br />
Jörg Handstein<br />
Der Kaiser schrie „Bravo !“<br />
Zu Mozarts Klavierkonzert B-Dur KV 456<br />
Wolfgang Amadeus Mozart<br />
(1756 – 1791)<br />
Konzert für Klavier und Orchester<br />
B-Dur KV 456<br />
1. Allegro vivace<br />
2. Andante un poco sostenuto<br />
3. Allegro vivace<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Lebensdaten des Komponisten<br />
Geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg;<br />
gestorben am 5. Dezember 1791 in Wien.<br />
Entstehung<br />
In Mozarts „Verzeichnüss aller meiner<br />
Werke“ ist das Klavierkonzert KV 456<br />
unter dem 30. September 1784 eingetragen,<br />
es entstand also – trotz widriger Umstände –<br />
außerhalb der eigentlichen Konzertsaison.<br />
Das von Leopold Mozart erwähnte „herrliche<br />
Concert, das er für die Paradis nach Paris<br />
gemacht hatte“, scheint ein Auftragswerk<br />
für die seinerzeit berühmte (blinde) Wiener<br />
Pianistin Maria Theresia von Paradis (1759 –<br />
1824) gewesen zu sein. Doch eindeutige Be -<br />
weise gibt es dafür nicht.<br />
Uraufführung<br />
Das genaue Uraufführungsdatum ist un -<br />
bekannt. Eine Aufführung durch Maria<br />
Theresia von Paradis ist nicht dokumen -<br />
tiert. Mozart selbst hat das Konzert am<br />
12. Februar 1785 in Wien in einer „Accademie“<br />
der Sängerin Luisa Mombelli-Laschi<br />
gespielt.
Fastenzeit in Wien<br />
Im schneereichen Winter des Jahres 1785<br />
machte sich Leopold Mozart auf zu seiner<br />
letzten Reise. Für einen 65-jährigen war das<br />
ein beschwerliches Unternehmen. Aber er<br />
wollte noch einmal den <strong>Münchner</strong> Fasching<br />
erleben und dann rechtzeitig zur Fastenzeit<br />
in Wien eintreffen, mit der auch die Konzertsaison<br />
begann. Das Ereignis, das er keinesfalls<br />
verpassen durfte, war das Konzert am<br />
10. Februar, mit dem sein Sohn die eigene<br />
Abonnement-Reihe eröffnete. Zunächst hatte<br />
er ja nicht geglaubt, dass Wolfgang es schaffen<br />
würde, in der umkämpften Wiener Musikszene<br />
Fuß zu fassen. Nun ließ er sich gerne<br />
mit eigenen Augen und Ohren eines Besseren<br />
belehren. Das Eröffnungskonzert, „wo<br />
eine große Versammlung von Menschen<br />
von Rang war“, fand er demgemäß in allem<br />
„unvergleichlich“ und „vortrefflich“. Das<br />
Erste aber, was Leopold Mozart zu berichten<br />
wusste, war, dass Wolfgang 480 Gulden<br />
Miete (das Mehrfache wie für eine Durchschnittswohnung)<br />
für ein „schönes quartier<br />
mit aller zum Hauß gehörigen Auszierung“<br />
zahlte. Er wohnte also überraschend repräsentativ.<br />
In den Kreisen, in denen er verkehrte,<br />
gehörte ein gehobener Lebensstil<br />
eben zum guten Ton. Das Geld spielte da<br />
keine Rolle, und auch mit der Fastenzeit<br />
nahm man es nicht so genau, wie Leopold<br />
Mozart etwas erstaunt zur Kenntnis nahm:<br />
„Es wurde nichts als Fleischspeisen aufgetragen,<br />
das übrige war Fürstlich, am Ende Austern,<br />
das herrlichste Confect und viele Boutellien<br />
Champagner.“<br />
„Bravo Mozart !“<br />
Damit auch das gesellige Musikvergnügen<br />
in der opernfreien Zeit nicht zu kurz kam,<br />
waren sogenannte „Fastenkonzerte“ groß<br />
in Mode, für gewiefte Musiker eine beliebte<br />
Methode, wie Leopold notierte, „erschröcklich<br />
viel Geld einzunehmen“. Bereits im Vor-<br />
jahr hatte Mozart, wie es scheint als Erster,<br />
ein dreiteiliges Abonnement dieser Fastenkonzerte<br />
auf Subskription angeboten – zum<br />
stolzen Preis von 6 Gulden. Vor allem Adelige,<br />
darunter so klingende Namen wie Eszterházy,<br />
Lichnowsky, Schwarzenberg und Lobkowitz,<br />
verzeichnet die Liste. Mozart spielte<br />
also für ein erlesenes, kunstsinniges Publikum.<br />
Auch in Privatpalästen trat er auf,<br />
zudem in „Accademien“ (so nannte man<br />
die in Eigenregie veranstalteten Konzerte)<br />
anderer Musiker. Ein Auftritt Mozarts, der<br />
inzwischen zum Star reüssiert war, hob<br />
den Marktwert jedes Konzerts, und man<br />
darf annehmen, dass er dies kaum umsonst<br />
tat. Allein innerhalb von sechs Wochen im<br />
Frühjahr 1784 spielte er in 22 Konzerten.<br />
Ermutigt durch diesen Erfolg, bot er in der<br />
Fastenzeit 1785 nun schon ein sechsteiliges<br />
Abo an, wirkte aber nach wie vor in „Accademien“<br />
von Kollegen mit. Am dritten Tag seines<br />
Wiener Aufenthalts, also am 12. Februar,<br />
erlebte Leopold Mozart einen solchen Star-<br />
Auftritt seines Sohnes (und hörte dabei das<br />
B-Dur-Konzert KV 456). Mit sichtlichem Stolz<br />
schrieb er darüber der Tochter: „Dein Bruder<br />
spielte ein herrliches Concert, das er für die<br />
Paradis nach Paris gemacht hatte. Ich war<br />
hinten nur 2 Logen von der recht schönen<br />
würtemb: Prinzessin neben ihr entfernt<br />
und hatte das Vergnügen, alle Abwechslungen<br />
der Instrumente so vortrefflich zu hören,<br />
daß mir vor Vergnügen die thränen in den<br />
augen standen. Als dein Bruder weg gieng,<br />
machte ihm der kayser mit dem Hut in der<br />
Hand ein Compl: hinab und schrie bravo<br />
Mozart.“<br />
Kommerz und Kunst<br />
Leider war der begeisterte Kaiser nicht<br />
unschuldig daran, dass Mozarts Glanzzeit<br />
als konzertierender Künstler bald zu Ende<br />
gehen sollte: Die rigorose Reformpolitik von<br />
Joseph II. führte zu innenpolitischen Krisen<br />
und wirtschaftlichen Problemen. Viele Ade-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
3
4<br />
lige kamen nicht mehr nach Wien oder<br />
stellten ihr kulturelles Engagement ein.<br />
Leopold Mozart hatte das Glück, das Wiener<br />
Konzertleben in seiner letzten Blüte zu erleben.<br />
Auf den bunt gemischten Programmen<br />
der „Accademien“ standen vor allem Symphonien,<br />
Arien und Konzerte. Es wirkten<br />
oft mehre re Solisten mit, und wenn Mozart<br />
auftrat, waren seine Klavierkonzerte natürlich<br />
die Hauptattraktion. Aber im Gegensatz<br />
zum heutigen Musikbetrieb wollte man nur<br />
Neues hören, niemand hätte einen Gulden<br />
für „Repertoire“ bezahlt. „Da muß man also<br />
schreiben,“ hieß die einfache Konsequenz<br />
für Mozart. So entstanden von 1784 bis 1786<br />
zwölf von insgesamt 21 Konzerten für Klavier<br />
und Orchester, sechs davon allein im<br />
Jahr 1784. Wenn man bedenkt, dass Mozart<br />
an sich genug mit seinen Auftritten zu tun<br />
hatte und am Vormittag auch noch unterrichtete,<br />
erscheint dies nahezu unglaublich.<br />
Denn er schrieb ja keineswegs „von der<br />
Stange“, sondern schuf bekanntlich individuelle<br />
Werke, die zum Kostbarsten gehören,<br />
was die Menschheit besitzt. Und das aus dem<br />
bloßen Antrieb, vor einem unersättlichen Publikum<br />
„nothwendig Neue Sachen spiellen“ zu<br />
müssen ! Noch fiel Instrumentalmusik nicht<br />
unter einen emphatischen Kulturbegriff –<br />
der Musiker produzierte in gewissem Sinn<br />
für den freien Markt der „Unterhaltungsbranche“.<br />
Aber unter einma ligen Bedingungen,<br />
und nur für kurze Zeit, ging hier ein<br />
kommerzieller Konzertbetrieb Hand in Hand<br />
mit einer gewissen „Serienproduktion“ von<br />
großer Kunst. Nachdem Mozart mit der Krise<br />
allmählich sein Publikum verloren hatte, gab<br />
es kaum noch einen Anlass, Klavierkonzerte<br />
zu schreiben.<br />
Symphonische Klangbühne<br />
Mit den ab 1784 entstandenen Werken<br />
steigerte Mozart nicht nur seine Produk -<br />
tion, sondern auch, verglichen mit seinen<br />
ersten Wiener Klavierkonzerten, den künst-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
lerischen Anspruch. Schon das erste jener<br />
Serie, das im Februar entstandene Konzert<br />
in Es-Dur KV 449, lässt aufhorchen in seinem<br />
hohen, dramatisch bewegten Tonfall.<br />
Der Geist von Mozarts Musiktheater zieht<br />
ein, die Beziehung zwischen dem Solisten<br />
und einem zu nehmend selbstständig agierendem<br />
Orches ter vertieft sich, der Satz<br />
wird komplexer. Aber noch genügt prinzipiell<br />
das Streichquartett zur Begleitung<br />
des Klaviers, die Bläserstimmen sind nur<br />
„ad libitum“. Diese eher karge Orchesterbegleitung<br />
„à quattro“ (die eine kommerzielle<br />
Verbreitung begünstigte) war beim<br />
Klavierkonzert die Regel, an die sich auch<br />
Mozart bislang gehalten hatte. Das ändert<br />
sich mit den folgenden Konzerten, die nun,<br />
wie Mozart erklärte, „ganz mit blasinstrumenten<br />
obligirt sind“. Geradezu programmatisch<br />
beginnt das B-Dur-Konzert KV 450<br />
mit obligaten Oboen und Fagotten, die nun<br />
also voll am thematischen Geschehen beteiligt<br />
sind. Auch das Konzert KV 456 führt die<br />
noch um eine Flöte erweiterten Bläser, ob -<br />
wohl es konventionell von den Streichern<br />
eröffnet wird, sofort auffällig vor: Als ge -<br />
schlossene Gruppe betreten sie, das signalhafte<br />
Thema aufgreifend, die Klangbühne,<br />
dann teilen sie sich auf und spielen sich mit<br />
dem zweiten Thema lebhaft konzertierend in<br />
den Vordergrund. In dem zweiten, durchführungsartigen<br />
Solo des Klaviers sind es ausschließlich<br />
die Blasinstrumente, die in wechselnden<br />
Kombinationen den thematischen<br />
Faden weiterspinnen.<br />
„Abwechslungen der Instrumente“<br />
Der Schritt zum symphonischen Begleitorchester<br />
ist getan. Neben der erweiterten<br />
Farbpalette bietet es die Möglichkeit, einen<br />
musikalischen Ablauf auf verschiedene Instrumentengruppen<br />
zu verteilen und damit<br />
dialogisch in Szene zu setzen. Dem Klavier<br />
als Individuum steht also keineswegs eine<br />
Art Chor, ein geschlossenes Kollektiv gegen-
Joseph Lange: Unvollendetes Portrait<br />
Wolfgang Amadeus Mozarts am<br />
Klavier (um 1783)
6<br />
über. Der Solist spielt zwar die Hauptrolle,<br />
aber er tritt in ein Geschehen ein, das in<br />
Form der plastisch gestalteten Themen bereits<br />
individuell belebt ist. Mit seinen revolutionären<br />
Bläserpartien riskierte Mozart einiges:<br />
Nicht nur, weil seine reiche Begleitung in<br />
Opern bisweilen als „überladen“ kritisiert<br />
wurde, sondern auch weil sie ungewohnt<br />
schwer waren. Bei einem mittelmäßigen<br />
Orchester und zuwenig Probenzeit drohte<br />
dann, wie ein Kritiker formulierte, „ein jämmerliches<br />
Geheule, das einem die Zähne<br />
klappern macht“. In Mozarts Wiener „Accademien“<br />
schien es jedoch zu funktionieren.<br />
Dass sein Vater an den „Abwechslungen der<br />
Instrumente“ solches Vergnügen empfand,<br />
dass ihm „die thränen in den augen standen“,<br />
zeigt, wie intensiv diese Neuerungen<br />
wirken konnten.<br />
Thematischer Reichtum<br />
Heute steht KV 456 etwas im Schatten der<br />
großen Konzerte, die Mozart noch schreiben<br />
sollte. Es ist sicher kein so spektakuläres<br />
Werk wie etwa die beiden Moll-Konzerte KV<br />
466 und 491 – eher ein fein geschmiedetes<br />
Schmuckstück, das seine Kostbarkeit nicht<br />
prunkvoll zur Schau stellt. Schon das erste<br />
Orchesterritornell verblüfft durch seinen<br />
thematischen Reichtum. Motivisch gearbeitet<br />
wie im folgenden Konzert wird hier nicht.<br />
Das marschartige Eingangsthema, ein Lieblingsmotiv<br />
Mozarts, liefert nur einen ersten<br />
Impuls, dann sprudeln, schon im Nachsatz<br />
des Themas, immer neue Motive und Einfälle.<br />
All diese Gestalten sind voll inneren<br />
Lebens und heben sich äußerst plastisch<br />
voneinander ab. Aber trotz teilweise dramatischer<br />
Kontraste sprießt alles wie organisch<br />
auseinander hervor, subtile Bezüge halten<br />
das thematische Netz zusammen. Auch das<br />
Klavier, das weitere neue Ideen beiträgt, ist<br />
in diesen Prozess eingebunden, ohne auf<br />
brillante Spielfiguren verzichten zu müssen.<br />
Im Andante, dem ersten Moll-Mittelsatz seit<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
dem genialen Frühwerk KV 271, beleuchten<br />
die fünf Doppelvariationen das Thema in un -<br />
glaublich vielfältigen Farben und Schattierungen.<br />
Die Melodie selbst erscheint zunächst<br />
ganz schlicht, in ihrer Traurigkeit wie erstarrt,<br />
dann belebt sich ihr schmerzlicher Ausdruck,<br />
und der harmonisch vielschichtige Satz leuchtet<br />
in die Tiefe einer dunklen Empfindungswelt.<br />
Umso aufgeräumter klingt das Finale,<br />
in seiner Dreiklangs melodik eine typische<br />
„Jagdmusik“. Nach etwa dreieinhalb Minuten<br />
schlagen auch hier emotionale Wo gen hoch,<br />
die Tonart schwankt und kippt ins fremde<br />
h-Moll. Für dramatische Unruhe sorgt auch<br />
die fast schon polyrhythmische Überlagerung<br />
des 6/8-Taktes durch einen 2/4- Takt. Doch<br />
dann setzt sich das muntere Spiel ungetrübt<br />
fort bis zum Schluss, der nach der virtuosen<br />
Solokadenz noch einmal mit „Abwechslungen<br />
der Instrumente“ vergnügt.
Nicole Restle<br />
„Weder Greis, noch gläubig“<br />
Zu Leosˇ Janáč eks „Glagolitischer Messe“<br />
Leosˇ Janáč ek<br />
(1854 – 1928)<br />
„Glagolská msˇe“ (Glagolitische Messe)<br />
für Solisten, Chor und Orchester<br />
1. Úvod (Einleitung)<br />
2. Gospodi pomiluj (Kyrie)<br />
3. Slava (Gloria)<br />
4. Vě ruju (Credo)<br />
5. Svet (Sanctus)<br />
6. Agneč e Bozˇij (Agnus Dei)<br />
7. Varhany solo (Orgelsolo)<br />
8. Intrada (Ausklang)<br />
Posthume, nach Janáč eks Tod revidierte<br />
Fassung von 1929<br />
Lebensdaten des Komponisten<br />
Geboren am 3. Juli 1854 in Hukvaldy (Hochwald,<br />
Bezirk Místek / Mähren); gestorben<br />
am 12. August 1928 in Moravská Ostrava<br />
(Mährisch-Ostrau / Mähren).<br />
Entstehung<br />
Entstanden vom 2. August bis 15. Oktober<br />
1926 im Kurort Luhačovice / Mähren unter<br />
Benutzung einer aus dem 9. Jahrhundert<br />
stammenden altkirchenslawischen Fassung<br />
des Ordinarium Missae, die Josef Vajs 1920<br />
aus der alten „glagolitischen“ Schrift in lateinische<br />
Schriftzeichen übertragen hatte; das<br />
Orgelsolo wurde Anfang Dezember 1926<br />
nachkomponiert, letzte Änderungen nahm<br />
Janáč ek im November 1927 vor. Der Komponist<br />
dachte nicht an eine liturgische Verwendung<br />
in Kirchen, sondern vielmehr an Aufführungen<br />
im Freien: „Ich wollte hier den<br />
Glauben an die Gewissheit der Nation nicht<br />
auf religiöser, sondern auf der sittlichen,<br />
felsenfesten Grundlage festhalten, die<br />
Gott zum Zeugen anruft.“<br />
Widmung<br />
„Seiner Eminenz Dr. Leopold Prečan gewidmet,<br />
Erzbischof von Olmütz“: Er hatte am<br />
11. Juli 1926 an der Feier zur Enthüllung<br />
der Gedenktafel an Janáč eks Geburtshaus<br />
in Hukvaldy teilgenommen und Janáč ek<br />
zur „Glagolitischen Messe“ angeregt.<br />
Uraufführung<br />
Am 5. Dezember 1927 in Brno (Brünn) im<br />
Konzertsaal „Stadion“ (Orchester des Brünner<br />
Nationaltheaters und Chor des Brünner<br />
Konzertvereins „Beseda“ unter Leitung von<br />
Jaroslav Kvapil; Solisten: Alexandra Čvanová,<br />
Sopran, Marie Hlousˇková, Alt, Stanislav Tauber,<br />
Tenor, Ladislav Němeček, Bass, und<br />
Bohumil Holub, Orgel).<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
7
8<br />
Tschechischer Nationalkomponist<br />
Als Leosˇ Janáč ek 1926 im Alter von 72 Jahren<br />
seine „Glagolitische Messe“ schrieb, stand<br />
er auf der Höhe seines Ruhms. Er war der<br />
tschechische Nationalkomponist schlechthin.<br />
Lange hatte er um Erfolg und Ruhm gerungen.<br />
Erst als 62-jähriger, nach dem überwältigenden<br />
Triumph seiner Oper „Jenu fa“ 1916,<br />
wurde er von einem breiten Publikum wahrgenommen.<br />
Radikaler und kompromissloser<br />
als die beiden anderen großen tschechischen<br />
Komponisten, Antonín Dvorˇák und Bedrˇich<br />
Smetana, hatte er sich von der romantischen<br />
Tonsprache des 19. Jahrhunderts abgewandt<br />
und eine ganz eigene persönliche Ausdrucksweise<br />
gefunden. Inspiriert von der mährischen<br />
Volksmusik, die er eingehend studierte, und<br />
der tschechischen Sprache entwickelte er<br />
seine „Theorie der Sprachmelodie“, die zur<br />
Grundlage seiner Kompositionen wurde. Er<br />
war der Meinung, dass sich alle melodischen<br />
und harmonischen Strukturen aus dem Rhythmus<br />
und dem Tonfall der Sprache ergeben.<br />
Blick in die Seele<br />
„Für mich hat die Musik so, wie sie aus den<br />
Instrumenten klingt, aus der Literatur, und<br />
wenn es selbst Beethoven oder wer immer<br />
ist – wenig Wahrheit. Töne, der Tonfall der<br />
menschlichen Sprache, jedes Lebewesens<br />
überhaupt, hatten für mich die tiefste Wahrheit.<br />
Und sehen Sie, dies war mein Lebensbedürfnis.<br />
Sprachmelodien sammle ich vom<br />
Jahr 1879 an – wissen Sie, das sind meine<br />
Fensterchen in die Seele – und was ich betonen<br />
möchte: gerade für die dramatische Musik<br />
hat dies große Bedeutung“, resümierte Leosˇ<br />
Janáč ek 1928, nur wenige Monate vor seinem<br />
Tod, in einem Interview. Sein Gespür<br />
für den Tonfall und die ihm zugrundeliegende<br />
Stimmung eines Menschen machte ihn zu<br />
einem idealen Opernkomponisten, der mit<br />
seinen Bühnenwerken „Katja Kabanova“,<br />
„Das schlaue Füchslein“, „Die Sache Mak-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
ropoulos“ und „Aus einem Totenhaus“<br />
den Nerv der tschechischen Seele traf.<br />
Aber auch auf dem Gebiet der Instrumentalmusik<br />
gelang es ihm, Unkonventionelles<br />
zu schaffen. Nur in einem Bereich war er<br />
noch nicht hervor getreten: in der geistlichen<br />
Musik. Dabei hatte er, der Sohn eines Organisten,<br />
in seinen Anfangsjahren eine Reihe<br />
von Kirchenmusikwerken komponiert. Neben<br />
mehreren Kantaten in lateinischer und tschechischer<br />
Sprache entstanden auch zwei Messen,<br />
die im Jahr 1901 geschriebene Messe<br />
in B-Dur für gemischten Chor und Orgel<br />
nach der „Messe pour orgue“ von Franz<br />
Liszt, die in ihrer Melodik und Harmonik<br />
noch sehr romantisch wirkt, und die unvollendet<br />
gebliebene Messe in Es-Dur für Soli,<br />
Chor und Or gel aus dem Jahr 1908, die stilistisch<br />
bereits sehr viel moderner erscheint.<br />
Beiden Werken gemeinsam ist die Schlichtheit<br />
des musikalischen Satzes sowie die<br />
kurze und knappe Behandlung des Textes.<br />
Auf den Spuren Cyrills<br />
und Methods<br />
Die Anregung, eine große, bedeutende Messe<br />
zu komponieren, erhielt Janáč ek von Leopold<br />
Prečan, dem Erzbischof von Olmütz und späteren<br />
Widmungsträger der „Glagolitischen<br />
Messe“. Im Sommer 1921 hatten sich die beiden<br />
in Hukvaldy, dem Geburtsort des Komponisten,<br />
über den schlechten Zustand der<br />
damaligen Kirchenmusik unterhalten, und<br />
der Erzbischof meinte daraufhin, Janáč ek<br />
solle doch diesbezüglich irgendetwas Großartiges<br />
schreiben. Allerdings war der Komponist,<br />
dessen nationalistische Einstellung<br />
an Fanatismus grenzte, nicht bereit, einen<br />
lateinischen Text zu vertonen. Ein Schüler<br />
machte ihn auf einen altslawischen Mess -<br />
text aufmerksam, der 1920 in der Zeitschrift<br />
„Cyril“ veröffentlicht worden war. Dieser<br />
Text geht zurück auf die beiden Glaubensapostel<br />
Cyrill und Method, zwei aus Mazedonien<br />
stammende Missionare, die im Auftrag
Leosˇ Janáč ek (um 1924)
10<br />
des byzantinischen Kaisers im 9. Jahrhundert<br />
nach Mähren kamen, um sich in dieser<br />
Region der Pflege des Kirchengesetzes und<br />
der slawischen Sprache zu widmen. Um das<br />
Slawische notieren zu können, entwickelten<br />
sie eine spezielle, vom griechischen Alphabet<br />
abgeleitete Schrift, die sogenannte „Glagoliza“.<br />
Der Begriff „glagolitisch“ bezieht sich<br />
also strenggenommen auf diese altslawische<br />
Schrift, nicht auf den altslawischen Text.<br />
Dass Janáč ek seinem Werk den Titel „Glagolská<br />
msˇe“ gegeben hat, wird in der Literatur<br />
meist als Nachlässigkeit des Komponisten<br />
gedeutet. Jüngere Forschungen ergaben<br />
jedoch, dass man zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
unter „glagolitisch“ auch den Kulturraum<br />
verstand, in dem der slawische Messtext<br />
verbreitet war. Immerhin gab es zu<br />
jener Zeit eine Reihe von slawischen Komponisten,<br />
die ihre Messvertonungen mit<br />
dem Zusatz „glagolitisch“ versehen haben.<br />
Patriotisches Werk<br />
Der altslawische Text entsprach so ganz<br />
Janáč eks nationaler Gesinnung. Wie er in<br />
einem Interview darlegte, ist seine Messe<br />
ein patriotisches, kein religiöses Bekenntnis.<br />
Eine Hommage an die noch junge tschechische<br />
Republik, die 1918 gegründet worden<br />
war: „Ich wollte hier den Glauben an die<br />
Gewissheit der Nation nicht auf religiöser,<br />
sondern auf der sittlichen, felsenfesten<br />
Grundlage festhalten, die Gott zum Zeugen<br />
anruft.“ Keine andere Sichtweise lässt er<br />
gelten. Die Bemerkung eines Brünner Kritikers,<br />
das Werk zeuge von dem festen Glauben<br />
eines alten Mannes, ärgerte Janáč ek so<br />
sehr, dass er dem Autor kurz und bündig<br />
erwiderte: „Weder Greis, noch gläubig“.<br />
Bruch mit der Tradition<br />
Bewusst verzichtet Janáč ek auf alles, was<br />
bislang typisch für geistliche Kompositionen<br />
war: fugierte und imitatorische Stimmfüh-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
rung, tonmalerische Wortausdeutung und<br />
ausschweifende Melismatik. Auch wenn er<br />
sich von musikalischen Traditionen abwendet,<br />
um etwas ganz Eigenes, Ursprüngliches<br />
zu schaffen, so trägt er doch den liturgischen<br />
Gegebenheiten Rechnung. So will es die slawische<br />
Überlieferung, dass die Messe mit<br />
einer fanfarenartigen Intrada beginnt und<br />
schließt, und auch das Orgelsolo nach dem<br />
„Agnus Dei“ entspringt der gottesdienstlichen<br />
Praxis. Neben dem Chor und den Vokalsolisten,<br />
deren Stimmen ganz syllabisch aus dem<br />
Sprachduktus entwickelt sind, kommt dem<br />
Orchester als Träger der musikalischen<br />
Stimmung eine große Bedeutung zu.<br />
Motiv als Keimzelle<br />
Charakteristisch für Janáč eks ausgereiften<br />
Stil ist, dass er mit kleinteiligen Motiven<br />
arbeitet. Diese Motive verwendet er auf mehreren<br />
Ebenen. Sie bestimmen die melodische<br />
Gestalt der Themen, gleichzeitig werden sie<br />
rhythmisch variiert und verändert als ostinate<br />
Begleitfiguren eingesetzt. Kurz, prägnant<br />
und straff organisiert – dadurch erhält<br />
seine Musik eine ungeheure dramatische<br />
Schlagkraft. Die einzelnen Motive sind in<br />
ihren Intervallstrukturen miteinander verwandt,<br />
und doch bildet jedes für sich ein<br />
eigenständiges Element. Bereits in der Einleitung<br />
setzt Janáč ek diese Technik wirkungsvoll<br />
ein. Aus den markanten Fanfarenrufen<br />
der Hörner und Trompeten, die diesen Satz<br />
eröffnen, leitet er die lebhaften, ostinaten<br />
Achtelfiguren der Streicher ab, die den klanglichen<br />
Teppich der Introduktion bilden. Das<br />
Fanfarenthema ist übrigens eine Reminiszenz<br />
an Smetanas Oper „Libusˇe“ und an<br />
seine eigene „Sinfonietta“, die Janáč ek kurz<br />
vor der Messe komponiert hat. Jener eben<br />
beschriebene Kompositionsstil zieht sich<br />
durch alle Sätze, angefangen vom „Kyrie“<br />
und „Gloria“ über das „Credo“, „Sanctus“<br />
und „Agnus Dei“ bis hin zu dem abschließenden<br />
Orgelsolo und der Intrada.
Leosˇ Janáč ek neben Jan Masaryk<br />
(rechts außen) in London<br />
(um 1926)
12<br />
Musikalischer Dom<br />
Trotz der strukturellen Gemeinsamkeiten<br />
legt Janáč ek in jeden einzelnen Satz einen<br />
individuellen klanglichen Ausdruck. Dem<br />
düsteren mit einem Solo der Bassklarinette<br />
beginnenden „Kyrie“ („Gospodi pomiluj“)<br />
folgt ein freudiges „Gloria“ („Slava“), in dem<br />
hohe Streicherklänge den Himmel zum Strahlen<br />
bringen; gleichzeitig unterstreichen Pauken-<br />
und Bläserfanfaren die Majestät Gottes.<br />
Demutsvoll zurückgenommen erklingt das<br />
„Credo“ („Věruju“) des Glaubensbekenntnisses.<br />
Bedrohlich wirkende Trillerketten, aber<br />
auch folkloristisch anmutende Melodiewendungen<br />
prägen die sen Satz. Das ausgedehnte<br />
Orchesterzwischenspiel und das Orgelsolo<br />
vor den Worten „Gekreuzigt, gemartert und<br />
begraben“ („Raspet zˇe zany“) wird in der<br />
Literatur dahingehend interpretiert, dass<br />
Janáč ek hier einzelne Stationen aus dem<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Der Maßstab<br />
für höchste Qualität.<br />
Das Beste für den<br />
gehobenen Anspruch.<br />
Leben Christi illus triert. Himmlisch entrückt,<br />
in Harfen-, Streicher- und Celestaklänge<br />
getaucht, gibt sich das „Sanctus“<br />
(„Svet“). Der flehentlichen, immer expressiver<br />
werdenden Bitte „Lamm Gottes, er -<br />
barme dich unser“ („Agneče Bozˇij“) schließt<br />
sich ein Orgelsolo an, dessen wildes, an eine<br />
Passa caglia erinnerndes Ostinatomotiv auf<br />
das Orgelsolo im „Credo“ verweist, ehe die<br />
Messe in der imposanten „Intrada“ ihren<br />
Abschluss findet. „In nebelhaften Fernen<br />
wuchs mir ein Dom in die riesenhafte Größe<br />
der Berge und des darüber gewölbten Himmels;<br />
mit ihren Glöckchen läutete in ihm<br />
eine Schafherde. Im Tenorsolo höre ich<br />
irgendeinen Hohepriester, im Sopran ein<br />
Mädchen – einen Engel, im Chor unser<br />
Volk. Kerzen, hohe Tannen im Walde, von<br />
Sternen angezündet; und in der Zeremonie,<br />
dort irgendwo, die Vision des Fürsten – des<br />
hl. Wenzel. Und die Sprache der Glaubens-<br />
Willkommen Essex<br />
steinway designed pianos jetzt in allen klassen.<br />
Lernen Sie die<br />
„Family of Steinway-Designed Pianos“ kennen.<br />
Gerne informieren wir Sie über die einzelnen Marken.<br />
Schicken Sie einfach diesen Coupon an:<br />
Landsberger Str. 336 · 80687 München-Laim<br />
Tel. 089 / 546 797-0 · www.steinway-muenchen.de<br />
MPhil07/08<br />
NEU<br />
Das leistungsstarke<br />
Instrument für alle Einsteiger.<br />
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial<br />
folgender Marken zu:<br />
Steinway & Sons Boston<br />
Essex Sonstiges: _________________<br />
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
#
oten Cyrill und Method.“ Diese Gedanken<br />
gingen Janáč ek durch den Kopf, als er in<br />
dem kleinen mährischen Kurort Luhačovice<br />
saß und seine Messe an weniger als drei<br />
Abenden ausarbeitete. In jener ersten, fast<br />
im Rausch hingeworfenen Version der Messe<br />
verwendete der Komponist auch einige Passagen<br />
aus seiner unvollendeten Es-Dur-Messe.<br />
Allerdings war Janáč ek mit dieser Urfassung<br />
nicht zufrieden. Bis zu seinem Tode 1928<br />
änderte und revidierte er immer wieder. So<br />
eliminierte er auch all’ jene Stellen, die an<br />
seine früheren Messkompositionen erinnerten.<br />
Welterfolg<br />
Janáč eks „Glagolitische Messe“ erregte<br />
sofort Aufsehen. Schon die Uraufführung<br />
am 5. Dezember 1927 in Brünn war ein<br />
Erfolg – obwohl die musikalischen Möglichkeiten<br />
des dortigen Chors und Orchesters<br />
nicht optimal waren. Das hatte vor allem<br />
zwei Gründe: Zum einen war die Besetzung<br />
nicht ausreichend, zum anderen erschienen<br />
den Ausführenden die technischen Schwierigkeiten<br />
zu hoch. Janáč ek suchte zu helfen,<br />
so gut er konnte. Während der Proben hatte<br />
er bereits die schwierigsten Stellen geändert<br />
und versucht, es den Mitwirkenden leichter<br />
zu machen. Trotz der Erleichterung stellte<br />
die Messe hohe Anforderungen an Sänger<br />
und Instrumentalisten. Im April 1928 wurde<br />
das Stück von der Tschechischen Philharmonie<br />
im Prager Smetana-Saal gegeben. Der<br />
Komponist sprach von einer „Musteraufführung“,<br />
die für ihn in jeder Hinsicht vollkommen<br />
war. Bereits ein knappes Jahr später<br />
fand die deutsche Erstaufführung in Berlin<br />
statt – unter Alexander Zemlinsky. Es folgten<br />
Konzerte in Genf, London und New York. Die<br />
Welt war neugierig auf Janáč eks Messe. Man<br />
erkannte sogleich, dass Janáč ek etwas noch<br />
nie zuvor da Gewesenes geschaffen hat –<br />
unorthodox, opernhaft, pantheistisch. „Das<br />
ist Gott auf den Feldern gesucht“, hieß es in<br />
einer Rezension der „Gazette de Lausanne“.<br />
Und der Wiener „Anbruch“ schrieb: „Eine<br />
fröhliche Messe sollte es werden, erzählt<br />
Janáč ek. Immer schon hat es ihn gewurmt,<br />
dass Messen so traurig sind. Und hier finden<br />
wir denn eine Vertonung, die uns einen Himmel<br />
voll Freude und Glanz vorzaubert, einen<br />
Himmel, in dem alles zum Preise des Herrn<br />
singt und tanzt, und in dem selbst Petrus<br />
und die bärtigen Propheten die feierlichen<br />
Gewänder raffen und über Wolken und schelmische<br />
Wölkchen zu tanzen beginnen: und<br />
dazu auf echt böhmisch.“<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
13
14<br />
GLAGOLSKÁ MSˇE<br />
I. Úvod (Orchestr)<br />
II. Gospodi pomiluj<br />
Gospodi pomiluj,<br />
Chrste pomiluj,<br />
Gospodi pomiluj !<br />
III. Slava<br />
Slava vo vysˇńich Bogu i na zeml’i mir<br />
člověkom blagovol’enija.<br />
Chvalim Te, blagoslovl’ajem Te, klańajem Ti<br />
se, slavoslovim Te, Bozˇe. Chvali vozdajem<br />
Tebě velikyje radi slavy tvojeje.<br />
Bozˇe, otče vsemogyj, Gospodi, Synu<br />
jedinorodnyj, Isuse Chrste !<br />
Gospodi Bozˇe, Agneče Bozˇij, Synu Oteč !<br />
Vzeml’ej grěchy mira, pomiluj nas,<br />
primi mol’enija nasˇa !<br />
Sědej o desnuju Otca,<br />
pomiluj nas !<br />
Jako Ty jedin svět, Ty jedin Gospod,<br />
Ty jedin vysˇńij, Isuse Chrste.<br />
Vo slavě Boga, so Svetym Duchom<br />
vo slavě Otca.<br />
Amin.<br />
IV. Věruju<br />
Věruju v jedinogo Boga, Otca vsemogusˇtago,<br />
tvorca nebu i zeml’i, vidimym vsˇem i<br />
nevidimym.<br />
Amin, Amin.<br />
Věruju, věruju !<br />
I v jedinogo Gospoda Isusa Chrsta,<br />
Syna Bozˇja jedinorodnago, i ot Otca<br />
rozˇdenago prězˇde vsěch věk.<br />
Boga ot Boga, Svět ot Světa, Boga istinna<br />
ot Boga istinnago, rozˇdena, ne stvor’ena,<br />
jedinosusˇtna Otcu, jimzˇe vsja bysˇe.<br />
Izˇe nas radi člověk i radi nasˇego spasenja<br />
snide s nebes i voplti se ot Ducha Sveta iz<br />
Marije děvy.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
GLAGOLITISCHE MESSE<br />
I. Einleitung (Orchester)<br />
II. Kyrie<br />
Herr, erbarme dich,<br />
Christe, erbarme dich,<br />
Herr, erbarme dich !<br />
III. Gloria<br />
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf<br />
Erden den Menschen, die guten Willens sind.<br />
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten<br />
dich an, wir verherrlichen dich, Gott. Wir<br />
danken dir ob deiner großen Herrlichkeit.<br />
Gott, allmächtiger Vater, Herr, eingeborener<br />
Sohn, Jesus Christus !<br />
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters !<br />
Der du die Sünden der Welt trägst, erbarme<br />
dich unser, erhöre unser Flehen !<br />
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,<br />
erbarme dich unser !<br />
Denn du allein bist heilig, du allein bist der<br />
Herr, du allein bist der Höchste, Jesus Christus.<br />
In der Herrlichkeit Gottes, mit dem Heiligen<br />
Geist in der Herrlichkeit des Vaters.<br />
Amen.<br />
IV. Credo<br />
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen<br />
Vater, Schöpfer des Himmels und der<br />
Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren<br />
Dinge.<br />
Amen, Amen.<br />
Ich glaube, ich glaube !<br />
Und an den einen Herrn Jesus Christus,<br />
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater<br />
geboren vor aller Zeit.<br />
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott<br />
vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,<br />
eines Wesens mit dem Vater, durch den alles<br />
erschaffen ist.<br />
Der für uns Menschen und um unseres<br />
Heiles willen herabstieg vom Himmel und<br />
Fleisch geworden ist durch den Heiligen<br />
Geist und die Jungfrau Maria.
Věruju, věruju !<br />
Raspet zˇe zany, mučen i pogreben byst.<br />
I voskrse v tretij den po Pisaniju.<br />
I vzide na nebo, sědit o desnuja Otca.<br />
I paky imat priti sudit zˇyvym mrtvym so<br />
slavoju, jegozˇe česarstviju nebudet konca.<br />
Věruju, věruju !<br />
I v Ducha Svetago, Gospoda i<br />
zˇivototvoresˇtago, ot Otca i Syna ischodesˇtago.<br />
S Otcem zˇe i Synom kupno poklańajema<br />
i soslavima, izˇe glagolal jest Proroky.<br />
I jedinu svetuju katoličesku i apostolsku<br />
crkov.<br />
I spovědaju jedino krsˇčenije votpusˇčenije<br />
grěchov.<br />
I čaju voskrsenija mrtvych<br />
i zˇivota budusˇctago věka.<br />
Amin.<br />
V. Svet<br />
Svet, svet, svet, Gospod, Bog Sabaoth !<br />
Plna sut nebesa zem slavy tvojeje !<br />
Blagoslovl’en gredyj vo ime Gospodńe.<br />
Osanna vo vysˇńich !<br />
VI. Agneče Bozˇij<br />
Agneče Bozˇij, pomiluj nas !<br />
Agneče Bozˇij, vzeml’ej grěchy mira,<br />
pomiluj nas !<br />
VII. Varhany solo<br />
VIII. Intrada (Orchestr)<br />
Ich glaube, ich glaube !<br />
Er wurde für uns gekreuzigt, gemartert und<br />
begraben.<br />
Und er ist auferstanden am dritten Tag,<br />
gemäß der Schrift.<br />
Und er ist aufgefahren zum Himmel, sitzend<br />
zur Rechten des Vaters.<br />
Und von dannen wird er wiederkommen in<br />
Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und<br />
die Toten, und seines Reiches wird kein Ende<br />
sein.<br />
Ich glaube, ich glaube !<br />
Und an den Heiligen Geist, den Herrn und<br />
Lebensspender, der vom Vater und vom Sohn<br />
ausgeht.<br />
Er wird mit dem Vater und dem Sohn<br />
zugleich angebetet und verherrlicht, er hat<br />
gesprochen durch die Propheten.<br />
Und an eine heilige katholische und<br />
apostolische Kirche.<br />
Und ich bekenne die eine Taufe zur<br />
Vergebung der Sünden.<br />
Und ich erwarte die Auferstehung der Toten<br />
und das Leben der zukünftigen Welt.<br />
Amen.<br />
V. Sanctus<br />
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott Sabaoth !<br />
Himmel und Erde sind voll deines Ruhms !<br />
Gesegnet sei, der da kommt<br />
im Namen des Herrn.<br />
Hosanna in der Höhe !<br />
VI. Agnus Dei<br />
Lamm Gottes, erbarme dich unser !<br />
Lamm Gottes, das du die Sünde der Welt<br />
trägst, erbarme dich unser !<br />
VII. Orgelsolo<br />
VIII. Intrada (Orchester)<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
15
16<br />
Leosˇ Janáč ek<br />
„Glagolitische Messe“<br />
Warum hast du sie komponiert ?<br />
Es strömt, strömt der Luhačovicer Regen. Aus dem Fenster schaust du in den finsteren Berg<br />
Komonec.<br />
Wolken wälzen sich, der Sturm zerreißt und zerstreut sie.<br />
Genau so, wie vor einem Monat, dort vor der Hukvalder Schule. Wir standen im Regen.<br />
Und neben mir ein hoher kirchlicher Würden träger. 1<br />
Dichter und dichter bewölkt es sich. Du schaust schon in die finstere Nacht; Blitze zerschneiden<br />
sie.<br />
Du schaltest das blinkende elektrische Licht an der hohen Decke ein.<br />
Nichts anderes als das stille Motiv eines verzweifelten Sinnes in den Worten „Herr, erbarme<br />
dich“ skizzierst du.<br />
Nichts anderes als den Freudenruf „Ehre sei Gott“.<br />
Nichts anderes als den herzzerreißenden Schmerz im Motiv „Für uns gekreuzigt, gemartert<br />
und begraben“.<br />
Nichts anderes als die Härte des Glaubens und Schwures im Motiv „Ich glaube“.<br />
Und das Ende aller Begeisterung und Gemütserregung im Motiv „Amen, Amen“.<br />
Die Größe der Heiligkeit in den Motiven „Heilig, heilig“ und „Lamm Gottes“.<br />
Ohne die Düsternis der mittelalterlichen Klosterzellen in den Motiven,<br />
ohne Nachhall stets gleicher Imitationsgeleise,<br />
ohne Nachhall der Bach’schen Fugengewirre,<br />
ohne Nachhall des Beethoven’schen Pathos,<br />
ohne Haydns Verspieltheit;<br />
gegen den Papierdamm der Witt’schen Reform – die uns Krˇízˇkovsk´y entfremdete ! 2<br />
Heute, o Mond, scheinst du mir vom hohen Himmel auf die Papierabschnitte, die mit Noten<br />
bedeckt sind –<br />
morgen schleicht sich die Sonne neugierig ein.<br />
Einmal erstarrten die Finger –<br />
einmal strömte durch das offene Fenster die warme Luft.<br />
Der Duft der feuchten Wälder von Luhačovice war – Weihrauch.<br />
In nebelhaften Fernen wuchs mir ein Dom in die riesenhafte Größe der Berge und des<br />
darüber gewölbten Himmels; mit ihren Glöckchen läutete in ihm eine Schafherde.<br />
Im Tenorsolo höre ich irgendeinen Hohepriester, im Sopran ein Mädchen – einen Engel,<br />
im Chor unser Volk.<br />
Kerzen, hohe Tannen im Walde, von Sternen angezündet; und in der Zeremonie, dort<br />
irgendwo, die Vision des Fürsten – des hl. Wenzel.<br />
Und die Sprache der Glaubensboten Cyrill und Method.<br />
WWW.MPHIL.DE
Leosˇ Janáč ek<br />
(um 1926)
18<br />
Und bevor drei Abende im Kurorte verstrichen, war dieses Werk vollendet; und deshalb,<br />
damit Dr. Nejedl´y teilweise recht behalte, dass ich „leicht und schnell“ nach Vymazal<br />
komponiere. 3<br />
Am 5. Dezember wird in Brünn im Konzertsaal „Stadion“ die „Glagolitische Messe“<br />
aufgeführt werden. Schon im vornherein lobe ich den Gesang des Herrn Tauber und<br />
der Frau Čvan. Auch die wenigen, aber gesunden Töne des Frl. Hlousˇek und des Herrn<br />
Němeček. Ich lobe die Frische der Stimmen und die Sicherheit der Intonation des Chores.<br />
Mit dem Orchester war schon Mascagni zufrieden, und mit dem Dirigenten Kvapil wird<br />
es bestimmt der Philharmonische Verein der Brünner „Beseda“ sein.<br />
Anmerkungen:<br />
Janáč eks Text über die Entstehung seiner<br />
„Glagolitischen Messe“ erschien am<br />
27. November 1927 in der „Lidové noviny“<br />
(„Volkszeitung“ / Jahrgang XXXV, Nr. 598),<br />
einer heute noch existierenden Brünner<br />
Tageszeitung, in der Janáč ek zahlreiche<br />
aphoristisch geprägte Feuilletons veröffentlichte.<br />
1 Leopold Prečan, Erzbischof von Olmütz;<br />
er hatte am 11. Juli 1926 an der Feier zur<br />
Enthüllung der Gedenktafel an Janáč eks<br />
Geburts haus in Hukvaldy teilgenommen<br />
und Janáč ek zur „Glagolitischen Messe“<br />
angeregt.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Brünn, 23. November 1927<br />
2 Franz Xaver Witt hatte den strengen Stil<br />
Palestrinas zum alleingültigen Vorbild für<br />
geistliche Kompositionen erhoben; wie so<br />
viele Kirchenmusiker seiner Zeit war ihm<br />
auch Pavel Krˇízˇkovsk´y darin gefolgt, Janá -<br />
č eks Musiklehrer an der Primarschule des<br />
Altbrünner Klosters.<br />
3 Zdeněk Nejedl´y gehörte als Musikwissenschaftler<br />
und Kritiker zu den erklärten<br />
Gegnern von Janáč eks Musik; unter dem<br />
Schlagwort „leicht und schnell“ kursierten<br />
von Frantisˇek Vymazal seinerzeit vielgelesene<br />
Anweisungen zum Erlernen fast aller<br />
euro päischer Sprachen.<br />
Stephan Kohler
Jakob Knaus<br />
„Der Glaube an<br />
die Gewissheit der Nation“<br />
Zur Fassungsproblematik der „Glagolitischen Messe“<br />
Wieso gibt es zwei verschiedene<br />
Fassungen bzw. Editionen ?<br />
Mit einer „Intrada“ schließt die heute noch<br />
meistens gebräuchliche Fassung der „Glagolitischen<br />
Messe“ – man fragt sich verwundert<br />
weshalb ? Dies entspreche der pantheistischen<br />
Auffassung Janáč eks, die den Menschen<br />
in die Natur hinaus entlassen will,<br />
hat der Biograph Jaroslav Vogel zu erklären<br />
versucht. Und man ist ihm darin fast 50<br />
Jahre lang gefolgt. Bis der junge englische<br />
Musikwissenschafter Paul Wingfield dem<br />
auf den Grund ging und feststellte, dass<br />
bei der Uraufführung in Brünn die „Intrada“<br />
am Anfang und am Schluss gespielt wurde.<br />
Gleichzeitig ist er auf eine stattliche Reihe<br />
von Veränderungen gestoßen, die durch die<br />
Bank als Vereinfachungen bezeichnet werden<br />
können. Und in dieser vereinfachten<br />
Form ist die Messe in Prag (April 1928),<br />
Berlin (Februar 1929) und in Genf (April<br />
1929) aufgeführt worden. Bereits der erste<br />
Druck des Klavierauszugs verwendete einige<br />
dieser Änderungen und ließ die „Intrada“<br />
zu Beginn weg. Die gedruckte Partitur, die<br />
im März 1929 herauskam, enthielt noch<br />
weitergehende Änderungen, die offensichtlich<br />
erst nach Janáč eks Tod am 12. Au gust<br />
1928 vorgenommen worden sind.<br />
Warum ist die Originalfassung erst<br />
in jüngster Zeit bekannt geworden ?<br />
Es war in der ehemaligen Tschechoslowakei<br />
nicht opportun, sich mit einem religiösen<br />
Werk zu beschäftigen, und weil sich ange-<br />
sichts der vertrackten Quellenlage niemand<br />
außer Paul Wingfield hinter diese Notenblätter<br />
gewagt hat. Gewiss wird ihn darin der<br />
englische Dirigent und Janáč ek-Spezialist<br />
Charles Mackerras bestärkt haben. Dass<br />
Janáč ek bei den letzten Proben und auch<br />
noch nach der Uraufführung kleinere Veränderungen<br />
vorgenommen hat, steht inzwischen<br />
fest; aber auch wer es war, der nach<br />
Janáč eks Tod weiter geändert und vor allem<br />
vereinfacht hat: Es war der Dirigent der Ur -<br />
aufführung, Jaroslav Kvapil, dem (noch) kein<br />
Ensemble auf dem heute üblichen hohen<br />
Niveau zur Verfügung stand. Besonders die<br />
damaligen Chöre hatten im „Gospodi pomiluj“<br />
große Mühe mit dem 5/4-Takt.<br />
Was ist anders in der<br />
Originalfassung gegenüber<br />
der Zweitfassung ?<br />
Die rhythmisch markante „Intrada“ wird<br />
zweimal gespielt, zu Beginn und zum Ab -<br />
schluss der Messe – analog zur Klammerfunktion<br />
der Fanfaren in der „Sinfonietta“.<br />
In den einfachen 3/4-Takt der darauffolgenden<br />
„Einleitung“ (Úvod) werden 5/4-Takte<br />
geschoben, die uns sofort aus dem Gleichgewicht<br />
bringen; auch die Chorpassage im<br />
„Kyrie“ (Gospodi pomiluj) ist im 5/4-Takt<br />
gehalten und damit für den Chor noch riskanter<br />
als in der (ohnehin nicht leichten)<br />
bisherigen Fassung. Die drei Klarinetten im<br />
„Credo“ (Věruju) erklingen ganz bewusst<br />
„hinter der Szene“; vor allem aber verleihen<br />
die drei Paukenpaare dem Abschnitt mit dem<br />
eingeschobenen Orgelsolo apokalyptische<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
19
20<br />
Die Abschnitte „Kyrie“ und „Gloria“ in glagolitischer Schrift<br />
Klanggewalt – überwältigend vor allem beim<br />
Choreinwurf „Er wurde für uns gekreuzigt,<br />
gemartert und begraben“ (Raspět zˇe zany).<br />
Das „Hosanna“ (Osanna vo vysˇńich) wird<br />
zur Höhe hin noch ekstatisch ausgeweitet.<br />
Auf der Suche nach der<br />
authentischen Botschaft<br />
Wenn die Vereinfachungen, wie sie in der<br />
bisherigen, 1929 gedruckten Fassung vorliegen,<br />
nun konsequent rückgängig gemacht<br />
werden, so entstehen natürlich zusätzliche<br />
Schwierigkeiten, die die traditionellen Prob-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
leme mit der Aufführung der „Glagolitischen<br />
Messe“ noch verstärken; sie verstärken aber<br />
auch Janáč eks ideelle Botschaft – indem z. B.<br />
die Pauken den Gestus der Einleitungsfanfaren<br />
verwenden. „Der Glaube an die Gewissheit<br />
der Nation“, wie es der Komponist in<br />
seinem Feuilleton für die „Lidové noviny“<br />
(Volkszeitung) so suggestiv formuliert hat,<br />
liegt in diesen Fanfaren, die sehr deutlich<br />
Bezug nehmen auf das Vorspiel zu Smetanas<br />
Oper „Libusˇe“: Die Prophezeihung Libusˇes,<br />
dass das tschechische Volk niemals untergehen<br />
werde, klingt damit bei Janáč ek unüberhörbar<br />
mit.
Lothar Zagrosek<br />
Seine erste musikalische Ausbildung erhielt<br />
der in Bayern geborene Dirigent als Mitglied<br />
der Regensburger Domspatzen. In den Jahren<br />
1962 bis 1967 studierte Lothar Zagrosek<br />
Dirigieren bei Hans Swarowsky, István Kertész,<br />
Bruno Maderna und Herbert von Karajan.<br />
Nach Stationen als Generalmusikdirektor<br />
in Solingen und in Krefeld-Mönchengladbach<br />
wurde er 1982 Chefdirigent des Österreichischen<br />
Radio-Sinfonieorchesters in Wien.<br />
Diesem Engagement folgten drei Jahre als<br />
Musikdirektor der Operá de Paris sowie als<br />
Chief Guest Conductor des BBC Symphony<br />
Orchestra in London. Von 1990 bis 1992<br />
wirkte Lothar Zagrosek als Generalmusikdirektor<br />
der Oper Leipzig, von 1997 bis 2006<br />
war er Generalmusikdirektor der Württembergischen<br />
Staatsoper Stuttgart. Seit 1995<br />
ist er darüber hinaus als Erster Gastdirigent<br />
und Künstlerischer Berater der Jungen Deutschen<br />
Philharmonie verbunden. Seit der Saison<br />
2006/2007 hat Lothar Zagrosek die Lei Lei-<br />
tung des Konzerthausorchesters Berlin inne.<br />
Neben seiner Tätigkeit als Operndirigent, die<br />
ihn u. a. an die Staatsopern von Hamburg,<br />
München und Wien, die Deutsche Oper Berlin,<br />
das Théâtre de la Monnaie Brüssel, das<br />
Royal Opera House Covent Garden in London<br />
und zum Glyndebourne Festival führte, dirigierte<br />
Lothar Zagrosek bedeutende Orchester<br />
des In- und Auslands, darunter die Berliner<br />
<strong>Philharmoniker</strong>, das Gewandhausorchester<br />
Leipzig, die Wiener Symphoniker, das Orchestre<br />
National de France, das London Philharmonic<br />
Orchestra und das NHK Symphony<br />
Orchestra Tokyo. Lothar Zagrosek war Gast<br />
bei den Wiener und Berliner Festwochen,<br />
den London Proms, den <strong>Münchner</strong> Opernfestspielen<br />
und den Salzburger Festspielen.<br />
Regelmäßig ist er auf den Festivals für zeitgenössische<br />
Musik in Donaueschingen, Berlin,<br />
Brüssel und Paris vertreten. Im März<br />
2006 wurde Lothar Zagrosek mit dem<br />
Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
21
MÜNCHEN STUTTGART SCHWÄBISCH HALL<br />
Manche nennen es<br />
Kunstwerk.<br />
Wir nennen es Bechstein.<br />
WWW.PIANO- FISCHER.DE INFO@PIANO- FISCHER.DE
Till Fellner<br />
Der in Wien geborene österreichische Pia -<br />
nist studierte bei Helene Sedo-Stadler, Alfred<br />
Brendel, Meira Farkas, Oleg Maisenberg<br />
und Claus-Christian Schuster. Seine internationale<br />
Karriere begann 1993 mit dem<br />
1. Preis beim Concours Clara Haskil in<br />
Vevey / Schweiz. Seitdem ist Till Fellner<br />
regelmäßiger Gast bei renommierten Orchestern<br />
in den großen Musikzentren in Europa,<br />
den USA und Japan sowie bei vielen wichtigen<br />
Festivals. Zu den Dirigenten, mit denen<br />
er zusammengearbeitet hat, zählen Claudio<br />
Abbado, Vladimir Ashkenazy, Nikolaus Harnoncourt,<br />
Heinz Holliger, Marek Janowski,<br />
Charles Mackerras, Neville Marriner, Kent<br />
Nagano, Jukka-Pekka Saraste, Franz Welser-<br />
Möst und Hans Zender. Als Kammermusiker<br />
spielt Till Fellner regelmäßig mit Heinrich<br />
Schiff sowie in einem Trio mit Lisa Batiashvili<br />
und Adrian Brendel, des weiteren begleitet<br />
er Mark Padmore bei Liederabenden. In<br />
der vergangenen Saison konzertierte Till<br />
Fellner u. a. in Paris, London, Wien und Budapest<br />
und arbeitete dabei mit Dirigenten wie<br />
Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Philippe<br />
Jordan und Zoltán Kocsis zusammen; weitere<br />
Höhepunkte waren eine Duo-Tournee mit<br />
Heinrich Schiff sowie äußerst erfolgreiche<br />
Gastspiele in den USA und Japan. Für die<br />
Saison 2007/08 sind u. a. Auftritte mit dem<br />
Orchestre National de France (Kurt Masur)<br />
und dem Philharmonia Orchestra London<br />
(Charles Mackerras) geplant. Weitere Schwerpunkte<br />
sind Rezitals in Europa und Nordamerika<br />
sowie Kammermusikkonzerte mit<br />
Viviane Hagner, Lisa Batiashvili und Adrian<br />
Brendel. Ab Herbst 2008 wird Till Fellner in<br />
einem auf 7 Konzerte und 2 Sai sonen angelegten<br />
Zyklus alle Beethoven-Klaviersonaten<br />
spielen; der gesamte Zyklus wird u. a. in New<br />
York, Tokio, London, Paris und Wien zu<br />
hören sein.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
23
24<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Melanie Diener<br />
Die in der Nähe von Hamburg geborene deutsche<br />
Sopranistin absolvierte ihr Gesangsstudium<br />
bei Sylvia Geszty an der Stuttgarter Musikhochschule<br />
und bei Rudolf Piernay in Mannheim.<br />
Ins Rampenlicht trat Melanie Diener<br />
erstmals als Preisträgerin des Salzburger<br />
Mozart-Wettbewerbs und des Internationalen<br />
Königin Sonja-Gesangswettbewerbs in Oslo.<br />
1996 gab sie ihren Bühneneinstand als Ilia<br />
in „Idomeneo“ an der Garsington Opera; mit<br />
derselben Partie debütierte sie ein Jahr später<br />
an der Bayerischen Staatsoper. Zwei weitere<br />
Mozart-Rollen waren es, mit denen sich<br />
Melanie Diener im internationalen Musikleben<br />
etablierte: Die Fiordiligi interpretierte<br />
sie in London, Paris, Ferrara, Dresden, an<br />
der MET und in Zürich; als Donna Elvira<br />
gastierte sie in Wien, Aix-en-Provence, bei<br />
den Salzburger Festspielen, an der Metropolitan<br />
Opera und in Tokyo. Aber auch als<br />
„Figaro“-Gräfin, Elettra in „Idomeneo“ und<br />
Vitellia im „Titus“ trat sie hervor. 1999 debütierte<br />
Melanie Diener den Bayreuther Festspielen<br />
als Elsa im „Lohengrin“. Im deutschen<br />
Fach gehören Sieglinde und Gutrune<br />
im „Ring“ und Strauss-Partien wie Chrysothemis,<br />
Marschallin und Ariadne zu ihrem<br />
Repertoire. Im Januar 2005 feierte die So -<br />
pranistin als Katja Kabanova an der Berli -<br />
ner Lindenoper einen großen persönlichen<br />
Er folg; kurz darauf reüssierte sie als Ellen<br />
Orford in Brittens „Peter Grimes“ an der<br />
Wiener und als Marschallin an der Hamburgischen<br />
Staatsoper.
Katharina Kammerloher<br />
Die in München geborene Mezzosopranistin<br />
studierte bei Mechthild Böhme in Detmold<br />
und Vera Rozsa in London. Seit 1993 ist<br />
Katharina Kammerloher Ensemblemitglied<br />
der Berliner Staatsoper Unter den Linden,<br />
wo sie u. a. als Cherubino in „Le nozze di<br />
Figaro“, Zerlina in „Don Giovanni“, Rosina<br />
im „Barbier von Sevilla“, Suzuki in „Madama<br />
Butterfly“, Mélisande in „Pelléas et Mélisande“<br />
und Octavian im „Rosenkavalier“ zu<br />
hören war. Darüber hinaus sang Katharina<br />
Kammerloher in zahlreichen Neuproduktionen<br />
der Berliner Staatsoper wichtige Partien<br />
ihres Fachs unter so renommierten Dirigenten<br />
wie Claudio Abbado, Daniel Barenboim<br />
und Antonio Pappano – z. B. Dorabella in<br />
„Così fan tutte“, Meg Page in „Falstaff“, Magdalene<br />
in den „Meistersingern“, Wellgunde<br />
im „Ring“ oder Lola in „Cavalleria rusticana“.<br />
Katharina Kammerloher ist regelmäßig<br />
Gast bedeutender Festivals, so z. B. der Salzburger<br />
und <strong>Münchner</strong> Festspiele, des Edinburgh<br />
Festivals, der BBC Proms und der<br />
<strong>Münchner</strong> „Musica Viva“; dabei arbeitet sie<br />
mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Michael<br />
Gielen, René Jacobs, Zubin Mehta und Kent<br />
Nagano zusammen. Katharina Kammerlohers<br />
Opern-, Lied- und Konzertrepertoire ist breitgefächert<br />
und reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen<br />
Werken.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
25
26<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Michal Lehotsky´<br />
Der slowakische Tenor hat 1995 sein Gesangsstudium<br />
mit einem erfolgreichen Rezital unter<br />
dem Patronat von „Slovkoncert“ in Pressburg<br />
abgeschlossen. 1996 absolvierte er Studien<br />
an der Mozart-Akademie Krakau und nahm<br />
an Meisterkursen in Piesˇ t’any und Bayreuth<br />
teil. Michal Lehotsky´ war Preisträger des<br />
Trnavsky´ - und Destinnová-Wettbewerbs<br />
sowie zweimaliger Semifinalist des Hans<br />
Gabor Belvedere-Wettbewerbs in Wien. Seit<br />
der Spielzeit 1996/97 bis 2001 war Michal<br />
Lehotsky´ an der Oper von Kosˇice engagiert,<br />
wo er zahlreiche Partien sang: Alfredo in „La<br />
traviata“, Herzog in „Rigoletto“, Manrico in<br />
„Trovatore“, Radames in „Aida“, Cavaradossi<br />
in „Tosca“, Rodolfo in „La Bohème“, Hans in<br />
„Die verkaufte Braut“ und Don José in „Carmen“.<br />
In 2001 trat Michal Lehotsky´ erfolgreich<br />
als Jirˇi in Dvorˇáks „Jakobiner“ beim<br />
Wexford Festival auf. In letzter Zeit war der<br />
junge Sänger Gast an den wichtigsten Opernhäusern<br />
in Deutschland, Österreich, Ungarn<br />
und Tschechien, dort vor allem an den Staatsopern<br />
von Prag und Brünn. Michal Lehotsky´<br />
widmet sich auch dem Konzertrepertoire, wo<br />
er sich u. a. auf Werke von Leosˇ Janáč ek,<br />
Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart<br />
und Joseph Haydn konzentriert. Seit 2004 ist<br />
Michal Lehotsky´ am Slowakischen Nationaltheater<br />
in Pressburg engagiert, wo er u. a. in<br />
Smetanas „Kuss“ und Verdis „Macbeth“ auftrat.
Petr Mikulásˇ<br />
Der slowakische Bass absolvierte sein<br />
Gesangsstudium an der Akademie für<br />
Musik und Darstellende Kunst in Pressburg<br />
bei Viktória Stracenská und war Gewinner<br />
zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie<br />
des Antonín Dvorˇák-Wettbewerbs Karlovy<br />
Vary (1978), des Pjotr Iljitsch Tschaikowsky-<br />
Wettbewerbs Moskau (1982) und des Miriam<br />
Helin-Wettbewerbs Helsinki (1984). Seit 1978<br />
ist Petr Mikulásˇ Solist am Slowakischen Nationaltheater<br />
in Pressburg, wo er sein Debüt als<br />
Colline in „La Bohème“ gab. Heute gastiert<br />
Petr Mikulásˇ am Prager Nationaltheater, an<br />
der MET in New York und an vielen europäischen<br />
Opernhäusern wie z. B. an der Oper<br />
von Rom. Zu seinen Partien zählen u. a. der<br />
Leporello in „Don Giovanni“, der Fiesco in<br />
„Simon Boccanegra“, der Philipp in „Don Carlo“,<br />
der Mephisto in den „Faust“-Vertonungen von<br />
Boito und Gounod und der Gremin in „Eugen<br />
Onegin“. Petr Mikulásˇ arbeitet mit Dirigenten<br />
wie Gerd Albrecht, Vladimir Ashkenazy, Jirˇi<br />
Bělohlávek, Semyon Bychkov, Charles Dutoit,<br />
Libor Pesˇek, Simon Rattle oder Helmut Rilling<br />
und tritt regelmäßig mit Orchestern auf wie<br />
dem Orchestre de Paris, den Wiener <strong>Philharmoniker</strong>n<br />
und den wichtigsten Orchestern<br />
in Italien und Spanien. Als Konzertsänger<br />
trifft man Petr Mikulásˇ u. a. beim Musikfestival<br />
„Prager Frühling“ an, bei den Salzburger<br />
Festspielen und bei den BBC-Proms<br />
in London.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
27
28<br />
Friedemann Winklhofer<br />
Friedemann Winklhofer studierte zunächst<br />
an der Hochschule für Musik in München<br />
Orgel, Klavier und Dirigieren. Weitere Studien<br />
führten ihn nach Paris zu Jean Guillou.<br />
1981 wurde er Preisträger beim Internationalen<br />
Orgelwettbewerb der Accademia di<br />
Santa Cecilia in Rom. Von 1977 bis 1981<br />
war Winklhofer Assistent Karl Richters<br />
beim <strong>Münchner</strong> Bach-Chor, auf Wunsch<br />
von Leonard Bernstein wirkte er 1988 und<br />
1990 bei Konzerten und Aufnahmen Bernsteins<br />
mit. Als gefragter Continuo-Spieler und<br />
auch als Solist trat Winklhofer unter Dirigenten<br />
wie Yehudi Menuhin, Georg Solti, Carlo<br />
Maria Giulini, Lorin Maazel, Bernard Haitink,<br />
Franz Welser-Möst, Roger Norrington, Krzysztof<br />
Penderecki, Marcello Viotti und Kent Nagano<br />
auf. Konzertreisen führten ihn in die wich-<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
tigsten Musikmetropolen und zu renommierten<br />
Festivals. Im November 2007 wurde Friedemann<br />
Winkl hofer eingeladen, als Orgelsachverständiger<br />
an der neuen Klais-Orgel<br />
im „Grand Natio nal Theater“ in Peking die<br />
Abnahmeprüfung durchzuführen. Anfang<br />
März 2008 erfolgte mit ihm als Solisten die<br />
offizielle Einweihung: mit dem Shanghai<br />
Philharmonic Orchestra spielte er die „Symphony<br />
for Organ and Orchestra“ von Aaron<br />
Copland. Winklhofer ist Professor an der<br />
Hochschule für Musik in München sowie<br />
Dozent am <strong>Münchner</strong> Richard-Strauss-<br />
Konservatorium. Seit 1992 ist er Orgelsachverständiger<br />
der Erzdiözese München-<br />
Freising, 2001 wurde er zum Kustos der<br />
Klais-Orgel in der <strong>Münchner</strong> Philharmonie<br />
ernannt.
Andreas Herrmann<br />
Andreas Herrmann, geboren 1963 in München,<br />
übernahm 1996 als Chordirektor die<br />
künstlerische Leitung des Philharmonischen<br />
Chores München. Mit ihm realisierte er zahlreiche<br />
Einstudierungen für Dirigenten wie<br />
Christian Thielemann, James Levine, Zubin<br />
Mehta, Mariss Jansons, Lorin Maazel, Krzysztof<br />
Penderecki, Daniele Gatti, Frans Brüggen<br />
und viele andere. Seine Ausbildung an der<br />
<strong>Münchner</strong> Musikhochschule, zuletzt in der<br />
Meisterklasse von Michael Gläser, ergänzte<br />
Andreas Herrmann durch verschiedene internationale<br />
Chorleitungsseminare und Meisterkurse<br />
bei renommierten Chordirigenten wie<br />
Eric Ericson und Fritz Schieri. Im Rahmen seiner<br />
Tätigkeit als Professor an der Hochschule<br />
für Musik und Theater in München unterrichtet<br />
Herrmann seit 1996 Dirigieren/Chorleitung<br />
in den Studiengängen Chordirigieren, Komposition,<br />
Gehörbildung, Musiktheorie, Schul- und<br />
Kirchenmusik; 1998/99 und erneut 2001/02<br />
wurde ihm die Vertretung des Lehrstuhls<br />
Evangelische Kirchenmusik/Chordirigieren<br />
anvertraut. 2004/05 übernahm Hermann interimistisch<br />
die Leitung des Madrigalchores der<br />
Hochschule für Musik und Theater München;<br />
ambitionierte Sonderprojekte, wie Konzertreisen<br />
nach Italien, TV-Aufnahmen, Uraufführungen<br />
Neuer Musik und die Gestaltung von Programmen<br />
mit Alter Musik und Originalinstrumenten<br />
standen hier im Vordergrund. Zehn<br />
Jahre, von 1996 bis 2006, leitete Andreas Herrmann<br />
den Hochschulchor und betreute in dieser<br />
Zeit unzählige Oratorienkonzerte, Opernaufführungen<br />
und a-cappella-Programme aller<br />
musikalischen Stilrichtungen. Internationale<br />
Konzertreisen als Chor- und Oratoriendirigent<br />
führten Herrmann u. a. nach Italien, Frankreich,<br />
Österreich, Ungarn, Bulgarien, in die<br />
Schweiz und in die Volksrepublik China. Mit<br />
zahlreichen Chören, Orchestern und Ensembles<br />
entfaltet er über seine Position beim Philharmonischen<br />
Chor hinaus eine rege Konzerttätigkeit.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
29
30<br />
Philharmonischer Chor München<br />
Der Philharmonische Chor München ist einer<br />
der führenden großen Konzertchöre Deutschlands.<br />
Sein Repertoire erstreckt sich über die<br />
gesamte Chormusik und umfasst anspruchsvolle<br />
a-cappella-Literatur aller Epochen und<br />
konzertante Opern von Mozart über Verdi,<br />
Puccini, Wagner und Strauss bis hin zu Schönbergs<br />
„Moses und Aron“ und Henzes „Bassariden“.<br />
Der Philharmonische Chor pflegt diese<br />
Literatur genauso wie die Chorwerke von Bach,<br />
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann,<br />
Bruckner, Reger, Strawinsky, Orff und<br />
Penderecki. Er musizierte unter der Leitung<br />
so bedeutender Komponisten und Dirigenten<br />
wie Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Krzysztof<br />
Penderecki, Lorin Maazel, Rudolf Kempe, Herbert<br />
von Karajan, Sergiu Celibidache, Seiji<br />
Ozawa, Zubin Mehta, Mariss Jansons, James<br />
Levine und Christian Thielemann. Um in dieser<br />
Bandbreite dem Publikum Stilsicherheit<br />
präsentieren zu können, tritt der Philharmonische<br />
Chor München außer in der gängigen<br />
Konzertchor-Formation von etwa 90 Sängerinnen<br />
und Sängern auch in kleineren oder größeren<br />
Besetzungen auf. Die Arbeit in wechselnden<br />
Kammerchor- und Vokalensemble-<br />
Besetzungen versetzt ihn über das klassischromantische<br />
Repertoire hinaus in die Lage,<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
sowohl barocke Literatur als auch Musik<br />
der Moderne auf höchstem Niveau darzubieten.<br />
Die Chor arbeit lag in der mittlerweile<br />
gut 110-jährigen Geschichte des Ensembles<br />
immer in der Hand ausgewiesener Experten<br />
in Sachen Chormusik wie Rudolf Lamy, Hans-<br />
Rudolf Zöbeley, Josef Schmidhuber, Joshard<br />
Daus, Michael Gläser und des jetzigen Dresdner<br />
Kreuzkantors Roderich Kreile. Seit 1996<br />
hat Andreas Herrmann, Professor für Chorleitung<br />
an der Hochschule für Musik und<br />
Theater in München, die künstlerische Leitung<br />
inne. Die wichtigste Aufgabe des Philharmonischen<br />
Chors ist die Mitwirkung bei<br />
Konzerten der <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />
mit Chor beteiligung in der Philharmonie am<br />
Gasteig. Da rüber hinaus runden eigene Konzerte<br />
und Aufnahmen das Angebot ab. Außerdem<br />
erhält der Chor immer mehr Einladungen<br />
von externen Veranstaltern. Er ist gern<br />
gesehener Gast bei Konzertereignissen in<br />
Deutschland, im europäischen und außereuropäischen<br />
Ausland; so unternahm der Philharmonische<br />
Chor eine Tournee mit Werken<br />
von Carl Orff nach Ägypten und präsentierte<br />
„Trionfo di Afrodite“ und „Carmina Burana“<br />
in den Opernhäusern von Alexandria und<br />
Kairo.
Die <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />
Generalmusikdirektor<br />
Christian Thielemann<br />
Ehrendirigent<br />
Zubin Mehta<br />
1. Violinen<br />
Sreten Krsti˘c<br />
Lorenz Nasturica-Herschovici<br />
Julian Shevlin<br />
Konzertmeister<br />
Karel Eberle<br />
Odette Couch<br />
stv. Konzertmeister/in<br />
Mathias Freund<br />
Vorspieler<br />
Manfred Hufnagel<br />
Theresia Ritthaler<br />
Katharina Krüger<br />
Masako Shinohe<br />
Claudia Sutil<br />
Philip Middleman<br />
Nenad Daleore<br />
Peter Becher<br />
Regina Matthes<br />
Wolfram Lohschütz<br />
Mitsuko Date-Botsch<br />
Martin Manz<br />
Céline Vaudé<br />
N.N.<br />
2. Violinen<br />
Simon Fordham<br />
Alexander Möck<br />
Stimmführer<br />
IIona Cudek<br />
stv. Stimmführerin<br />
Matthias Löhlein<br />
Vorspieler<br />
Dietmar Forster<br />
Josef Thoma<br />
Zen Hu-Gothoni<br />
Anja Traub<br />
Katharina Reichstaller<br />
Nils Schad<br />
Clara Bergius-Bühl<br />
Esther Merz<br />
Katharina Triendl<br />
Ana Vladanovic-Lebedinski<br />
Bernhard Metz<br />
Namiko Fuse<br />
Qi Zhou<br />
Clément Courtin<br />
N.N.<br />
Bratschen<br />
Helmut Nicolai<br />
N.N.<br />
Konzertmeister<br />
Burkhard Sigl<br />
Julia Mai<br />
stv. Solo<br />
Max Spenger<br />
Herbert Stoiber<br />
Wolfgang Stingl<br />
Gunter Pretzel<br />
Wolfgang Berg<br />
Dirk Niewöhner<br />
Beate Springorum<br />
Agata Józefowicz-Fiolek<br />
Konstantin Sellheim<br />
Thaïs Coelho<br />
Julio Lopez<br />
Violoncelli<br />
Helmar Stiehler<br />
Michael Hell<br />
Konzertmeister<br />
Stephan Haack<br />
Thomas Ruge<br />
stv. Solo<br />
Herbert Heim<br />
Veit Wenk-Wolff<br />
Sissy Schmidhuber<br />
Elke Funk-Hoever<br />
Manuel von der Nahmer<br />
Isolde Hayer<br />
Sven Faulian<br />
David Hausdorf<br />
Joachim Wohlgemuth<br />
Kontrabässe<br />
Matthias Weber<br />
Slawomir Grenda<br />
Solo<br />
Alexander Preuß<br />
stv. Solo<br />
Stephan Graf<br />
Vorspieler<br />
Holger Herrmann<br />
Erik Zeppezauer<br />
Stepan Kratochvil<br />
Jesper Ulfenstedt<br />
Shengni Guo<br />
N.N.<br />
Flöten<br />
Michael Martin Kofler<br />
Burkhard Jäckle<br />
Solo<br />
Hans Billig<br />
stv. Solo<br />
Martin Belič<br />
Ulrich Biersack<br />
Piccoloflöte<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
31
32<br />
Oboen<br />
Ulrich Becker<br />
Marie-Luise Modersohn<br />
Solo<br />
Lisa Outred<br />
Bernhard Berwanger<br />
Kai Rapsch<br />
Englischhorn<br />
Klarinetten<br />
Alexandra Gruber<br />
N.N.<br />
Solo<br />
Annette Maucher<br />
stv. Solo<br />
Peter Flähmig<br />
Albert Osterhammer<br />
Bassklarinette<br />
Fagotte<br />
Lyndon Watts<br />
Bence Bogányi<br />
Solo<br />
Jürgen Popp<br />
Barbara Kehrig<br />
Jörg Urbach<br />
Kontrafagott<br />
Hörner<br />
Ivo Gass<br />
N.N.<br />
Solo<br />
David Moltz<br />
Ulrich Haider<br />
stv. Solo<br />
Hartmut Hubert<br />
Robert Ross<br />
Alois Schlemer<br />
Hubert Pilstl<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Trompeten<br />
Guido Segers<br />
Florian Klingler<br />
Solo<br />
Bernhard Peschl<br />
stv. Solo<br />
Franz Unterrainer<br />
Markus Rainer<br />
Posaunen<br />
Dany Bonvin<br />
N.N.<br />
Solo<br />
Matthias Fischer<br />
stv. Solo<br />
Bernhard Weiß<br />
Benjamin Appel<br />
Bassposaune<br />
Tuba<br />
Thomas Walsh<br />
Pauken<br />
Stefan Gagelmann<br />
Guido Rückel<br />
Solo<br />
Manfred Trauner<br />
Walter Schwarz<br />
stv. Solo<br />
Schlagzeug<br />
Arnold Riedhammer<br />
1. Schlagzeuger<br />
Harfe<br />
Sarah O’Brien<br />
Orchestervorstand<br />
Guido Segers<br />
Wolfgang Berg<br />
Manuel von der Nahmer<br />
Stipendiaten der<br />
Orchesterakademie<br />
2007/2008<br />
Violine<br />
Miryam Nothelfer<br />
Stefanie Pfaffenzeller<br />
Katarzyna Reifur<br />
Katarzyna Woznica<br />
Viola<br />
Alice Mura<br />
María Ropero Encabo<br />
Violoncello<br />
Lidija Cvitkovac<br />
Susanne Tscherbner<br />
Kontrabass<br />
Mantaro Jo<br />
Dominik Luderschmid<br />
Oboe<br />
N.N.<br />
Klarinette<br />
Matthias Mauerer<br />
Fagott<br />
Heidrun Wirth<br />
Trompete<br />
Peter Moriggl<br />
Posaune<br />
Andreas Oblasser<br />
Tuba<br />
Yusuke Kasai<br />
Schlagzeug<br />
André Philipp Kollikowski<br />
Harfe<br />
Antonia Schreiber
Die Geschichte der<br />
<strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />
Die <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong> wurden<br />
1893 auf Privatinitiative von Franz Kaim,<br />
Sohn eines Klavierfabrikanten, ge grün det<br />
und prägen seit her unter renommierten<br />
Diri gen ten das musi ka lische Leben Münchens.<br />
Be reits in den Anfangsjahren des<br />
Or chesters – zunächst unter dem Namen<br />
„Kaim-Orchester“ – garantierten Diri gen ten<br />
wie Hans Win der stein, Hermann Zumpe<br />
und der Bruckner-Schüler Ferdinand Löwe<br />
hohes spieltech nisches Niveau und setzten<br />
sich intensiv auch für das zeitgenössische<br />
Schaffen ein.<br />
... die klangvolle Adresse<br />
... für höchste Ansprüche<br />
... in allen Preisklassen<br />
... Meisterwerkstatt<br />
... Konzertservice<br />
Lindwurmstraße 1<br />
80337 München<br />
Tel.: 0 89-2 60 95 23<br />
Fax: 0 89-26 59 26<br />
www.klavierhirsch.de<br />
Von Anbeginn an gehörte zum künstle rischen<br />
Konzept auch das Bestreben, durch<br />
Pro gramm- und Preisgestaltung allen Bevöl -<br />
ke rungs schichten Zugang zu den Konzerten<br />
zu er mög lichen. Mit Felix Weingartner, der<br />
das Orches ter von 1898 bis 1905 leitete,<br />
mehrte sich durch zahlreiche Auslandsreisen<br />
auch das inter nationale Ansehen.<br />
Gustav Mahler dirigierte das Orchester in<br />
den Jahren 1901 und 1910 bei den Urauf -<br />
füh run gen seiner 4. und 8. Sym phonie.<br />
Im No vem ber 1911 gelangte mit dem in -<br />
zwischen in „Kon zert v erein-Or chester“<br />
umbenannten E n semble unter Bruno<br />
Walters Leitung Mahlers „Das Lied von<br />
der Erde“ zur Urauf führung – nur ein<br />
halbes Jahr nach dem Tod des Kom po -<br />
nisten in Wien.<br />
Von 1908 bis 1914 übernahm Ferdinand<br />
Löwe das Orchester erneut. In Anknüp fung<br />
an das triumphale Wiener Gastspiel am<br />
1. März 1898 mit Bruckners 5. Sym phonie<br />
leitete er die ersten Bruckner-Konzerte und<br />
begründete so die bis heute andauernde<br />
Bruckner-Tra dition des Orchesters.<br />
In die Amtszeit von Siegmund von Hausegger,<br />
der dem Orchester von 1920 bis 1938<br />
als General musikdirektor vorstand, fielen<br />
u. a. die Uraufführungen zweier Symphonien<br />
Bruckners in ihren jeweiligen Original fas sungen<br />
sowie die Umbenennung in „Münch ner<br />
Phil har mo niker “ und damit endgültige<br />
Namensgebung.<br />
Von 1938 bis zum Sommer 1944 stand der<br />
österreichische Dirigent Oswald Kabasta an<br />
der Spitze des Orchesters, der die Bruckner-<br />
Tradition der <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />
WWW.MPHIL.DE<br />
33
34<br />
glanzvoll fortführte und auch bei zahlreichen<br />
Gastspielreisen im In- und Ausland unter<br />
Beweis stellte.<br />
Das erste Konzert nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
eröffnete Eugen Jochum mit der Ouvertüre<br />
zu Shakespeares „Ein Sommer nachtstraum“<br />
von Felix Men dels sohn Bartholdy,<br />
dessen Musik in der Zeit des Nationalsozialismus<br />
verfemt war.<br />
Mit Hans Rosbaud gewannen die Phil harmoniker<br />
im Herbst 1945 einen herausragenden<br />
Orchesterleiter, der sich zudem leidenschaftlich<br />
für neue Musik einsetzte.<br />
Rosbauds Nachfolger war von 1949 bis 1966<br />
Fritz Rieger, in dessen Amtszeit die Grundlagen<br />
für die erfolgreiche Jugendarbeit der<br />
<strong>Philharmoniker</strong> gelegt wurden. In der Ära<br />
Rudolf Kempes, der das Orchester von 1967<br />
bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1976 leitete,<br />
bereisten die Philharmo ni ker erstmals<br />
die damalige UdSSR und stiegen zu einem<br />
internationalen Spitzenorchester auf.<br />
Im Februar 1979 leitete Sergiu Celibi dache<br />
seine erste Konzertserie bei den <strong>Münchner</strong><br />
<strong>Philharmoniker</strong>n. Im Juni desselben Jahres<br />
erfolgte Celibidaches Ernennung zum Gene -<br />
ral musikdirektor. Konzertreisen führten ihn<br />
und das Or chester durch viele Länder Euro -<br />
pas, nach Südamerika und Asien. Die ge mein -<br />
sa men legendären Bruckner-Konzerte trugen<br />
wesentlich zum inter natio nalen Ruf des<br />
Orchesters bei.<br />
Nach langen Interimsjahren im Münch ner<br />
Herkulessaal erhielten die Philhar mo niker<br />
1985 mit der Philharmonie im städtischen<br />
Kulturzentrum am Gasteig nach über 40 Jahren<br />
endlich wieder einen eigenen Konzertsaal<br />
– ihre alte Heim statt, die sog. „Tonhalle“ in<br />
der Türken straße, war 1944 völlig zerstört<br />
worden.<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Von September 1999 bis Juli 2004 war James<br />
Levine Chefdirigent der Münch ner <strong>Philharmoniker</strong>.<br />
Mit ihm unternahmen die <strong>Münchner</strong><br />
<strong>Philharmoniker</strong> ausgedehnte Konzerttourneen:<br />
Nach einer großen Europa tournee im<br />
Winter 2000 gastierten sie mit James Levine<br />
im Februar 2002 u. a. in der Carnegie Hall in<br />
New York. Im Sommer 2002 gaben sie ihr<br />
gemeinsames Debüt bei den „Proms“ in<br />
London.<br />
Im Frühjahr 2003 wurde den <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong>n<br />
vom Deutschen Musik verleger-<br />
Verband der Preis für das „Beste Konzertprogramm<br />
der Saison 2003/2004“ verliehen.<br />
Im Januar 2004 ernannten die <strong>Münchner</strong><br />
<strong>Philharmoniker</strong> Zubin Mehta zum ersten<br />
„Ehrendirigenten“ in der Geschichte des<br />
Orchesters.<br />
Im Mai 2003 unterzeichnete Christian Thielemann<br />
seinen Vertrag als neuer Ge neralmusik -<br />
direktor. Am 29. Oktober 2004 dirigierte er<br />
sein Antrittskonzert mit der 5. Sym phonie<br />
von Anton Bruckner, kurz zuvor wurde er im<br />
Rahmen der „Echo Klassik“-Preisverleihung<br />
2004 als einziger Preisträger mit dem Prädikat<br />
„Artist of the Year“ ausgezeichnet.<br />
Am 20. Oktober 2005 wurde den Münch ner<br />
<strong>Philharmoniker</strong>n die Ehre zuteil, unter der<br />
Lei tung von Christian Thielemann ein Kon zert<br />
vor Papst Benedikt XVI. im Vatikan zu geben,<br />
an dem rund 7.000 geladene Gäste teilnahmen.<br />
Eine von Christian Thielemann geleitete Asientournee<br />
führte das Orchester im November<br />
2007 zu Konzerten nach Japan, Korea und<br />
China, wo es von Publikum und Presse in<br />
gleicher Weise gefeiert wurde.
Programmvorschau<br />
Samstag, 20. September<br />
2008, 10 Uhr<br />
Öffentliche Generalprobe<br />
Sonntag, 21. September<br />
2008, 11 Uhr<br />
1. Abonnementkonzert M<br />
Montag, 22. September<br />
2008, 20 Uhr<br />
1. Abonnementkonzert E<br />
Mittwoch, 24. September<br />
2008, 20 Uhr<br />
1. Abonnementkonzert A<br />
Georges Enescu<br />
„Rumänische Rhapsodie“<br />
A-Dur op. 11 Nr. 1<br />
George Gershwin<br />
Concerto in F<br />
Ottorino Respighi<br />
„Fontane di Roma“<br />
„Pini di Roma“<br />
Ion Marin<br />
Dirigent<br />
Jean-Yves Thibaudet<br />
Klavier<br />
Donnerstag, 2. Oktober<br />
2008, 19 Uhr<br />
1. Jugendkonzert<br />
Freitag, 3. Oktober<br />
2008, 20 Uhr<br />
1. Abonnementkonzert C<br />
Samstag, 4. Oktober<br />
2008, 19 Uhr<br />
1. Abonnementkonzert D<br />
Béla Bartók<br />
Vier Orchesterstücke op. 12<br />
Peter Eötvös<br />
„Jet Stream“ für Trompete<br />
und Orchester<br />
Claude Debussy<br />
„Jeux“<br />
Edgard Varèse<br />
„Arcana“<br />
Peter Eötvös<br />
Dirigent<br />
Håkan Hardenberger<br />
Trompete<br />
Sonntag, 5. Oktober<br />
2008, 11 Uhr<br />
1. Kammerkonzert<br />
Franz Schubert<br />
Trio für Violine, Viola und<br />
Violoncello B-Dur D 581<br />
Ludwig van Beethoven<br />
Trio für Violine, Viola und<br />
Violoncello c-Moll op. 9 Nr. 3<br />
Darius Milhaud<br />
Sonatine für Violine, Viola<br />
und Violoncello op. 221 b<br />
(2. Fassung)<br />
Ernst von Dohnányi<br />
Serenade für Streichtrio<br />
C-Dur op. 10<br />
Céline Vaudé<br />
Violine<br />
Thaïs Coelho<br />
Viola<br />
Sissy Schmidhuber<br />
Violoncello<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
35
36<br />
MÜNCHNER PHILHARMONIKER<br />
DAS ORCHESTER DER STADT<br />
Kellerstraße 4, 81667 München<br />
Herausgeber<br />
Direktion der <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />
Presse/Marketing/Jugendprogramm<br />
Tel +49 (0)89/480 98-5100<br />
Fax +49 (0)89/480 98-5130<br />
presse.philharmoniker@muenchen.de<br />
Abonnementbüro<br />
Tel +49 (0)89/480 98-5500<br />
Fax +49 (0)89/480 98-5400<br />
abo.philharmoniker@muenchen.de<br />
Mo – Do 9:30 – 18 Uhr,<br />
Fr 9:30 – 13 Uhr<br />
Einzelkartenverkauf<br />
München Ticket GmbH<br />
Postfach 20 14 13, 80014 München<br />
Tel 0180 54 81 81 8 (€ 0,14 pro Minute*)<br />
(*) aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls<br />
abweichende Preise aus dem Mobilfunk<br />
Fax +49 (0)89/54 81 81 54<br />
Mo – Fr 9 – 20 Uhr,<br />
Sa 9 – 16 Uhr<br />
www.muenchenticket.de<br />
KlassikLine (Kartenverkauf mit Beratung)<br />
Tel 0180 54 81 81 0 (€ 0,14 pro Minute*)<br />
(*) aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls<br />
abweichende Preise aus dem Mobilfunk<br />
Mo – Fr 9 – 18 Uhr<br />
Glashalle im Gasteig<br />
Rosenheimer Str. 5, 81667 München<br />
Mo – Fr 10 – 20 Uhr,<br />
Sa 10 – 16 Uhr<br />
Corporate Identity<br />
ANZINGER | WÜSCHNER | RASP<br />
Agentur für Kommunikation GmbH<br />
Gestaltung dm druckmedien gmbh, München<br />
Gesamtherstellung Color-Offset GmbH,<br />
München<br />
WWW.MPHIL.DE<br />
Anzeigenverkauf und –verwaltung<br />
G.o. MediaMarketing GmbH<br />
Verdistraße 116, 81247 München<br />
office@go-mediamarketing.de<br />
Ansprechpartnerinnen<br />
Angela Großmann<br />
Tel +49 (0)89/89 12 88-0<br />
Fax +49 (0)89/89 12 88-90<br />
a.grossmann@go-mediamarketing.de<br />
Eleonore Weidinger<br />
Tel +49 (0)89/28 15 40<br />
Fax +49 (0)89/28 05 449<br />
eweidinger@t-online.de<br />
Textnachweise:<br />
Jörg Handstein, Nicole Restle und Jakob<br />
Knaus schrieben ihre Texte als Originalbeiträge<br />
für die <strong>Programmheft</strong>e der <strong>Münchner</strong><br />
<strong>Philharmoniker</strong>. Die Wiedergabe der<br />
Gesangstexte der „Glagolitischen Messe“<br />
folgt dem von Janáč ek komponierten altslawischen<br />
Text und einer wörtlichen Übersetzung,<br />
die uns die Universal Edition Wien<br />
zur Verfügung stellte; für umfassende Beratung<br />
und Mitarbeit an der authentischen<br />
Wiedergabe der altslawischen Gesangstexte<br />
danken wir Daniela Burgstaller und Elisabeth<br />
Bezdicek von der Universal Edition Wien.<br />
Leosˇ Janáč eks Text über die Entstehung seiner<br />
„Glagolitischen Messe“ entnahmen wir<br />
dem von Charlotte Mahler übersetzten Band:<br />
Jan Racek und Leo Spies (Hrsg.), Leosˇ Janá -<br />
č eks Feuilletons aus den „Lidové noviny“,<br />
Leipzig 1959. Die lexikalischen Angaben<br />
und Kurzkommentare zu den aufgeführten<br />
Werken redigierte bzw. verfasste Stephan<br />
Kohler. Alle Rechte bei den Autorinnen und<br />
Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der<br />
Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig.<br />
Bildnachweise:<br />
Abbildung zu Wolfgang Amadeus Mozart:<br />
Maximilian Zenger und Otto Erich Deutsch<br />
(Hrsg.), Mozart und seine Welt in zeitgenössischen<br />
Bildern (Neue Mozart-Ausgabe, Serie X:<br />
Supplement, Werkgruppe 32), Basel / London<br />
/ New York 1961. Abbildungen zu Leosˇ Janá -<br />
č ek: Jaroslav Vogel, Leosˇ Janáč ek – Leben<br />
und Werk, Kassel 1958; Leosˇ Janáč ek Gesellschaft,<br />
Zürich.
www.mphil.de