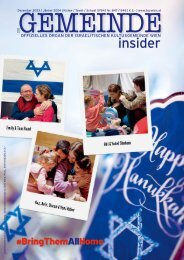Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05<br />
9 120001 135738<br />
DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN<br />
#05 Jg. 6<br />
€ 4,90<br />
Mai 2017<br />
Ijar/Siwan 5777<br />
wina-magazin.at<br />
P.b.b. 11Z039078 W | Verlagspostamt 1010 Wien | ISSN 2307-5341<br />
Tut etwas! Beim March of the<br />
Living wurde ein besonderer Fokus<br />
auf die junge Generation gelegt I 6<br />
Die Met ohne sie ist<br />
nahezu undenkbar<br />
Der Salon der Sissy Strauss I 30<br />
Haltung zeigen Erwin<br />
Steinhauer über Familie, Beruf<br />
und seine Liebe zum Klezmer I 22<br />
DURCH DIE EINZIGARTIGKEIT VEREINT<br />
Gibt es junge jüdische Kunst aus Wien? Eine Ausstellung der Kuratorin ALINE REZENDE<br />
beim „Festival der jüdischen Kultur“ soll diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten
www.wina-magazin.at<br />
Wir stellen ihre Welt<br />
Auf den Kopf<br />
wina Das jüdische Stadtmagazin
Editorial<br />
BU gegenTatesequ<br />
iatenem. Lo mollitat<br />
eum numquo moluptias<br />
exeres aceaquia ditae<br />
culpa qui volor<br />
Stellen sie sich vor, sie drehen in der Früh die Nachrichten<br />
auf und die Welt hat sich plötzlich um 180 Grad<br />
gedreht – ihre Welt hat sich mit einem Schlag völlig verändert.<br />
Von gestern auf heute sind sie nicht mehr Bürger<br />
der Europäischen Union, wird ihrer Universität die<br />
Existenzberechtigung entzogen, wird ihre<br />
persönliche Freiheit durch einen Terroranschlag<br />
beschnitten, oder sie leben plötzlich<br />
in einer Diktatur und in Angst vor Verhaftungswellen.<br />
Stellen Sie sich vor, sie gehen mit Träumen und Plänen<br />
ins Bett und wachen in einem Alptraum auf, die ab nun<br />
ihre Realität ist.<br />
Genauso hat sich die Lebenswirklichkeit hunderttausender<br />
junger Menschen in den letzten Jahren und Monaten<br />
in London, Budapest, Paris,<br />
Berlin oder Istanbul verändert.<br />
Doch wo bleibt die Aufmüpfigkeit,<br />
die transformierende Kraft, der Wille<br />
zur Verteidigung von Freiheit, Vielfalt<br />
und Demokratie jener Generation,<br />
deren Wertesysteme und Zukunftspläne<br />
derzeit von der "weisen"<br />
Elterngeneration, von der mittlerweile,<br />
nicht nur am Haupthaar, ergrauten<br />
politischen Elite zerstört und<br />
verunmöglicht wird? Welche politische<br />
Mittel und künstlerische Formen<br />
machen sie sich zu Nutzen in<br />
Zeiten von Facebook, Instagram und<br />
Snapchat um ihre Zukunft zu sichern<br />
und mitzugestalten?<br />
Wir haben in diesem Heft einige von ihnen versammelt.<br />
Wie die beiden rebellischen Jungs in der jüdischen<br />
Hochschülerschaft, die manchmal vielleicht zu kritisch,<br />
aber ganz sicher hochpolitisch und herzerwärmend sozial<br />
sind. Wie die jungen jüdischen Künstler, die im Rahmen<br />
einer Ausstellung beim Festival der jüdischen Kultur<br />
ihre Welten zeigen. Oder wie jene Jugendliche, die<br />
auf der March of the Living die Grauen der Vergangenheit<br />
erspürten um von dort den Auftrag mitzunehmen,<br />
etwas zu tun, denn die Zukunft – der Freiheit, des Friedens,<br />
der Menschenrechte – liegt in ihren Händen.<br />
Alles junge Menschen, die ethnisch, kulturell, religiös<br />
und politisch unterschiedlich sozialisiert sind und hier<br />
ihre Heimat gefunden haben. Und darin liegt auch ihre<br />
Stärke: in ihrer Buntheit, in ihrem respektvollen, interessierten<br />
und achtsamen Umgang mit der Vielfalt unserer<br />
Weltengemeinschaft. Und mit dieser Stärke werden<br />
ihre Träume, ihre Pläne für die Zukunft sicherlich wahr.<br />
Julia Kaldori<br />
„Aber wie sieht<br />
eine Brasilianerin<br />
aus? Eine<br />
Sambatänzerin?<br />
Ein Fußballspieler?<br />
Das sind<br />
Stereotypen. Jeder<br />
Mensch könnte<br />
Brasilianer sein.“<br />
Aline Rezende<br />
© Xxxxxxx<br />
wına-magazin.at<br />
1
S. 08<br />
Martina Steer betreibt Erinnerungsforschung<br />
an der Universität<br />
Wien – ihr Fachgebiet ist jüdische<br />
Geschichte der Neuzeit.<br />
INHALT<br />
„Antisemitismus<br />
ist nicht jüdische<br />
Geschichte –<br />
das ist eher die<br />
Geschichte<br />
der Antisemiten.“<br />
Martina Steer<br />
IMPRESSUM:<br />
Medieninhaber (Verlag):<br />
JMV – Jüdische Medien- und Verlags-<br />
GmbH, Seitenstettengasse 4,<br />
1010 Wien<br />
Chefredaktion: Julia Kaldori,<br />
office@jmv-wien.at<br />
Redaktion/Sekretariat:<br />
Inge Heitzinger (T. 01/53104–271)<br />
Anzeigenannahme:<br />
Manuela Glamm (T. 01/53104–272)<br />
Redaktionelle Beratung:<br />
Matthias Flödl<br />
Artdirektion: Noa Croitoru-Weissmann<br />
Mitarbeit: Sebestyén Fiumei<br />
Lektorat: Angela Heide<br />
Druck: AV+Astoria Druckzentrum<br />
GmbH, Wien<br />
POLITIK<br />
06 March of the Living<br />
Beim March of the Living 2017<br />
wurde ein besonderer Fokus auf<br />
die Geschichtsvermittlung an<br />
junge Generationen gelegt.<br />
08 „Blick auf starke jüdische Frauen“<br />
Martina Steer befasst sich mit jüdischer<br />
Geschichte der Neuzeit und<br />
betreibt Erinnerungsforschung an<br />
der Universität Wien.<br />
10 Ungarische Medienlandschaft<br />
Die Freunde Orbáns teilen sich den<br />
medialen Kuchen ungeniert auf.<br />
Widerstand gibt es nur vereinzelt –<br />
und dann meist auf Onlineportalen.<br />
12 Drucken in 3D<br />
Auch Apple-Chef Steve Jobs hat sich<br />
bei der Entwicklung des iPhones auf<br />
israelische 3D-Drucker verlassen.<br />
14 Eine Ansichtssache<br />
Digitale Landkarten bestimmen<br />
unsere Sicht auf die Welt. Wir sprechen<br />
mit Alex Gekker, Experte für<br />
neue Medien und digitale Kultur.<br />
S. 51<br />
Die Tik aus Patras.<br />
Thora-Rollen werden zum Schutz und als<br />
Ausdruck der Heiligung schön „angezogen“.<br />
GESELLSCHAFT<br />
19 Es war nicht immer einfach<br />
Das bewegte Leben einer starken<br />
Frau. Gerti Schächter erzählt zwischen<br />
Bridge und Fleischlaberln.<br />
20 MenTschen<br />
Der Strategie- und Kommunikationsberater<br />
Daniel Kapp war längstdienender<br />
Ministersprecher der österreichischen<br />
Bundesregierung.<br />
22 „Man muss Haltung zu zeigen“<br />
Über die jüdische Mischung in seiner<br />
Familie und seine Liebe zur Klezmer-<br />
Musik erzählt der beliebte Kabarettist<br />
und Schauspieler Erwin Steinhauer.<br />
26 Rebellische Studierende<br />
Eine junge jüdische politische Stimme<br />
habe in Wien bisher gefehlt, meinen<br />
die beiden neuen Leiter der Jüdischen<br />
Österreichischen HochschülerInnen.<br />
28 Ein Schatz im Ungeheuer<br />
Die architektonischen Schandflecken<br />
aus den Siebzigerjahren sind in Tel<br />
Aviv nicht zu übersehen.<br />
30 „Die Netrebko bei uns treffen“<br />
Opernliebhaberin Sissy Strauss hat ihren<br />
New Yorker Künstlersalon in ihre<br />
Geburtsstadt Wien verpflanzt.<br />
34 Süßes aus der Manufaktur<br />
In der Wiener Chocolaterie Fabienne<br />
bieten Vater Yoram Hess und sein<br />
Sohn Jonathan handgemachte belgische<br />
Pralinen an.<br />
36 Kauftempel und Gemüseplantage<br />
Mit Urban Farming wird auch in<br />
Israel bereits fleißig experimentiert,<br />
die Technologien sind vielfältig und<br />
überraschend einfach.<br />
2 wına | Mai 2017
KULTUR<br />
42 Einzigartig und verschieden<br />
Aline Rezende kuratiert eine Ausstellung<br />
mit jungen Wiener jüdischen Künstlern<br />
beim Festival der jüdischen Kultur.<br />
45 Dattelpalme und Dattelpalmer<br />
In seinem neuen Buch hat der große<br />
Erzähler Meir Shalev die Natur selbst<br />
zu seiner Heldin gemacht.<br />
46 Ein imaginärer Davidstern<br />
Im Zentrum Badens erinnert ein neues<br />
Mahnmal an die Opfer des Nationalsozialismus.<br />
48 Das Jerusalem des Nordens<br />
„Messieurs, mir scheint, wir sind in<br />
Jerusalem“, sagte Napoleon, als er<br />
einst Wilna betrat. Nun ist ein Porträt<br />
dieser Stadt erschienen.<br />
50 Die neue Odyssee<br />
Der britische Journalist Patrick Kingsley<br />
hat sich den Flüchtlingstrecks angeschlossen<br />
und nun ein Reportagebuch<br />
darüber vorgelegt.<br />
52 Jesus und „die Juden“<br />
Die schlüssigen Analysen der Passionsgeschichte<br />
des deutsch-israelischen Starjuristen<br />
Chaim Cohn wurden neu aufgelegt.<br />
„Hunderte<br />
Generationen<br />
von Juden<br />
sind für ein Verbrechen<br />
bestraft worden, das weder<br />
sie noch ihre Vorfahren<br />
begangen haben.“<br />
Chaim Cohn<br />
S. 52<br />
WINA ONLINE:<br />
wina-magazin.at<br />
facebook.com/winamagazin<br />
Coverfoto: Aline Rezende, © Anna Goldenberg<br />
WINASTANDARDS<br />
01 Editorial<br />
04 WINA_Wirtschaft & Politik<br />
Österreich, Israel, Europa<br />
05 WINA_Kommentar<br />
Doron Rabinovic über Zentren<br />
für Israel-Studien<br />
16 Nachrichten aus Tel Aviv<br />
Die Jugend misstraut Institutionen<br />
18 WINA_Gesellschaft<br />
Städte, Menschen, Leben<br />
25 WARUM WIEN<br />
Autorin Schulamit Meixner<br />
38 WINA_Feinspitz<br />
Kräutlein auf und in der Suppe<br />
39 Matok & Maror<br />
Vegetarisches Soulfood im Naches<br />
40 Generation unverhofft<br />
Daliah Dombrowski ist abenteuerlustig<br />
41 WINA_Kultur<br />
Musik, Ausstellungen, Film<br />
51 WINA_Werk-Städte<br />
Der Tik aus Patras<br />
54 Urban Legends<br />
Paul Divjak in der Riesenbubble<br />
55 WINA_KulturKalender<br />
Festival der jüdischen Kultur 2017<br />
56 Das letzte Mal<br />
Regisseurin Mirjam Unger<br />
„Man muss<br />
sich gegen den<br />
rechten Zeitgeist<br />
wehren,<br />
man muss<br />
Farbe bekennen<br />
und Zivilcourage<br />
haben.“<br />
Erwin Steinhauer<br />
S. 22<br />
Erwin Steinhauer: der<br />
beliebte Kabarettist und<br />
Schauspieler über die<br />
jüdische Mischung in<br />
seiner Familie, seinen<br />
Entdecker Gerhard<br />
Bronner und seine Liebe<br />
zur Klezmer-Musik.<br />
wına-magazin.at<br />
3
Null Toleranz für<br />
Antisemitismus<br />
Der Antisemitismusbericht 2016 wurde<br />
gemeinsam von IKG-Präsident Oskar Deutsch<br />
und BM Sebastian Kurz präsentiert<br />
Was es braucht, ist Bewusstsein in der<br />
Bevölkerung, dass Antisemitismus<br />
kein Kavaliersdelikt ist“, erklärte Bundesminister<br />
für Europa, Integration und Äußeres<br />
Sebastian Kurz bei der Präsentation<br />
des Antisemitismusberichts 2016, zusammengestellt<br />
vom Forum gegen Antisemitismus<br />
(FGA). Der Antisemitismusbericht<br />
wird seit dem Jahr 2000 jährlich vom FGA<br />
herausgegeben und dokumentiert sämtliche<br />
Fälle von Antisemitismus innerhalb eines<br />
Jahres in Österreich.<br />
Laut Bericht wurden 2016 insgesamt 477<br />
Fälle von Antisemitismus in Österreich vermeldet,<br />
das sind um 12 mehr als im Jahr<br />
2015, ein leichter Anstieg im Vergleich zum<br />
Vorjahr. Als eindeutiger Trend ist aber der Anstieg<br />
bei Hasspostings in sozialen Medien<br />
und bei tätlichen Angriffen zu beobachten.<br />
Über die Beweggründe der Vorfälle Aussagen<br />
zu treffen, ist schwierig, denn nur<br />
etwa 41 % davon lassen sich eindeutig bestimmten<br />
Ideologien zuordnen – davon<br />
sind 28 % rechts-, 9 % islamistisch- und<br />
4 % linksorientiert.<br />
„Wir brauchen mehr denn je klare Zeichen“,<br />
sagte BM Kurz und fordert gemeinsam mit<br />
Präsident Deutsch verstärkte Bemühungen<br />
im Bildungsbereich und bei der Integration,<br />
Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung<br />
und die Übernahme der Arbeitsdefinition<br />
von Antisemitismus der International Holocaust<br />
Remembrance Alliance durch das<br />
österreichische Parlament, um der Justiz<br />
eindeutige Grundlagen für die Verfolgung<br />
antisemitischer<br />
Antisemitismusbericht<br />
2016. Amber Weinber (FGA),<br />
Präsident Oskar Deutsch<br />
und BM Sebastian Kurz.<br />
© Tatic/BMEIA<br />
4 wına | Mai 2017<br />
Vorfälle zu geben.<br />
Dies wurde<br />
Ende April auf Initiative<br />
von Bundesminister<br />
Kurz<br />
im Ministerrat<br />
bereits beschlossen<br />
und wird nun<br />
im Parlament zur<br />
Prüfung vorgelegt.<br />
red.<br />
50<br />
POLITIK & WIRTSCHAFT<br />
Juden sollen derzeit noch im kriegszerrissenen<br />
Jemen leben. Es gibt<br />
keine genauen Angaben über ihren Verbleib,<br />
vermutet wird, dass sie auf einem<br />
Grundstück in der Nähe der US-<br />
Botschaft in Sanaa leben. Die letzte<br />
Gruppe jemenitischer Juden traf<br />
im Rahmen einer geheimen<br />
Operation im März 2016<br />
in Israel ein.<br />
WINAWISSENSCHAFT<br />
HOFFNUNG FÜR BRUST-<br />
KREBSPATIENTINNEN<br />
Die israelische Firma Dune Medical<br />
Devices hat ein Instrument<br />
entwickelt, das die Wahrscheinlichkeit<br />
für eine erneute Operation<br />
nach einer Brustkrebs-OP deutlich<br />
reduziert. Es handelt sich dabei<br />
um eine Art Pen, der einem Ultraschallsensor<br />
ähnlich sieht und<br />
Signale an das entnommene Ge<strong>web</strong>e<br />
sendet. Dieser wird bereits<br />
in den USA und Israel eingesetzt.<br />
Damit wird eine unmittelbare<br />
histologische Untersuchung des<br />
entnommenen Ge<strong>web</strong>es noch<br />
im Operationssaal ermöglicht. So<br />
soll sichergestellt werden, dass<br />
das den Tumor umgebende Ge<strong>web</strong>e<br />
frei von Tumorzellen ist. Bislang<br />
konnte diese Untersuchung<br />
nur zeitversetzt vorgenommen<br />
werden. Die Hochfrequenztechnologie,<br />
die der nun entwickelte<br />
Sensor verwendet, könne die<br />
elektrischen Eigenschaften der<br />
Zellen innerhalb von Sekunden<br />
erfassen, erklärt Gal Aharonovitz,<br />
CEO von Dune Medical Devices.<br />
In klinischen Studien sank damit<br />
die Zahl der Patientinnen, die erneut<br />
operiert werden mussten,<br />
um 51 %; Kliniken, die das Gerät<br />
bereits einsetzen, sprechen von<br />
80 % weniger Folge-OPs. red.<br />
Working Holiday<br />
Ab Mai können junge Erwachsene aus<br />
Österreich und Israel am bilateralen<br />
Working-Holiday-Programm partizipieren<br />
Die Working-Holiday-Programme sind<br />
bilaterale Übereinkommen, die jungen<br />
ÖsterreicherInnen im Alter von 18 bis<br />
30 einen Auslandsaufenthalt für ein halbes<br />
Jahr samt Arbeitserlaubnis ermöglichen.<br />
Mit insgesamt sechs solcher Abkommen,<br />
u. a. auch mit Neuseeland,<br />
Japan und Taiwan, befindet sich Österreich<br />
im europäischen Spitzenfeld, weitere<br />
Länder sollen folgen.<br />
Das Abkommen mit Israel wurde letztes<br />
Jahr bei einem Arbeitsbesuch in Jerusalem<br />
von PM Netanjahu und BM Kurz unterzeichnet<br />
und tritt ab Mai in Kraft. „Ich<br />
bin sehr glücklich, dass das Working-Holiday-Abkommen<br />
nun in Kraft tritt. Es bietet<br />
eine einzigartige Möglichkeit für die jungen<br />
Generationen unserer beiden Länder,<br />
einander kennenzulernen“, freut sich Botschafterin<br />
Talya Lador-Fresher über die erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit. Denn das Programm<br />
basiert auf Gegenseitigkeit und gibt<br />
auch jungen Israelis die Möglichkeit, ein<br />
halbes Jahr bewilligungsfrei in Österreich<br />
zu arbeiten. red.<br />
Nähere Infos: bmeia.gv.at<br />
© Jemen:Joker / SZ-Photo / picturedesk.com; Working Holiday: Tatic/BMEIA
WINA KOMMENTAR<br />
Ein Gespür für<br />
Zwischentöne<br />
Weltweit existieren seit vielen Jahren Zentren für Israel-<br />
Studien, wichtige Forschungs- und Vermittlungseinrichtungen,<br />
in denen die langfristige intensive Auseinandersetzung mit der<br />
Kultur dieses Landes im Fokus steht. Doch in Österreich wartet<br />
man noch vergeblich auf ein Institut dieser Art.<br />
manchen Ländern gibt es sie bereits:<br />
Zentren für Israel-Studien. Es mag einen<br />
nicht verwundern, wenn sie in den Vereinigten<br />
Staaten von Amerika bereits seit<br />
RabinoviciIn Längerem existieren. In New York finden<br />
sich gar vier verschiedene Lehrstühle<br />
und Institutionen, die eigene Vorlesungen zu Israel<br />
anbieten. Aber selbst im Ramallah der palästinensischen<br />
Autonomiebehörde nimmt sich ein<br />
Palestinian Forum for Israeli Studies, MADAR,<br />
seit dem Jahr 2000 dieser Aufgabe an. In Kanada,<br />
dem Vereinigten Königreich, Russland, Australien<br />
und Deutschland widmen sich universitäre Institute<br />
dem Judenstaat, um ihn jenseits der Klischees<br />
wahrzunehmen. Nicht die Aktualität und nicht das<br />
Akute stehen dabei unbedingt im Vordergrund. Israel<br />
ist nicht nur der Konflikt darum.<br />
An der Münchner Universität wurde 2015 ein<br />
Zentrum für Israel-Studien eröffnet. Es beschäftigt<br />
sich mit den vielseitigen Gesellschaften des<br />
jungen Staates. Organisatorisch eingebettet ist es<br />
in der Abteilung für jüdische Geschichte und Kultur.<br />
In Wien agiert das Centre for Israel Studies,<br />
zu dessen Vorstand sich auch der Autor dieser Zeilen<br />
zählen darf, seit 2013 – wenn auch leider noch<br />
nicht universitär verankert.<br />
Warum jedoch nicht? Es gibt schließlich auch die<br />
Fachrichtung der Anglistik, der Amerikanistik und<br />
der Japanologie. Die eigene Annäherung an Israel<br />
ist zudem von besonderer Bedeutung. Dieses Land<br />
kann nicht im Rahmen einer allgemeinen Auseinandersetzung<br />
mit dem Nahen Osten ergründet<br />
werden, weil es in diesem Gebiet allzu oft bloß als<br />
Feind und als blinder Fleck behandelt wird. Israel<br />
wird zuweilen nur als künstliches Gebilde oder als<br />
Stützpunkt des westlichen Imperialismus betrachtet.<br />
Eine Erforschung dieser Gesellschaft zu unterstützen,<br />
bedeutet, die Existenz der israelischen Nation<br />
anzuerkennen.<br />
Von Doron<br />
Aber in Deutschland und in Österreich geht es<br />
um noch mehr: Israel ist der Staat, der auch von<br />
jenen und für jene Juden gegründet wurde, die der<br />
Vernichtung entrinnen konnten. Israel ist nicht<br />
in, doch aus Europa. Israelische und österreichische<br />
Vergangenheit sind miteinander unentwirrbar<br />
verbunden. Die Gegenwart beider Länder ist<br />
weiterhin miteinander verstrickt. Die Auseinandersetzung<br />
mit Israel nicht zu wagen, heißt letztlich,<br />
jener mit den historischen Kontinuitäten hierzulande<br />
auszuweichen.<br />
Hinzu kommt, dass die wissenschaftliche Perspektive<br />
sich den herkömmlichen dogmatischen<br />
Voreingenommenheiten verweigert. Bekanntlich<br />
gibt es eine Kampagne, die den Boykott israelischer<br />
Forscher, Künstler oder Autoren fordert. Zugleich<br />
Eine Erforschung dieser<br />
Gesellschaft zu unterstützen,<br />
bedeutet, die Existenz der israelischen<br />
Nation anzuerkennen.<br />
wollen andere – wiederum aus verschiedenen dogmatischen<br />
Gründen – manche israelischen Koryphäen<br />
gar nicht zu Wort kommen lassen, weil sie<br />
ihnen aus Wiener Sicht nicht israelisch scheinen.<br />
So sehen sich die sensibelsten Geister im Judenstaat<br />
immer wieder einer doppelt grobschlächtigen<br />
Ignoranz gegenüber.<br />
Umso wichtiger sind solche Zentren, in denen<br />
den Studien über israelische Kunst, Filme, Literatur,<br />
Soziologie oder Geschichte nachgegangen<br />
wird, denn sie schärfen das Gespür für die Zwischentöne,<br />
die einen auch den blutigen Konflikt<br />
um dieses Land besser begreifen lassen. <br />
wına-magazin.at<br />
5
MARCH OF THE LIVING<br />
TUT<br />
ETWAS!<br />
Beim diesjährigen March of the Living wurde<br />
ein besonderer Fokus auf Schüler und<br />
Bildung gelegt – Schulen und Universitäten<br />
die Geschichte des Holocaust und das<br />
Erinnern in aller Bestimmtheit vermitteln.<br />
Text: Margaretha Kopeinig<br />
In der Tempel-Synagoge, der ältesten<br />
von Krakau, war die Atmosphäre<br />
einen Tag nach dem March<br />
of the Living mehr als gelöst. Oberkantor<br />
Shmuel Barzilai sang jüdische Lieder<br />
von Frieden und Versöhnung, und es<br />
gelang ihm sowie zwei Musikern, die Jugendlichen<br />
aus Österreich wie bei einem<br />
Popkonzert mitzureisen. Der Tempel war<br />
übervoll, die Schülerinnen und Schüler<br />
sangen lautstark mit, klatschten begeistert<br />
in die Hände und tanzten leidenschaftlich.<br />
„Das ist das Schönste an unserer<br />
Reise nach Auschwitz und Birkenau“,<br />
freut sich Johanna, die 16-jährige Gymnasiastin<br />
aus Niederösterreich. Barzilai<br />
nimmt den Schülern die dunklen Emotionen<br />
und die Trauer, die sich nach dem<br />
Anblick der Baracken, der Gaskammern,<br />
der Krematorien in ihr Denken und Fühlen<br />
geschlichen hat. „Es ist für mich unfassbar,<br />
wie viel Böses Menschen anderen<br />
Menschen antun können“, sagt ein 17-jähriger<br />
Wiener.<br />
Österreichische Schüler waren in diesem<br />
Jahr beim March of the Living aus<br />
Anlass des internationalen Holocaust-Gedenktages<br />
besonders zahlreich vertreten.<br />
Mehr als 560 Jugendliche aus 13 Gymnasien<br />
reisten mit ihren Lehrern nach Polen,<br />
um am 24. April mit mehr als Zehntausend<br />
Menschen aus der ganzen Welt, darunter<br />
noch zahlreiche Überlebende und<br />
Zeitzeugen, an die von den Nazis ermordeten<br />
Juden zu erinnern.<br />
Dass in diesem Jahr der Fokus beim<br />
March of the Living auf Schüler und auf<br />
IKG-Präsident Oskar Deutsch<br />
und Unterrichtsministerin<br />
Sonja Hammerschmid trafen<br />
auch den israelischen Unterrichtsminister<br />
Naftali Bennett<br />
Bildung gelegt wurde, geht auf die Initiative<br />
des Präsidenten der Israelitischen<br />
Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch,<br />
zurück. Er führte die österreichische Delegation<br />
an, und gemeinsam mit Unterrichtsministerin<br />
Sonja Hammerschmid<br />
gelang es ihm, zwölf Bildungsminister aus<br />
EU-Staaten, den zuständigen Ressortchef<br />
aus Israel, Naftali Bennett, und hohe<br />
Vertreter verschiedener Institutionen, darunter<br />
die Generaldirektorin für Bildung<br />
und Kultur der EU-Kommission, Martine<br />
Reicherts, für den Plan zu gewinnen, das<br />
Wissen um den Völkermord an Juden und<br />
Angehörigen von Minderheiten im Unterricht<br />
zu vertiefen. „Das wichtigste Signal<br />
ist, dass wir gemeinsam hier sind, um<br />
Seite an Seite gegen das Vergessen und für<br />
ein friedliches Zusammenleben zu marschieren“,<br />
erklärten Hammerschmid und<br />
Deutsch unisono.<br />
Hammerschmid kündigte an, die Lehrerfortbildung<br />
in Hinblick auf den Holocaust<br />
zu intensivieren, entsprechende Unterrichtsmaterialien<br />
zu erarbeiten und eng<br />
mit der IKG zu kooperieren. „Es geht darum,<br />
in unseren Schulen und Universitäten<br />
die Geschichte des Holocaust und das<br />
Erinnern in aller Bestimmtheit zu vermitteln,<br />
damit die zukünftigen Generationen<br />
die Wurzeln des Nationalsozialismus verstehen,<br />
künftige Entwicklungen in unserer<br />
Gesellschaft genau beobachten und sich<br />
mutig Hass, Diskriminierung und Rassismus<br />
entgegenstellen“, betonte Hammerschmid.<br />
Für sie ist die Zunahme antisemitischer<br />
Vorfälle an Österreichs Schulen,<br />
wie das der Antisemitismusbericht 2016 beweist,<br />
„ein Alarmsignal. Wir sehen auf vie-<br />
© Jenny Mitbreit<br />
6 wına | Mai 2017
SCHÜLER IN AUSCHWITZ<br />
© Alik Keplicz / AP / picturedesk.com<br />
len Ebenen, dass Radikalisierung, Extremismus<br />
und Populismus zunehmen. Es<br />
gilt verstärkt auf diese Phänomene hinzuschauen.“<br />
Auch die Sorge, dass immer<br />
mehr Menschen in sozialen Netzwerken<br />
den Massenmord der Nazis an den europäischen<br />
Juden leugnen und den Holocaust<br />
bestreiten, nimmt sie ernst.<br />
Wie groß das Interesse an Österreich<br />
ist, zeigt auch die Frage des israelischen<br />
Bildungsministers Bennett, der seine<br />
Amtskollegin beim Besuch des jüdischen<br />
Friedhofs in Krakau neugierig fragte, ob<br />
„die Schoah im österreichischen Curriculum<br />
vorkommt“.<br />
Eines wurde beim March of the Living<br />
sehr klar: Die Position von Unterrichtsministerin<br />
Hammerschmid und die<br />
Initiative von IKG-Präsident Deutsch<br />
fanden enormen Anklang. „Das ist das<br />
neue Österreich, das wir schätzen und<br />
gerne haben“, erklärte spontan nach dem<br />
March of the Living der Vertreter der jüdischen<br />
Gemeinde von Madrid, David<br />
Hatchwell Altaras.<br />
An dem Gedenken an die Schoah<br />
wurde aber auch eines sehr bewusst: Die<br />
Zahl der Überlebenden und Zeitzeugen<br />
wird jährlich kleiner. In Israel gibt es nach<br />
Angaben des Finanzministeriums noch<br />
160.000 Überlebende, wie viele es weltweit<br />
sind, ist nicht bekannt. In Österreich<br />
Es ist nicht selbstverständlich,<br />
„in einer<br />
demokratischen,<br />
freien Gesellschaft<br />
zu leben. Wir müssen<br />
tagtäglich dafür<br />
kämpfen.“<br />
Sonja Hammerschmid,<br />
Unterrichtsministerin<br />
ist Marko Feingold, der Ende Mai seinen<br />
104. Geburtstag feiert, der älteste Holocaust-Überlebende.<br />
Und wie alle Jahre<br />
zuvor nahm er auch diesmal wieder am<br />
March of the Living teil. Hunderte österreichische<br />
Schüler saßen auf der Wiese<br />
und hörten ihm aufmerksam zu, als er mit<br />
kräftiger Stimme über sein Überleben in<br />
drei Konzentrationslagern berichtete –<br />
und eine Einschätzung der aktuellen politischen<br />
Lage gab. Sein Ton war warnend.<br />
Eine Gruppe junger kanadischer Juden, die<br />
vorbeikamen, blieben stehen und lauschten<br />
den Worten von Feingold: „Wow, das<br />
ist ein cooler Typ“, sagten gleich mehrere.<br />
Auch Viktor Klein aus Wien, beinahe<br />
90 Jahre alt, hat Auschwitz überlebt. Auch<br />
Schüler in Auschwitz<br />
und Birkenau.<br />
Zukünftige Generationen<br />
sollen die Wurzeln<br />
des Nationalsozialismus<br />
verstehen lernen<br />
und sich mutig Hass,<br />
Diskriminierung und<br />
Rassismus entgegenstellen.<br />
er nahm am Marsch teil.<br />
Seine große Angst derzeit<br />
ist „die Zunahme an Nationalismus“.<br />
Immer wieder wiesen<br />
die Überlebenden<br />
da-rauf hin, dass die Zeit<br />
bald kommen werde, in<br />
der es keine Überlebenden<br />
mehr gebe. „Wenn der Letzte von uns<br />
gegangen ist, können wir auf die jungen<br />
Leute zählen“, hofft Shmuel Rosenman,<br />
der Vorsitzende des March of the Living.<br />
Auch IKG-Präsident Oskar Deutsch<br />
weiß das: „Auschwitz zu erleben, ist eine<br />
starke emotionale Erfahrung für Juden und<br />
Nicht-Juden“, fasst er die Eindrücke zusammen.<br />
Ihm geht es darum, dass „Lehrer<br />
und Schüler diese Erfahrungen mit nach<br />
Hause tragen und verstehen, dass am Ende<br />
Menschlichkeit die Grausamkeit besiegt.<br />
Das ist heute die Botschaft von Auschwitz.“<br />
Er verbindet das aber auch mit einem<br />
Wunsch an die Jungen: „Tut etwas!“,<br />
lautet seine Aufforderung. „Die Zukunft<br />
liegt in euren Händen.“<br />
Essenziell findet die SPÖ-Politikerin<br />
Sonja Hammerschmid, dass Schüler und<br />
Lehrer begreifen, dass es nicht „selbstverständlich<br />
ist, in einer demokratischen,<br />
freien und offenen Gesellschaft zu leben.<br />
Wir müssen tagtäglich dafür kämpfen“,<br />
betont die Bildungsministerin. <br />
wına-magazin.at<br />
7
ERINNERUNGSFORSCHUNG<br />
„Ein klarer Blick auf<br />
starke jüdische<br />
Frauen“<br />
Die aus München zugewanderte Historikerin<br />
Martina Steer befasst sich mit jüdischer<br />
Geschichte der Neuzeit und betreibt Erinnerungsforschung<br />
an der Universität Wien.<br />
Von Marta S. Halpert<br />
Wenn du nach Wien gehst,<br />
enterbe ich dich“, dekretierte<br />
die Großmutter in<br />
München ziemlich resolut.<br />
„Sie hat das auch strikt durchgezogen“,<br />
lacht Enkelin Martina Steer heute darüber.<br />
Aber etwas Verletzendes, Wehmütiges<br />
klingt da noch mit. Eine Schachtel<br />
mit Schmähbriefen hat die nicht weniger<br />
entschlossene Martina aus dem Nachlass<br />
der geliebten Oma dann doch an sich genommen.<br />
„Sie kam aus Budapest nach<br />
Oberbayern, wo sie den Großteil ihres Lebens<br />
verbrachte. Trotz der antisemitischen<br />
Briefe, die sie als Geschäftsfrau jahrelang<br />
gesammelt hatte, war sie überzeugt, dass es<br />
in Wien noch schlimmer sei“, erzählt die<br />
Historikerin, die seit 2010 jüdische Geschichte<br />
der Neuzeit an der Universität<br />
lehrt und Erinnerungsforschung betreibt.<br />
Der Diskurs mit der Großmutter fand<br />
im Jahre 2000 statt, als die in Landshut<br />
in Niederbayern geborene Wissenschafterin<br />
wegen ihres Doktorvaters nach Wien<br />
zog, um hier ihre Dissertation zu verfassen.<br />
„Vier Tage vor meinem Rigorosum ist<br />
sie gestorben“, erzählt die zweifache Mutter.<br />
Doch bevor sie in Wien mit ihrer Familie<br />
sesshaft wurde, arbeitete die Historikerin<br />
an ihrer vielfältigen akademischen<br />
Karriere, die sie in Kürze mit ihrer Habilitation<br />
krönen wird.<br />
Wie aber kam es zur Entscheidung für<br />
das Studienfach „Jüdische Geschichte der<br />
Neuzeit“? „Grundsätzlich studierte ich in<br />
München Geschichte, aber bereits während<br />
des ersten Semesters wurden verschiedene<br />
Referatsthemen zur jüdischen<br />
Geschichte Europas angeboten, und das<br />
hat mich interessiert“, erzählt Steer, die<br />
daraufhin die Geschichte der Juden in<br />
Landshut im Mittelalter erforschte. „Ein<br />
wenig Hebräisch konnte ich aus dem Religionsunterricht,<br />
und je mehr ich gelesen<br />
habe, umso mehr bin ich in das Thema hineingewachsen.“<br />
Bald darauf ging sie nach<br />
Berlin, anschließend ein Jahr nach Rotterdam,<br />
um dann an die Ludwig-Maximilians-Universität<br />
in München zurückzukehren.<br />
„Mit Professor Michael Brenner<br />
hatte ich einen sehr guten Betreuer für<br />
meine Masterarbeit über die jüdische Philosophin<br />
Margarete Susman (1872–1966),<br />
die sich auch mit Frauenemanzipation beschäftigt<br />
hatte.“ Durch Zufall stieß Steer<br />
auf einen Artikel über Susman, deren Leben<br />
und Schaffen sie gleichermaßen faszinierten.<br />
„Es kamen bei dieser Essayistin<br />
und Poetin so viele verschiedene intellektuelle<br />
Strömungen während der Weimarer<br />
Republik zusammen, dass ich sie unbedingt<br />
näher kennenlernen wollte.“ Doch<br />
die Historikerin begnügte sich nicht mit<br />
dem Porträt einer einzigen großen jüdischen<br />
Frau: Sie verfasste auch die Biografie<br />
von Bertha Badt-Strauss (1885–1970),<br />
einer überzeugten Zionistin und streng religiös<br />
lebenden deutschen Jüdin. Bertha<br />
Badt stammte aus einem Haus jüdischer<br />
Gelehrter und promovierte 1908 in Berlin<br />
als erste Frau an der philosophischen<br />
Fakultät. Nach dem Ersten Weltkrieg begann<br />
sie, über jüdische Themen zu schreiben,<br />
und wurde zu einer der produktivsten<br />
und bekanntesten Publizistinnen im Berlin<br />
der Zwischenkriegszeit. „Ich bin mit<br />
starken, dominanten Frauen aufgewach-<br />
sen, die die Geschicke ihrer Familie in<br />
weiten Teilen bestimmt haben“, schmunzelt<br />
Steer, „vielleicht rühren die Faszination<br />
und das Interesse daher.“<br />
Kein homogenes Kollektiv Bevor<br />
Martina Steer Lehraufträge und den Assistentinnenposten<br />
am Institut für Geschichte<br />
an der Universität Wien annahm,<br />
war sie u. a. an der Europäischen Universität<br />
in Florenz, am German Historical Institute<br />
in Washington sowie an der Universität<br />
Breslau und dem Simon Dubnow<br />
Institut in Leipzig tätig. „Neben meinen<br />
jüdischen Themen mache ich europäische<br />
und transnationale Geschichte. Wirklich<br />
aufregend und interessant sind – in Zeiten<br />
wie diesen – die Sommer- und Winterseminare<br />
in Lemberg und Kiew. Die habe<br />
ich mit einem ukrainischen Kollegen im<br />
Auftrag der Open Society Foundation für<br />
junge Kulturwissenschaftler aus ehemaligen<br />
Sowjetstaaten organisiert.“ Übersetzer<br />
benötigt die umtriebige Wissenschafterin<br />
nicht, denn sie spricht mehrere Sprachen,<br />
darunter Italienisch, Holländisch und natürlich<br />
Jiddisch und Hebräisch.<br />
„Das Projekt, das ich gerade abschließe,<br />
beschäftigt sich mit Moses-Mendelssohn-<br />
Jubiläen in Deutschland, Polen, Israel und<br />
den USA. Natürlich auch im Habsburgerreich,<br />
da habe ich wunderbare jiddische<br />
Texte aus Galizien und Predigten<br />
von Adolf Jellinek aus Wien gefunden“,<br />
erzählt die Bayerin, die als Jugendliche<br />
die Bücher von Christine Nöstlinger<br />
verschlungen hatte. Für die Forscherin<br />
stellt der 1729 in Dessau geborene Philosoph<br />
der Aufklärung und Wegbereiter<br />
der Has kala einen bedeutenden Referenzpunkt<br />
in der Vergangenheit dar, weil<br />
er eine starke identitätsstiftende Wir-<br />
8 wına | Mai 2017
JÜDISCHE GESCHICHTE<br />
© Reinhard Engel<br />
die getauften Nachfahren<br />
Mendelssohns überhaupt<br />
auszublenden. Etwas<br />
später wurde man<br />
offener, und Musikstücke<br />
von Felix Mendelssohn<br />
Bartholdy wurden<br />
auch in Synagogen gespielt“,<br />
berichtet Steer. In<br />
der bisherigen Forschung<br />
hat es eine ganz klare<br />
Ost-West-Trennung gegeben:<br />
In Westeuropa befürworteten die<br />
Juden die Emanzipationsbestrebungen<br />
Mendelssohns, ohne die Jüdischkeit zu<br />
verwässern, im Osten dagegen wurde er<br />
als Sinnbild der Assimilation, der Mischehe<br />
etc. dargestellt.<br />
„Was mich bei Fragen zur jüdischen<br />
Geschichte immer gestört hat, ist, dass<br />
viele dabei nur an die Themen Antisemitismus<br />
und Schoah denken. Natürlich spielt<br />
das eine wesentliche Rolle im jüdischen<br />
Bewusstsein und in der Historie, aber Ankung<br />
auf unterschiedliche<br />
Gruppierungen innerhalb<br />
der jüdischen Gemeinden<br />
ausübte. „Moses Mendelssohn<br />
ist sozusagen ein<br />
wichtiger Erinnerungsort.<br />
Das ist aber keine geografische<br />
Bezeichnung, sondern<br />
eine Metapher für<br />
ein Ereignis oder eine<br />
Person, die über Grenzen<br />
hinweg die Menschen im<br />
positiven oder negativen Sinn beschäftigt<br />
und beeinflusst hat.“ Da die Juden kein<br />
homogenes Kollektiv waren und sind, erinnern<br />
Liberale, Orthodoxe und Zionisten<br />
unterschiedlich, weil sie jeweils auch<br />
andere Ziele mit Mendelssohn verfolgten.<br />
Sowohl aus Büchern und Texten über den<br />
zeitlebens religionsgesetzestreuen Reformer<br />
als auch aus musikalischen Kompositionen<br />
und Feiern lässt sich ablesen, wie<br />
man mit Mendelssohn umgegangen ist.<br />
„Seine Befürworter versuchten zu Beginn,<br />
„Antisemitismus<br />
ist nicht<br />
jüdische Geschichte<br />
– das<br />
ist eher die<br />
Geschichte der<br />
Antisemiten.“<br />
Martina Steer<br />
tisemitismus ist nicht jüdische Geschichte<br />
– das ist eher die Geschichte der Antisemiten“,<br />
entrüstet sich die Historikerin. Es<br />
gebe auch ein modernes jüdisches Kollektivgedächtnis,<br />
das sich nicht zwangsläufig<br />
mit dem Holocaust oder anderen Traumata<br />
beschäftigt. Aber wo und wie findet<br />
heute ein junger jüdischer Mensch, der<br />
kein religiöses oder historisches Wissen<br />
hat, die positiven Erinnerungsorte? „Das<br />
kann Theodor Herzl sein, Gefillter Fisch<br />
oder die Stadt Prag. Israel ist ein gutes Beispiel,<br />
wie man Erinnerungsarbeit machen<br />
kann: Auch die militärische Stärke kann als<br />
Garant des Überlebens positiv besetzt sein<br />
– als Kontrapunkt dazu, dass Juden immer<br />
nur Opfer waren.“<br />
Martina Steer hatte kein Problem, sich<br />
in Wien schnell und gut einzuleben. In ihrer<br />
Lehrtätigkeit an der Universität Wien<br />
war sie weniger mit Antisemitismus konfrontiert<br />
als mit Unwissen und merkwürdigen<br />
Ressentiments. Sprüche wie „Ihr Juden<br />
könnt ja gut mit Geld umgehen“ hat<br />
sie schon serviert bekommen. „Schlimmer<br />
ist, dass Diskussionen oft in eine Israel-Kritik<br />
umschlagen, z. B. wenn von den<br />
‚bösen Besatzern‘ die Rede ist, die ‚von<br />
Amerika finanziert werden‘. Es geht so in<br />
Richtung Dämonisierung“, erzählt Steer.<br />
Das nächste Projekt der Historikerin<br />
wird sich mit der Geschichte der jüdischen<br />
Frauen in der Habsburger-Monarchie<br />
und insbesondere mit jenen in<br />
Galizien im Ersten Weltkrieg beschäftigen.<br />
„Wenn ich mir das Leben der jüdischen<br />
Frauen in Galizien anschaue, eröffnet<br />
das ganz andere Blickweisen auf das<br />
österreichische Judentum insgesamt: In<br />
Lemberg z. B. lebten zumeist bürgerliche<br />
Frauen, die sich intellektuell weiterbilden<br />
konnten. Aber der Großteil der Frauen<br />
lebte im Schtetl in ländlichen Gegenden.<br />
Sie konnten zwar auch schreiben und lesen,<br />
waren aber auf einen gänzlich religiösen<br />
Mikrokosmos eingeschränkt. Sie<br />
hatten die meiste Verantwortung für die<br />
Familie zu tragen.“ Womit Martina wieder<br />
bei starken Frauen angelangt sein wird<br />
– und sich der Kreis zur geliebten Großmutter<br />
erneut schließt. <br />
wına-magazin.at<br />
9
GELENKTE MEDIEN<br />
Medienlandschaft in Ungarn –<br />
neu aufgemischt<br />
Die Freunde Orbáns teilen sich den medialen Kuchen ungeniert auf. Widerstand<br />
gibt es nur vereinzelt – und dann meist auf Onlineportalen.<br />
Von Marta S. Halpert<br />
Der Wille nach absolutem<br />
Machterhalt scheint in<br />
Viktor Orbáns Ungarn<br />
nicht nur kräfteraubend<br />
zu sein, er verdrängt offensichtlich<br />
auch nationale Eigenschaften.<br />
Und das trotz der viel strapazierten nationalistischen<br />
Töne: Der so typische sarkastische<br />
bis selbstironische ungarische<br />
Humor ist der politischen Führungsriege<br />
komplett abhanden gekommen. Auf satirische<br />
Verfälschungen eines Orbán-Interviews<br />
wurde mit unverzüglichen Kündigungen<br />
reagiert. Hier die Vorgeschichte:<br />
In der Weihnachtsausgabe des Fejér Megyei<br />
Hírlap erschien das für alle zwölf regionalen<br />
Mediaworksblätter zentral redigierte<br />
Orbán-Interview mit einigen<br />
erfundenen Zitaten, die ein Unbekannter<br />
eingefügt hatte. Unter anderem wurde<br />
Orbáns Aussage, wonach Ungarn deshalb<br />
ein stabiles Land sei, weil die Regierung<br />
das Volk regelmäßig nach seiner Meinung<br />
befrage, um den frei erfundenen Zusatz<br />
ergänzt: „Obwohl sie uns gar nicht interessiert<br />
hat.“ An einer anderen Stelle wird<br />
Orbán, der dem Christentum eine staatstragende<br />
Funktion in seinem Land zubilligt,<br />
fälschlicherweise in den Mund gelegt:<br />
„Ich wünsche mir, dass immer mehr<br />
Menschen zu einer heidnischen Auffassung<br />
von Weihnachten zurückkehren.“<br />
Die verantwortliche Redakteurin des Fejér<br />
Megyei Hírlap (dem Nachrichtenblatt<br />
des Komitats Fejér) aus Székesfehérvár<br />
wurde ebenso gekündigt wie vier weitere<br />
leitende Mitarbeiter dieser und einer<br />
zweiten Zeitung, wie das Internetportal<br />
Veszprémkukac.hu berichtete.<br />
Ziemlich unappetitlich war die österreichische<br />
Beteiligung an der plötzlichen<br />
Schließung der traditionsreichen, regierungskritischen<br />
ungarischen Tageszeitung<br />
Népszabadság. Obwohl der österreichische<br />
Eigentümer der Mediaworks AG, der Investmentbanker<br />
Heinrich Pecina, die Einstellung<br />
mit massiven Verlusten zu argumentieren<br />
versuchte, wurde rasch klar, dass<br />
das Blatt durch die Totalblockade staatlicher<br />
Inserate sowie den Druck auf private<br />
Inserenten systematisch ausgetrocknet<br />
wurde. Der passionierte Jäger Pecina<br />
leitete von 1990 bis 1997 die Creditanstalt<br />
Investment Bank (CAIB); Anfang 2001<br />
ging er bei der kroatischen Schifffahrtsgesellschaft<br />
Tankerska an Bord, laut Firmenbuch<br />
mischte er jahrelang im Gas- und Ölhandel<br />
mit. Im Frühjahr 2014 übernahm<br />
Pecina dann vom Schweizer Medienhaus<br />
Ringier die ungarische Firma Mediaworks<br />
AG mit der Tageszeitung Népszabadság,<br />
dem Wirtschaftsblatt Világgazdaság, der<br />
Sportzeitung Nemzeti Sport sowie weiteren<br />
Regionalzeitungen und einer Druckerei.<br />
Pecina wies jede politische Einflussnahme<br />
seitens der Orbán-Regierung beim<br />
Verkauf von Népszabadság empört von sich.<br />
Doch die Druckerschwärze war noch<br />
nicht trocken, als bekannt wurde, dass die<br />
Mediaworks AG inklusive des liberalen<br />
Aushängeschildes an das Medienunternehmen<br />
Opimus Press verkauft wurde.<br />
Dieses gehört zu einem Firmengeflecht<br />
von Lőrinc Mészáros, einem engen Freund<br />
des ungarischen Ministerpräsidenten Victor<br />
Orbán. Mészáros ist vom Installateur<br />
zum Millionär aufgestiegen – auch dank<br />
seines Jugendfreundes. Außerdem ist er der<br />
Bürgermeister von Felcsút, dem Heimatort<br />
Orbáns. Vorsitzender des Beirats der<br />
Verkäuferfirma Vienna Capital Partners ist<br />
der frühere österreichische Botschafter in<br />
Brüssel, Gregor Woschnagg. Ferner sitzt<br />
auch ein Mann mit Beziehungen zum ungarischen<br />
Premier dort: der ehemalige ungarische<br />
Außenminister János Mártonyi.<br />
Während über dem pflegeleichten<br />
Freund Mészáros noch das Füllhorn ausgeschüttet<br />
wird, damit regierungstreue<br />
Medien die Oberhand an der öffentlichen<br />
Meinung gewinnen können, werden aufmüpfige<br />
Freunde bestraft.<br />
Das erfolgreiche Tandem, das die ehemalige<br />
Jugendpartei Fidesz zur Regierungsmacht<br />
führte, der Politiker Orbán<br />
und der Bau-, Agrar- und Medienunternehmer<br />
Lajos Simicska, ist einander seit<br />
einem Jahr spinnefeind. „Mein Bündnis<br />
mit Orbán war darauf gegründet, dass wir<br />
die Diktatur und das postkommunistische<br />
System abreißen wollten“, sagte der Geschäftsmann<br />
nach dem Zerwürfnis. „Aber<br />
bei diesem Bündnis war nicht die Rede davon,<br />
dass wir stattdessen eine neue Diktatur<br />
errichten.“ Das Verhältnis der Schulfreunde<br />
kühlte nach Orbáns zweitem<br />
Wahlsieg merkbar ab, weil zwar Simicskas<br />
Baukonzern Közgép weiterhin von öffentlichen<br />
Aufträgen profitierte, aber seine<br />
Medien damit begannen, einzelne Regierungsmaßnahmen<br />
zu kritisieren. Orbán<br />
verfügte daraufhin, dass diese Medien<br />
nicht mehr mit Werbeaufträgen von staatlichen<br />
und staatsnahen Unternehmen „versorgt“<br />
werden würden. Simicskas Medien,<br />
darunter die einflussreiche Zeitung Magyar<br />
Nemzet, der Nachrichtensender Hír<br />
TV und Lánchíd Rádió, hatten wesentlich<br />
zum erdrutschartigen Wahlsieg des Fidesz<br />
2010 beigetragen. „Als Nachrichtenkonsumenten<br />
profitieren wir von diesem Krieg<br />
10 wına | Mai 2017
MUTIGE PORTALE<br />
© Andras Nagy /picturedesk.com<br />
Skandalgeschichten<br />
über Viktor Orbán wie<br />
hier im Herbst 2016 in<br />
der nicht mehr existierenden<br />
Tageszeitung<br />
Népszabadság<br />
wird es in Ungarn in<br />
naher Zukunft kaum<br />
mehr geben, wenn<br />
die Medienlandschaft<br />
weiterhin so rasant<br />
unter den Einfluss der<br />
derzeitigen Regierung<br />
gerät.<br />
sches Instrumentarium erschöpft sich in<br />
abgestumpfter political correctness. Ihnen<br />
fehlt schlicht und einfach der Mut,<br />
und wenn sie jemanden treffen, der diese<br />
Tugend aufbringt, greifen sie ihn an. Kein<br />
Wunder, dass sie sich vom Freiheitskämpfer<br />
Orbán irritiert fühlen.“<br />
Dieser mutige Mann hatte bereits 2010,<br />
als er die Zweidrittelmehrheit im Parlament<br />
eroberte, die elektronischen Medien<br />
unter seine Kontrolle gebracht. Hunderte<br />
Redakteure im öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunk wurden auf die Straße gesetzt.<br />
Wer bleiben durfte, wurde unter das Dach<br />
der MTVA eingegliedert, jene staatliche<br />
Agentur, die über ein gut Dutzend Radio-<br />
und TV-Programme herrscht und<br />
den „Kunden“ die regierungsfreundlichen<br />
Meldungen kostenlos und fertig redigiert<br />
liefert. Sogar ein treuer „ungarischer<br />
Heimkehrer“ aus den USA durfte<br />
„Die Onlineportale<br />
Index, 444, Átlátszó<br />
oder Direkt 36 wühlen<br />
dort, wo es der Regierung<br />
weh tut: bei<br />
Korruptionsskandalen<br />
rund um die Regierungspartei<br />
Fidesz. Sie<br />
erfüllen die Aufgabe<br />
des Watchdogs in der<br />
Gesellschaft.“<br />
Péter Új, Chefredakteur<br />
der beiden Schulfreunde“, freut sich die<br />
Soziologin Éva Kovács, „denn jetzt weiß<br />
man eindeutig, dass Simicskas Hír TV<br />
keine Pro-Regierungspropaganda mehr<br />
macht.“<br />
So ungetrübt kann diese Freude nicht<br />
sein, denn nur ein einzelner enttäuschter<br />
Orbán-Freund trägt noch nicht wesentlich<br />
zur freien Information in Ungarn<br />
bei. Ganz im Gegenteil, die jüngste Übernahme<br />
des angesehenen Wirtschaftsmagazins<br />
Figyelő (Beobachter) durch Mária<br />
Schmidt, die langjährige Hofhistorikerin<br />
Orbáns, ist ein weiterer Tiefschlag für<br />
die Meinungsvielfalt. Auch als Branchenfremde<br />
konnte sie die vor 60 Jahren gegründete<br />
Wochenzeitung ohne viel Risiko<br />
erwerben: Seit 2006 verfügt sie über<br />
ein großes Vermögen, das sie von ihrem<br />
Mann geerbt hat. Schmidt ist für ihre<br />
geschichtsrevisionistischen Projekte sowie<br />
die Relativierung des Holocaust bekannt-berüchtigt.<br />
Erst jüngst schwärmte<br />
sie von Viktor Orbán in der konservativen<br />
Wochenzeitung Heti Válasz: „Durch sein<br />
strategisches Denken, seine Standhaftigkeit,<br />
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit,<br />
Ausdauer und nicht zuletzt seinen<br />
Mut löst Orbán bei den Entscheidungsträgern<br />
im heutigen Westeuropa nicht<br />
nur Panikreaktionen, sondern auch Gereiztheit<br />
und Irritationen aus“, denn, so<br />
Schmidt weiter, „im Gegensatz zu Orbán<br />
sind diese Personen keine Politiker, sondern<br />
politische Manager. Von der Politik<br />
interessiert sie nur jenes Kapitel, das von<br />
der Technik der Macht handelt. Sie sind<br />
davon getrieben, ihre Macht so lange wie<br />
möglich aufrechtzuerhalten. Sie können<br />
nicht zwischen richtig und falsch, gut und<br />
schlecht unterscheiden, denn ihr politimitnaschen:<br />
Der Filmproduzent und<br />
Regierungskommissar für die staatliche<br />
Filmförderung, Andrew G. alias András<br />
Vajna, kaufte von ProSiebenSat1 Media<br />
den Sender TV2 ebenso wie den landesweit<br />
gehörten Sender Radio 1. „Wir sind<br />
der einzig verbliebene private Radiosender“,<br />
berichtet Julia Váradi vom Klubrádió,<br />
„und daher ständigen Schikanen ausgesetzt“.<br />
„Gott soll einen hüten vor allem,<br />
was noch ein Glück ist.“ Seit 2010 ist<br />
Viktor Orbán Regierungschef, und ab diesem<br />
Zeitpunkt fiel Ungarn im Pressefreiheits-Ranking<br />
der Organisation Reporter<br />
ohne Grenzen um 44 Plätze. Im Jahr<br />
2016 war das Land unter 180 Staaten auf<br />
Rang 67 gelandet, hinter Malawi, Niger<br />
und der Mongolei. Und auch diese Platzierung,<br />
frei nach Friedrich Torberg, „was<br />
noch ein Glück ist“, verdankt Ungarn ausschließlich<br />
einzelnen mutigen Unternehmern.<br />
„Wir füllen die Lücke, die Népszabadság<br />
hinterlassen hat“, sagt László Puch, der<br />
Népszava (Volksstimme), die einzige verbliebene<br />
linke Tageszeitung Ungarns, gemeinsam<br />
mit anderen Investoren gekauft<br />
hat. Népszava wurde 1877 gegründet, im<br />
Kommunismus war sie das Zentralorgan<br />
der Gewerkschaften, jetzt ist sie die neue<br />
Hoffnung der Linken. Puch war aktiv<br />
in der ungarischen sozialistischen Partei<br />
(MSZP) und ist ein Neounternehmer, der<br />
neben anderen Firmen auch noch zwei regionale<br />
Wochenzeitungen in Ungarn betreibt.<br />
Puch hat zwanzig Redakteure vom<br />
eingestellten Népszabadság übernommen.<br />
Die unerschrockenen Regierungskritiker<br />
findet man derzeit fast nur mehr<br />
bei den Onlineportalen. Diese produzieren<br />
billiger als Zeitungen oder Radiosender<br />
und erreichen mehr Menschen, auch<br />
über Landesgrenzen hinweg. Das Onlineportal<br />
444.hu ist eines der aufmüpfigsten<br />
Medien Ungarns. „Als wir gesehen haben,<br />
dass die Politik immer näher kommt, haben<br />
wir Ende der 1990er-Jahre erst Index*<br />
und dann 444 gegründet“, erklärte Chefredakteur<br />
Péter Új dem deutschen Journalisten<br />
Stephan Ozsváth. „Diese Onlineportale<br />
wie Index, 444, Átlátszó oder Direkt 36<br />
wühlen dort, wo es der Regierung weh tut:<br />
bei Korruptionsskandalen rund um die Regierungspartei<br />
Fidesz. Sie erfüllen die Aufgabe<br />
des Watchdogs in der Gesellschaft“,<br />
fügt Ozsváth an. Finanzieren müssen sich<br />
solche Projekte über Spenden und großzügige<br />
Förderer. <br />
*Index wurde<br />
von einer<br />
Firma erworben,<br />
die über<br />
eine Stiftungskonstruktion<br />
zu großen Teilen<br />
dem Oligarchen<br />
Simicska<br />
gehört.<br />
wına-magazin.at<br />
11
MILLIARDEN IN 3D<br />
Von Reinhard Engel<br />
Der Eintrag an der amerikanischen<br />
Technologiebörse<br />
Nasdaq zu Stratasys Ltd. ist<br />
knapp und präzise: Das Unternehmen<br />
hat zwei Zentralen, eine in<br />
Minneapolis in den USA und eine in<br />
Rehovot in Israel. Mit seinen insgesamt<br />
2.800 Beschäftigten hält der Spezialist<br />
für 3D-Druck weltweit mehr als 600 einschlägige<br />
Patente. Die Drucker werden<br />
für drei Arten von Anwendungen eingesetzt:<br />
für die Produktentwicklung, für den<br />
Bau von Prototypen und auch für die direkte,<br />
digital gesteuerte Produktion.<br />
Die heutige Stratasys entstand im Jahr<br />
2012 durch das Verschmelzen der amerikanischen<br />
Stratasys mit der israelischen<br />
Objet. „Mit diesem Zusammenschluss“,<br />
schrieb damals das Techportal NoCamels<br />
- Israeli Innovation News, „entsteht<br />
ein 3D-Druck-Gigant mit einem Börsenwert<br />
von etwa 1,4 Milliarden Dollar“.<br />
Objet setzte damals geschätzte 150<br />
Mio. Dollar jährlich um, etwa gleich viel<br />
wie Stratasys. Dabei hatten beide Unternehmen<br />
schon zuvor in der innovativen<br />
Branche als wichtige Akteure gegolten.<br />
Und gemeinsam starteten die<br />
beiden Partner einen steilen Wachstumskurs,<br />
zusätzlich getrieben von weiteren<br />
Zukäufen. Im Jahr 2014 betrug der<br />
Umsatz schon 750 Mio. Dollar, um dann<br />
zwei Jahre später auf 670 Mio. Dollar zurückzufallen.<br />
Der US-amerikanische Firmenteil<br />
geht auf den Erfinder Scott Crump zurück,<br />
der schon 1988 in der Küche seiner<br />
Mutter Wachs und Plastik zusammenrührte,<br />
um damit seine ersten Druckversuche<br />
zu starten. Während der nächsten<br />
Jahre folgte ein stetiger Aufstieg des Unternehmens,<br />
das er mit gegründet hatte.<br />
Das israelische Unternehmen Objet<br />
wurde zehn Jahre nach seinem künftigen<br />
Partner ins Leben gerufen. Im Jahr<br />
1998 gründeten Rami Bonen, Gershon<br />
Miller und Hanan Gotaiit die Firma, finanzierten<br />
sie mit mehreren Runden von<br />
Venture-Kapital, unter anderem vom<br />
Schweizer israelischen Investor Elan Jaglom,<br />
von der TDA-Stiftung und von<br />
Leon Recanati.<br />
Objet entwickelte sich laut NoCamels<br />
zu einem global führenden Unternehmen<br />
in der 3D-Branche. Die Drucker<br />
des Unternehmens, die pro Stück zwischen<br />
10.000 und 400.000 Dollar kosten,<br />
werden unter anderem in folgenden<br />
Industriebranchen eingesetzt: bei Herstellern<br />
von Spielwaren und elektronischen<br />
Geräten, in der Automobil- und<br />
Zulieferindustrie, bei Schmuckerzeugern,<br />
in Dentallabors und in modernen<br />
Schuhfabriken. Angeblich hat Apple-<br />
Viele Hightechunternehmen<br />
lassen in Israel entwickeln<br />
und fertigen<br />
anderswo. Der 3D-Druck-<br />
Spezialist Stratasys produziert<br />
in zwei Werken im<br />
Land seine Maschinen:<br />
Exportquote 99 Prozent.<br />
Chef Steve Jobs die ersten Prototypen<br />
des iPhone auf Druckern von Objet anfertigen<br />
lassen. Diese Werkstücke bestehen<br />
übrigens längst nicht mehr nur<br />
aus Kunststoff – oder aus einem einzigen<br />
Kunststoff: Manche Drucker können<br />
auch unterschiedliche Materialkomponenten<br />
nahtlos miteinander kombinieren,<br />
so dass verschiedene Bauteile nicht mehr<br />
zusammengebaut oder verklebt werden<br />
müssen. Das spart Arbeitsschritte, Zeit<br />
und Lohnkosten.<br />
Warum überhaupt 3D-Druck? Was<br />
sind die Vorteile von 3D-Druck? Die<br />
Methode, die auf Englisch „additive manufacturing“<br />
heißt, bedeutet, dass man<br />
nicht aus einem Rohling die Form des<br />
Bauteils herausarbeitet, wie das üblicherweise<br />
geschieht, mit Fräsen, Bohrern oder<br />
anderen Werkzeugen. Im Gegenteil, das<br />
Teil wird in winzigen Schichten langsam<br />
aufgebaut, aus flüssigem oder pulverförmigem<br />
Material quasi gedruckt. Damit<br />
sind viel komplexere Formen möglich, die<br />
auch unregelmäßige Hohlräume enthalten,<br />
wie man sie mit Werkzeugen kaum<br />
herausbohren könnte. Das kann für Maschinenbauer<br />
sehr interessant sein, etwa<br />
für Turbinen, aber auch, um tragende<br />
Strukturteile leichter zu machen, ähnlich<br />
menschlichen oder tierischen Knochenstrukturen.<br />
Vor allem aber wird es der-<br />
Drucken<br />
AUF ISRAELISCH<br />
12 wına | Mai 2017
STRATASYS DRUCKGIGANT<br />
© Stratasys<br />
Schicht um<br />
Schicht entstehen<br />
die Objekte beim<br />
3D-Druck und<br />
können so auch<br />
komplexeste Formen<br />
annehmen.<br />
sende von unterschiedlichen Ersatzteilen<br />
teuer auf Lager gehalten und dann einzeln<br />
zu den Werkstätten geschickt, die<br />
sie gerade brauchen. Künftig könnten die<br />
Unternehmen der Automobil-, Elektround<br />
Maschinenbauindustrie bloß riesige<br />
elektronische Datenbanken der Teile vorhalten.<br />
Ausgedruckt wird dann nur das,<br />
was aktuell nachgefragt wird.<br />
Der Druck könnte auch ganz in der<br />
Nähe der Kunden stattfinden, selbst<br />
wenn das defekte Gerät von sehr weit<br />
her kommt – aus Japan, China oder Korea.<br />
Nicht zuletzt deshalb interessieren<br />
sich schon Logistikkonzerne wie DHL<br />
für die 3D-Technologie. Denn warum<br />
sollte nicht der Spediteur in seinem Lager<br />
gleich die Herstellung übernehmen<br />
und das Teil dann nur die letzten Kilometer<br />
bis zum Kunden transportieren?<br />
Zwei Fabriken in Israel – Turbulenzen<br />
an der Börse. Im September 2014<br />
schnitt der damalige Finanzminister Yair<br />
Lapid bei einer feierlichen Zeremonie<br />
das Eröffnungsband der zweiten israelischen<br />
Fabrik von Stratasys durch, in der<br />
Stadt Kiryat Gat im Süden von Israel, wo<br />
Auch die ersten<br />
Prototypen des<br />
iPhone sollen auf<br />
Druckern von Objet<br />
entstanden sein.<br />
zeit beim Prototypenbau genutzt: Damit<br />
lassen sich in den Entwicklungsabteilungen<br />
schnell neue Komponenten herstellen<br />
und auch physisch testen, die Ingenieure<br />
sind nicht bloß auf das theoretische<br />
Berechnen angewiesen.<br />
Dies funktioniert übrigens nicht nur<br />
für die direkte Produktion der Maschinenteile,<br />
sondern auch für die Herstellung<br />
komplexer Formen, in denen dann<br />
Kunststoff- oder Metallteile ganz herkömmlich<br />
gegossen werden. Das macht<br />
etwa ein österreichischer 3D-Spezialist,<br />
Lithoz, für Komponenten, die einmal in<br />
einer Flugzeugturbine eingebaut werden<br />
sollen. Aber es gibt auch ganz andere Anwendungsbeispiele<br />
aus unterschiedlichen<br />
Branchen: Ohrenärzte nutzen die Technik<br />
für persönliche angepasste Stöpsel<br />
bei Hörgeräten; jüngere Patienten von<br />
Zahnärzten bekommen ihre durchsichtigen<br />
Zahnspangen auf diese Weise angemessen.<br />
Der Sportartikelhersteller Adidas<br />
beginnt gerade damit in einer Fabrik<br />
in Deutschland ganze Schuhe drucken,<br />
das Ziel sind hier hohe Stückzahlen.<br />
Aber damit sind die Möglichkeiten<br />
noch lange nicht ausgereizt. Zwar wird<br />
sich auch in der Zukunft nur schwer ein<br />
ganzes Auto ausdrucken lassen. Aber<br />
besonders für das weltweite Ersatzteilgeschäft<br />
könnte die Technologie interessant<br />
werden. Heute werden noch Tauschon<br />
Intel eine Chip-Fertigung betreibt.<br />
Dazu kamen damals auch 60 Mitarbeiter<br />
des Unternehmens mit bunten Helmen<br />
angeradelt, die bei Tagesanbruch in der<br />
Zentrale von Stratasys in Rehovot aufgebrochen<br />
waren und mit ihren Rädern 45<br />
Kilometer zurückgelegt hatten. Seither<br />
werden die Hightechdruckstationen für<br />
industrielle Anwender aus beiden Fertigungsstätten<br />
zu 99 Prozent exportiert.<br />
An der Börse hat Stratasys eine extreme<br />
Berg- und Talfahrt hingelegt, nicht<br />
unähnlich anderen Techfirmen. Investoren<br />
erwarteten eine rasante Marktdurchdringung<br />
mit 3D-Druckern, schnell<br />
breite industrielle Anwendungen. Doch<br />
dazu ist es bisher nicht gekommen. Noch<br />
werden vor allem komplizierte Spezialteile<br />
gedruckt, und das eher in bescheidenen<br />
Stückzahlen. Das langsamere<br />
Wachstum beim Verkauf von Druckern<br />
ließ auch das Folgegeschäft stagnieren:<br />
die Lieferung von Materialien zum<br />
Drucken sowie Service- und Reparaturdienstleistungen.<br />
Die Auswirkungen für<br />
das Unternehmen waren kurzzeitig hohe<br />
Abschreibungen und Verluste, jene an der<br />
Nasdaq fielen dramatisch aus: Der Börsenkurs<br />
von Stratasys schoss zunächst<br />
von 18 Dollar auf 135 Dollar in die Höhe,<br />
nur um im Jahr 2015 wieder auf 18 abzustürzen.<br />
Mittlerweile<br />
steht er bei 24. <br />
Einsatzsmöglichkeiten.<br />
Ob Figuren, Helme,<br />
Sport- und Hörgeräte,<br />
Zahnspangen, Schuhe,<br />
Flugzeugteile ...<br />
wına-magazin.at<br />
13
PERSPEKTIVEN DER WELTANSICHT<br />
Eine<br />
Ansichtssache<br />
Digitale Landkarten auf Smartphones und Tablets ersetzen ihre analogen Vorgänger<br />
in unserem Alltag faktisch zur Gänze. Doch ihre Funktionsweise<br />
verdanken sie Menschen, die genau definiert haben, was sie davon profitieren<br />
und wir sehen sollen. Ein Interviewmit dem Kultur- und Medienwissenschafter<br />
Alex Gekker. Von Itamar Treves-Tchelet<br />
WINA: Dr. Alex Gekker, digitale Landkarten<br />
auf Smartphones und Computern<br />
spielen heute eine zentrale Rolle in unserem<br />
Alltag. Faktisch ersetzten sie die analogen<br />
Landkarten. Welche Aspekte dieses<br />
Wandels sind uns, den Usern, nicht unmittelbar<br />
bewusst?<br />
Alex Gekker: Eine der Herausforderungen<br />
bei den digitalen Landkarten ist, dass<br />
sie von uns als natürlich und selbstverständlich<br />
begriffen werden. Es muss aber<br />
klar sein, dass dahinter ein Algorithmus<br />
steckt – und der ist artifiziell hergestellt,<br />
auch wenn er als mathematisch-objektiv<br />
erscheint. Denn er wurde von Menschen geschrieben, die genau<br />
definiert haben, was er tun soll. Wir sehen also die Welt, so<br />
wie der Anbieter der Karten-App, so wie Google, Apple oder<br />
die in Israel entwickelte App Waze sie uns zeigen wollte. Und<br />
diese Sicht ist sicher nicht objektiv.<br />
Im Februar 2016 sind in Colorado (USA) viele Autofahrer steckengeblieben,<br />
nachdem sie die Warnhinweise in Form von<br />
Straßenschildern über die winterliche Autobahnsperre ignorierten.<br />
Sie meinten, ihr Navigationssystem zeigte, dass die<br />
Route offen wäre. Wieso vertrauen Menschen den digitalen<br />
Landkarten so automatisch?<br />
•<br />
Eine Ursache ist die Integration von kommerzieller Satellitentechnologie.<br />
Die Anbieter der Landkarten haben somit einen<br />
billigen Zugang zu Daten und Bildern in hoher Auflösung.<br />
Von oben: Krim aus österreichischer<br />
Sicht. Die Halbinsel Krim<br />
aus der österreichischen Version<br />
von Google Maps. Die strichlierte<br />
Linie markiert eine umstrittene<br />
Grenze. (Ukraine im Norden,<br />
Russland im Osten).<br />
... aus russischer Sicht. Die<br />
Halbinsel Krim aus der russischen<br />
Version von Google Maps. Die<br />
schwarze Linie markiert eine klare<br />
russische Grenze (Russland liegt<br />
im Osten).<br />
... aus ukrainischer Sicht. Die<br />
Halbinsel Krim aus der ukrainischen<br />
Version von Google Maps.<br />
Die strichlierte, grau markierte Linie<br />
wird benutzt, um Regionen im<br />
Landesinneren zu unterscheiden,<br />
gilt aber nicht als Außengrenze<br />
des Staates.<br />
Auf Google Maps kann man zum Beispiel<br />
leicht zwischen dem Satellitenbild und<br />
der Landkarte hin und her wechseln. Die<br />
Benutzer glauben dann, dass die beiden<br />
identisch sind, was nicht der Fall ist. Die<br />
digitalen Landkarten haben zudem auch<br />
viele der kognitiven Aufgaben vom User übernommen. So kann<br />
das System schon selber Routen und Distanzen berechnen. Die<br />
Landkarte weiß auch oft besser als wir, wo wir uns im Moment<br />
befinden. All das verstärkt das Gefühl, dass die Landkarte natürlich,<br />
selbstverständlich und transparent ist. Das ist ein generelles<br />
Problem vieler User-Interfaces.<br />
Dass sie zu vereinfacht sind?<br />
•<br />
Dass sie eine Illusion von Transparenz verleihen. Heute wird<br />
die digitale Landkarte kaum hinterfragt. Und wenn die Realität<br />
dann mit der digitalen Landkarte kollidiert, würden sich tatsächlich<br />
viele Menschen immer noch auf das Navisystem verlassen.<br />
Das ist auch das Ziel des Herstellers: Er will, dass die User<br />
darauf vergessen, dass sie eine Technologie benutzen, die ihnen<br />
die Welt vereinfacht darstellt. Würde man sich stets fragen, ob<br />
14 wına | Mai 2017
DIGITAL LITERACY<br />
© google maps; privat<br />
die Datenbank hinter der Landkarte mit der Realität übereinstimmt,<br />
wäre diese Technologie für den Alltag nicht nutzbar.<br />
Auf der Welt gibt es viele geopolitisch umstrittene Grenzen.<br />
Letztes Jahr behaupteten palästinensische Journalisten, dass<br />
Google Maps „Palästina“ entfernt habe. Der Konzern meinte<br />
hingegen zu Recht, es existierte vorher nie im System. Sind digitale<br />
Landkarten anfälliger für politischen Einfluss?<br />
•<br />
Selbstverständlich. Die Palästina-Diskussion ist ein klassisches<br />
Beispiel dafür, wie die Politik die Landkarte beeinflussen könnte.<br />
In diesem Fall würde aber Google so oder so dem User unterschiedliche<br />
Landkarten zeigen – abhängig davon, wer sucht, wo<br />
er sich befindet oder welchen Browser er benutzt. So wie bei<br />
der Halbinsel Krim. In Russland zeigt Google die Krim als Teil<br />
Russlands. In der Ukraine ist sie ukrainisch.<br />
Wie schätzen Sie denn die politische Wirkung einer digitalen<br />
Landkarte ein?<br />
•<br />
Als Propagandatool ist sie, wie jede andere Landkarte, sehr<br />
wirksam. Früher waren ja die sehr detaillierten Landkarten ein<br />
Staatsgeheimnis. Aber schon vor sechs Jahren konnte die Friedensbewegung<br />
Peace Now (Schalom Achschaw) eine Karte der<br />
jüdischen Siedlungen im Westjordanland auf Google herstellen<br />
und damit der ganzen Welt über deren Ausdehnung berichten.<br />
Die israelische Regierung würde diese Informationen vielleicht<br />
nicht veröffentlichen wollen, auch wenn sie existieren.<br />
Kann man von einem ähnlichen Einfluss auf unsere Verhaltensweisen<br />
im Alltag ausgehen?<br />
•<br />
Ich habe mich mit einem Landkartendesigner ausgetauscht,<br />
der eine Idee in seinem Team durchzusetzen versuchte. Er wollte<br />
Parks und Naturschutzgebiete mit einer augenfälligen grünen<br />
Farbe markieren. Er dachte, dass die User somit umweltbewusster<br />
unterwegs sein würden. Ob sowas wirklich wirkt, ist schwer zu<br />
beweisen. Allerdings zeigt die Tatsache, dass Mitarbeiter in dieser<br />
Branche mit solchen Gedanken spielen, ein Informationsgefälle<br />
zwischen ihnen und den Usern an.<br />
Wie nutzen dann Google, Apple, Garmin und auch die israelische<br />
Navi-App Waze diesen Vorteil aus?<br />
•<br />
Mit der Satellitentechnologie im Hintergrund ist von einem<br />
Wettbewerb auszugehen, in dem es darum geht, wer schneller und<br />
präziser die Informationen liefert. Google Maps, als die populärste<br />
gratis angebotene Landkarte der<br />
Welt, betrachtet beispielsweise<br />
die User als Konsumenten. Sie<br />
sollten bei ihrer Suche möglichst<br />
viele Geschäfte in ihrer Umgebung<br />
sehen. Googles Businesskern<br />
ist ja der Verkauf von Werbungen.<br />
Darum findet man in<br />
Wien, London oder New York<br />
eine detailliertere Landkarte als<br />
in afrikanischen Ländern. Es ist<br />
auch ihr Recht, so zu handeln.<br />
DR. ALEX GEKKER<br />
(32) ist in der Ukraine geboren und in<br />
Israel aufgewachsen. Er arbeitet für die<br />
Universität Amsterdam als Dozent und<br />
Forscher im Bereich New Media und<br />
Digital Culture. alexgekker.com<br />
DIGITAL MAPPING,<br />
auf Deutsch „Digitale Kartierung“,<br />
bezieht sich auf die Visualisierung von<br />
Daten, hauptsächlich für die Herstellung<br />
von digitalen Landkarten auf<br />
Smartphones, Computern oder GPS-<br />
Geräten. Bekannte Anbieter dieser<br />
Landkarten sind Google und Apple aus<br />
den USA., Garmin aus der Schweiz<br />
und Tomtom aus Holland. Die in Israel<br />
entwickelte populäre Navi-App Waze<br />
wurde 2013 von Google aufgekauft.<br />
Wie können wir uns als User besser<br />
schützen?<br />
•<br />
Eine Lösung wäre die Förderung von Digital Literacy, vor allem<br />
bei jungen Menschen. Sie sollen verstehen, was eine digitale<br />
Landkarte macht, wer sie kontrolliert und dass dahinter Menschen<br />
mit einer Agenda stehen. Eine andere Lösung wäre, mehr<br />
in Alternative Mapping zu investieren, das Aktivisten betreiben,<br />
z. B. openstreetmap.com, oder auch in staatliche Kartografieinstitutionen,<br />
die eigentlich ihr Vorrecht über die Herstellung<br />
von Landkarten zu Gunsten kommerzieller Anbieter längst<br />
verloren haben.<br />
wına-magazin.at<br />
15
NACHRICHTEN AUS TEL AVIV<br />
Generation<br />
wohin?<br />
Von Gisela Dachs<br />
Ihr Misstrauen in Institutionen<br />
eint die heutige Jugend in Europa<br />
und Israel. Darüberhinaus gibt es<br />
aber auch noch andere Daten,<br />
die auf einen zunehmenden<br />
Pessimismus bei jungen<br />
jüdischen Israelis verweisen.<br />
Gerade hat man in Tel Aviv wieder<br />
einmal kollektiv Geburtstag<br />
gefeiert. Der Staat wurde 69<br />
Jahre alt. Und wie immer bevölkerten<br />
auch diesmal Kinder und<br />
Jugendliche am Vorabend des Unabhängigkeitstages<br />
die Straßen im Stadtzentrum, gerüstet mit<br />
Schaumdosen und aufblasbaren Hammern. Der<br />
Alkoholkonsum hat auch hier zugenommen,<br />
aber es gibt immer noch viel weniger Betrun-<br />
Jüdische Jugendliche definieren sich generell<br />
als religiöser als bisher und verordnen sich<br />
damit auch stärker im rechten politischen<br />
Lager (von 56 % 2004 auf 67 % 2016).<br />
kene als in Europa bei vergleichbaren öffentlichen<br />
Feierlichkeiten.<br />
Für ein genaueres Bild in Hinblick auf Ähnlichkeiten<br />
und Unterschiede bei der jüngeren<br />
Generation hier und dort lohnt sich ein Blick<br />
auf zwei Studien, die fast zeitgleich im April<br />
erschienen sind. Europäische Rundfunkanstalten<br />
haben die größte kontinentale Jugendstudie<br />
veröffentlicht, die es je gab: An Generation<br />
What? haben sich fast eine Million junger<br />
Menschen zwischen 18 und 34 Jahren aus 35<br />
Ländern beteiligt. Mit einem klaren Ergebnis:<br />
Junge Europäer hegen Institutionen gegenüber<br />
ein großes Misstrauen. 86 % der Befragten haben<br />
somit „kein Vertrauen“ in religiöse Institutionen,<br />
82 % misstrauen der Politik, 79 % den<br />
Medien, 65 % den Gewerkschaften, 58 % der<br />
Justiz, 49 % den Schulen und 47 % der Polizei.<br />
In Israel liegt die Fragestellung erwartungsgemäß<br />
ein wenig anders. Aber in Hinblick auf<br />
das Vertrauen in Institutionen zeichnet sich<br />
ein ähnlicher Trend ab. Nach der jüngsten von<br />
insgesamt vier Studien, die von MACRO und<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung in den vergangenen<br />
zwanzig Jahren durchgeführt wurden, ist<br />
das Vertrauen in das Justizwesen und die Armee<br />
stark gesunken. Waren es 1998 noch 74 %<br />
der jüdischen Jugend, die der Justiz vertrauten,<br />
so sind es heute nur mehr 54 %. Das Vertrauen<br />
in die Armee sank von 63 % auf 40 %. Bei der<br />
arabischen Jugend wiederum ging im gleichen<br />
Zeitraum das Vertrauen in die israelische Polizei<br />
von 72 % auf 40 % zurück. Und während<br />
1998 noch 71 % ihren religiösen Institutionen<br />
vertrauten, sind es heute nur mehr 46 %.<br />
Die Studie erforschte die „Seelenlage“ von<br />
1.260 Jugendlichen aus allen Sektoren im Alter<br />
von 15 bis 18 und 21 bis 24 Jahren. Dabei wurde<br />
jeweils zwischen vier Fokusgruppen unterschieden:<br />
Säkulare, Ultraorthodoxe, Nationalreligiöse<br />
und Araber. Die Ergebnisse verweisen auf<br />
einen klaren Trend: Demnach definieren sich<br />
jüdische Jugendliche generell als religiöser als<br />
bisher und verordnen sich damit auch stärker<br />
© Zeichnung: Karin Fasching; Flash 90<br />
16 wına | Mai 2017
Israels Jugend:<br />
Wirtschaftlich<br />
erfolgreich wollen<br />
sie sein und dabei<br />
das Leben so<br />
richtig genießen.<br />
im rechten politischen Lager (von 56 % 2004<br />
auf 67 % 2016).<br />
Befragt nach ihren Lebenszielen, steht bei allen<br />
wirtschaftlicher Erfolg ganz oben auf der<br />
Skala (mit Ausnahme der jungen arabischen<br />
Frauen, die vor allem eine höhere Bildung anstreben).<br />
Gleich danach sehnt man sich nach<br />
einer höheren Bildung, will aber gleichermaßen<br />
auch das Leben genießen. Nur ein kleiner<br />
Prozentsatz (8,4 % der jüdischen jungen Männer,<br />
6,2 % der jüdischen jungen Frauen sowie<br />
5,9 % der arabischen Jugendlichen und 7,6 %<br />
der weiblichen arabischen Jugend) sieht einen<br />
Umzug ins Ausland als erstrebenswert an.<br />
Das überraschendste Ergebnis mag die unterschiedliche<br />
Wahrnehmung zwischen Juden<br />
und Arabern sein, wenn es um die Einschätzung<br />
der individuellen Zukunftsmöglichkeiten<br />
geht. 74 % der arabischen Jugend ist in dieser<br />
Hinsicht optimistisch (so hoch wie nie zuvor),<br />
während nur 56 % der jüdische Jugend so denkt<br />
(so niedrig wie nie zuvor).<br />
Demnach war die junge jüdische Generation<br />
noch nie so pessimistisch eingestellt. Erklärt<br />
wird diese Haltung vor allem mit Ernüchterung<br />
im Erwachsenenleben. Denn<br />
damit ist häufig die konkrete Erfahrung verbunden,<br />
nach Armeepflicht und teurem Studium<br />
keinen Job zu finden. Für die arabische<br />
Jugend wiederum habe sich das Bildungsniveau<br />
verbessert, was mehr Arbeitsmöglichkeiten<br />
als früher bedeute. Zudem biete eine zunehmend<br />
offenere Welt, ermöglicht durch die<br />
sozialen Netzwerke im Internet, mehr Einblicke<br />
in die Realität der arabischen Nachbarländer,<br />
die Israel im Vergleich sowohl politisch<br />
wie wirtschaftlich besser abschneiden lassen<br />
– auch wenn sich nur 24,4 % der arabischen<br />
jungen Männer und 13,3 % der jungen Frauen<br />
der israelischen Gesellschaft zugehörig fühlen.<br />
Und während bei den jungen Juden in Israel<br />
an oberster Stelle die Sorge über steigende<br />
Lebenskosten (67,4 %) und damit verbundene<br />
gesellschaftliche Gräben steht, ist es bei den<br />
Mehr als 90 % der Juden und knapp<br />
80 % der Araber sind nach einer Studie<br />
mit sich und ihrem Leben in Israel<br />
„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.<br />
jungen israelischen Arabern das Verhältnis zur<br />
jüdischen Bevölkerung (47,3 %).<br />
Zieht man eine weitere Studie zu Rate, die<br />
sich mit der Befindlichkeit der Erwachsenen<br />
beschäftigt, entspannt sich das Bild wieder ein<br />
wenig. Pünktlich zum Unabhängigkeitstag hat<br />
das Jerusalemer Jewish People Policy Institute<br />
seinen zweiten Pluralismus Index veröffentlicht.<br />
Demnach sind mehr als 90 % der Juden und<br />
knapp 80 % der Araber mit sich und ihrem Leben<br />
in Israel „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.<br />
Es gilt: Je weiter rechts und religiös sich die<br />
jüdischen Befragten definieren, desto zufriedener;<br />
und am zufriedensten sind die, die sich<br />
hauptsächlich als „Israeli“ definieren. Was alle<br />
eint, ist die mehrheitliche Überzeugung, dass<br />
das gute Leben am besten in getrennten Nachbarschaften<br />
stattfinden sollte. <br />
wına-magazin.at<br />
17
GESELLSCHAFT<br />
Madame<br />
Courage<br />
Zum Geburtstag der<br />
Schauspielerin Helene<br />
Weigel am 12. Mai<br />
Am Ende wurde ihr letzter Wille<br />
missachtet. Zu Recht. Eigentlich<br />
wollte Helene Weigel, am 12. Mai 1900<br />
in Wien als Tochter jüdischer Eltern geboren<br />
und eine Woche vor ihrem 71. Geburtstag<br />
verstorben, auf dem zentral gelegenen<br />
Dorotheenstädtischer Friedhof<br />
in Berlin zu Füßen ihres Ehemanns Bertolt<br />
Brecht beigesetzt werden. Heute ruht<br />
sie an seiner Seite. Zu groß war ihr Anteil<br />
am schriftstellerischen Werk des Dichters,<br />
Dramatikers und Theaterintendanten,<br />
mit dem sie seit Mitte der 1920er-<br />
Jahre bis zu seinem Tod 1956 zusammen<br />
war. Sie selbst stufte ihren Part an seiner<br />
Werkentwicklung in ihrer charakteristisch<br />
herben Art auf die Bemerkung „Ich habe<br />
gut gekocht“ herab.<br />
Auszuhalten<br />
hatte sie mit<br />
dem Augsburger<br />
aus gutbürgerlichem<br />
Haus genug,<br />
vor allem in<br />
emotionaler Hinsicht.<br />
Denn der<br />
schmale, listige,<br />
ideenreiche wie<br />
formulierungsgewaltige<br />
Marxist<br />
war, was Gefühle<br />
anging, von<br />
großer einseitiger<br />
Freizügigkeit.<br />
Was für Helene<br />
© Andreas Nader/Jan Arnold Gallery | *Bertolt Brecht über die Bühnenarbeit<br />
Helene Weigels.<br />
18 wına | Mai 2015<br />
„alles/Ausgesucht<br />
nach Alter, Zweck<br />
und Schönheit<br />
Mit den Augen<br />
der Wissenden/<br />
Und den Händen<br />
der brotbackenden,<br />
netzestrickenden/Suppenkochenden<br />
Kennerin/Der<br />
Wirklichkeit.“*<br />
BUCH-TIPP<br />
Bertolt Brecht, Helene Weigel:<br />
ich lerne: gläser +<br />
tassen spülen: Briefe<br />
1923–1956.<br />
Suhrkamp, 402 S.,<br />
€ 27,70<br />
WINAPLOTKES<br />
ISRAELISCHE<br />
STRASSENKÜNSTLER<br />
VEREWIGEN SICH AM<br />
WIENER NASCHMARKT<br />
Zur Veröffentlichung ihrer Doppelausstellung<br />
OUT OF PLACE in der<br />
Jan Arnold Gallery im Museumsquartier<br />
machten die Straßenkünstler Nitzan<br />
Mintz und Dede halt am Wiener Naschmarkt.<br />
Das Paar, welches sowohl gemeinsam<br />
als auch separat Kunst im öffentlichen<br />
Raum schafft, ist in der israelischen<br />
Straßenkunstszene nicht mehr wegzudenken.<br />
Die Künstlerin Nitzan Mintz ist<br />
für ihre Gedichte bekannt, die sich aus<br />
verschiedenen Materialien und Formen<br />
zusammensetzen. Sie beschreibt ihre<br />
Poesie als ein Zeichen des Versagens<br />
großer Träume und den Versuch, das<br />
Unvernünftige zu verbalisieren: die Unfähigkeit,<br />
in die Kindheit zurückzukehren,<br />
das gebrochene Herz, die politischen und<br />
gesellschaftlichen Hoffnungen, Genderfragen<br />
und ihre einseitige Beziehung zu<br />
Gott. Dede malt Tiere aus Holzstücken,<br />
die in ständiger Flucht von Ort zu Ort laufen,<br />
auf der Suche nach Sicherheit. Sein<br />
Markenzeichen ist das Pflaster, welches<br />
als Symbol für die Heilung persönlicher<br />
und sozialer Wunden gilt. Er betrachtet<br />
die Straße als den ultimativen Raum der<br />
Schöpfung, die passendste und wahre<br />
Plattform für die Kommunikation von<br />
Botschaften und Selbstausdruck.<br />
Dede und seine Partnerin Nitzan Mintz<br />
starteten ihre Tour mit einer Präsentation<br />
ihrer Arbeit auf der Leipziger Buchmesse.<br />
Anschließend kamen sie für ihre<br />
Ausstellung und Buchveröffentlichung<br />
in die Jan Arnold Gallery nach Wien und<br />
reisten weiter nach München. Wer im<br />
sechsten Bezirk aufmerksam durch die<br />
Straßen geht, wird nicht nur am Naschmarkt,<br />
sondern auch in der Kaunitzgasse<br />
auf ein Werk der beiden stoßen. I.L.<br />
Weigel bedeutete, dass sie allezeit Nebenbuhlerinnen<br />
erdulden musste, mal verdeckt,<br />
nach 1933, nach der Flucht ins dänische,<br />
schwedische, dann amerikanische<br />
Exil, offen in ménages à trois et à quatre.<br />
Am Ende war sie aber dann die Witwe,<br />
die seine Theaterkompagnie im Haus am<br />
Schiffbauerdamm in Berlin zur Brecht-Pilger-<br />
und -Leitstätte erhob. Dort wurden bis<br />
Mitte der 1980er-Jahre seine Dramen in<br />
orthodox mustergültiger Form inszeniert.<br />
Und dabei mit jener Intensität, die Helene<br />
Weigel als Schauspielerin auszeichnete,<br />
ob beim Vorsprechen 1919, bei der<br />
die blutjunge Anfängerin Routiniers der<br />
Wiener Volksbühne einschüchterte, oder,<br />
nach 15-jähriger Auftrittspause, ab 1949<br />
als Mutter Courage. AK<br />
Helene Weigel und Bertolt Brecht: Die<br />
beiden lernten einander 1923 kennen und<br />
blieben bis zu seinem Tod 1956 ein Paar.<br />
Ihr gemeinsames Grab steht auf dem<br />
Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.<br />
© Friedrich / Interfoto / picturedesk.com
FAMILIENMENSCH & GESCHÄFTSFRAU<br />
© Reinhard Engel; privat<br />
Gerti Schächter:<br />
Es war nicht<br />
immer einfach<br />
Das bewegte Leben einer starken Frau – erzählt<br />
zwischen Bridge und Fleischlaberln.<br />
Von Marta S. Halpert<br />
Es geht gleich los, ich muss meinen<br />
Platz einnehmen“, ruft die<br />
elegante weißhaarige Dame und<br />
lässt ihre Gesprächspartnerin unvermutet<br />
stehen. Gerti Schächter feiert in diesen Tagen<br />
ihren 92. Geburtstag und hat es eilig<br />
zum Bridgetisch und dem darauffolgenden<br />
Turnier. „Heute bin ich nur Dritte geworden,<br />
von insgesamt 48 Teilnehmern“, berichtet<br />
sie nachher telefonisch. „Aber hier<br />
sind die Listen der letzten Spiele, da war<br />
ich immer auf Platz 1!“ Auf den fünf Protokollblättern<br />
steht sie tatsächlich als Erste<br />
in der Gewinnerrubrik.<br />
Gerti spielt seit vielen Jahren leidenschaftlich<br />
gerne Bridge, die Turniere machen<br />
ihr besonders viel Spaß. Sie fährt<br />
noch Auto und kommt auch mit dem eigenen<br />
Wagen in den Klub. Im Bus fährt<br />
sie mit ihren Bridgepartnern nur zu den<br />
Auswärtsturnieren, z. B. nach Waltersdorf<br />
oder Puchberg. „Da spielen wir nachmittags<br />
und abends, und am nächsten Morgen<br />
werden die Partien gemeinsam besprochen.“<br />
Nur bei den Auslandsreisen macht<br />
sie jetzt nicht mehr mit. Gerti führt uns<br />
durch die denkmalgeschützte Wohnung, in<br />
der sich seit 1967 der Bridge-Club-Wien<br />
befindet. Adolf Loos, einer der wichtigsten<br />
Wegbereiter der architektonischen Moderne<br />
in Österreich, richtete 1913 diese<br />
großbürgerliche Wohnung für den jüdischen<br />
Unternehmer Emil Löwenbach ein.<br />
Loos machte Löwenbach auch mit dem<br />
jungen Oskar Kokoschka bekannt, der<br />
ihn 1914 porträtierte. Das Gemälde hängt<br />
heute in der Neuen Galerie in New York.<br />
So locker und leicht, wie jetzt das Leben<br />
zu laufen scheint, war es für Gerti Schächter<br />
nicht immer. Knapp 23 Jahre war sie alt,<br />
Gerti Schächter mit ihren Söhnen<br />
Norbert und Siegfried.<br />
„Ich wollte immer<br />
nach Wien, weil ich<br />
so viel Schönes darüber<br />
gehört habe.“<br />
als sie ohne Eltern 1948 mit der Bahn aus<br />
Bukarest über Budapest in Wien ankam.<br />
„Meine Schwester ging mit einem Kindertransport<br />
nach Israel, aber ich wollte immer<br />
nach Wien, weil ich so viel Schönes<br />
darüber gehört habe“, erzählt sie. Gleichaltrige<br />
Freunde aus der rumänischen Heimat<br />
nahmen sie auf, und bald darauf lernte<br />
sie ihren zukünftigen Mann kennen. „Paul<br />
sagte nach einer Woche zu mir: ‚Du wirst<br />
meine Frau.‘ Ich habe darüber gelacht, aber<br />
er ließ nicht locker, hat ständig angerufen,<br />
mich ins Theater und zum Essen ausgeführt.“<br />
Paul Schächter wurde bald darauf<br />
ihr Mann und der Vater ihrer beiden<br />
Söhne Siegfried und Norbert. „Zuerst war<br />
noch gar nicht klar, ob wir in Wien bleiben,<br />
aber bald etablierte sich Paul mit einem<br />
Textilgroßhandel am Wiener Salzgries.“<br />
Und eine weitere jüdische Familie<br />
aus dem zerstörten Osteuropa hatte sich<br />
hier eine Existenz aufgebaut.<br />
Doch Paul Schächter starb im 50. Lebensjahr,<br />
und Gerti begann, täglich im<br />
Geschäft zu arbeiten: „Das war wirklich<br />
schlimm, mein älterer Sohn erlitt so einen<br />
Schock, dass er in der Schule kaum etwas<br />
leisten konnte. Ich war ständig bei den<br />
Lehrern und musste viele Nachhilfestunden<br />
zahlen.“ In der Oberstufe löste sich der<br />
Knoten und Siegfried, der jetzt mehrere<br />
Modegeschäfte betreibt, schloss sein Wirtschafts-<br />
und Psychologiestudium mit dem<br />
Magister ab. Norbert, der sportliche Marathonläufer,<br />
begann zwar Jus zu studieren,<br />
entschied sich dann aber doch für das<br />
praktische Geschäftsleben. Als Vorstandsmitglied<br />
von Keren Hayessod engagiert er<br />
sich seit vielen Jahren für Sozialprojekte<br />
in Israel. „Ich habe drei Enkeltöchter und<br />
bin mächtig stolz auf sie. Sarah arbeitet als<br />
Ärztin, Aviella ist Betriebswirtin, und Lisa,<br />
die Jüngste, studiert noch“, freut sich Oma<br />
Schächter.<br />
Im Wiener Stadttempel hat Gerti<br />
Schächter seit Jahrzehnten einen fixen<br />
Sitzplatz. Von der ersten Galerie aus kann<br />
sie zu ihren Söhnen hinunterschauen und<br />
winken. „Mein Sohn Norbert ruft mich jeden<br />
Tag um acht Uhr in der Früh an, um zu<br />
hören, wie es mir geht.“ Und was macht die<br />
energiegeladene, lebensfrohe Gerti nach<br />
dem heutigen Bridgeturnier? „Ich mache<br />
jetzt 40 Fleischlaberln für die Party meiner<br />
Enkelin Aviella. Die liebt sie so sehr.“ <br />
wına-magazin.at<br />
19
„Mein Ziel war, die<br />
ÖVP auf die<br />
Vielfalt dieses<br />
Landes aufmerksam<br />
zu machen.“<br />
20<br />
wına | Mai 2017
„Politik ist keine Einbahnstraße,<br />
sondern ein Dialog“<br />
WINA: Über zehn Jahre waren Sie als Berater und Pressesprecher<br />
für ÖVP-Politiker tätig. Inwieweit muss jemand<br />
in dieser Rolle die Ansichten und Werte seiner Arbeitgeber<br />
auch als Privatperson teilen?<br />
Daniel Kapp: Wenn es eine möglichst hohe Deckung an<br />
Wertorientierung gibt – und das war zwischen mir und<br />
Josef Pröll definitiv der Fall – kann die Zusammenarbeit<br />
eine spannende Tätigkeit sein. Politik ist keine Einbahnstraße,<br />
sondern ein Dialog: Ein Berater von Politikern beeinflusst<br />
ja deren Positionierung. Ich zum Beispiel habe mir<br />
gewünscht, dass die ÖVP in manchen Dingen weltoffener,<br />
weltgewandter, liberaler wäre. Und zumindest ihr Verhältnis<br />
zum Judentum betreffend ist mir das auch gelungen.<br />
Was genau galt es an diesem Verhältnis zu verbessern?<br />
❙ Da die ÖVP früher noch viel stärker auf ihre christlichen<br />
Wurzeln pochte, war es für bürgerliche und marktliberal<br />
denkende Menschen anderer Glaubensrichtungen<br />
schwierig, in dieser Partei eine politische Heimat zu finden.<br />
Verschlimmert wurde die Situation durch den problematischen<br />
Umgang mit der Geschichte: beginnend mit<br />
der mangelnden Distanzierung vom christlichen Antisemitismus<br />
der Zwischenkriegszeit und kulminierend in der<br />
Waldheim-Affäre. Der Sager „Ein echter Österreicher“<br />
trieb das Ganze noch auf die Spitze. Was die ÖVP vollkommen<br />
verabsäumte, war, sich auch mit ihrer antifaschistischen<br />
Vergangenheit auseinanderzusetzen und diese Facette<br />
positiv hervorzuheben. Die Hälfte der Mitglieder<br />
des ersten Parteivorstandes kam direkt aus dem KZ oder<br />
der politischen Haft. In der heutigen Politsprache würde<br />
man das als ein Asset bezeichnen.<br />
Wie gingen Sie an die Sache heran?<br />
❙ Mein Ziel war, die ÖVP auf die Vielfalt dieses Landes<br />
aufmerksam zu machen und somit auch der jüdischen Gemeinde<br />
näherzubringen. Diese Zusammenführung mündete<br />
in einen offiziellen Empfang zu Rosch ha-Schana.<br />
Traditionell gibt der Bundespräsident einen Weihnachtsempfang.<br />
Da dachte ich, das österreichische Judentum sollte<br />
in einem ähnlich symbolischen Akt gewürdigt werden. Vizekanzler<br />
Pröll übernahm damals diese Aufgabe; heute wird<br />
MEN T SCHEN: DANIEL KAPP<br />
Der Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp war längstdienender<br />
Ministersprecher der österreichischen Bundesregierung. Als<br />
engste Vertrauensperson Josef Prölls brachte er die ÖVP dem Judentum<br />
näher. Kapp war viele Jahre Vorstandsmitglied der Österreichisch-Israelischen<br />
Gesellschaft. Redaktion und Fotografie: Ronnie Niedermeyer<br />
sie von Außenminister Kurz weitergeführt. Zum jüdischen<br />
neuen Jahr werden also jährlich um die hundert prominente<br />
Mitglieder der jüdischen Gemeinde in das Ministerium<br />
eingeladen – Kultusräte, Rabbiner und so weiter.<br />
Deshalb sollen Juden ÖVP wählen?<br />
❙ Es gibt keinen Grund für Juden, irgendeine Partei zu wählen<br />
– außer jene, die sie für sich als sinnvoll erkennen. Mein<br />
Ideal wäre, dass es keine Partei gibt, die man als Jude definitiv<br />
nicht wählen kann.<br />
Während des Jugoslawien-Krieges haben Sie sich humanitär<br />
engagiert: Sie evakuierten Flüchtlinge, transportierten<br />
Medikamente und ermöglichten Kindern aus dem belagerten<br />
Sarajevo, Ferien in Österreich zu verbringen. Wenn<br />
Sie heute wieder jung wären, würden Sie sich für syrische<br />
Flüchtlinge einsetzen?<br />
❙ Höchstwahrscheinlich ja. Als junger Mann hätte ich es,<br />
ohne lange zu reflektieren, einfach getan. Diesmal hat die<br />
Bequemlichkeit gesiegt, bestärkt durch den Gedanken: „Ich<br />
habe schon genug gemacht, ich kann nimmer.“ Stolz bin<br />
ich nicht darauf.<br />
Ihre Mutter war Ethnologin, Ihr Vater Diplomat. Die Kindheit<br />
verbrachten Sie in Ruanda, Sambia, Burma und Malaysia.<br />
Welche Einsichten haben Sie von dort mitgenommen?<br />
❙ Dass das Leben in der Tat sehr vielfältig ist. Ich habe viele<br />
Kulturen kennengelernt, viele unterschiedliche Lebenskonzepte<br />
wahrgenommen. Das führte mich zu dem Schluss,<br />
dass jeder Mensch die Möglichkeit eines erfüllten Lebens<br />
haben sollte – gegenseitiger Respekt vorausgesetzt. Aus diesem<br />
Grund bestärkte ich Josef Pröll darin, die eingetragene<br />
Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare zu ermöglichen.<br />
Ich sagte ihm: Wer für sich einen Wertekanon übernommen<br />
hat, der eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft<br />
nicht zulässt, muss ja selber keine eingehen. Von mir aus<br />
kann er diesen Wertekanon auch seinen Kindern vermitteln.<br />
Wenn die Kinder es aber trotzdem anders machen, hat<br />
er das auch zu respektieren. Respekt vor der Vielfalt ist das<br />
Wesentliche, das ich meiner internationalen Erziehung zu<br />
verdanken habe. Das – und die Sehnsucht nach der Sonne.<br />
wına-magazin.at<br />
21
INTERVIEW MIT ERWIN STEINHAUER<br />
„Man muss den Mut haben,<br />
Haltung zu zeigen“<br />
Über die jüdische Mischung in seiner<br />
Familie, seinen Entdecker Gerhard<br />
Bronner und seine Liebe zur Klezmer-<br />
Musik spricht der beliebte Kabarettist<br />
und Schauspieler Erwin<br />
Steinhauer mit Marta S. Halpert.<br />
WINA: Herr Steinhauer, Sie sind als scharfzüngiger Kabarettist,<br />
vielseitiger Bühnen- und Filmschauspieler und auch als<br />
Regisseur ein Begriff. Seit einigen Jahren widmen Sie sich wieder<br />
verstärkt Ihren Musikprogrammen. Das überrascht nicht,<br />
weiß man doch, dass Sie Ihre ersten Jazzmessen mit Gitarre<br />
und Gesang schon als Zehnjähriger in der Lichtentaler Kirche<br />
vor Publikum absolviert haben. Dennoch, beim Festival der jüdischen<br />
Kultur präsentieren Sie das Programm Klezmer, reloaded,<br />
extended. Wie haben Sie die jüdische, die Klezmer-Musik<br />
entdeckt?<br />
Erwin Steinhauer: Ich bin mit der Klezmer-Musik aufgewachsen,<br />
durch meinen Vater war mir diese Musik immer schon ein<br />
Begriff. Beim Begräbnis meines Vaters hat auch eine Klezmer-<br />
Band gespielt.<br />
Gab es auch jüdische Mitglieder in Ihrer Familie?<br />
•<br />
Ja, das kann man wohl sagen: Mein Urgroßvater Eduard Just<br />
kam als 18-Jähriger aus Rumänien über Ofen (alter Name für das<br />
heutige Buda, Anm.) nach Wien. Er wurde später nach Theresienstadt<br />
deportiert, doch zum Glück befreit. Ich habe ihn noch<br />
kennengelernt, denn er hat bis 1954 gelebt, da war ich drei Jahre<br />
alt. Er hat mich Ofenstierer genannt, weil ich beim Kamintürl<br />
alles hinein und heraus geräumt habe.<br />
Die erste prägende Persönlichkeit in Ihrem Leben war Ihre<br />
Großmutter Emmi, das Ergebnis einer katholisch-jüdischen<br />
Beziehung?<br />
•<br />
Ja, das war meine Großmutter. Wir haben gemeinsam im neunten<br />
Bezirk gelebt, und da meine Eltern arbeiten gegangen sind,<br />
war Emmi die Chefin im Haus. Sie überlebte die NS-Zeit, weil<br />
sie in Schwechat im Keller eines Lebensmittelgeschäfts versteckt<br />
war. Mein Urgroßvater (genannt Papaa) und mein Vater waren<br />
in einem Schrebergarten in Meidling versteckt, sind aber verraten<br />
worden: Meinem Vater, einem „Mischling ersten Grades“,<br />
hat „der Führer noch eine Chance gegeben“, wie das so schön<br />
geheißen hat. Er konnte zwischen der SS und der Wehrmacht<br />
wählen. Da ist mein Vater mit sechzehn Jahren an die Front gegangen,<br />
ist sehr früh verletzt worden, und damit war der Krieg<br />
gleich aus für ihn. Der Papaa ging über den Umweg Morzinplatz<br />
nach Theresienstadt.<br />
Hat die legendäre Emmi, Mutter Ihres Vaters Wolfgang, den<br />
berüchtigten Wiener Antisemitismus zu spüren bekommen?<br />
•<br />
Ja, Großmutter Emmi hat wirklich sehr gelitten. Es gab ein<br />
traumatisches Erlebnis am Vorabend des Einmarsches 1938:<br />
Da kam ein junger Mann, der immer bei uns in der Wohnung<br />
die „Politische“ kassierte, so nannte man den geheimen Mitgliedsbeitrag<br />
für die SPÖ. Als mein Vater am nächsten Tag aus<br />
der Schule gekommen ist, sah er seine Mutter, die Emmi, kniend<br />
am Gehsteig beim „Putzen“ – und daneben stand der junge<br />
Mann, der am Vorabend die „Politische“ kassiert hatte, in seiner<br />
SA-Uniform. Mein Vater hat die Welt nicht mehr verstanden.<br />
Das war ein sehr prägendes Erlebnis für ihn.<br />
Ihr Vater war die wichtigste Bezugsperson bei Ihrer politischen<br />
Sozialisierung in jungen Jahren, aber auch später. Erzählen<br />
Sie uns davon?<br />
•<br />
Also die Emmi hat das Meiste in unserer Familie bestimmt,<br />
so auch, dass ich in ein katholisches Gymnasium gehen soll.<br />
„Man weiß ja nie, was noch kommt“, hat sie gesagt, „das ist<br />
g,scheiter.“ Mein Vater hat klein beigegeben. Dann kam ich<br />
plötzlich mit 14 Jahren, am ersten Tag des neuen Schuljahres,<br />
von der Schule nach Hause und erklärte meinem Vater, dass<br />
man mich in der Schule nicht mehr haben will. Mein Vater ist<br />
© Nancy Horowitz<br />
22 wına | Mai 2017
gleich in die Schule gelaufen und hat nachgefragt: „Das geht gar<br />
nicht, dass Ihr Sohn in der Schule erzählt, dass er ständig am<br />
jüdischen Friedhof bei seinen Verwandten am 4. Tor ist!“ Das<br />
war bitte, 1965! Daraufhin hat mein Vater zur Großmutter gesagt,<br />
„jetzt nehme ich die Geschichte in die Hand“: Von diesem<br />
Moment an hat er begonnen, mich zu politisieren. Er hat mir<br />
Einschlägiges zu lesen gegeben und mir auch zum ersten Mal<br />
unsere komplizierte Familiengeschichte erzählt. Bis zu diesem<br />
magischen Punkt, bis zu meinem 14. Lebensjahr hatte die Familie<br />
geschwiegen. Diese neue enge Bindung zu meinem Vater<br />
hat dann bis zu seinem Tod bestanden.<br />
Wo sind Sie dann in die Schule gegangen?<br />
•<br />
Er hat mich im zweiten Bezirk in ein öffentliches Gymnasium<br />
gesteckt, dort habe ich dann maturiert. Das war im Stuwerviertel<br />
beim Prater, das war eine herrliche Zeit.<br />
Sie gelten als einer der Pioniere des neuen österreichischen<br />
Kabaretts. Wie kam es dazu?<br />
•<br />
Ich bin mit 23 Jahren von Gerhard Bronner entdeckt worden.<br />
1974 gründete ich gemeinsam mit Wolfgang A. Teuschl, Erich<br />
Demmer, Alfred Rubatschek und Erich Bernhardt das Kabarett<br />
Keif. Felix Rotholz, der Mann und Manager von Brigitte<br />
Neumeister, hat mich dort gesehen und den Gerhard gedrängt,<br />
mich anzuschauen. Bronner hat mich in der Folge in seine Radiosendung<br />
Schlager für Fortgeschrittene eingeladen und später<br />
ins Fernsehen, in seine Sendung Showfenster; viele Jahre war ich<br />
auch im Team des sonntäglichen Gugelhupf.<br />
Beim Festival der jüdischen Kultur 2017 präsentieren Sie unter<br />
dem Titel Ich bin ein Durchschnitts-Wiener fast ausschließlich<br />
Lieder von Hermann Leopoldi. Wie kam es dazu?<br />
Gerhard hat immer gesagt, „hör dir den Hermann Leopoldi<br />
•<br />
genau an. Er vertonte wunderbare Texte!“ Mir war Leopoldi nur<br />
ein Begriff von seinen Gassenhauern Schön ist so ein Ringelspiel<br />
oder Schnucki, ach Schnucki. Erst viel später, als wir mit Peter Rosmanith<br />
und unserer Band überlegt haben, was wir machen könnten,<br />
sind wir wieder auf Leopoldi gekommen<br />
und auf unglaublich tolle<br />
„Man muss sich<br />
gegen den rechten<br />
Zeitgeist wehren,<br />
man muss Farbe bekennen,<br />
Zivilcourage<br />
haben – und man<br />
muss den Mut haben,<br />
diese Haltung<br />
auch zu zeigen.“<br />
Erwin Steinhauer<br />
Texte gestoßen. Das wollen wir einer<br />
jüngeren Generation näherbringen,<br />
weil es so schade wäre, wenn das<br />
verschwindet.<br />
Hätte Hermann Leopoldi als Hersch<br />
Kohn auch so einen Erfolg gehabt?<br />
•<br />
Wahrscheinlich nicht. Die Namensänderung<br />
hat schon sein Vater<br />
1911 vorgenommen, und er hat sicher<br />
Recht gehabt. Leopoldi war ja<br />
im KZ Dachau und wurde später von<br />
den Eltern seiner ersten Frau, die bereits<br />
in den USA waren, „freigekauft“.<br />
Er feierte in den USA Riesenerfolge,<br />
wına-magazin.at<br />
23
DIE LIEBE ZUM KLEZMER<br />
Erwin Steinhauer (sitzend) und<br />
Seine Lieben: Joe Pinkl, Peter<br />
Georg Graf und Peter Rosmanith.<br />
füllte Hallen mit drei- bis viertausend Zuschauern. Leopoldi<br />
passte sein Repertoire an die neue Sprache an: Mit I am a quiet<br />
Drinker oder A Little Café Down the Street trat er in New York,<br />
Ohio und Pittsburgh auf. Seine Texte waren so melodisch gehalten,<br />
dass wir es mit Klezmer probieren wollten. Sascha Shevchenko<br />
(Akkordeon) und Maciej Golebiowski (Klarinette) haben<br />
sich intensiv damit beschäftigt, und so sind praktisch neue<br />
Lieder entstanden. Wir haben seine Texte verziert, die Basis natürlich<br />
erkennbar gelassen, aber jetzt kommt der Leopoldi stark<br />
Klezmer-betont daher.<br />
Sie haben erst unlängst im Wiener Konzerthaus sehr bewegende<br />
Texte im Rahmen des Gedenkkonzerts Defiant Requiem<br />
– Verdi in Terezin gelesen. Sie nehmen oft an Benefizveranstaltungen<br />
teil, die gegen das Vergessen gerichtet sind. Haben Sie<br />
ähnlich wie Ihr Vater Ihren Kindern auch ein gesellschaftspolitisches<br />
Bewusstsein weitergegeben?<br />
•<br />
Ich habe meiner Tochter und meinen beiden Söhnen sehr früh<br />
alles über unsere familiäre Mischung erzählt. Sie sind auch alle<br />
stolz darauf, ohne es groß nach außen zu publizieren. Ich denke,<br />
dass mein Sohn Matthias, der auch am Theater in der Josefstadt<br />
spielt, auch in dieser Beziehung in meine Fußstapfen treten wird.<br />
Er ist sicher bereit, sich zu engagieren, wenn er gefragt wird. Sogar<br />
mein 17-jähriger Sohn Stanislaus kennt<br />
seine Wurzeln, denn das ist das Allerwichtigste,<br />
man muss wissen, woher man kommt.<br />
Wie sehen Sie die Welt heute aus Ihrer Erfahrung:<br />
Kann man noch irgendetwas Positives<br />
bewirken?<br />
•<br />
Wenn ich es nicht glauben würde, würde<br />
ich es nicht versuchen. Man muss sich gegen<br />
den rechten Zeitgeist wehren, man muss<br />
Farbe bekennen, Zivilcourage haben – und<br />
man muss den Mut haben, diese Haltung<br />
auch zu zeigen. Es ist ganz wichtig, sich<br />
zu positionieren, das sage ich auch meinen<br />
Kindern, das ist das einzige, das Sinn macht.<br />
Kommt das bei der Jugend an?<br />
•<br />
Es muss uns gelingen, den Kindern zu vermitteln,<br />
dass sie nicht auf die Populisten<br />
ERWIN STEINHAUER<br />
wurde 1951 in Wien geboren. Nach der<br />
Matura wollte er das Reinhardt-Seminar<br />
besuchen und Schauspieler werden, begann<br />
aber 1969 auf Wunsch des Vaters<br />
ein Studium (Germanistik und Geschichte),<br />
das er vor der Dissertation abbrach.<br />
Als Kabarettist begann er 1974 im Keif,<br />
spielte später auch im Simpl. Von 1982<br />
bis 1988 war er Ensemblemitglied des<br />
Burgtheaters und begeisterte u. a. in der<br />
Rolle des Herrn Karl; am Theater in der<br />
Josefstadt war und ist er als Schauspieler<br />
und Regisseur erfolgreich tätig.<br />
Als freischaffender Künstler schrieb er<br />
Lieder und Texte sowie mehrere Bücher.<br />
Steinhauer wirkte außerdem in mehr als<br />
50 Hörspielen und über einhundert Filmund<br />
Fernsehproduktionen mit.<br />
und deren einfache Antworten hereinfallen. Wir müssen uns<br />
um Lösungen und Menschlichkeit bemühen. Denn die Demokratie<br />
hat den Nachteil, dass auch jene Kräfte, die sie zerstören<br />
wollen, gleich behandelt werden. Wenn wir gewisse Leute an<br />
die Macht lassen, dürfen wir uns nicht wundern, dass sie Schritt<br />
für Schritt über neue Gesetze die Demokratie aushebeln. Wie<br />
man an der Türkei sieht, geht das ganz schnell, und man befindet<br />
sich plötzlich in einem System mit autoritären Strukturen.<br />
Wie sehen Ihre beruflichen Pläne aus? Sehen wir Sie bald wieder<br />
im Theater? Oder bleiben Sie vorerst bei der Musik?<br />
•<br />
Jetzt arbeite ich mit Fritz Schindlecker an unserem dritten gemeinsamen<br />
Buch, das wird Schöne Weihn-Achterln heißen. Bisher<br />
haben wir schon Sissi, Stones und Sonnenkönig, Geschichten unserer<br />
Jugend gemacht und zuletzt Wir sind SUPER! ... Die österreichische<br />
Psycherl-Analyse. Mitte Mai gastieren wir mit Flieger<br />
grüß mir die Sonne im Wiener Konzerthaus: ein Text von H. C.<br />
Artmann, musikalisch umrahmt von meiner Band, den Lieben.<br />
Wir haben diese wunderbare Erzählung schon 2012 im Mandelbaum<br />
Verlag als Hörbuch herausgebracht und uns wegen des<br />
großen Erfolgs zu einer Bühnenfassung entschlossen.<br />
Wann sehen wir Sie im Fernsehen?<br />
•<br />
Derzeit verhandeln wir über einen Tatort; außerdem drehe ich<br />
mit Florian Teichtmeister zwei weitere TV-Krimis für die Serie<br />
Die Toten von Salzburg. Im Spätherbst arbeite ich wieder am<br />
Theater in der Josefstadt für eine Uraufführung von Peter Turrini.<br />
Ihr Vater war in seiner Freizeit Schüler bei<br />
Josef Dobrowsky an der Akademie der bildenden<br />
Künste. Er malte in Öl und Aquarelle.<br />
Haben Sie auch diese Neigung zur Malerei?<br />
•<br />
Nein, ich leider nicht, aber mein Sohn Matthias<br />
hat das Talent geerbt. Als mein Vater<br />
gestorben ist, hat er als Reaktion auf seinen<br />
Tod unbedingt Malerei studieren wollen.<br />
Aber dann kann das Bundesheer, und danach<br />
wollte er sich nur mehr der Schauspielerei<br />
und dem Drehbuchschreiben widmen.<br />
Waren Sie schon einmal in Israel?<br />
•<br />
Ja, mit meinem Vater, der öfter Israel besucht<br />
hat. 1990 ist er mit mir nach Jerusalem<br />
gefahren, weil er unbedingt wollte, dass<br />
ich die Gedenkstätte Yad Vashem sehe. Dafür<br />
bin ich ihm sehr dankbar.<br />
© Nancy Horrowitz<br />
24 wına | Mai 2017
ARUM<br />
WIEN<br />
Foto & Redaktion: Ronnie Niedermeyer<br />
Obwohl ein Teil meiner Familie nachweislich seit<br />
1789 in Österreich weilt, bin ich die einzige, für<br />
die Wien der Lebensmittelpunkt darstellt. (Von<br />
einem gelehrten und kampfbegeisterten Vorfahren abgesehen,<br />
der als Revolutionär 1848 das Weite suchte). Im<br />
Juni 1989, einen Tag, nachdem ich mein Maturazeugnis<br />
erhalten hatte, stand ich mit zwei Koffern (einer mit<br />
Kleidung, der andere mit Büchern) am Westbahnhof. Die<br />
Bundeshauptstadt war mein Ziel, dort wollte ich Judaistik<br />
studieren, ein Studium, das mir große Freude bereiten<br />
sollte, außerdem kannte ich bereits meinen zukünftigen<br />
Mann, der hier auf mich wartete. Das vielfältige kulturelle<br />
Angebot auf Weltklasseniveau, die zeitlose Eleganz der<br />
Donaumonarchie und die gute Infrastruktur innerhalb der<br />
jüdischen Gemeinde waren von jeher die Hauptfaktoren,<br />
weshalb nur Wien für uns im deutschsprachigen Raum<br />
in Frage kommen konnte. Wir wollten es jedoch genauer<br />
wissen und sind 2006 mit unserem Nachwuchs nach London<br />
übersiedelt. Noch mehr Kultur und noch mehr Juden.<br />
Unsere drei Kinder haben dort eine exzellente Ausbildung<br />
genossen, in kodesch und in chol, ich aber habe unser liebes<br />
Wien vermisst. Im Londoner Haus, in der Dachkammer,<br />
habe ich angefangen, Romane zu schreiben, mir fehlten<br />
jedoch das künstlerische Eingebundensein und die Auseinandersetzung<br />
mit Gleichgesinnten. Und natürlich die<br />
deutsche Sprache. In London konnte ich Kultur antizipieren,<br />
hier bin ich ein Teil davon. Da mein Mann beruflich<br />
an den Kontinent gebunden war und nur am Wochenende<br />
bei uns sein konnte, kehrten wir vor zwei Jahren mit<br />
unserem jüngsten Sohn nach Wien zurück.<br />
TIPP: Der stimmungsvollste Ort in Wien ist für mich der<br />
Spittelberg, dort habe ich meine Schreibstube. Angrenzend an<br />
den ersten Bezirk ist er ein Miniaturstädtchen in sich, mit<br />
wunderschönen Biedermeierhäusern, autofreien Kopfsteinpflastergässchen,<br />
Dorfbrunnen und Künstlerateliers. Ein<br />
Blick aus dem Fenster, und die Inspiration fließt.<br />
Schulamit Meixner:<br />
In London konnte ich<br />
Kultur antizipieren, in<br />
Wien bin ich ein Teil davon.<br />
SCHULAMIT MEIXNER<br />
wuchs im Rheintalischen auf. Während ihrer Schulzeit gründete<br />
sie gemeinsam mit Robert Schneider und Efraim Meixner den<br />
Theaterverein Die Schaukinder. In Wien studierte sie Judaistik<br />
und Theaterwissenschaft, arbeitete im Jüdischen Museum und<br />
unterrichtete jüdische Geschichte an der ZPC-Schule und im<br />
JIFE. Ihre Romane ohnegrund (2012) und Bleibergs<br />
Entscheidung (2015) sind bei Picus erschienen. 2016 war<br />
sie Co-Organisatorin des Yiddish Culture Festival Vienna.<br />
wına-magazin.at<br />
25
JÜDISCHE HOCHSCHÜLERSCHAFT<br />
Text: Alexia Weiss<br />
Foto: Daniel Shaked<br />
Rebellische<br />
Studierende<br />
„Eine junge jüdische<br />
politische“ Stimme habe in<br />
Wien bisher gefehlt, meint<br />
die neue Leitung der<br />
Jüdischen Österreichischen<br />
HochschülerInnen<br />
(JÖH).<br />
Benjamin „Bini“ Guttmann (21),<br />
er studiert Jus und Politikwissenschaften,<br />
und Benjamin<br />
„Beni“ Hess (23), Jusstudent,<br />
sind seit Jänner das neue Präsidententeam<br />
der JÖH und stehen damit an der Spitze<br />
des sechsköpfigen Boards. Im kurzen<br />
Wahlkampf waren sie angetreten, um die<br />
JÖH, die in den vergangenen Jahren vor<br />
allem von internationalen Studierenden<br />
der Lauder Business School geführt worden<br />
war, wieder politischer zu machen. Vor<br />
allem aber suchten sie einen Ort, an dem<br />
sie sich auch als Studierende engagieren<br />
können.<br />
„Als wir noch in der Schule waren,<br />
waren wir sehr aktiv“, sagt Guttmann. Er<br />
besuchte die Oberstufe der Zwi-Perez-<br />
Chajes-Schule, war als Jugendlicher im<br />
Shomer, leistete seinen Zivildienst im Jüdischen<br />
Museum Wien. Auch Hess ist ein<br />
Shomernik, nach der Matura an der American<br />
International School ging er nach Israel<br />
zur Tzava – dem Militärdienst. „Und<br />
als ich dann nach eineinhalb Jahren wieder<br />
nach Wien zurückgekommen bin, hat<br />
etwas gefehlt. Man hat sich zwar mit jüdischen<br />
Freunden getroffen, aber es gab da<br />
nicht eine Organisation, in der man sich<br />
gemeinsam engagieren konnte. Wir haben<br />
von unseren Eltern die ganze Zeit Geschichten<br />
gehört, wie es früher einmal war.<br />
Das hat sich supertoll angehört, und das<br />
wollten wir auch.“<br />
Nun sind sie, wo sie hinwollten, die beiden<br />
Benjamins. Und sie haben viel vor. Mit<br />
einer Podiumsdiskussion zum Thema Antisemitismus<br />
in den JÖH-Räumlichkeiten<br />
haben sie schon etwas vorgelegt. Mit<br />
Schabbat-Abenden und Partys wie etwa<br />
zu Purim kommt auch die Geselligkeit in<br />
der JÖH nicht zu kurz: „Das Soziale ist<br />
auch wichtig“, so Guttmann. Sie möchten<br />
die Räume in der Währinger Straße zu<br />
einem Open Space machen, in dem man<br />
sich in der Mittagspause treffen oder auch<br />
lernen kann. Dazu muss die Immobilie allerdings<br />
erst aufgemöbelt werden – doch<br />
die Finanzierung dafür ist noch nicht aufgestellt.<br />
Als wir einander zum Interview<br />
treffen, sind die Räume nicht einmal zugänglich:<br />
Der erste Schlüssel sperrt nicht,<br />
der zweite ebenfalls nicht, und bald ist klar:<br />
Hier wurde am Schloss manipuliert. Ob es<br />
sich um einen Einbruchsversuch oder einen<br />
antisemitischen Akt handelte, konnte<br />
bisher nicht eruiert werden.<br />
Neben dem Sozialen ist die Vernetzung<br />
für die neue JÖH-Spitze ein zentrales<br />
Thema: in Wien unter den jüdischen<br />
Studierenden, aber auch international. Das<br />
Board der JÖH hat bereits an einer Konferenz<br />
der World Union of Jewish Students<br />
(WUJS) teilgenommen. International<br />
ein großes Thema: der Kampf gegen<br />
die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment,<br />
Sanctions). „Da sind wir natürlich<br />
solidarisch“, so Hess. In Wien spiele BDS<br />
allerdings so gut wie keine Rolle, betont<br />
Guttmann. Das habe auch damit zu tun,<br />
dass die HochschülerInnenschaft an der<br />
Uni Wien hier eine klare Position dagegen<br />
vertrete. Das sei in anderen Ländern nicht<br />
so. Als Beispiel nennt Guttmann England:<br />
Dort würden von Studierendenvertretern<br />
sogar Boykottaufrufe gegen Israel unterschrieben.<br />
Ein Anliegen ist es ihnen aber vor allem,<br />
eine laute, junge jüdische politische<br />
Stimme zu sein. Und wer jung ist, rebelliert<br />
gerne. So betonen die beiden unisono,<br />
dass sie nicht mit allem, was die Führung<br />
der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG)<br />
Wien tut, einverstanden sind und dass sie<br />
in Zukunft einer breiteren Öffentlichkeit<br />
durch entsprechende Statements zeigen<br />
wollen, „dass es in mancher Hinsicht progressivere<br />
Stimmen gibt, die eine konträre<br />
Meinung vertreten“, so Hess.<br />
Gibt es da Beispiele? Guttmann und<br />
Hess nennen die Position zu Flüchtlingen.<br />
„Die IKG hat die Stigmen gegen Flücht-<br />
26 wına | Mai 2017
DIALOG & SOLIDARITÄT<br />
Die Rebellen: Benjamin Hess<br />
(li.) und Benjamin Guttmann. Sie<br />
sind jung, jüdisch, politisch und<br />
die neuen Gesichter der JÖH.<br />
linge noch verschärft und dem Chor von<br />
der rechten Seite auch noch Argumente<br />
geliefert“, meint Hess. Guttmann ergänzt:<br />
„Und wenn Strache sagen kann, ‚schaut,<br />
die IKG sagt auch, die Flüchtlinge sind<br />
ein Problem‘, dann ist das Munition, die<br />
man nicht liefern muss.“ Und Hess weiter:<br />
„Wenn der Staat Israel es schafft, die<br />
Grenze zu Syrien aufzumachen und Menschen<br />
zu helfen – warum schaffen wir das<br />
nicht?“<br />
Mit Muslimen will die neue JÖH-Führung<br />
mehr in Dialog treten. Dass es bei<br />
dem einen oder anderen Muslimen antisemitische<br />
Ressentiments gibt, ist ihnen<br />
bewusst. Eine rein konfrontative Schiene<br />
sei da aber keine Lösung. Nur das Gespräch<br />
und das gegenseitige Kennenlernen<br />
können helfen. „Uns ist bewusst,<br />
dass wir da wesentlich flexibler sind als<br />
die IKG-Führung. Wir können mit mehr<br />
Menschen und Gruppen in Kontakt treten,<br />
wo das die IKG vielleicht aus politischen<br />
oder anderen Gründen nicht tun<br />
kann“, meint Hess. Grenzen gebe es aber<br />
natürlich: „Mit den Grauen Wölfen würden<br />
wir uns nicht an einen Tisch setzen“,<br />
betont Guttmann.<br />
„Dialog mit Nazis<br />
hat keinen Platz.<br />
Man muss sie<br />
blockieren und<br />
alles tun, um sie<br />
zu verhindern.“<br />
Benjamin<br />
Guttmann<br />
Mehr Solidarität hätten sich Hess<br />
und Guttmann seitens der jüdischen Gemeinde<br />
in der kürzlich geführten Kopftuchdebatte<br />
erwartet, räumen aber ein:<br />
Hier sei zwar die Mehrheit des JÖH-Vorstands,<br />
aber nicht das gesamte Board ihrer<br />
Meinung. Guttmann: „Wir wären dafür<br />
gewesen zu sagen, dass ein Verbot von religiösen<br />
Kleidungsvorschriften nicht geht,<br />
da das Diskriminierung ist und auch auf<br />
uns zurückfällt. Als Minderheiten muss<br />
man zusammenstehen und Solidarität zeigen.“<br />
Wenn eine Laizismusdebatte geführt<br />
worden wäre, „wäre das legitim gewesen.<br />
Aber der Punkt ist ja, dass das einfach eine<br />
offen rassistische Maßnahme ist“, so Guttmann.<br />
„Wir können nicht selektiv gegen<br />
Rassismus, der uns betrifft, auftreten und<br />
gegenüber dem anderen nicht“, sagt Hess.<br />
Klar abgrenzen wollen sich die jüdischen<br />
Studierendenvertreter auch weiterhin<br />
von rechten Antisemiten. Hier sehen<br />
sie auch keine Möglichkeit des Dialogs<br />
oder Gesprächs: Einen überzeugten Antisemiten<br />
könne man nicht vom Gegenteil<br />
überzeugen. „Und ich finde das auch<br />
nicht den richtigen Umgang. Dialog mit<br />
Nazis hat keinen Platz. Man muss sie blockieren<br />
und alles tun, um sie zu verhindern“,<br />
betont Guttmann. Die JÖH war<br />
daher auch Teil der Demonstration gegen<br />
den so genannten Akademikerball in<br />
der Hofburg. Die Straße sieht sie als Studierendenvertretung<br />
auch als einen jener<br />
Räume, wo man Flagge zeigen könne –<br />
vor allem wenn es um Rechtsextremismus<br />
geht.<br />
„Es ist sehr leicht, die Diskussion auf<br />
muslimischen Antisemitismus zu beschränken“,<br />
so Hess. „Wir sagen ja auch<br />
nicht, dass es dieses Problem nicht gibt.<br />
Aber das, was uns unmittelbar betrifft,<br />
ist der rechte Antisemitismus.“ Unterschwellig<br />
ist diesem Hess am Juridikum<br />
begegnet. Guttmann hat so seine Erfahrungen<br />
beim Ausgehen und im Fußballstadion<br />
gemacht. Hier kennen sie keinen<br />
Pardon. Und würden sich wünschen, wenn<br />
das alle in der jüdischen Gemeinde so sähen.<br />
joeh.at<br />
wına-magazin.at<br />
27
ARCHITEKTURSÜNDEN<br />
Das Ungeheuer von T<br />
und der gefundene Schatz<br />
Die Stadtplanung in Tel<br />
Aviv war nicht immer<br />
vorteilhaft. Doch manchmal<br />
verbirgt sich an architektonischen<br />
Schandflecken<br />
zwischen Schmutz<br />
und Verwahrlosung ein<br />
wahrer Schatz – wie die<br />
landesweit größte Sammlung<br />
an jiddischer Literatur<br />
in der „neuen“ zentralen<br />
Busstation.<br />
Bausünde.Tel<br />
Aviver nennen<br />
das monströse<br />
Gebäude<br />
der zentralen<br />
Busstation voll<br />
Abscheu „Ha<br />
Miflezet“ – das<br />
Ungeheuer.<br />
Von Daniela Segenreich-Horsky<br />
Die Verantwortlichen für die<br />
Tel Aviver Stadtplanung haben<br />
einige Bausünden zu verantworten,<br />
so etwa den verschandelten<br />
Dizengoff-Platz, der jetzt<br />
nach beinahe fünfzig Jahren wieder in<br />
seine ursprüngliche Form zurückversetzt<br />
wird. Oder den Atarim-Platz an der<br />
Strandpromenade, von dem Bürgermeister<br />
Lahat im zweiten Golfkrieg gesagt<br />
hat, er sollte am besten von einer Scud-<br />
Rakete getroffen werden. Auch das pittoreske<br />
alte Viertel von Neve Zedek wäre<br />
damals beinahe zu Gunsten von Hochhäusern<br />
niedergemäht worden. Doch bei<br />
Weitem führend in dieser Liste ist wohl<br />
die „neue“ zentrale Busstation. Die Tel<br />
Aviver nennen das monströse Gebäude<br />
im südlichen Stadtviertel von Neve<br />
Sha’anan voll Abscheu „HaMiflezet“ –<br />
das Ungeheuer. Und der Name passt:<br />
44.000 Quadratmeter Boden verschlingt<br />
das Unding. Und in seinem Inneren liegt<br />
ein insgesamt 230.000 Quadratmeter<br />
umfassendes hässliches Labyrinth aus<br />
sieben teilweise unterirdischen Stockwerken<br />
mit unübersichtlichen Passagen,<br />
Parkplätzen und über tausend heruntergekommenen<br />
Geschäftslokalen, die zum<br />
Großteil leer stehen.<br />
Architekt dieses Schandmals war niemand<br />
Geringerer als Ram Karmi, der im<br />
In- und Ausland gefeierte Meister, zu<br />
dessen Werken unter anderem das majestätische<br />
Gebäude des Obersten Gerichtshofs<br />
in Jerusalem gehört. Die zentrale<br />
Busstation ist wohl eher zu seinen<br />
„Jugendsünden“ zu zählen und scheint<br />
offiziell in der Liste seiner Bauwerke<br />
und in seinen Büchern nirgends auf. –<br />
Wohl mit gutem Grund: Die neue Anlage<br />
sollte die aus allen Nähten platzende<br />
alte Tel Aviver Busstation ersetzen. Baubeginn<br />
unter Ram Karmi war 1967, doch<br />
Budgetprobleme verschleppten den Bau,<br />
und das von den Tel Avivern als „weißer<br />
Elefant“ betitelte Projekt wurde erst beinahe<br />
drei Jahrzehnte später von zwei anderen<br />
Architekten fertiggestellt. Bereits<br />
kurz nach der Eröffnung 1993 war klar,<br />
dass die damals weltweit größte Busstation,<br />
die bis heute täglich von etwa hunderttausend<br />
Menschen bevölkert wird,<br />
extrem schlecht geplant, inadäquat und<br />
unwirtschaftlich ist. Die kompliziert angelegte<br />
Anlage mit ihren 29 Rolltreppen<br />
und 13 Liften ist völlig unübersichtlich,<br />
und einige der als Shoppingcenter vorgesehenen<br />
Stockwerke werden so gut<br />
wie nicht verwendet, während die übrigen<br />
Etagen überfüllt und die Bahnsteige<br />
und Zugänge viel zu eng sind.<br />
Wer hier um Hilfe schreit, wird nicht<br />
gehört. Vor fünf Jahren meldeten die Eigentümer<br />
schließlich den Bankrott an.<br />
28 wına | Mai 2017
JIDDISCHE SCHATZINSEL<br />
el Aviv<br />
Heute tummeln sich im Inneren dieses<br />
„Ungeheuers“ in einem der ärmsten Viertel<br />
von Tel Aviv Drogensüchtige, Prostituierte,<br />
Taschendiebe und Obdachlose.<br />
Daneben bieten Fremdarbeiter aus den<br />
Philippinen und Flüchtlinge aus Afrika<br />
auf einer Art Markt im Erdgeschoss des<br />
Gebäudes ihre Waren an, hauptsächlich<br />
Textilien, Obst, Gemüse und ihre lokalen<br />
kulinarischen Spezialitäten. Es ist, als<br />
wäre man auf einem Straßenmarkt in Senegal<br />
und Manila gleichzeitig.<br />
Kunst und jiddische Kultur. Das<br />
Gelände wirkt vernachlässigt, schmutzig<br />
und abgenützt, ist teilweise überfüllt und<br />
an anderen Stellen leer wie eine Geisterstadt.<br />
Ein Mord und drei Vergewaltigungen<br />
sollen in den letzten Jahren hier stattgefunden<br />
haben: „Hier würde man gar<br />
nicht gehört werden, wenn man um Hilfe<br />
schreit“, verkündet Ajelet, eine der zahlreichen<br />
Fremdenführerinnen, die hier<br />
ihr tägliches Brot verdienen, indem sie<br />
Gruppen von Schaulustigen durch die<br />
Anlage führen. Im fünften, völlig abgelegenen<br />
und menschenleeren Stockwerk<br />
angelangt, entdecken die Besucher unerwartet<br />
einen künstlerischen Schatz –<br />
riesige Wandbilder, Graffitis, wo immer<br />
man hinsieht. Manche der hier vertretenen<br />
Künstler, wie Dede oder Neta Mintz,<br />
sind im In- und Ausland bekannt, andere<br />
sind völlig anonym. Es ist, als wäre<br />
man in einer großen Ausstellungshalle.<br />
Daneben dienen einige der kleinen leerstehenden<br />
Lokale als Kunstgalerien und<br />
werden von den Künstlern aus Geldmangel<br />
auch als vorübergehende Schlafstellen<br />
benützt.<br />
Und wenn man dann schließlich am<br />
allerletzten Ende des Nordflügels angekommen<br />
ist, sozusagen in der Mitte von<br />
nirgendwo, steht man vor dem Eingang<br />
zu Yung & Yiddish, der Bibliothek mit<br />
der größten Sammlung an jiddischen<br />
Büchern im Land. 50.000 Titel an jid-<br />
Mendy<br />
Cahane hat<br />
ein kleines<br />
Universum des<br />
Jiddischen<br />
geschaffen,<br />
das wohl an<br />
das verlorene<br />
Paradies erinnern<br />
mag.<br />
discher und übersetzter Literatur sowie<br />
Zeitungen und Magazine sind hier rund<br />
um eine kleine Bühne gestapelt, auf der<br />
Mendy Cahane, der Initiator dieses Unternehmens,<br />
ab und zu jiddische Klassiker,<br />
aber auch Jacques Brel und internationale<br />
Hits auf „Mamme Luschen“ singt.<br />
Der Schauspieler, Übersetzer und Interpret<br />
von Chansons hat, nachdem er<br />
auf der Tel Aviver Universität Deutsch,<br />
Englisch und Französisch abgehakt<br />
hatte, den Charme der jiddischen Sprache<br />
entdeckt und war von dieser Kultur<br />
nicht mehr losgekommen: „Da hat<br />
sich mir plötzlich eine ganze Welt aufgetan“,<br />
sagt er heute. Er tauchte ein in diese<br />
Welt und hatte noch das Privileg, Schauspielunterricht<br />
bei den Großen des Jiddischen<br />
Theaters zu nehmen. So wurde<br />
der gebürtige Belgier zum Jiddisch-Spezialisten<br />
und machte vor zwei Jahren unter<br />
anderem als Übersetzer, Sprachcoach<br />
und Schauspieler beim preisgekrönten<br />
Holocaustfilm Schauls Sohn mit, in dem<br />
Großteils Jiddisch gesprochen wird.<br />
In seiner Sammlung, die er vor etwa<br />
zehn Jahren in das kostengünstige Lokal<br />
in der Busstation übersiedelte, finden<br />
sich unzählige Schätze, etwa eines<br />
der ältesten erhaltenen Bücher in Jiddisch<br />
aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert,<br />
zwei illustrierte Ausgaben von<br />
Rudyard Kiplings Dschungelbuch aus<br />
den 1920er-Jahren, eine alte Antholo-<br />
In der Mitte von<br />
nirgendwo steht<br />
man vor dem<br />
Eingang zu<br />
Yung & Yiddish,<br />
der Bibliothek<br />
mit der größten<br />
Sammlung an<br />
jiddischen<br />
Büchern in Israel.<br />
gie der französischen Literatur und eine<br />
Übersetzung von Baudelaire ins Jiddische.<br />
Daneben Tagesblätter und Illustrierte<br />
vom Anfang des letzten Jahrhunderts,<br />
zahlreiche Platten, Kinderbücher<br />
und Spiele und sogar ein Monopoly-Spiel<br />
mit Anweisungen auf Jiddisch ...<br />
Einige potenzielle Besucher der Veranstaltungen<br />
von Yung & Yiddish lassen<br />
sich vom Labyrinth der Busstation mit<br />
ihren zwielichtigen Typen sicherlich abschrecken,<br />
aber Mendy Cahane sieht in<br />
dem Ort auch Vorteile: „Dieser Platz ist<br />
billig und groß und auch ein wenig wirr<br />
und exotisch. Und wenigstens ist hier inzwischen<br />
ein Fortbestehen der Sammlung<br />
möglich ...“ <br />
wına-magazin.at<br />
29
30 wına | Mai 2017
OPERNSALON<br />
„Manche hoffen darauf,<br />
die Netrebko bei uns<br />
zu treffen“<br />
Sissy Strauss verpflanzte ihren<br />
New Yorker Künstlersalon in ihre<br />
Geburtsstadt. Trotzdem bleibt die<br />
Sehnsucht nach dem Job an der<br />
Met und im Big Apple.<br />
© Reinhard Engel, medaivilm<br />
Von Marta S. Halpert<br />
Sie denkt gar nicht daran, ihre<br />
Gefühle, ihre Wehmut zu verbergen.<br />
Dafür ist Sissy Strauss<br />
viel zu offen und direkt. Bereut<br />
sie den Umzug nach<br />
Wien? „Ja, natürlich, ständig und täglich“,<br />
sprudelt es aus der aparten Frau mit den<br />
strahlend blauen Augen hervor. Aber die<br />
Sehnsucht gilt nicht nur der Stadt New<br />
York, „sondern den beiden Sachen, die ich<br />
geliebt habe und die ich jetzt nicht mehr<br />
haben kann: meinen Job an der Metropolitan<br />
Opera und die Gegend, in der wir<br />
gelebt haben.“ Nur zwei Häuserblocks<br />
von der Met entfernt lag die Wohnung<br />
mit einem atemberaubenden Blick von<br />
der Dachterrasse über die Stadt. Aber<br />
auch den Doorman, der sie rührend bewacht<br />
hatte, vermisst sie. Wenigstens der<br />
Fahrstuhlführer, ein Serbe mit Familie in<br />
Wien, kam sie bereits zu Silvester hier<br />
besuchen.<br />
Hier, das ist eine großbürgerliche, gemütliche<br />
Wohnung mit charmantem<br />
Flair innerhalb des Gürtels. Riesige Ölgemälde<br />
der jüdischen und nicht-jüdischen<br />
Vorfahren aus der Welt der Großindustrie<br />
Brünns umgeben die elegant<br />
leger gekleidete Gastgeberin – und ge-<br />
nau als solche hat sie sich einen legendären<br />
Ruf erworben. Beruflich für die<br />
Betreuung der internationalen Künstler<br />
an der Met zuständig, wusste sie um<br />
deren Einsamkeit in der Riesenmetropole:<br />
„Für eine Neuproduktion oder eine<br />
Wiederaufnahme sitzen sie sechs bis acht<br />
Wochen allein in New York und kennen<br />
niemanden“, erzählt<br />
Sissy, und Ehemann Max<br />
fügt hinzu: „Hier in Europa<br />
kann man über das<br />
Wochenende nach Berlin<br />
oder Paris heimfliegen,<br />
von den USA aus<br />
ging das gar nicht.“ Mehr<br />
als vierzig Jahre stand ihr<br />
New Yorker Zuhause unzähligen<br />
internationalen<br />
Stars aus aller Welt offen:<br />
„Auf meinen zwei Riesenherden<br />
konnte ich für 80<br />
Gäste leicht Gulasch machen:<br />
40 Pfund Fleisch,<br />
30 Pfund Zwiebel, das ging noch. Aber<br />
in den letzen 20 Jahren kamen immer<br />
mehr – so bis zu 200 Personen –, und da<br />
musste ich auf Pasta Bolognese umstellen.<br />
Das war kein Problem, es gab gute<br />
fertige Pasta-Saucen, und ein Packerl<br />
Nudeln kann man immer noch ins Was-<br />
„Ich war eine<br />
miserable Studentin,<br />
ich habe<br />
immer nur die<br />
Hetz’ gesucht.“<br />
Sissy Strauss<br />
ser hauen“, lacht Sissy, die jetzt auch in<br />
Wien gelegentlich die berühmt-beliebten<br />
„Pasta Partys“ veranstaltet. „Gulasch<br />
geht nur mehr für zehn bis zwölf Freunde<br />
bei Tisch.“<br />
Als „Salondame“ oder gar „Salonlöwin“<br />
sieht sie sich nicht gerne tituliert,<br />
obwohl auch der jüngst über sie gedrehte<br />
Film Der letzte Salon<br />
von ihren gesellschaftlichen<br />
Aktivitäten<br />
in diesem Sinne<br />
handelt. Der deutsche<br />
Autor und Regisseur<br />
Joachim Dennhardt<br />
zeichnet ein sehr feinfühliges<br />
Porträt der<br />
Grande Dame der<br />
Metropolitan Opera<br />
und verewigt darin<br />
jenen „letzten Salonabend“,<br />
den Sissy und<br />
Max Strauss vor ihrem<br />
Umzug nach<br />
Wien im August 2015 für ihre befreundeten<br />
Künstler gegeben haben. Spontane<br />
großartige Soloarien, Duette und Quartette,<br />
die alle als Liebeserklärung an Sissy<br />
gedacht sind, bereichern diesen Film, der<br />
mit dem Hollywood International Independent<br />
Documentary Award 2016<br />
wına-magazin.at<br />
31
MUSIK & FREUNDSCHAFTEN<br />
Schenk & Strauss. Seit einem<br />
halben Menschenleben sind sie<br />
eng befreundet, und die Verbindung<br />
reicht von Wien bis nach<br />
New York – und zurück.<br />
ausgezeichnet wurde. Die Spitzentenöre<br />
Juan Diego Flórez und Piotr Beczala,<br />
die Mezzosopranistinnen von<br />
Weltrang Elina Garanča und Elena<br />
Maximova gehören ebenso zu den<br />
Stars, die Ständchen für die großzügige<br />
Gastgeberin anstimmen, wie Anna Netrebko.<br />
„Sie ist ein besonders warmherziger<br />
Mensch und lustiger Kumpel“, erzählt<br />
Sissy, die sich jetzt in Wien kaum<br />
der vielen Einladungen erwehren kann.<br />
Anna<br />
Netrebko.<br />
Zu Gast bei<br />
Sissy: „Ein<br />
besonders<br />
warmherziger<br />
Mensch<br />
und lustiger<br />
Kumpel.“<br />
Zurück in<br />
Österreich. In<br />
den eineinhalb<br />
Jahren in Wien<br />
haben Sissy<br />
und ihr Mann<br />
Max inzwischen<br />
zu sechs<br />
Kultursalons<br />
eingeladen.<br />
„Vielleicht hoffen sie dann, irgendwann<br />
bei uns die Netrebko zu treffen – und<br />
manchmal passiert das sogar“, schmunzelt<br />
Strauss. Elina Garanča nannte sie liebevoll<br />
„unsere Met-Mama“ und meinte,<br />
Sissys Salon in New York sei einer der<br />
wenigen Orte in der hektischen Opernwelt<br />
gewesen, wo man sich zuhause fühlen<br />
konnte. „Die Met ohne sie ist nahezu undenkbar“,<br />
sagte Chefdirigent James Levine<br />
bei Sissys Pensionierung 2014.<br />
Von Opernleidenschaft und „Wiener-Brünner<br />
jüdischen Mafia“. Doch<br />
wie kommt eine wohlbehütete junge Frau<br />
Mitte der 1960er-Jahre allein in die USA?<br />
Nach der Matura wusste Sissy nicht, was<br />
sie studieren sollte. „Wenn man das nicht<br />
weiß, geht man meistens an die juridische<br />
Fakultät“, erzählt sie. Ihr Vater hatte zwar<br />
Medizin studiert, widmete sich aber dem<br />
Theaterbetrieb, u. a. leitete er das Theater<br />
in der Liliengasse und später das Ateliertheater<br />
am Naschmarkt. „Ich war eine<br />
miserable Studentin, ich habe immer nur<br />
die Hetz’ gesucht“, gibt sie freimütig zu.<br />
Die Musik und die Liebe zur Oper hatte<br />
ihr der Vater bereits in die Wiege gelegt,<br />
und so arbeitete sie unentgeltlich mit ihren<br />
engen Freunden im Büro der Jeunesse<br />
Musicale. „Das war eine wichtige Station<br />
in meinem Leben: Ich war zwar weder in<br />
einem Chor, noch habe ich ein Instrument<br />
gespielt, aber die Musik ging mir<br />
ans Herz.“ Der unruhige Geist wollte<br />
weg aus Wien, weg von der Familie und<br />
Englisch lernen.<br />
Die Cousine ihrer Mutter war nach<br />
Montreal ausgewandert und lud sie bei<br />
ihren Wien-Besuchen immer wieder<br />
nach Kanada ein. „Sie war die Tochter<br />
des Bruders meiner Großmutter und hat<br />
als einzige den Holocaust überlebt, weil<br />
sie in Prag und Brünn versteckt war; ihre<br />
ganze Familie ist umgekommen. Sie hat<br />
nach dem Krieg einen Architekten geheiratet.<br />
Als dann die Kommunisten kamen,<br />
sind sie nach Kanada ausgewandert.“<br />
Sissy organisierte ihre Reise hinter<br />
dem Rücken der Eltern: Sie bekam am<br />
kanadischen Konsulat problemlos ein<br />
Immigrationsvisum, das Geld für das<br />
One-Way-Ticket nach Montreal streckte<br />
© medaivilm<br />
32 wına | Mai 2017
NEW YORK WIEN<br />
ihr die Caritas vor. Sie hatte eine Arbeitserlaubnis,<br />
konnte kaum Englisch und begann<br />
deshalb, in einem schicken Warenhaus<br />
Büstenhalter und Korsetts zu<br />
schlichten. Bei einem deutschen Flüchtling,<br />
der behauptete, Engländer zu sein,<br />
nahm sie Privatstunden und besserte innerhalb<br />
von fünf Monate ihre Sprachkenntnisse<br />
wesentlich auf. „Meine Tante<br />
hatte einen großen Freundeskreis, ich<br />
habe sie immer die „Wiener-Brünner<br />
jüdische Mafia“ genannt. Einen dieser<br />
Brünner Freunde lernte ich bei einem<br />
Brunch kennen. Er lebte in New York,<br />
und als ich ihn dort auf dem Rückweg<br />
von eine Europareise besuchte, fragte er<br />
mich nach einer Woche, ob ich ihn heiraten<br />
wolle.“ Sechs Monate<br />
später wurde geheiratet,<br />
aus dieser Ehe<br />
stammt ein Sohn.<br />
Sissys Salon entsteht.<br />
Sissy lebte in einem<br />
beschaulichen Vorort<br />
von New York, etwa<br />
45 Minuten von Manhattan<br />
entfernt, langweilte<br />
sich und spielte<br />
täglich rund vier Stunden<br />
Bridge. „Das habe<br />
ich fast drei Jahre so gemacht.<br />
Dann sagte ich<br />
mir, ich bin nicht einmal<br />
30 Jahre alt, ich will mein<br />
Leben nicht so verbringen!“<br />
Freunde, die auch<br />
aus Wien emigriert waren, kannten die<br />
künstlerische Betriebsleiterin an der Metropolitan<br />
Opera – und die suchte einen<br />
Volontär. Drei Jahre arbeitete Sissy unbezahlt<br />
in diesem Büro: „Ich habe noch<br />
Italienisch und etwas Spanisch gekonnt<br />
und aus den internationalen Opernmagazinen<br />
herausgesucht, wo welcher<br />
Künstler welche Partie singt. 1975 gab es<br />
ja noch keinen Computer, und ich hatte<br />
eine riesige Kartothek angelegt, die für<br />
das künstlerische Betriebsbüro sehr hilfreich<br />
war.“ So lernte sie mit der Zeit eine<br />
große Zahl an Dirigenten, Regisseuren<br />
und Sängern kennen. Vier Jahre später<br />
Der letzte Salon.<br />
Sissy Strauss,<br />
New York – Wien.<br />
Buch & Regie:<br />
Joachim Dennhardt;<br />
Produzent: Mario Hann<br />
„Ich bin ein<br />
Spezialist in<br />
billigen Weinen“,<br />
bekennt Max<br />
schmunzelnd.<br />
„Wenn die Leute<br />
exquisit essen<br />
wollen, müssen<br />
sie ins Restaurant<br />
gehen.“<br />
bekam Sissy eine neue Chefin, und diese<br />
bot ihr einen Vollzeitjob mit Bezahlung<br />
an. Da Sissy inzwischen mit ihrer Familie<br />
wieder in Manhattan wohnte, nahm<br />
sie freudig an.<br />
„Die meisten Sängerinnen<br />
und Solisten<br />
konnten damals kaum<br />
Sprachen. Der Otti<br />
Schenk war da eine<br />
Ausnahme, der sprach<br />
ganz gut Englisch. Ich<br />
kümmerte mich um<br />
Wohnungen für sie,<br />
um Arzttermine und<br />
vieles mehr.“ Die ersten<br />
kleinen Einladungen<br />
zum Abendessen<br />
machte Sissy noch,<br />
als sie im ländlichen<br />
Bronxville lebte. Ihr<br />
damaliger Mann war<br />
geschäftlich viel gereist,<br />
und so begann<br />
sie, kleine Essen für<br />
die einsamen Großstadtkünstler zu machen.<br />
Auch ihren Max hat Sissy indirekt<br />
durch die Met kennengelernt. „Jeffrey<br />
Tate war 1979 Assistent von James<br />
Levine an der Met und vorher auch bei<br />
Herbert von Karajan. Max und ich waren<br />
unabhängig voneinander sehr befreundet<br />
mit Tate. Er hat uns vorgestellt, aber wir<br />
waren damals beide verheiratet. Erst als<br />
unsere Ehen zerbrachen, haben wir uns<br />
näher kennengelernt.“<br />
Seit 1983 lebt Sissy mit Max Strauss,<br />
der in Hamburg geboren wurde, aber in<br />
Amerika aufwuchs, wo er als Industrieller<br />
erfolgreich war. War er auch so ein<br />
Opernfan? „Ich lebte eine Zeit lang in<br />
Holland und bin gerne ins Concertgebouw<br />
zu Konzerten gegangen, so habe<br />
ich auch Jeffrey Tate kennengelernt. Als<br />
ich nach New York zurückkam, war Bizets<br />
Carmen meine erste und einzige<br />
Oper, die ich gehört hatte. Aber da ich<br />
ganz nah bei der Met gewohnt habe,<br />
bin ich öfter auf gut Glück – auch ohne<br />
Karte – hingegangen“, lacht Strauss. Gab<br />
es Künstler, um die sie sich gekümmert<br />
haben und die sie dann in der Folge<br />
menschlich enttäuscht haben? „Nein,<br />
Sänger und Sängerinnen sind besonders<br />
nette und anhängliche Menschen“,<br />
beeilt sich Sissy zu versichern. Dann zählen<br />
beide auf, wie tiefgreifend und ausdauernd<br />
die Freundschaften mit Größen<br />
wie Edita Gruberova, Gwyneth Jones,<br />
Placido Domingo oder Christa Ludwig<br />
sind. „Für René Pape waren wir seine<br />
amerikanischen Eltern.“<br />
In den eineinhalb Jahren in Wien<br />
haben Sissy und Max inzwischen sechs<br />
große Partys veranstaltet: „Ich habe<br />
schon 650 Flaschen Wein in Wien gekauft“,<br />
berichtet Max voller Stolz. Ist er<br />
so ein Weinkenner? „Nein, ich bin ein<br />
Spezialist in billigen Weinen“, bekennt<br />
er schmunzelnd. „Wenn die Leute exquisit<br />
essen wollen, müssen sie ins Restaurant<br />
gehen“, sekundiert Sissy humorvoll.<br />
Gesellschaftlich ist das Ehepaar Strauss<br />
in Wien angekommen, dennoch schimmert<br />
ein wenig verklärter Seelenschmerz<br />
nach der ganz großen Weltbühne bei den<br />
Erzählungen durch. <br />
wına-magazin.at<br />
33
SÜSSES HANDWERK<br />
Süßes aus der<br />
Manufaktur<br />
In der Chocolaterie<br />
Fabienne bieten Vater<br />
Yoram Hess und sein<br />
Sohn Jonathan handgemachte<br />
belgische Pralinen<br />
an. Wiener Kunden<br />
können gustieren und sich<br />
ihre Schokomischungen<br />
Text und Foto: Reinhard Engel<br />
Die weiß lackierten Ziegelwände<br />
kontrastieren kühl mit den sorgfältig<br />
aufgeschichteten Stapeln<br />
kleiner Köstlichkeiten in unterschiedlichen<br />
Brauntönen. Das Konfektgeschäft<br />
Fabienne in der Wiener Innenstadt wirkt<br />
wie ein schickes Loft, man könnte sich<br />
leicht in Manhattan vermuten, in London<br />
oder in einem bürgerlichen Pariser Bezirk.<br />
„Wir sind vor wenigen Monaten hierher<br />
in die Riemergasse übersiedelt“, erzählt<br />
Jonathan Hess, der Juniorchef. „Unser altes<br />
Geschäft war schon ein wenig in die<br />
Jahre gekommen. Mit dem Umzug haben<br />
wir auch das Gold von den Verpackungen<br />
genommen, sind cleaner und moderner<br />
geworden.“ Fabienne war von seinem<br />
Vater Yoram vor 30 Jahren gegründet worden,<br />
wenige Blocks entfernt, in der Wollzeile.<br />
Und Fabienne konnte sich in diesen<br />
Jahren einen soliden Stammkundenstock<br />
von Wiener und niederösterreichischen<br />
Naschkatzen aufbauen.<br />
Dabei hatte der Gründer eigentlich –<br />
abgesehen von seinem eigenen Hang zum<br />
Süßen – keine Beziehung zu dieser Branche<br />
gehabt. Yoram Hess, Jahrgang 1953,<br />
wurde in Israel geboren und studierte in<br />
Aachen Maschinenbau. „Ich komme aus<br />
einer linken israelischen Familie, da waren<br />
die klassischen Diaspora-Studien wie<br />
selbst zusammenstellen,<br />
ins übrige Österreich<br />
wird per Post geliefert.<br />
Arzt oder Anwalt verpönt. Ich sollte als<br />
Techniker Israel weiterbringen.“ Aachen<br />
wählte er wegen des hervorragenden Rufs<br />
der Rheinisch Westfälischen Technischen<br />
Hochschule und weil es dort schon einige<br />
israelische Studenten gab. „Außerdem<br />
stammte mein Vater aus Deutschland,<br />
und ich konnte etwas Deutsch.“<br />
Die Idee mit dem Import belgischer<br />
Schokolade war Hess schon während seiner<br />
Studienzeit in Aachen gekommen. Er<br />
hatte wiederholt jenseits der nahen Grenze<br />
diese Köstlichkeiten gekostet. „Als mich<br />
dann die Liebe nach Wien verschlagen hat,<br />
habe ich gedacht, das müsste auch hier gut<br />
funktionieren, und habe ein Geschäft aufgemacht.“<br />
Das war Ende der 80er-Jahre.<br />
„Wir führen heute 80 verschiedene Pralinen<br />
von 16 belgischen Lieferanten“, erzählt<br />
der Junior Jonathan. „Und das sind<br />
durchwegs keine Industriefirmen, sondern<br />
kleine Manufakturen in der Provinz – mit<br />
Handarbeit. Sie liefern stets frische Ware,<br />
ohne Konservierungsmittel.“<br />
Doch so gerne die beiden das Süße haben,<br />
ganz abhängig wollen sie davon nicht<br />
sein. Und das müssen sie auch nicht. Hess<br />
Senior war nach dem Studium zunächst<br />
nach Israel zurückgekehrt und hatte einen<br />
Job bei einem namhaften Schmuckhersteller<br />
angenommen. „Die haben Halbfertigwaren<br />
erzeugt aus unterschiedlichen<br />
Edelmetallen, ähnlich wie die Ögussa<br />
hier.“ Einen Ingenieur mit einschlägigen<br />
Sprachkenntnissen brauchte man, weil<br />
der Großteil des Maschinenparks aus<br />
Deutschland stammte. Doch er blieb nicht<br />
lange in seinem ursprünglichen Technikfeld.<br />
Bald sandte ihn die Firma nach Europa,<br />
um in England, Deutschland und<br />
Österreich den Vertrieb aufzubauen. Dann<br />
lernte er seine Frau kennen, heiratete und<br />
zog nach Wien.<br />
Nach wenigen Jahren machte er<br />
sich mit dem Verkauf von israelischem<br />
Schmuck selbstständig, und das sehr erfolgreich.<br />
Heute gehören zu den Kunden<br />
seines 12-Mitarbeiter-Unternehmens<br />
Kaufhof und Otto in Deutschland, der<br />
riesige englische Versandhändler Argos,<br />
das Dorotheum oder Hartlauer in Österreich.<br />
„Wir bewegen uns im unteren und<br />
mittleren Segment, das heißt, nichts ist<br />
teurer als 2.000 Euro im Endverkauf“, erklärt<br />
Yoram Hess. „Und wir liefern nicht<br />
an einzelne Juweliere, nur an den Großhandel<br />
oder an Ketten.“<br />
Auch sein technikaffiner Sohn Jonathan,<br />
geboren 1991, betreibt daneben<br />
ein eigenes Unternehmen, schon seit er<br />
34 wına | Mai 2017
Vater & Sohn.<br />
Yoram (re.) und<br />
Jonathan (li.)<br />
Hess versüßen<br />
das Leben ihrer<br />
Kunden mit<br />
feinsten<br />
Pralinen.<br />
18 ist. Mittlerweile 12 Mitarbeiter<br />
in seiner Medienund<br />
Showtechnikfirma stellen<br />
Licht, Tonanlagen oder<br />
Bühnen für unterschiedliche<br />
Veranstaltungen zur Verfügung.<br />
Das kann eine einfache<br />
Pressekonferenz sein<br />
oder ein ganzer Abend mit<br />
Musik und Gesang wie etwa<br />
im Wiener Palais Schönburg, als Yoram<br />
Hess im März gemeinsam mit der Sopranistin<br />
Chen Reiss die hiesige Freundesgesellschaft<br />
für das Israel Philharmonic<br />
Orchestra ins Leben rief.<br />
Jonathan ist inzwischen nicht nur bei<br />
den schokoüberzogenen Fruchtstücken<br />
und Trüffeln Partner seines Vaters, sondern<br />
auch im Schmuckhandel. Denn in<br />
beiden Branchen werden Technik und<br />
IT immer wichtiger. Das betrifft etwa<br />
im Pralinengeschäft den Webshop und<br />
die Werbung auf diversen Internetplattformen<br />
sozialer Netze. Und das umfasst<br />
auch längst das Bestell- und Liefersystem<br />
von Schmuckstücken für die großen<br />
Kaufhäuser oder Kataloghändler. Deren<br />
Kunden wählen dort die Ware aus, verpackt<br />
und geliefert wird von Hess. „Es ist<br />
„Wir führen heute 80<br />
verschiedene Pralinen<br />
von 16 belgischen<br />
Lieferanten<br />
[...] keine Industriefirmen,<br />
sondern<br />
kleine Manufakturen<br />
in der Provinz –<br />
mit Handarbeit.“<br />
Jonathan Hess<br />
ganz entscheidend, dass wir<br />
diese Technologien beherrschen“,<br />
ist sich der Senior sicher.<br />
„Denn daran arbeiten<br />
alle anderen auch.“ Ebenso<br />
entscheidend ist aber, stets<br />
veränderte Kollektionen anzubieten<br />
und nicht nur neue<br />
Designs, sondern auch neue<br />
Materialien auszuprobieren.<br />
„Genaueres möchte ich dazu noch nicht<br />
sagen“, so Yoram Hess. „Aber wir suchen<br />
ständig nach Möglichkeiten, der Konkurrenz<br />
voraus zu sein. Das betrifft natürlich<br />
Herstellungstechniken wie Materialien.“<br />
Selbst im scheinbar simplen Schokoladegeschäft<br />
wird laufend modernisiert.<br />
Zwar bleiben die traditionellen Produktionsmethoden<br />
in Belgien dieselben.<br />
Aber schon längst fahren keine Lieferanten<br />
mehr quer durch Europa mit eigenen<br />
Kleinlastern, sondern DHL stellt die<br />
süße Ware kurzfristig je nach der saisonal<br />
wechselnden Nachfrage zu. Und mit<br />
dem neuen gekühlten Lieferservice der<br />
österreichischen Post „Daily Fresh“ bekommt<br />
jeder Kunde in Österreich seine<br />
Pralinen nach der Internetbestellung am<br />
nächsten Tag ins Haus. <br />
© Martin Steiger<br />
wına-magazin.at<br />
35
DAS FELD AM DACH<br />
URBAN FARMING:<br />
oben Gemüseplantage<br />
Mit der urbanen Landwirtschaft<br />
wird auch in Israel<br />
fleißig experimentiert, die<br />
Technologien sind vielfältig<br />
und überraschend einfach.<br />
Eines der Ziele der neuen<br />
israelischen Pioniere ist es,<br />
dass in Zukunft jeder<br />
Städter seinen eigenen<br />
organischen Gemüsegarten<br />
auf dem Fensterbrett<br />
oder Balkon<br />
anlegen kann.<br />
Von Daniela Segenreich-Horsky<br />
Die Gruppe von Nahrungsmittelberatern<br />
und Gastronomen<br />
aus Deutschland und<br />
Österreich klettert langsam<br />
die altmodischen labyrinthähnlichen<br />
Stockwerke des Shoppingcenters<br />
hoch. Das Dizengoff-Center am südlichen<br />
Ende der berühmten gleichnamigen<br />
Einkaufsstraße war das allererste seiner<br />
Art in Israel, und beinahe ist das etwas<br />
abgenützte und verblaste Flair der Siebzigerjahre<br />
schon wieder charmant und en<br />
vogue. Für die Besucher geht es bei dieser<br />
vom Zukunftsfonds organisierten Reise<br />
um das Thema Food, also um Trends in der<br />
Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln<br />
– ein wichtiges Thema für<br />
die Zukunft.<br />
Fünfzehn Minuten von der Farm bis<br />
auf den Teller. „Wir pflanzen hier auf<br />
650 Quadratmetern jeden Monat etwa<br />
hunderttausend Setzlinge, die wir dann<br />
an Geschäfte und Restaurants hier im<br />
Zentrum und im nahen Umkreis auch<br />
an private Haushalte verkaufen“, erzählt<br />
der junge Farmer Lavi Kushelevich seinen<br />
staunenden Gästen, als sie aus dem<br />
lauten Tumult der Verkaufsetagen in die<br />
sonnige Idylle auf dem Dach<br />
des Einkaufszentrum hoch oben<br />
über den Straßen von Tel Aviv<br />
hinaustreten. Wichtig sei dabei,<br />
dass die hier angebauten Salatblätter<br />
oder Mangos möglichst<br />
schnell und frisch von der Farm<br />
zum Endverbraucher kommen:<br />
„Der Weg von Obst und Gemüse<br />
zum Konsumenten kann<br />
oft Wochen dauern, bei Importware<br />
sogar Monate. Die Ware,<br />
die die Konsumenten dann hier<br />
im Supermarkt kaufen, hat meist<br />
schon Tausende von Kilometern<br />
in Lkws oder Flugzeugen<br />
zurückgelegt. Unser Salat dagegen<br />
ist in zehn Minuten unten<br />
in einer Restaurantküche und in<br />
fünfzehn Minuten am Teller des<br />
Gastes.“<br />
Zu TuBiShvat, dem Neujahrsfest<br />
der Bäume im Frühling,<br />
kommen besonders viele Gruppen<br />
von Kindern und Jugendlichen, um Setzlinge<br />
auf dem Dach zu pflanzen und von<br />
einem völlig neuen Blickwinkel aus darüber<br />
zu lernen, „wie einfach man selbst anbauen<br />
und gesund essen kann“. Im Bereich<br />
der Erziehung sieht Lavi eine wichtige<br />
Aufgabe, aber auch die Entwicklung von<br />
Technologien für die Zukunft steht hoch<br />
oben auf seiner Prioritätenliste. Es geht<br />
unter anderem darum, neue platz- und<br />
wassersparende Technologien für den Anbau<br />
von Obst und Gemüse auszuprobieren,<br />
die leicht anzuwenden und auch leicht<br />
zu exportieren sind und auch in Afrika<br />
oder China angewandt werden können –<br />
eine Aufgabe, die in Hinblick auf die immer<br />
weiter wachsende Weltbevölkerung<br />
immer dringender wird. Im Gemüseanbau<br />
in der Großstadt liegt eine denkbare<br />
Alternative zur heute üblichen Landwirtschaft,<br />
denn in etwa fünfzig Jahren werden<br />
nach Schätzung der Vereinten Nationen<br />
achtzig Prozent aller Menschen in Großstädten<br />
leben, weit weg von den Anbaugebieten.<br />
Zugleich soll es bis dahin um drei<br />
Milliarden mehr Menschen auf der Welt<br />
geben, und die herkömmlichen Anbauflächen<br />
werden dann nicht mehr ausreichen,<br />
um den ständig steigenden Nahrungsbedarf<br />
aller zu decken.<br />
36 wına | Mai 2017
INNOVATION AQUAPONIE<br />
Aquaponische Systeme<br />
erlauben es, Gemüse und<br />
Fische gemeinsam wachsen<br />
zu lassen.<br />
deren Seite kommen dann flüssiger Dünger<br />
und Gas zum Kochen heraus. „Dieses<br />
Gas wird dann manchmal von den Chefs<br />
verwendet, die hier oben ihren Gästen demonstrieren,<br />
wie man ein besonders frisches<br />
und gesundes Menü kocht“, erklärt<br />
Lavi. Na, dann: Bon Appetit!<br />
© Xxxxx, living green<br />
Die neuen Technologien könnten da<br />
Abhilfe schaffen: Sie erschließen neue<br />
Anbauflächen und brauchen weniger Platz<br />
und Energie als die traditionelle Landwirtschaft.<br />
Außerdem benötigen die in<br />
den hydroponischen Systemen angebauten<br />
Gurken und Tomaten auf dem Dizzengoff-Center<br />
um etwa achtzig Prozent<br />
weniger Bewässerung als Gemüse aus dem<br />
konventionellen Anbau, weil das Wasser<br />
nicht im Boden versickert, nachdem es die<br />
Wurzeln der Pflanzen genährt hat, sondern<br />
erhalten bleibt. Und auch der Einsatz<br />
von Pestiziden ist hier oben nicht notwendig,<br />
womit die Produkte als „organisch“<br />
gelten können.<br />
Lavi und sein Team haben einige interessante<br />
Methoden und Hydrotechnologien<br />
entwickelt und getestet, die zum<br />
Teil auch auf dem kleinsten Balkon angewandt<br />
werden können. „Wir wollen den<br />
Städtern hier in Israel zeigen, wie sie ihren<br />
organischen Spinat ohne viel Aufwand zu<br />
Hause anbauen können“, meint der Agronom.<br />
„Alles, was diese Pflanzen brauchen,<br />
sind Luft, ein wenig Wasser und Sonne,<br />
und von der haben wir hier ja genug ...“<br />
Die Wurzeln der Salat- und Gemüseblätter,<br />
die in den großflächigen Wannen<br />
„Unser Salat ist in<br />
zehn Minuten unten<br />
in einer Restaurantküche<br />
und in fünfzehn<br />
Minuten am<br />
Teller des Gastes.“<br />
Lavi Kushelevich<br />
auf dem Dach des Kauftempels wachsen,<br />
floaten im Wasser. Sie brauchen, ebenso<br />
wie die Setzlinge in den verschiedenen<br />
Rohrtürmchen, keine Erde. Daneben<br />
schwimmen in einem Pool Goldfische,<br />
die in einem aquaponischen System<br />
durch ihre Ausscheidungen den Dünger<br />
für die Pflanzen schaffen. Und gegenüber<br />
steht eine Kompostbox, in die auf der einen<br />
Seite Bioabfall geworfen wird – auf der an-<br />
Tel Aviv als Food-Mekka und Trendsetter.<br />
Die Farm auf dem Dach ist nicht<br />
das einzige Unternehmen, dass die österreichische<br />
Trendforscherin Hanni Rützler<br />
und ihre Food-Touristen-Gruppe in<br />
Staunen versetzt: „Es gibt hier in Israel so<br />
viele kulinarische Welten, die miteinander<br />
harmonisieren! Die Küche ist frisch und<br />
gesund und hat kulinarischen Tiefgang“,<br />
schwärmt die diplomierte Ernährungswissenschaftlerin,<br />
die Israel zum Schwerpunkt<br />
ihres Food Report 2017 gewählt hat.<br />
Auch der Levinsky-Markt in Süd-Tel-<br />
Aviv hat großen Eindruck hinterlassen:<br />
„Man sieht dort erst auf den zweiten Blick<br />
die tolle Spezialisierung ... Zum Beispiel<br />
die hohe Qualität und das große Sortiment<br />
an Hülsenfrüchten. Und auch der<br />
Meat-Market ist unglaublich beeindruckend,<br />
all diese jungen, engagierten Unternehmer<br />
haben einen völlig neuen Zugang<br />
zum Thema Fleisch.“<br />
Besonders überrascht ist Rützler von<br />
der Vielfalt und Qualität der israelischen<br />
Küche. Sie meint, dass die dritte Generation<br />
von Israelis mit großem Selbstbewusstsein<br />
zurück zu den Wurzeln geht<br />
und das kulinarische Erbe ihrer jeweiligen<br />
Herkunftsländer neu interpretieren<br />
kann: „Das führt dazu, dass sie spielerisch<br />
und kreativ mit diesen kulinarischen Zitaten<br />
umgehen können. Es gibt in Tel<br />
Aviv heute im Food-Bereich eine ganz<br />
tolle, junge, urbane Szene - von der kleinen<br />
Imbissstube bis zum teuren Restaurant<br />
-, die hervorragend ist!“ Dabei sieht<br />
sie auch hier den Trend weg von der traditionellen<br />
schweren Mahlzeit mit drei<br />
Gängen. „In“ sind laut der Trendforscherin<br />
vielfältige Mezze, also viele kleine, kreative,<br />
frische Gerichte, die man formlos<br />
untereinander teilen kann: „Da liegt ein<br />
kulinarischer Schatz, da gibt es noch viel<br />
zu heben!“ <br />
Info: livingreen.co.il/en/urbanfarming-israel-en<br />
wına-magazin.at<br />
37
WINAFINESPITZ<br />
Das Kräutlein auf der Suppe<br />
Schon Paracelsus meinte, alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel seien Apotheken,<br />
und ging dabei auf die Heilkraft der Kräuter ein. Eine der schönsten Nebensachen der Welt<br />
sollte man dabei nicht außer Acht lassen – den wohltuenden Geschmack vieler Kräuter.<br />
Appetizer. Zwei<br />
Handvoll Kräuter<br />
mit der Gurke,<br />
Knoblauch,<br />
Zitronensaft,<br />
saurer Milch und<br />
Öl pürieren und<br />
fein abschmecken.<br />
Wenn in Wien jemand als „Kräutl auf jeder Suppe“ bezeichnet<br />
wird, so ist diese Beurteilung meist wenig<br />
schmeichelhaft, ist doch damit eine Person gemeint, die immer<br />
und überall dabei sein muss, ohne jedoch Wünschenswertes<br />
beizutragen.<br />
Im wahren Wortsinn allerdings ist das Kräutlein in jeder<br />
Suppe oder auch in jedem anderen Gericht mehr als begrüßenswert.<br />
Und gerade im Frühling bringen die grünen Energiespender<br />
nicht nur viel Geschmack in das Essen, sondern<br />
auch Wohlbefinden für Körper und Geist. Die Macht der<br />
Kräuter spielte im Lauf der Menschheitsgeschichte unterschiedliche<br />
Rollen, und aus geheimnisvollen Gemischen und<br />
Destillaten, die nur Wissenden bekannt waren, aus Arzneien<br />
und Giftmischungen, aus Liebestränken und Schlafmitteln<br />
sind heute schmackhafte und bekömmliche Zutaten unserer<br />
frischen lokalen Küche geworden. Aus Hexen und Alchemisten,<br />
die in die Geheimnisse um die<br />
© Scheriau & Typolt<br />
Wirkungen eingeweiht waren und daher eine<br />
bedeutende Rolle in der jeweiligen Gesellschaft<br />
eingenommen haben, sind Köchinnen<br />
und Köche geworden, die mit ihren Kreationen<br />
begeistern und verzaubern. Dass Kräuter<br />
aus unserem Leben nicht wegzudenken<br />
sind, steht fest, und dass sie über ihren physischen<br />
Einsatz hinaus bedeutend<br />
sind, können wir alljährlich<br />
auf der Sederplatte sehen, wo die<br />
bitteren Kräuter eine besondere<br />
spirituelle Rolle spielen.<br />
Aber nicht nur Bitteres, auch<br />
viele andere Gewürzpflanzen<br />
kann man im Tanach aufspüren:<br />
der Kapernstrauch in Kohanim<br />
12,5 als Symbol für die<br />
Vergänglichkeit der Welt, Koriander,<br />
das „Wanzenkraut“ (von den Griechen<br />
wegen des muffigen Geruchs nach Koris =<br />
Wanze und Aneson = Anis benannt) in Ex<br />
16,31 oder Kümmel und Dill, deren Anbau<br />
in Jes 28,25 als wichtige Tätigkeit des Bauern<br />
erwähnt wird.<br />
Der heutige Geschmack ist zwar mehr<br />
nach Zitronenmelisse und Basilikum ausgerichtet,<br />
dennoch: Die jahrhundertealte Kultivierung<br />
unseres Kräuterbezugs lässt sich<br />
nicht verleugnen. In Europa machten sich<br />
in der Geschichte der Kräuterheilkunde vor<br />
allem die Benediktinermönche des frühen<br />
KRÄUTERSUPPE<br />
ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):<br />
2 Handvoll frische Kräuter<br />
(Petersilie, Schnittlauch, Basilikum,<br />
Oregano, Kresse, Minze ...)<br />
1 Salatgurke<br />
1 Knoblauchzehe gehackt<br />
1 Zitrone, Saft<br />
250 ml saure Milch<br />
3 EL Olivenöl<br />
Salz, Pfeffer<br />
einige Kräuter zum Bestreuen<br />
ZUBEREITUNG:<br />
Kräuter waschen, gut trocknen<br />
und mit einem scharfen Messer<br />
klein hacken. Gurke schälen,<br />
klein würfeln, einige Würfel beiseitelegen.<br />
Die Kräuter mit der<br />
Gurke, Knoblauch, Zitronensaft,<br />
saurer Milch und Öl pürieren.<br />
Mit Salz und Pfeffer würzen, evtl.<br />
mit Wasser verdünnen. In Suppenschalen<br />
anrichten, mit Gurkenwürfel<br />
und einigen Kräutern<br />
garnieren. Lässt sich gut vorbereiten<br />
und ist ein erfrischender<br />
Appetizer.<br />
Mittelalters verdient. Sie übertrugen die hebräischen und griechischen<br />
Texte und retteten so das Wissen um die Wirkung<br />
der Pflanzen bis in unsere Zeit. Sie legten in ihren Klöstern<br />
auch selbst Gärten an, um die Heilkräfte von Kräutern und<br />
Gewürzen nutzen zu können.<br />
Aber auch die jüdischen Gelehrten des Mittealters trugen<br />
zur Erweiterung des europäischen Kräuterwissens bei: In den<br />
Medizinschulen von Montpellier und Toulouse in Südfrankreich<br />
wurden die arabischen Übersetzungen antiker Quellen<br />
ins Hebräische transferiert und erweiterten das Wissen der<br />
ruhmreichen jüdischen Ärzte. Das Mittelalter wurde so zur<br />
Hochblüte der Heilkräuter- und Heilpflanzenwissenschaft.<br />
Und der legendäre Gelehrte der frühen Neuzeit, Paracelsus,<br />
meinte: „Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel<br />
sind Apotheken.“ Er trennte pflanzliche und mineralische<br />
Ausgangssubstanzen mit Hilfe alchemistischer Techniken<br />
und vereinte sie zu neuen Rezepturen. Mit<br />
der Erfindung des Buchdrucks verbreiteten<br />
sich nach und nach auch kräuterkundliche<br />
Schriften.<br />
Und tatsächlich ist nicht nur der Geschmack<br />
der Kräuter ein ernstzunehmendes<br />
Thema, sondern auch ihre wohltuende<br />
bis heilende Wirkung: Kümmel und Koriander<br />
helfen bei Verdauungsbeschwerden<br />
und Magenschmerzen und sind daher<br />
ideal für schwere Kost, wie Kraut oder roher<br />
Fisch. Thymian lindert Husten und Bronchialinfekte<br />
und passt zu Pilzgerichten. Salbei<br />
heilt Zahnschmerzen und Wunden auf<br />
den Schleimhäuten und peppt jedes Geflügel<br />
auf. Rosmarin stärkt das Herz, wirkt<br />
anregend und ist der perfekte Begleiter für<br />
Lamm. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen,<br />
und wer sich damit intensiver beschäftigen<br />
möchte, dem sei eines der zahlreichen<br />
Fachbücher empfohlen.<br />
Nun aber zurück zum eigenen Lieblingskraut,<br />
das man frisch in kleinen Töpfen auf<br />
der Fensterbank ziehen kann - Küchenkräuter<br />
sind übrigens genügsam und dekorativ:<br />
Hier steht der persönliche Geschmack im<br />
Vordergrund, und das folgende Rezept, eine<br />
erfrischende kalte Kräutersuppe, kann nach<br />
Belieben variiert werden.<br />
<br />
<br />
Be’TeAvon und Le Chajim!<br />
Herzlichst, Finespitz<br />
38 wına | Mai 2017
MATOK & MAROR<br />
WEIN<br />
Der Grüne Veltliner<br />
Fass 4 vom Weingut<br />
Ott in Feuersbrunn<br />
am Wagram in Niederösterreich<br />
ist unter Kennern<br />
eine Legende. Vor<br />
etwa 20 Jahren wurde das<br />
vierte Veltliner-Fass einer<br />
Serie von einigen wissenden<br />
Kunden als das Beste<br />
seiner Art auserkoren, und<br />
seitdem sind die Flaschen<br />
mit dem interessanten grafischen<br />
Etikett immer<br />
rasch verkauft. Auch der<br />
Jahrgang 2015 ist wieder<br />
besonders gut gelungen. In<br />
vier Durchgängen im Oktober<br />
handverlesen lagerte<br />
der feine GrüVe im Stahltank<br />
bis Februar 2016,<br />
und wenn man die Flasche<br />
jetzt, mehr als ein Jahr danach,<br />
öffnet, tut sich ein<br />
wahres Geschmacks- und<br />
Dufterlebnis auf: von Zitrus<br />
über Vanille bis<br />
zu herbem Pfeffer<br />
und grasigen Kräutern<br />
auf dem Gaumen,<br />
frischer Apfel<br />
in der Nase, „zupackend<br />
frisch und unfassbar<br />
trinkfreudig“.<br />
Daher gilt:<br />
Wenn es irgendwo<br />
eine Flasche Fass<br />
4 zu haben gibt,<br />
gleich zugreifen,<br />
sonst ist sie vergriffen!<br />
ott.at<br />
Mit „Naches“<br />
Gesundes<br />
genießen<br />
Die Betreiber der Maschu-<br />
Maschu-Lokale eröffnen eine<br />
neue Gastrolinie mit vegetarischem<br />
Soul Food.<br />
Ich komme fast täglich hierher, mir taugt<br />
das“, lacht eine junge Frau, die sich gerade<br />
ein schickes Einmachglas mit diversen Salaten<br />
anfüllen lässt. Das Naches hat erst vor<br />
drei Wochen aufgesperrt und kann sich schon<br />
über mehr als eine Stammkundin freuen. „In<br />
der unmittelbaren Umgebung arbeiten ca.<br />
3.000 Menschen: im nahe gelegenen Finanzamt,<br />
im Verlag des Standard und<br />
so weiter“, erzählt Simon Deutsch,<br />
Gründer der drei Maschu-Maschu-<br />
Lokale. „Viele von ihnen möchten<br />
auch zu Mittag etwas Vernünftiges<br />
und nicht allzu Schweres essen.“<br />
Die drei Geschäftspartner<br />
Gerald Spennadel, Avi Yosfan und<br />
Simon Deutsch reagieren mit ihrem<br />
Pilotprojekt Naches auf den<br />
aktuellen Trend und die wachsende<br />
Nachfrage nach vegetarischen, zum Teil sogar<br />
veganen Speisen. „Falls unser Konzept hier<br />
aufgeht, werden wir uns um weitere Standorte<br />
bemühen, an denen es eine hohe Fluktuation<br />
an Menschen gibt“, sagt Spennadel und<br />
träumt schon von Naches-„Kindern“ auf dem<br />
WU-Campus, dem Flughafen oder in Spitälern.<br />
Er kümmert sich außerdem um das gegenüber<br />
gelegene Maschu Maschu in Wien-<br />
Landstraße, während Deutsch und Yosfan<br />
zusätzlich die Standorte in Neubau und der<br />
Innenstadt führen.<br />
Doch was unterscheidet das Naches von den<br />
erfolgreichen Maschu-Maschu-Lokalen? „Es<br />
gibt kein Fleisch und auch kein Falafel, dafür<br />
jede Menge an Gesundem: Quinoa, Linsen,<br />
Süßkartoffeln, Couscous, Chia-Samen, Sprossen,<br />
rote Rüben und vieles mehr“, erklärt Yosfan,<br />
der auch stolz hinzufügt, dass rund 80 Prozent<br />
der Kundschaft weiblich ist. Das Angebot<br />
reicht von einer Tagessuppe um 4,20 € bis zu<br />
einem warmen Tagesgericht, etwa einem Kürbis-Kichererbsen-Curry<br />
mit Basmati-Reis um<br />
7,20 €. Im Fokus steht die Vielfalt an frischen<br />
bunten Salaten: Tabouleh-Bulgur-Tomaten-<br />
Frühlingszwiebel und Minze oder Roter Reis<br />
© Reinhard Engel<br />
„Viele möchten<br />
auch zu Mittag<br />
etwas Vernünftiges<br />
und nicht<br />
allzu Schweres<br />
essen.“<br />
RESTAURANT- TIPP<br />
NACHES<br />
Sparefrohgasse 1, 1020 Wien<br />
Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 11–19 Uhr<br />
Tel.: +43/(0)664/261 30 03<br />
mit Butterkürbis und getrockneten<br />
Tomaten. Den<br />
Hummus gibt es in drei Variationen:<br />
klassisch mit Sesamsauce und Olivenöl,<br />
mit roten Rüben und Pinienkernen oder<br />
mit getrockneten Tomaten.<br />
Naches ist die jiddische Version des hebräischen<br />
Nachat und bedeutet so viel wie „Freude,<br />
Zufriedenheit“. Die Freude vermittelt sich auch<br />
bei den moderaten Preisen der hochwertigen<br />
Produkte: Salat klein kostet 4,90 €, die große<br />
Portion 6,50 €. Dazu wird Feigensenf, scharfes<br />
S’chuk, Erdbeer-Balsamico und selbstgemachtes<br />
Bärlauch-Salz angeboten. 100 Blumen heißt<br />
das leichte Craftbeer, es ist das einzige alkoholische<br />
Getränk, sonst beherrschen Softdrinks<br />
und Matchbata-Eistee die Kühlvitrinen. Alle<br />
Speisen gibt es zum Mitnehmen in Einmachgläsern,<br />
das Pfand kostet einen Euro. Das puristische<br />
Interieur lädt an einer Bartheke mit<br />
Hockern auch zum Verweilen ein, dabei kann<br />
man sich vielerlei Saucen und Zutaten für zuhause<br />
aussuchen. Für das schöne Wetter stehen<br />
schon Tische vor dem Naches bereit. „Im<br />
Sommer bieten wir dann auch Eis am Stiel an,<br />
ähnlich wie das israelische Produkt Artik“, freut<br />
sich Gerald Spennadel, „das wird ohne Milch<br />
produziert und ist damit koscher oder zumindest<br />
parve.“ Paprikasch<br />
wına-magazin.at<br />
39
GENERATION UNVERHOFFT<br />
Die Welt ist ihr<br />
Zuhause<br />
Eigentlich hatte Daliah Dombrowski nicht<br />
geplant, nach Israel auszuwandern. Dem Auslandsjahr<br />
folgte das Studium – und nun der perfekte Job.<br />
Ihre Abenteuerlust ist aber noch längst nicht gestillt.<br />
„Ich will schon noch woanders<br />
hin.“ Daliah Dombrowski<br />
Es war so, ‚Ooops, jetzt bin ich nach<br />
Israel ausgewandert‘ “, sagt Daliah<br />
Text & Foto:<br />
Dombrowski und schiebt den Laptop<br />
auf ihrem Schoß zurecht. Auf<br />
Anna<br />
Goldenberg<br />
der Wand hinter ihr ein Bild von<br />
Marilyn Monroe, links und rechts<br />
türmen sich Pölster. Gemütlich sieht sie aus, ihre<br />
Wohnung in Tel Aviv.<br />
Daliah, 28, war die Erste in der Freundesgruppe,<br />
die mit der Alija, der Auswanderung nach Israel, ernst<br />
machte. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend<br />
viel Zeit in der zionistisch-sozialistischen Jugendbewegung<br />
Hashomer Hatzair verbracht hatte, war die Option,<br />
mit der Organisation ein Jahr nach der Matura in<br />
Israel zu verbringen, attraktiv. Man lernte Hebräisch,<br />
arbeitete und lebte in einer Gemeinschaft.<br />
Nach dem Jahr ging sie trotzdem nach Wien zurück<br />
und schrieb sich für Architektur an der Technischen<br />
Universität ein. „Bei der ersten Vorlesung<br />
gab es keinen Platz im Raum für mich.“ Desillusioniert<br />
erkundete sie andere Möglichkeiten. In die<br />
USA? Zu teuer, zu weit weg. „Israel war leicht, weil<br />
ich es schon gekannt habe.“ Ideologische Gründe,<br />
wie sie sie nennt, gab es keine, nur pragmatische:<br />
Als Neuzuwanderin zahlte der Staat für ihre Studiengebühren<br />
und einen intensiven Hebräischkurs.<br />
Die Betreuungsverhältnisse an der Tel Aviv University,<br />
wo sie nun Geografie und Wirtschaft studierte,<br />
waren paradiesisch. Jetzt war Daliah also<br />
eine von denen, die im Ausland studierten. Im jüdischen<br />
Freundeskreis taten das mehrere, sie verbrachten<br />
die Semester in England, Frankreich oder<br />
Holland. Im Sommer traf man einander in Wien.<br />
Ende 2013, als Daliah schon ihren Master in<br />
Stadtplanung am Technion Haifa machte, gründete<br />
sie eine englischsprachige Theatergruppe, The<br />
Stage. Nun hatte sie etwas, ähnlich wie damals der<br />
Shomer, zu dem sie selbst aktiv beitrug, an das sie<br />
glaubte und das einen Freundeskreis entstehen ließ,<br />
der durch das gemeinsame Projekt zusammengehalten<br />
wurde. Irgendwann begann es sich so anzufühlen,<br />
als sei sie tatsächlich hergezogen.<br />
Dann kam letzten Herbst der Job, „der für sie erfunden<br />
wurde“, als Community Managerin bei der<br />
von Google gekauften Navigationsapp Waze. Das<br />
Büro ist in Tel Aviv, Daliah bereist nun die ganze<br />
Welt. Zuletzt kombinierte sie einen Geschäftstermin<br />
in Prag mit einer Wien-Visite. Sieht sie ihre<br />
Zukunft also in Israel? „Ich will schon noch woanders<br />
hin“, sagt sie, vielleicht nach Berlin. Auch<br />
Wien wäre eine Möglichkeit, wenn ihre Wiener<br />
Freunde nicht gerade alle woanders lebten, weil<br />
sie von ihren Auslandsstudien nicht zurückgekehrt<br />
waren. „Aber“, sagt sie und lächelt in die Kamera<br />
von ihrem Laptop, „wo man lebt, hat nicht so viel<br />
Bedeutung.“ <br />
40 wına | Mai 2017
KULTUR<br />
Meschuggene<br />
Kuscheltiere<br />
Charlemagne Palestines<br />
Einzelausstellung in Paris<br />
Hat hier jemand etwa Toys “R” Us geplündert?<br />
Oder eine Handgranate<br />
hineingeworfen? Das Musée d’art et<br />
d’histoire du Judaïsme zeigt einen irren<br />
Kindergeburtstag. Oder ist das Kunst?<br />
Aber ja ist das Kunst. Und zwar die<br />
Charlemagne Palestines. Der gebürtige<br />
New Yorker, dessen Eltern aus Odessa<br />
stammten, hatte 2015 eine Schau in<br />
Irrer Kindergeburtstag<br />
oder<br />
der Kunsthalle Wien.<br />
Kunst im Jüdischen<br />
Museum Heuer wird er, eigentlich<br />
Chaim Moshe Pa-<br />
in Paris?<br />
lestine, 70. Lange als<br />
Avantgardemusiker tätig,<br />
unter anderem mit Terry Riley, hat<br />
er ein höchst eigenwilliges, dabei putziges<br />
und durch und durch meschuggenes<br />
Lebenskunstwerk geschaffen,<br />
mit ganz vielen Teddybären, Kindersachen,<br />
Kinderspielzeug, knallbunt und<br />
erfrischend heiter. In Paris sind auch<br />
neueste Arbeiten zu sehen. Ob Anfassen<br />
erlaubt ist, fragen Sie am besten<br />
die Aufseher. A.K.<br />
© mahj, Gisèle Freund; IMEC,<br />
Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais<br />
MUSÉE D’ART ETI<br />
D’HISTOIRE DU JUDAÏSMEI<br />
bis 19. November 2017i<br />
mahj.orgI<br />
BUCH-TIPP<br />
Lorenz Jäger:<br />
Walter Benjamin:<br />
Das Leben eines<br />
Unvollendeten.<br />
Rowohlt 2017,<br />
400 S., € 26,95<br />
MUSIK-TIPPS<br />
BEN-HAIM<br />
Das kleine deutsche cpo-<br />
Label ist nicht genug zu loben für seine<br />
ambitionierte Programmarbeit in heutigen,<br />
für Entdeckungen auf CD harten<br />
Zeiten. Nun liegt Symphony No. 2<br />
von Paul Ben-Haim (1897–1984), abgeschlossen<br />
1945 und eine Synthese<br />
der Spätromantik, plus sein Concerto<br />
Grosso in einer höchst engagierten Einspielung<br />
der NDR Radiophilharmonie<br />
des 2015 verstorbenen Dirigenten Israel<br />
Yinon vor. Eine Entdeckung.<br />
FELDMAN<br />
Morton Feldmans Piano and<br />
Orchestra, simpel, abstrakt,<br />
schroff, zerbrechlich, ist das<br />
Gegengift zur Zerstreuungsunkultur.<br />
Die Pianistin Palais de<br />
Mari und das Radio-Sinfonieorchester<br />
Frankfurt unter dem Dirigat von Markus<br />
Hinterhäuser haben es 2000 subtil aufgenommen,<br />
das Label col legno hat den<br />
Silberling jetzt zum Sonderpreis neu<br />
aufgelegt. Repetitiv ausharrend, sich<br />
nie wiederholend, langsam und dezent<br />
dissonant: intime Musik zum Atemholen<br />
und Mitdenken.<br />
DAVID ORLOWSKY TRIO<br />
Musik hat keine Grenzen.<br />
Und auf der neuen CD Paris<br />
– Odessa (Sony) des David<br />
Orlowsky Trios hat auch Europa<br />
keine Grenzen. Das inzwischen<br />
mehrfach mit Preisen ausgezeichnete<br />
Trio des Klarinettisten führt<br />
in zwölf Tracks Klezmer, Klassik, Volksweisen,<br />
gehört und aufgeschnappt in<br />
Bukarest, Wien und in der Bukowina,<br />
zusammen. Das ist beschwingt, klug<br />
und macht gute Laune. Auch und erst<br />
recht auf ein vereintes Europa. AK<br />
Passagen<br />
Künstlerische Reflexionen zu<br />
Walter Benjamins „Passagen“-Buch<br />
Das Foto ist bekannt: Da sitzt ein etwas<br />
fülliger Essayist und Kulturphilosoph<br />
namens Walter Benjamin, 1933<br />
aus Berlin exiliert, an einem Tisch in der<br />
Pariser Nationalbibliothek und exzerpiert<br />
hoch konzentriert alte Bücher. Wie<br />
macht man daraus Kunst? Wie macht<br />
man aus Benjamins anspruchsvollem<br />
Passagenwerk über Paris und die vielgestaltigen<br />
Passagen der Seine-Stadt,<br />
1927 begonnen und bei seinem Suizid<br />
1940 nicht abgeschlossen, Kunst?<br />
Das zeigt das Jewish Museum New York<br />
durchaus eindrucksvoll mit seiner Schau<br />
The Arcades: Contemporary Art. Eine<br />
Vielzahl von Arbeiten sehr unterschiedlicher<br />
Künstlerinnen<br />
und Künstler, von Walker<br />
Evans bis Mike Kelley,<br />
von Joel Sternfeld,<br />
Walter<br />
Benjamin in<br />
der Pariser<br />
Nationalbibliothek.<br />
Cindy Sherman, Haris Epaminonda und<br />
Andreas Gursky bis zu Raymond Hains<br />
und Markus Schinwald, zeigen Reflexionen,<br />
ferne bis lose Echos und urbanistische<br />
Nähe. A.K.<br />
JÜDISCHES MUSEUM NEW YORK<br />
bis 6. August 2017<br />
thejewishmuseum.orgI<br />
41
WINA: Wie haben Sie die Werke ausgewählt?<br />
Aline Rezende Ich habe jeden der sechs<br />
Künstler einzeln in ihren Studios getroffen<br />
und mit ihnen gemeinsam jene<br />
Werke ausgewählt, die sie gemacht haben,<br />
weil sie es wollten. Viele der Künstler<br />
fertigen auch Auftragsarbeiten an. Ich<br />
habe ihnen aber gesagt, lass uns deinen<br />
Selbstausdruck präsentieren. Die Werke der Künstler sind sehr<br />
unterschiedlich, aber sie vervollständigen einander. Man spürt,<br />
dass sie alle Teil einer Gruppe sind. Aber man muss nicht gleich<br />
sein, um das Gleiche zu fühlen.<br />
Wie werden die unterschiedlichen Werke zusammenpassen?<br />
Der Fokus liegt auf der Einzigartigkeit und Verschiedenheit<br />
•<br />
innerhalb der Gruppe. Wir haben alle gemeinsam, dass wir in<br />
Wien arbeiten. Die Künstler haben gemeinsam, dass sie jüdisch<br />
sind, aber die Religion spielt in ihren Werken kaum eine Rolle.<br />
Anstatt sich darauf zu versteifen, was wir gemeinsam haben,<br />
richte ich den Blick auf die Unterschiede. Unsere Einzigartigkeit<br />
trennt uns nicht, sie bringt uns zusammen.<br />
Die Künstler wurden also ausgewählt, weil sie jüdisch sind, obwohl<br />
die Ausstellung selbst ihr Judentum kaum behandelt?<br />
Ich denke, es ist ein einmaliger Zugang und ein bisschen radikal.<br />
Auch wenn es in der Ausstellung nicht hauptsächlich um<br />
•<br />
Judentum gehen wird, ist sie doch Teil des jüdischen Festivals.<br />
Die Kulturkommission will zeigen, was zeitgenössische, junge<br />
jüdische Künstler machen – bevor sie jüdisch sind. Sie haben<br />
mich als nicht-jüdische Kuratorin eingeladen. Ich habe ihnen<br />
gleich gesagt, dass Religion ein sehr sensibles Thema ist, insbesondere,<br />
wenn es nicht die eigene ist. Für eine Ausstellung darüber<br />
wäre ich nicht die richtige Person. Sie sagten, dass sei der<br />
Grund, weshalb sie mich ausgewählt hatten.<br />
Fanden Sie es eine Herausforderung, dass die Kulturkommission<br />
die Künstler schon zuvor bestimmt hatte?<br />
INTERVIEW MIT ALINE REZENDE<br />
„Unsere Einzigartigkeit<br />
bringt uns zusammen“<br />
Gibt es junge jüdische Kunst<br />
aus Wien? Eine Ausstellung<br />
mit sechs Künstlern beim Festival<br />
der jüdischen Kultur soll<br />
diese Frage mit einem klaren<br />
„Ja“ beantworten. Warum sie<br />
sich auf die Räumlichkeiten im<br />
Brick-5 besonders freut und<br />
was ihre eigenen Erfahrungen<br />
zum Konzept beitragen, erzählt<br />
die Kuratorin Aline<br />
Rezende im Interview mit<br />
Anna Goldenberg.<br />
Es ist ein ungewöhnlicher Zugang<br />
•<br />
zum Kuratieren. Normalerweise würde<br />
ich zuerst über das Konzept nachdenken<br />
und dann über die möglichen Künstler.<br />
Aber die Ausstellungsvorbereitung verläuft<br />
nicht immer linear. Die Kulturkommission<br />
hat die Künstler mit gutem<br />
Grund ausgewählt. Das Thema des Festivals<br />
ist Österreich, und es ist ein jüdisches<br />
Festival. Wir haben die Auswahl diskutiert und sind zu<br />
dem Schluss gekommen, dass sie als Gruppe gut funktioniert.<br />
Die dreitägige Ausstellung findet im Veranstaltungszentrum<br />
Brick-5 statt, eine ehemalige Erbsenschälfabrik und vor dem<br />
Krieg ein jüdisches Kulturzentrum. Das ist keine klassische Galerie.<br />
Ist das ein Vor- oder Nachteil?<br />
Für mich haben so genannte Offspaces nur Vorteile. Wir sind so<br />
•<br />
gewohnt, Kunstwerke in einem Museum zu sehen, wo es strikte<br />
Regeln gibt und man die Dinge zum Beispiel nicht anfassen<br />
kann. Hier hingegen kann ich mit dem Raum spielen und zum<br />
Beispiel entscheiden, ob man Musik spielt, und kreativ darin sein,<br />
wie man die Werke platziert. Man kann Wein trinken, wenn man<br />
will. Kunst anzusehen, ist nie passiv, sondern aktiv. Man vergleicht<br />
die Werke, fragt sich, warum ist das hier, warum ist das Kunst. In<br />
einem Offspace kann man mit dieser Erfahrung mehr spielen.<br />
Wie empfanden Sie die Arbeit in großen Museen?<br />
Ich bin seit zehn Jahren als Kuratorin tätig, zumeist in Museen.<br />
•<br />
Die Arbeit in großen Museen wie dem National Art Center oder<br />
dem MoMA in New York ist teuer und eingeschränkt, weshalb<br />
ich es genieße, jetzt in einem Offspace zu kuratieren. Zum Beispiel<br />
wurde in Tokio streng geregelt, wer in der Galerie sein darf,<br />
wenn die Werke geliefert werden. Die Kuratoren machten die<br />
ganzen Recherchen und Vorbereitungen, und meistens waren es<br />
dann nur die Chefs, die dabei waren, wenn die Werke kamen.<br />
Aber natürlich war es auch eine große Freude, mit berühmten<br />
Kunstwerken zu arbeiten! Picasso selbst lebt jedoch nicht mehr.<br />
Arbeitet man hingegen mit zeitgenössischen Künstlern zusam-<br />
42 wına | Mai 2017
„Man muss nicht<br />
gleich sein, um<br />
das Gleiche zu<br />
fühlen.“<br />
Aline Rezende<br />
men, kann man die Ausstellung gemeinsam erstellen.<br />
Das finde ich sehr interessant.<br />
Haben Sie das Bedürfnis gehabt, sich auf den<br />
jüdischen Aspekt vorzubereiten?<br />
Ich fühle mich nicht anders als die Künstler.<br />
•<br />
Ich liebe das. Ich frage Menschen nicht zuerst<br />
nach ihrer Religion. Ich habe einen katholischen<br />
Hintergrund, aber ich rede ja nicht die ganze Zeit<br />
über Jesus. Was du tust und wie du dich mit Menschen<br />
verbindest, ist wichtiger. Außerdem habe ich<br />
in New York gearbeitet, wo die Kunstszene sehr<br />
jüdisch ist. Ich habe mich dort nicht als Außenseiterin gefühlt.<br />
Und so sollte es auch sein. Deshalb habe ich Diversität als Thema<br />
für die Ausstellung ausgesucht. Wir sollten mehr in diese Richtung<br />
gehen, nicht nur in der Kunst.<br />
ALINE LARA REZENDE<br />
wurde in Brasilien geboren und<br />
studierte u. a. an der University<br />
of Tsukuba in Japan. Sie<br />
arbeitete u. a. für das Museum<br />
of Modern Art (MoMA) in New<br />
York, das Vitra Design Museum,<br />
das National Art Center sowie<br />
das Museum of Contemporary<br />
Art, beide in Tokio. Als Journalistin<br />
schreibt sie für Magazine,<br />
Zeitungen und Rundfunkmedien<br />
über Design und Kultur.<br />
in Wien lebe, habe ich hauptsächlich österreichische<br />
Freunde – obwohl mein Deutsch nicht<br />
so gut ist, wie ich es gerne hätte. So lebt man<br />
hier eben. Man muss offen sein.<br />
Welche Rolle spielt bei Ihrer Einstellung, dass<br />
Sie in Brasilien aufgewachsen sind?<br />
Vielleicht wäre ich anders, wenn ich nicht im<br />
•<br />
multikulturellen Brasilien aufgewachsen wäre,<br />
sondern zum Beispiel in Japan. Wir sind so gemischt,<br />
Europäer, Nicht-Europäer, Muslime,<br />
Juden, Japaner und viele mehr. Wenn ich auf<br />
etwas von meiner Nationalität stolz bin, ist es das. Oft höre ich,<br />
dass ich nicht brasilianisch aussehe. Aber wie sieht eine Brasilianerin<br />
aus? Eine Sambatänzerin? Ein Fußballspieler? Das sind<br />
Stereotypen. Jeder Mensch könnte Brasilianer sein.<br />
© Anna Goldenberg<br />
Wie kann das gelingen?<br />
Vor über zehn Jahren zog ich von Brasilien nach Japan, wo ich<br />
•<br />
dann sechs Jahre lebte. Der Unterschied zwischen den beiden<br />
Ländern ist riesig. Dort musste ich mich anpassen, sonst hätte ich<br />
sehr gelitten. Das erste Jahr fühlte ich mich als Touristin, weil<br />
alles so neu war. Im zweiten Jahr war ich richtig müde von all<br />
den Adaptionen, die ich an mir selbst vornehmen musste, um<br />
Teil der Gesellschaft zu werden. Zum Beispiel berühren einander<br />
Menschen in Japan kaum. In Brasilien umarmt man<br />
sich die ganze Zeit, Japaner geben einander kaum die Hand.<br />
Und im dritten Jahr wurde ich zur Japanerin. Mein damaliger<br />
Chef sagte zu mir, es ist so seltsam, du bist eine weiße Person,<br />
verhältst dich aber wie eine Japanerin. Dann zog ich nach Europa,<br />
erst nach Lissabon und schließlich nach Wien. Seit ich<br />
Finden Sie es manchmal schwierig, die Balance zwischen Anpassung<br />
und Bewahrung der Einzigartigkeit zu halten?<br />
Nein. Ich höre nie auf, ich selbst zu sein. Zum Beispiel liebe<br />
•<br />
ich Akzente. So viele Menschen wollen Englisch akzentfrei<br />
sprechen. Ich bin dagegen, denn wir haben Englisch als Sprache,<br />
um mit Menschen aus verschiedenen Ländern zu sprechen.<br />
Wir machen es zu einer internationalen Sprache und benutzen<br />
Redewendungen aus unseren Muttersprachen. Wir denken<br />
also alle unterschiedlich, aber wir sprechen in Englisch.<br />
Der Akzent ist deshalb oft das Einzige, das mir zeigt, dass du<br />
anders bist und wo du herkommst. Es ist ein guter Anfang für<br />
Gespräche. Wenn Franzosen das „H“ nicht aussprechen können,<br />
finde ich das super. Man strengt sich ein wenig an und<br />
trifft sich in der Mitte.<br />
wına-magazin.at<br />
43
AUSSTELLUNG BRICK 5<br />
Jung.Jüdisch.Kunst<br />
Eine Austellung im Brick5 im Rahmen des Festivals<br />
der jüdischen Kultur zeigt Werke junger Künstler als<br />
deren Selbstausdruck und geht dabei der Frage nach,<br />
was einen (jüdischen) Künstler ausmacht.<br />
Gioia Zloczower<br />
liebt … Objekte<br />
Gioias Werke spiegeln Kontraste<br />
wider. Dabei spielt sie beispielsweise<br />
mit der feinen Linie zwischen<br />
Schönheit und Revolte<br />
sowie Sauberkeit und Schmutz.<br />
„Ich liebe es, mit meinen Objekten<br />
zu spielen und mit ihnen intim<br />
zu werden, sei es ein Donut,<br />
ein Model oder ein Einkaufswagen.“<br />
blondebundle.com<br />
Roy Riginashvili<br />
liebt … das Geschriebene<br />
Roy, in Haifa geboren und in Wien<br />
aufgewachsen, schöpft aus dem<br />
unendlichen Fundus weiser und<br />
wunderschöner Verse der Thora<br />
und setzt sie kalligrafisch und malerisch<br />
mit Tinte, Tusche und Aquarelltechniken<br />
in Szene.<br />
phesh.at<br />
Shira Ehlers<br />
malt ... neue Welten<br />
Shira hat eine Leidenschaft<br />
für verschiedene Kunststile.<br />
Durch das Mixen unterschiedlicher<br />
Materialien<br />
und Maltechniken erschafft<br />
sie in filigranen Tuschezeichnungen<br />
und aufwändigen<br />
Collagen mysteriös-schöne<br />
neue Welten.<br />
shiraehlers.com<br />
Daniel Shaked<br />
fotografiert … Kontexte<br />
Daniels Porträts nationaler und<br />
internationale Musikstars, Politiker<br />
und Fußballer zeigen nicht<br />
nur Gesichter. Sie halten die<br />
Stimmung des Moments fest,<br />
thematisieren den Kontext<br />
und erzählen dadurch ganze<br />
Geschichten.<br />
danielshaked.com<br />
Andrew M. Mezvinsky<br />
mixt … Ironie, Poetik<br />
und Medien<br />
Andrew, der 2009 aus Philadelphia,<br />
USA, nach Wien kam und mit Franz<br />
West arbeitete, verbindet Mixed<br />
Media mit skulpturalen Zeichnungen,<br />
Malereien und Videos, die poetische<br />
Situationen mit Ironie und Humor<br />
darstellen. India Ink, Grafit, Öl, Pastel,<br />
Collagen sowie Färbetechniken<br />
gehören unter anderem zur Bandbreite<br />
der verschiedenen Techniken<br />
seiner Werke, die bereits international<br />
gezeigt wurden.<br />
andrewmezvinsky.com<br />
Sascha Vernik<br />
erzählt … große Formate<br />
Sascha alias Revkin studierte<br />
Malerei an der Universität für<br />
angewandte Kunst in Wien.<br />
Seine Arbeiten umspannen narrative<br />
Medien wie klassische 2D-<br />
Animation und Storyboards<br />
sowie großformatige Ölgemälde<br />
und sind international bekannt.<br />
revkin.at<br />
44 wına | Mai 2017
GARTENGESCHICHTEN<br />
Dattelpalme<br />
und Dattelpalmer<br />
Wer Meir Shalevs<br />
Romane kennt, weiß<br />
von dessen Liebe zur<br />
Natur, zu den Pflanzen<br />
und Tieren, zur<br />
Landschaft Israels, in<br />
der seine Figuren und<br />
ken und stetigen Männlichkeit“ sitzen zu<br />
ihre Geschichten allesamt<br />
verwurzelt sind.<br />
Gärtner nur weibliche Exemplare dieser<br />
müssen, pflanzt der klug vorausschauende<br />
Im neuen Buch Mein<br />
Spezies.<br />
Wildgarten hat der<br />
große Erzähler nun<br />
die Natur selbst<br />
zu seiner Heldin<br />
gemacht.<br />
Meir Shalev:<br />
Mein Wildgarten.<br />
Aus dem Hebräischen<br />
von Ruth<br />
Achlama.<br />
Diogenes 2017,<br />
352 S., € 24,70<br />
doch recht viele zu geben, denn Gartenkultur<br />
dürfte derzeit ziemlich „in“ sein.<br />
Für die allzu kultivierten, manikürten<br />
Anlagen, in die Neureiche alte Olivenbäume<br />
verpflanzen lassen, hat der Wildgärtner<br />
allerdings nur leisen Spott übrig.<br />
Von Anita Pollak<br />
Im Norden Israels hat Meir Shalev<br />
ein altes Haus inmitten eines großen<br />
Grundstücks gefunden und gekauft.<br />
Es scheint auf ihn gewartet zu haben, liegt<br />
es doch im „Emek“, in der Jesreelebene,<br />
im Kernland Shalevs, dort, wo alle seine<br />
großen Romane angesiedelt sind. Und<br />
nachträglich verwundert nur, dass der<br />
Autor nicht immer schon dort gewohnt<br />
hat. Ziemlich spät im Leben ist er angekommen<br />
in diesem Garten, der seine neue<br />
Liebe und eine späte, umso heftigere Leidenschaft<br />
geworden ist.<br />
Wenn es gilt, irgendwo Pflanzen vor<br />
anrückenden Baggern zu retten, Knollen<br />
auszugraben oder Samen einzusammeln,<br />
dann muss auch das Schreiben warten.<br />
Pflanzen sind Lebewesen, für Shalev haben<br />
sie Gefühle, sie können leiden, ja sogar<br />
lieben. So sehnt sich die Dattelpalme<br />
nach dem Dattelpalmer, und die Blüten<br />
des männlichen Johannisbrotbaums riechen<br />
gar nach menschlichem Sperma. Um<br />
nicht eines Tages „im Schatten seiner star-<br />
Gartenfantasien. Man sieht schon, es<br />
menschelt gewaltig in Shalevs Paradiesgarten,<br />
einem offenbar gar nicht so kleinen<br />
Stückchen Land, von dem aus man<br />
keine menschlichen Ansiedlungen sieht,<br />
weil die sanften Hügelketten des Karmel<br />
sie gnädig verdecken. Völlig abgeschirmt<br />
von der „höchst komplizierten Weltgegend“,<br />
in der er lebt, jätet er rückenschonend<br />
auf allen Vieren, sät,<br />
pflanzt, beobachtet Vögel,<br />
bekämpft Schädlinge und<br />
wartet geduldig auf Blüten<br />
und Früchte, denn Geduld<br />
kann man lernen von einem<br />
Garten. Erinnerungen,<br />
Episoden, Weisheiten<br />
aus der Bibel, Gedichte der großen Lyriker<br />
des Landes, zu denen auch Meirs<br />
Vater Yitzhak Shalev zählte, gehen dem<br />
fantasievollen Fabulierer dabei durch den<br />
Kopf.<br />
Gäste sind nicht immer willkommen,<br />
schon gar nicht andere besserwisserische<br />
Gärtner. Und davon scheint es in Israel<br />
Es menschelt<br />
gewaltig in<br />
Shalevs Paradiesgarten.<br />
Seit die frühen Zionisten den kargen<br />
Boden des Landes fruchtbar machten,<br />
gehört das Arbeiten mit und in der Erde<br />
und das Wissen darum zum nationalen<br />
Erbe der Gründerväter und wird nach<br />
wie vor hoch geschätzt. Und so lernt man<br />
auch bei Shalev, der keinen Gartenratgeber<br />
und schon gar kein<br />
botanisches Lehrbuch<br />
schreiben wollte, doch<br />
eine Menge von der erstaunlichen<br />
Vielfalt der<br />
Flora Israels mit seinen<br />
über 2.700 Pflanzenarten.<br />
Viele der im Buch<br />
beschriebenen und von Meirs Schwester<br />
Refaella Shir feinst gezeichneten Blumen<br />
wird man außerhalb Israels nicht kennen,<br />
geschweige denn zum Blühen bringen<br />
können. Aber eine Sehnsucht nach<br />
so einem verwunschenen Garten Eden<br />
unter südlicher Sonne wird beim Lesen<br />
wohl entstehen. <br />
wına-magazin.at<br />
45
BADENER MAHNMAL<br />
Ein imaginärer<br />
Davidstern<br />
sch<strong>web</strong>t über der Endstation<br />
Im Zentrum Badens erinnert ein neues<br />
Mahnmal an die Opfer des<br />
Nationalsozialismus.<br />
April im Zentrum der Stadt, am Josefsplatz,<br />
der Endstation der Badener Bahn.<br />
Passanten können es eilig durchschreiten<br />
oder stehen bleiben und entlang der<br />
36 im Boden verankerten Stahlstäbe hinaufschauen<br />
und dann etwas erblicken,<br />
das nicht da ist. Einen imaginären Davidstern,<br />
der gleichsam über dem Platz<br />
sch<strong>web</strong>t. Symbolhaft soll er an die Opfer<br />
des Nationalsozialismus erinnern, die<br />
ja auch nicht mehr da sind. Schon lange<br />
nicht mehr, obwohl die jüdische Gemeinde<br />
der Kurstadt vor dem Krieg mit<br />
2.400 Mitgliedern die drittgrößte Österreichs<br />
war.<br />
„In Österreich<br />
wurde ja eher an<br />
die Gefallenen<br />
als an die Verfolgten<br />
erinnert.“<br />
Robert Vorberg<br />
Von Anita Pollak<br />
Es ist so, als hätten wir nie<br />
existiert.“ Dieser Satz einer<br />
aus Baden vertriebenen<br />
Jüdin war quasi die Initialzündung<br />
für das Interesse<br />
von Badener Schülern an der jüdischen<br />
Vergangenheit ihrer Stadt. Heute ist der<br />
damalige HAK-Schüler Lukas Hold,<br />
Jahrgang 1988, Obmann des Vereins zur<br />
Aufarbeitung der jüdischen Geschichte<br />
in Baden. Gemeinsam mit dem Historiker<br />
Robert Vorberg, der damaligen Gemeinderätin<br />
Nedina Malinovic und einer<br />
in Folge von der Stadt Baden eingerichteten<br />
Arbeitsgruppe hat er ein ambitioniertes<br />
Projekt angestoßen und verwirklicht.<br />
Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
in Baden steht seit Ende<br />
Offenes Denkfeld. Mit seiner Installation<br />
Counterpoles/Widerstäbe hat Peter<br />
Kozek einen für das Mahnmal ausgeschriebenen<br />
Wettbewerb gewonnen.<br />
Dass der Künstler ein geborener Badener<br />
ist, bezeichnet er selbst als „Zufall“.<br />
Als „offenes Denkfeld“, das man beliebig<br />
durchschreiten kann, hat Kozek seine Installation<br />
entworfen. Aus immer neuen<br />
Perspektiven werden sich dabei immer<br />
neue Bilder ergeben. Am Boden bilden<br />
die Verankerungen von jeweils drei Stäben<br />
die Spitzen imaginärer Dreiecke, die<br />
sich auf die verschiedenen Winkel beziehen,<br />
mit denen in den KZs unterschiedliche<br />
Häftlingsgruppe wie Homosexuelle<br />
und politisch Verfolgte gekennzeichnet<br />
wurden, denn allen, nicht nur den jüdischen<br />
Opfern ist dieses Mahnmal gewidmet.<br />
Das war eine Vorgabe der Arbeitsgruppe,<br />
die sich mit dem Wunsch eines<br />
solchen Projekts 2013 an die Stadtge-<br />
© Peter Kozek<br />
46 wına | April 2017
HISTOTAINMENT<br />
Projektentwurf von Peter<br />
Kozek. 36 im Boden verankerte<br />
Stahlstäbe lassen<br />
einen imaginären Davidstern<br />
entstehen.<br />
meinde wandte. „2005 wurde zwar<br />
die Synagoge saniert, doch ein zentrales<br />
Erinnerungszeichen an die<br />
Opfer des Nationalsozialismus hat<br />
gefehlt. In ganz Österreich wurde<br />
ab den 50er-Jahren ja eher an die<br />
Gefallenen als an die Verfolgten erinnert.<br />
Die schwarz-grüne Stadtregierung<br />
hat sehr offen auf unsere<br />
Vorstellungen reagiert. Unser Ziel<br />
war es, dieses Projekt auch in der<br />
Bevölkerung zu verankern, deshalb<br />
sollte es an einem zentralen Platz<br />
und dauerhaft sein“, erzählt Robert<br />
Vorberg, der Leiter der Arbeitsgruppe.<br />
Die inhaltlichen Vorgaben hat Peter<br />
Kozek mit seiner Stahlkonstruktion<br />
künstlerisch perfekt umgesetzt. „Ich habe<br />
gleich Feuer gefangen und mich im Vorfeld<br />
auch mit Elie Rosen, dem Vertreter<br />
der jüdischen Gemeinde in Baden, beraten,<br />
was man sich von jüdischer Seite von<br />
so einem Mahnmal erwartet. Ich wollte<br />
nicht mit einer brachialen, banalen Symbolik<br />
arbeiten.“<br />
Deshalb bleibt der Ort an sich unverändert,<br />
mit Parkbänken, Blumen und<br />
Fahrradständern, und doch kommt man<br />
an den fest verankerten Stäben nicht<br />
vorbei. Kozek sieht sie einerseits hoffnungsvoll<br />
als heilende „Akupunktur des<br />
Platzes“, gleichzeitig aber sind seine „Widerstäbe“<br />
auch „Widerstände“, die eine<br />
aktive Auseinandersetzung mit der Erinnerung<br />
evozieren sollen, die man ja<br />
nicht verordnen kann. Eine Infostele erklärt<br />
zusätzlich die historischen Hintergründe<br />
und die Gestaltung des Mahnmals.<br />
„Ich wollte<br />
nicht mit einer<br />
brachialen,<br />
banalen Symbolik<br />
arbeiten.“<br />
Peter Kozek<br />
„Histotainment“. Wie die Badener<br />
Bevölkerung das doch immerhin irritierende<br />
Objekt aufnehmen wird, ist<br />
noch nicht wirklich absehbar. Für Arbeitsgruppe<br />
und Verein sind mit dieser<br />
künstlerischen Setzung die Aktivitäten<br />
keineswegs abgeschlossen,<br />
der begonnene Diskurs ist damit erst<br />
sichtbar eröffnet. Schülergruppen besuchen<br />
schon seit einiger Zeit die Synagoge<br />
und den jüdischen Friedhof<br />
in Baden und beginnen auch selbst<br />
zu recherchieren. „Da kann es schon<br />
vorkommen, dass sie in ihrer Umgebung<br />
auf ein Nachbarhaus stoßen, in<br />
dem Opfer gelebt haben. Wir arbeiten<br />
da aber nicht mit erhobenem Zeigefinger“,<br />
erklärt Lukas Hold.<br />
Der Verein hat eine „Schicksalsdatenbank“<br />
auf Basis der Vermögensanmeldungen<br />
und der Arisierungsakte erstellt<br />
und nach einjähriger Recherche<br />
unter anderem bei Yad Vashem außerdem<br />
eine wunderbare deutsch-englische<br />
Website eingerichtet, die als „Histotainment“<br />
vor allem Anknüpfungspunkte für<br />
junge Menschen bieten soll. jewishhistorybaden.com<br />
stößt auf reges Interesse aus<br />
der ganzen Welt.<br />
Mit vereinten Kräften und höchst bescheidenen<br />
Mitteln – die Gesamtkosten<br />
des Mahnmals belaufen sich auf nur<br />
80.000 Euro und sind neben Sponsoren<br />
größtenteils von Stadt und Land Niederösterreich<br />
aufgebracht worden – haben<br />
diese drei jungen Herren, Angehörige der<br />
Enkelgeneration, mit dem neuen Mahnmal<br />
im Herzen von Baden ein Zeichen<br />
gesetzt, das Hoffnung gibt.<br />
wına-magazin.at<br />
47
PORTRÄT WILNA<br />
Das Jerusalem<br />
des Nordens<br />
„Messieurs, mir scheint,<br />
wir sind in Jerusalem“,<br />
sagte Napoleon, als er<br />
einst Wilna betrat. Nun<br />
erschien das Porträt<br />
dieser Stadt, zu Deutsch<br />
Von Alexander Kluy<br />
Mein Winkel Europas ermöglicht<br />
aufgrund der<br />
dort stattfindenden außerordentlichen<br />
und<br />
todbringenden Ereignisse, für die nur<br />
verheerende Erdbeben die passende<br />
Metapher scheinen, eine besondere Perspektive,<br />
der zufolge alle, die von dort<br />
stammen, die Poesie unseres Jahrhunderts<br />
etwas anders zu beurteilen pflegen<br />
als die Mehrheit meiner<br />
Hörer.“ Als der polnische<br />
Dichter und Nobelpreisträger<br />
Czesław<br />
Miłosz dies 1982 in einer<br />
Vorlesung an der<br />
Harvard University bekannte,<br />
sprach er über<br />
eine Grenzregion, die<br />
er, der Emigrant, damals<br />
seit mehr als dreißig Jahren<br />
nicht mehr gesehen<br />
hatte – Nordostpolen<br />
und Litauen. Städte<br />
wie Kaunas und Kowno<br />
und Vilnius, Letzteres<br />
auf Polnisch Wilno, auf<br />
Deutsch Wilna. Und auf<br />
Jiddisch Vilne.<br />
170 Jahre zuvor soll Napoleon, seit<br />
acht Jahren Kaiser der Franzosen, auf<br />
seiner Kampagne durch Russland, die so<br />
schmählich enden sollte, in Wilna gesagt<br />
haben: „Messieurs, mir scheint, wir sind<br />
in Jerusalem.“ So auffällig waren auf den<br />
Gassen der Stadt die vielen orthodoxen<br />
Juden, dass sie als „Jerusalem des Nor-<br />
Wilna, auf Jiddisch Vilne,<br />
und zeigt einen Ort<br />
jüdischen Lebens und<br />
gelebter Jiddischkeit.<br />
Judengasse in<br />
Wilna,1915. Bis 1940<br />
war Wilna ein Kristallisationspunkt<br />
des<br />
Judentums, 1943 hörte<br />
jüdisches Leben hier<br />
nahezu auf.<br />
dens“, „Jerusalem Litauens“, „Jerusalem<br />
Osteuropas“ bezeichnet wurde.<br />
1323 waren erstmals Juden vom litauischen<br />
Fürsten ins Land gerufen worden.<br />
Wie überall auch wurden sie in den folgenden<br />
Jahrhunderten Opfer von Verfolgungen,<br />
Pogromen, Ausweisungen,<br />
neuerlichen Einladungen. Bauten ein<br />
Gemeindeleben auf. Ab etwa 1740 wurde<br />
Wilna ein Ort jüdischer Frömmigkeit, jüdischer<br />
Gelehrsamkeit und der Haskala,<br />
auch säkularer Bildung, Kultur, Poesie.<br />
Druck- und Verlagshäuser,<br />
junge Poeten, die<br />
auf Jiddisch schrieben,<br />
wie Moshe Kulbyak, der<br />
1937 Opfer des Stalinismus<br />
wurde – jüngst<br />
ist sein schmaler Revolutionsroman<br />
Montag<br />
auf Deutsch erschienen<br />
–, Bundisten, Zionisten.<br />
Bis 1940 war Wilna<br />
ein Kristallisationspunkt<br />
des Judentums, auch<br />
in einem immer stärkeren<br />
Meer aufbrausenden<br />
Nationalismus,<br />
Extremismus, Antisemitismus<br />
(plus bei Vilne<br />
zusätzlich eines heutzutage<br />
wieder vertraut klingenden hässlichen<br />
Polonismus). Dreizehnmal haben sich die<br />
Herrschaftsverhältnisse in der Stadt allein<br />
während des 20. Jahrhunderts geändert,<br />
radikal, noch öfters mit Gewalt, Blutvergießen,<br />
Ermordungen, Vertreibungen und<br />
Verschleppungen. Ende September 1943,<br />
mit der brutalen Auflösung des Ghettos<br />
© picturedesk.com<br />
48 wına | Mai 2017
JÜDISCHE TOPOGRAFIE<br />
Dann wird auf jüdische und jiddische<br />
Kultur und die Bedeutung von Übersetzungen<br />
als innereuropäischer Weltkulturund<br />
Gedankentransfer eingegangen – wer<br />
weiß schon, dass die erste jiddische Übersetzung<br />
von Thomas Manns Roman Der<br />
Zauberberg 1930 von Isaac Bashevis Singer<br />
stammte? –, auf den Kampf um Autonomie,<br />
sozialen Status und den Blick<br />
von außen, hier jenen des Autors Arnold<br />
Zweig, der ab 1917 an der Ostfront erstmals<br />
jiddisches Leben hautnah erlebte.<br />
Danach wird Jiddischkeit in Berlin und<br />
deren Wechselwirkungen mit Wilna ausgeleuchtet,<br />
auf den großen Dichter Abrain<br />
Wilna, hörte jüdisches Leben hier nahezu<br />
auf; im späteren Sowjetkommunismus<br />
balancierte die Gemeinde auf der<br />
Demarkationslinie eines Geradesogeduldetwerdens.<br />
Auf Initiative der Historiker Elke-Vera<br />
Kotowski und Julius H. Schoeps, beide am<br />
Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische<br />
Studien in Potsdam aktiv,<br />
dessen Gründungsdirektor 1992 und<br />
seitheriger Leiter Schoeps ist, fand 2013<br />
die Tagung Das jiddische Vilne statt. Nun<br />
liegen dank der Finanzierung mehrerer<br />
Stiftungen die Tagungsbeiträge in Buchform<br />
vor, kombiniert mit zwei Dutzend<br />
Illustrationen, historischen Fotografien<br />
(besonders interessant und aussagekräftig)<br />
und zeitgenössischen künstlerischen<br />
Echos darauf, die zwischen Surrealismus<br />
und Abstraktion changieren.<br />
Es entspricht der Natur solcher Publikationen,<br />
dass die Beiträge recht unterschiedlich<br />
sind. Unterschiedlich im<br />
Ansatz. Unterschiedlich im Stil. Auch<br />
unterschiedlich in Anspruch und Niveau.<br />
So ist es keine Überraschung, dass es<br />
sich auch in diesem Fall so<br />
verhält. Eine entschieden<br />
negative Überraschung ist<br />
aber, dass in diesem akademischen<br />
Band wissenschaftlicher<br />
Beiträger derart<br />
viele orthografische<br />
Fehler enthalten sind. Es<br />
gibt Texte, deren mündlicher<br />
Tonfall nur sacht<br />
überarbeitet wurde. Andere<br />
Kurzstudien hingegen,<br />
ganz besonders der<br />
Text des am Frankfurter<br />
Fritz-Bauer-Instituts tätigen<br />
Historikers Christoph<br />
Dieckmann über die<br />
Zerstörung des Ghettos in<br />
Vilnius im September 1943, sind derart<br />
gehaltvoll und dicht, dass auf 25 Seiten<br />
hier fast zu viele Informationen untergebracht<br />
sind.<br />
Klug ist die dramaturgische Reihung.<br />
Es setzt ein mit einer historischen<br />
Einführung, die weit in die Historie<br />
zurückgeht, bis in die frühe Neuzeit.<br />
„... im friedlichen<br />
Winkel Europas<br />
zwischen Wannsee<br />
und Potsdam<br />
– dort,/<br />
wo vieles geschah<br />
und wohl<br />
nichts mehr geschehen<br />
wird.“<br />
Tomas Venclova<br />
Elke-Vera Kotowski,<br />
Julius H. Schoeps (Hrsg.):<br />
Vilne Wilna Wilno<br />
Vilnius. Eine jüdische<br />
Topografie zwischen<br />
Mythos und Moderne.<br />
Edition Hentrich<br />
2017, 202 S.,<br />
€ 22,70 (A)/€ 22 (D)<br />
Die<br />
weibliche<br />
Seite<br />
Gottes<br />
30. April bis<br />
8. Okt. 2017<br />
Jüdisches<br />
Museum<br />
Hohenems<br />
ham Sutzkever eingegangen, auf die Zerstörung<br />
des Ghettos 1943 und die fast<br />
vollständige Auslöschung jüdischen Lebens.<br />
Die letzten fünf Texte widmen sich<br />
jüdischen und jiddischen Lebens- und<br />
Sprachwelten im Rückspiegel, in der Erinnerung,<br />
im Zuge von nach 1990 einsetzenden<br />
Rekonstruktionen. Überaus<br />
nützlich ist am Schluss eine Liste mit<br />
weiterführender Literatur.<br />
Der aus dem litauischen Klaipeda<br />
stammende und seit 40 Jahren im Exil,<br />
erst kurz in Wien, seither in den USA lebende<br />
Poet Tomas Venclova schrieb bei<br />
einem Berlin-Aufenthalt in einem Gedicht,<br />
nach Osten gerichtet: „... ein Schatten<br />
liegt auf/der Vergangenheit (wie auf<br />
der Gegenwart), im Licht der ersten heiteren/Wochen:<br />
die Brücken/im friedlichen<br />
Winkel Europas zwischen Wannsee und<br />
Potsdam – dort,/wo vieles geschah und<br />
wohl nichts mehr geschehen wird.“ <br />
Museum & Café:<br />
Di bis So 10–17 Uhr<br />
Schweizer Str. 5<br />
A-6845 Hohenems<br />
www.jm-hohenems.at<br />
wına-magazin.at<br />
49
EUROPÄISCHE FLÜCHTLINGSKRISE<br />
Die neue<br />
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge:<br />
Haben sie überhaupt einen individuel-<br />
ODYSSEElen Fluchtgrund, den es braucht, um Asyl<br />
zugesprochen zu bekommen? Warum flüchten Menschen<br />
überhaupt? Und was nehmen sie dabei auf sich?<br />
Von Anita Pollak<br />
Der britische Journalist Patrick<br />
Kingsley war in den vergangenen<br />
Jahren an vielen Hotspots<br />
dieser Erde: Er hat sich in Afrika<br />
den Fluchtweg durch die Sahara angesehen<br />
und sich umgeschaut, wie und von<br />
wo Menschen aus Libyen den Weg über<br />
das Mittelmeer nach Europa starten. Er<br />
hat sich Flüchtlingstrecks auf der Balkanroute<br />
angeschlossen und nachgeforscht,<br />
wie es Syrern ergeht, die sich nach Ägypten<br />
gerettet haben. Er hat einen Flüchtling<br />
auf seiner Zugfahrt durch Europa begleitet,<br />
der es schließlich bis Schweden<br />
geschafft hat. Doch hat er dort eine Zukunft?<br />
Und wird er eines Tages seine Familie<br />
nachholen können?<br />
Kingsley zeigt in seinem Reportagenband<br />
Die neue Odyssee. Eine Geschichte der<br />
europäischen Flüchtlingskrise vor allem eines<br />
auf: die globale Dimension der aktuellen<br />
Fluchtbewegungen. Wer die Geschichten<br />
liest, die er hier dokumentiert,<br />
hat nach der Lektüre zwar genau so wenig<br />
wie der Autor eine Antwort parat,<br />
weil es für solch komplizierte Sachverhalte<br />
eben auch keine einfachen Lösungen<br />
gibt. Man wird sich aber der blinden<br />
Patrick Kingsley:<br />
Die neue Odyssee.<br />
Eine Geschichte<br />
der europäischen<br />
Flüchtlingskrise,<br />
C. H. Beck, 2016,<br />
332 S., 21,95 €<br />
Flecken bewusst, vor allem hinsichtlich<br />
der Lage in Afrika.<br />
Beispiel Eritrea. Männer werden für<br />
unbegrenzte Zeit zum Militärdienst eingezogen,<br />
der Sklavenarbeit ähnelt, körperliche<br />
Misshandlungen inklusive. Das<br />
gilt auch für Jugendliche: Kingsley schildert<br />
den Fall des 15-jährigen Adam, der<br />
„Die einzige vernünftige, logische und langfristige<br />
Antwort auf die Krise ist, ein legales Verfahren<br />
einzurichten.“ Patrick Kingsley<br />
bereits als 14-Jähriger zur Armee eingezogen<br />
wurde, desertierte, verhaftet, ins<br />
Gefängnis gesteckt und schließlich erneut<br />
zu einem Leben als Kindersoldat gezwungen<br />
wurde. Er konnte sich schließlich bis<br />
Italien durchschlagen. „In Eritrea habe ich<br />
nie an die Zukunft gedacht – ich wusste<br />
nie, ob ich den morgigen Tag noch erleben<br />
würde. Aber jetzt versuche ich es“,<br />
sagte der Jugendliche Kingsley in Europa.<br />
Der Journalist hat viele solcher Schicksale<br />
zusammengetragen: Sie geben den<br />
Flüchtlingen eine Stimme und machen<br />
ihre Fluchtgründe nachvollziehbar. Ihre<br />
Geschichten zeigen aber auch, wie sie immer<br />
stärker in Abhängigkeit von skrupellosen<br />
Schleppern geraten, desto mehr Europa<br />
sich abschottet.<br />
Fazit Kingsleys. Und trotzdem werden<br />
sich immer mehr Menschen auf den<br />
Weg nach Europa machen. In ihrer Heimat<br />
können sie aus den verschiedensten<br />
Gründen nicht mehr bleiben, die Nachbarländer<br />
bieten entweder keinen Schutz<br />
oder keine Möglichkeit zu existieren. „Der<br />
Schlüssel zur Bewältigung des Problems<br />
ist, diese Realität zu akzeptieren“, so der<br />
Autor. Er habe hunderte von Flüchtlingen<br />
gefragt, warum sie sich auf den beschwerlichen<br />
Weg machen. Die Antwort<br />
sei immer gewesen: „Weil es keine andere<br />
Wahl gibt.“ Er rät daher: „Die einzige vernünftige,<br />
logische und langfristige Antwort<br />
auf die Krise ist, ein legales Verfahren<br />
für die riesige Zahl von Flüchtlingen<br />
einzurichten, über das sie Europa auf einem<br />
sicheren Weg erreichen können. Von<br />
einem perfekten Szenario ist das weit entfernt.<br />
Es ist jedoch das geringste Übel.“<br />
Ja, Kingsleys Beobachtungen und<br />
Schlüsse bieten jede Menge Diskussionsstoff.<br />
Dieser Debatte werden wir uns<br />
allerdings nicht entziehen können – dieses<br />
Buch setzt der Abschottungspolitik<br />
die menschliche Dimension entgegen. <br />
50 wına | Mai 2017
WINA WERK-STÄDTE<br />
Patras<br />
Thora-Rollen werden zum<br />
Schutz und als Ausdruck der<br />
Heiligung schön „angezogen“.<br />
Während sie bei uns in einen<br />
Thora-Mantel gehüllt werden,<br />
verwahrt man sie traditionell in<br />
Griechenland und im Orient in<br />
einem Behältnis (hebräisch Tik).<br />
Von Esther Graf<br />
Der Tik gehört zur<br />
Sammlung des Jüdischen<br />
Museums in Athen.<br />
Die Verwendung von Thora-Mänteln<br />
und Tikkim (Plural von Tik,<br />
Thora-Behältnis) wurde nachweislich<br />
bereits im Mittelalter<br />
gepflegt. Illuminierte Handschriften<br />
ab dem 9. Jahrhundert liefern uns dafür<br />
bildliche Beweise. Thora-Mäntel sind aus Stoff<br />
und fast ausnahmslos in Europa zu finden. Tikkim<br />
sind aus Holz oder Metall gefertigt, mit verschließbaren<br />
Scharnieren versehen und typisch<br />
für den Orient und Griechenland.<br />
Während zur Ausstaffierung einer Thora-Rolle<br />
in Europa neben Thora-Mantel auch eine Thora-<br />
Krone und Thora-Aufsätze gehören, sind diese<br />
im orientalischen Tik mit integriert.<br />
Das hier gezeigte Exemplar stammt aus dem<br />
18. Jahrhundert aus der Synagoge in Heraklion,<br />
Kreta. Der Tik war ein Geschenk der Synagoge<br />
in Patras, stammt aber wahrscheinlich aus Korfu.<br />
Korfu war im 18. Jahrhundert unter venezianischer<br />
Herrschaft, was den stilistischen Einfluss<br />
der italienischen Lagunenstadt erklärt. Eine Stifterinschrift<br />
verrät, dass die<br />
Thora-Rolle 1913 ein Geschenk<br />
von Bona Elchai<br />
war, Mitglied einer renommierten<br />
jüdischen Familie<br />
in Heraklion. Der Korpus<br />
des hölzernen Tik ist in<br />
Rot gehalten. Den oberen<br />
Abschluss bildet eine Art<br />
Krone in Gold. Das Rankendekor<br />
der Thora-Krone<br />
lässt einen an architektonische<br />
Elemente venezianischer<br />
Renaissancepaläste<br />
denken. Die Thora-Aufsätze<br />
(hebräisch Rimmonim)<br />
erinnern an ein königliches<br />
Zepter. Daneben<br />
verbergen sich Metallhülsen,<br />
die an Simchat Thora<br />
oder Schawuot als Halter<br />
für Blumen oder Ähren<br />
dienen. <br />
PATRAS, die Hauptstadt der<br />
Region Westgriechenland, ist mit<br />
214.000 Einwohnern die drittgrößte<br />
Stadt Griechenlands. Die ersten<br />
Juden kamen im 4. Jahrhundert v.<br />
d. Z. aus Syrien. Im 15. Jahrhundert<br />
kamen Flüchtlinge aus Spanien,<br />
und Italien hinzu. Vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg lebten ca. 260 Juden hier,<br />
von denen etwa die Hälfte ermordet<br />
wurde. Die nach 1945 von wenigen<br />
Mitgliedern neu gegründete<br />
Gemeinde bestand bis 1991. Das<br />
Innere der bereits 1984 geschlossenen<br />
Synagoge wurde in das Jüdische<br />
Museum nach Athen gebracht.<br />
© The Jewish Museum of Greece, 2014<br />
wına-magazin.at<br />
51
TRAGISCHER JUSTIZIRRTUM<br />
Jesus und<br />
„die Juden“<br />
Eine jüdische Perspektive auf die Passionsgeschichte Jesu<br />
bot vor fast einem halben Jahrhundert erstmals der deutschisraelische<br />
Starjurist Chaim Cohn. Sein Standardwerk<br />
ist jetzt in deutscher Übersetzung wieder neu aufgelegt<br />
worden und immer noch faszinierend.<br />
Von Anita Pollak<br />
Kein anderer Prozess in der Menschheitsgeschichte<br />
hatte derart weitreichende<br />
Folgen. Geführt wurde<br />
er unter Ausschluss der Öffentlichkeit,<br />
und dennoch scheint die ganze Welt darüber<br />
Bescheid zu wissen. Seit fast zweitausend<br />
Jahren gilt als erwiesen: Die Juden<br />
waren oder sind schuld am Tod Jesu. Obwohl<br />
die Kirche diesen christlichen Common<br />
Sense nach der Schoah in Erklärungen<br />
abzuschwächen versucht hat, zeigt die<br />
Geschichte des Judenhasses, wie stark und<br />
ungebrochen das Stigma des Gottesmordes<br />
weiter wirksam ist.<br />
Bei Gründung des Staates Israel im Jahr<br />
1948 wurde sein Oberster Gerichtshof vor<br />
allem von protestantischer Seite ersucht,<br />
den Prozess Jesu wiederaufzunehmen, um<br />
den tragischen Justizirrtum zu bereinigen.<br />
Dazu kam es zwar nicht, aber einen damals<br />
tätigen jungen Oberstaatsanwalt<br />
ließ die faszinierende<br />
Causa nicht mehr<br />
los. Zwanzig Jahre lang<br />
widmete sich Chaim Cohn<br />
„abendlich-nächtlich“ diesem<br />
Prozess und legte seine<br />
Thesen 1968 in einem hebräischen<br />
Buch vor, das 1997<br />
erstmals ins Deutsche übersetzt<br />
worden ist.<br />
Der 1911 in Lübeck geborene<br />
und 2002 in Jerusalem<br />
verstorbene Chaim<br />
Cohn war nicht nur Oberster<br />
Richter, Menschenrechtsexperte<br />
und sogar<br />
einmal Justizminister Israels, er war darüber<br />
hinaus ein profunder Kenner des<br />
römischen und jüdischen Rechts. Dieser<br />
Expertise und einem tiefgründigen Studium<br />
der Quellen verdanken sich seine<br />
revolutionären Thesen.<br />
Tendenziöse Evangelien. Was in Wirklichkeit<br />
geschehen sein könnte, nennt er den<br />
Hauptteil seines Werks, der sich der Verhaftung,<br />
dem Prozess und der Kreuzigung<br />
Jesu widmet. Was darüber bekannt ist, vermitteln<br />
im Wesentlichen die Evangelien,<br />
die Cohn einerseits mit den historischen<br />
Gegebenheiten zu Zeiten Jesu, andererseits<br />
mit den römischen und jüdischen Gesetzen<br />
während der römischen Besatzung Judäas<br />
konfrontiert. Aus den sich daraus ergebenden<br />
Widersprüchlichkeiten stellt er<br />
die Faktizität der Evangelien infrage und<br />
außerdem fest: Je später sie verfasst wurden,<br />
umso mehr verlagerten sie die Schuld<br />
an der Kreuzigung Jesu<br />
weg von Pilatus und<br />
pauschal auf „die Juden“.<br />
Weil die frühen<br />
Christen zunehmend<br />
„Hunderte Generationen<br />
von Juden<br />
sind für ein Verbrechen<br />
bestraft<br />
worden, das<br />
weder sie noch<br />
ihre Vorfahren<br />
begangen haben.“<br />
unter römischer Verfolgung<br />
litten, schien<br />
es ihnen vermutlich<br />
opportuner, die Römer<br />
zu entlasten und<br />
sie damit gewogener<br />
zu machen. Infolge<br />
dieser stark tendenziösen<br />
Darstellungsweise<br />
der Ereignisse in den<br />
Evangelien hat sich<br />
das Bild der Juden als<br />
Chaim Cohn:<br />
Der Prozeß und<br />
Tod Jesu aus<br />
jüdischer Sicht.<br />
Aus dem Englischen<br />
von Christian Wiese und<br />
Hannah Liron. Jüdischer<br />
Verlag im Suhrkamp<br />
Verlag; 573 S., € 39,10<br />
blutgierige Gottesmörder tief in das christliche<br />
Bewusstsein eingegraben. „Hunderte<br />
Generationen von Juden sind in der ganzen<br />
christlichen Welt für ein Verbrechen<br />
bestraft worden, das weder sie noch ihre<br />
Vorfahren begangen haben. Schlimmer<br />
noch, jahrhunderte-, vielmehr jahrtausendelang<br />
wurden sie gezwungen, aufgrund<br />
des angeblichen Anteils ihrer Vorväter am<br />
Prozess und an der Kreuzigung Jesu alle<br />
denkbaren Formen der Peinigung, Verfolgung<br />
und Demütigung zu erdulden [...].“<br />
Wenn man die in sich schlüssigen Analysen<br />
des Autors auf eine These herunterbrechen<br />
müsste, was kaum möglich ist, so<br />
wäre es seine wohl begründete Behauptung,<br />
dass die Juden Jesus liebten, denn er<br />
war einer der ihren und wie sie ein Opfer<br />
der römischen Gewaltherrschaft über Israel.<br />
Aus dieser Perspektive müsse das Verhör<br />
Jesu am Vorabend des Pessachfestes<br />
als verzweifelter Versuch des Hohepriesters<br />
verstanden werden, diesen von seinem<br />
messianischen Anspruch abzubringen und<br />
so vor der Kreuzigung zu bewahren.<br />
Als Gegenentwurf zur kanonisierten<br />
Passionsgeschichte und ihrer Traditionen<br />
hatte Cohns Klassiker bislang nur ein<br />
schwaches Echo. Ob die Neuauflage nach<br />
fast einem halben Jahrhundert in einen anderen<br />
Resonanzraum vorstoßen wird können,<br />
bleibt abzuwarten. <br />
52 wına | Mai 2017
URBAN LEGENDS<br />
Im Schlund<br />
Mitunter platzen all die kleinen<br />
Filterblasen, und wir finden uns<br />
wieder in einer monströsen<br />
Riesenbubble, in der sich die Welt<br />
abzeichnet. Zeitgleich wirken<br />
Fakten, Fiktionen und herrschende<br />
Narrationen auf uns ein.<br />
Paul Divjak<br />
Die so genannte Zeitlinie der Zuckerberg’schen<br />
Prosumentenplattform hält<br />
einen tagtäglich auf Trab. Schließlich<br />
gilt es, nichts zu versäumen, Klicks und Likes zu<br />
verteilen, soziales Engagement zu beweisen und<br />
ein paar persönliche Spuren zu hinterlassen. Und<br />
mitunter platzen all die kleinen Filterblasen, und<br />
wir finden uns wieder in einer Monsterbubble, in<br />
der grelle Infohäppchen aufpoppen und um unsere<br />
Aufmerksamkeit buhlen: Fakten, Fiktionen<br />
und herrschende Narrationen wirken zeitgleich auf uns<br />
ein, erzählen von einer Welt, die mit jedem Weiterscrollen<br />
das Parallelgeschehen noch absurder erscheinen lässt.<br />
Eine Menschenmenge in Japan: Sexarbeiterinnen tragen<br />
seit dem Jahr 1977 alljährlich einen Stahlpenis durch<br />
die Straßen, um den Dämon in der Vagina zu besiegen,<br />
wie es heißt. Ein Ritual, das dem Gebet gegen sexuell<br />
„We,re robots, made of robots,<br />
made of robots.“ Daniel Dennett<br />
übertragbare Krankheiten gilt. Es wird rosa Stangenwassereis<br />
gelutscht. Unterdessen gibt andernorts die Defacto-Präsidentin<br />
Myanmars eine Erklärung ab: Es gäbe<br />
keine ethnischen Säuberungen in ihrem Land. – Smash<br />
Cut.<br />
Pepsi hat eine Kampagne lanciert, in der eine weiße<br />
Frau die Softdrinkrevolution mit einer Dose des sprudelnden<br />
Zuckergetränks anführt; potenzielle Polizeigewalt<br />
löst sich in Lifestyle-Wohlgefallen auf; Bombenstimmung!<br />
Logisches Resultat auf diese hanebüchene<br />
Werbeidee ist – auf gut Deutsch – ein Scheißsturm.<br />
Die wiederkehrenden Bilder von Giftgastoten in Syrien<br />
und die widersprüchlichen Interpretationen und Reaktionen<br />
darauf sind mit dem nächsten Post auch schon<br />
wieder vergessen, denn: Siegfried kehrt ins Opernhaus<br />
Nürnberg zurück. Was in Serbien naturgemäß weniger<br />
auf Interesse stößt: Dort wird weiterhin gegen den künftigen<br />
Präsidenten demonstriert.<br />
Nach dem Übergriff auf ein homosexuelles Paar posieren<br />
Politiker demonstrativ händchenhaltend für Fotografen.<br />
Währenddessen hat in Hessen ein 22-Jähriger<br />
beschlossen, die Sache mit der Verkehrssicherheit selbst<br />
in die Hand zu nehmen: Er malt sich einfach seine eigenen<br />
Zebrastreifen.<br />
Die AfD ist mit einem Plakat an die Öffentlichkeit<br />
gegangen: „Wir stehen als AfD an der Seite der jüdischen<br />
Gemeinde in Deutschland.“ – Newsflash: Steve<br />
Bannon ist nun nicht mehr im nationalen Sicherheitsrat.<br />
(Unglaublich auch jenes Video: Ein Bär rettet einen<br />
Vogel vor dem Ertrinken.)<br />
Eine vergrabene Box mit 6.000 Fotos aus dem Ghetto<br />
Łódź dokumentiert den Alltag und die Deportationen<br />
zwischen 1940 und 1944. In der Ausstellung Memory<br />
Unearthed ist im Museum of Fine Arts Boston derzeit<br />
eine Auswahl der Bilder von Henryk Ross zu sehen.<br />
„We pray for the lives of the wounded and the souls<br />
of those who have passed“, sagt Präsident Trump nach<br />
dem US-Luftangriff in Syrien.<br />
Josef Hader erzählt etwas über Erdbeerjoghurt.<br />
In Banksys Walled Off Hotel an der Mauer in Bethlehem<br />
werden nun schon seit mehreren Wochen interessierte<br />
Gäste empfangen; eine dystopische Touristenattraktion.<br />
– Mikroplastik überall. Und: Doug Aitkens<br />
Mirror House reflektiert die Schönheit und Einsamkeit<br />
der Kalifornischen Wüste.<br />
„Goebbels’ Sekretärin bricht ihr Schweigen“: Sie gibt<br />
ein erstes – und zugleich allerletztes – ausführliches Interview<br />
vor der Kamera, und ihr faltenzerfurchtes Gesicht<br />
in Schwarzweiß zeugt von der Kartografie inszenierter<br />
Erinnerung. Ein Deutsches Leben – jetzt im Kino!<br />
Popsänger Barry Manilow outet sich mit 73 Jahren. –<br />
Die Frieze Fair widmet sich diesmal übrigens den Fragen:<br />
„How important is art as a form of protest?’“ und „How<br />
effective is it as a conduit of change?“ – Und wo wir gerade<br />
von Kunst sprechen: Mit Worry will vanish revelation<br />
lädt die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist zur Kunstmeditation,<br />
zu einem Trip in das Sinnliche und Sublime.<br />
Sensationsfund: In Ägypten wurde eine neue Pyramide<br />
entdeckt!<br />
Ist unser Bewusstsein tatsächlich bloß eine Illusion?<br />
Unsere Gehirnzellen sind Roboter, die auf chemische Signale<br />
reagieren, sagt der Kognitionsforscher Daniel Dennett<br />
in einem Interview mit der BBC.<br />
Erwähnt werden sollte schließlich noch eine aktuelle<br />
Studie, die belegt: Menschenaffen können erkennen,<br />
wenn wir etwas glauben, das nicht wahr ist. – Und sie fühlen<br />
Mitleid mit uns ... <br />
Zeichnung: Karin Fasching<br />
wına-magazin.at<br />
53
MAI KALENDER<br />
von Angela Heide<br />
KONZERT<br />
19.30 Uhr<br />
MuTh<br />
Am Augartenspitz 1,<br />
1020 Wien<br />
ERÖFFNUNGSKONZERT<br />
19.30 Uhr<br />
Odeon<br />
Taborstraße 10, 1020 Wien<br />
9. MAI<br />
OUT OF SIGHT<br />
Aus dem Blick geratene, vergessene<br />
Werke von so wunderbaren<br />
Komponisten, Kabarettisten, Sängern<br />
und vielem mehr wie Fritz<br />
Spielmann, Hermann Leopoldi,<br />
Friedrich Hollaender oder Walter<br />
Jurmann präsentieren der unermüdliche<br />
Wiener Musiker und Komponist<br />
Bela Koreny und Ethel Merhaut.<br />
„Mit Bela ein Programm zu<br />
entwickeln und es aufzuführen, ist<br />
jedes Mal ein Abenteuer“, erzählt<br />
die in Wien geborene junge Sopranistin.<br />
Nun haben sich die beiden<br />
KünstlerInnen erneut auf die<br />
gemeinsame Spurensuche begeben<br />
und haben musikalische Juwelen<br />
wiederentdeckt, die von der<br />
vertriebenen und vergessenen großen<br />
Zeit des Wiener jüdischen Kulturlebens<br />
erzählen und die sie mit<br />
Hits des New Yorker Jiddish Theatre<br />
von Avraham Ellstein kombinieren,<br />
dem so mancher der Vertriebenen<br />
im Exil begegnet sein mag – nun<br />
finden sie erneut auf der Bühne zusammen.<br />
Begleitet werden die beiden beim<br />
Eröffnungskonzert des diesjährigen<br />
Festivals der jüdischen Kultur von<br />
Schauspieler-Multitalent Cornelius<br />
Obonya, der unter anderem Texte<br />
von Ephraim Kishon liest.<br />
11. MAI<br />
ICH BIN EIN<br />
DURCHSCHNITTS-WIENER<br />
Was für eine Begegnung: Erwin<br />
Steinhauer & Klezmer, reloaded, extended<br />
– Erwin Steinhauer, Schauspieler,<br />
Kabarettist, Autor, Publikumsliebling<br />
seit Jahrzehnten auf der<br />
Bühne und im Fernsehen, trifft hier –<br />
als Sänger! – auf Klezmer reloaded,<br />
Alexander Shevchenko und Maciej Golebiowski,<br />
auf Hermann Leopoldi und<br />
auf Songs, die man in dieser Formation<br />
und musikalischen Neusicht wohl<br />
nicht so schnell wieder hören wird.<br />
Auch der Titel folgt einem Lied Leopoldis,<br />
der 1888 als Hersch Kohn<br />
in Wien Meidling geboren wurde, jedoch<br />
früh schon auf Anraten des Vaters<br />
den Namen änderte – was ihn<br />
nicht vor den Konzentrationslagern<br />
retten sollte. Dank eines Affidavits seiner<br />
Schwiegereltern überlebte er die<br />
Schoah, emigrierte nach New York –<br />
und kehrte 1947 nach Wien zurück,<br />
wo er 1959 starb. Seine Texte sind so<br />
vordergründig leicht wie tiefgründig<br />
traurig, humorvoll und menschlich –<br />
und erzählen von den verlorenen Heimaten,<br />
ob im Schtetl oder im kleinen<br />
Café in Hernals ... Wienerlied meets<br />
Jazz meets Tango meets Chanson –<br />
bunter kann Klezmer wohl nicht sein.<br />
Interview mit Erwin Steinhauer<br />
auf Seite 22<br />
VERNISSAGE<br />
18 Uhr<br />
Brick5<br />
Fünfhausgasse 5 , 1150 Wien<br />
15. MAI<br />
JUNGE JÜDISCHE KUNST<br />
AUS WIEN<br />
Die Gemeinsamkeit der Unterschiedlichkeit<br />
– Kuratiert von der<br />
in Brasilien geborenen und heute<br />
in Wien lebenden jungen Kuratorin<br />
Aline Lara Rezende, präsentieren<br />
jüdische KünstlerInnen, deren Gemeinsamkeit<br />
ihr Leben in Wien ist,<br />
aktuelle Positionen aus ihren sehr<br />
unterschiedlichen künstlerischen<br />
Arbeiten. Shira Ehlers kombiniert<br />
unterschiedliche Materialien und<br />
Maltechniken, Andrew Mezvinsky<br />
verbindet Mixed Media mit skulpturalen<br />
Zeichnungen, Malereien und<br />
Videos, und Daniel Shaked hält in<br />
seinen Fotoarbeiten zu Musikstars,<br />
Politikern oder Fußballern deren<br />
sehr persönliche Stimmungen fotografisch<br />
fest, Porträts, die dem Moment<br />
gelten, den Augenblick in einer<br />
Welt der Prominenz und des<br />
Scheins wertschätzen. Weitere Arbeiten<br />
sind zu sehen von Roy Riginashvili,<br />
Sascha Vernik und Gioia<br />
Zloczower, die in den Räumen des<br />
Brick 5 auf aufregende und ungewöhnliche<br />
Weise abseits klassischer<br />
Museumskunst präsentiert werden.<br />
Interview mit Aline Rezende<br />
auf Seite 42<br />
54 wına | Mai 2016
FILM<br />
18 Uhr<br />
Votivkino<br />
Währinger Straße 12,<br />
1090 Wien<br />
SZENISCHE LESUNG<br />
19.30 Uhr<br />
Kunst im Prückel<br />
Biberstraße 2,<br />
1010 Wien<br />
16. MAI<br />
VIKTOR FRANKL,<br />
DER PSYCHOLOG<br />
Über die Größe des<br />
Menschen – Als der<br />
Wiener Arzt Viktor Frankl,<br />
u. a. Begründer der Logotherapie<br />
und Existenzanalyse,<br />
kurz nach Ende<br />
des Zweiten Weltkrieges<br />
von seinem Freund<br />
Bruno Pittermann – von<br />
1957 bis 1967 Vorsitzender<br />
der SPÖ, von<br />
1957 bis 1966 Vizekanzler<br />
und von 1964<br />
bis 1976 Präsident der<br />
Sozialistischen Internationale<br />
–, gebeten wird,<br />
seine Erlebnisse im Konzentrationslager<br />
niederzuschreiben,<br />
ist wohl<br />
niemandem klar, wie<br />
bahnbrechend Frankls<br />
1946 erschienenes<br />
Buch … trotzdem Ja zum<br />
Leben sagen: Ein Psychologe<br />
erlebt das Konzentrationslager<br />
sein<br />
wird. Christian Spatzek,<br />
der auch Regie führt,<br />
präsentiert gemeinsam<br />
mit Julia Reisinger, Kurt<br />
Hermann und dem Autor<br />
des Abends, Helmut<br />
Korherr, dessen biografisches<br />
Stück über das<br />
Leben und Werk Frankls<br />
als gespielte Lesung.<br />
STRASSENFEST<br />
Einlass 14:30 Uhr<br />
Rathaus Wien<br />
Friedrich-Schmidt-Platz 1,<br />
1010 Wien<br />
21. MAI<br />
STRASSENFEST<br />
Höhepunkt des Festivals<br />
der jüdischen Kultur ist<br />
auch dieses Jahr das gemeinsame<br />
große Straßenfest<br />
im Arkadenhof des Wiener<br />
Rathauses. Moderiert von<br />
Schauspieler und Humor-Spezialisten<br />
Giora Seeliger (Rote<br />
Nasen, Internationale Schule<br />
für Humor in Wien) präsentieren<br />
eine Reihe großartiger<br />
Musikformationen Beliebtes<br />
und Bekanntes, Traditionelles<br />
und Aktuelles. Zu Gast<br />
sind das siebenköpfige Ensemble<br />
Klesmer Wien, Timna<br />
Brauer und Elias Meiri, FRE-<br />
JLECH der Grinberg-Brüder,<br />
die Schlomo Band Vienna<br />
rund um Sänger Shlomo Sarikov,<br />
das Ensemble Shalom<br />
Alejchem und Yair Barzilai mit<br />
seiner Band. Das Programm<br />
ist so schillernd wie seine InterpretInnen:<br />
chassidische<br />
Lieder und jiddische Volkslieder,<br />
Songs from Jerusalem,<br />
Musik aus Ost- und Westeuropa,<br />
Amerika und natürlich<br />
Wien – und das auf Hebräisch,<br />
Englisch, Russisch, Italienisch,<br />
Spanisch und Bucharisch.<br />
Ein Fest für alle mitten<br />
im Herzen von Wien.<br />
18. MAI<br />
VIENNA’S LOST<br />
DAUGHTERS<br />
Wiens verlorene Töchter<br />
Die 1970 nahe Wien geborene<br />
Filmregisseurin, Moderatorin<br />
und Fotografin Mirjam<br />
Unger hat mit ihrem<br />
vor 10 Jahren erschienenen<br />
Film Vienna’s Lost Daughters<br />
acht jüdischen Frauen<br />
im Alter von über 80, die<br />
1938/39 vor dem Nationalsozialismus<br />
durch Kindertransporte<br />
gerettet werden<br />
konnten, ein sehr persönliches<br />
filmisches Denkmal<br />
gesetzt, in dem das ambivalente<br />
Verhältnis der vertriebenen<br />
Jüdinnen zu Wien<br />
ebenso wenig verschwiegen<br />
wird wie deren traumatische<br />
Erfahrungen von Ausgrenzung,<br />
Verfolgung und<br />
Flucht. Aber auch ihrem<br />
neuen Leben in New York,<br />
in dem Wien bis zuletzt in ihnen<br />
weiterlebte, spürt Unger<br />
darin feinfühlig nach. Nach<br />
der Vorstellung spricht die<br />
Regisseurin, die zuletzt für<br />
ihre Verfilmung von Christine<br />
Nöstlingers Maikäfer<br />
flieg mehrere Auszeichnungen<br />
erhielt, mit Giora Seeliger<br />
über die Entstehung des<br />
Films und darüber, wie sich<br />
Erinnerungen über Generationen<br />
hinweg manifestieren<br />
und was Kinder und Enkelkinder<br />
weitertragen können<br />
und wollen.<br />
Siehe auch Das letzte Mal,<br />
Seite 56<br />
KONZERT<br />
19.30 Uhr<br />
Porgy & Bess<br />
Riemergasse 11, 1010 Wien<br />
23. MAI<br />
SCHUM DAVAR<br />
Sandra Kreisler & Band<br />
Die Tochter von Georg Kreisler<br />
und Topsy Küppers<br />
weiß um ihr großes künstlerisches<br />
Erbe. Denn „wo<br />
Kreisler draufsteht, ist auch<br />
Kreisler drin“. Sanfte und<br />
entspannende Töne darf<br />
man an diesem Abend also<br />
nicht erwarten, dazu sind<br />
die Dinge, die Kreisler, kongenial<br />
begleitet von Gennadij<br />
Desatnik an Geige, Bratsche,<br />
Gitarre und Valeriy<br />
Khoryshman am Akkordeon,<br />
zu erzählen hat, zu wichtig,<br />
zu heutig und zu herrlich<br />
düster. Und so verspricht<br />
der Titel auf der einen Seite<br />
„kleine Sachen“ und auf der<br />
anderen knoblauchscharfe<br />
Beobachtungen rund um<br />
das jüdische Leben von<br />
heute. Modern, musikalisch<br />
und mutig – Kreisler eben.<br />
© ikg-kultur.at, Simone Hofmann, filmfonds-wien.at, Nancy Horrowitz<br />
wına-magazin.at<br />
55
DAS LETZTE MAL<br />
Das letzte Mal beeindruckt von<br />
einem filmischen Ereignis war<br />
ich …<br />
... bei der Berlinale. Dort gibt es so<br />
wundervolle Kinos in einer Dimension,<br />
wie ich sie selbst nur aus Filmen<br />
kannte. Beim Film Beuys im<br />
vollen Friedrichstadtpalast blieb<br />
mir der Atem weg.<br />
Das letzte Mal filmreif gefeiert<br />
habe ich …<br />
... beim Sederabend auf Einladung<br />
meiner Mutter, mit meinen<br />
Schwestern und unseren Kindern,<br />
also drei Generationen. Es war ein<br />
festliches Tohuwabohu, wir können<br />
ja alle nicht still halten. Das<br />
sind dann Szenen wie aus einem<br />
Woody-Allen-Film, ich würde das<br />
gerne mal mit filmen.<br />
Meine letzte oscarverdächtige<br />
Leistung war …<br />
... vielleicht, als ich unseren Kater<br />
mitten in der Nacht intuitiv gepflegt<br />
habe, als er von einem Marder völlig<br />
zerkratzt und zerbissen, nass<br />
und zitternd nach Hause gekommen<br />
ist. Nach zwei Stunden hat<br />
er sich beruhigt, und am nächsten<br />
Tag wollte er schon wieder strawanzen<br />
gehen.<br />
Das letzte große Drama in<br />
meinem Leben war …<br />
... die plötzliche Erkrankung meiner<br />
Tante. Sie kämpft tapfer um ihr<br />
Leben.<br />
Meine letzte wichtige „Regieanweisung“<br />
bekam ich …<br />
... von meiner Mutter, als sie mir<br />
sagte: „Mirjam, du darfst glücklich<br />
sein.“<br />
VOM<br />
GLÜCKLICH-<br />
SEINDÜRFEN<br />
Für alles gibt es ein erstes Mal – aber auch ein letztes<br />
Mal. Regisseurin Mirjam Unger erzählt über filmreife<br />
Sederabende, einen oscarverdächtigen Pflegeeinsatz<br />
und die wichtigste Regieanweisung ihrer Mutter.<br />
Im Rahmen des Festivals der jüdischen Kultur 2017 läuft<br />
Mirjam Ungers Film Vienna’s Lost Daughters (2007).<br />
Im Film porträtiert die geborene Wienerin acht jüdische<br />
Frauen, die 1938/39 vor dem Nationalsozialismus<br />
aus Wien nach New York geflüchtet sind, und<br />
zeichnet ihre traumatischen Erfahrungen mit Flucht und<br />
Ankunft in einem neuen ungewissen Leben nach.<br />
© Christine Ebenthal<br />
Vienna’s Lost Daughters: 18.5., 18–20.30 Uhr, Votivkino, mit anschließendem Gespräch der Regisseurin mit Giora Seeliger<br />
Weitere Infos: ikg-kultur.at<br />
56 wına | Mai 2017
Fischerauto<br />
Ihr Familienunternehmen seit Generationen<br />
EDITION 25! Sondermodelle<br />
Jetzt bis zu<br />
€ 4.900,– sparen!<br />
Die Hyundai EDITION 25!<br />
Sondermodelle mit attraktiver Sonderausstattung zum Bestpreis!<br />
Hyundai i10 EDITION 25!<br />
Jetzt ab € 9.490,–<br />
Ihr Preisvorteil: bis zu € 2.500,-<br />
Hyundai ix20 EDITION 25!<br />
Jetzt ab € 15.990,–<br />
Ihr Preisvorteil: bis zu € 3.150,-<br />
Hyundai i20 EDITION 25!<br />
Jetzt ab € 11.490,–<br />
Ihr Preisvorteil: bis zu € 3.400,-<br />
Hyundai Tucson EDITION 25!<br />
Jetzt ab € 24.990,–<br />
Ihr Preisvorteil: bis zu € 4.900,-<br />
Wagramer Straße 36A<br />
1220 Wien<br />
Tel: +43 263 42 92<br />
verkauf@fischerauto.at<br />
www.fischerauto.at<br />
VERKAUF - SERVICE - REPARATUR<br />
Ihr Auto in besten Händen