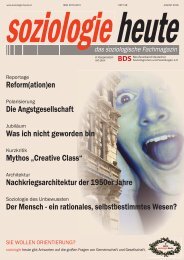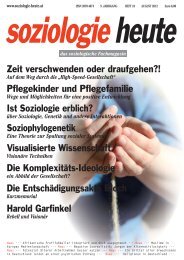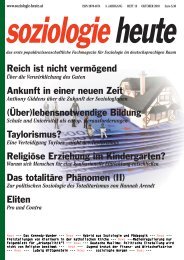soziologie heute Juni 2016
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschen Sprachraum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschen Sprachraum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sah, andererseits historisch-methodisch<br />
sich auf Max Weber ausgerichtet<br />
hatte, so war Rosenmayr in den<br />
USA durch die Begegnung mit Paul<br />
Lazarsfeld in eine völlig andere Sozialwissenschaft<br />
eingeführt worden.<br />
Und die Soziologie im „Nachkriegs-<br />
Deutschland“ hatte von Beginn an<br />
sich in eine empirische und in eine<br />
geisteswissenschaftliche Richtung<br />
getrennt.<br />
Praxisorientierte Forschung<br />
Rosenmayr sah früh ebenfalls die<br />
Vorteile einer empirischen Richtung<br />
für eine praxisorientierte Forschung.<br />
Allerdings hatte er das Thema seiner<br />
anfänglichen Forschungen eher<br />
zurückhaltend auf spezifi sch sozialpolitische<br />
Fragen abgestellt wie<br />
Lazarsfeld vor 1938. Somit waren<br />
Familien- und Jugend<strong>soziologie</strong> die<br />
dominanten Themen, die gleichzeitig<br />
auch bei René König und Helmut<br />
Schelsky im Mittelpunkt des<br />
Interesses standen. In Berücksichtigung<br />
einer Politik für Jugend und<br />
Jugendwohlfahrt, die die Stadt Wien<br />
immer deutlicher unterstützt hatte,<br />
begann er die Arbeitswelt der Jugendlichen<br />
zu untersuchen. In diese<br />
Untersuchungen waren schließlich<br />
die neuen Dimensionen der Sozialpsychologie<br />
einbezogen worden<br />
und bestätigten die Aussagen David<br />
Riesmans über die „einsame<br />
Masse“. Das methodische Vorgehen<br />
hatte bei Rosenmayr stets eine<br />
realistische Grundlage, da er bei<br />
allen seinen reichen Forschungen<br />
zuerst einmal das persönliche Erleben<br />
gesellschaftlicher Problemlagen<br />
gleichsam als Praxisrelevanz voranstellte.<br />
Nachdem er seine Familie in<br />
den 50er Jahren gegründet hatte,<br />
war er Familiensoziologe geworden,<br />
während des Heranwachsens seiner<br />
Kinder hierauf Jugendsoziologe, um<br />
schließlich im fortgeschrittenen Alter<br />
sich der Alters<strong>soziologie</strong> zu widmen.<br />
Diese Neigung zum „Realismus“<br />
oder zum persönlich erfahrenen<br />
Realitätsbezug war eine legitime Begründung<br />
seiner wissenschaftlichen<br />
Neugier. Selten war er in seinen Aufzeichnungen<br />
gleichsam archivalisch<br />
vorgegangen, doch darin zeigte er<br />
speziell in der Dokumentation der<br />
Jugendpsychiatrie und Psychoanalyse<br />
in Österreich nach 1918 seine<br />
beeindruckende Einschätzung.<br />
Leopold Rosenmayr hatte nach der<br />
immer besseren Ausstattung des<br />
soziologischen Institutes während<br />
der 70er Jahre buchstäblich seine<br />
betriebsame „Forschungsstelle“<br />
ausgeweitet, die er im Geist Paul<br />
Lazarsfelds organisierte - hatte also<br />
gleichsam eine arbeitsteilige Wissensproduktion<br />
in Gang gesetzt. Nun<br />
war es ein Wissenschaftsbetrieb innerhalb<br />
des Institutes geworden und<br />
somit nicht mehr eine affi liierte Forschungseinrichtung<br />
an einer Universität.<br />
Trotz der Schwierigkeiten, die<br />
sich sowohl durch die Neuorganisation<br />
der Universität ab 1972 ergeben<br />
haben, als auch durch die Wiener<br />
Spielart von Studentenprotest, war<br />
Rosenmayr ein unbeirrter Arbeiter<br />
geblieben und hatte mit viel diplomatischem<br />
Geschick „sein“ Institut<br />
durch unruhige Zeiten gesteuert. Obwohl<br />
man in Wien weit davon entfernt<br />
blieb, so hätte natürlich das Fach<br />
Soziologie ein Ziel der Provokationen<br />
wie in Paris sein können. Durch<br />
die Drittelparität der „Berufsstände“<br />
in den universitären Gremien waren<br />
die Entscheidungsmechanismen der<br />
Universität nachdrücklich verändert<br />
worden, weshalb man eine ähnliche<br />
Konfl iktaustragung und „Demonstrationskultur“<br />
wie in Berlin oder<br />
Frankfurt hätte erwarten können.<br />
Allerdings beschränkte sich die Wiener<br />
Revolte auf die Defäkation eines<br />
Hörsaales. Rosenmayr hatte damals<br />
für anarchistischen oder ähnlichen<br />
Aktionismus wenig Verständnis, sah<br />
darin eine bittere Vergeudung von<br />
Zeit und Geld.<br />
Ideologisierte Soziologie<br />
Mit diesen veränderten Verhältnissen<br />
an der Universität und in deren<br />
intellektuellen Umwelt war ausgerechnet<br />
sein fachliches Selbstverständnis<br />
in Misskredit gekommen,<br />
was ihn erheblich verletzt hatte.<br />
Hatte er bislang die Auffassung<br />
vertreten, an der Wiedergeburt der<br />
neuen und empirischen Soziologie<br />
in Mitteleuropa beteiligt gewesen zu<br />
sein, vielleicht auch deshalb Bedenken<br />
gegenüber den Richtungen der<br />
Frankfurter Schule nicht ausdrücklich<br />
formulieren zu müssen, so war<br />
dennoch eine Schwächung der „institutionalisierten“<br />
Sozialforschung<br />
eingetreten. Soziologie war inzwischen<br />
eine Weltanschauungsproduzentin<br />
geworden, hatte sogar ihre<br />
Ideologisierung in Kauf genommen,<br />
aber für die empirische Sozialforschung<br />
war der bei weitem größere<br />
Rückschlag, ab nun im Schatten von<br />
kommerziellen Meinungs- Marktund<br />
Wirtschaftsforschungsinstituten<br />
zu stehen. Rosenmayr musste zur<br />
Kenntnis nehmen, in Österreich in<br />
derartigen Forschungen nicht mehr<br />
konkurrenzlos zu sein und vielleicht<br />
erleichterte es seinen Entschluss,<br />
sich auf Sozialgerontologie und Altenforschung<br />
zu konzentrieren.<br />
Bis dahin gelang es ihm mit wechselndem<br />
Erfolg zwischen den „Fronten“<br />
der Standesvertretungen und<br />
Gremien der Fakultät und des Institutes<br />
zu vermitteln, für Absurditätsminimierung<br />
am Institut und in der<br />
Fakultät zu sorgen, was ihm schließlich<br />
mit der Einrichtung eines unabhängigen<br />
„Boltzmann Institutes für<br />
Sozialgerontologie und Lebenslaufforschung“<br />
am Institut gelungen war.<br />
Allerdings war das wie ein Rückzug<br />
aus der Repräsentanz seiner wissenschaftlichen<br />
Position am Institut erschienen.<br />
Diese Korrektur verdankte<br />
er seinem Talent, unbeirrt ein Ziel<br />
zu verfolgen, für sich Freiräume zu<br />
schaffen, was er sich offensichtlich<br />
während seines Militärdienstes in<br />
Griechenland als Dolmetscher angeeignet<br />
zu haben schien, wie er es<br />
auch in seinen Erinnerungen an die<br />
Kriegszeit beschrieben hatte: Nach<br />
außen stets konziliant, gesprächsbereit,<br />
hatte er hingegen am Institut<br />
eine straffe Organisation durchgesetzt.<br />
Diese Fertigkeit zur Emanzipation<br />
gegenüber einer „Behörden-<br />
Universität“ neueren Zuschnitts<br />
samt deren Tendenz zur Kommerzialisierung<br />
der Wissensangebote<br />
<strong>Juni</strong> <strong>2016</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 33