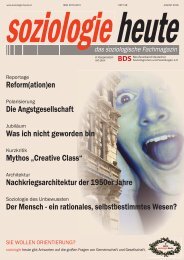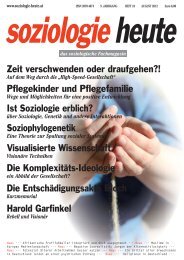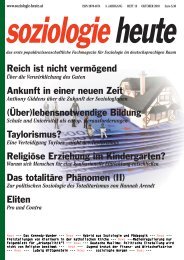soziologie heute Juni 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Juni</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 19<br />
lieben. Es kommt zum Konflikt zwischen<br />
den Schülern/Sängern, der darin<br />
endet, dass das Mädchen stirbt.<br />
Das Video verharrt auf traditionellem<br />
Rollenverständnis. Wiederum werden<br />
die Sänger als aggressiv, cool und stark<br />
präsentiert und zeigen damit männliche<br />
Typisierungen. Dem Mädchen<br />
kommt ebenfalls ein traditionales Rollenmuster<br />
zu. Es ist den Jungs völlig<br />
untergeordnet, zeigt keine eigeninitiative,<br />
sondern schließt sich dem an, der<br />
sich in dem Konflikt als der Stärkste<br />
herauskristallisiert. Es werden somit<br />
traditionell-patriarchale Werte in Verbindung<br />
mit biologischen Vorstellungen<br />
visualisiert.<br />
Zusammenfassung<br />
Hinsichtlich der Geschlechterdarstellung<br />
in koreanischen Videoclips lässt<br />
sich somit folgendes festhalten: Promotional<br />
Videos von Boybands beinhalten<br />
keine wesentlichen Aussagen.<br />
Im Grunde genommen könnte man<br />
sie als postmoderne Konstrukte bezeichnen,<br />
die in der Hauptsache aus<br />
einer reinen Performance bestehen, in<br />
welcher vor allem traditionelle Rollenmuster<br />
wiedergegeben werden. Diese<br />
beziehen sich sowohl auf das Rollenverständnis<br />
des Mannes als auch<br />
demjenigen der Frau. Frauen treten<br />
in der Regel selten auf, es sei denn, es<br />
handelt sich um ein narratives Video.<br />
Innerhalb der visualisierten Erzählung<br />
erhält die weibliche Rolle einen<br />
unemanzipierten Charakter, der sich<br />
dem Mann willenlos unterordnet.<br />
Gegenüber den Boybands treten Videoclips<br />
von koreanischen Girlbands<br />
etwas differenzierter auf. Dies liegt<br />
daran, dass die meisten der Videos<br />
als semi-narrativ kategorisiert werden<br />
können und durch unterschiedliche<br />
Ideen auffallen. Zum anderen liegt dies<br />
sicherlich auch an der Farbgebung. In<br />
koreanischen Boyband-Clips dominieren<br />
(in der Performance) die Farben<br />
Weiß und Schwarz. Im Gegensatz dazu<br />
legen Videos von Girlbands großen<br />
Wert auf intensive Bonbonfarben. Das<br />
in den Videos dargestellte Rollenverständnis<br />
ist differenziert. So existieren<br />
Videoclips, in denen Frauen durchaus<br />
als emanzipiert dargestellt, aber<br />
auch Clips, in denen Frauen als mädchenhaft-naiv<br />
präsentiert werden. Ein<br />
wesentlicher Punkt betrifft satirische<br />
Elemente, mit denen manche der Videos<br />
arbeiten und welche bei den Clips<br />
der Boybands nicht zu finden sind. So<br />
wird mithilfe von Promotional Videos<br />
Gesellschaftskritik geübt, welche in<br />
Performance und Konzept eingebettet<br />
ist.<br />
Der internationale Erfolg koreanischer<br />
Bands scheint für diese Konzepte zu<br />
sprechen. David MacIntyre zufolge<br />
war bereits im Jahr 2002 in den Musikindustrien<br />
von Japan, Taiwan und anderen<br />
asiatischen Ländern eine zunehmende<br />
Koreanisierung zu vermelden.<br />
Das bedeutet, dass die koreanischen<br />
Konzepte von japanischen, taiwanesischen<br />
und anderen asiatischen Produzenten<br />
übernommen werden, um dadurch<br />
die Vermarktung zu verbessern.<br />
Der Trend greift zudem über in die<br />
USA, Kanada und Australien, wo koreanische<br />
Bands ebenfalls zunehmende<br />
Erfolge feiern können. Möglicherweise<br />
greift diese Entwicklung demnächst<br />
auch über auf Europa.<br />
Literatur<br />
Altrogge, Michael (2000). Tönende Bilder. Interdisziplinäre<br />
Studie zu Musik undBildern in Videoclips und ihrer<br />
Bedeutung für Jugendliche. Berlin: Vistas.<br />
Bachmayer, Eva (1990). „Gequälter Engel. Das Frauenbild<br />
in den pornographischen Comics“. In: Ruth Linhart/Fleur<br />
Wöss (Hrsg). Nippons neue Frauen. S. 205-225. Hamburg:<br />
Rohwohlt.<br />
Blume, Jutta (1993). „Neue Ästhetik-Alter Sexismus?<br />
Frauenbilder in populären Musikvideoclips. Popularität<br />
vs. Eigensinn.“ In: Hutschenreuter, H. (Hrg). Feministische<br />
Streifzüge durch das Punkteuniversum. Medienkunst<br />
von Frauen. Edition Filmwerkstatt: Essen, S. 93-109.<br />
Düllo, Thomas (2000). »Coole Körpermaschinen, hysterisierte<br />
Räume. Maskierte Identitätsvokabeln in neueren<br />
Musik-Clips.« In: Kursbuch Kulturwissenschaft. Hg. v.<br />
Thomas Düllo, Arno Meteling, André Suhr und Carsten<br />
Winter. Münster: Lit, S. 259-275.<br />
Kaplan, Elisabeth Ann (1987). Rocking around the clock.<br />
Routledge: London.<br />
MacIntyre, Donald (2002). „Flying too high?“. In: Time<br />
Magazine (Asia Edition), 29. Juli 2002.<br />
Pechmann, Max (2005). „Die Entwicklung des südkoreanischen<br />
Bildungssystems“ In: Patrick Köllner (Hrsg.),<br />
Koreajahrbuch 2005, Institut für Asienkunde, S. 155-167.<br />
Pechmann, Max (2008). „Von unheimlichen Schulmädchen<br />
und ungebetenen Gästen. Zur Charakteristik des<br />
südkoreanischen Horrorfi lms“. In: Phantastisch 2/2008,<br />
S. 40-44.<br />
Springklee, Holger (1985). „Videoclips. Typen und Auswirkungen.“<br />
In: Behne, Klaus-Ernst (Hrsg). Film-Musik-Video<br />
oder Die Konkurrenz von Auge und Ohr. Gustav Bosse Verlag:<br />
Regensburg: S. 117-154.<br />
Max Pechmann,<br />
Jahrgang 1973, wurde<br />
in Wien geboren und<br />
studierte in Heidelberg<br />
Soziologie, Philosophie<br />
und Asiatische Geschichte.<br />
Er war/ist als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter<br />
bzw. Dozent u.a. am<br />
Institut für Soziologie<br />
in Bamberg, Heidelberg<br />
und Würzburg tätig.<br />
Schwerpunkte seiner Arbeit sind Aspekte der Filmund<br />
Kultur<strong>soziologie</strong>. Nebenberuflich ist er als Essayist,<br />
Film- und Buchkritiker tätig.<br />
BUCHEMPFEHLUNG<br />
Berger, Peter L.<br />
Einladung zur Soziologie<br />
Eine humanistische Perspektive<br />
1. Aufl age <strong>2011</strong><br />
220 S.<br />
UTB / UVK<br />
ISBN: 978-3-8252-3495-9<br />
UTB: 3495<br />
Buchpreis: EUR 14,90 (D) / SFR 21,90<br />
(CH) / EUR 15,40 (A) inkl. Mwst. + zzgl.<br />
Versandkosten<br />
Peter L. Berger eröffnet mit seiner „Einladung<br />
zur Soziologie“ auf leichtfüßige<br />
und eingängige Art einen Zugang in die<br />
Denkweise des Fachs. Im Alter von nur<br />
35 Jahren schrieb er diese zeit- und konkurrenzlose<br />
Einführung, welche zwischenzeitlich<br />
in zahlreiche Sprachen<br />
übersetzt wurde. Ergänzt wird das Werk<br />
durch ein aktuelles Interview, das die<br />
Herausgeberin Michaela Pfadenhauer<br />
mit Peter L. Berger über dieses Buch und<br />
sein heutiges Verständnis von Soziologie<br />
führte.<br />
Peter L. Berger gilt als bedeutendster Vertreter<br />
der sogenannten „neueren Wissens<strong>soziologie</strong>“<br />
und scharfer Analytiker der<br />
Gegenwart. Er leitete 30 Jahre lang das<br />
von ihm gegründete „Institute for Culture,<br />
Religion and World Affairs“ (CURA)<br />
an der Boston University.<br />
SOZIOLOGIEHEUTE_JUNIausgabe<strong>2011</strong>a.indd 19 26.05.<strong>2011</strong> 13:35:20