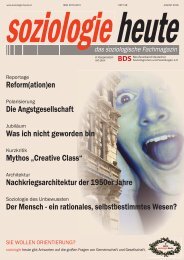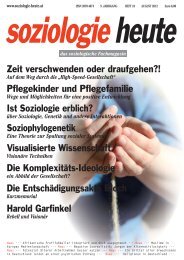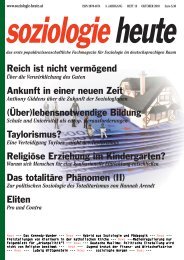soziologie heute Juni 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Juni</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 23<br />
Unterlegenheit zu entrinnen, und oft<br />
verschwimmt dabei der Blick auf den<br />
sozialen Gesamtzusammenhang, denn<br />
appelliert wird üblicherweise schließlich<br />
an die Fähigkeit des Einzelnen zur<br />
inneren „Transformation“ und nicht<br />
etwa an die politische Organisation<br />
der Individuen oder auch nur an eine<br />
Bereitschaft zur offenen sozialen Problematisierung.<br />
In letzter Konsequenz<br />
bedeutet das: Das Individuum wird<br />
vollständig auf sich selbst zurückgeworfen.<br />
Wenn der Erfolg ausbleibt,<br />
sieht der Einzelne folglich in erster Linie<br />
das eigene Versagen und übersieht<br />
die starren sozialen Hindernisse, die<br />
womöglich in der Tat für sein individuelles<br />
Scheitern verantwortlich waren.<br />
Als „dauerhafte Empfindung eigener<br />
Unzulänglichkeit“ charakterisiert der<br />
Wiener Soziologe Sighard Neckel die<br />
Depression, jene psychische Verfassung<br />
also, die aufgrund ihrer Besorgnis<br />
erregenden Verbreitung vielerorts<br />
längst als „Volkskrankheit“ bezeichnet<br />
wird. Wer sich in Erwartung von Aufstieg<br />
und Teilhabe an der Transformation<br />
des eigenen Innenlebens abarbeitet,<br />
ohne den erwarteten Erfolg<br />
einzustreichen, der läuft demzufolge<br />
Gefahr, in einen dauerhaften Zustand<br />
von Trübsinn und Erschöpfung zu gelangen,<br />
wenn immer wieder der gefährliche<br />
Schluss gezogen wird: Wer auf<br />
der Strecke bleibt, der hat es nicht anders<br />
gewollt, und wem der Erfolg verwehrt<br />
bleibt, dem fehlt der Wille zur<br />
Veränderung, dem fehlt das positive<br />
Denken. Laut Neckel soll den Gefühlen<br />
persönlicher Unzulänglichkeit in unserer<br />
gegenwärtigen Gesellschaft mit<br />
Foto: <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong><br />
der „Selbstinzenierung eines stoischen<br />
Optimismus“ begegnet werden.<br />
Das „soziale Bedürfnis“ zur Selbstoptimierung<br />
Was aber bringt uns dazu, eine solche<br />
Sicht auf unser Leben einzunehmen?<br />
Aus der soziologischen Perspektive<br />
muss man dahinter Bedürfnisse vermuten,<br />
die gesellschaftlich regelrecht<br />
„produziert“ werden. Natürlich gibt<br />
es Grundbedürfnisse, die höchstwahrscheinlich<br />
dem einzelnen Menschen<br />
und seiner Biologie entspringen: das<br />
Bedürfnis zu essen oder das Bedürfnis<br />
zu schlafen beispielsweise. Doch ebenso<br />
gibt es Bedürfnisse, die erst durch<br />
unser Zusammenleben entstehen und<br />
die deshalb in Hinsicht auf ihren sozialen<br />
Sinn betrachtet werden müssen:<br />
Das Bedürfnis nach ökonomischem<br />
Erfolg beispielsweise ergibt sich im<br />
Rahmen einer bestimmten zivilisierten<br />
und kapitalistischen Lebensweise und<br />
wäre in anderen Gesellschaftsformen<br />
womöglich irrelevant oder zumindest<br />
von geringerer Bedeutung. Auch sozial<br />
„produzierte“ Bedürfnisse werden<br />
jedoch in der gegenwärtigen Ratgeber-<br />
und Optimierungskultur mitunter<br />
an den Mann gebracht, als wären sie<br />
ebenso dringend, natürlich und selbstverständlich<br />
wie das unmittelbare Bedürfnis<br />
nach Nahrungsaufnahme oder<br />
Schlaf. Die Warnung davor, sich einem<br />
solchen Bedürfnis zu verschließen,<br />
folgt auf dem Fuße, wenn etwa in einem<br />
Ratgeber davon die Rede ist, dass Bedürfnisse,<br />
die über längere Zeiträume<br />
hinweg vernachlässigt werden, einen<br />
überaus negativen Einfluss auf unser<br />
persönliches Wohlbefinden und unsere<br />
Leistungsfähigkeit haben . Diese Beschreibung<br />
von Ursache und Wirkung<br />
lässt die sozialen Bedingungen und<br />
Begleitumstände außen vor und greift<br />
direkt in das emotionale Innenleben<br />
ein, das im Rahmen der Selbstoptimierung<br />
im Folgenden bearbeitet werden<br />
soll. Die Legitimation des Bedürfnisses<br />
wirkt somit ganz natürlich und selbstverständlich.<br />
Die Möglichkeit zur Problematisierung<br />
wiederum gerät ins<br />
Hintertreffen.<br />
Aspekte von Herrschaft und Zwang<br />
begreifen<br />
Nach Norbert Elias zieht sich ein soziales<br />
Streben nach oben durch nahezu<br />
alle Gesellschaftsschichten. Die Ausbreitung<br />
der Selbstmanipulation im<br />
Namen der Vitalität, der Teilhabe und<br />
der Lebensoptimierung ist also groß,<br />
Die Beschäftigung mit der Optimierung des<br />
eigenen Innenlebens führt zum Ressourcenver-<br />
brauch, der dem Einzelnen oftmals das Gefühl<br />
persönlicher Unzulänglichkeit beschert.<br />
und dementsprechend umfassend und<br />
dauerhaft greift die Beschäftigung mit<br />
dem eigenen Innenleben und dessen<br />
Optimierung um sich. So verbrauchen<br />
die Gesellschaftsmitglieder bis in die<br />
hoch qualifizierten, gebildeten Schichten<br />
hinein ihre Ressourcen – wie Zeit,<br />
Aufmerksamkeit und Energie – zunehmend<br />
in einem Prozess, der dem<br />
Individuum nicht selten seelisches<br />
Ungemach wie das beschriebene Gefühl<br />
persönlicher Unzulänglichkeit beschert.<br />
Im Alltagsverständnis mag uns die<br />
Selbst- und Lebensoptimierung als<br />
eine durchweg freiwillige, harmlose,<br />
nützliche Maßnahme erscheinen. Die<br />
soziologische Perspektive dagegen<br />
gestattet, dass wir auch die Rückseite<br />
der Medaille betrachten und die<br />
Aspekte von Herrschaft und Zwang<br />
begreifen, die mit dem Streben nach<br />
Vitalität und Teilhabe Hand in Hand gehen.<br />
In Zukunft wird es notwendig sein,<br />
diese Zusammenhänge klar zu benennen,<br />
sofern uns daran gelegen ist, die<br />
Verbreitung psychischer Gebrechen<br />
aufzuhalten und den Weg für eine tatsächliche<br />
Chancengleichheit zu ebnen.<br />
Ausgewählte Grundlagen zum Thema:<br />
Ehrenberg, Alain (2004): Das erschöpfte Selbst. Depression<br />
und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt am Main,<br />
Campus Verlag GmbH<br />
Elias, Norbert (1969): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische<br />
und psychogenetische Untersuchungen. Bern/<br />
München, Francke<br />
Foucault, Michel (1986): Sexualität und Wahrheit, Erster<br />
Band: Der Wille zum Wissen. Frankfurt am Main, Suhrkamp<br />
Verlag<br />
Neckel, Sighard (2005): Emotion by Design. Das Selbstmanagement<br />
der Gefühle als kulturelles Programm. In: Berliner<br />
Journal für Soziologie, Heft 3/2005<br />
Kai Ginkel<br />
Diplom-Soziologe, Jahrgang 1981, wohnhaft in<br />
Darmstadt.<br />
Diplomarbeit zum Thema „Zwang in der Moderne.<br />
Zu den Selbstzwängen des zivilisierten Menschen vor<br />
dem Hintergrund der Lebensoptimierung“<br />
Interessensschwerpunkte: Prozess der Zivilisation,<br />
Soziologie der Emotionen, Bio-Macht, die Soziologie<br />
Pierre Bourdieus<br />
SOZIOLOGIEHEUTE_JUNIausgabe<strong>2011</strong>a.indd 23 26.05.<strong>2011</strong> 13:35:28