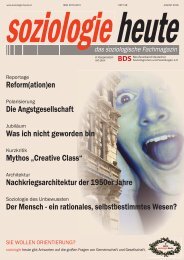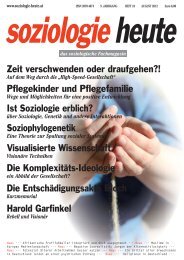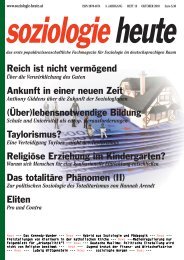soziologie heute Juni 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Juni</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 33<br />
Übergewicht und im Extremfall Adipositas<br />
begegnen Gesundheitsexperten<br />
mit Nahrungsumstellung<br />
und auch Bewegung, in schwierigen<br />
Fällen erscheint zuerst ein chirurgischer<br />
Eingriff (Magenverengung) erforderlich.<br />
Für Außenstehende stellen<br />
sich zuerst folgende, vielleicht<br />
banal klingende Fragen: Wie konnte<br />
es zu diesen extremen Fällen von<br />
Übergewicht kommen? Veränderte<br />
sich die Kleidergröße innerhalb weniger<br />
Tage oder gilt letztlich der altbekannte<br />
Spruch: Ist die Figur erst<br />
mal ruiniert, lebt’s sich frisch und<br />
ungeniert. Wie hat das engste soziale<br />
Umfeld auf die doch offensichtliche<br />
körperliche Veränderung reagiert,<br />
sind wir vielleicht alle co-adipös?<br />
Hilft ein Mehr an Bewegung das<br />
Gewicht zu reduzieren? Schon vor<br />
30 Jahren war bekannt, dass der<br />
Kalorienverbrauch bei sportlicher<br />
Betätigung nicht überdimensional<br />
ist, kurzfristig allerdings Botenstoffe<br />
ausgeschüttet werden, die zu<br />
Glückgefühlen führen und damit das<br />
Hungergefühl senken. Auch regt körperliche<br />
Betätigung das Herz-Kreislaufsystem<br />
an und trägt zum Erhalt<br />
bzw. zur Stärkung der Muskulatur<br />
bei. Beide Faktoren beeinflussen unsere<br />
Gesundheit positiv. Um Übergewicht<br />
zu „bekämpfen“, müssen also<br />
die Lebensgewohnheiten, vor allem<br />
das Essverhalten, verändert werden.<br />
An viel Obst und noch mehr Gemüse<br />
mit wenig Fett führt also im Falle des<br />
Übergewichts kein Weg vorbei.<br />
Hier drängt sich einigen kritischen<br />
Konsumenten wahrscheinlich folgende<br />
Frage auf: Wie gesund ist „unser“<br />
Obst und Gemüse (noch)? Einige<br />
alltägliche Erfahrungen mögen<br />
die erwähnte Skepsis verdeutlichen:<br />
Vor den vollen Obstregalen „laden“<br />
beispielsweise Erdbeeren aus einem<br />
europäischen Nachbarland zur Mitnahme<br />
ein. Einer genauen Beäugung,<br />
- sie sind dunkelrot-, und einem Geruchstest,<br />
- sie duften herrlich aromatisch<br />
-, halten sie stand. Keine 24<br />
Stunden später hat sich diese Wahrnehmung<br />
allerdings als undurchsichtiger<br />
Marketinggag entpuppt.<br />
Schimmelstellen und geruchsneutrales<br />
Aroma machen den Verzehr der<br />
erworbenen Erdbeeren fast zu einer<br />
Qual! Es drängt sich somit folgende<br />
Frage auf: Kann diese Art von Obst<br />
denn überhaupt gesund sein? Ist es<br />
nicht doch besser, anstelle dessen<br />
eine Vitamintablette zu sich zu nehmen?<br />
Ähnliche Beispiele finden sich<br />
tausendfach: steinharte Birnen/Äpfel<br />
und Brot, das nach einem Tag entweder<br />
bretthart oder gummiartig erscheint.<br />
Soweit Altbekanntes durch<br />
ähnlich gelagerte Erfahrungen. Was<br />
aber verbirgt sich dahinter?<br />
Leider hat die Kommerzialisierung<br />
der Lebensmittel böse Folgen für<br />
unsere Existenz, auf welche bis dato<br />
wenig hingewiesen wird. Biologische<br />
Produkte, soweit es diese aufgrund<br />
der verschmutzten Luft und der verunreinigten<br />
Böden überhaupt noch<br />
gibt, sind teuer und werden von vielen<br />
gesellschaftlichen Gruppen als<br />
Luxus empfunden. Als individueller<br />
homo oeconomicus kann jede/r ihre/<br />
seine Präferenzen entsprechend<br />
dem wahrgenommenen Nutzen setzen.<br />
Problematisch wird es aber,<br />
wenn die materielle Absicherung<br />
des Individuums unzureichend ist.<br />
Bereits Jahoda, Lazarsfeld und Zeisl<br />
konnten den Zusammenhang zwischen<br />
finanzieller Ausstattung des<br />
Haushalts und der Qualität der Jausen<br />
von Schulkindern in ihrer Studie<br />
„Die Arbeitslosen von Marienthal“<br />
nachweisen. Dass sich auch <strong>heute</strong><br />
noch finanziell minder bemittelte<br />
Gruppen „ungesünder“ ernähren,<br />
ist bekannt. Dazu gesellen sich aber<br />
noch ganz andere Probleme.<br />
Ein Blick nach Amerika soll dies<br />
verdeutlichen: Die „schwergewichtige<br />
Bevölkerung der USA“ ernährt<br />
sich in erster Linie von Rindfleisch<br />
aus Massentierhaltung. Gleichzeitig<br />
muss betont werden, dass sich nicht<br />
alle übergewichtigen Personen ausschließlich<br />
von Chips und Hamburgern<br />
und Limonade ernähren. Der<br />
Verzehr von mit Exkrementen kontaminierten<br />
Fleisch hat in den USA<br />
schon zu einem Todesfall geführt.<br />
Da die Lobby der Lebensmittelindustrie<br />
dort starken Einfluss hat, ist das<br />
Aufzeigen dieser Missstände besonders<br />
schwierig, wenn nicht sogar für<br />
den einzelnen gefährlich. Vor einigen<br />
Monaten wurde auch eine Studie publiziert,<br />
nach der unsere Haustiere<br />
immer mehr an Übergewicht leiden.<br />
Auch hier könnte man argumentieren:<br />
zu wenig Bewegung und zu viel<br />
Liebesbeweise mit „Leckerlis“. Zunehmend<br />
drängt sich aber der Verdacht<br />
auf, dass unsere Lebensmittel<br />
Inhaltsstoffe aufweisen, welche<br />
bei (vielen) Menschen zu Übergewicht<br />
führen. Hormone, Antibiotika,<br />
aber wahrscheinlich noch nicht so<br />
bekannte Zusatzstoffe wirken vermutlich<br />
auf unseren Stoffwechsel<br />
in ungünstiger Weise ein. Der Reaktorunfall<br />
von Fukoshima lässt uns<br />
bewusst werden, wie die Umwelt<br />
und die Nahrungsmittel mit- und ineinander<br />
verwoben sind, an dieser<br />
Kausalität kann auch der technische<br />
Fortschritt wenig ändern.<br />
Was wenige sich allerdings verdeutlichen<br />
wollen, ist, dass sich die<br />
notwendige Profitgier der Lebensmittelproduzenten<br />
nachhaltig und<br />
dauerhaft auf unserer aller Existenz/<br />
Gewicht auswirkt. Die Konsumenten<br />
sitzen ihren subjektiven Einschätzungen<br />
zufolge in der Falle. Nicht<br />
jede/r kennt einen „Bio-Bauern“,<br />
dem er vertraut, und hat die finanziellen<br />
und zeitlichen Mittel, diese<br />
„gesunden“ Lebensmittel zu organisieren.<br />
Offen bleibt auch die Frage,<br />
inwieweit neuerste technische Fortschritte<br />
die Qualität unserer Lebensmittel<br />
verbessern können. Ist der<br />
Einsatz von Farbstoffen für Fleisch<br />
seit Jahrzehnten Standard, so spielen<br />
<strong>heute</strong> noch ganze andere Methoden<br />
(Gentechnik, Nanotechnologie)<br />
eine Rolle. Was der Spielfilm „Bauernopfer“<br />
drastisch dargelegt hat, lässt<br />
einem bei längerem Nachdenken<br />
erschaudern. Als weiteres trauriges<br />
Beispiel sei die Verwendung von Alkohol<br />
in speziellen Kinderprodukten<br />
erwähnt, Lebensmittelskandale dominieren<br />
in regelmäßigen Abständen<br />
die Medien.<br />
Unbestritten und dennoch schwach<br />
im öffentlichen Diskurs vertreten ist<br />
die Tatsache, dass die kausalen Wirkungen<br />
zwischen Inhaltsstoffen in<br />
Lebensmitteln und deren Auswirkungen<br />
auf das Körpergewicht und unsere<br />
Gesundheit ungenügend erforscht<br />
sind. Feststeht aber auch, dass die<br />
Skepsis unseren Nahrungsmitteln<br />
gegenüber steigt, Unsicherheit in Belangen<br />
der Ernährung macht sich in<br />
weiten Teilen der Gesellschaft breit.<br />
SOZIOLOGIEHEUTE_JUNIausgabe<strong>2011</strong>a.indd 33 26.05.<strong>2011</strong> 13:35:50