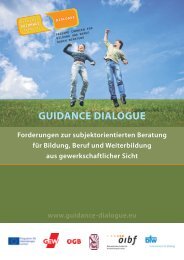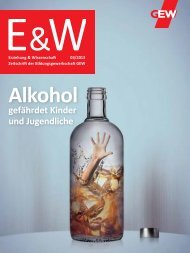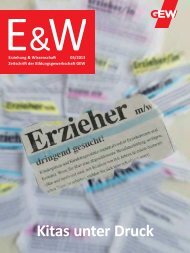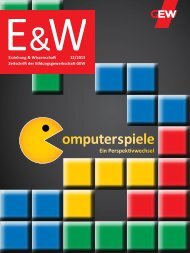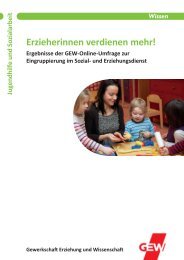Im Sinkflug - GEW
Im Sinkflug - GEW
Im Sinkflug - GEW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
Editorial<br />
Schwerpunkt<br />
Liebe Kolleginnen<br />
und Kollegen,<br />
vielleicht haltet ihr gerade die<br />
letzte Ausgabe der <strong>GEW</strong>-Weiterbildungszeitung<br />
„prekär“ in<br />
den Händen. Der Grund: Bisher<br />
sind Produktion und Vertrieb<br />
der „prekär“ als gemeinsames<br />
Projekt von Hauptvorstand<br />
und Landesverbänden<br />
im Rahmen des Organisationsprozesses<br />
gelaufen – und<br />
finanziert worden. Diese Phase<br />
ist jetzt beendet. Auf dem<br />
Gewerkschaftstag, der vom 23.<br />
bis 27. April in Erfurt stattfindet,<br />
entscheiden die Delegierten,<br />
ob „prekär“ eingestellt<br />
oder in den Aufgaben-Kanon<br />
der <strong>GEW</strong> übernommen wird.<br />
Es gibt viele gute Gründe für<br />
Letzteres. Andererseits muss<br />
Ulf Rödde,<br />
verantwortlicher<br />
Redakteur<br />
von „prekär“<br />
die Organisation politisch<br />
genau abwägen, welche Arbeiten<br />
Priorität haben. Denn eins<br />
steht fest: Das Geld der <strong>GEW</strong>,<br />
die Beiträge der Mitglieder,<br />
lässt sich nicht beliebig vermehren.<br />
Der Projektbeirat und die<br />
Redaktion meinen, dass die<br />
Evaluation des „prekär“-Experiments<br />
für die Delegierten<br />
eine gute Entscheidungsgrundlage<br />
für ein positives Votum<br />
ist. Sie empfehlen dem<br />
Gewerkschaftstag, die Zeitung<br />
weiter zu führen. Auch die<br />
sehr ermutigenden Ergebnisse<br />
der Leserbefragung, für die der<br />
renommierte Hamburger<br />
Kommunikationswissenschaftler<br />
Professor Jürgen Prott verantwortlich<br />
zeichnet (s. Seite<br />
neun), liefern viele Argumente<br />
dafür, mit „prekär“ auch künftig<br />
regelmäßig über den Weiterbildungsbereich<br />
zu berichten.<br />
Bei allen Unwägbarkeiten ist<br />
eins allerdings sicher: Dies<br />
wird das letzte „Editorial“ der<br />
„prekär“-Geschichte. Denn<br />
auch das hat die Befragung<br />
gezeigt: Das „Editorial“ halten<br />
die Leserinnen und Leser für<br />
die Rubrik, auf die man am<br />
ehesten verzichten kann.<br />
Ulf Rödde<br />
Fortsetzung von Seite 1<br />
gegen Konzerte. Aber der politische<br />
Gehalt darf nicht fehlen.“<br />
Zu der finanziellen Krise kommt<br />
spätestens seit den 90er-Jahren<br />
eine weitere: Politische Bildung,<br />
heißt es, müsse sich modernisieren,<br />
marktgängiger und nachfrageorientierter<br />
werden. Der Gießener<br />
Politikwissenschaftler Karsten<br />
Rudolf stellte in seinem „Bericht<br />
politische Bildung 2002“ eine<br />
ganze Reihe provokanter Thesen<br />
auf: Eine politische Bildung, die<br />
nicht „das Klagelied der neoliberalen<br />
Durchkapitalisierung der Gesellschaft“<br />
singe, könne nicht wie<br />
heute nur fünf, sondern bis zu 39<br />
Prozent der Bürger erreichen. Statt<br />
tief schürfender Minderheitenseminare<br />
forderte er aktuelle, konkrete<br />
und das Informationsbedürfnis<br />
befriedigende Angebote: Broschüren,<br />
Bürgertelefone, Infostände.<br />
Der Präsident der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung,<br />
Thomas Krüger, ist nicht ganz so<br />
radikal, wird aber auch deutlich:<br />
„Die politische Bildung ist zur<br />
Modernisierung verurteilt.“ Sie<br />
müsse mehr mit modernen Medien<br />
arbeiten und neue – auch<br />
politikferne – Zielgruppen erschließen.<br />
Krüger selbst hat<br />
seit 2000 viel Energie in die Bundeszentrale<br />
gesteckt: unter anderem<br />
in einen attraktiven Online-<br />
Auftritt und in das Jugendmagazin<br />
„fluter“.<br />
Längst ist die Palette der Angebote<br />
breiter als viele meinen. „Wir diskutieren<br />
schon lange nicht mehr<br />
auf der Alm über Parteiendemokratie“,<br />
sagt Schiele. Vor allem jene<br />
Angebote seien erfolgreich, die<br />
Menschen Teilhabe ermöglichen:<br />
beispielsweise die von der Stuttgarter<br />
Landeszentrale unterstützten<br />
Jugendgemeinderäte in all jenen<br />
Gemeinden, in denen sie ernst<br />
genommen und in politische Entscheidungen<br />
einbezogen würden;<br />
politische Stände auf Marktplätzen,<br />
wenn sich politisch Verantwortliche<br />
außerhalb des Wahlkampfs<br />
den Fragen der Menschen<br />
stellten. Für den harten Kern politisch<br />
Interessierter, sagt Schiele,<br />
müssten weiterhin tiefgründige<br />
Angebote gemacht werden: „Das<br />
sind wir ihnen schuldig.“<br />
Kleinteilige Angebote<br />
Auch der stellvertretende Leiter der<br />
niedersächsischen Volkshochschulen,<br />
Jürgen Heinen-Tenrich, konstatiert<br />
eine enorme Veränderung:<br />
„Die großen politischen Themen<br />
sind tot“, sagt er, „aber mit kleinteiligen<br />
Angeboten erreicht man die<br />
Leute doch.“ Also: Statt fünftägiger<br />
Seminare „Lange Abende“ zu<br />
einem Thema, das von verschiedenen<br />
Seiten aufgearbeitet wird.<br />
Erfolg habe alles, sagt Heinen-Tenrich,<br />
was „aktuell, punktuell, verwendungs-<br />
und verwertungsorientiert“<br />
sei. Bedauern schwingt mit:<br />
„Vor zehn Jahren haben wir sokratische<br />
Gespräche angeboten – das ist<br />
heute undenkbar.“<br />
Die Frage, wie die Wirksam- und<br />
Verwertbarkeit politischer Bildung<br />
sichergestellt werden sollen, stellt<br />
sich insbesondere in ihrem vielleicht<br />
wichtigsten Aufgabenfeld:<br />
der Erziehung zur Demokratie<br />
beziehungsweise der Bekämpfung<br />
und Prävention von Antisemitismus<br />
und Rassismus. „Kein<br />
Mensch macht aus Glatzköpfen<br />
mal eben multikulturelle Demokraten“,<br />
sagt Matthias Heyl,<br />
pädagogischer Leiter der Gedenkstätte<br />
Ravensbrück in Brandenburg,<br />
„unsere Arbeit ist nicht<br />
messbar. Aber ist sie deswegen<br />
nicht förderungswürdig?“ Das hat<br />
sich offenbar auch die nordrheinwestfälische<br />
Landesregierung gefragt.<br />
Ihre Antwort: <strong>Im</strong> Februar<br />
2004 strich sie den gesamten Etat<br />
für Gedenkstättenfahrten.<br />
Neue Argumente<br />
Ein irrsinniger Beschluss, findet<br />
Klaus Ahlheim: „Es geht nicht an,<br />
dass die wesentlichsten bildungspolitischen<br />
Anstöße aus den Rechnungshöfen<br />
kommen.“ Um den<br />
Vertretern der politischen Bildung<br />
schlagkräftige Argumente zu liefern,<br />
arbeitet der Essener Professor<br />
deshalb zurzeit an einer Studie zur<br />
Nachhaltigkeit politischer Bildung.<br />
Ahlheim: „Der engagierte politische<br />
Bildner von heute ist nichts<br />
Geringeres als ein dynamischer<br />
Optimist am ständigen Rande der<br />
Resignation. Er braucht unsere<br />
Unterstützung.“<br />
Jeannette Goddar<br />
Kommentar<br />
Werkstätten der Demokratie<br />
Ein Blick in die Realität zeigt:<br />
Politische Bildung ist unverzichtbar.<br />
Arbeitsplätze sind vorrangig,<br />
Sozialhilfe ist wichtig,<br />
die Schulen müssen<br />
dramatische Rückstände aufholen<br />
– viele Prioritäten der Politik<br />
scheinen sonnenklar. Und wer<br />
braucht politische Erwachsenenbildung?<br />
Junge Leute brauchen politische<br />
Erwachsenenbildung: Die<br />
These, junge Leute kämen politisch<br />
gebildet aus der Schule,<br />
ignoriert die Zwänge dieser Institution.<br />
Jüngere nehmen wegen<br />
ihrer Mobilität weniger an der<br />
formellen politischen Erwachsenenbildung<br />
teil – aber sie machen<br />
die Erfahrung, dass die politische<br />
Debatte unter den Bedingungen<br />
einer Bildungsstätte oder<br />
Volkshochschule (VHS) eine<br />
neue Dimension hat. Sie ist dort<br />
offener, differenzierter, weil mehrere<br />
Generationen an der Diskussion<br />
beteiligt sind, näher an der<br />
Realität, weil hier schneller als in<br />
der Richtlinienmaschinerie neue<br />
Fragen, Ergebnisse und Kontroversen<br />
aufgenommen werden<br />
können.<br />
Alte Menschen brauchen politische<br />
Erwachsenenbildung: Die<br />
wachsende Gruppe älterer Teilnehmer<br />
hat besonders viel an Wandel<br />
zu verarbeiten. Und sie trägt zum<br />
Erfahrungstransfer bei: Welche<br />
Erfahrungen mit gesellschaftlichen<br />
Zwängen und Freiheiten haben<br />
die Älteren gemacht, wie wurden<br />
„ Politische<br />
Standpunkt: Bildung muss<br />
Jens Schmidt,<br />
sich heute mehr<br />
„Arbeit und Leben“, Hamburg<br />
denn je Fragen<br />
wie Solidarität, Demokratie und<br />
Verteilung von Ressourcen stellen.<br />
Sie sollte lebendig und erlebnisorientiert<br />
sein und aktuelle<br />
sozialpolitische Fragestellungen wie<br />
Gender Mainstreaming oder interkulturelles<br />
Lernen berücksichtigen.<br />
“<br />
Lebenskrisen bewältigt, welche<br />
Orientierungsmuster für Gesellschaft<br />
und Lebensführung trugen,<br />
welche sind zerbrochen? Diese<br />
Fragen sind in systematische Bildungsangebote<br />
einzubringen, haben<br />
aber auch Raum in Erzählcafés<br />
oder Gesprächen zwischen<br />
den Generationen.<br />
Vereine, Verbände und Bürgerinitiativen<br />
brauchen politische<br />
Erwachsenenbildung: Sie bekommen<br />
ihr Handwerkszeug:<br />
„politisches Management“,<br />
Know-how in Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Rhetorik, das Gespräch<br />
mit Experten und Entscheidungsträgern<br />
in den Einrichtungen<br />
der politischen Bildung, von<br />
denen viele aus sozialen Bewegungen<br />
hervorgegangen sind.<br />
Politiker brauchen politische<br />
Erwachsenenbildung: Politische<br />
Bildung zeigt politische Gestaltbarkeit<br />
auf – die einzige Chance<br />
zur Identifikation mit dem politischen<br />
System. Die Politik<br />
braucht diese Arena auch als Ort<br />
der Vermittlung, als Raum der<br />
Argumentation und Abwägung<br />
von Alternativen, als Chance der<br />
Korrektur von Entscheidungen,<br />
die im „Raumschiff Politik“<br />
getroffen wurden – und auch<br />
weiterhin zur Schulung ihres<br />
Nachwuchses.<br />
Städte und Regionen brauchen<br />
politische Erwachsenenbildung:<br />
Für die Entwicklung der Kommunen<br />
stellen sich zurzeit<br />
schwierige Fragen: Welche Infrastruktur<br />
können wir uns noch<br />
leisten und wo? Wie ist Bürger-<br />
Norbert<br />
Reichling,<br />
Bildungswerk der<br />
Humanistischen<br />
Union<br />
engagement möglich? Wie können<br />
wir neue soziale Ausgrenzungen<br />
vermeiden, wie Zuwanderung<br />
gestalten? Gerade in Städten<br />
und Gemeinden gibt es<br />
große Partizipationsbereitschaft.<br />
Politische Bildung hat die Kompetenz,<br />
solche Abwägungsprozesse<br />
zu moderieren und Wissen<br />
einzubringen.<br />
Die Demokratie braucht politische<br />
Erwachsenenbildung:<br />
Ohne den Unterbau einer informierten<br />
„demokratischen Elite“<br />
kann Demokratie nicht funktionieren.<br />
Die Institutionen der<br />
politischen Bildung stellen einen<br />
Teil der Öffentlichkeit dar,<br />
in der die Entscheidungen der<br />
Politik präsentiert, abgewogen<br />
und korrigiert werden können –<br />
ein Raum der Mitgestaltung.<br />
Dazu gehören politisches Wissen<br />
und eine Debatte über Prioritäten,<br />
an der sich jeder beteiligen<br />
kann. Es wäre schön, wenn<br />
zehn oder 20 Prozent der Bürger<br />
zu dieser Elite gehörten. Jedenfalls<br />
kann sich kein Demokrat<br />
leisten, auf die fünf Prozent zu<br />
verzichten, die wir bisher erreicht<br />
haben – oder will da wer<br />
zurück zur „autoritären Ermächtigungsdemokratie“<br />
der<br />
50er-Jahre?<br />
Norbert Reichling