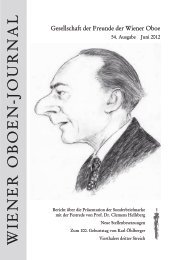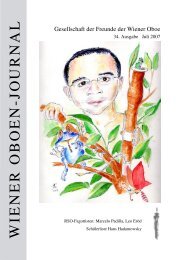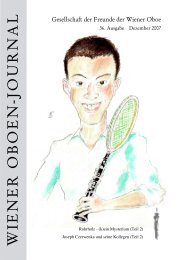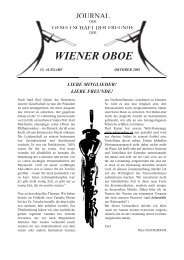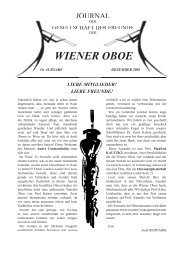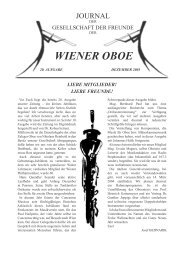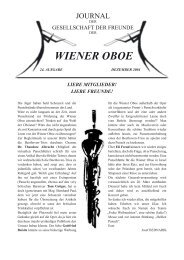„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dass Mozart (genauso wie er im ersten Akt nur für<br />
eine Flöte, später dann für die Bassetthörner der<br />
Stadler-Brüder) nunmehr für ein Quartett prominenter<br />
Orchestersolisten schreiben konnte. Es handelte sich<br />
dabei um den Oboisten Georg Triebensee, den Geiger<br />
Thomas Woborzil, den Cellisten Joseph Weigl sowie<br />
Joseph Prowos, der am 1. Mai 1782 als neuer Soloflötist<br />
engagiert worden war.<br />
Joseph Prowos<br />
Der Name des Flötisten Joseph Prowos/Prowoz/Brovos/<br />
Probus wird zwar in verschiedenen Schriftstücken<br />
unterschiedlich geschrieben, aber die Beweislage lässt<br />
auf „Prowos“ als die am häufigsten verwendete Form<br />
des Namens (zumindest während seiner späteren Jahre)<br />
schließen. Geboren 1752 oder 1753 in Bilina (nahe<br />
dem böhmischen Ort Teplitz) kam er ursprünglich als<br />
Schneidergeselle nach Wien, wo er aber auch Flöten- und<br />
<strong>Oboe</strong>nunterricht bei dem gebürtigen Böhmen [Franz<br />
oder Mathias?] Hofmann nahm. Dieser war fallweise als<br />
Flötist am Hoftheater (Burgtheater) engagiert, ehe man<br />
ab 1780 Thurner und Menschel als ständige Flötisten<br />
engagierte. Prowos’ erste Dienste als Ersatz für den<br />
erkrankten Thurner fanden zwischen April 1781 und<br />
März 1782 statt und wurden mit 7 Gulden (vermutlich<br />
für 7 Dienste) entlohnt.<br />
Ende April 1782 verließ Thurner das Orchester,<br />
worauf er durch Prowos als Soloflötist ersetzt wurde,<br />
während Martin Menschel zweiter blieb. Beide erhielten<br />
das für viele ihrer Kollegen übliche Jahressalär von 350<br />
Gulden. Der ca. 1741 in Teplitz geborene Menschel<br />
spielte bis zu seinem Tod am 10. Dezember 1784 weiter<br />
zweite Flöte. Er wurde seinerseits von Ludwig Gehring<br />
(ca. 1753-1819) ersetzt, der die nächsten beiden<br />
Jahrzehnte neben Prowos spielte. In der Zwischenzeit<br />
(von September 1782 bis zu seiner Entlassung Ende<br />
August 1783) engagierte das Hoftheater als dritten<br />
Flötisten Grubner, möglicherweise um Piccolo zu<br />
spielen. Weiters ist belegt, dass Prowos irgendwann<br />
im Verlauf des Fiskaljahres 1782/83 für „Anschaffung<br />
zweyer Mittel-Stücke zur Flauten“ 2 Gulden bezahlt<br />
bekam, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich<br />
auf Dienstinstrumenten aus Hofbesitz spielte. Bis zum<br />
Fiskaljahr 1801/02, welches bereits von August bis zum<br />
folgenden Juli gerechnet wurde, war das Jahressalär<br />
von sowohl Prowos als auch Gehring auf die damals<br />
allgemein üblichen 400 Gulden angewachsen.<br />
Da er unverheiratet blieb, wissen wir nicht, wo<br />
er anfänglich wohnte. Deshalb gibt es auch keine<br />
14<br />
Journal - <strong>Wiener</strong> <strong>Oboe</strong><br />
(sonst aufschlussreichen) Dokumente bezüglich Eheschließung,<br />
Geburt und Tod von Kindern. Belegt ist,<br />
dass er 1804/05 im Haus „Zum Schwarzen Lamm“<br />
(Kohlmarkt 255) wohnte, ein Haus östlich der heutigen<br />
Konditorei „Demel“, nur ca. 100 Meter vom damaligen<br />
Burgtheater am Michaelerplatz entfernt. 1807/08 (er<br />
war immer noch erster Flötist) wohnte er dann im Haus<br />
„Katze“ am Graben Nr. 620, in einem der Gebäude,<br />
die zwischen Graben und Stephansplatz standen. Er<br />
ging ca. 1809, gleichzeitig mit dem Orchester-Eintritt<br />
des sehr jungen Aloys Khayll (1791-1866) in den<br />
Ruhestand und übersiedelte nochmals, diesmal über den<br />
heutigen Donaukanal in die Leopoldstadt Nr.447 (an der<br />
Westseite der Rothe Sterngasse, zwei Häuser nördlich der<br />
Fuhrmanngasse, der heutigen Großen Mohren-Gasse).<br />
Schon lange vor seiner Pensionierung war Prowos in<br />
den Gewerbeverzeichnissen der Stadt als Flötenlehrer<br />
angeführt. 1815 berichtete Dlabaczs Künstler-Lexikon:<br />
„Er hat schon mehrere Scholaren gebildet, aus welchen<br />
ein gewisser Hönig, ein Israelite, der beste ist.“ Als<br />
Prowos am 10. Mai 1832 an Tuberkulose verstarb,<br />
wohnte er im westlichen Vorort St. Ulrich Am Platzl No.<br />
59, Haus „Braunes Rössel“, ein Haus an der Nordseite<br />
der heutigen Neustiftgasse, an dessen Stelle es heute<br />
möglich ist, durch einen langen Hof zur Lange Gasse<br />
zu gelangen.<br />
Georg Triebensee, Oboist<br />
Das älteste erhalten gebliebene Theater Kassabuch im<br />
<strong>Wiener</strong> Haus-Hof- und Staatsarchiv belegt, dass Georg<br />
Triebensee am 1. Jänner 1777 als Ersatz für Georg<br />
Kapfer (ca. 1729-1787), der in die Bratschengruppe<br />
wechselte, zum Orchester des Burgtheaters gekommen<br />
war. Zum gleichen Zeitpunkt wurde Johann Nepomuk<br />
Went (1745-1801) als zweiter Oboist engagiert und<br />
sein Vorgänger, Franz Kühtreiber (ca. 1727-1777)<br />
pensioniert. Obwohl Triebensee, gemeinsam mit<br />
seinem Sohn Joseph, der nach 1800 ein prominenter<br />
Komponist war, Gegenstand kurzer Artikel sowohl<br />
in MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart) als<br />
auch New Grove wurde, können wir hier noch einige<br />
interessante biographische Einzelheiten hinzufügen:<br />
Georg Triebensee wurde am 28. Juli 1746 im schlesischen<br />
Ort Herrndorf geboren und studierte bei Carlo<br />
Besozzi (1738-nach 1798) in Dresden. 1767 trat er<br />
als Gründungsmitglied der achtstimmigen Harmonie,<br />
welche abwechselnd im fürstlichen Gut in Wittingau<br />
(Třeboň) und in Wien spielte, in den Dienst des Fürsten<br />
Joseph Adam Schwarzenberg (1722-1782).