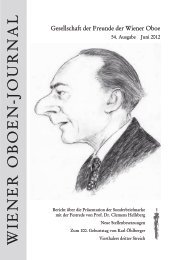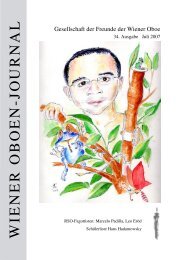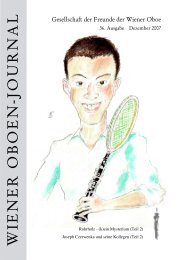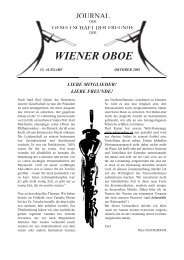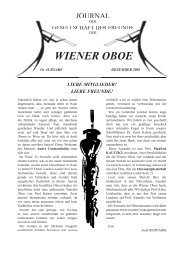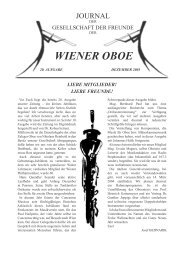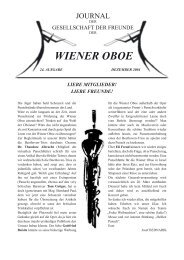„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
„Martern aller Arten“ – Mozarts „Sinfonia Concertante“ - Wiener Oboe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Joseph Weigl, Violoncello<br />
Der Cellist Joseph Weigl ist (zusammen mit seinen<br />
Söhnen) wie Triebensee sowohl MGG als auch New<br />
Grove einer Erwähnung wert und vielleicht auch dem<br />
Leser besser bekannt als seine drei anderen Kollegen,<br />
die bei der Uraufführung der <strong>„Martern</strong> <strong>aller</strong> <strong>Arten“</strong>-<br />
Arie spielten. Geboren in Bayern am 19. Mai 1740,<br />
kam er vermutlich schon in jungen Jahren nach Wien,<br />
wo er unter anderem bei Sebastian Witzig studierte.<br />
Am 1. Juni 1761 trat er auf Grund einer Empfehlung<br />
Haydns zuerst in Wien und etwas später in Eisenstadt<br />
in das Orchester des Fürsten Esterházy ein. 1769<br />
wurde er Solocellist im Kärntnertor Theater, fand sich<br />
aber aufgrund der häufigen Organisationsreformen<br />
im Musikbetrieb des Hofes spätestens 1776 im Burgtheater<br />
wieder. Dort blieb er zumindest bis 1808, war<br />
aber sicherlich 1812 in Pension. Inzwischen war<br />
er 1792 der Hofkapelle beigetreten, in der er bis zu<br />
seinem Tod spielte. Infolge von Schlagfluss verstarb<br />
er am 25. Jänner 1820 um halb fünf Nachmittags<br />
in seiner Wohnung an der Ostseite der Himmelpfortgasse<br />
(Nr.1007, das zweite Haus südlich der<br />
Rauhensteingasse), die er lange Zeit bewohnt hatte.<br />
Seine Söhne Joseph (1766-1846) und Thaddäus (1776-<br />
1844) wurden beide Komponisten, letzterer verwaltete<br />
später auch das Musikverlagsgeschäft des Hofes.<br />
Thomas Woborzil, Violine<br />
Vielleicht etwas unerwartet ist die Tatsache, dass sich<br />
Konzertmeister Thomas Woborzil als am schwierigsten<br />
zu erfassendes Mitglied des „Uraufführungs-<br />
Solistenquartetts“ entpuppt. Es ist aber möglich, an<br />
Hand der verhältnismäßig wenigen noch erhaltenen<br />
Dokumente vorsichtig eine Kurzbiographie zu wagen.<br />
Geboren wurde Woborzil ca. 1734. Der Geburtsort<br />
ist unbekannt, könnte aber in Böhmen gelegen sein,<br />
wo der Name häufig vorkommt. Da er 1792-93 vom<br />
Hofdienst bei vollen Bezügen in den Ruhestand<br />
gegangen war, kann man annehmen, dass er dreißig<br />
oder vielleicht gar vierzig Dienstjahre geleistet hatte<br />
und somit spätestens 1762/63 in den Musikbetrieb des<br />
Hofes eingetreten sein muss. Als er am 8. Mai 1771<br />
der Tonkünstler-Societät als Gründungsmitglied mit<br />
der Mitgliedsnummer 33 beitrat, war er Geiger bei<br />
den kaiserlichen Kammer Musici <strong>–</strong> eine Gruppierung,<br />
die für die alltägliche Kammermusik (nicht aber für die<br />
Kirchenmusik) des Hofes zuständig war. Am 1. Mai<br />
18<br />
Journal - <strong>Wiener</strong> <strong>Oboe</strong><br />
1772 (und wahrscheinlich auch schon davor) betrug<br />
sein Gehalt 250 Gulden jährlich.<br />
Bis Ende Dezember 1777 war ein gewisser Michael<br />
Hofer (gestorben am 12. Juni 1789) Orchester<br />
Director (Konzertmeister) am Burgtheater gewesen.<br />
Am 1. Jänner 1778 wurde Woborzil überraschend als<br />
„Orchester Director für Singspiele“ (mit dem Vermerk<br />
„Neue Einstellung“) engagiert, obwohl er anscheinend<br />
noch nie in der Violingruppe des Theaters gespielt hatte.<br />
Hofer blieb „Orchester Director für Schauspiele“, und<br />
beide bezogen das gleiche Gehalt von 20 Gulden 50<br />
Kreuzer monatlich. Im April 1778 verdiente Woborzil<br />
bereits 25 Gulden monatlich, ehe im Oktober 1779<br />
seine Gage auf 33 Gulden 20 Kreuzer (400 Gulden<br />
jährlich) erhöht wurde. Von April 1782 bis März 1786<br />
<strong>–</strong> also in der Entstehungszeit der „Entführung“ Entführung“ <strong>–</strong> erhielt<br />
er 37 Gulden 30 Kreuzer (450 Gulden jährlich). Im<br />
April 1786 wurde sein Gehalt noch ein letztes Mal auf<br />
41 Gulden 40 Kreuzer (500 Gulden jährlich) angehoben<br />
und blieb bis zu seiner Pensionierung (zwischen März<br />
1792 und Februar 1793) auf diesem Niveau. Seine<br />
Pension betrug ebenfalls 500 Gulden und war somit<br />
gleich seinem letzten aktiven Gehalt. Noch während<br />
seiner aktiven Zeit am Burgtheater und auch nach<br />
seiner Pensionierung vom Theaterdienst spielte er bis<br />
Ende 1797 weiter bei den Kammer Musici des Hofes.<br />
1800 hatte Woborzil seinen festen Wohnsitz in<br />
der Alservorstadt, Schlößelgasse Nr. 15. Gestorben<br />
(an „Gedarmentzündung“) ist er <strong>aller</strong>dings am 14.<br />
Jänner desselben Jahres in Nussdorf (wo er auch<br />
vermutlich begraben liegt, was aber nicht belegt<br />
ist). Die beim <strong>Wiener</strong> Magistrat eingegangene<br />
Verlassenschafts-Abhandlung bestätigt, dass er<br />
ledig gewesen sei und sein Nachlass (der auch<br />
mehrere Immobilien umfasste) dem Gegenwert von<br />
9460 Gulden 20 Kreuzer entsprach!! Verglichen mit<br />
einem durchschnittlichen Musiker der Zeit, der den<br />
Gegenwert von vielleicht 100 Gulden hinterließ oder<br />
in dessen Hinterlassenschaft sich auch häufig nichts<br />
von nachhaltigem Wert fand, war dies ein schier<br />
unglaubliches Vermögen. Unter anderem befanden<br />
sich in seinem Nachlass „3 Violinien [sic!] samt 2<br />
Futteralen“, die mit 50 Gulden taxiert wurden. Noch<br />
einmal im Gegensatz zu den meisten Musikern<br />
der Zeit hinterließ er auch ein in Klosterneuburg<br />
hinterlegtes Testament. Als Universalerben<br />
setzte er seinen Bruder Johann Anton Woborzil,<br />
„Oberwaagmeister im k.k. Salzamt in Sowar in<br />
Hungarn“, ein.